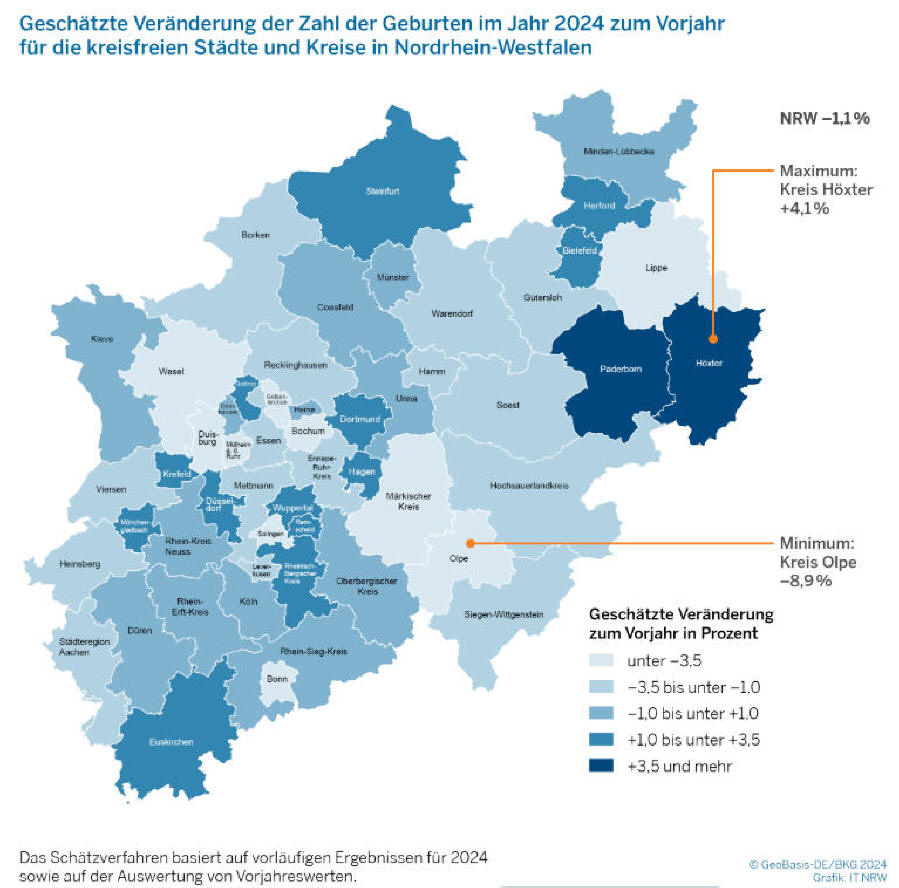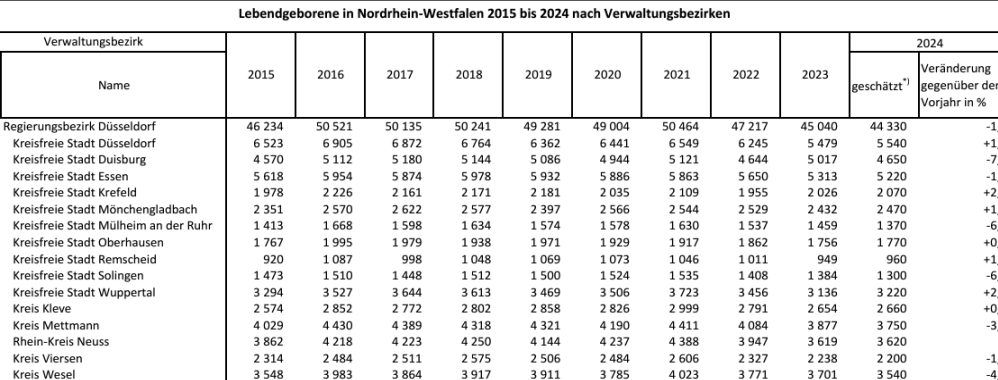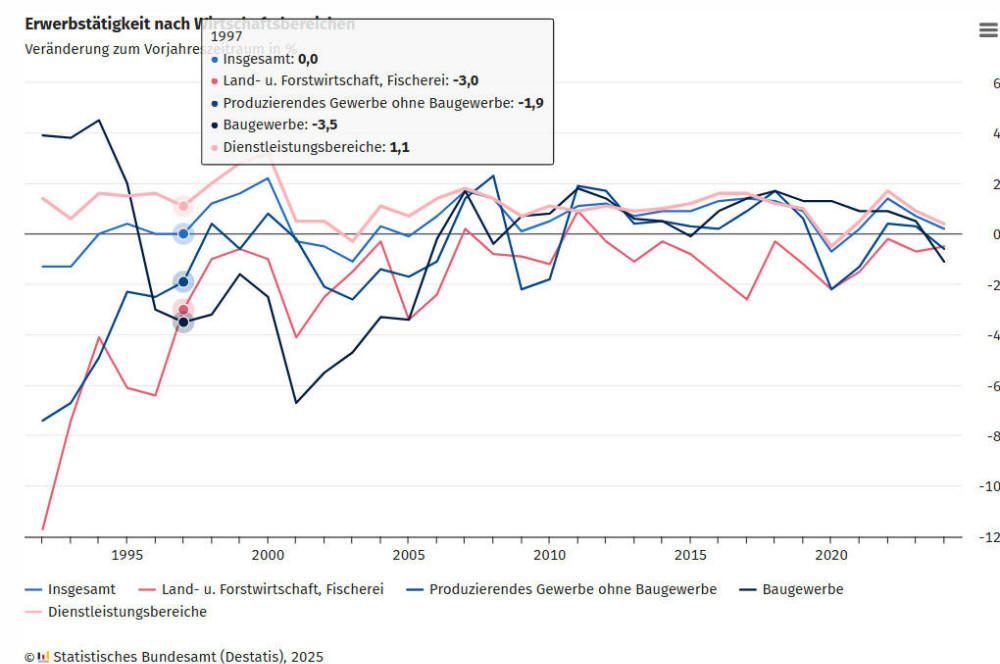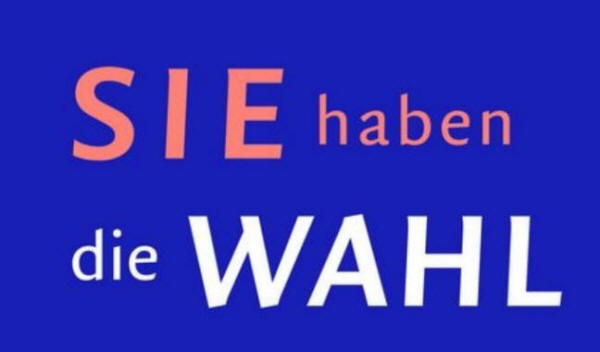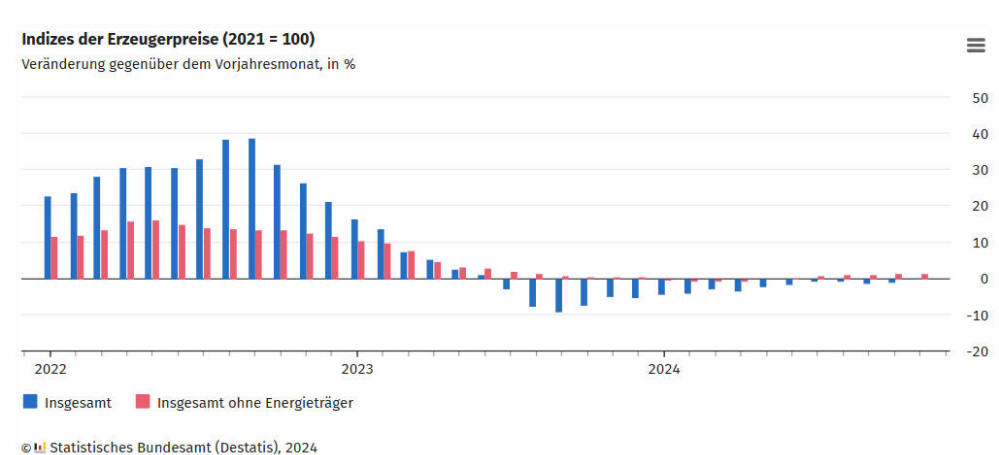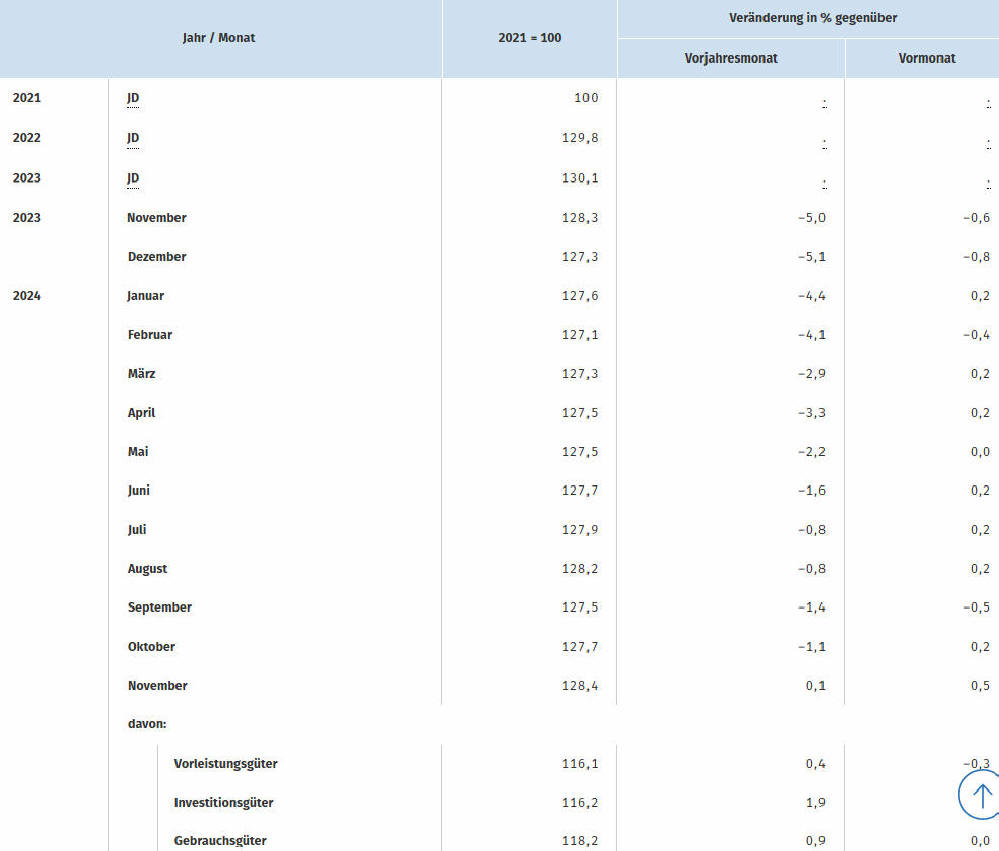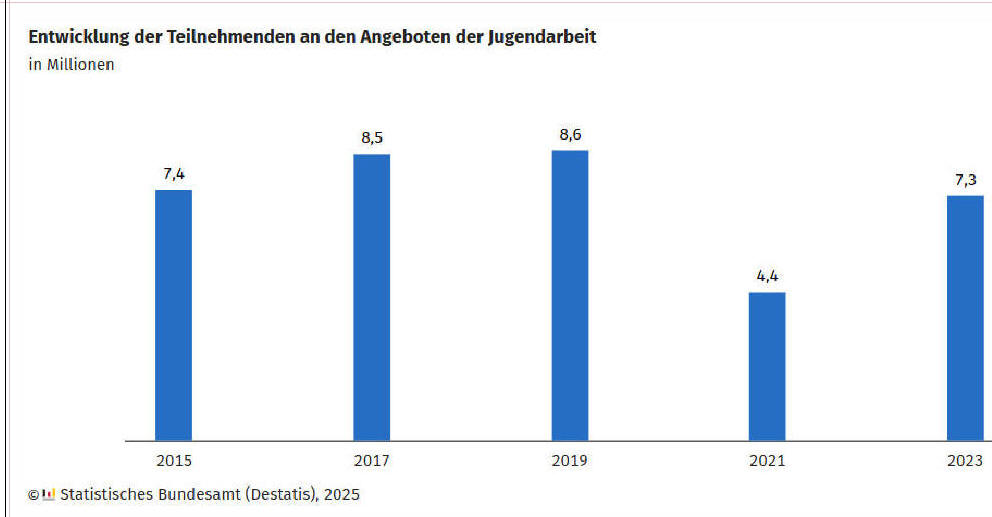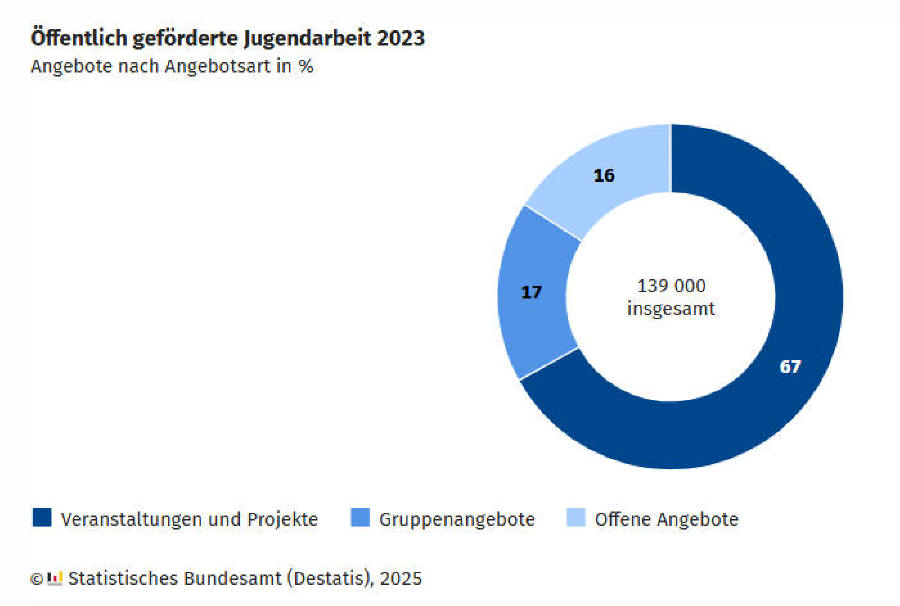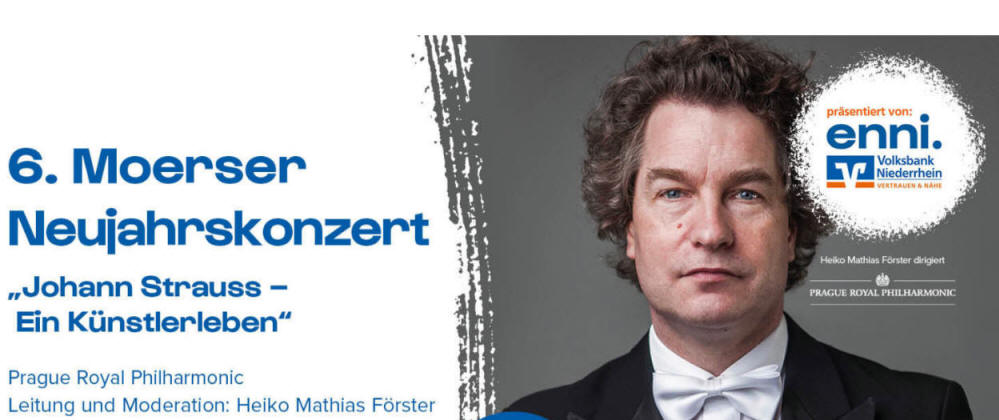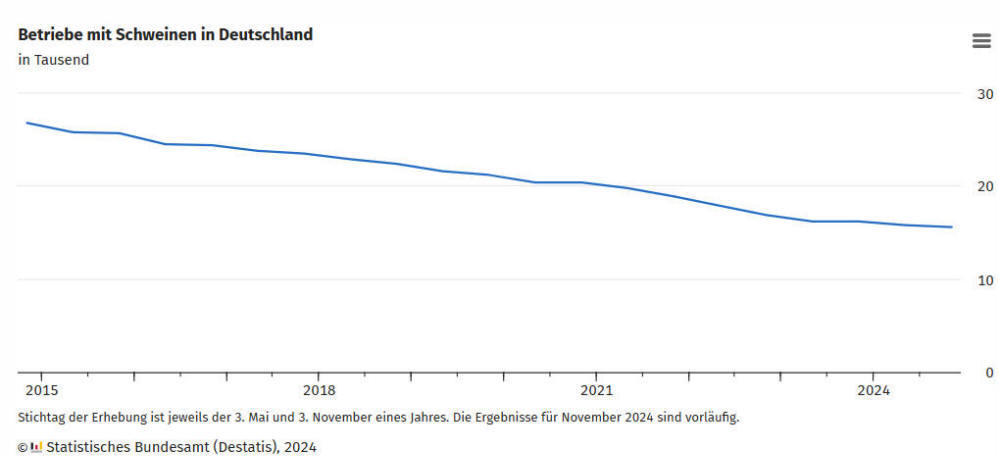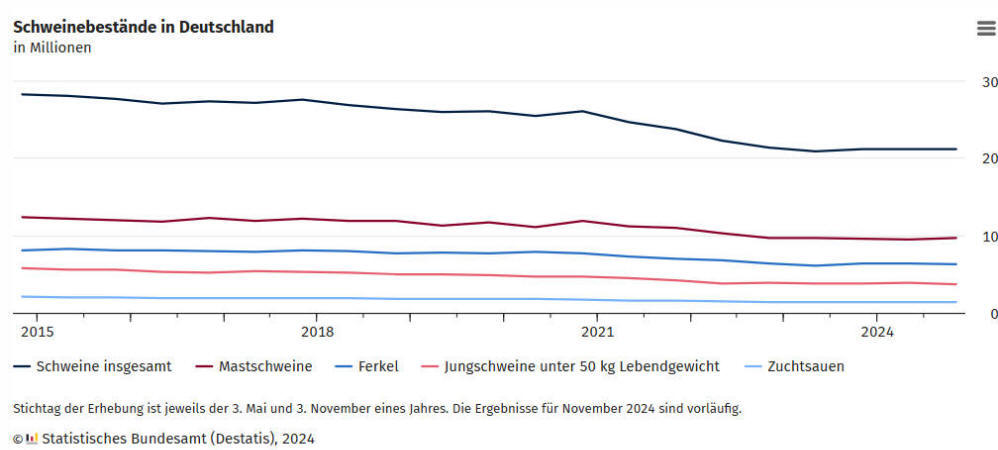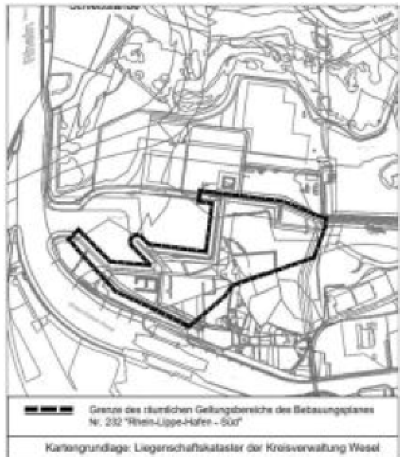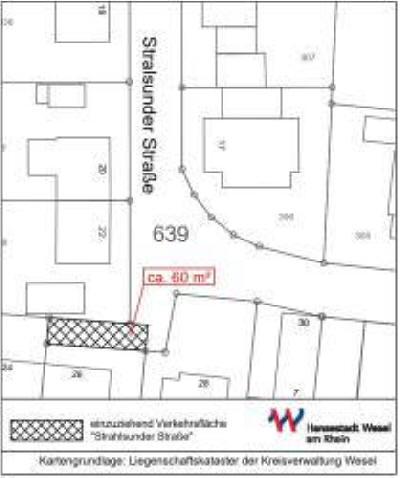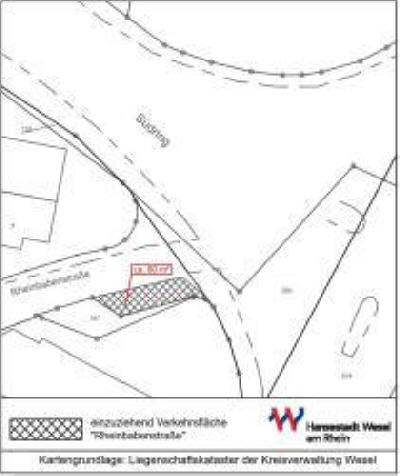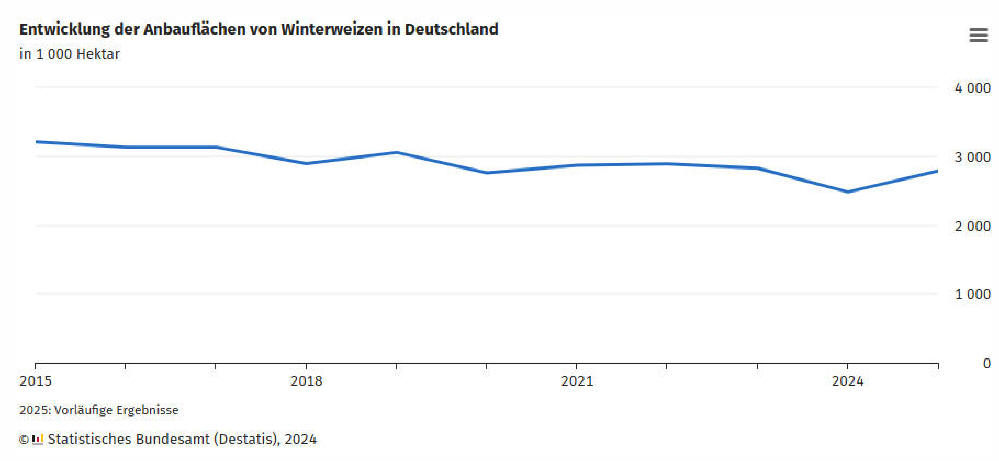|
Samstag, 4., Sonntag, 5. Januar 2025
Moers: Karbonatisierung und Chloride nagen an
Stützpfeilern
Spezialisten sanieren bis zum
Frühjahr das Unterdeck des Parkhauses
Wallzentrum
An dem Anfang der
1970er-Jahre errichteten Parkhaus gegen-über dem
Wallzentrum nagt der Zahn der Zeit. Bei der
letzten turnusmäßigen Routineuntersuchung hatte
ein Gutachter einen erheblichen Sanierungsbedarf
festgestellt.
Vor allem die 77 Stützen
des über die Oberwallstraße befahrbaren
Unterdecks weisen teils starke
Karbonatisierungsschäden auf, wodurch das in der
Bewehrung verwendete Eisen zu rosten droht.
Entsprechend eines Instandsetzungskonzeptes
eines Moerser Ingenieurbüros wird Enni im
Auftrag der Stadt Moers mit einem hierauf
spezialisierten Fachunternehmen bereits am
Montag, 13. Januar, mit der Sanierung beginnen.
Die soll rund vier Monate laufen.
Die aktuell 139 Stellplätze des unteren
Parkdecks fallen während der Bauzeit weg. Das
über die Unterwallstraße erreichbare Oberdeck
bleibt für Autofahrer aber als Parkfläche
erhalten. Gut für Eigen-tümer und Mieter des
Wallzentrums: Sie können Stellplätze in der
Tiefgarage weiter nutzen. „Die Einfahrt in das
Unterdeck des Parkhauses ist wie der Verkehr in
der Oberwallstraße durch die Baumaßnahme nur
gering beeinträchtigt“, sagt Kai Ruthmann als
Projektleiter der Enni. Er bittet Anwohner um
Verständnis, dass es kurzzeitig zu
Einschränkungen kommen kann.
Ein
Gutachter hatte ermittelt, dass Spritzwasser
zusammen mit Streusalz von den Fahrbahn- und
Stellplatzflächen im Laufe der Jahre vor allem
den Stützpfeilern im Innenbereich des unteren
Parkdecks und deren Fundamenten zugesetzt hatte.
Um die Standfestigkeit der Stützpfeiler in den
kommenden Jahrzehnten sicherzustellen, wird ein
hierauf spezialisiertes Fachunternehmen die
Stützpfeiler Instand setzen und dabei den
Altbeton mit einem bis zu 2500 bar starken
Hochdruckwasserstrahl bis zur Bewehrung
abtragen.
Dort wo das Bewehrungseisen
bereits beschädigt ist, wird es ersetzt. Erst
danach werden die Monteure die Stützen im
Vergussbetonverfahren wieder aufbauen, die
nachfolgend samt Fundamenten einen
Oberflächenschutz erhalten.
Naturgemäß
hat Enni auch diese Sanierungsmaßnahme vorab mit
dem genehmigenden Fachbereich der Stadt Moers
sowie der Feuerwehr und Polizei abgestimmt. Die
wenigen Mieter der Stellplätze wird das
Unternehmen über die Baumaßnahme jeweils
schriftlich informieren. Fragen beantwortet Enni
unter der Mo-erser Rufnummer 104-600 am
Baustellentelefon.
Besuch der DITIB-Moschee in Meerbeck
Der erste Stadtteiltreff Neu_Meerbeck im Jahr
2025 ist ein Besuch: Am Mittwoch, 8. Januar,
16.30 bis 18 Uhr, sind alle Interessierten
eingeladen, die DITIB Kocatepe Moschee
kennenzulernen. Treffpunkt ist am Eingang,
Römerstraße 605. Der Ehrenpräsident der Moschee
führt durch die Räumlichkeiten.
Anmeldungen
und Rückfragen telefonisch unter 0 28 41 / 201 -
530 oder online an stadteilbuero.meerbeck@moers.de.
50 Jahre Kreis Wesel -
Eröffnungskonzert
Im Jahr 2025 feiert
der Kreis Wesel sein 50-jähriges Bestehen. Zu
diesem Anlass findet am Donnerstag, 23. Januar
2025, um 19 Uhr ein Eröffnungskonzert im
Willibrordi-Dom am Großen Markt in Wesel statt.
Das abwechslungsreiche, musikalische
Programm wird gestaltet von den „Lohberg Voices“
aus Dinslaken, den „Colorsounds“ aus Wesel und
„Die Hedwigskapelle“ aus Hünxe. Landrat Ingo
Brohl lädt alle Menschen im Kreis Wesel herzlich
zum Eröffnungskonzert ein: „Wir wollen
schwungvoll in das Jubiläumsjahr mit dem
Eröffnungskonzert starten.

50 Jahre Kreis Wesel sind ein guter Anlass
gemeinsam zu feiern: Unsere Vielfältigkeit, aber
auch unsere Gemeinsamkeiten. Die Menschen im
Kreis Wesel erwartet ein tolles Jahresprogramm,
unter anderem mit einem zentralen Tag inklusive
einer Blaulichtmeile am Kreishaus und der
Kreispolizeibehörde in der Mitte des Jahres. Ich
freue mich darauf, möglichst vielen Bürgerinnen
und Bürgern bei unseren Veranstaltungen im
Niederrhein Kreis Wesel zu begegnen.“ Der
Eintritt für das Konzert ist frei, die Platzzahl
ist begrenzt.
Mit Walzerschwung ins Johann-Strauss-Jahr
6.
Moerser Neujahrskonzert begeistert in der
Enni-Eventhalle
Es war eine
Verneigung vor dem Meister des Walzers: Das 6.
Moerser Neujahrskonzert stand ganz im Zeichen
von Komponist Johann Strauß Sohn, der 1825
geboren, in diesem Jahr seinen 200.Geburtstag
feiern würde. Passend zu diesem Ereignis war die
Enni-Eventhalle beim Gastspiel der PRAGUE ROYAL
PHILHARMONIC am Neujahrstag erneut ausverkauft
und komplett erfüllt von den unvergleichlichen
Walzerklängen des Wiener Künstlers.
In Vertretung des kurzfristig erkrankten
Moerser Bürgermeisters Christoph Fleischhauer
begrüßte Landrat Ingo Brohl die über 1.200
Besucherinnen und Besucher, die beim
Neujahrskonzert einmal mehr gut gelaunt den
Start ins neue Jahr feierten. Das weltweit
geschätzte Orchester sorgte unter der Leitung
von Chefdirigent Heiko Mathias Förster für
schwungvoll-kurzweilige Stunden, die den
gesamten Facettenreichtum des Werks von Johann
Strauss Sohn aufzeigten.
Mit dem
Marsch „Zivio“ – zu Deutsch: „Er lebe hoch“ –
war die Richtung gesetzt. Es folgten Walzer,
Polkas und Opernklänge, bei denen die rund 65
Musikerinnen und Musiker ihr ganzes Können
aufboten. Zwischen den Stücken führte Heiko
Mathias Förster gewohnt gekonnt durchs Programm,
wobei er spannende, witzige und erstaunliche
Episoden aus dem Leben von Johann Strauss Sohn
und der Entstehungsgeschichte der einzelnen
Werke präsentierte. Unter anderem, dass Strauss
auf dem Rückweg von Paris einmal in Baden-Baden
halt machte und mit den dortigen Philharmonikern
den Banditen-Galopp aufführte.
Natürlich band Förster wie in den Vorjahren auch
das Publikum mit ein, das zum Klatschen animiert
und Kuss-Geräusche nachahmend zum Bestandteil
der gesamten Inszenierung avancierte. Die
begeisterten Besucherinnen und Besucher dankten
es mit Standing Ovation und konnten sich über
zwei Zugaben des Orchesters freuen.
Kurzum: Das Moerser Neujahrskonzert war auch in
seiner sechsten Auflage wieder ein fulminanter
und gelungener Jahresauftakt, den die beiden
Sponsoren, die Volksbank Niederrhein und die
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein (Enni), als
das erste kulturelle Highlight des Jahres in der
Grafenstadt erneut ermöglicht hatten.
Dinslaken: „Campen mit Paul
und ein Hauch von Tzatziki“
Am Freitag, 17. Januar 2025, bringt Heike Becker
ihr Soloprogramm auf die Bühne des Dachstudios.
Die Comedylesung aus ihrem Buch: „Campen mit
Paul und ein Hauch von Tzatziki“ beginnt um 19
Uhr in der 3. Etage der Stadtbibliothek.

Kabarettistin Heike Becker
Wer Heike Becker schon einmal live erlebt hat, weiß, dass es
mit Sicherheit urkomisch wird. Als Autorin ist
sie eine so messerscharfe Beobachterin und
pointierte und selbstironische Erzählerin, wie
sie auf der Bühne Vollblutkomödiantin ist. Ohne
geringste Ahnung, dafür mit gewohnt großer
Klappe und ihrem typischen Ruhrpott Humor, nimmt
Heike Becker das Publikum mit auf eine
unglaubliche Reise. Vom Ruhrpott nach
Griechenland. Dafür muss man schon ziemlich
bekloppt sein und das ist sie. Es ist eine ihrer
Kernkompetenzen.
Ein Abend,
wie Heike es wohl sagen würde: „Mit allem Zick
und Zack. Quasi wie Pommes mit Majo oder wie
Curry mit Wurst. Sozusagen datt Sahnehäubchen
auffem Kakao. Und natürlich gibbet auch noch ne
gemischte Tüte mit Extras oben drauf.“ Urlaub,
Sonne, Sand und jede Menge Spaß. Das ist ihr
Auftrag.
Eintrittskarten für den
Abend sind in der Stadtinformation (Di. – Sa. 10
– 13 Uhr, Di. – Do. 14 – 17 Uhr, an allen
Reservix-Vorverkaufsstellen oder online unter
stadt-dinslaken.reservix.de (zusätzliche
Gebühren) für 15 Euro erhältlich.
30. Satzung vom 11.12.2024 zur Änderung der
Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung der
Stadt Wesel vom 01.12.1995
Bekanntmachung der Stadt Wesel
30. Satzung
vom 11.12.2024 zur Änderung der Gebührensatzung
zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Wesel vom
01.12.1995
Aufgrund
des § 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV.
NRW. S. 444),
der §§ 1, 2, 4 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.
NW. S. 712) zuletzt geändert durch Gesetz vom
05.03.2024 (GV. NRW. S. 155) und
des § 9 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen
(Landeskreislaufwirtschaftsgesetz - LKrWG) vom
21.06.1988 (GV. NRW. S. 250), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (GV.
NRW. S. 443)
hat der Rat der Stadt Wesel in
seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende Satzung
zur Änderung der Gebührensatzung zur
Abfallentsorgungssatzung der Stadt Wesel vom
01.12.1995 beschlossen:
§ 1
§ 4 Nr. 1
erhält folgende Neufassung: Die
Entsorgungsgebühr für Restmüll beträgt jährlich
für einen
60 l-Behälter 14-tägliche
Entleerung 104,00 Euro
60 l-Behälter
wöchentliche Entleerung 208,00 Euro
80
l-Behälter 14-tägliche Entleerung 139,00 Euro
80 l-Behälter wöchentliche Entleerung 277,00
Euro
120 l-Behälter 14-tägliche Entleerung
208,00 Euro
120 l-Behälter wöchentliche
Entleerung 416,00 Euro
240 l-Behälter
14-tägliche Entleerung 416,00 Euro
240
l-Behälter wöchentliche Entleerung 832,00 Euro
1.100 l-Behälter 14-tägliche Entleerung 1.907,00
Euro
1.100 l-Behälter wöchentliche Entleerung
3.814,00 Euro
5.000 l-Behälter wöchentliche
Entleerung 17.333,00 Euro
5.000 l-Behälter
14-tägliche Entleerung 8.667,00 Euro
10.000
l-Behälter wöchentliche Entleerung 34.667,00
Euro
10.000 l-Behälter 14-tägliche Entleerung
17.333,00 Euro
Die Entsorgungsgebühr für
Bioabfälle beträgt jährlich für einen
80
l-Behälter 14-tägliche Entleerung 40,00 Euro
120 l-Behälter 14-tägliche Entleerung 60,00 Euro
240 l-Behälter 14-tägliche Entleerung 120,00
Euro
Die Entsorgungsgebühr für eine saisonale
Laubtonne (01.10. bis 31.12.eines Jahres)
beträgt für einen
240 l-Behälter
14-tägliche Entleerung 20,00 Euro
bei
dauerhaftem Verbleib auf dem Grundstück und
240 l-Behälter 14-tägliche Entleerung 30,00 Euro
bei jährlicher An – und Abfahrt.
§ 4 Nr. 5a
erhält folgende Neufassung:
Containergestellung je Monat
Für
Entsorgungsleistungen mit anderen als den in § 4
Nr.1 genannten Gefäßen werden folgende Gebühren
erhoben
a. Containergestellung je Monat:
5 cbm Absetz- oder Abrollcontainer 28,00 Euro /
Monat
7 cbm Absetz- oder Abrollcontainer
31,20 Euro / Monat
10 cbm Absetz- oder
Abrollcontainer 36,00 Euro / Monat
20 cbm
Absetz- oder Abrollcontainer 84,00 Euro / Monat
10 cbm Presscontainer 268,00 Euro/Monat
14
cbm Presscontainer 324,00 Euro/ Monat
Containergestellung Gebühr auf Abruf für
folgende Abfallarten:
Grünschnitt:
7 cbm
250,00 Euro
10 cbm 280,00 Euro
20 cbm
330,00 Euro
40 cbm 410,00 Euro
Sperrmüll:
7 cbm 250,00 Euro
10 cbm 300,00 Euro
20 cbm 390,00 Euro
40 cbm 580,00 Euro
§
4 Nr. 5 d erhält folgende Neufassung:
d)
Verbrennungsgebühren 122,01 Euro
§ 2
S7 i)
erhält folgende Neufassung:
i) Gebühr für die
Entsorgung von A 4 Holz gemäß § 16 d
Abfallentsorgungssatzung:
pro 100 l 3,00 Euro
pro cbm 10,00 Euro
§ 3
§ 8 erhält folgende
Neufassung:
Gebühren für zusätzliche
Leistungen
a)
Absetzkipper mit Fahrer
Abrollkipper mit Fahrer
Zubehör:
Anhänger
Container pro angefangene Woche:
62,30 Euro
62,30 Euro
10,00 Euro
12,00 Euro
b)
b1)
Hausmüllwagen mit Fahrer und Lader
Hausmüllwagen mit Fahrer
104,30 Euro
70,00
Euro
c) Kleines Hausmüllfahrzeug mit Fahrer
47,30 Euro
d)
d1)
Sperrmüllfahrzeug,
3–Achser mit Fahrer und zwei Ladern
Sperrmüllfahrzeug, 3–Achser mit Fahrer und einem
Lader
135,40 Euro
101,10 Euro
e) Lkw
Pritsche mit Ladebordwand und Fahrer 34,00 Euro
f) Personaleinsatz 34,30 Euro
g)
Gestellung von Müllgefäßen, Fahrtkosten pauschal
(Anlieferung und Abholung von Müllgefäßen)
34,00 Euro
h)
Kosten je Müllgefäß für
einmalige Leerung: (incl.
Verbrennungsgebühren)
60 l
80 l
120 l
240 l
1.100 l
5.000 l
10.000 l

NRW: Weniger Neugeborene zum dritten Mal in
Folge
Nach ersten Schätzungen
wurden im Jahr 2024 etwa 153 800r Kinder in
Nordrhein-Westfalen geboren. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, wären das im
Vergleich zum Vorjahr rund 1 700 oder
1,1 Prozent weniger neugeborene Kinder
(2023: 155 515 Lebendgeborene). Bereits in den
Jahren 2022 und 2023 hatte es Geburtenrückgänge
gegenüber den Vorjahren gegeben (2022: −6,2
Prozent, 2023: −5,5 Prozent).
Nach
ersten Schätzungen werden für die meisten
kreisfreien Städte und Kreise niedrigere
Geburtenzahlen erwartet Für die meisten Kreise
und kreisfreien Städte erwarten die
Statistikerinnen und Statistiker für das gerade
zu Ende gegangene Jahr niedrigere Geburtenzahlen
als im Vorjahr. Die höchsten Rückgänge werden
für den Kreis Olpe (−8,9 Prozent) sowie die
kreisfreien Städte Duisburg (−7,3 Prozent),
Mülheim an der Ruhr (−6,1 Prozent), Solingen
(−6,1 Prozent) und Bochum (−6,0 Prozent)
prognostiziert.
Die größten Anstiege
der Zahl der Neugeborenen werden hingegen für
die Kreise Höxter (+4,1 Prozent, Paderborn (+3,6
Prozent) und Steinfurt (+3,1 Prozent) sowie die
kreisfreien Städte Bottrop (+3,1 Prozent) und
Wuppertal (+2,7 Prozent) erwartet. Mit einer
nahezu unveränderten Geburtenzahl wird in der
kreisfreien Stadt Münster (−0,3 Prozent), im
Rhein-Kreis Neuss (+0 Prozent), in den Kreisen
Unna (+0 Prozent) und Kleve (+0,2 Prozent) sowie
in der kreisfreien Stadt Herne (+0,4 Prozent)
gerechnet.
Im gesamten Ruhrgebiet
kamen im Jahr 2024 schätzungsweise rund
44 400 Kinder auf die Welt, das wären
2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor
(damals: 45 451). Wie die Statistikerinnen und
Statistiker mitteilen, stammen die genannten
Daten aus einer Schätzung, die vom Statistischen
Landesamt Nordrhein-Westfalen entwickelt und
durchgeführt wurde.
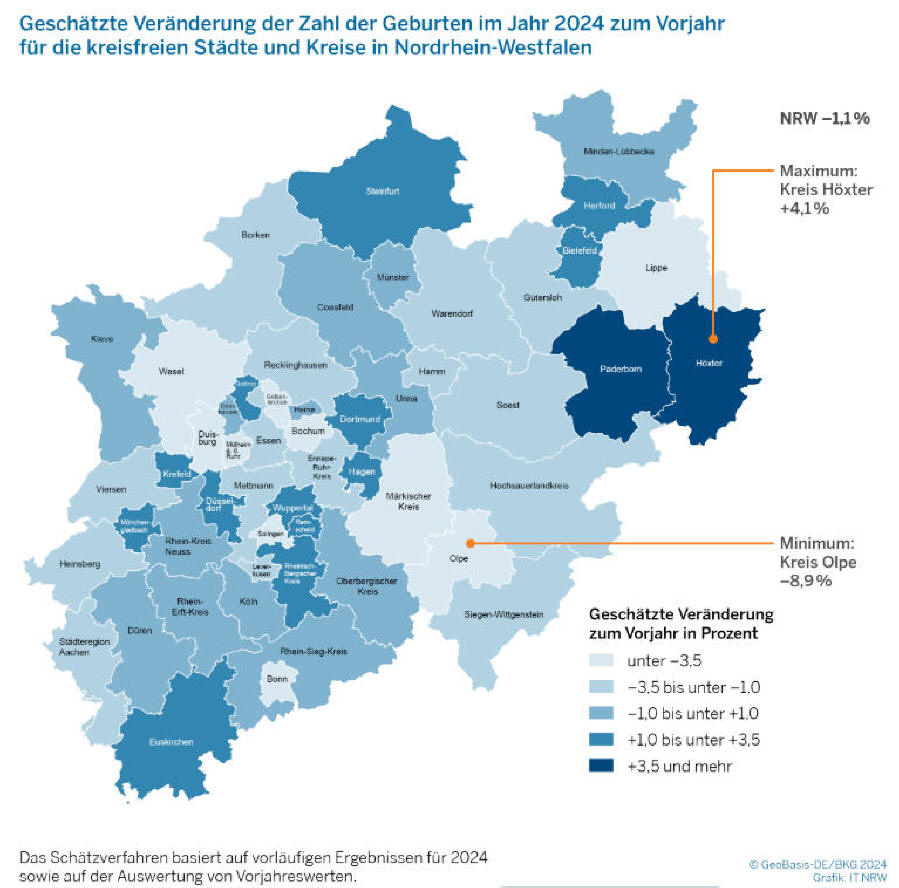
Das Schätzverfahren basiert auf vorläufigen
Ergebnissen für 2024 sowie auf der Auswertung
von Vorjahreswerten und ermöglicht lediglich
Aussagen zur Zahl der Geburten. Endgültige
Ergebnisse der Geburtenstatistik 2024 mit
weiteren Angaben wie z. B. zum Alter der Mütter,
durchschnittliche Kinderanzahl je Frau oder zu
Mehrlingsgeburten stehen voraussichtlich ab
Juni 2025 zur Verfügung. (IT.NRW)
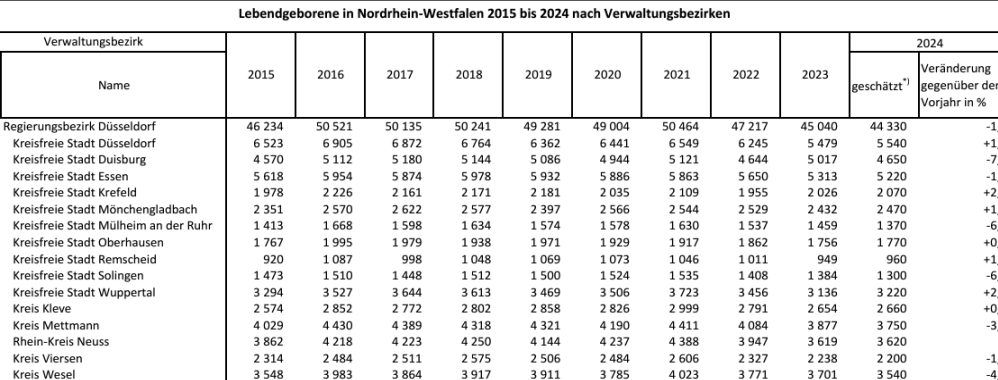
Freitag, 3.
Januar 2025
Das Krankenhaus Bethanien
Moers heißt sieben Neujahrsbabys willkommen
Insgesamt 1.423 Geburten betreute
das Team der Geburtshilfe 2024 Als Baby Eslem
am 01. Januar 2025 um 01.48 Uhr früher als
geplant, aber gesund und munter, das Licht der
Welt erblickte, war sie außerdem das erste
Neujahrsbaby, das das Team der Geburtshilfe
Bethanien an diesem Tag willkommen hieß.
Auf Baby Eslem folgten sechs weitere
Neugeborene – drei von ihnen kamen am Abend des
01. Januars innerhalb einer Minute auf die Welt.
„Unser Team hatte alle Hände voll zu tun und ich
bin wirklich stolz auf die großartige Arbeit,
die hier Tag für Tag geleistet wird“, betont
Dr. Peter Tönnies, Chefarzt der Klinik für
Gynäkologie, Geburtshilfe, Gynäkologische
Onkologie & Senologie.
Im
vergangenen Jahr betreute das Krankenhaus
Bethanien insgesamt 1.423 Geburten und hielt
damit die durchschnittliche Gesamtgeburtenrate
der letzten Jahre. „Die beachtliche Zahl zeigt
deutlich, wie etabliert unsere Geburtsklinik
seit vielen Jahren ist und zu den führenden
Geburtskliniken am linken Niederrhein gehört“,
erklärt Dr. Tönnies.
Zusammen mit
der Klinik für Kinder- & Jugendmedizin des
Krankenhauses Bethanien Moers ist die Klinik für
Gynäkologie, Geburtshilfe, Gynäkologische
Onkologie & Senologie Perinatalzentrum Level 1
und damit personell und strukturell sehr gut
sowohl für physiologische wie auch für Früh- und
Risikogeburten aufgestellt.

Dr. Peter Tönnies, Chefarzt der Klinik für
Gynäkologie, Geburtshilfe, Gynäkologische
Onkologie & Senologie, freut sich gemeinsam mit
den Eltern und einem Teil seines Teams über die
gut verlaufenen Geburten der insgesamt sieben
Neujahrsbabys.
Neue EU-Bauproduktenverordnung: Mehr
Verbraucherschutz und Fokus auf nachhaltiges
Bauen
Die neue
EU-Bauproduktenverordnung ist veröffentlicht
worden. Damit sind die Verhandlungen zwischen
der Europäischen Kommission, dem Europäischen
Parlament und dem Rat der Europäischen Union
abgeschlossen. Sie legt als Teil des
europäischen Green Deal einen stärkeren Fokus
auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte,
Produktsicherheit sowie die Kreislaufwirtschaft
in der Baubranche.
Die Novelle
stärkt den Binnenmarkt und den Verbraucherschutz
im Bereich des Bauens. Klara Geywitz,
Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen, begrüßt die Einführung der neuen
EU-Bauproduktenverordnung: „Nach intensiver
Arbeit an dieser Novelle kann sie im Januar 2025
in Kraft treten. Mit der neuen Verordnung wird
ein digitaler Pass für Bauprodukte eingeführt,
der alle Angaben über Leistung und Eigenschaften
des Produkts bündelt. Verbraucherinnen und
Verbraucher, die bspw. ein Haus, einen Anbau
oder ein Carport bauen wollen, können somit
zukünftig auf einen Blick sehen, wie nachhaltig
ihre Baumaterialien sind und wo die Produkte
herkommen.
Mit der neuen Verordnung wird es
zusätzlich leichter, bereits verwendete
Bauprodukte wieder zu verwenden, was die Umwelt
und den Geldbeutel schont.“
Mit
den neuen Vorgaben werden Normungsprozesse
erleichtert und beschleunigt. Dies erfolgt durch
die Einrichtung einer Expertengruppe, die alle
wichtigen Beteiligten frühzeitig in die Arbeit
einbindet. Die Kommission wird Anfang des Jahres
einen Arbeitsplan vorlegen, wann welche
Produktgruppen überarbeitet werden, sodass die
Wirtschaft mit den Vorbereitungen beginnen kann.
Zusätzliche Regelungen in der Marktüberwachung
ermöglichen darüber hinaus die gezielte
Überwachung der Märkte für Bauprodukte, sodass
nicht EU-konforme Produkte leichter
identifiziert werden können.
Die
neue EU-Bauproduktenverordnung ist am 18.
Dezember 2024 im Amtsblatt der Europäischen
Union veröffentlicht worden. Sie tritt 20 Tage
nach Veröffentlichung, also am 7. Januar 2025,
in Kraft. Die Anwendung sowie der Übergang von
der alten auf die neue Verordnung erfolgen
gestaffelt. Die Artikel der neuen Verordnung,
die sich auf die Entwicklung von harmonisierten
Normen und Produktanforderungen beziehen, gelten
unmittelbar mit dem Inkrafttreten. Alle anderen
Artikel der Verordnung gelten ein Jahr nach
Inkrafttreten der Verordnung (8. Januar 2026),
mit Ausnahme von Artikel 92 (über Sanktionen),
der zwei Jahre nach Inkrafttreten Anwendung
findet.
Sicher, attraktiv und intakt
Nächster Abschnitt der Sanierung rund um die
Moerser Bahnhofstraße startet im Januar
Es war ein
Kraftakt in mehreren Teilen – kurz vor
Weihnachten konnte Diane Schiffer als
Projektleiterin der ENNI Stadt & Service
Niederrhein (Enni) bis auf aktuell noch fehlende
Markierungen endlich einen Haken an den ersten
großen Abschnitt der Sanierung der Bahnhofstraße
in Moers-Kapellen machen. Vom
Hermann-Thelen-Platz bis kurz vor die
Lauersforter Straße hat die Verkehrsachse im
Herzen des südlichen Moerser Stadtteils ein
modernes Erscheinungsbild erhalten.
Der neue Kreisverkehr zur Nieper Straße beruhigt
dabei den Verkehr, was die Sicherheit im Umfeld
der Geschäftszeilen und die Lebensqualität für
Anwohner erhöht. In den kommenden zweieinhalb
Jahren liegt vor Dia-ne Schiffer nun die zweite
große Sanierungsetappe, in der Enni das dor-tige
Kanalnetz auf einer Länge von rund 400 Metern
erneuern und der heute noch schlechte Zustand
der Bahnhofstraße zwischen dem
Her-mann-Thelen-Platz und der evangelischen
Kirche, sowie in Teilabschnit-ten der Bendmann-,
Neukirchener- und der Moerser Straße in mehreren
Bauabschnitten verschwinden wird.
„Auch diese Baumaßnahme wird den Stadtteil
weiter aufwerten, die hier lebenden Menschen auf
dem Weg dorthin in ihren täglichen
Lebensgewohnheiten aber einschränken“, sei dies
laut Diane Schiffer bei derart großen
Sanierungsprojekten leider nicht zu verhindern.
„Am Ende haben wir aber die Infrastruktur
zukunfts-fähig für nächste Generationen
aufgestellt“, könnten sich Kapellener bereits in
weiten Teilen der Bahnhofstraße davon
überzeugen.
Spielt das Wetter mit, geht
es bereits am 6. Januar zunächst in der Mo-erser
Straße los. Rund zwölf Monate sind dann
angesetzt, um zwischen der Kreuzung Bahnhof- und
der Richard-Wagner-Straße die in bis zu vier
Metern Tiefe und in der Fahrbahnmitte liegenden
Kanäle in jeweils nur kleinen Abschnitten von 15
Metern auszutauschen. Wegen des
un-terschiedlichen Gefälles können die Monteure
dabei nur schrittweise vorgehen, werden so erst
den Schmutzwasser- und danach den
Re-genwasserkanal sanieren. „Abschließend
bekommt dieser Teilabschnitt der Moerser Straße
im Auftrag der Stadt Moers ein Facelift.“
Auf dem rund 180 Meter langen Abschnitt
wird es danach einen neuen Gehweg geben, für
Radfahrer wird ein Leitstreifen auf der neuen
Fahrbahn ange-bracht. „Anlieger können ihre
Häuser während der Baumaßnahme weit-gehend
erreichen, im direkten Baufeld kann es aber
kurzzeitig zu Behin-derungen kommen.“ Für den
Durchgangsverkehr wird die Moerser Stra-ße aber
mit Baubeginn zur Sackgasse. „Für Autofahrer und
den Busver-kehr haben wir in beide Richtungen
eine großräumige Umleitung einge-richtet.“
Ab 2026 wandert die Baumaßnahme dann in den
Kreuzungsbereich an der evangelischen Kirche und
in die Bendmann- und die Neukirchener Straße.
Die Bendmannstraße wird auf einem rund 50-Meter
langen Ab-schnitt bis zur Hausnummer 10 saniert.
Auch in der Neukirchener Straße wird nur ein
Teilbereich bis zum hinter der Tankstelle
gelegenen Linn-bruchweg erneuert. Erst in der
finalen Bauphase ab Mitte 2026 wird Enni in der
Bahnhofstraße noch einmal Hand anlegen. Dann
wird das Unter-nehmen bis zum Sommer 2027
zwischen dem Hermann-Thelen-Platz und der
Moerser Straße die Kanäle austauschen und der
Straße ein modernes Erscheinungsbild sicheren
Fußwegen und Radfahrstreifen, barrierefreien
Fußgängerquerungen, einer neuen Ampel und
Neuan-pflanzungen geben.
Wie immer hat
Enni auch diese große Sanierungsmaßnahme vorab
mit dem genehmigenden Fachbereich der Stadt
Moers, weiteren beteiligten Behörden sowie der
Feuerwehr, Polizei und der NIAG abgestimmt.
An-lieger wird das Unternehmen über die
Baumaßnahme jeweils schriftlich oder im Falle
einiger Gewerbebetriebe auch persönlich
informieren.
Wer Fragen zur Baustelle hat,
kann sich unter der Rufnummer 104-600
informieren.
Stadtwerke
Dinslaken: Notwendige Sanierungsarbeiten an der
Willy-Brandt-Straße
"Die
Stadtwerke Dinslaken GmbH erneuern an der
Willy-Brandt-Straße (B8) die Wasser- und
Stromversorgungsleitungen im Geh- und
Radwegbereich im Bereich Willy-Brandt-Straße 224
und Einmündung Hans-Böckler-Straße. Die
Baumaßnahme beginnt am 6. Januar 2025 und dauert
voraussichtlich 4 Monate.
Im Rahmen
der Sanierungsarbeiten wird die
Willy-Brandt-Straße in Höhe der Hausnummer 224
bis zum Durchgang zur Grenzstraße halbseitig in
Richtung Duisburg-Walsum gesperrt. Der Verkehr
wird durch eine Verkehrssignalanlage geregelt.
Die Sperrung gilt auch für den Fuß- und Radweg.
Eine provisorische Fußgängerampel leitet
die Passanten auf die gegenüberliegende
Straßenseite um. Die Stadtwerke Dinslaken bitten
alle betroffenen Verkehrsteilnehmer*innen und
Anwohner*innen um Verständnis für die
notwendigen Sanierungsarbeiten."
Moers: ,ZusammenLeben‘:
Wanderausstellung der wir4-Kommunen eröffnet
Wie bereichert kulturelle Vielfalt unser
Zusammenleben? Die Kulturbüros der wir4-Kommunen
Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und
Rheinberg haben Kunstschaffende dazu eingeladen,
sich mit dem Thema ,ZusammenLeben‘
auseinanderzusetzen.
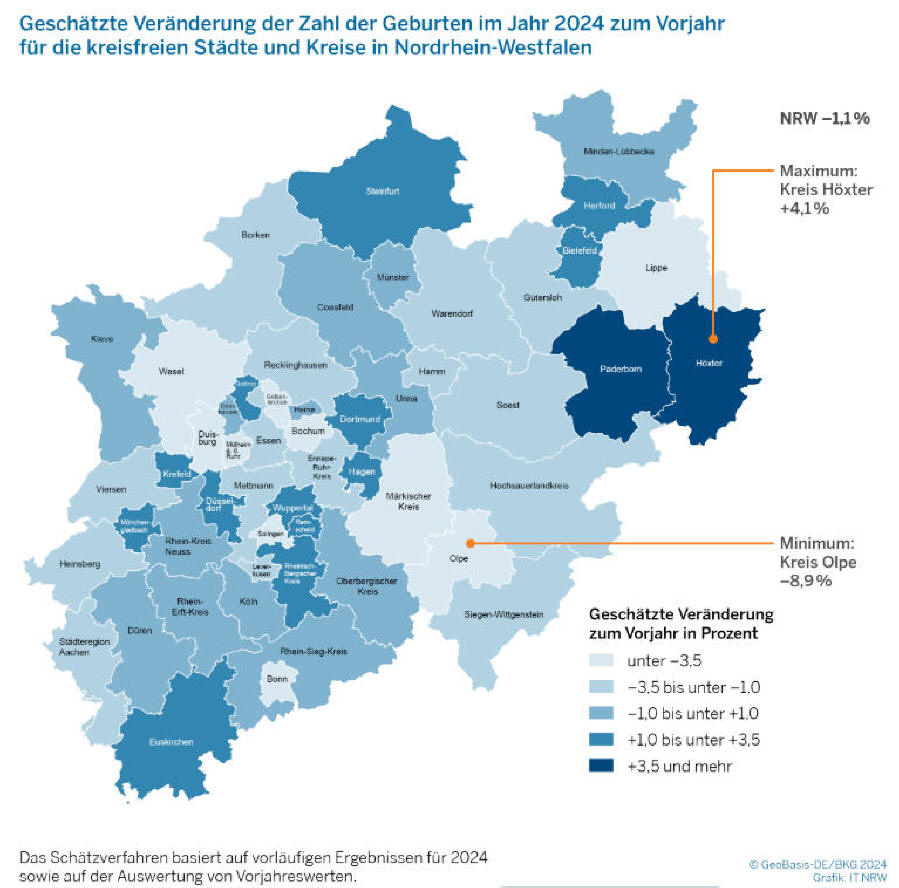
Die Beteiligten freuen sich auf die
Ausstellungseröffnung am 5. Januar im
Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum
(Wilhelm-Schroeder-Str. 10). Foto: pst
Das verbindende Element aller 81 eingereichten
Arbeiten, die Erfahrungen, Wünsche und Ideen
sichtbar machen, ist das Format von 60 mal 60
Zentimeter. Die Fotografien, Malereien,
Collagen, Grafiken und Skulpturen werden im
Rahmen einer Gruppenausstellung unter dem Titel
,ZusammenLeben 60x60‘ im Foyer und zweiten Stock
des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums
(Wilhelm-Schroeder-Str. 10) präsentiert.
Die Ausstellungseröffnung findet am
Sonntag, 5. Januar, um 11 Uhr
statt. Bis Samstag, 25. Januar, kann die
Ausstellung zu den regulären Öffnungszeiten des
Bildungszentrums, montags bis freitags von 10.30
bis 18.30 Uhr und samstags von 10.30 bis 13.30
Uhr, besucht werden.
Eine
Kooperation des Verbundes der vier Kulturbüros
,Wir4Kultur‘
Dann zieht sie als
Wanderausstellung weiter in die Nachbarstädte
Kamp-Lintfort, Rheinberg und Neukirchen-Vluyn.
Im Anschluss können die Objekte auch erworben
werden. Die Preise gibt es auf Anfrage;
Kaufinteressierte können sich an das Kulturbüro
der Stadt des jeweiligen Kunst-schaffenden
wenden. Die Mitarbeitenden stellen gerne den
Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern her.
Die Ausstellung ist eine Kooperation des
Verbundes der vier Kulturbüros ,Wir4Kultur‘.
Bereits zur Landesgartenschau in
Kamp-Lintfort gab es eine erfolgreiche
wir4-Wanderausstellung. Daran soll nun
angeknüpft werden. Für die grenzenlosen Angebote
der Kulturschaffenden in der Region existiert
auch eine eigene Website mit allen Terminen
unter der Domain www.wir4kultur.de.
Alle Eröffnungstermine auf einen
Blick:
Sonntag, 5. Januar, 11 Uhr: Moers,
Hanns Dieter Hüsch Bildungszentrum,
Wilhelm-Schroeder-Str. 10, 47441 Moers
Sonntag, 2. Februar, 11 Uhr: Kamp-Lintfort,
Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee 79, 47475
Kamp-Lintfort Montag, 10. März, 11 Uhr:
Rheinberg, Stadthaus, Kirchplatz 10, 47495
Rheinberg
Sonntag, 6. April, 11 Uhr:
Neukirchen-Vluyn, KulturCafé,
Von-der-Leyen-Platz 1 (Ecke Pastoratstraße),
47506 Neukirchen-Vluyn
Moers: Wohnungsbau GmbH spendet für
neues Equipment
Freude über
großzügige Spende: Die Wohnungsbau Stadt Moers
GmbH hat dem Kunstverein Peschkenhaus eine
Spende über 1.000 Euro übergeben. Mit dem Betrag
konnte der Verein dringend benötigtes Equipment
für die regelmäßigen Auftritte von Musikerinnen
und Musiker finanzieren.

Musiker wie Georg Göbel-Jakobi und Peter
Kroll-Ploeger (v.l.) können künftig durch die
Spende der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH auf ein
besseres Equipment im Peschkenhaus
zurückgreifen. (Foto: Agentur Berns)
Stellvertretend für den Verein haben die
Gitarristen Georg Göbel-Jakobi (alias Ozzy
Ostermann von Herbert Knebels Affentheater) und
Peter Kroll-Ploeger die Spende
entgegengenommen.
„Das Peschkenhaus ist
seit Jahren eine wichtige kulturelle Institution
in der Region und bietet Künstlerinnen und
Künstlern aus verschiedenen Bereichen eine
Plattform, um ihre Talente zu präsentieren. Wir
freuen uns sehr, dass wir dazu beitragen können,
solche Angebote zu erhalten und weiter
auszubauen“, erläutert Tobias Pawletko
(Geschäftsführer der Wohnungsbau Stadt Moers
GmbH). Das Peschkenhaus lädt alle Musik- und
Kunstbegeisterten herzlich ein, die neuen
Möglichkeiten bei einem der kommenden Konzerte
selbst zu erleben.
vhs-Kurs: Viren und Bakterien den
Kampf ansagen
In die Welt der
Heilkräuter entführt ein Kurs der vhs Moers –
Kamp-Lintfort am Freitag, 10. Januar, ab 17 Uhr.
Eine Apothekerin und diplomierte Kräuterfachfrau
erläutert in den Räumen der vhs an der
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, welche Heilkräuter
eine nachgewiesene Wirkung gegen Viren und
Bakterien haben und wie sie traditionell
angewendet werden.
Zusätzlich erhalten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Rezepttipps.
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und
online unter www.vhs-moers.de sowie
ab dem 2. Januar auch telefonisch unter 0 28
41/201 – 565 möglich.
Moers: vhs-Gesundheitsforum
beleuchtet Situation Kinder psychisch kranker
Eltern
Einem wichtigen Thema
widmet sich die nächste Veranstaltung im Rahmen
des vhs-Gesundheitsforums am Donnerstag, 9.
Januar: Ab 18 Uhr geht es im Alten Landratsamt,
Kastell 5b, um die Situation Kinder psychisch
kranker Eltern. Nachgegangen wird den Fragen
‚Wie ist ihre Situation?‘ ‚Wie kann ihnen
geholfen werden?‘ und ‚Welche
Präventionsmöglichkeiten gibt es?‘
Laut Schätzungen wachsen in Deutschland rund 3,8
Millionen Kinder mit einem psychisch kranken
Elternteil auf. An diesem Abend erfahren die
Teilnehmenden, was Eltern und das soziale Umfeld
zum gesunden Aufwachsen der betroffenen Kinder
beitragen können. Die Veranstaltung ist eine
Kooperation mit dem Bündnis gegen Depression im
Kreis Wesel.
Moers: Besuch der DITIB-Moschee in
Meerbeck
Der erste Stadtteiltreff
Neu_Meerbeck im Jahr 2025 ist ein Besuch: Am
Mittwoch, 8. Januar, 16.30 bis 18 Uhr, sind alle
Interessierten eingeladen, die DITIB Kocatepe
Moschee kennenzulernen. Treffpunkt ist am
Eingang, Römerstraße 605.
Der
Ehrenpräsident der Moschee führt durch die
Räumlichkeiten. Anmeldungen und Rückfragen
telefonisch unter 0 28 41 / 201 - 530 oder
online an stadteilbuero.meerbeck@moers.de

Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2024 auf
neuem Höchststand
•
Erwerbstätigkeit wächst gegenüber Vorjahr um 72
000 Personen (+0,2 %)
• Anstieg seit Mitte
2022 mit deutlich nachlassender Dynamik
•
Beschäftigungsgewinne im Jahr 2024 nur in
Dienstleistungsbereichen, Produzierendes Gewerbe
und Baugewerbe mit Verlusten
Im
Jahresdurchschnitt 2024 waren rund 46,1
Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland
erwerbstätig. Das waren so viele Erwerbstätige
wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im
Jahr 1990. Nach einer ersten Schätzung des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg die
jahresdurchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen
im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 72 000
Personen (+0,2 %).
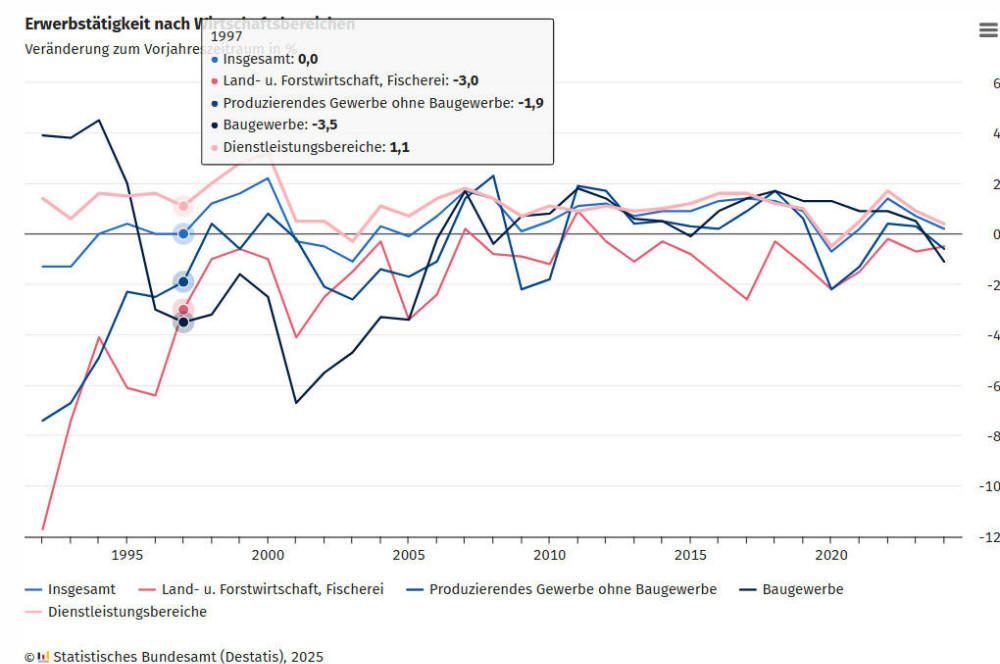
Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 wuchs
die Erwerbstätigenzahl damit seit 2006
durchgängig. Allerdings verlor der Anstieg seit
Mitte des Jahres 2022 deutlich an Dynamik (siehe
auch Pressemitteilung Nr. 427 zur
Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2024 vom 15.
November 2024): Nach dem Rückgang zu Beginn der
Corona-Krise im Jahr 2020 um 325 000 Personen
(-0,7 %) war die Erwerbstätigenzahl im Jahr 2021
zunächst leicht um 87 000 (+0,2 %) und im Jahr
2022 insgesamt kräftig um 622 000 Personen (+1,4
%) gestiegen. Im Jahr 2023 war der Zuwachs mit
336 000 Personen (+0,7 %) nur noch halb so stark
wie im Vorjahr und schwächte sich im Jahr 2024
weiter deutlich ab.
Ursächlich für die
Beschäftigungszunahme waren im Jahr 2024 wie
bereits in den Vorjahren die Zuwanderung
ausländischer Arbeitskräfte und eine gestiegene
Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung.
Diese beiden Wachstumsimpulse überwogen die
dämpfenden Effekte des demografischen Wandels,
die zum verstärkten Ausscheiden der
geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben
führen.
Beschäftigungszugewinne
ausschließlich in Dienstleistungsbereichen
Im Jahr 2024 trugen ausschließlich die
Dienstleistungsbereiche zum Anstieg der
Erwerbstätigenzahl bei. 75,5 % aller
Erwerbstätigen arbeiteten 2024 in den
Dienstleistungsbereichen (2023: 75,3 %). Die
Zahl der Beschäftigten wuchs im
Vorjahresvergleich um 153 000 Personen (+0,4 %)
auf 34,8 Millionen. Innerhalb der
Dienstleistungsbereiche entwickelte sich die
Beschäftigung allerdings unterschiedlich: Einen
großen Zuwachs gab es wie in den Vorjahren im
Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung,
Gesundheit mit +184 000 Personen (+1,5 %).
Demgegenüber ging bei den
Unternehmensdienstleistern, zu denen auch die
Arbeitnehmerüberlassung zählt, die
Erwerbstätigkeit erstmals seit 2020 wieder
zurück (-55 000 Personen; -0,9 %). Geringe
Zunahmen gab es in den Bereichen Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen (+12 000 Personen;
+1,1 %) sowie Information und Kommunikation (+6
000 Personen; +0,4 %), während die Zahl der
Erwerbstätigen im Bereich Handel, Verkehr,
Gastgewerbe mit -1 000 Personen (0,0 %) nahezu
unverändert gegenüber dem Vorjahr blieb.
Beschäftigungsverluste im Produzierenden
Gewerbe und im Baugewerbe
Außerhalb des
Dienstleistungsbereichs nahm die Beschäftigung
ab: Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe)
sank die Erwerbstätigenzahl 2024 um 50 000 (-0,6
%) auf 8,1 Millionen Personen. Im Baugewerbe
ging mit einem Rückgang um 28 000 Erwerbstätige
(-1,1 %) auf 2,6 Millionen der seit dem Jahr
2009 andauernde und nur im Jahr 2015
unterbrochene Aufwärtstrend zu Ende. Insgesamt
arbeiteten damit 23,3 % aller Erwerbstätigen im
Jahr 2024 im Produzierenden Gewerbe (2023: 23,5
).
Im Bereich Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei waren 3 000 Personen weniger
erwerbstätig als im Vorjahr, was einem Rückgang
um 0,5 % auf 569 000 Personen entspricht. Damit
setzte sich der negative Trend der vergangenen
Jahre fort.
Mehr Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, weniger Selbstständige
Entscheidend für die insgesamt positive
Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt war
die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
die im Jahresdurchschnitt 2024 um 146 000
Personen (+0,3 %) auf 42,3 Millionen wuchs. Zu
diesem Anstieg trug maßgeblich die
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei.
Leichte Verluste gab es hingegen bei der
Zahl der marginal Beschäftigten (geringfügig
entlohnte und kurzfristig Beschäftigte sowie
Personen in Arbeitsgelegenheiten). Bei den
Selbstständigen einschließlich mithelfender
Familienangehöriger setzte sich im Jahr 2024 der
nunmehr seit 2012 andauernde Abwärtstrend fort:
Ihre Zahl sank gegenüber 2023 um 74 000 Personen
(-1,9 %) auf 3,8 Millionen.
Zahl der
Erwerbslosen steigt deutlich
Die Zahl der
Erwerbslosen (nach international vergleichbarer
ILO-Definition) in Deutschland stieg nach
vorläufigen Schätzungen auf Basis der
Arbeitskräfteerhebung im Jahresdurchschnitt 2024
im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 179 000
Personen oder 13,4 % auf 1,5 Millionen. Die Zahl
der aktiv am Arbeitsmarkt verfügbaren
Erwerbspersonen, definiert als Summe der
Erwerbstätigen und Erwerbslosen, stieg im
gleichen Zeitraum um 260 000 Personen (+0,6 %)
auf 47,4 Millionen. Die Erwerbslosenquote,
gemessen als Anteil der Erwerbslosen an der Zahl
der Erwerbspersonen, stieg gegenüber dem Vorjahr
von 2,8 % auf 3,2 %.
Donnerstag, 2.
Januar 2025
Landesregierung ermöglicht
Kostenübernahme der Vertraulichen
Spurensicherung nach Gewalttaten
Von
Gewalt betroffene Personen sehen sich nicht
immer in der Lage, die erlebte Tat unmittelbar
anzuzeigen. In diesen Fällen kann die sogenannte
Vertrauliche Spurensicherung sicherstellen, dass
Beweise auch bei späterer Anzeige nicht verloren
gehen. Zur Vertraulichen Spurensicherung gehören
die Dokumentation von Verletzungen sowie die
Sicherung von Tatspuren am Körper von
Betroffenen. Die gerichtsfest dokumentierten
Befunde und Tatspuren stehen damit in einem
späteren Strafverfahren als Beweismittel zur
Verfügung. Zukünftig erstatten die Gesetzlichen
Krankenkassen den Kliniken die Kosten für die
vertrauliche Spurensicherung, was Betroffene von
Gewalttaten stärkt.
Das Ministerium für
Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht
und Integration hat die neuen Regelungen
gemeinsam mit dem Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales in den vergangenen drei
Jahren federführend verhandelt. Beteiligt an den
intensiven und konstruktiven Verhandlungen waren
zudem Vertretungen der Gesetzlichen
Krankenversicherungen, der Institute für
Rechtsmedizin, der Krankenhausgesellschaft
Nordrhein-Westfalen sowie der Landesverband der
autonomen Frauenberatungsstellen NRW e.V..
Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen ist
das fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V).
Gleichstellungsministerin Josefine Paul: „Die
Gewalt an Mädchen und Frauen ist in allen
Deliktsbereichen laut dem aktuellen Lagebild des
Bundes gestiegen. Häufig sind von Gewalt
betroffene Frauen und Mädchen nach einer
Gewalthandlung nicht in der Lage, die Tat
anzuzeigen. Mit dem Vertrag tragen wir dazu bei,
dass Opfer von Gewalt sich für eine Anzeige die
Zeit nehmen können, die sie benötigen, um
körperliche Verletzungen auszukurieren und sich
psychisch zu stabilisieren. Die vertrauliche
Spurensicherung hat damit nicht nur aus
forensischer Sicht, sondern auch mit Blick auf
die Gesundheit des Gewaltopfers einen hohen
Stellenwert.”
Gesundheitsminister
Karl-Josef Laumann: „Die Opfer von Gewalttaten
haben Schlimmes erlebt und sind häufig
traumatisiert. Wir wollen mit diesem Vertrag
dazu beitragen, dass ihnen in dieser
außerordentlich schwierigen Situation geholfen
wird und dass sie sich auch noch längere Zeit
nach der Tat für ein strafrechtliches Verfahren
entscheiden können. Dafür ist es unbedingt
notwendig, dass ihnen niedrigschwellig bei der
Beweissicherung geholfen wird. Das ist für die
Beweisführung in etwaigen späteren
strafrechtlichen Verfahren ein wichtiger
Schritt. Mein herzlicher Dank gilt den
Vertragspartnerinnen und -partnern für ihr
großes Engagement beim Zustandekommen des
Vertrages“.
Tom Ackermann,
Vorstandsvorsitzender der AOK NordWest, für die
gesetzlichen Krankenkassen: „Gemeinsam mit den
beiden beteiligten Ministerien ist es uns
gelungen, eine gute vertragliche Grundlage für
die künftige Kostenübernahme durch die
Gesetzliche Krankenversicherung zu schaffen und
damit gleichzeitig Opfer von Gewalttaten zum
wichtigen Schritt der Beweissicherung zu
ermutigen. Wenn rechtsmedizinische Leistungen
anonym übernommen und abgerechnet werden, dann
hilft das, die Betroffenen nicht zusätzlich zu
belasten oder zu gefährden. Deshalb steht der
Opferschutz an oberster Stelle.“
Den
Vertragspartnerinnen und -partnern war es
wichtig, bewährte Strukturen einzubeziehen. So
wird bspw. das iGOBSIS-System bei der Umsetzung
des Vertrages Anwendung finden. iGOBSIS ist ein
durch Forschende des Universitätsklinikums
Düsseldorf und der FH Dortmund entwickeltes
intelligentes Gewaltopfer-Beweissicherungs- und
-Informationssystem (www.gobsis.de). Der Einsatz
von iGOBSIS wird vom MKJFGFI mit rund 800.000
Euro in 2025 gefördert.
Prof. Stefanie
Ritz, Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin
am Universitätsklinikum Düsseldorf mit der
angeschlossenen Rechtsmedizinischen Ambulanz für
Gewaltopfer: „Es ist sehr wichtig, dass die
Dokumentation von Verletzungen wirklich
gerichtsfest ist und die Spurensicherung
sachgerecht durchgeführt wird. Darauf müssen
sich Betroffene unbedingt verlassen können.
Rechtsmedizinische Kompetenz muss daher rund um
die Uhr zur Verfügung stehen und Kliniken müssen
systematisch geschult werden.
Genau
dafür wurde iGOBSIS entwickelt und in
zahlreichen nordrheinwestfälischen Kliniken
erprobt. Über das System wird eine qualifizierte
Vertrauliche Spurensicherung auch abseits der
Zentren möglich. Betroffene sollten keine langen
Wege in Kauf nehmen müssen, wenn ihnen Gewalt
widerfahren ist und sie kompetente
Ansprechpartner brauchen.”
2020 hat der
Bundesgesetzgeber die Voraussetzungen
geschaffen, damit die von Einrichtungen des
Gesundheitswesens erbrachten Leistungen zur
vertraulichen Spurensicherung am Körper
betroffener Personen finanziert werden können.
Hintergrund ist, dass allein die mündliche
Aussage der Opferzeugin oder des Opferzeugen
mangels weiterer Beweismittel für eine
Anklageerhebung oft nicht ausreichend ist.
Voraussetzung für die Anwendung ist der nun
ausgearbeitete Vertrag zwischen den
Vertragspartnerinnen und -partnern, der die
Leistungen und deren Vergütung zur vertraulichen
Spurensicherung in Fällen von sexualisierter
Gewalt und Misshandlungen regelt.
Nach
der Beschlussfassung durch das Landeskabinett am
17. Dezember 2024 erfolgt nun die
vorgeschriebene Unterrichtung des Landtags
Nordrhein-Westfalen. Im Anschluss wird die
Unterzeichnung durch die Vertragsparteien
erfolgen. Angestrebt wird ein Inkrafttreten im
Februar 2025. Im Anschluss wird das Angebot
sukzessive in nordrhein-westfälischen Kliniken
zur Verfügung stehen.
Brachflächen zu Bauflächen machen –
Aufruf zur Beteiligung an der
Nordrhein-Westfalen-Initiative „Bau.Land.Leben“
Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat,
Kommunales, Bau und Digitalisierung, ruft Städte
und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen dazu auf,
sich am Bewerbungsverfahren 2025 der
Nordrhein-Westfalen-Initiative „Bau.Land.Leben“
zu beteiligen. Ziel ist es, Hemmnisse bei der
Aktivierung von ungenutzten und brachgefallenen
Grundstücken zu beseitigen und die Brachflächen
gemeinsam mit den Kommunen und
Grundstückseigentümern zu neuem Leben zu
erwecken.
„Bau.Land.Leben“ bündelt alle
Unterstützungsangebote, Initiativen und
Aktivitäten des Ministeriums zur Mobilisierung
von Bauland. Neu am Aufruf für das Jahr 2025
ist, dass die Kommunen mit einer Bewerbung
Zugang zu den drei Leistungsbausteinen
„Bau.Land.Partner“, Bau.Land.Partner+“ und
„Bau.Land.Potential“ erhalten. Die
Bewerbungsseite finden Sie hier: BauLandLeben.NRW:
Bewerben! „Brachflächen sind die offenen
Wunden unserer Städte und Gemeinden.
Mit der Nordrhein-Westfalen-Initiative
‚Bau.Land.Leben‘ wollen wir diese Wunden
schließen. Das Angebot unterstützt Kommunen und
Flächeneigentümer mit Know-how und Personal, um
un- oder untergenutzte Flächen für Wohnen und
Gewerbe zu aktivieren. Dabei machen wir es den
Kommunen jetzt noch einfacher. Denn ab sofort
ist eine einzige Bewerbung ausreichend, um
Zugang zu allen Leistungsbausteinen zu erhalten.
Unsere Initiative umfasst alle wichtigen
Hilfsinstrumente für Kommunen, um Bauland zu
entwickeln.
Dies Angebot
ist bundesweit einmalig. Bewerbungen können bis
zum 31. März 2025 abgegeben werden“, sagt Ina
Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales,
Bau und Digitalisierung. An dem Förderinstrument
beteiligen sich bereits 126 Städte und Gemeinden
mit 384 Standorten und einem
Entwicklungspotenzial von 2084 Hektar Fläche.
Davon konnten 617 Hektar für die Zielnutzung
Wohnen identifiziert werden. Typische Beispiele
für die Unterstützung durch die
Leistungsbausteine sind brachliegende
Freiflächen im Siedlungszusammenhang.
Daneben gibt es in vielen Kommunen ehemalige
Gewerbe- oder Industrieareale mit unklaren
Perspektiven, die Bodenuntersuchungen oder
Rückbaukosten verursachen. Zudem gibt es in
einigen Kommunen innerstädtische Gemengelage mit
Aufwertungs- und Nachverdichtungspotenzial.
Das Ministerium hilft im Rahmen von
„Bau.Land.Leben“ durch die Leistungsbausteine
„Bau.Land.Partner“, „Bau.Land.Partner+“ und
„Bau.Land.Potential“ bei der Aktivierung dieser
Flächen. Dies geschieht etwa durch die
Moderation wischen Eigentümern und Kommune,
Einschätzung der ökonomischen und rechtlichen
Machbarkeit und der Klärung von
Nutzungsperspektiven.
Eine Standortanalyse
sowie darauf aufbauende Planungen und
überschlägige Kostenberechnungen, beispielsweise
für die Herrichtung und Erschließung, oder die
Beauftragung von Gutachten und
Planungsleistungen sind ebenfalls Bestandteile
des Leistungsumfangs. Das Förderinstrument des
Ministeriums bietet ein umfassendes Beratungs-
und Unterstützungsangebot für die Kommunen durch
die landeseigene Entwicklungsgesellschaft
NRW.URBAN.
Die
Nordrhein-Westfalen-Initiative „Bau.Land.Leben“
setzt sich aus folgenden drei Bausteinen
zusammen: Bei „Bau.Land.Partner“ werden die
Nachfolgenutzungen für Flächen geprüft, die sich
im privaten Eigentum befinden und zu denen
bislang keine Eignung hinsichtlich einer neuen
Entwicklungsperspektive erzielt werden konnte.
„Bau.Land.Partner“ dient hier als
neutraler Moderator und strebt eine Einigung
zwischen Kommune und Eigentümer zur künftigen
Nutzung einer Fläche an.
Bau.Land.Partner+: Bei „Bau.Land.Partner+“
werden Flächen betrachtet, die einen erhöhten
Aufklärungsbedarf haben und ohne fundierte
Planungen und eine Förderperspektive nicht
reaktiviert werden können. Kommunen können
Gutachten und Untersuchungen in Auftrag geben.
Die Finanzierung erfolgt mit einem kommunalen
Eigenanteil.
Bau.Land.Potential: „Bau.Land.Potential“
unterstützt Kommunen bei der Inventur von
Flächen im Stadtgebiet. Gemeinsam werden
städtebauliche Entwicklungsperspektiven sowie
Planungskonzepte erarbeitet. Darüber hinaus wird
eine Standortpriorisierung mit
Handlungsempfehlung erstellt. Weitere
Informationen zur Initiative „Bau.Land.Leben“
finden Sie unter https://www.mhkbd.nrw/themenportal/landesinitiative-baulandleben
Diskussionsreihe zur Bundestagswahl
über Wirtschaft, Migration und Digitalität
Die Evangelische Akademie Bad Boll bietet im
Vorfeld der Bundestagswahl eine Online-Reihe zu
ausgewählten Themen an. Gemeinsam mit Fachleuten
werden wahlentscheidende Fragestellungen aus den
Bereichen Migration, Digitalität und Wirtschaft
diskutiert:
Niedriges Wachstum,
Infrastrukturprobleme, eine nur zögernde
Transformation und eine komplexe
gesellschaftliche Situation weisen auf die
Notwendigkeit eines Wandels in Deutschland hin.
Welche Rolle wird dabei der Schuldenbremse
beigemessen? Gemeinsam mit Prof. Dr. Birgitt
Mahnkopf und Prof. Dr. Rudolf Hickel werden
diese Fragen zum Auftakt der Diskussionsreihe am
23.01.2025 angegangen.
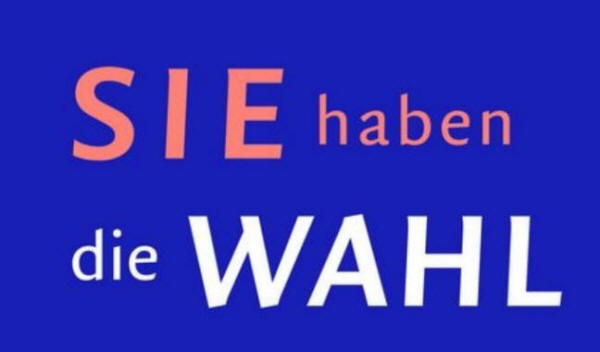
© Evangelische Akademie Bad Boll
Wie lässt sich eine humane
Flüchtlingspolitik angesichts der Sorgen der
Menschen vor Überforderung des Sozialsystemes
und zugleich einer sachlichen Diskussion über
legale Einreisewege in die EU gestalten?
Im
Gespräch am 06.02.2025 mit Vertreterinnen und
Vertreter der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) und der Diakonischen Werke in
Baden und Württemberg werden diese Punkte
diskutiert. Ebenso wird die unternehmerische
Perspektive eingebracht und mit einem
Betroffenen darüber gesprochen, weshalb es so
wichtig ist, Menschen aufzunehmen, die aufgrund
schwerster Menschenrechtsverletzungen aus ihren
Ländern fliehen.
Online-Gesichtserkennung
– was bedeutet es für die Privatsphäre, wenn der
Staat womöglich eine eigene Bilder-Datenbank mit
Millionen Portraitfotos unbescholtener
Bürgerinnen und Bürger aufbaut? Und wie wäre
eine solche Lösung mit der
Datenschutzgrundverordnung und dem AI Act der
Europäischen Union vereinbar? Alexander Poitz,
stellvertretender Bundesvorsitzender der
Gewerkschaft der Polizei, und Kilian
Vieth-Ditlmann, stellvertretender Leiter des
Policy- & Advocacy-Teams von AlgorithmWatch,
bietet den Teilnehmenden am 23.02.2025 die
Chance, sich eine eigene Meinung zu bilden.
Wir laden Sie als Vertreterinnen und
Vertreter der Medien herzlich zur Teilnahme an
der Online-Reihe und zur Berichterstattung ein.
Außerdem freuen wir uns über eine Ankündigung in
den Veranstaltungskalendern: „Diskussionsreihe
zur Bundestagswahl“
23.01., 06.02.,
23.02.2025, 18-19.30 Uhr, online
Bitte melden
Sie sich als Pressevertretung per Mail an:
miriam.kaufmann@ev-akademie-boll.de und Sie
erhalten den Zugangslink
Details zu den
Schwerpunkten der Reihe:
Schuldenbremse und
wirtschaftliche Herausforderungen
(https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/640825.html)
Flucht & Migration ‒ wie gestalten wir eine
humane Flüchtlingspolitik?
(https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/431025.html)
Online-Gesichtserkennung: Öffentliche Sicherheit
contra Privatsphäre
(https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/530625.html)
Moonlight-Shadows: Ein literarischer
Ausflug in die Nacht am 17. Januar
Zu einem literarischen Ausflug in die Nacht lädt
das Grafschafter Museum am Freitag, 17. Januar,
um 19 Uhr ein. Die Lesung ‚Moonlight-Shadows‘
findet im Alten Landratsamt, Kastell 5, statt.
In der heutigen Zeit machen immer mehr Menschen
die Nacht zum Tag, arbeiten und feiern mit so
viel Licht, dass die Dunkelheit kaum noch
auffällt.
Der Nachthimmel mit seinen
Sternen ist nur noch weit von Großstädten
richtig wahrnehmbar. Aber gerade Dunkelheit und
Nachthimmel laden zum Staunen über die
kosmisch-menschlichen Zusammenhänge ein.
Schauspielerin Katja Stockhausen (ehemals
Schlosstheater Moers) trägt literarische Texte
zum Thema Dunkelheit und Nacht, zu ihren
Begleitern am Himmel und auf der Erde.

Foto: Kanenori, Pixabay
Für passende Sphären-Klänge sorgt Harry
Meschke aus Düsseldorf, der seine
außergewöhnlichen Handpan-Instrumente mitbringt.
Durch das Programm führt Rita Mielke vom
Kulturraum Niederrhein als Moderatorin. In der
Pause stehen ein Glas Wein und ein kleiner
‚Nacht-Imbiss‘ für alle Gäste bereit. Die Lesung
findet statt in Kooperation mit der Moerser
Gesellschaft zur Förderung des literarischen
Lebens.

Erzeugerpreise im November 2024: +0,1 %
gegenüber November 2023
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
(Inlandsabsatz), November 2024 +0,1 % zum
Vorjahresmonat +0,5 % zum Vormonat
Die
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im
November 2024 um 0,1 % höher als im November
2023. Dies ist der erste Anstieg gegenüber dem
Vorjahresmonat seit Juni 2023 (+1,2 % gegenüber
Juni 2022). Im Oktober 2024 hatte die
Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat
-1,1 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, stiegen die
Erzeugerpreise im November 2024 gegenüber dem
Vormonat Oktober 2024 um 0,5 %.
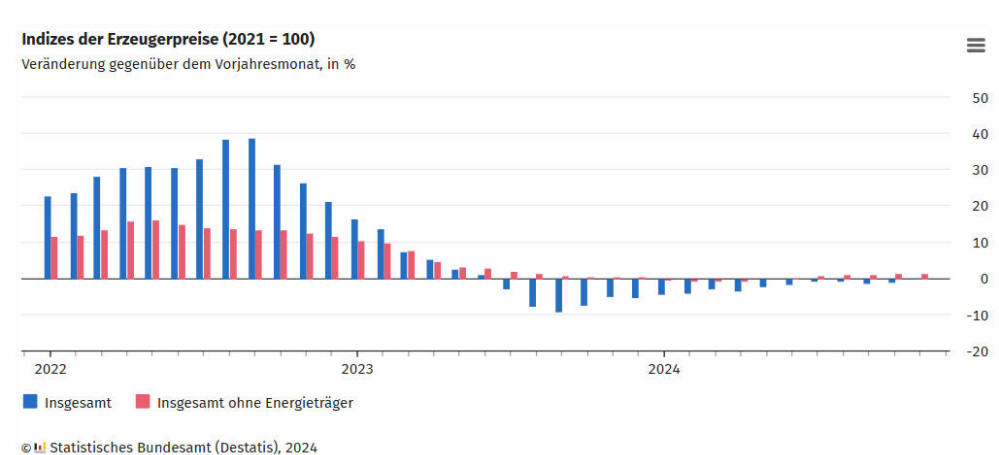
Hauptursächlich für den Anstieg
der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat
waren im November 2024 die Preissteigerungen bei
den Investitionsgütern. Auch Verbrauchsgüter,
Gebrauchsgüter und Vorleistungsgüter waren
teurer als im Vorjahresmonat, während Energie
billiger war. Ohne Berücksichtigung von Energie
stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum
Vorjahresmonat im November 2024 um 1,3 % und
sanken gegenüber Oktober 2024 um 0,1 %.
Preisrückgänge bei Energie gegenüber dem
Vorjahresmonat, aber Anstiege gegenüber dem
Vormonat
Energie war im November 2024 um
2,4 % billiger als im November 2023. Gegenüber
Oktober 2024 stiegen die Energiepreise
allerdings um 1,8 %. Den höchsten Einfluss auf
die Veränderungsrate gegenüber dem
Vorjahresmonat bei Energie hatten die
Preisrückgänge bei Mineralölerzeugnissen. Diese
waren 8,6 % billiger als im November 2023.
Gegenüber Oktober 2024 stiegen die Preise für
Mineralölerzeugnisse um 1,0 %. Leichtes Heizöl
war 13,2 % billiger als im November 2023 (+1,2 %
gegenüber Oktober 2024). Kraftstoffe kosteten
8,4 % weniger als ein Jahr zuvor (+0,4 %
gegenüber Oktober 2024).
Die Preise für
Erdgas fielen über alle Abnehmergruppen
betrachtet gegenüber November 2023 um 7,5 %,
gegenüber Oktober 2024 stiegen sie um 1,1 %.
Strom kostete im November 2024 über alle
Abnehmergruppen hinweg 3,1 % weniger als im
November 2023, aber 4,0 % mehr als im Oktober
2024.
Preisanstiege bei
Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und
Gebrauchsgütern
Die Preise für
Investitionsgüter waren im November 2024 um 1,9
% höher als im Vorjahresmonat (unverändert
gegenüber Oktober 2024). Maschinen kosteten 2,0
% mehr als im November 2023. Die Preise für
Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um 1,4 %
gegenüber November 2023.
Verbrauchsgüter
waren im November 2024 um 2,4 % teurer als im
November 2023 (+0,4 % gegenüber Oktober 2024),
Nahrungsmittel kosteten 2,8 % mehr als im
November 2023. Deutlich teurer im Vergleich zum
Vorjahresmonat waren Butter mit +42,9 % (+2,3 %
gegenüber Oktober 2024) und Süßwaren mit +23,9 %
(+3,9 % gegenüber Oktober 2024). Rindfleisch
kostete 16,5 % mehr als im November 2023 (+4,7 %
gegenüber Oktober 2024). Billiger als im
Vorjahresmonat waren im November 2024 dagegen
insbesondere Getreidemehl (-7,7 %) und
Schweinefleisch (-6,4 %).
Gebrauchsgüter
waren im November 2024 um 0,9 % teurer als ein
Jahr zuvor (unverändert gegenüber Oktober 2024).
Leichter Preisanstieg bei
Vorleistungsgütern
Die Preise für
Vorleistungsgüter waren im November 2024 um 0,4
% höher als ein Jahr zuvor. Gegenüber dem
Vormonat fielen sie um 0,3 %.
Preissteigerungen gegenüber November 2023 gab es
unter anderem bei Natursteinen, Kies, Sand, Ton
und Kaolin (+4,4 %), Gipserzeugnissen für den
Bau (+4,4 %), elektrischen Transformatoren (+3,3
%) sowie bei Kabeln und elektrischem
Installationsmaterial (+1,7 %).
Holz
sowie Holz- und Korkwaren kosteten 2,0 % mehr
als im November 2023. Nadelschnittholz war 16,4
% teurer als im November 2023. Dagegen war
Laubschnittholz 5,9 % günstiger als im
Vorjahresmonat. Die Preise für Spanplatten waren
gegenüber dem Vorjahresmonat 4,2 % niedriger.
Die Preise für Metalle blieben sowohl
gegenüber dem Vorjahresmonat als auch gegenüber
dem Vormonat unverändert. Kupfer und Halbzeug
daraus war 8,3 % teurer als im November 2023.
Dagegen lagen die Preise für Roheisen, Stahl und
Ferrolegierungen mit -7,4 % deutlich unter denen
des Vorjahresmonats. Die Preise für Stabstahl
sanken im Vorjahresvergleich um 5,9 %.
Chemische Grundstoffe verbilligten sich
insgesamt um 1,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat.
Glas und Glaswaren waren 4,8 % günstiger als im
Vorjahresmonat, Futtermittel für Nutztiere waren
4,1 % billiger.
Umbasierung des
Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte
Der
Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte wurde
mit dem Berichtsmonat Januar 2024 auf das neue
Basisjahr 2021 umgestellt. Die Umstellung auf
ein neues Basisjahr erfolgt turnusmäßig in der
Regel alle fünf Jahre. Das der Neuberechnung des
Erzeugerpreisindex zugrunde liegende
Wägungsschema, das die Teilindizes für die
Berechnung des Gesamtindex gewichtet, basiert
auf dem gewerblichen Inlandsabsatz im Jahr 2021.
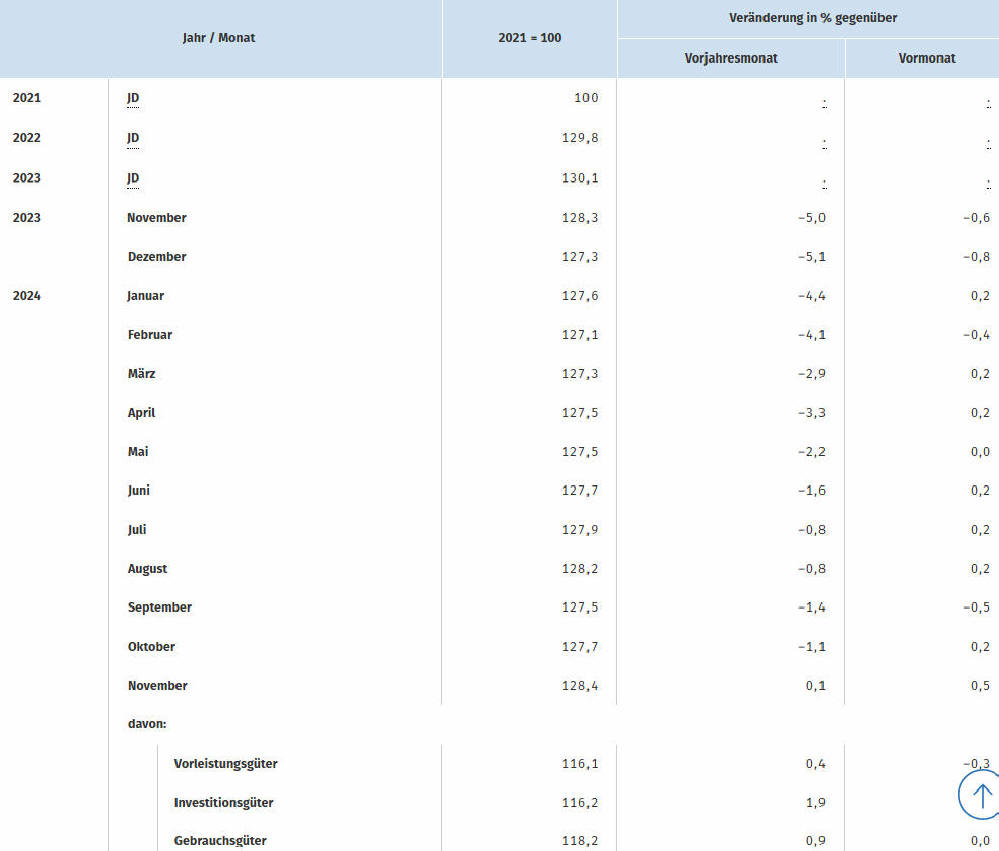
Mittwoch, 1. Januar 2025 - Neujahrstag
Neurungen in den Bereichen Mobilität,
Nachhaltigkeit, Digitales und Produktsicherheit
Im Jahr 2025 treten bei der Prüfung von
Fahrzeugen, Anlagen und Produkten sowie bei der
Zertifizierung und Auditierung von Unternehmen
zahlreiche Neuerungen in Kraft. Neben der
technischen Sicherheit rücken Nachhaltigkeit und
digitale Sicherheit in den Fokus. Der
TÜV-Verband zeigt, was sich für Wirtschaft und
Verbraucher:innen im kommenden Jahr ändert.
MOBILITÄT Führerscheinumtausch – letzte
Frist läuft
Bis zum 19. Januar 2025 müssen
alle Personen, die zwischen 1971 und 1998
geboren wurden und noch einen rosafarbenen oder
grauen Papierführerschein besitzen, diesen gegen
einen Scheckkarten-Führerschein umtauschen.
Damit endet die Umtauschaktion. Ab dem 19.
Januar 2025 dürfte niemand mehr einen rosa oder
grauen Papierführerschein besitzen. Es sei denn,
er oder sie ist vor 1953 geboren. Der Umtausch
ist verpflichtend. Wer noch mit einem alten
Exemplar unterwegs ist, riskiert ein
Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro.
Hauptuntersuchung: Gelbe HU-Plakette wird
vergeben
Bestehen Fahrzeughalter:innen mit
ihrem Pkw die Hauptuntersuchung (HU), erhalten
sie vom TÜV im Jahr 2025 eine gelbe Plakette mit
einer Laufzeit bis zum Jahr 2027. Das gilt für
Fahrzeuge, die alle zwei Jahre zur
Hauptuntersuchung müssen. In welchem Monat die
Hauptuntersuchung fällig ist, zeigt die Zahl
oben „bei 12 Uhr“ auf der Plakette. Die Ziffer 6
steht beispielsweise für Juni. Alternativ hilft
ein Blick in den Fahrzeugschein, die offiziell
„Zulassungsbescheinigung Teil I“ heißt. Darin
ist der nächste HU-Termin vermerkt.
Wer den Termin um mehr als zwei Monate
überzieht, dem droht bei Polizeikontrollen ein
Bußgeld. Bei mehr als zwei Monaten Verzug steht
außerdem eine vertiefte HU mit zusätzlichen
Kosten an. Gasprüfung für Wohnmobile ausgeweitet
Ab dem 19. Juni 2025 gelten neue Regelungen für
die Prüfung von Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen.
Künftig sind alle fest eingebauten
gasbetriebenen Geräte wie Kocher, Kühlschränke
oder Warmwasserboiler untersuchungspflichtig.
Bisher galt das nur für die Heizung, etwa in
Wohnmobilen, Freizeitfahrzeugen oder
Mobilheimen.
Die Prüfungen erfolgen
alle 24 Monate sowie vor der ersten Nutzung und
nach wesentlichen Änderungen an der Anlage. Wer
gegen die Prüfpflichten verstößt, muss mit
Bußgeldern bis zu 60 Euro rechnen.
Gefahrguttransport – jetzt auch mit alternativen
Antrieben Die Antriebswende wird auch bei der
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
berücksichtigt.
Ab 1. Januar 2025
sind Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben,
Wasserstoffbrennstoffzellen und
Verbrennungsmotoren für Wasserstoff auch für den
Transport von brennbaren Gasen und Flüssigkeiten
zugelassen (Fahrzeugkategorie FL). Grundlage ist
die EU-Regelung ADR 2025.
NACHHALTIGKEIT Neue Ökodesign-Anforderungen für
Smartphones und Tablets
Ab 20. Juni 2025
gelten in der EU neue Produktanforderungen für
Smartphones und Tablets. Gemäß der in diesem
Jahr verabschiedeten Ökodesign-Verordnung müssen
die Geräte dann länger halten. So muss die
Batterie auch nach 500-maligem Auf- und Entladen
noch mindestens 80 Prozent Ladekapazität
erreichen. Zudem soll die Verfügbarkeit von
Ersatzteilen für neue Handys und Tablets für
mindestens sieben Jahre gewährleistet sein und
Reparaturen weniger oft notwendig werden.
Einheitliches Ladekabel EU kommt
Eine EU-Richtlinie soll dem Kabelchaos und
Elektroschrott ein Ende bereiten. Ab 2025 gibt
es nur noch einen Anschluss: USB-C als
Ladestandard für Smartphones, Tablets und andere
Geräte wird Pflicht. Für Laptops gilt das
einheitliche Ladekabel erst ab 2026. CO2-Preis
steigt Der CO2-Preis steigt ab Januar 2025 von
45 auf 55 Euro pro Tonne. Das wirkt sich auf die
Preise von Benzin, Diesel, Erdgas und Heizöl
aus.
Der CO2-Preis soll den
klimaschädlichen Verbrauch fossiler Brennstoffe
und damit den CO2-Ausstoß verringern und dabei
helfen, die Klimaschutzziele zu erreichen. Neue
Grenzwerte für Kaminöfen Kamine, Kaminöfen und
Öfen, die zwischen Januar 1995 und dem 21. März
2010 installiert wurden, müssen ab 1.1.2025 die
in der Bundesimmissionsschutzverordnung
festgelegten Werte für Feinstaub und
Kohlenmonoxid einhalten. Konkret heißt das: Sie
dürfen pro Kubikmeter Abgas nicht mehr als vier
Gramm Kohlenmonoxid und 0,15 Gramm Staub
ausstoßen. Ob die Feuerstätte die neuen
Grenzwerte einhält, kann beim
Bezirksschornsteinfeger erfragt werden. Er kann
auch über Ausnahmen von der Sanierungspflicht
informieren.
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Schrittweise Umsetzung des AI Acts
Die
Umsetzung der europäischen KI -Verordnung (AI
Act) erfolgt in mehreren Schritten. Ab Februar
2025 gelten EU-weite Verbote von KI-Systemen mit
hohen Risiken wie Social Scoring,
Emotionserkennung am Arbeitsplatz oder bestimmte
manipulative KI-Techniken. Im April soll ein
Verhaltenskodex für Anbieter von
Allzweck-KI-Modellen wie ChatGPT, Gemini oder
Claude AI vorgelegt werden.
Der
Kodex wird Themen wie Transparenz,
Risikobewertung und Urheberrecht abdecken und
soll die ordnungsgemäße Anwendung der
Vorschriften des KI-Gesetzes erleichtern. Bis
August müssen die EU-Mitgliedsländer Behörden
ernannt haben, die die Umsetzung der EU-Vorgaben
überwachen. Der KI-Behörde obliegt auch die
Aufsicht über externe Stellen, die besonders
sicherheitskritische KI-Anwendungen
(„Hochrisiko-KI“) wie Medizinprodukte oder
autonome Fahrzeuge prüfen können. Der für die
nationale Umsetzung des AI Act notwendige
Gesetzentwurf soll im ersten Quartal 2025
vorgelegt werden.
PRODUKTSICHERHEIT
Neue Produktsicherheitsverordnung in Kraft
getreten Bereits am 13. Dezember 2024 ist die
neue EU-Verordnung über die Produktsicherheit
(EU) 2023/988 in Kraft getreten. Die Verordnung
erweitert den bisher gültigen
Sicherheitsbegriff. Neben physikalischen und
chemischen Eigenschaften werden unter anderem
auch Aspekte wie Cybersicherheit, Kennzeichnung
oder Entsorgungshinweise berücksichtigt. Der
Online-Handel wird dem stationären Handel
gleichgestellt.
Alle in
Online-Shops, auf Social Media Plattformen oder
auf Online-Marktplätzen angebotenen Produkte
müssen die gleichen EU-Anforderungen erfüllen.
Um den Verbraucherschutz zu verbessern, müssen
Anbieter auf dem Produkt oder der Verpackung die
Kontaktdaten einer verantwortlichen Person in
der EU benennen. Durch das Produkt verursachte
Unfälle müssen den EU-Behörden gemeldet werden.
Online-Marktplätze müssen sich registrieren und
sicherstellen, dass sie über Verfahren zur
Gewährleistung der Produktsicherheit auf ihrer
Plattform verfügen.
Neue Regeln für kommunales
Abwasser erhöhen Schutz für Bürger und Umwelt
Am 1. Januar treten neue Regeln für
eine gründlichere und kosteneffizientere
Bewirtschaftung kommunaler Abwässer in Kraft.
Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger und die
Umwelt besser vor schädlichen Einleitungen von
kommunalem Abwasser zu schützen. Gemäß dem
Verursacherprinzip werden die Kosten für
fortschrittliche Behandlungsmethoden künftig
hauptsächlich von der verantwortlichen Industrie
und nicht über die Wassergebühren oder den
öffentlichen Haushalt gedeckt. Die EU-Staaten
müssen die neuen Vorgaben nun in den kommenden
Jahren in nationales Recht umsetzen.
Neue Regelung wird Flüsse, Seen, das
Grundwasser und Europas Küsten sauberer machen
Die überarbeitete
Richtlinie wird nun auch für die kleinsten
Gemeinden ab 1.000 Einwohnern gelten. Sie bringt
finanzielle Vorteile und vereinfacht die
Berichterstattungspflichten der Mitgliedstaaten.
Künftig werden mehr Nährstoffe aus kommunalem
Abwasser entfernt, neue Normen für
Mikroschadstoffe eingeführt und eine
systematische Überwachung von Mikroplastik und
PFAS vorgeschrieben.
Die neuen
Regeln werden das Management von Regenüberläufen
in Städten verbessern und die Kreislauffähigkeit
von Abwasser erhöhen. Die Richtlinie
gewährleistete auch Zugang von zwei Millionen
der am stärksten gefährdeten und ausgegrenzten
Menschen in der EU zu sanitären Einrichtungen im
öffentlichen Raum. Die Kommission wird eng mit
den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um eine
wirksame Umsetzung der Richtlinie
sicherzustellen und so zu einem
widerstandsfähigen Europa im Bereich der
Wasserpolitik beizutragen.
Stadt Wesel:
Ordnungsbehördliche Verordnung über das
unbefugte Plakatieren, Beschriften, Bemalen und
Besprühen von öffentlichen Flächen an
Verkehrsflächen sowie in öffentlichen Anlagen
Aufgrund der §§ 27
Abs. 1, Abs. 4 S. 1, 31 des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz – (OBG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV NW S.
528), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23.06.2021(GV NW S. 762), hat der Rat der Stadt
Wesel in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende
Ordnungsbehördliche Verordnung über das
unbefugte Plakatieren, Beschriften, Bemalen und
Besprühen von öffentlichen Flächen an
Verkehrsflächen sowie in öffentlichen Anlagen
beschlossen:
Inhaltsverzeichnis:
§ 1
Begriffsbestimmungen
§ 2 Plakatieren,
Beschriften, Bemalen, Besprühen
§ 3
Beseitigungspflicht
§ 4 Ausnahmen und
Befreiungen
§ 5 Ordnungswidrigkeiten
§ 6
Inkrafttreten
§1 Begriffsbestimmungen
Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind
alle dem öffentlichen Verkehr dienenden Flächen
ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. Zu
den Verkehrsflächen gehören insbesondere
Straßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege, Radwege,
Bürgersteige, Plätze, Seiten-, Rand- und
Sicherheitsstreifen, Böschungen, Rinnen und
Gräben, Brücken, Unterführungen, Treppen und
Rampen vor der Straßenfront der Häuser.
Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne
Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse
insbesondere:
alle der Allgemeinheit zur
Nutzung zur Verfügung stehenden oder
bestimmungsgemäß zugänglichen Grün-, Erholungs-,
Spiel- und Sportflächen, Toiletten-,
Kinderspiel- und Sporteinrichtungen, Waldungen,
Gärten, Parks, Friedhöfe sowie die Ufer und
Böschungen von Gewässern,
Flächen, die dem
öffentlichen Nutzen dienen, insbesondere
Wertstoffbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe,
Verteiler- und Schaltkästen, Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen, Hinweisschilder,
Parkhäuser, Schallschutzwände, Geländer, Bänke,
Denkmäler, Litfaßsäulen, Bäume, Licht- und
Leitungsmasten, Signalanlagen, Wartehäuschen,
Briefkästen, Telefonzellen sowie Türen, Tore,
Wände, Mauern, Zäune und
Begrenzungseinrichtungen von öffentlichen
Gebäuden.
§ 2
Plakatieren, Beschriften,
Bemalen, Besprühen
Das Anbringen oder
Anbringenlassen von Plakaten, Anschlägen und
anderen Werbemitteln jeder Art (Plakatanschlag)
auf den in § 1 genannten Flächen sowie an den im
Angrenzungsbereich zu den Verkehrsflächen und
Anlagen gelegenen Einfriedungen, Hauswänden und
sonstigen Anlagen, Einrichtungen und
Gegenständen ist verboten. Der
Angrenzungsbereich schließt Standorte auf
Privatgrundstücken mit ein, welche sich
innerhalb eines Abstands von 1 Meter, gemessen
vom äußeren Rand der öffentlichen Verkehrsfläche
bzw. öffentlichen Anlage, befinden und die in
Satz 1 genannten Werbeträger ganz oder teilweise
erreichen.
Ebenso ist es verboten, Flächen im
Sinne von § 1 zu beschriften, zu bemalen, zu
besprühen oder beschriften, bemalen und
besprühen zu lassen.
Die Absätze 1 und 2
finden ferner keine Anwendung auf die dem
öffentlichen Bauordnungsrecht unterliegenden
Anlagen der Außenwerbung nach § 13 der
Landesbauordnung in der jeweils geltenden
Fassung, ferner nicht auf genehmigte oder sonst
gestattete Sondernutzungen.
§ 3
Beseitigungspflicht
Wer entgegen den
Verboten des § 2 Absatz 1 und 2 Plakatanschläge
anbringt, beschriftet, bemalt, besprüht oder
hierzu veranlasst, ist zur unverzüglichen
Beseitigung verpflichtet.
Die
Beseitigungspflicht trifft in gleichem Maße auch
den Veranstaltenden, auf den auf den jeweiligen
Plakatanschlägen oder Darstellungen nach § 2
hingewiesen wird.
§ 4
Ausnahmen und
Befreiungen
Von den Vorschriften dieser
Verordnung kann die Verwaltungsbehörde Ausnahmen
zulassen, wenn dies im berechtigten Interesse
einzelner oder im öffentlichen Interesse geboten
ist.
Die Verwaltungsbehörde kann darüber
hinaus Ausnahmen zulassen, wenn die Durchführung
der Verordnung im Einzelfall zu einer offenbar
nicht beabsichtigten Härte führen würde und
öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.
§ 5
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig einem der in § 2 Absatz 1 und 2
enthaltenen Verbote zuwiderhandelt oder als
Verpflichteter der in § 3 beschriebenen
Beseitigungspflicht nicht nachkommt.
Verstöße
gegen die Vorschriften dieser Verordnung können
nach den Bestimmungen des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer Geldbuße
bis zu 1.000,00 €, bei fahrlässigem Handeln bis
zu 500,00 € für jeden Fall einer Zuwiderhandlung
geahndet werden.
Verwaltungsbehörde im Sinne
des § 36 Absatz 1 Nr. 1 OWiG und § 4 Absatz 1
dieser Satzung ist die örtliche Ordnungsbehörde.
§ 6
Inkrafttreten
Diese
ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tage
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die ordnungsbehördliche
Verordnung über das unbefugte Plakatieren,
Beschriften, Bemalen und Besprühen von
öffentlichen Flächen an Verkehrsflächen sowie in
öffentlichen Anlagen vom 24.06.2015 außer Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende
Satzung/ortsrechtliche Bestimmung der Stadt
Wesel wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Eine Veröffentlichung erfolgt ebenfalls unter
www.wesel.de.
Von der Behörde zum
Weltmarktführer - DHL Group: Vor 30 Jahren wurde
die Deutsche Post zur Aktiengesellschaft
Der 1. Januar 1995 markiert den
Aufbruch in eine neue, privatwirtschaftliche Ära
Mit einem Umsatz von etwa 82 Milliarden Euro und
fast 600.000 Beschäftigten ist DHL Group heute
der weltweit führende Logistikdienstleister
Vorstandschef Tobias Meyer: „Die Postreformen
der 90er-Jahre in Deutschland waren weitsichtige
politische Entscheidungen“ Bonn, 30. Dezember
2024: Die Deutsche Post AG hat in den
vergangenen 30 Jahren einen weiten Weg
zurückgelegt - von einem nationalen
Postdienstleister zum weltweit führenden
Logistikunternehmen DHL Group.

Ein Meilenstein war der 1. Januar 1995:
Damals wurde die Deutsche Post zur
Aktiengesellschaft. Die drei öffentlichen
Unternehmen Postdienst, Telekom und Postbank,
die aus der damaligen Deutschen Bundespost
hervorgegangenen waren, wurden dabei
privatisiert. Was für viele heute Normalität ist
– der Konzern DHL Group gehört seit vielen
Jahren zur Riege der deutschen DAX 40
Unternehmen – war damals eine in Politik und
Gesellschaft umstrittene Entscheidung.
Heute lässt sich sagen: Der eingeschlagene
Weg sorgte dafür, dass das Unternehmen im
aufkommenden europäischen Wettbewerb bestehen
konnte. Durch internationale Zukäufe stieg es
als DHL Group zu einem globalen Akteur auf. Lag
der Fokus in den 1990er-Jahren auf dem
Briefgeschäft, sind es heute vor allem Pakete
und Frachtgüter – von Onlinebestellungen über
Medikamente oder Computerchips bis hin zu
Maschinen und Bauteilen.
Der Konzern
transportiert sie auf dem Land,- See- und
Luftweg. „Die Postreformen der 90er-Jahre in
Deutschland, insbesondere die Umwandlung der
Deutschen Post in eine AG, waren weitsichtige,
mutige politische Entscheidungen”, sagt Tobias
Meyer, Vorstandsvorsitzender der DHL Group.
„Heute sind wir in über 220 Ländern und
Territorien präsent. Gleichzeitig sind wir
unserem Heimatmarkt und unseren Wurzeln treu
geblieben – mit unserem Unternehmensbereich Post
& Paket Deutschland.”
Übernahme von
DHL in 2002 schafft globales Netzwerk
International präsent wurde die Deutsche Post
vor allem durch die Übernahme von DHL im Jahr
2002, das zuvor ein US-Unternehmen war. Durch
diesen Schritt konnte die Deutsche Post ihr
internationales Netzwerk erheblich erweitern und
ihre Präsenz auf dem globalen Logistikmarkt
stärken. DHL war bereits ein etablierter Akteur
im internationalen Express- und
Logistikgeschäft, was es der Deutschen Post
ermöglichte, ihre Dienstleistungen weltweit
anzubieten.
Ihre globale Bedeutung
stellte DHL Group später unter anderem während
der Corona-Pandemie unter Beweis: In dieser Zeit
hielt das Unternehmen nicht nur weltweit
Lieferketten aufrecht, sondern lieferte auch
über zwei Milliarden dringend benötigte
Impfdosen in 175 Länder. Maßnahmen zur
Umwandlung in eine AG Blick zurück: Zur
Privatisierung 1995 waren in Deutschland viele
Weichen zu stellen. Eine besondere Hürde etwa
war das Beamtenrecht. Es musste die Überleitung
der Beamten in eine Aktiengesellschaft und deren
Weiterbeschäftigung geklärt werden.
Neben diesen komplexen rechtlichen Änderungen
gab es auch Anpassungen im sprachlichen Bereich,
alte Behördenbegriffe mussten in
allgemeinverständliche Sprache „übersetzt“
werden: Aus dem „Postamt“ wurde die
Niederlassung, der „Ministerialrat“ hieß ab
sofort Fachbereichsleiter und „Verfügungen,
Erlasse und Amtsblätter“ wurden ganz
abgeschafft. Alles mit dem Ziel, einige Jahre
später den nächsten Reformschritt zu vollziehen:
den Börsengang, der dann im November 2000
erfolgte.
Und so sollte Wolfgang
Bötsch, der letzte Bundesminister für Post und
Telekommunikation, Recht behalten mit seiner
Einschätzung in einem Interview mit der
Zeitschrift Wirtschaft & Markt 1995: „Die
Privatisierung war notwendig, um auf dem sich
weltweit dynamisch entwickelnden
Kommunikationsmarkt bestehen zu können.
Unternehmen mit einer Behördenstruktur, gebunden
an verwaltungsrechtliche und dienstrechtliche
Grundsätze, wären dabei ein Hemmnis gewesen,
weil sie unflexibel sind.“
Der Weg
zur AG – 1990 bis 1995
Der Privatisierung
vorausgegangen war die Postreform I, also die
1990 vorgenommene Aufspaltung der früheren
Deutschen Bundespost in die drei öffentlichen
Unternehmen Deutsche Bundespost Postdienst,
Deutsche Bundespost Telekom und Deutsche
Bundespost Postbank. In dieser Zeit, also
zwischen 1990 und 1995, konzentrierte sich das
damalige Post-Management darauf, die
Behördenstruktur zugunsten einer
wettbewerbsgerechten Spartenorganisation mit
klaren Führungsstrukturen aufzugeben.
Die Sparten Briefpost, Frachtpost und
Postfilialen durchliefen eine umfassende
Transformation: Im Briefbereich wurde 1993 ein
neues, fünfstelliges Postleitzahlensystem
eingeführt. Ein Jahr später folgte die
Fertigstellung der ersten – von insgesamt 82 –
modernen Briefzentren. Auch ein aus 33
„Frachtpostzentren“ bestehendes neues
Paketverteilnetz wurde ab 1994 stufenweise in
Betrieb genommen. Und in den Postfilialen hielt
ein neues „Open Service-Konzept“ Einzug und
erste Partner-Filialen nahmen ihren Betrieb auf.
Die Maßnahmen zeigten Wirkung: 1994,
also im letzten Jahr vor der Umwandlung in eine
AG, wurde für Gesamtdeutschland erstmals seit
der Wiedervereinigung ein positives Ergebnis aus
gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftet,
nämlich 257 Millionen DM. Der Umsatz lag bei
rund 25 Milliarden DM, davon machte die
Briefpost 57 Prozent und der Paketbereich
(Frachtpost) 16 Prozent aus. Heute macht DHL
Group einen Umsatz von fast 82 Milliarden Euro,
davon rund 80 Prozent im Ausland.
Post &
Paket Deutschland ist ein Unternehmensbereich
der DHL Group mit rund 187.000
Mitarbeiter:innen. Kerngeschäft ist das
nationale Brief- und Paketgeschäft – also das
Transportieren, Sortieren und Zustellen von
Briefen und Paketen. Sein umfangreiches Angebot
an Dienstleistungen und Produkten vertreibt Post
& Paket Deutschland unter den beiden starken
Marken Deutsche Post und DHL.
Mit seinen
beiden Marken Deutsche Post und DHL ist Post &
Paket Deutschland der größte Postdienstleister
Europas, Marktführer im deutschen Brief- und
Paketmarkt, Dienstleister erster Wahl für
Versender- und Empfängerkunden sowie Betreiber
des größten Paketautomaten-Netzes (Packstationen
und Poststationen) in Deutschland. In seiner
Branche ist Post & Paket Deutschland Vorreiter
im Bereich der ökologischen und sozialen
Nachhaltigkeit.
DHL Group erzielte als
Konzern 2023 einen Umsatz von mehr als 81,8
Milliarden Euro. Mit Investitionen in grüne
Technologien sowie dem Engagement für
Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern
einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050
strebt DHL Group die netto
Null-Emissionen-Logistik an.

Jugendarbeit: Öffentliche Hand förderte 139
000 Angebote für 7,3 Millionen Teilnehmende
• Öffentliche Hand förderte Jugendarbeit mit 2,3
Milliarden Euro
• 30 % mehr Angebote und 65
% mehr Teilnehmende als im Corona-Jahr 2021
• Angebots- und Teilnehmerzahlen 2023 aber
weiter unter Vor-Corona- Niveau
• Spiele,
gesellschaftliche und religiöse Angebote und
Sport besonders beliebt
Bund, Länder und
Gemeinden haben im Jahr 2023 gut 2,3 Milliarden
Euro zur Förderung der Jugendarbeit in
Deutschland ausgegeben. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden damit
knapp 139 000 Angebote gefördert, an denen 7,3
Millionen Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene teilnahmen.
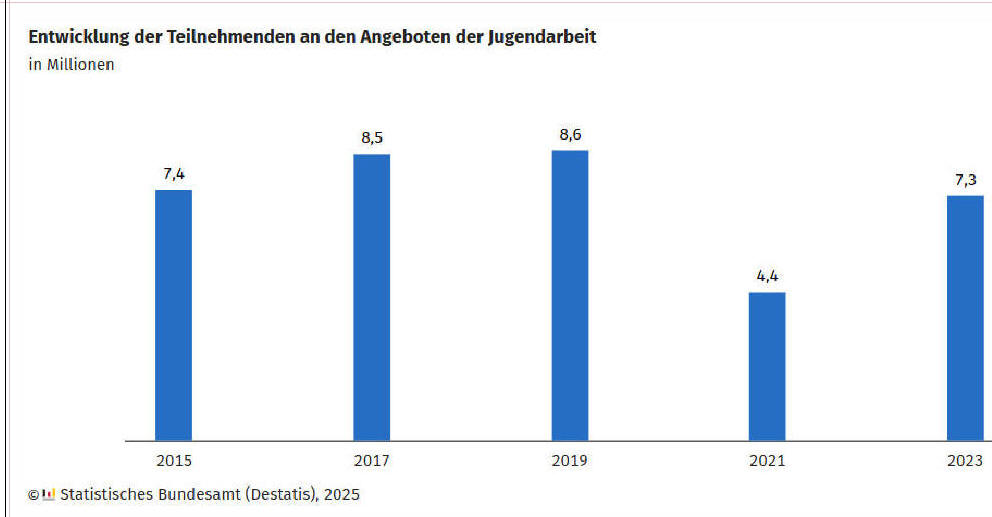
Damit ist die Zahl der Teilnehmenden im Jahr
2023 wieder um 2,9 Millionen oder 65 %
gestiegen, nachdem sie 2021 infolge der Pandemie
auf ein Rekordtief von 4,4 Millionen gesunken
war. Trotzdem lag die Teilnehmerzahl im Jahr
2023 noch deutlich unter dem Niveau vor der
Pandemie: 2019 hatten 8,6 Millionen junge
Menschen an den öffentlich geförderten Angeboten
der Jugendarbeit teilgenommen – 1,3 Millionen
mehr als 2023.
Die Zahl der Angebote nahm 2023 ebenfalls wieder
zu: Im Vergleich zu 2021 stieg sie um fast
32 300 Fälle oder 30 % auf rund
139 000 Angebote. Auch das waren weiterhin
weniger Fälle als vor der Pandemie: 2019
verzeichnete die Statistik 157 000 Angebote.
Besonders beliebt: Spiele, gesellschaftliche und
religiöse Angebote sowie Sport Im Schnitt nahmen
im Jahr 2023 an jedem Angebot 52 junge Menschen
teil.
Besonders beliebt waren
Spiele (36 %), gesellschaftliche und religiöse
Angebote (23 %), Sport (23 %) sowie Kunst und
Kultur (22 %). In zwei Drittel aller Fälle
wurden dabei mit den jungen Menschen
Veranstaltungen oder Projekte durchgeführt
(67 %), zum Beispiel Freizeiten, Konzerte oder
Feste. In weiteren 17 % waren es
Gruppenangebote, etwa die wöchentliche
Gruppenstunde der Kirche, und in 16 % der Fälle
waren es offene Angebote, wie Jugendtreffs oder
Jugendcafés.
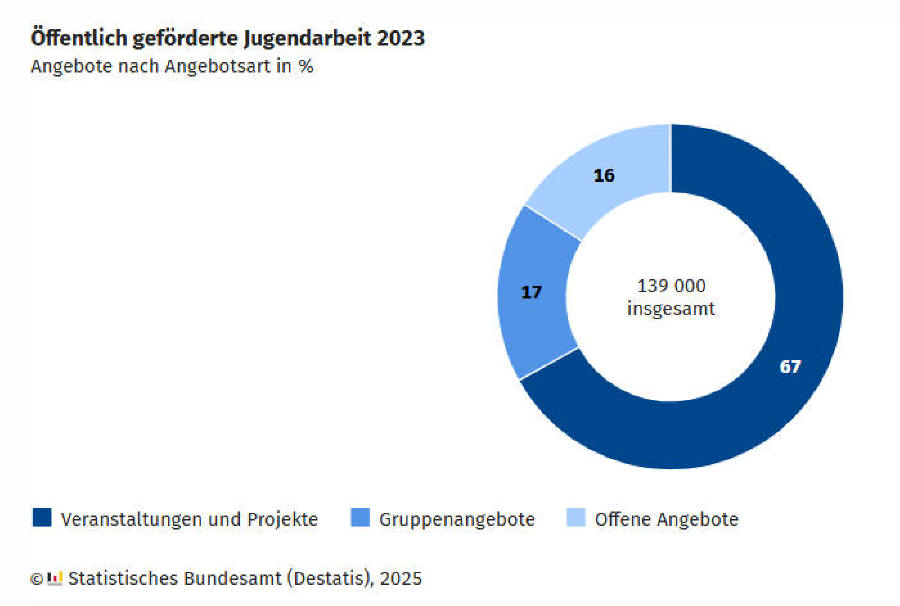
Die meisten Angebote (69 %) führten
anerkannte freie Träger der Kinder- und
Jugendhilfe durch. Dazu gehören beispielsweise
Kirchen, Wohlfahrts- oder Jugendverbände. Knapp
ein weiteres Drittel (31 %) lag in den Händen
öffentlicher Träger wie den Kommunen oder
Jugendämtern. 16 % aller Angebote wurden in
Kooperation mit Schulen durchgeführt, wobei die
Grundschulen hier besonders aktiv waren (8 %).
In etwa 1 400 Fällen handelte es sich um
Angebote der internationalen Jugendarbeit. Am
häufigsten stammten hierbei die meisten oder
alle ausländischen Teilnehmenden aus: Frankreich
(15 %), Polen (11 %), Spanien (5 %), der Türkei
(5 %) oder Italien (4 %).
Dienstag, 31,
Dezember 2024 - Silvester
Verkaufs-Überwachung von Silvester-Feuerwerk:
Bezirksregierung stellt 108 Verstöße fest
Mit 15 Mitarbeitenden in sieben Teams war die
Bezirksregierung Düsseldorf in den vergangenen
Tagen schwerpunktmäßig im Kreis Kleve und in
Duisburg unterwegs, um die Lagerung und den
Verkauf von Silvesterfeuerwerk zu kontrollieren.
Insgesamt wurden 108 Verstöße aufgedeckt.
In einer Verkaufsstelle in Kranenburg
musste der Verkauf von Feuerwerk untersagt
werden. Dort wurde ein Zelt als Verkaufsraum
genutzt. Laut Erster Verordnung zum
Sprengstoffgesetz darf Silvesterfeuerwerk jedoch
nur in geschlossenen Räumen vertrieben und
anderen überlassen werden. Da der betroffene
Händler der Untersagung zunächst nicht nachkam,
wurde die Anordnung mit Hilfe der Polizei vor
Ort vollstreckt. Den Betroffenen erwartet nun
ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Insgesamt hat der Arbeitsschutz der
Bezirksregierung in den vergangenen Tagen 290
Lager- und Verkaufsstellen überprüft. Dabei ging
es unter anderem um die zulässige Höchstmenge an
explosiven Stoffen, die Vorschriften zur
Lagerung und die Kennzeichnung des Feuerwerks,
aber auch um die Einhaltung der Bestimmungen für
Rettungswege. Bei den 108 Verstößen handelte es
sich in 54 Fällen um Verstöße gegen das
Sprengstoffgesetz, wie beispielsweise den
Verkauf mangelhafter Pyrotechnik.
In
54 Fällen wurden Verstöße gegen das
Arbeitsschutzgesetz, wie etwa versperrte
Notausgänge, festgestellt. Die alljährliche
Aktion dient dem Schutz der Verkäufer sowie der
Sicherheit der Kunden. Da die Bezirksregierung
Düsseldorf immer nur Stichproben durchführen
kann, sollten Käuferinnen und Käufer von
Silvesterfeuerwerk für einen sicheren Start in
das neue Jahr immer auf die CE-Kennzeichnung
achten.
Landeswahlleiterin
Monika Wißmann fordert die Parteien jetzt zur
Einreichung von Wahlvorschlägen auf.
„Für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23.
Februar 2025 sind die Wahlvorschläge für die
Wahl nach Landeslisten für das Land
Nordrhein-Westfalen spätestens am Montag, 20.
Januar 2025 bis 18.00 Uhr bei der
Landeswahlleiterin einzureichen“, heißt es in
ihrer heute veröffentlichten Wahlbekanntmachung.
„Jetzt sind die Fristen für die vorgezogene
BT-Wahl amtlich“, erklärte Wißmann.
Der Bundespräsident löste am vergangenen
Freitag (20. Dezember 2024) den Bundestag auf
und setzte den Termin für die vorgezogene
Bundestagswahl wie erwartet auf den 23. Februar
fest. Zugleich hat das Bundesinnenministerium
die gesetzliche Frist für die Einreichung der
Wahlvorschläge verkürzt. Sie müssen demnach bis
zum 20. Januar eingegangen sein.
„Parteien, die in NRW an der Bundestagswahl
teilnehmen wollen, müssen vor Ablauf der Frist
ihre Landeslisten in Papier mit allen
erforderlichen Unterschriften und Unterlagen im
Original vorlegen. Eine elektronische Zusendung
genügt nicht“, erinnert die Landeswahlleiterin.
Parteien, die Unterstützungsunterschriften
benötigen, müssen diese mit den erforderlichen
Originalunterschriften und Bestätigungen der
Wahlberechtigung durch die jeweilige Gemeinde
mit einreichen.
Es handelt sich um eine
Ausschlussfrist. Verspätete Unterlagen können
für die Prüfung, ob ein Wahlvorschlag zugelassen
werden kann, nicht berücksichtigt werden. Auf
der Sonderseite zur Bundestagswahl 2025 -
www.wahlen.nrw - finden sich regelmäßig aktuelle
und umfassende Informationen zur Wahl.
Moers:
Neujahrsfrühstück
Sie möchten dem Silvesterkater den Kampf
ansagen? Ihnen steht der Sinn nach einem
ausgiebigen Frühstück in schönster Atmosphäre
und ohne Stress? Dann sind Sie bei uns genau
richtig und herzlich willkommen. Genießen Sie
ein ausgiebiges Neujahrsfrühstück, mit dem 2025
nur ganz wunderbar starten kann. 21,50 Euro pro
Person 10,75 Euro pro Kind Info und Reservierung
per E-Mail moers@vandervalk.de oder
Tel.: 0 28 41 / 14 60.
6. Moerser Neujahrskonzert -
,,Johann Strauss – Ein Künstlerleben“
-
Keine Abendkasse
für das Neujahrskonzert - 1200 Gäste feiern in
Moers mit den Prager Philharmonikern den
Jahresstart
- Volksbank Niederrhein und Enni
präsentieren: Prague Royal Philharmonic Leitung
und Moderation: Heiko Mathias Förster
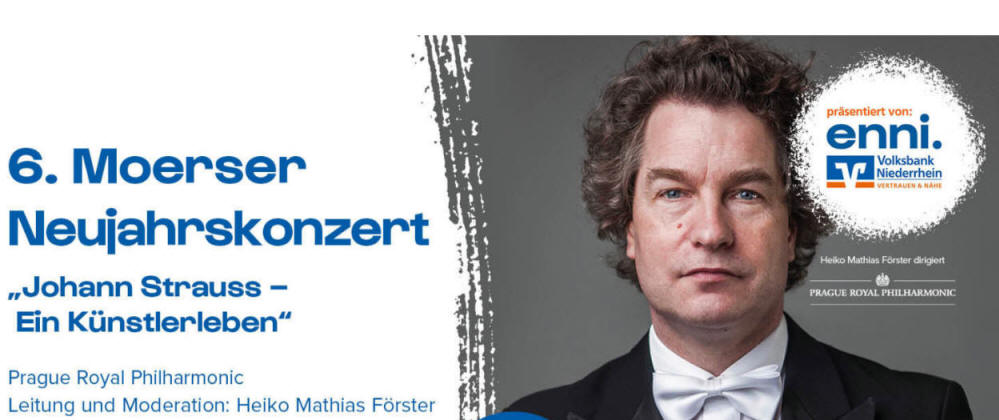
Einen schwungvollen Start ins neue Jahr
verspricht das 6. Moerser Neujahrskonzert mit
dem PRAGUE ROYAL PHILHARMONIC in der
enni.eventhalle. Unter dem Titel „Johann Strauss
– Ein Künstlerleben“ präsentieren der weltweit
gefeierte Chefdirigent Heiko Mathias Förster und
seine 65 Musikerinnen und Musiker am Neujahrstag
2025 eine brillante Auswahl an Walzern, Polkas,
Märschen und Ouvertüren.
Das Konzert
ehrt den Walzerkönig Johann Strauss Sohn, dessen
200. Geburtstag 2025 gefeiert wird. Dank der
Unterstützung der beiden Sponsoren, Volksbank
Niederrhein und ENNI Energie & Umwelt
Niederrhein GmbH (Enni), ist es gelungen, das
Prager Spitzenensemble zum sechsten Mal in die
Grafenstadt zu holen. Mit dem prachtvollen
„Zivio-Marsch“ eröffnen die Philharmoniker den
fulminanten Abend. Es folgt der namensgebende
Walzer „Künstlerleben“, eines der bekanntesten
Werke von Strauss, das 1867 komponiert wurde, um
der getrübten Stimmung in Wien entgegenzuwirken.
Ein weiteres Highlight ist der
weltbekannte „Donauwalzer“, der als inoffizielle
Bundeshymne Österreichs gilt. Zwischen
spritzigen Polkas und exotisch anmutenden
Walzern darf auch das Publikum musikalisch aktiv
werden – bei der Polka „Im Krapfenwaldl“, die
Strauss während seiner Waldspaziergänge
inspiriert hat. Schunkeln, leises Mitsummen und
Vogelstimmen-Imitationen sind ausdrücklich
erwünscht! Das Interesse ist groß.
Veranstaltungsdatum 01.01.2025 - 16:00
Uhr - 21:00 Uhr Veranstaltungsort ENNI
Eventhalle
Abschmücken und rausstellen: ENNI holt
nach dem Dreikönigstag die Weihnachtsbäume ab
Die ENNI Stadt & Service Niederrhein (Enni) holt
auch zu Beginn des neuen Jahres die
abgeschmückten Weihnachtsbäume bei Moerser
Bürgern ab. Die Aktion beginnt erneut nach dem
Dreikönigstag und läuft zwischen Montag, 13.
Januar und Freitag, 17. Januar, dann eine Woche.
Ulrich Kempken, Abteilungsleiter
Entsorgung bei Enni, bittet die Bürger dabei,
Bäume am Tag vor der Abfuhr abgeschmückt an die
Straßen zu legen. Wichtig: „Wir holen
ausschließlich Tannenbäume ab und sammeln bei
dieser Gelegenheit keinen Strauchschnitt ein.“
Die genauen Termine und Bezirke erfahren
Moerser wie gewohnt aus ihrem neuen
Abfallkalender, den die Enni vor Weihnachten an
alle Haushalte verschickt hat. Übrigens: Wer
keine Termine versäumen möchte, kann sich auch
im Internet unter www.enni.de informieren, für
den elektronischen Erinnerungsdienst anmelden
oder die App „Meine Enni“ nutzen.
Neue Bewerbungsrunde für DiscoverEU:
rund 6.000 Zugtickets allein für junge Reisende
aus Deutschland European Union
Ab dem nächsten Frühjahr
können wieder über 35.000 junge Menschen im
Alter von 18 Jahren Europa kostenlos mit dem Zug
kennenlernen. Für Reisende aus Deutschland
stehen 6104 Traveltickets zur Verfügung. Die
Kommission hat gerade die Bewerbungen für die
neue Runde der DiscoverEU-Initiative geöffnet.
Wer 18 Jahre alt ist und sich erfolgreich
beworben hat, kann ab März 2025 für 30 Tage
durch Europa reisen.

Wie das abläuft, bestimmen die Jugendlichen
selbst: Bis Ende Mai 2026 können die Tickets
genutzt werden. Iliana Ivanova, Kommissarin für
Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und
Jugend ermutigte alle 18-Jährigen, diese Aktion
im Rahmen des Programms Erasmus+ zu
nutzen: „DiscoverEU ist eine unglaubliche
Gelegenheit für junge Menschen, ihren Horizont
zu erweitern, die reiche Vielfalt Europas zu
erleben und Verbindungen über Grenzen hinweg
aufzubauen.
Mit diesen kostenlosen
Reisepässen fördern wir ein tieferes Verständnis
der europäischen Kulturen, Werte und
Geschichte.“
•
Teilnahme am Quiz gehört zur Bewerbung
Zur Verfügung stehen insgesamt 35.500
Reisepässe. Um sich zu qualifizieren, müssen
junge Menschen, die zwischen dem 1. Januar und
dem 31. Dezember 2006 geboren sind, zunächst ein
Quiz beantworten, das aus fünf Fragen über die
EU besteht, sowie eine zusätzliche Frage zum Europäischen
Jugendportal. Die
Kandidatinnen und Kandidaten werden auf der
Grundlage ihrer Antworten in eine Rangliste
aufgenommen, und die Reisepässe werden auf der
Grundlage dieser Rangliste verteilt.
•
Die Aufforderung steht
jungen Menschen aus der Europäischen Union und
den mit dem Programm Erasmus+ assoziierten
Ländern offen, darunter Island, Liechtenstein,
Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und die
Türkei. Die Ausschreibung läuft bis zum 16.
Oktober um 12:00 Uhr.
•
Tipps zur Routenplanung
Erfolgreiche
Bewerberinnen und Bewerber können entweder ihre
eigenen Routen planen oder sich von bestehenden
Routen inspirieren lassen, wie z. B. der „Feel
Good Route“, die sich auf die körperliche
und geistige Gesundheit auf Reisen konzentriert.
Die Teilnehmer können sich auch von der DiscoverEU
Kultur Route inspirieren lassen, einer
Initiative des Europäischen Jahres der Jugend
2022, die verschiedene Ziele mit Schwerpunkt auf
Architektur, Musik, bildender Kunst, Theater,
Mode und Design miteinander verbindet.
•
Eine weitere Möglichkeit ist eine Reise
zu den Kulturhauptstädten
Europas, den Stätten auf der UNESCO-Liste
des Weltkulturerbes oder mit dem Europäischen
Kulturerbe-Siegel oder in Städte, die mit
dem Access
City Award ausgezeichnet wurden. Gute
Vorbereitung und Vernetzung Zusätzlich zum
kostenlosen Reisepass erhalten die Teilnehmer
eine Rabattkarte mit
über 40.000 Angeboten für öffentliche
Verkehrsmittel, Kultur, Unterkunft, Essen, Sport
und andere Dienstleistungen.
Darüber
hinaus organisieren die nationalen
Erasmus+ Agenturen vor der Abreise
Informationstreffen und DiscoverEU
Meet-ups, Lernprogramme, die ein bis drei
Tage dauern. Das Jugendinformationsnetzwerk
Eurodesk beantwortet in Deutschland alle Fragen
zu DiscoverEU.
Grüne
Oasen im urbanen Raum: Ministerin Gorißen ruft
Landeswettbewerb für Kleingartenanlagen in
Nordrhein-Westfalen aus
Der
Wettbewerb lädt Städte, Gemeinden und ihre
Kleingarten-Organisationen ein, ihre kreativen
und nachhaltigen Ideen rund um die Gestaltung
und Nutzung von Kleingärten zu präsentieren
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Gärtnern liegt weiterhin im Trend: Viele
Menschen bearbeiten gerne Beete auf der eigenen
Parzelle oder schließen sich einem öffentlichen
Gartenprojekt an. Der Reiz dabei ist das
entschleunigende Arbeiten in der Natur und die
Aussicht, selbst angebautes Obst oder Gemüse
ernten zu können. In Nordrhein-Westfalen hat das
urbane Gärtnern eine lange Tradition, die sich
bis heute fortsetzt – der Kleingarten ist immer
noch die häufigste Form des Gartenlebens in der
Stadt. Zudem sind Kleingärten wichtige, grüne
Orte der Erholung. Das Ministerium für
Landwirtschaft und Verbraucherschutz unterstützt
daher das Kleingartenwesen und ruft dazu auf, ab
Mittwoch, 1. Januar 2025, am
nordrhein-westfälischen Landeswettbewerb für
Kleingartenanlagen teilzunehmen.
Ministerin für Landwirtschaft und
Verbraucherschutz Silke Gorißen: „Kleingärten
sind grüne Oasen in unseren Städten, die Räume
für Freizeit und Erholung bieten – hier finden
Mensch und Natur zusammen. In den dicht
besiedelten Gebieten leisten Kleingärten zudem
einen wertvollen Beitrag für den Schutz der
Natur. Wir wollen die besten Kleingartenprojekte
Nordrhein-Westfalens entdecken und sichtbar
machen, die über das normale Gärtnern hinaus
Beiträge zu spürbar mehr Lebens- und
Aufenthaltsqualität vor Ort leisten. Ich lade
herzlich dazu ein, sich am Landeswettbewerb zu
beteiligen und freue mich auf zahlreiche
Bewerbungen.“

Pixabay
Aufruf an Kommunen und ihre
kleingärtnerischen Organisationen
Alle
Städte, Gemeinden und Kleingarten-Organisationen
in Nordrhein-Westfalen sind dazu aufgerufen,
ihre Kleingartenanlagen vorzustellen, die von
vorbildlicher städtebaulicher, ökologischer und
sozialer Bedeutung sind. Zugelassen sind alle
Kleingartenanlagen,
die nach 2012 an
keinem Landes- bzw. Bundeswettbewerb
teilgenommen haben,
die von vorbildlicher
städtebaulicher, ökologischer und sozialer
Bedeutung sind,
deren Vereine beispielhafte
ökologische, soziale und kulturelle Leistungen
für die Bürgerinnen und Bürger ihrer Stadt
vollbringen.
Die Wettbewerbsunterlagen müssen
bis spätestens Montag, 31. März 2025, über das
Portal Beteiligung NRW eingereicht werden. Je
Kommune sind bis zu zwei Bewerbungen möglich.
Wettbewerbsablauf und Bundeswettbewerb
Anhand der eingereichten Bewerbungen wird eine
Landesbewertungskommission im Juni/Juli 2025
eine Auswahl von Wettbewerbern vor Ort
besichtigen. Anschließend gibt die Kommission
eine Empfehlung zur Auszeichnung ab.
Voraussichtlich im Herbst 2025 werden dann die
Preisträger durch Landwirtschaftsministerin
Silke Gorißen im Rahmen einer
Abschlussveranstaltung bekannt gegeben und
ausgezeichnet.
Der Landeswettbewerb dient
zugleich als Auswahlverfahren für die Teilnahme
am 26. Bundeswettbewerb „Gärten im Städtebau“,
der die städtebauliche, ökologische und soziale
Bedeutung des Kleingartenwesens bundesweit
würdigt. Bei erfolgreicher Teilnahme am
vorangegangenen Landeswettbewerb erfolgt die
Anmeldung zum Bundeswettbewerb durch das
Ministerium für Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen.
Mit dem Wettbewerb
leistet die Landesregierung einen weiteren
Beitrag zu der in der Landesverfassung
festgeschriebenen Förderung des
Kleingartenwesens in Nordrhein-Westfalen. Der
Wettbewerb findet bereits zum zehnten Mal statt.
Online-Teilnahme und weitere Informationen:
Kleingartenwettbewerb 2025
GOVSATCOM Hub stärkt Raumfahrtstandort
Nordrhein-Westfalen
Die
Entscheidung der EU-Kommission, einen GOVSATCOM
Hub des EU- Programms IRIS² (Infrastructure for
Resilience, Interconnectivity and Security by
Satellites) am Standort Köln anzusiedeln,
markiert einen Meilenstein für die Raumfahrt in
Nordrhein-Westfalen. Mit dem Hub wird nicht nur
ein zentraler Baustein für Europas sichere
Satellitenkommunikation geschaffen, sondern auch
die strategische Bedeutung des
Raumfahrtstandortes Köln weiter ausgebaut.

Der GOVSATCOM Hub dient als
hochsicherer Netzwerkknoten, über den
satellitengestützte Kommunikationsdienste für
sicherheitskritische Anwendungen bereitgestellt
und gesteuert werden. Er ermöglicht
beispielsweise Behörden, Katastrophenschutz und
anderen öffentlichen Institutionen eine
resiliente und störungsfreie Kommunikation –
auch in Krisensituationen. Ministerpräsident
Hendrik Wüst: „Dass die Entscheidung für das
GOVSATCOM Hub auf Köln gefallen ist,
unterstreicht ein weiteres Mal die herausragende
Bedeutung Nordrhein-Westfalens als zentraler
Standort für Luft- und Raumfahrt in Europa.
In diesem Jahr haben wir bereits das
einzigartige Trainings- und Technologiezentrum
LUNA in Köln eröffnet. Jetzt folgt die
Beteiligung am IRIS²-Programm zur
Satellitenkommunikation der Europäischen Union.
Beides zeigt: Der Weg in den Weltraum führt über
Nordrhein-Westfalen. Mit dieser Investition in
das GOVSATCOM Hub schaffen wir eine sichere
Kommunikationsinfrastruktur und legen den
Grundstein für einen zusätzlichen
Innovationsstandort, von dem die gesamte Region
nachhaltig profitiert.
Insbesondere
Köln wird als Knotenpunkt für Weltraumforschung
gestärkt und leistet einen wesentlichen Beitrag
zur Weiterentwicklung technologischer
Innovationen.“ Wirtschafts- und
Klimaschutzministerin Mona Neubaur: „Der
Standort Köln entwickelt sich Schritt für
Schritt zum führenden Kompetenzzentrum für
Raumfahrt und Zukunftstechnologien in Europa.
Hier finden Spitzenforscherinnen und -forscher
attraktive Bedingungen und eine strategische
günstige Lage, die eine intensive internationale
Zusammenarbeit über Forschungsbereiche hinweg
ermöglicht.
Der GOVSATCOM Hub wird
als Schnittstelle für sichere und schnelle
Kommunikationssysteme einen wichtigen Beitrag zu
mehr Resilienz und Souveränität in Europa
leisten und die Grundlagen für neue
Technologie-Anwendungen schaffen. Das zeigt: Wir
haben in Nordrhein-Westfalen das Wissen und die
Fähigkeiten, mit wegweisenden Innovationen
Zukunft zu gestalten. Gemeinsam mit unseren
Partnern vor Ort werden wir die Entwicklung der
Weltraumforschung in Köln weiter nach Kräften
unterstützen.“
Der Standort Köln,
Heimat des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR) sowie zahlreicher
internationaler Partner wie der Europäischen
Weltraumorganisation (ESA), bietet mit seiner
einzigartigen Infrastruktur ideale
Voraussetzungen für die Integration des
GOVSATCOM Hubs. Zuletzt hat die Landesregierung
den Standort mit der Förderung der LUNA-Halle
zur Simulation von Mondmissionen vorangetrieben.
Der GOVSATCOM Hub wird nicht nur die
bestehende Infrastruktur erweitern, sondern auch
als Katalysator für weitere Ansiedlungen in der
Raumfahrt- und Hightech-Branche dienen. Die
Landesregierung hat aktiv dazu beigetragen, den
GOVSATCOM Hub nach Nordrhein-Westfalen zu holen.
Mit der Zusage, die Ausgaben für die Errichtung
eines Gebäudes am Standort bis zu einer Höhe von
maximal 50 Millionen Euro zu übernehmen, hat das
Land entscheidend zum Erfolg der Bewerbung
beigetragen.
Die laufenden
Betriebskosten werden von der EU-Kommission
getragen. Die Landesregierung wird weiterhin eng
mit dem Bund, der EU und den beteiligten
Partnern zusammenarbeiten, um den GOVSATCOM Hub
erfolgreich in die bestehenden Strukturen
einzubinden und die langfristige Entwicklung des
Raumfahrtstandorts Köln zu sichern.
Zahl der schweinehaltenden Betriebe
sinkt weiter: -3,4 % im November 2024 gegenüber
dem Vorjahr
• Zahl
schweinehaltender Betriebe innerhalb eines
Jahres um 3,4 % oder 600 Betriebe gesunken, im
Zehnjahresvergleich um 41,7 % oder 11 200
Betriebe
• Schweinebestand im Vergleich zum
Vorjahr nahezu konstant, im Zehnjahresvergleich
um 25,2 % niedriger
• Trend zu größeren
Betrieben hält an: Im November 2024 hielt ein
Betrieb im Schnitt 1 400 Schweine, zehn Jahre
zuvor waren es 1 100 Tiere pro Betrieb
Zum Stichtag 3. November 2024 gab es in
Deutschland 15 600 schweinehaltende Betriebe.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach
vorläufigen Ergebnissen der Viehbestandserhebung
mitteilt, nahm die Zahl der Betriebe damit im
Vergleich zum 3. Mai 2024 um 1,0 % (-200
Betriebe) und im Vergleich zum 3. November 2023
um 3,4 % (-600 Betriebe) ab. Im
Zehnjahresvergleich wird die rückläufige Tendenz
bei der Zahl der schweinehaltenden Betriebe noch
deutlicher: Seit 2014 ging die Zahl der Betriebe
um 41,7 % (-11 200 Betriebe) zurück
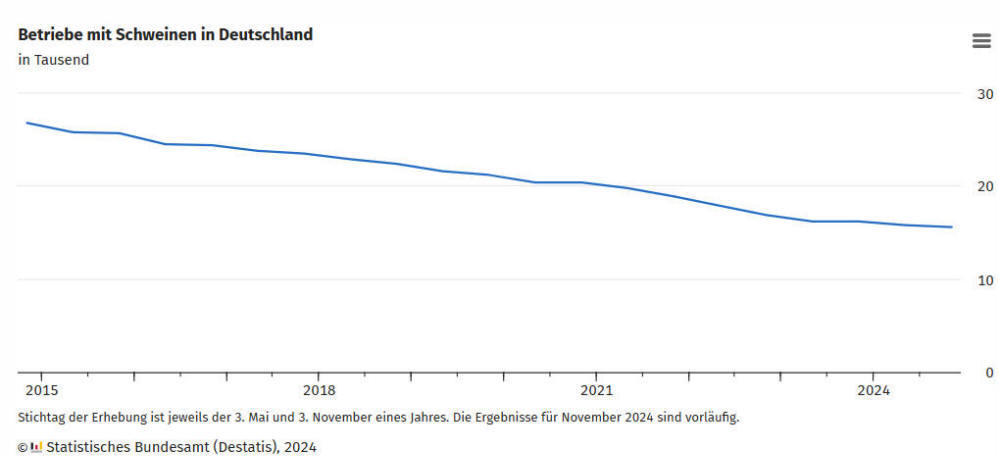
Betriebe halten durchschnittlich 300
Schweine mehr als vor zehn Jahren Die Zahl der
in Deutschland gehaltenen Schweine lag zum
Stichtag 3. November 2024 bei
21,2 Millionen Tieren. Damit blieb der Bestand
sowohl im Vergleich zum Stichtag 3. Mai 2024
(+10 100 Tiere) als auch gegenüber dem
Vorjahreszeitpunkt (-0,2 % oder -39 400 Tiere)
nahezu unverändert.
Verglichen mit
2014 ging der Schweinebestand allerdings um
25,2 % oder 7,2 Millionen Tiere zurück. Da die
Zahl der Betriebe in dem Zeitraum deutlich
stärker gesunken ist, hält die Entwicklung hin
zu größeren Betrieben weiter an: Während im Jahr
2014 ein Betrieb durchschnittlich 1 100 Schweine
hielt, waren es zehn Jahre später 1 400 Tiere
pro Betrieb.
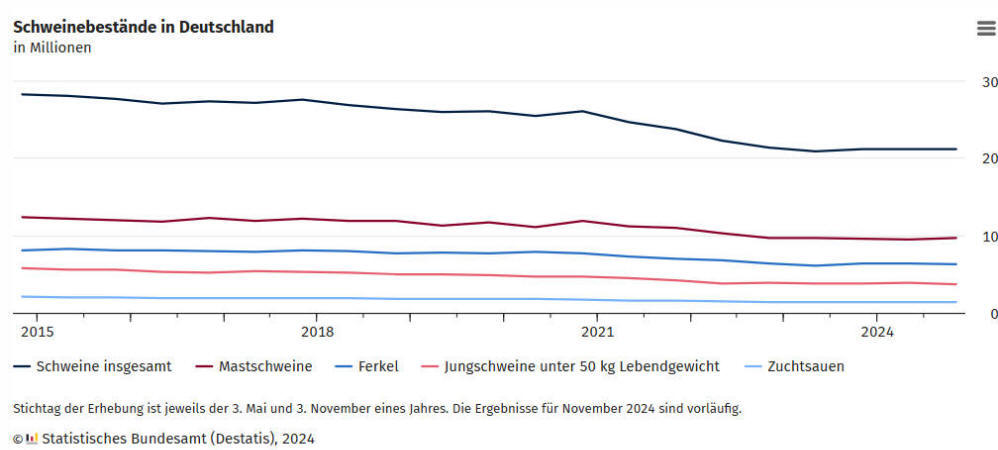
Für die einzelnen Kategorien der
Schweinehaltung ergibt sich folgendes Bild: Zum
Stichtag 3. November 2024 wurden in Deutschland
mit 9,7 Millionen Mastschweinen 3,0 % oder
282 900 Tiere mehr gehalten als ein halbes Jahr
zuvor. Die Zahl der Ferkel und der Jungschweine
hingegen verringerte sich um 2,5 % oder
254 700 Tiere und lag bei 10,0 Millionen. Die
Zahl der Zuchtsauen ging mit
1,4 Millionen gehaltenen Tieren gegenüber Mai
2024 um 1,3 % (-18 100 Tiere) zurück.
Rinder- und Milchkuhbestand verringert sich
weiter
Die Zahl der in Deutschland
gehaltenen Rinder ging zuletzt zurück. Zum
Stichtag 3. November 2024 hielten die Betriebe
in Deutschland 10,5 Millionen Rinder, darunter
3,6 Millionen Milchkühe. Das waren 1,6 % oder
165 500 Rinder und 2,1 % oder 78 900 Milchkühe
weniger als am 3. Mai 2024. Gegenüber November
2023 sank der Rinderbestand um 3,5 % (-374 900
Tiere) und gegenüber 2014 um 17,9 % (-2,3
Millionen Tiere).
Der
Milchkuhbestand reduzierte sich innerhalb eines
Jahres um 3,3 % (-123 400 Tiere) und im
Zehnjahresvergleich um 16,4 % (-706 200 Tiere).
Auch bei den Haltungen mit Milchkühen setzte
sich der langjährige rückläufige Trend fort.
Gegenüber Mai 2024 sank die Zahl der Haltungen
um 1,6 % (-800 Haltungen) auf 48 600, gegenüber
November 2023 ging sie um 3,8 %
(-1 900 Haltungen) zurück. Das waren 36,4 %
(-27 800 Haltungen) weniger Milchkuh-Haltungen
als noch im Jahr 2014.
Schafbestand
ebenfalls rückläufig
Zum 3. November 2024
hielten deutsche Betriebe insgesamt
1,5 Millionen Schafe und damit 3,4 % oder
53 200 Tiere weniger als ein Jahr zuvor (3.
November 2023). Im Zehnjahresvergleich nahm der
Bestand um 5,9 % oder 94 300 Tiere ab.
Montag, 30.
Dezember 2024
Freie Fahrt in
der Moerser Blücherstraße: Römerstraße wird zu
Beginn des nächsten Bauabschnitts der
Kanalsanierung rund drei Wochen vollgesperrt
Die Kanäle sind ausgetauscht, die Blücherstraße
hat zwischen den Bordsteinen eine neue Fahrbahn
und neue Parkflächen erhalten. Auch wenn erst im
Frühjahr die geplante Anpflanzung neuer Bäume
mehr grün bringt, so ist die durch Autofahrer
gerne genutzte Verbindung zur Planetensiedlung
wieder frei.
Brian Jäger kann als
zuständiger Bauüberwacher der ENNI Stadt &
Service Niederrhein (Enni) somit einen Haken an
den ersten von vier Bauabschnitten machen, in
denen die Römer- und mehrere angrenzende
Nebenstraßen bis 2026 neue Kanäle bekommen und
im Auftrag der Stadt Moers nach der
Blücherstraße später auch die Galgenbergsheide
eine neue Fahrbahn erhalten wird. Soweit es die
Witterung zulässt, wird Jäger ab dem 6. Januar
bereits den zweiten Bauabschnitt angehen.
„Dann werden wir im Abschnitt zwischen der
Blücher- und der Römerstraße 652 bis zum
Frühjahr den Mischwasserkanal austauschen.“
Zu Beginn dieses Abschnitts muss Enni die
Römerstraße bis Anfang Februar im Bereich der
Kreuzung zur Blücherstraße wegen der Lage des
Kanals in der Straßenmitte für rund drei Wochen
in beide Fahrrichtungen voll sperren. Während
dieser Phase wird Enni den Verkehr in Richtung
Moerser Norden über die Kirschenallee sowie die
Mosel-, Jahn- und Bismarckstraße umleiten.
Stadteinwärts müssen Autofahrer das Nadelöhr
über die Bismarck- und Donaustraße sowie die
Kirschenallee umfahren.
„Sind unsere
Arbeiten im Kreuzungsbereich erledigt, können
Autofahrer die Hauptverkehrsachse bis zum
dritten Bauabschnitt im Frühjahr aber auch
während unserer Arbeiten in beide Fahrrichtungen
befahren.“
Jäger hat wie bei
Großbaustellen üblich auch diese Maßnahme mit
dem zuständigen Fachbereich der Stadt Moers, der
Polizei, der Feuerwehr und auch der NIAG
abgestimmt, die während der Arbeiten auch Busse
umleiten und Haltestellen aufheben muss. Die
Anwohner der Römerstraße können ihre Häuser
jederzeit erreichen, Radfahrer und Fußgänger die
Baustelle passieren.
Voraussichtlich ab
Mai wird die Enni die Arbeiten in der
Römerstraße dann bis zum Germendonkskamp
fortsetzen. Für diesen und spätere Bauabschnitte
laufen derzeit noch die Planungen. Wer Fragen
hat, kann sich unter der Rufnummer 104-600 über
die Baumaßnahme informieren.
Keine Abendkasse
für das Neujahrskonzert - 1200 Gäste feiern in
Moers mit den Prager Philharmonikern den
Jahresstart
Das Neujahrskonzert bleibt in Moers auch dieses
Jahr das gesellschaftliche Highlight zum
Jahresbeginn. Am kommenden Mittwoch werden über
1.200 Besucher in der bis auf wenige
Einzelplätze ausverkauften Enni-Eventhalle mit
dem PRAGUE ROYAL PHILHARMONIC schwungvoll ins
neue Jahr starten. Wie der Veranstalter, ES
Event-Service Niederrhein, am Montag mitteilte,
wird es keine Abendkasse geben.
Noch
bis Mittwoch können Musikliebhaber jedoch noch
Tickets für die letzten acht verfügbaren
Einzelplätze online erwerben. Bereits zum
sechsten Mal treten die Prager Philharmoniker in
Moers auf und präsentieren diesmal ihr Programm
„Johann Strauss – Ein Künstlerleben“ erneut vor
einem ausverkauften Haus.
Das
Ensemble gehört mittlerweile fest zum
Kulturkalender der Region und lockt dabei
alljährlich auch zahlreiche Gäste von außerhalb
in die Grafenstadt. Moers hat sich längst als
eine der Top-Adressen für Neujahrskonzerte in
Deutschland etabliert. Der international
renommierte Chefdirigent Heiko Matthias Förster
und sein 65-köpfiges Orchester versprechen auch
in diesem Jahr ein musikalisches Feuerwerk.
Förster, der als charismatischer
Vermittler zwischen Bühne und Publikum gilt,
wird dabei Werke von Johann Strauss Sohn, dem
berühmtesten Vertreter der Strauss-Dynastie,
dessen 200. Geburtstag 2025 gefeiert wird,
spielen und gewohnt charmant und unterhaltsam
begleiten. . Kurzentschlossene können
Einzelplätze noch online unter
www.moerser-neujahrskonzert.de erwerben.
Böllern ohne Grenzen?
Was beim Feuerwerk in Europa wirklich zündet
Immer häufiger durchbrechen Knallgeräusche die
winterliche Stille – ein untrügliches Zeichen,
dass Silvester näher rückt. Doch nicht überall
in Europa hört sich das gleich an. Ob
Grenzbewohner oder Reisende:
- Was sollten
Sie wissen, wenn Sie zum Jahreswechsel eine
Ländergrenze passieren – ob mit oder ohne
Feuerwerkskörper?
- Was ist legal, was
nicht? Wie unterscheiden sich die Regelungen in
unseren Nachbarländern, und was muss man
beachten, wenn man den Jahreswechsel dort
feiert?

Feuerwerk in Europa: Was gilt beim Böllerkauf in
Polen und dem generellen Zünden im Ausland? Das
EVZ klärt auf. Bild: KI-generiert
Überraschende Fakten und wichtige Warnungen –
Juliane Beckmann, Juristin im Europäischen
Verbraucherzentrum (EVZ), hat Antworten.
Feuerwerk in Europa: Was gilt beim Böllerkauf in
Polen und dem generellen Zünden im Ausland? Das
EVZ klärt auf. Bild: KI-generiert
Hallo
Frau Beckmann, schön, dass Sie Zeit für uns
haben. Gibt es beim Feuerwerk in Europa
überhaupt eine Gemeinsamkeit?
Hallo, sehr
gerne! Eine Gemeinsamkeit gibt es tatsächlich –
die Kennzeichnung auf den Feuerwerkskörpern. Das
CE-Siegel und die Registrierungsnummer sind
europaweit vorgeschrieben. Diese auf der Ware
angebrachten Zeichen zeigen, dass grundlegende
Sicherheitsanforderungen erfüllt sind. Abgesehen
davon kocht aber jedes Land sein eigenes
Süppchen... In Deutschland dürfen klassische
Silvesterraketen beispielsweise nur an den drei
Tagen vor dem Jahreswechsel verkauft werden.
Fällt ein Sonntag in den Zeitraum, gibt’s einen
Extratag obendrauf. In Polen dagegen können Sie
diese Produkte das ganze Jahr über kaufen und
sogar im eigenen Garten – nicht aber im
öffentlichen Raum – abbrennen. Allerdings nur
zwischen 6 und 22 Uhr, abgesehen von Silvester
natürlich.
Wow, das sind ja wirklich
beeindruckende Unterschiede! Wenn ich mich recht
entsinne, gibt es in manchen Ländern je nach
Region nochmal unterschiedliche Regeln. Stimmt
das?
Ja, und wie! In Frankreich oder
Belgien regeln zum Beispiel die Kommunen selbst,
ob und wo Feuerwerk erlaubt ist. In manchen
Städten gibt es festgelegte Zonen, wo geknallt
werden darf, andernorts ist es komplett
verboten. Mein Rat: Informieren Sie sich vor
einer Reise unbedingt über die Regeln in der
Zielregion.
Gut zu wissen! Aber woher
kommen die Knaller, die wir hier schon Wochen
vor Silvester hören? Das können ja dann keine
frisch gekauften Artikel sein.
Das könnte
man meinen, stimmt aber nur bedingt. In
Deutschland dürfen Feuerwerkskörper im Laden
tatsächlich nur kurz vor Silvester verkauft
werden, aber es gibt eine Ausnahme: Der Import
aus dem Ausland ist das ganze Jahr über erlaubt
– sofern die gesetzlichen Bestimmungen
eingehalten werden.
Was meinen Sie mit
gesetzlichen Bestimmungen?
Zunächst
einmal die Gefahrenkategorien. In Deutschland
sind die Kategorien F1 und F2 für Personen ab 18
Jahren frei erhältlich. Die Kategorien F3 und
F4, die deutlich gefährlicher sind, dürfen nur
mit behördlicher Genehmigung gekauft und genutzt
werden. In Polen oder Tschechien aber sind
F3-Produkte ab 21 Jahren völlig frei
verkäuflich. Doch die Einfuhr solcher Artikel
nach Deutschland ist ohne Genehmigung verboten –
das regelt das Sprengstoffgesetz. Wer das
missachtet, riskiert Geld- oder sogar
Freiheitsstrafen und muss außerdem für die
fachgerechte Entsorgung der Feuerwerkskörper
aufkommen, wenn er erwischt wird.
Eine
weitere Bestimmung, die viele nicht kennen: Die
Sicherheitshinweise müssen in einer für Sie
verständlichen Sprache verfasst sein, wenn Sie
das Produkt nach Deutschland importieren
möchten. Sollten Sie die polnische oder
tschechische Aufschrift also nicht verstehen,
lassen Sie besser die Finger davon!
Und
zu guter Letzt: Es gibt Mengenbegrenzungen. Ein
bis unters Dach mit Knallkörpern gefülltes Auto
ist natürlich ein Sicherheitsrisiko für die
Insassen und andere. Wie viel man mitnehmen
darf, hängt in der Regel vom sogenannten
Nettoexplosivstoffgewicht ab, also der Menge an
Sprengstoff. Dabei gelten zwei Grenzwerte: Je
nach Produktart dürfen entweder maximal fünf
Kilogramm oder aber bis zu 50 Kilogramm
transportiert werden. Erkundigen Sie sich daher
vorher beim Zoll, falls Sie größere Mengen
mitnehmen möchten.
Das klingt
kompliziert. Und was ist mit dem Online-Kauf? Es
gibt einige deutschsprachige Shops aus Polen
oder Tschechien. Sind Bestellungen dort legal?
Das kann man pauschal nicht beantworten.
Fakt ist aber, dass man bei Bestellungen sehr
aufmerksam sein sollte. Onlineshops aus Polen
oder Tschechien bieten oft auch F3-Produkte an,
die in Deutschland verboten sind. Trotzdem
können auch die hierher bestellt werden.
Außerdem muss der Versand solcher Artikel
eigentlich als Gefahrgut erfolgen – was aber
meist nicht passiert. Das wirft Zweifel an der
Seriosität solcher Anbieter auf. Eine
deutschsprachige Website bedeutet also noch
lange nicht, dass alles gesetzeskonform ist.
Was raten Sie Menschen, die im europäischen
Ausland Feuerwerk kaufen oder nutzen möchten?
Wenn Sie den Jahreswechsel im EU-Ausland
verbringen, informieren Sie sich unbedingt
vorab, ob das Zünden von Feuerwerk dort erlaubt
ist – denken Sie daran, dass auch regionale oder
kommunale Regelungen gelten können. Ist das
Knallen erlaubt, kaufen Sie ausschließlich in
seriösen Geschäften. Auf Straßenmärkten kann man
nämlich leicht an aus Fernost importierte oder
andere Feuerwerkskörper ohne Zulassung geraten.
Achten Sie deshalb auf eine gültige
Kennzeichnung wie das CE-Siegel und die
Registrierungsnummer. Im Idealfall sind auch
Hinweise auf Deutsch oder in einer anderen
Sprache, die Sie beherrschen, auf dem Produkt.
Diese Tipps gelten grundsätzlich für den
Feuerwerkskauf im Ausland. Weitere hilfreiche
Informationen finden Sie auf der Website der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM). So vermeiden Sie Ärger, vermeidbare
Kosten und vor allem unnötige Gefahren.
Vielen Dank, Frau Beckmann! Haben Sie noch einen
letzten Tipp für unsere Leserinnen und Leser?
Ja. Egal, wo Sie Ihr Silvesterfest feiern –
kommen Sie gut ins Neue Jahr… und verbrennen Sie
sich nicht die Finger!
Gewusst wie: Silvesterfeuerwerk richtig zünden
Wenn beim Feuerwerk etwas
schiefgeht: Welche Versicherung zahlt?
Auch wenn es in einigen Städten
Zonen gibt, in denen Böller oder Raketen
verboten sind, viele Menschen werden das neue
Jahr trotzdem traditionell mit einem Feuerwerk
begrüßen. Damit es nicht in der Notaufnahme
eines Krankenhauses oder mit erheblichem
Sachschaden beginnt, rät die HUK-COBURG nur
Feuerwerkskörper zu verwenden, die von
unabhängigen Prüfanstalten getestet wurden.
Natürlich müssen Feuerwerkskörper in
einwandfreiem Zustand und unbeschädigt sein.
Lässt sich eine Rakete oder ein Böller
nicht gleich zünden, weg damit! Geprüfte und
zugelassene Feuerwerkskörper tragen eine
vierstellige Registriernummer und ein CE-Zeichen
mit der Kennnummer der Prüfstelle. Der Aufdruck
verrät zudem, wer mit den Feuerwerkskörpern
hantieren darf: Kategorie F2 darf nur zu
Silvester und nur von volljährigen Personen
abgebrannt werden.
•
Feuerwerkskörper der Kategorie F1 - zum Beispiel
Knallbonbons oder Wunderkerzen - können
Jugendliche ab zwölf Jahren allein verwenden.
Ganz wichtig: Vor dem Abschuss von
Feuerwerkskörpern immer die Gebrauchsanweisung
lesen und auf einen ausreichenden
Sicherheitsabstand zum nächsten Menschen
achten.
Wer selbst alles richtig
macht, ist noch lange nicht vor Fehlern Dritter
gefeit. Immer wieder beschädigen Raketen und
Böller in der Silvesternacht parkende Autos. Wer
schuldhaft einen Schaden verursacht, muss in der
Regel haften. Tatsächlich kennen
Autobesitzer:innen den Schuldigen aber eher
selten. Haben er oder sie eine
Teilkasko-Versicherung, können sie den Schaden
melden und regulieren lassen. Selbst wenn ein
Verursacher feststeht, ist dieser Weg gangbar.
•
Natürlich
holt sich die Versicherung das Geld nach der
Regulierung von der Schädigerin oder dem
Schädiger zurück. Zu den typischen Schäden einer
Silvester-Nacht zählen zudem Raketen, die durch
offene Fenster oder Dachluken fliegen. Wenn sich
daraus ein Brand entwickelt, der das Gebäude
oder den Hausrat beschädigt, ist dies ein Fall
für Wohngebäude- und Hausratversicherung.
In
der Regel lassen sich solche Schäden leicht
vermeiden, wenn Fenster und Dachluken
verschlossen sind.
•
Weitaus
schlimmer, in der Silvesternacht aber leider
nicht selten: Ein verirrter Kracher verletzt
jemanden ernsthaft – zum Beispiel an den Augen –
ein dauerhafter Schaden bleibt zurück. Niemand
weiß, wer den Kracher abgeschossen hat. Der oder
die Verletzte kann also niemanden in die Pflicht
nehmen. Dann bleiben er oder sie auf ihren
Schadenersatzansprüchen sitzen. Hier hilft eine
private Unfallversicherung. Sie fragt nicht nach
dem Verursacher.
•
Worüber kaum
jemand nachdenkt: Selbst, wenn der Zünder eines
Böllers bekannt ist, können Opfer leer ausgehen.
Ohne private Haftpflichtversicherung müssen sie
aus der eigenen Tasche entschädigt werden. Bei
schweren Unfällen ist das eine Verpflichtung,
die Privatleute häufig nicht erfüllen können.
Auch hier hilft Unfallopfern eine private
Unfallversicherung. Sie zahlt unabhängig von
anderen Versicherungen wie zum Beispiel einer
privaten Haftpflichtversicherung.

Damit das Jahr gut beginnt: Silvesterfeuerwerk
richtig zünden. Foto: HUK-COBURG
Wesel:
Jahresausblick 2025
2024: Dass Wesel
Partnerschaften pflegt, ist bekannt. So feierte
die Stadt gemeinsam mit der britischen Stadt
Felixstowe das 50-jährige Jubiläum der
Städtepartnerschaft. Unter anderem wurden
symbolisch fünf Bäume vor der Zitadelle
gepflanzt. Zudem ist im Rahmen der
Jubiläumsfeier in Wesel an einer Hausfassade an
der Brandstraße/Ecke Tückingstraße dank der
großzügigen Unterstützung der Jubiläumsstiftung
Verbands-Sparkasse Wesel ein künstlerisch
hochwertiges Wandbild entstanden.

Während der Krieg in der Ukraine fortgesetzt
wird, hat die Stadt Wesel gemeinsam mit hiesigen
Unternehmen einen weiteren Hilfstransport mit
medizinischem Equipment sowie Spielgeräten für
Samar organisiert. Zudem konnte dank der
Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) ein umgebauter,
barrierefreier Minibus beschafft werden. Dieser
wird zeitnah nach Samar überführt.
Positiv hervorzuheben
ist, dass im Sommer 2024 Kinder und Jugendliche
aus Samar an einer Ferienfreizeit in Wesel
teilgenommen haben. Zwei Wochen lang erholten
sich die Kinder vom Krieg in ihrer Heimat. Dabei
lernten sie deutsche Freunde kennen. Zudem wurde
Anfang 2024 im Weseler Rathaus eine Ausstellung
zu Samar eröffnet.
Auch im Zusammenleben
innerhalb der Stadt ist eine Menge geschehen.
Der Integrationsrat hat mit einem tollen bunten
Festakt sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Der
Jugendrat hat mit Beteiligungsangeboten und
Veranstaltungen auf sich und die Belange junger
Menschen aufmerksam gemacht. Neben dem
Integrationsrat und Jugendrat der Stadt Wesel
hat erfolgreich ein drittes wichtiges
Bürgergremium seine Arbeit aufgenommen: der
Inklusionsrat. Hochmotiviert haben die
Mitglieder in ihrer konstituierenden Sitzung
festgelegt, sich gemeinsam mit
gesellschaftlichen und institutionellen Akteuren
für die Belange von Menschen mit
Beeinträchtigungen stark zu machen.
Neben den guten
Beziehungen zu den Partnern der Stadt Wesel und
dem bürgerschaftlichen Engagement ist es
gelungen, die Herausforderungen der Zeit zu
meistern und zugleich auch geplante Bauprojekte
voranzutreiben oder sogar erfolgreich
abzuschließen. So ist unter anderem die
Retentionsfläche an der Rheinpromenade
fertiggestellt worden. Stadtfeste und andere
größere Veranstaltungen können dort durchgeführt
werden. Zum Beispiel findet dort 2025 die große,
beliebte Esel-ordenverleihung statt.
Animierter
Planungsentwurf des neuen Kombibads am Rhein -
Blick auf die Saunawiese
2025 – Projekte,
Vorhaben in der Stadt Wesel
Das Kombibad Wesel
zählt zu den bedeutendsten Bauprojekten in
Wesel. Wer sich von dem Baufortschritt ein Bild
machen möchte, kann die Baustelle in den letzten
Zügen beobachten. Nach dem Feinschliff im
„Innenleben“ des Bads soll die Eröffnung im
nächsten Jahr stattfinden.
Wie in den
Vorjahren werden große Summen in die städtischen
Immobilien investiert. Vor allem in das Schulbauprogramm
fließen mehrere Millionen Euro. Unter
anderem beginnt 2025 ein Planungsbüro mit den
Arbeiten an der Ida-Noddack Gesamtschule. Noch
im Laufe des Jahres 2025 wird dem Rat die
konkrete Planung zur Beratung vorgelegt. Auch an
anderen Standorten werden die Arbeiten
aufgenommen.

So werden derzeit Ausschreibungen für die Baumaßnahmen an den
Gemeinschaftsgrundschulen Feldmark und Quadenweg
sowie für den 2. Standort der Innenstadt
Grundschule vorbereitet. Die drei Maßnahmen
zusammen umfassen ein Investitionsvolumen von
über 60 Millionen Euro.
Auch im
Bereich der Kinderbetreuung investiert die Stadt
Wesel erneut mehrere Millionen Euro. Mit dem Neubau
einer Kindertageseinrichtung Am Feldtor entstehen
sechs neue Gruppen, um den steigenden Bedarf an
Kita-Plätzen gerecht zu werden (8 Millionen
Euro). Darüber hinaus werden die Einrichtungen
an der Delogstraße und im Hessenviertel
erweitert (zusammen 3,4 Millionen Euro).
Neu ist, dass auch die
Kindertageseinrichtungen Lutherhaus erweitert
wird.

Die Ausbau-Initiative
im Bereich der Kindertageseinrichtungen ist
ein Ausdruck der wachsenden Bevölkerung der
Stadt Wesel. Es ziehen nicht nur mehr Familien
nach Wesel, sondern durch die gestiegene
Lebensqualität werden die Menschen in der
Hansestadt Wesel statistisch älter.
Über 35
Personen im Stadtgebiet werden 2025
voraussichtlich 100 Jahre und älter sein.
Auch deshalb ist es wichtig, dass die Stadt
Wesel weiterhin den Bau von Seniorenheimen
unterstützend begleitet.
Darüber hinaus wird
viel Geld in das schulische Umfeld und Inventar
investiert. Zum Beispiel erhalten alle Schulen
Defibrillatoren.
Auch
Kultureinrichtungen profitieren von
zahlreichen Modernisierungsmaßamen. Das Städtische
Bühnenhaus wird mit neuer Ton- und
Lichttechnik für fast 30.000 Euro ausgestattet.
Dadurch werden nicht nur die Veranstaltungen in
ein besseres Licht gerückt, sondern durch den
Einsatz von modernen LED werden Energiekosten
weiter gesenkt.

Um die Stadtgeschichte
besser als bisher an die Bedingungen der
digitalen Welt anzupassen, wird ein neuer moderner
Archivscanner im Stadtarchiv angeschafft.
Das 20.000 Euro teure Gerät erstellt wichtige
Digitalisate. So kann die Weseler Geschichte,
das Weseler Stadtarchiv an wichtige zugängliche
Archivportale angedockt werden. Das sichert
Kulturgut und bietet die Möglichkeit, an Quellen
der Stadtgeschichte heranzukommen, die bislang
aus den Tiefen des Archivs geholt werden
mussten.
Neben den
städtischen Immobilien legt die Stadt Wesel
besonderen Wert darauf, die städtischen Straßen
auf Vordermann zu bekommen. Erst kürzlich wurden
die Straßenarbeiten an der Pastor-Janßen-Straße
und dem Kaldenberg erfolgreich beendet. 2025
werden auch die Ritterstraße und Flesgentor abgeschlossen
sein.
Die Neugestaltung
weiterer Straßen wird zum Beschluss im nächsten
Jahr in den Rat gegeben. Unter anderem sind Baubeschlüsse geplant
für die Hafenstraße, die Grünstraße und die
Straße Am Nordglacis. Voraussetzung sind
Fördermittel.
Um in Zukunft
Verkehrsströme besser planen zu können, wird –
unter der Voraussetzung, dass europäische
Fördermittel fließen – ein digitaler Zwilling der
Stadt Wesel erstellt. Mit den visualisierten
Daten lassen sich Veränderungen und vor allem
die Auswirkungen simulieren. Zudem können Daten
besser und zielgenauer erhoben und in einem
Zusammenhang gesetzt werden.
Um in
Zukunft Verkehrsströme besser planen zu können,
wird – unter der Voraussetzung, dass europäische
Fördermittel fließen – ein digitaler Zwilling der
Stadt Wesel erstellt. Mit den visualisierten
Daten lassen sich Veränderungen und vor allem
die Auswirkungen simulieren. Zudem können Daten
besser und zielgenauer erhoben und in einem
Zusammenhang gesetzt werden.

Bereits seit Jahren ein adäquates Mittel, um das
Stadtklima zu verbessern und die Hitze-Resilienz
zu steigern, ist das Anlegen von neuen
Grünflächen. Die Stadt Wesel hat 2024 weitere
Flächen entsiegelt (u. a. ehemalige
Rollschuhbahn) und begonnen, diese ökologisch
(Biodiversität) aufzuwerten, zum Beispiel mit Bürgergärten (Büderich)
oder Pico-Parks (z. B.
Hugo-Becker-Straße).
Bei sämtlichen
Baumaßnahmen, vor allem im Straßenbau, werden
die Hinweise der AG Baumpflanzung berücksichtigt.
Die Arbeitsgruppe berät, welche Bäume sich bei
Hitze und Extremwetterereignisse wie Starkregen
eignen. Dort, wo möglich, versucht die Stadt
Wesel mehr neue Bäume zu pflanzen.
Ein
weiterer Ansatz, einen Beitrag zur
Klimaneutralität zu leisten, ist der Ausbau von
PV-Anlagen. Neben innovativen Projekten wie dem
PV-Caport an der Gesamtschule Am Lauerhaas
entsteht derzeit auf einer Fläche Am Fänger
eine Freiflächenphotovoltaikanlage durch die
in 2023 gegründete Stadtwerke Wesel Service und
Energie. Weitere PV-Anlagen sind auf den Dächern
der Polderdorfschule, der
Konrad-Duden-Grundschule und dem AVG geplant.

v. l. : Dezernent Dr. Markus Postulka,
Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, Thorsten Hummel
(Fachbereichsleiter Gebäudeservice) und
Christopher Kloß (Klimaschutzmanager)
Darüber hinaus werden fast 500.000 Euro in
die Umrüstung von Straßenlaternen auf
LED-Technik investiert. So lässt sich
Energie sparen. Das schont die Umwelt und den
städtischen Haushalt.
Eine weitere
Änderung ergibt sich im Standesamt. Da
die Dienstleistungen stark nachgefragt sind,
verbleibt ein Teil im Erdgeschoss des
Rathauses. Dadurch können Prozesse
beschleunigt werden.
Die Neugestaltung
des Auebereichs hin zu einem modernen Freizeit-
und Naherholungsraum nimmt immer weitere Züge
an. Nachdem bereits die Minigolf-Anlage
fertiggestellt wurde, wird 2025 die neue Trendsportanlage
am Auesee fertiggestellt. Die Anlage umfasst
einen Calisthenics-Teil, einen Boulder-Bereich
sowie ein Multifunktionsspielfeld mit
Basketballkörben und Fußballtoren. Der Baustart
einer Skate- und Bikeanlage im Auebereich
erfolgt ebenfalls in 2025. Das neue
Multifunktionsgebäude soll auch in 2025
fertiggestellt werden.

Für 2025 sind zudem
erneut Investitionen in Spielplätze (im
sechsstelligen Bereich) geplant. Auch in die Sport-Infrastruktur wird
investiert. Neben den Arbeiten in mehreren
Turnhallen werden u. a. zahlreiche Zäune für
mehrere hunderttausend Euro für die Zukunft fit
gemacht.
Doch um all das zu
planen und umzusetzen, braucht es Mitarbeitende.
Neben den städtischen Projekten kommen fast
jedes Jahr neue Aufgaben dazu. Zum Beispiel wird
mit der Gesetzesänderung im Bereich des
Wohngelds+ ab 01.01.2025 der Kreis der
Berechtigten angehoben. Solche Anstiege spüren
die Mitarbeitenden. Gleichzeitig besteht ein
enormer Fachkräftemangel im Öffentlichen
Dienst. Die Stadt Wesel konnte bisher noch
erfolgreich junge Menschen für eine Ausbildung bei
der Verwaltung gewinnen. Durch den eigenen
„Nachwuchs“ konnten entstandene Lücken
(größtenteils durch Erreichen der Altersgrenze)
zum Teil kompensiert werden.
Nach
wie vor kann die Stadtverwaltung viele
Dienstleistungen vergleichsweise zügig
bearbeiten. Längst sind vielerorts die
Meldestellen nur eingeschränkt bzw. nur mit
vorheriger Terminabsprache erreichbar – anders
in Wesel. Die Stadtverwaltung wird weiterhin
ihr freies, flexibles Angebot für Bürgerinnen
und Bürger aufrechterhalten. Dazu zählt auch,
dass die Stadtverwaltung auch zwischen den
Jahren geöffnet hat.
Erfreulich
ist, dass fast 150 Dienste auch online
abgewickelt werden können. Im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes
(OZG) bietet die Stadtverwaltung Wesel
zahlreiche Dienstleistungen digital an. Erneut
kommen digitale Dienstleistungen ins Portfolio
dazu. Bürgerinnen und Bürger können zum Beispiel
ab 2025 Bewohnerparkausweise oder den
Fischereischein digital beantragen.
Im Bereich des Rettungswesens wird es 2025
wieder laut: weitere 230.000 Euro werden in
moderne Sirenentechnik investiert. Im
Zweifelsfall können so flächendeckend weit über
90 Prozent der Bevölkerung unabhängig vom
Stromnetz gewarnt werden.

Besonders erfreulich ist, dass die Ausschreibung
zur neuen Feuer- und Rettungswache auf
dem Markt ist. Mit gleich acht zusätzlichen
Auszubildenden in 2025 rüstet sich die Weseler
Feuerwehr gegen den Fachkräftemangel.
Durch die gestiegenen Herausforderungen und vor
allem durch die angewachsene Aufgabenpalette der
Kommunen, die der Bund und das Land beschlossen
haben, sind die städtischen Ausgaben gestiegen.
Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt
unverändert (370 %).
Im Bereich der
Grundsteuer B werden differenzierte Hebesätze
eingeführt. Für Wohngebäude ergibt sich ein Satz
von 782%. Für Nichtwohngebäude beträgt der Satz
1.353%. Die Gewerbesteuer bleibt auf 468 %
unverändert.
Auch die Hundesteuer
(ein Hund 94 Euro pro Jahr) bleibt unverändert.
Die Abwassergebühr wird
moderat in 2025 steigen. So zahlen Haushalte
2025 für Schmutzwasser 3,57 Euro pro Kubikmeter
(zuvor 3,41 Euro). Die Gebühren für
Niederschlagswasser steigt ebenfalls – 2025 1,19
Euro pro Kubikmeter (vorher 1,11 Euro pro
Kubikmeter).
Im Bereich der
Abfallentsorgung ist eine Gebührenerhöhung in
Höhe von 5 Prozent unumgänglich. Auch die
Friedhofsgebühren werden um 5 Prozent steigen,
wohingegen die Gebühren im Bereich der
Straßenreinigung und des Winterdienstes konstant
gehalten werden konnten
Bebauungsplan Nr. 232 “Rhein-Lippe-Hafen
– Süd“ der Stadt Wesel für nachstehend
abgebildeten Geltungsbereich im Ortsteil
Wesel-Lippedorf
Der Rat der Stadt
Wesel beschloss am 10.12.2024 den Bebauungsplan
Nr. 232 “Rhein-Lippe-Hafen-Süd“ gemäß § 10
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), in
Verbindung mit § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444),
als Satzung.
Bekanntmachungsanordnung
Der
Beschluss des Bebauungsplans Nr. 232
“Rhein-Lippe-Hafen – Süd“ der Stadt Wesel als
Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
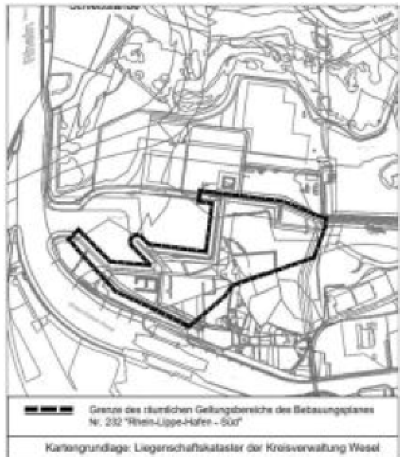
Hinweise:
1. Der räumliche Geltungsbereich
des Bebauungsplans Nr. 232 “Rhein-Lippe-Hafen –
Süd“ ist aus der Karte ersichtlich, die im Kopf
dieser Bekanntmachung abgedruckt ist.
Der
Eingriff im Plangebiet kann nicht vollständig
ausgeglichen werden, daher ist eine externe
Kompensation in Höhe von 888.350 ökologischen
Werteinheiten (ÖWE) erforderlich.
Dieses Kompensationserfordernis wird auf den
Flächen folgender Ökokonten durchgeführt:
•
"Lippemündungsraum": Gemarkung Wesel, Flur 68,
Flurstücke 17, 87, 88, 89, 90, 102, 103, 104,
105, 106; Gemarkung Wesel, Flur 69, Flurstücke
54 tlw. und 73 tlw. (341.470 ÖWE)
•
"Lipperandsee": Gemarkung Wesel, Flur 93,
Flurstücke 31 tlw. und 33 tlw. (163.276 ÖWE)
• "Lackhausen 1": Gemarkung Wesel, Flur 84,
Flurstück 38 tlw. sowie Gemarkung Lackhausen,
Flur 7, Flurstücke 34 tlw., 38 tlw. und 555 tlw.
(163.187 ÖWE)
• "Lackhausen 2": Gemarkung
Wesel, Flur 84, Flurstück 38 tlw. (122.201 ÖWE)
• "Kanonenberge" Gemarkung Wesel, Flur 11,
Flurstück 363 tlw. und Flur 80 Flurstück 158
tlw. (98.216 ÖWE) durchgeführt.
Durch
den Eingriff im Plangebiet wird ebenso ein
artenschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich.
Dieser Ausgleich wird auf den Flächen folgender
Ökokonten erbracht:
• WLM-Ö-02 "Lippedorf
Alter Bauernhof": Gemarkung Wesel, Flur 90,
Flurstücke 566 tlw., 622 tlw. und 660 tlw.
(Anbringen von Nisthilfen für Gartenrotschwanz,
Star und Waldkauz sowie Anbringen von
Fledermauskästen)
• WLM-Ö-04 "Lippedorf
Storchennest": Gemarkung Wesel, Flur 90,
Flurstücke 88, 95, 99 tlw., 218, 563 tlw., 622
tlw., 627 tlw., 692 tlw. und 693 tlw. (Anbringen
von Nisthilfen für Gartenrotschwanz, Star und
Waldkauz, Anpflanzung von Einzelbäumen sowie das
Anlegen von Krautsäumen)
• WLM-Ö-05
"Lippedorf Obstgarten": Gemarkung Wesel, Flur
90, Flurstücke 217 und 624 (Anbringen von
Nisthilfen für Gartenrotschwanz)
• WLM-Ö-06
"Lippedorf Wilder Garten": Gemarkung Wesel, Flur
90, Flurstücke 81 und 86 (Anbringen von
Nisthilfen für Steinkauz)
• WLM-Ö-08
"Lippedorf Wald und Brache": Gemarkung Wesel,
Flur 90, Flurstücke 107 tlw., 120, 122, 201,
336, 342 tlw., 371 tlw., 449-452, 468, 469, 696
tlw., 697 tlw., 698, 699 tlw. (Anbringen von
Nisthilfen für Gartenrotschwanz)
• WLM-Ö-11
"Lippeverlegung": Gemarkung Wesel, Flur 68,
Flurstück 107 tlw. (Optimierung von Lebensraum
Kreuzkröte)
• Gemarkung Büderich, Flur 41,
Flurstücke 1 tlw. und 2 tlw. (Schaffung von
Lebensräumen für Steinkauz)
• Gemarkung
Wesel, Flur 90, Flurstücke 225 tlw. und 304 tlw.
sowie Flur 69, Flurstück 50 tlw. (Verpflanzung
wertvoller Vegetationsbestände) vorgenommen.
Darüber hinaus wird ein
bodenschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich.
Dieser erfolgt auf den Flächen folgender
Ökokonten:
• "Lippemündungsraum": Gemarkung
Wesel, Flur 68, Flurstücke 17, 87, 88, 89, 90,
102, 103, 104, 105, 106 tlw. (195.842 m²)
•
WLM-Ö-10 "Wald 'Holzstraße'": Gemarkung Wesel,
Flur 92, Flurstücke 57, 58 tlw. und 73 tlw. (903
m²).
benso wird durch den Eingriff in das
Landschaftsbild ein entsprechender Ausgleich
erforderlich. Dieser wird auf der Fläche des
Ökokontos
• WLM-Ö-10 "Wald 'Holzstraße'":
Gemarkung Wesel, Flur 92, Flurstücke 71 tlw.,
72, 74 tlw. und 76 tlw. (6.902 m²)
vorgenommen.
2. Mit dieser Bekanntmachung
tritt der Bebauungsplans Nr. 232
“Rhein-Lippe-Hafen – Süd“ der Stadt Wesel in
Kraft.
Bekanntmachung der Stadt
Wesel: Gebühren für die Belegung der
Kommunalfriedhöfe
10. Satzung vom
11.12.2024 zur Änderung der Satzung über die
Erhebung von Gebühren für die Belegung der
Kommunalfriedhöfe der Stadt Wesel -
Friedhofsgebührensatzung – vom 19.12.2001
Aufgrund § 4 des Gesetzes über das Friedhofs-
und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG
NRW) vom 17.06.2003 (GV. NRW. S. 313), zuletzt
geändert durch Artikel 71 des Gesetzes vom
01.02.2022 (GV. NRW. S. 122), der §§ 7 und 8 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV.
NRW. S. 444), und der §§ 4, 5 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.
NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom
05.03.2024 (GV. NRW. S. 155)
hat der Rat
der Stadt Wesel in seiner Sitzung am 10.12.2024
folgende 10. Satzung zur Änderung der Satzung
über die Erhebung von Gebühren für die Belegung
der Kommunalfriedhöfe der Stadt Wesel –
Friedhofsgebührensatzung – vom 19.12.2001
beschlossen.
§ 1
§ 4
erhält folgende Fassung:
§ 4 Gebührentarif
A. Erwerb des Nutzungsrechtes incl. Räumung der
Grabstätte nach Ablauf der Nutzung
(Nutzungszeit für alle Gräberarten 25 Jahre)
Nr. Art des Grabes Betrag
1. Wahlgrab
1.425,00 €
2. Reihengrab für Verstorbene ab
vollendetem 5. Lebensjahr 802,00 €
3.
Reihengrab für Kinder bis zum vollendeten 5.
Lebensjahr * 166,00 €
4. Urnenwahlgrab
1.425,00 €
5. Urnenkolumbarium 2.425,00 €
6. Urnengrab (Baumbestattung) 1.650,00 €
7.
Franziskus Kolumbarium 2.825,00 €
B.
Benutzung des Friedhofgebäudes
1.
Leichenzelle
a) 1. – 5. Tag einschließlich
220,00 €
b) jeder weitere angefangene Tag
49,00 €
2. Kühlzelle
a) 1. - 5. Tag
einschließlich 320,00 €
b) jeder weitere
angefangene Tag 90,00 €
3. Aussegnungshalle
175,00 €
4. Friedhofskapelle Franziskus
Kolumbarium 175,00 €
5. Obduktionsraum 320,00
€
C. Bestattungsgebühren
(einschließlich
Öffnen und Schließen des Grabes)
Nr. Art
der Bestattung Betrag
1. Wahlgrab 690,00 €
2. Reihengrab für Verstorbene ab vollendetem 5.
Lebensjahr 540,00 €
3. Reihengrab für Kinder
bis zum vollendeten 5. Lebensjahr * 180,00 €
4. Urnengrab, Urnenkolumbarium, Urnengrab
(Baumbestattung) 172,00 €
D. Beisetzung auf
einem Aschenstreufeld
(einschl. Verstreuung,
Bereitstellung und Unterhaltung der Anlage)
je Urne 676,00 €
E. Verlängerung des
Nutzungsrechtes pro Verlängerungsjahr
(nur
bei Wahlgräbern möglich)
Nr. Art des
Grabes Betrag
1. Wahlgrab 57,00 €
2.
Urnengrab 57,00 €
3. Urnengrab
(Baumbestattung) 66,00 €
4. Urnenkolumbarium
97,00 €
5. Franziskus Kolumbarium 113,00 €
F. Ausgrabung und Umbettung
a) Ausgrabungen
ohne Wiederbeisetzung auf demselben Friedhof:
Nr. Art des Grabes Betrag
1. Wahlgrab /
Reihengrab für Verstorbene ab vollendetem 5.
Lebensjahr 2.310,00 €
2. Reihengrab für
Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr *
315,00 €
3. Urnengrab 252,00 €
b)
Umbettung auf demselben Friedhof
(ohne Kosten
für etwa notwendigen neuen Sarg)
Nr. Art
des Grabes Betrag
1. Wahlgrab/ Reihengrab für
Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr
2.940,00 €
2. Reihengrab für Kinder bis zum
vollendeten 5. Lebensjahr * 525,00 €
3.
Urnengrab 472,00 €
G.
Friedhofsunterhaltungsgebühr
Die Gebühr
wird einmalig je Bestattung bzw. Verstreuung
erhoben und dient der Unterhaltung der
allgemeinen Friedhofsinfrastruktur. 310,00 €
H. Sonstige Leistungen
1. Genehmigung zur
Aufstellung eines Grabmales (einschl.
Sicherheitskontrollen 116,00 €
2. Genehmigung
zur Aufstellung einer Grabplatte 44,00 €
3.
Bereitstellung einer Namensplatte einschl.
Auflegen (graviert mit Vor- und Zuname, Geburts-
und Todesjahr) 220,00 €
4.
Kammerverschlussplatte für die Grabstätte in
einem Urnenkolumbarium.
Die Kosten für die
Gestaltung der Platte trägt der
Nutzungsberechtigte.
(Die Gebühr beinhaltet
den Austausch mit der neutralen
Kammerverschlussplatte
nach der Gravur und
am Ende der Nutzungszeit) 220,00 €
5.
Kammerverschlussplatte Franziskus Kolumbarium
Erstbeschriftung der Kammerverschlussplatte
mit Ornament
Erstbeschriftung der
Kammerverschlussplatte ohne Ornament
Zweitbeschriftung der Kammerverschlussplatte
220,00 €
400,00 €
315,00 €
262,00 €
6. Grabpflege / Rasenpflege für 25 Jahre
a.
Wahlgrab / Reihengrab für Verstorbene ab
vollendetem 5. Lebensjahr
b. Reihengrab für
Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr * /
Urnengrab
Bei weniger als 25 Jahren
Pflegedauer wird je angefangenes Kalenderjahr
1/25 der Pflegegebühr erhoben.
925,00 €
462,50 €
7. Bescheinigung zur Vorlage beim
Krematorium 20,00 €
8. Gebühren für
außergewöhnliche und unvorhersehbare Arbeiten
werden
nach der Gebührensatzung der Stadt
Wesel über die Abrechnung von
Leistungen der
Grünflächen- und Straßenunterhaltung des ASG
(Abfall,
Straßen, Grünflächen; Betrieb für
kommunale Dienstleistungen der Stadt
Wesel)
in der jeweils gültigen Fassung erhoben.
*
einschl. Tot- und Fehlgeborene
§ 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am
01.01.2025 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende
Satzung/ortsrechtliche Bestimmung der Stadt
Wesel wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Eine Veröffentlichung erfolgt ebenfalls unter
www.wesel.de.
Es wird darauf hingewiesen,
dass eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim
Zustandekommen dieser
Satzung/Verordnung/Richtlinie nach Ablauf von
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt, diese Satzung/ortsrechtliche
Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekanntgemacht worden.
Einziehung von
Teilstücken der öffentlichen Verkehrsflächen
“Stralsunder Straße“ sowie “Rheinbabenstraße“ in
Wesel-Altstadt
Die Stadt Wesel
beabsichtigt nach Beschluss des Rates der Stadt
Wesel vom 10.12.2024 gemäß § 7 Abs. 2 des
Straßen- und Wegegesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen
Fassung (StrWG NRW) die folgenden öffentlichen
Verkehrsteilflächen frühestens in 3
Monaten einzuziehen, weil die betroffenen
Verkehrsteilflächen keine Verkehrsbedeutung mehr
besitzen:
Teilstück der
öffentlichen Verkehrsfläche “Stralsunder Straße“
in Wesel-Altstadt (ca. 60 m² große Teilfläche
des Grundstücks Gemarkung Wesel, Flur 41,
Flurstück 639) - siehe Lageplan 1
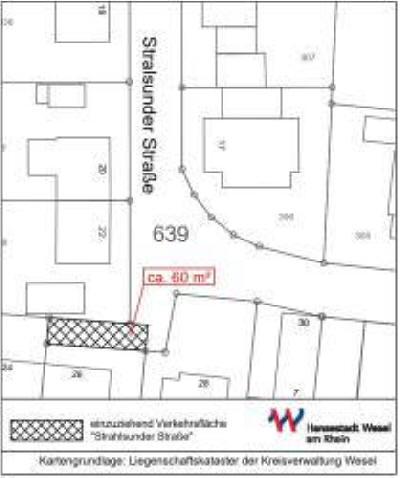
sowie Teilstück der
öffentlichen Verkehrsfläche “Rheinbabenstraße“
in Wesel-Altstadt (ca. 80 m² große Teilfläche
des Grundstücks Gemarkung Wesel, Flur 39,
Flurstück 186) - siehe Lageplan 2.
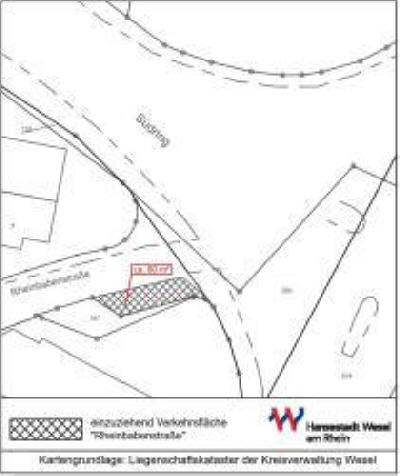
Hiermit wird die
Absicht der Einziehung gem. § 7 Abs. 4 StrWG NRW
öffentlich bekanntgemacht, um Gelegenheit zu
Einwendungen zu geben.
Hinweise:
1.
Pläne, aus denen die
genaue Lage und die Ausdehnung der
einzuziehenden Verkehrsteilflächen ersichtlich
ist, liegen beim Team Bauleitplanung der Stadt
Wesel im Rathausanbau, Klever-Tor-Platz 1, 46483
Wesel, Zimmer 231, aus. Sie können dort bis zum
Erlass der jeweiligen Einziehungsverfügung, die
frühestens drei Monate nach Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung ergehen kann, montags bis
freitags während der allgemeinen Dienststunden
der Stadtverwaltung von jedermann eingesehen
werden.
2.
Etwaige Einwendungen
können während der Auslegungsfrist schriftlich
oder mündlich zur Niederschrift oder per Mail
an bauleitplanung@wesel.de erhoben
werden. Die Stadt Wesel wird diese zum Anlass
nehmen, die Einziehungsabsicht nochmals zu
überprüfen.
3.
Nach Ablauf der
gesetzlichen Frist für die Dauer der
Bekanntmachung der Absicht zur Einziehung von
mindestens drei Monaten wird über die Einziehung
entschieden.
4.
Diese Bekanntmachung
dient lediglich der Vorbereitung einer durch
einen späteren Verwaltungsakt zu treffenden
Entscheidung. Sie ist daher mit Rechtsmitteln
nicht anfechtbar.

Herbstaussaat zur Ernte 2025: Knapp 6 % mehr
Wintergetreide
• Aussaat von
Winterweizen gegenüber 2024 um gut 12 %
gestiegen
• Ansteigende Tendenz auch bei
Roggen und Wintermenggetreide sowie Triticale
• Flächenrückgang bei Wintergerste um gut 5
%
Im Herbst 2024 haben die
landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland auf
4,8 Millionen Hektar Ackerland Wintergetreide
für die kommende Erntesaison 2025 ausgesät. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
ist die Aussaatfläche für Wintergetreide damit
um 256 900 Hektar (+5,6 %) größer als die
Anbaufläche des Jahres 2024.
Der
Anstieg erfolgt allerdings von einem niedrigen
Niveau aus, da witterungsbedingte
Schwierigkeiten, insbesondere hohe
Niederschläge, bei der Aussaat im Herbst 2023
und um den Jahreswechsel 2023/2024 zu einem
deutlichen Rückgang der Wintergetreideflächen
für die Ernte 2024 geführt hatten (-9,3 %
gegenüber 2023). Zum Wintergetreide zählen
Winterweizen, Wintergerste, Roggen und
Wintermenggetreide sowie die
Weizen-Roggen-Kreuzung Triticale.
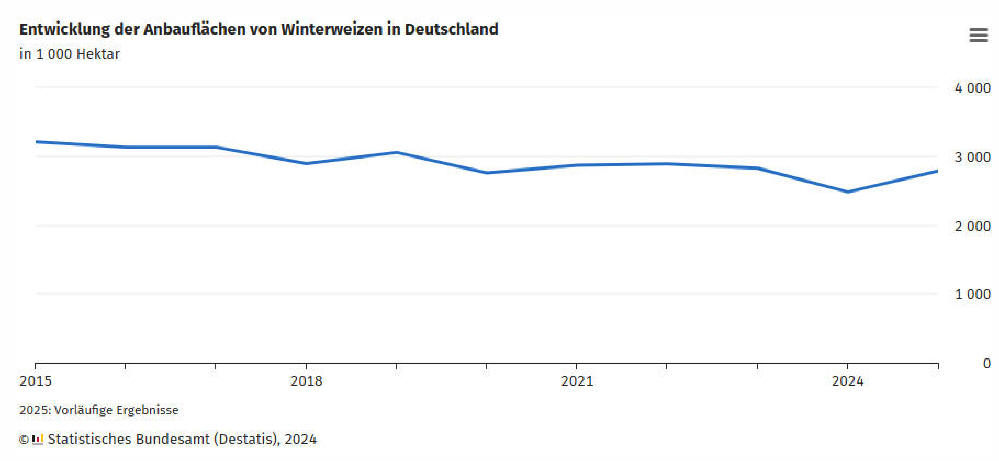
Die Aussaatfläche von Winterweizen, der
flächenmäßig bedeutendsten Getreideart in
Deutschland, vergrößerte sich für die anstehende
Erntesaison 2025 gegenüber der diesjährigen
Anbaufläche um 305 800 Hektar oder 12,3 % auf
2,8 Millionen Hektar. Die größten
Flächenzuwächse in absoluten Werten sind in
Niedersachsen (+71 100 Hektar; +25,3 %), Bayern
(+51 500 Hektar; +11,5 %) und Schleswig-Holstein
(+31 400 Hektar; +27,8 %) festzustellen.
Bei der Aussaatfläche für Roggen und
Wintermenggetreide wird für die Erntesaison 2025
von einem leichten Zuwachs um 2,8 % (+15 200
Hektar) auf 550 100 Hektar ausgegangen. Die
Aussaat von Triticale erfolgte auf 271 600
Hektar, dies sind 6 300 Hektar beziehungsweise
2,4 % mehr als die Anbauflächen zur Ernte 2024.
Beim Anbau von Wintergerste ist ein Rückgang der
Aussaatfläche um 5,4 % (‑70 300 Hektar) auf
1,2 Millionen Hektar festzustellen.
Mit Winterraps haben die
landwirtschaftlichen Betriebe 1,1 Millionen
Hektar bestellt. Damit vergrößert sich die
Fläche um 2,3 % oder 24 900 Hektar gegenüber
2024. Methodische Hinweise: Die hochgerechneten
Aussaatflächen zur Ernte 2025 beruhen auf den
Mitteilungen einer begrenzten Anzahl
freiwilliger Ernte- und
Betriebsberichterstatter/-innen von Ende
November 2024. Nicht enthalten in den
Ergebnissen sind die Stadtstaaten Berlin, Bremen
und Hamburg.
Die Ergebnisse sind als
vorläufige Anbautendenzen zu bewerten. Bis zur
Ernte 2025 können auch noch Auswinterungsschäden
sowie Schädlings- und Krankheitsbefall eine
Rolle spielen. Die Vorjahresvergleiche beziehen
sich auf die endgültigen Ergebnisse der
Bodennutzungshaupterhebung 2024.
|