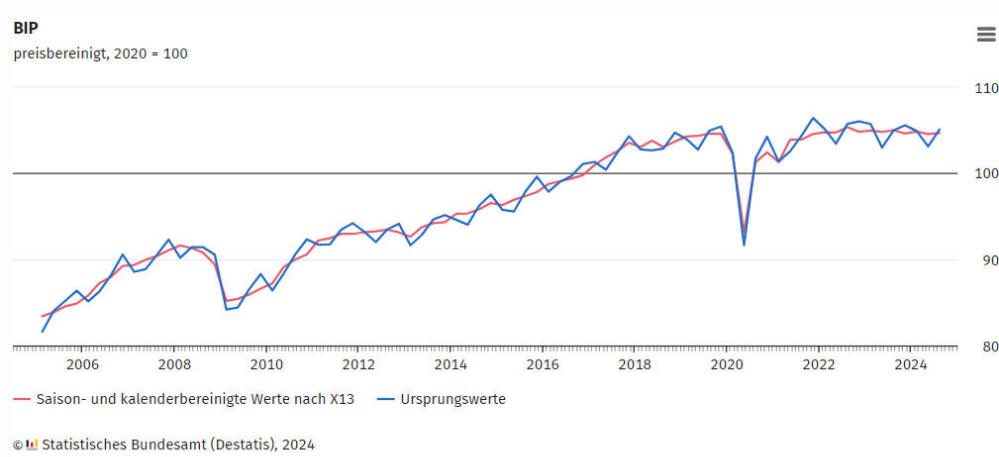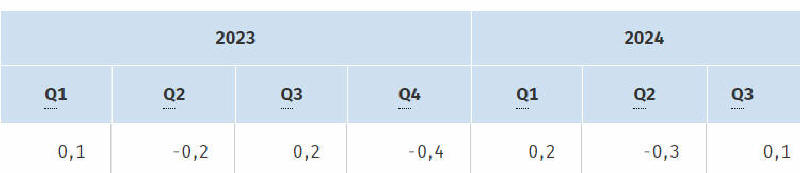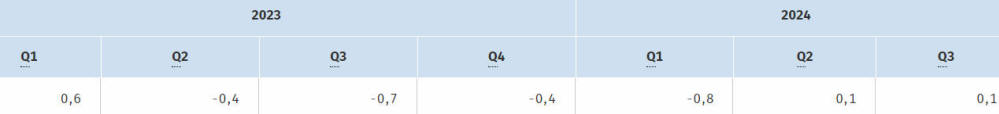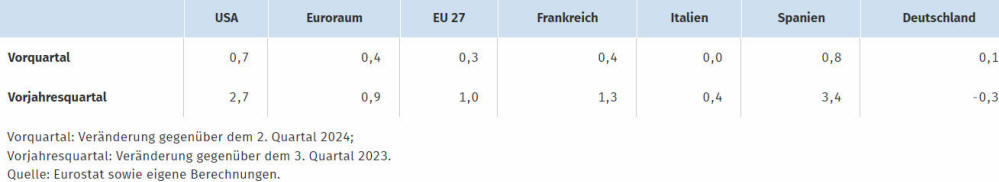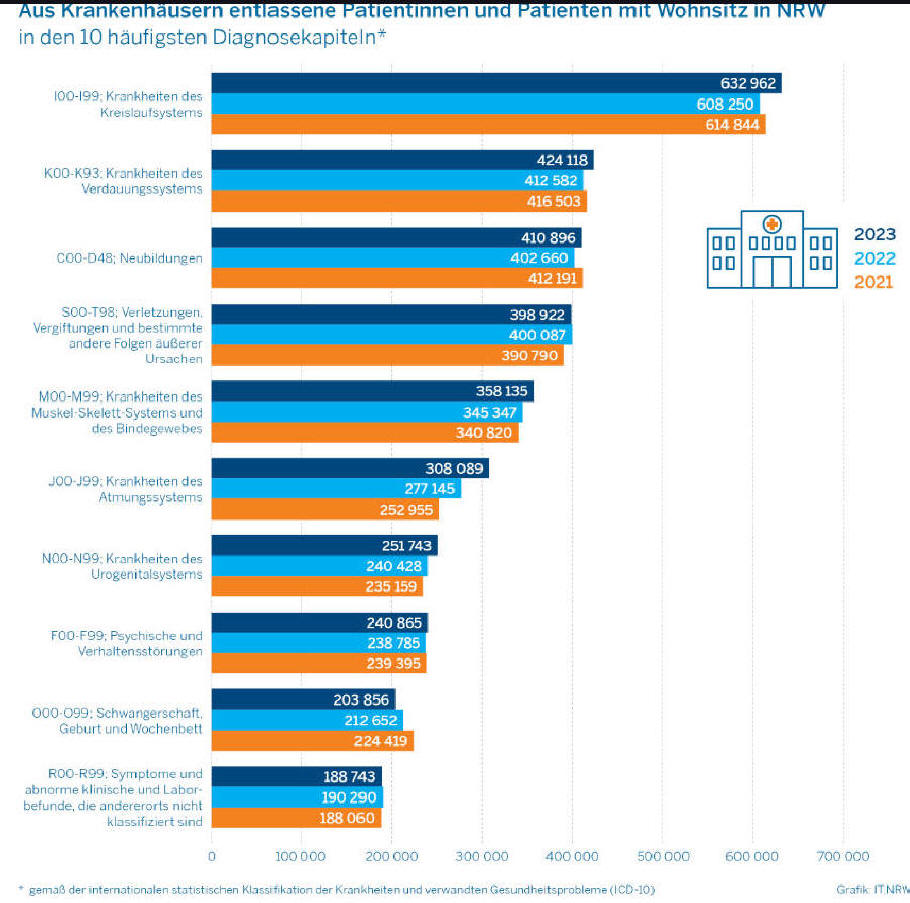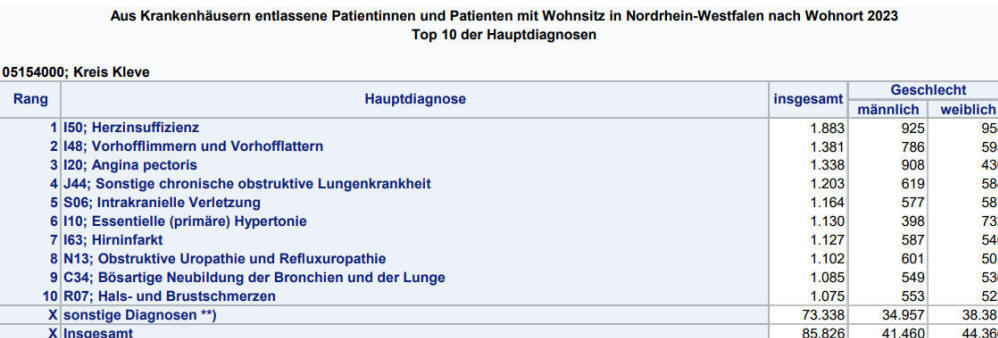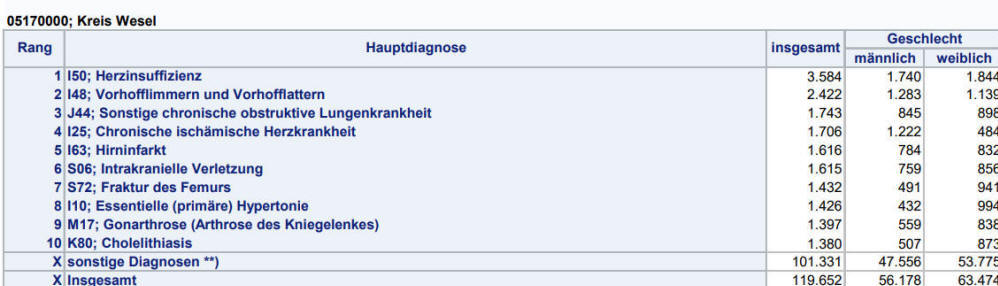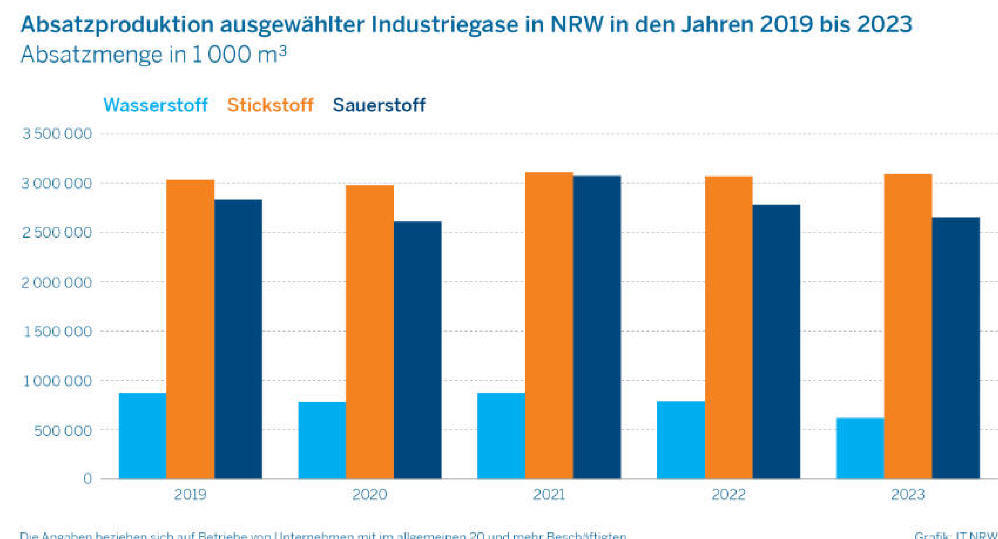|
Samstag, 23., Sonntag, 24. November 2024
Erklärung der Bundesregierung zum Beschluss
des Internationalen Strafgerichtshofs
Die Bundesregierung hat die Entscheidung des
Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) zu
den beantragten Haftbefehlen gegen den
israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu
und den ehemaligen Verteidigungsminister Joaw
Galant zur Kenntnis genommen. Die
Bundesregierung war an der Ausarbeitung des
IStGH-Statuts beteiligt und ist einer der
größten Unterstützer des IStGH.
Diese Haltung ist auch Ergebnis der deutschen
Geschichte. Gleichzeitig ist Konsequenz der
deutschen Geschichte, dass uns einzigartige
Beziehungen und eine große Verantwortung mit
Israel verbinden. Die innerstaatlichen Schritte
werden wir gewissenhaft prüfen. Weiteres stünde
erst dann an, wenn ein Aufenthalt von
Premierminister Benjamin Netanjahu und dem
ehemaligen Verteidigungsminister Joaw Galant in
Deutschland absehbar ist.
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die
Bundestagswahl 2025 gesucht
Landeswahlleiterin Monika Wißmann: „Demokratie
heißt mitmachen!“ „Demokratie heißt
mitmachen!“, so wirbt Landeswahlleiterin Monika
Wißmann um Wahlhelfende für die vorgezogene
Bundestagswahl.
Die Bundestagswahl ist
für den 23. Februar 2025 angekündigt. An diesem
Sonntag werden in Nordrhein-Westfalen rund
110.000 Wahlhelfende im Einsatz sein. Sie sorgen
dafür, dass die rund 13 Millionen
Wahlberechtigten im bevölkerungsreichsten
Bundesland ihr Wahlrecht frei und geheim in
einem wohnortnahen Wahlraum ausüben können. Nach
Schließung der Wahlräume zählen sie die Stimmen
ab 18.00 Uhr öffentlich aus. Sie sind Garanten
für die korrekte Ermittlung und Weitergabe des
Ergebnisses ihres Wahlbezirks.
„Wahlen
sind eine Veranstaltung des Volkes. Daher sitzen
in den Wahlvorständen die Wahlberechtigten
selbst. Ich freue mich sehr über die vielen
Wählerinnen und Wähler, die dieses Ehrenamt bei
einer Wahl übernehmen und bedanke mich schon
jetzt bei all denen, die sich immer wieder dazu
bereit erklären. Wir brauchen aber auch neue
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Melden Sie sich
deshalb jetzt bei Ihrer Gemeinde oder Ihrer
Stadt und erklären Sie Ihre Bereitschaft, bei
der Bundestagswahl am 23. Februar mitzuhelfen.“
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erhalten vorher
eine Schulung und werden am Wahlsonntag von
erfahrenen Wahlvorständen unterstützt. Der
Einsatz ist ehrenamtlich, man bekommt jedoch ein
sogenanntes Erfrischungsgeld.
Landeswahlleiterin Monika Wißmann betont: „Die
Wahlhelfenden wissen, dass Sie zum guten
Gelingen der Bundestagswahl beitragen. Ihr
Engagement zählt. Sie gestalten Demokratie.“
Für die Bundestagswahl müssen
Wahlhelfende am Wahltag das 18. Lebensjahr
vollendet haben, die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen und seit mindestens
drei Monaten eine Wohnung oder ihren sonstigen
Aufenthalt innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland innehaben. Weitere Informationen
finden Sie unter
www.wahlen.nrw und in den Internetangeboten
der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen.
18. Wunschbaumaktion von
‚Klartext für Kinder‘: 11 Standorte in Moers
Krieg in der Ukraine und Nahost,
Rechtsruck in Europa, die USA eine ‚Wundertüte‘,
die Bundesregierung am Ende, die deutsche
Wirtschaft lahmt und die soziale Schere ist weit
geöffnet: Auch am Niederrhein wird das
Zusammenleben der vielen Kulturen, Religionen
und politischen Einstellungen täglich auf eine
harte Probe gestellt.

Gemeinsam mit Kindern aus der Kita
Diergardtstraße haben Bürgermeister
Fleischhauer, Mitarbeitende der Stadt und
‚Klartext‘-Vorsitzender Michael Paßon die Tanne
im Kinder- und Jugendbüro behängt. (Fotos: pst)
Darunter leiden die Schwächsten. Für
2.000 von ihnen kann der Verein ‚Klartext für
Kinder - Aktiv gegen Kinderarmut!‘ zu
Weihnachten etwas Gutes tun. Seit Donnerstag,
21. November, hängen an 18 Wunschbäumen in
Moers, Rheinberg, Kamp-Lintfort und
Neukirchen-Vluyn bescheidene kleine
Kinderwünsche – allein 11 davon stehen in Moers.
Der Moerser Auftakt zur 18.
Weihnachtswunschbaumaktion fand im Kinder- und
Jugendbüro der Stadt mit Bürgermeister Christoph
Fleischhauer und weiteren Mitgliedern des
Verwaltungsvorstands statt.
Dank an
die Jugendämter
Neben Klassikern wie Lego,
Barbie oder Playmobil stehen z. B. auch die
trendigen Kuscheltiere Squishmallows auf den
Wunschkarten. Gemeinsam mit Mädchen und Jungen
aus der Kita Diergardtstraße haben Bürgermeister
und Mitarbeitende der Stadt sowie der
‚Klartext‘-Vorsitzende Michael Paßon die Tanne
im Kinder- und Jugendbüro mit Schmuck und den
Wunschkarten behängt.
„Danke, dass
ihr so tollen Schmuck gebastelt habt und heute
geholfen habt“, sagte Bürgermeister
Fleischhauer. Michael Paßon schloss sich an und
ergänzte: „Mit dieser Aktion spüren wir im
Verein immer besonders intensiv, warum wir das
machen. Ich danke auch den Jugendämtern der
beteiligten Städte, dass sie uns dabei
unterstützen.“
Bis Mittwoch, 4.
Dezember, können im Kinder- und Jugendbüro
(Seiteneingang des Rathauses an der
Unterwallstraße) Karten abgeholt und Geschenke
im Wert von bis zu 25 Euro (unverpackt und mit
Wunschbaum-Karte) abgegeben werden.
Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 8.15
bis 17 Uhr und freitags von 8.15 bis 14 Uhr.
Hier stehen weitere Wunschbäume in Moers:
Medienhaus Moers am Kö,
Kios West in
der City,
Coiffeur Dedters im Rheinkamper
Ring,
Markt-Apotheke in Repelen,
Sparkasse Filiale Asberg,
ENNI
Kundenzentrum,
‚Brillenmacher‘ in
Kapellen,
Eurotec Loop in Utfort sowie
Gartencenter Schlößer und
Da Mimmo in
Schwafheim.
Moers: Inner
Wheel Club unterstützt Grafschafter Museum
Ruth Maes und Anke Lüdeking vom
Inner Wheel Club Moers überreichten
Museumsleiterin Diana Finkele eine Spende in
Höhe von 600 Euro. Damit können Schulklassen
kostenlos an Führungen durch das Museum
teilnehmen. Ein Weihnachtsgeschenk für
Schulklassen hat der Inner Wheel Club (IWC)
Moers dem Grafschafter Museum übergeben. Durch
die Spende von 600 Euro können Schulklassen an
kostenlosen Führungen durch die Kultur- und
Bildungseinrichtung teilnehmen.

Präsidentin Ruth Maes und Anke Lüdeking
übergaben den Scheck am Donnerstag, 14.
November, an Museumsleiterin Diana Finkele. Foto
Inner Wheel Club Moers. Sie freute sich sehr
über die Spende: „Toll, dass der Inner Wheel uns
erneut unterstützt und so die Klassenkassen für
einen Museumsbesuch nicht belastet werden.“
Der IWC hat auch bereits andere
Einrichtungen des Eigenbetriebs Bildung, wie die
Moerser Musikschule, unterstützt. „Wir wollen
regional und sozial unterstützen – das ist unser
erklärtes Ziel“, so IWC-Präsidentin Ruth Maes.
Der Erlös stammt aus der Veranstaltung
‚White Dinner‘ im Sommer. Die nächste Aktion ist
bereits in Planung: Zum Museumssonntag am 2.
Advent veranstalten die Damen das Café Henriette
und verkaufen Kaffee und Kuchen für den guten
Zweck. Schulklassen können sich für die
kostenlosen Führungen telefonisch (0 28 41 /
201-6 82 00) oder per E-Mail (Grafschafter-Museum@Moers.de)
anmelden.
Dinslakens
Bürgermeisterin begrüßt hochmoderne
Schnellladesäule mit Shop
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel bei der
Eröffnung des Fastned-Shops. Fastned, das
europäische Schnellladeunternehmen, hat gestern
seinen ersten eigenen unbemannten und rund um
die Uhr geöffneten Shop in Deutschland an der
Schnellladestation in Dinslaken-Nord,
Nordrhein-Westfalen, eröffnet.

In unmittelbarer Nähe zur A3 bietet der neue
Shop, zusätzlich zu den acht bestehenden
Ladepunkten mit bis zu 400 kW Ladeleistung, rund
um die Uhr Zugang zu barrierereduzierten
Toiletten sowie zu Kaffee- und
Verkaufsautomaten.
Der kostenfreie
Zugang erfolgt unkompliziert durch eine
Verifizierung per Debit- oder Kreditkarte. Mit
der Eröffnung dieses Shops setzt Fastned ein
klares Zeichen für die Zukunftsgestaltung eines
modernen und komfortablen Ladeerlebnisses.
„Mit der Entstehung unseres ersten eigenen
Fastned-Shops in Deutschland haben wir für uns
völlig neues Terrain betreten. Dabei war es uns
von Anfang an wichtig, Elektroautofahrer:innen
ein noch angenehmeres Ladeerlebnis in
Dinslaken-Nord zu bieten. Dieser Shop ist erst
der Anfang: Hier konnten wir den naturnahen
Ansatz unserer Fastned-DNA in Design und
Gestaltung verwirklichen. An weiteren Standorten
arbeiten wir eng mit Partnern zusammen, um
innovative Konzepte zu entwickeln. Für andere
mag dies nur ein kleiner Schritt sein – für uns
ist es ein großer Fortschritt“, sagt Linda Boll,
Country Director Fastned Deutschland.
Modulares Design und ressourcenschonende
Bauweise Die Schnellladestation liegt
verkehrsgünstig nahe der Ausfahrt Dinslaken-Nord
an der A3 zwischen Oberhausen und Wesel. Um den
stetig steigenden Bedarf an Schnellladestationen
zu decken, wurde der Standort vorausschauend
geplant und erst in diesem Jahr um vier
zusätzliche Ladepunkte sowie nun auch um den
ersten eigenen Fastned-Shop mit eigenen
Sitzmöglichkeiten erweitert. An der heutigen
Eröffnungsfeier nahm unter anderem
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel teil.
"Ich heiße dieses junge und innovative
Unternehmen in Dinslaken herzlich willkommen.
Unsere Stadt ist Mitglied in der EUREGIO,
deshalb freue ich mich ganz besonders über die
Partnerschaft mit einem niederländischen
Unternehmen. Es ist der erste deutsche Shop und
ich freue mich, dass dieser in Dinslaken steht.
Es ist toll zu sehen, was hier vor Ort umgesetzt
wurde: Hier treffen alte Energie und neue
Energie aufeinander. Der alte Zechenturm
befindet sich in unmittelbarer Nähe zu
hochmodernen Ladesäulen, die wie ein Kunstwerk
aussehen. Dass hier nun auch durch ein
Serviceangebot die Aufenthaltsqualität während
des Ladevorgangs erhöht wird, ist ein echter
Zugewinn für die Region", so Bürgermeisterin
Michaela Eislöffel.
Um beim Aufbau
des Shops so viele Emissionen wie möglich zu
sparen, bedient sich Fastned eines
vergleichbaren Ansatzes wie bei der
Dachkonstruktion seiner Stationen. Modulare
Komponenten sorgen für effizienten
Ressourceneinsatz und bestmögliche
Skalierbarkeit. Der erste deutsche Fastned-Shop
wurde als Komplettmodul konstruiert, das mit nur
einer Anfahrt zur Baustelle transportiert und
dort in nur zwei Tagen betriebsfertig
installiert wurde.
Das Gebäude
besteht vollständig aus PEFC-zertifiziertem Holz
und kommt ohne ein Betonfundament aus. Die
architektonische Gestaltung mit großen Fenstern
ermöglicht einen freien Blick auf die
Ladestation und gewährt von außen Einblick in
den Shop. Zugang für alle – Elektromobilität
einfach und barrierefrei gestalten In
Deutschland betreibt Fastned derzeit 39
Schnellladestationen, die mit der für Fastned
typischen großflächigen Überdachung, guter
Beleuchtung und ausreichend Sitzmöglichkeiten
ausgestattet sind.
Der neu eröffnete
Shop ist barrierereduziert gestaltet und verfügt
über ein modernes Zugangssystem, das einfach mit
Debit- oder Kreditkarte bedient werden kann. Mit
diesem neuen Angebot in Dinslaken trägt Fastned
dazu bei, Elektromobilität noch attraktiver und
benutzerfreundlicher zu gestalten sowie die
Ladeinfrastruktur in Deutschland weiter
auszubauen.
Hier geht‘s zur Pressemeldung im
Fastned-Newsroom.
Über Fastned
Fastneds Mission ist es, den Übergang zur
Elektromobilität zu beschleunigen. Seit 2012
treibt das Unternehmen als Vorreiter die
Entwicklung der europäischen Ladeinfrastruktur
voran und unterhält ein schnell wachsendes Netz
an Schnellladestationen. Die gelben Stationen im
naturnahen Design schaffen eine einladende
Umgebung für Autofahrende, für die das Aufladen
von bis zu 300 Kilometern je nach Fahrzeugtyp
lediglich 15 Minuten dauert.
Fastneds Anspruch ist es, das zuverlässigste,
bequemste und angenehmste Ladeerlebnis in Europa
zu bieten. Millionen Menschen sollen so dazu
inspiriert werden, mit Solar- und Windenergie zu
fahren und gemeinsam mit Fastned dem Klimawandel
etwas entgegenzusetzen. Fastned ist an der
Euronext Amsterdam gelistet (AMS: FAST) und
B-Corp-zertifiziert. Pressekontakt Fastned
Dederichs Reinecke & Partner Agentur für
Öffentlichkeitsarbeit fastned@dr-p.de +49 40
209198278
Zu Gast im Museum:
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel liest ihr
Lieblingsmärchen
Am Samstag, 30.
November 2024, ist Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel zu Gast im Museum Voswinckelshof. Sie
setzt die Reihe der Märchen-Lesungen im Museum
fort und präsentiert ihr liebstes Märchen: Die
kleinen Leute von Swabedoo.
Die
Bürgermeisterin hat sich bereits vor Jahrzehnten
als Lehrerin damit beschäftigt, wie man Kindern
Werte vermitteln kann. Dabei ist sie auf die
Geschichte der kleinen Leute gestoßen: "Die
Geschichte der Swabedoodahs ist ein Märchen für
alle Altersgruppen. Seine berührende Erzählung
regt zum Nachdenken über das Miteinander unter
Menschen an. Frieden, Geborgenheit und Vertrauen
können dort wachsen, wo Menschen dem Gegenüber
ebenfalls das Beste wünschen und miteinander
teilen.
Wie schön und zugleich wie
angreifbar der Friede einer Gesellschaft ist,
wird in diesem Märchen dargestellt."
Die Lesung findet in der historischen Küche
des Museums statt, die ein passendes Ambiente
für diese besondere Märchenstunde bietet.
Bürgermeisterin Eislöffel freut sich über einen
regen Austausch über ihr Lieblingsmärchen.
Eingeladen sind vorwiegend Kinder und
Jugendliche, aber natürlich dürfen auch
Erwachsene sehr gerne teilnehmen. Die
Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr und wird etwa
90 Minuten dauern. Der Eintritt ist frei. Die
Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine Anmeldung
daher erforderlich. Zur Anmeldung genügt eine
E-Mail an museum-voswinckelshof@dinslaken.de.
Projekteinreichung
Kulturrucksack 2025
Dinslaken - Der
Kulturrucksack 2024 neigt sich dem Ende zu und
für den Kulturrucksack 2025 können nun ab sofort
von Kulturschaffenden, Kreativen und den
Partnern der kulturellen Bildungsarbeit in
Dinslaken Projektvorschläge eingereicht werden.
Das Programm Kulturrucksack NRW ist
außerschulisch angelegt und für die Kinder und
Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren
kostenlos.
Ziel des landesweiten
Vorhabens ist es, allen Kindern und Jugendlichen
kostenlose oder deutlich kostenreduzierte
kulturelle Angebote zu eröffnen. Dabei soll die
eigene kreative Betätigung der Kinder unter
künstlerischer Anleitung im Fokus stehen. Die
Projekte werden voll gefördert. Einen Überblick
über das Programm des Jahres 2024 in Dinslaken
finden Sie auf der Seite der Stadt Dinslaken: www.dinslaken.de/kulturrucksack#
Weitergehende Informationen bietet die
Homepage des Programms: www.kulturrucksack.nrw.de
Der Kulturrucksack ist ein Programm
des Landes in Zusammenarbeit mit den Kommunen
und Kultureinrichtungen des Landes, welches
jährlich mit rund 4 Millionen Euro von der
Landesregierung gefördert wird. Da Dinslaken
auch 2025 mit Duisburg im Städteverbund
kooperiert, sind auch Projektvorschläge, die
städteübergreifend angelegt sind, Austausch
ermöglichen und dabei vielleicht auch (Stadt-)
Grenzen überschreiten, sehr willkommen.
Wenn Sie Teil des Kulturrucksack NRW 2025 werden
möchten, dann freue ich mich über Ihre
Kontaktaufnahme und/oder Ihre Projektvorschläge.
Bitte nutzen Sie zur Einreichung der
Projektvorhaben den Förderantrag, welcher
unter: www.dinslaken.de/kulturrucksack#
heruntergeladen werden kann. Einsendeschluss ist
der 30.11.2024. Bei Rückfragen wenden Sie sich
bitte an den Fachdienst Kultur der Stadt
Dinslaken: Tel.: 02064/66-267 E-Mail: kultur@dinslaken.de
Dinslaken:
Kinderwunschbaum-Aktion
Die
Kinderwunschbaum-Aktion startet Bürgermeisterin
Michaela Eislöffel und Kinder der Kita St.
Franziskus haben bei BMW Riedel Wunschzettel am
Weihnachtsbaum aufgehängt. Auch in diesem Jahr
gibt es in Dinslaken wieder die bekannte und
breit unterstützte Kinderwunschbaum-Aktion. Der
neue Förderverein des Jugendamtes, KiND e.V.,
organisiert die Aktion und wird in der
Adventszeit mit den Geschäftsleuten, dem Team
der Sozialen Dienste der Stadtverwaltung und den
Dinslakener*innen aktiv, um Kindern und
Jugendlichen das Weihnachtsfest zu verschönern.
Das Jugendamt der Stadt Dinslaken
hat Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus
finanzschwachen Familien gesammelt. Die Wünsche
haben einen Wert von rund 25 Euro. Am Freitag,
den 22. November 2024, wurde der erste Baum
geschmückt. Mit Unterstützung von
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel haben Kinder
der Kita St. Franziskus bei BMW Riedel
Wunschzettel am Weihnachtsbaum aufgehängt. Die
weiteren Wunschzettel wurden von der
Kindergartengruppe bei Geschäften in der
Innenstadt abgegeben.
Bürgermeisterin Eislöffel dankte den Kinder
sowie KiND e.V. und allen Beteiligten: „Alle
Unterstützer*innen der Kinderwunschbaum-Aktion
leisten einen wertvollen Beitrag dazu, dass
Kinder ein fröhliches und unbeschwertes
Weihnachtsfest erleben können. Indem sie
Geschenke für diese Kinder spenden, schenken sie
ihnen nicht nur Freude, sondern zeigen auch,
dass Gemeinschaft und Nächstenliebe in unserer
Gesellschaft von großer Bedeutung sind. Es ist
berührend zu sehen, wie viele Menschen bereit
sind, ihre Zeit und Ressourcen zu investieren,
um anderen zu helfen.
Für all diese
großzügigen Gesten und die Unterstützung bin ich
zutiefst dankbar. Sie machen einen echten
Unterschied im Leben dieser Kinder und tragen
dazu bei, dass Weihnachten für sie zu einem
besonderen Erlebnis wird.“
„Ab
sofort können die Wünsche an insgesamt 14
Standorten abgeholt und erfüllt werden. Die
Geschenke werden dann in der Woche vor dem
Weihnachtsfest über das Jugendamt an die
jeweiligen Familien verteilt“, erläutert
Gabriele Schneiderhan von KiND e.V.
Zu
finden sind die Tannenbäume hier: Autohaus
Riedel – Willy-Brandt-Str. 1, Autohaus Nagel –
Wilh.-Lantermann-Str. 102-104, decobar –
Bahnstr. 10, Foto Wolff – Bahnstr. 27b, Gasthof
Ortmann – Weseler Str. 155, Juwelier Michels –
Voerder Str. 70, Glückauf Apotheke –
Friedrich-Ebert-Str. 79-81, Lederwaren Berensen
– Neustr. 31, Malteser Apotheke – Neustr. 2-4,
NRZ – Friedrich-Ebert-Str. 40, Parfümerie Pieper
– Neustr. 28, Schuhhaus Bogen – Neustr. 35,
Feuerwehr Dinslaken – Hauptwache - Hünxer Str.
300.
Beim Adventszauber der
Lebenshilfe Dinslaken am Samstag, den 30.
November, in den Werkstätten auf der
Nikolaus-Groß-Straße 4 ebenfalls ein
Kinderwunschbaum aufgestellt. Die Geschenke
sollten bis zum 14.12.2024 mit den Wunschkarten
versehen bei den Geschäften abgegeben werden,
damit diese rechtzeitig bei den Familien
ankommen.
Kleve: Adventsfreude mit dem
„digitalen Adventskalender“ der WTM
Die Wirtschaft und Tourismus Stadt Kleve (WTM)
sorgt dieses Jahr für digitale Adventsfreude.
Die WTM wird über die 24 Adventstage hochwertige
Preise auf Ihren Social Media Kanälen verlosen.
Jeden Tag wird ein digitales „Türchen“ auf
Instagram (kleve_erleben) und Facebook (kleve
erleben) veröffentlicht und so kann jeder, der
den Beitrag mit „Gefällt mir“ markiert und
kommentiert mit etwas Glück die Auslosung
gewinnen.

Es gibt viele attraktive Preise von
Brettspielen über Kino- und Einkaufsgutscheine
bis hin zu Geschenkkörben voller Leckereien, die
von Einzelhändlern, Gastronomen und
Freizeiteinrichtungen zur Verfügung gestellt
wurden. „Wir haben Preise im Gesamtwert von über
1.200 € bekommen und sind überwältigt von der
großzügigen Beteiligung“ so WTM
Geschäftsführerin Charmaine Haswell, die sich
herzlich bei den Unterstützern bedankt und allen
Teilnehmern viel Glück wünscht.
Klimafester Garten – Tipps für den
zukunftsfähigen, ertragreichen Anbau von Obst
und Gemüse
Der Klimawandel verändert die Bedingungen in
heimischen Gärten: Exotische Obstsorten wie
Kakis profitieren von wärmeren Wintern. Die
Erderwärmung zwingt Gartler:innen, sich an neue
Gegebenheiten anzupassen. Der Gartenbauexperte
Dr. Lutz Popp vom Bayerischen Landesverband für
Gartenbau und Landespflege e. V. (BLGL)
erläutert, welche Änderungen sich bei der
Anbauplanung unter dem Einfluss des Klimawandels
ergeben.

Quelle: Bayerischer Landesverband für Gartenbau
und Landespflege e. V. München
Der
Klimawandel macht auch vor den Gärten nicht
halt. Steigende Durchschnittstemperaturen
begünstigen beispielsweise das Auftreten von
Schädlingen sowie Krankheiten und führen zu
Qualitäts- und Ertragseinbußen durch vermehrten
Hitzestress. Dürreperioden und
Extremwetterereignisse treten häufiger auf und
können ebenfalls große Schäden verursachen und
zu Ernteausfällen führen.
Aber die
Erderwärmung bietet Gartler:innen auch Chancen:
Sie ermöglicht den Anbau von neuen Arten und
Sorten, fördert eine schnellere Entwicklung der
Pflanzen und erlaubt eine längere
Bewirtschaftung der Gärten. Melone, Süßkartoffel
und Co. in heimischen Gärten Da die Sommer in
unseren Breitengraden tendenziell wärmer und
trockener werden, ist es mittlerweile gut
möglich, wärmeliebende Pflanzen wie tropische
und mediterrane Gemüsearten im eigenen Garten zu
kultivieren.
„Zu den Gemüsearten,
die vom Klimawandel profitieren, zählen
beispielsweise Blattgemüse wie Handama, auch
unter dem Namen Okinawa-Spinat bekannt, Amaranth
und Sommerportulak. Hülsenfrüchte wie Bohnen und
Edamame finden ebenfalls gute
Wachstumsbedingungen vor“, weiß Dr. Lutz Popp
vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und
Landespflege e. V. (BLGL). Gartler:innen können
sich auch an Fruchtgemüse wie Auberginen und
Melonen oder an wärmeliebendes Wurzelgemüse,
etwa Ingwer, Yacón und Süßkartoffel, wagen.
„Wichtig bei diesen Gemüsearten ist ein
sehr warmer, sonniger und windgeschützter
Platz“, betont Dr. Popp. Mit dem Auspflanzen
sollten Gartler:innen bis nach den Eisheiligen
warten. Trotz aller Experimentierfreude gilt:
Die Mischung macht's. Denn auch bei der
allgemeinen Tendenz zu trockenen Sommern und
milderen Wintern treten auch kalte Jahre mit
viel Niederschlag auf. „Ein möglichst
vielfältiger, abwechslungsreicher Anbauplan ist
daher die beste Voraussetzung für eine reiche
Ernte“, so der Gartenbauexperte.
Wintergemüseanbau bis nach Weihnachten
Spätestens ab Oktober muss der Garten winterfest
gemacht werden – so lautete die Empfehlung lange
Zeit. Doch die mildere Herbstwitterung und ein
immer späterer Winterbeginn schaffen neue
Voraussetzungen: „Gartler:innen können nun
sogenannte Nachkulturen in den Gemüsebeeten
anbauen, deren Saison im September und Oktober
beginnt“, informiert Dr. Popp. Der Klimawandel
ermöglicht es, die Beete jährlich zwei oder
sogar drei Mal mit neuem Gemüse zu bestücken.
Dank längerer Anbauphasen können
Gartler:innen bis in die Weihnachtszeit und
darüber hinaus Gemüse aus dem eigenen Garten
ernten. Achtung Frost Abhängig von der Region
treten trotz Klimawandel weiterhin frühe Fröste
auf. Daher empfiehlt sich eine Vliesauflage oder
ein kleiner Folientunnel auf dem Gemüsebeet,
wenn der Wetterbericht leichte Fröste
vorhersagt. Neben diesen Hilfsmitteln eignen
sich für den Wintergemüseanbau auch
Frühbeetkästen und Hobbygewächshäuser.
„Viele Gemüsearten kommen mit der
winterlichen Witterung erstaunlich gut zurecht.
Gemüse wie Spinat, Winterportulak, Feldsalat und
Blattsalate bevorzugen sogar kühlere
Temperaturen“, erläutert Dr. Popp. Bei der
Sortenwahl am besten auf spezielle Frühjahrs-
und Herbstsorten achten. Auch beim Obstanbau
sollten Gartler:innen drohende Fröste im Blick
behalten. Bedingt durch den Klimawandel blühen
Obstgehölze früher, weshalb die Blütezeit
häufiger mit Frostperioden zusammenfällt.
Während ihrer Blüte und kurz danach sind
Obstbäume allerdings am empfindlichsten – und
das bereits bei geschlossenen Blüten. Sind
Griffel, Pollen oder Blütenboden nicht mehr
intakt, kann sich keine Frucht entwickeln. Mit
aufgelegten Vliesen oder Folien können
Gartler:innen Blüten und Jungfrüchte vor
Spätfrösten schützen. Treten die Nachtfröste
mehrmals hintereinander auf, empfiehlt es sich,
die Abdeckmaterialien tagsüber zu öffnen, um
Insekten die Bestäubung der Blüten zu
ermöglichen.
Exotisches Obst aus eigenem
Anbau
Im Bereich Obst gibt es ebenfalls
Arten, die durch den Klimawandel bessere
Wachstumsbedingungen vorfinden: Quittenbäume
sind winterfrosthart und weitgehend robust,
vertragen aber auch Hitze und Trockenheit. In
geschützten Lagen können fränkische
Gartler:innen künftig sogar den Mandelanbau
versuchen. Weitere Obstarten, die wärmeliebend
und trockenheitsverträglich sind, sind Mispel,
Feige, Tafeltraube, Kaki oder Aprikose.
Wildobstarten wie Aronia, Felsenbirne, Sanddorn,
Kornelkirsche und Maibeere bringen diese
Eigenschaften ebenfalls mit. Für den
Streuobstanbau eignen sich unter anderem
Speierling, Maulbeere, Walnuss und Esskastanie.
„Durch die mildere Witterung und eine längere
Vegetationsdauer ist in einigen Regionen wie im
Alpenvorland auch der Anbau von spät
ausreifenden Apfel-, Birnen- und
Tafeltraubensorten möglich“, ergänzt der
Gartenbauexperte.
Mit Nützlingen gegen
Schädlinge
Eine Gefahr für die Obsternte ist
die Kirschessigfliege, da sich der neue
Schädling durch den Klimawandel unkontrolliert
verbreitet. Auch andere neue Erreger wie der
Asiatische Laubholzbockkäfer, die
Walnussfruchtfliege oder die Blattfallkrankheit
an Apfel lassen sich kaum eindämmen, weil
Gegenmaßnahmen fehlen. „Die milderen Winter
verschaffen eingeschleppten Schaderregern
dauerhafte Überlebenschancen über eine
Vegetationsperiode hinaus“, erklärt Dr. Popp.
„Hinzu kommen heimische
Schaderreger, die von der Erderwärmung ebenfalls
profitieren.“ Die sinnvollste Maßnahme gegen
Schaderreger sind Nützlinge. Nützlinge finden
gute Lebensbedingungen in naturnahen Gärten mit
blühenden Staudenbeeten, heimischen Sträuchern,
Blühstreifen, Trockenmauern und Reisighaufen. Je
größer das Nahrungsangebot, desto besser können
sich Nützlinge vermehren und ausbreiten.
„Ein naturnah angelegter Garten unterstützt
bei der natürlichen Regulation von Schädlingen,
ist pflegeleicht und schön anzusehen“, so Dr.
Popp. Mehr Informationen gibt es unter:
https://www.gartenbauvereine.org/

Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche
Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im
3. Quartal 2024 Wirtschaftsleistung um 0,1 %
höher als im Vorquartal
Bruttoinlandsprodukt (BIP), 3. Quartal 2024
+0,1 % zum Vorquartal (preis-, saison- und
kalenderbereinigt) +0,1 % zum Vorjahresquartal
(preisbereinigt) -0,3 % zum Vorjahresquartal
(preis- und kalenderbereinigt)
Das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 3. Quartal
2024 gegenüber dem 2. Quartal 2024 – preis-,
saison- und kalenderbereinigt – um 0,1 %
gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, fiel das
Wirtschaftswachstum damit um 0,1 Prozentpunkte
schwächer aus als in der Schnellmeldung
vom 30. Oktober 2024 berichtet.
Im
2. Quartal war die Wirtschaftsleistung um 0,3 %
zurückgegangen, nachdem sie im 1. Quartal noch
leicht gestiegen war (+0,2 %). Nach dieser
insgesamt verhaltenen Entwicklung in der ersten
Jahreshälfte startet die deutsche Wirtschaft mit
einem kleinen Plus in das zweite Halbjahr 2024.
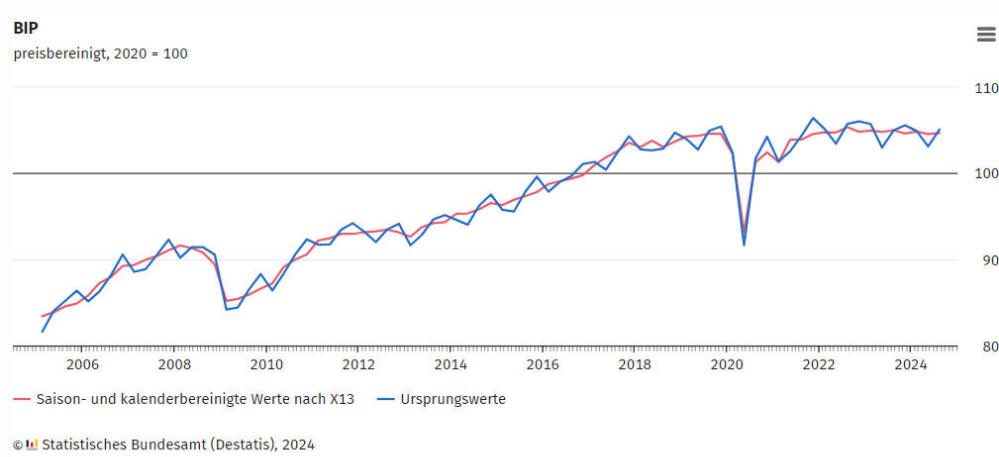
Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt
(saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13)
Veränderung gegenüber dem Vorquartal in Prozent
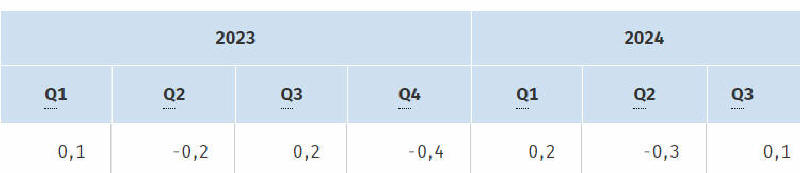
Konsumausgaben im Vergleich zum Vorquartal
gewachsen, Exporte deutlich im Minus
Nach dem
Rückgang im 2. Quartal 2024 stiegen die preis-,
saison- und kalenderbereinigten privaten
Konsumausgaben im 3. Quartal 2024 um 0,3 %
gegenüber dem Vorquartal an. So gaben die
Verbraucherinnen und Verbraucher unter anderem
mehr für Verbrauchsgüter aus, beispielsweise für
Nahrungsmittel und Getränke. Auch der
Staatskonsum legte mit +0,4 % gegenüber dem
Vorquartal zu.
Insgesamt nahmen die
Konsumausgaben gegenüber dem 2. Quartal 2024 um
0,3 % zu. Leicht negative Impulse kamen dagegen
von den Investitionen: In Ausrüstungen – also
vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge –
wurde im 3. Quartal 2024 preis‑, saison- und
kalenderbereinigt 0,2 %, in Bauten 0,3 % weniger
investiert als im Vorquartal. Sowohl die Bau-,
als auch die Ausrüstungsinvestitionen waren
schon im 2. Quartal 2024 zurückgegangen, das
Minus war mit -2,2 % beziehungsweise -3,4 %
jedoch deutlich größer gewesen.
Die
Entwicklungen im Außenhandel zeigten sich im 3.
Quartal 2024 zweigeteilt: So wurden preis-,
saison- und kalenderbereinigt 1,9 % weniger
Waren und Dienstleistungen exportiert als im 2.
Quartal 2024, wobei insbesondere die
Warenexporte deutlich abnahmen (-2,4 %).
Demgegenüber stiegen die Importe von Waren und
Dienstleistungen leicht um 0,2 % an, was
insbesondere auf zunehmende Warenimporte
zurückzuführen ist (+1,3 %).
Bruttowertschöpfung in den meisten Bereichen im
Minus
Die preis-, saison- und
kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war im 3.
Quartal 2024 insgesamt um 0,2 % niedriger als im
2. Quartal 2024. Die stärksten Rückgänge waren
im Verarbeitenden Gewerbe (-1,4 %) und im
Baugewerbe (-1,2 %) zu verzeichnen. Insbesondere
beim Maschinenbau und der Herstellung von
chemischen Erzeugnissen zeigten sich starke
Produktionsrückgänge. Die Produktion von
Kraftwagen und Kraftwagenteilen stieg dagegen im
Vorquartalsvergleich leicht an.
Auch
die Finanz- und Versicherungsdienstleister (-0,9
%) sowie der Bereich Information und
Kommunikation (‑0,4 %) konnten ihre
Wirtschaftsleistung nicht steigern. Positive
Signale sendeten der Bereich Öffentliche
Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+1,3 %)
sowie die sonstigen Dienstleister (+0,6 %). Im
zusammengefassten Bereich Handel, Verkehr,
Gastgewerbe nahm die preis-, saison- und
kalenderbereinigte Wertschöpfung zum Vorquartal
leicht um 0,1 % zu, nachdem sie in den beiden
Vorquartalen noch gesunken war.
Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich
gestiegen
Im Vorjahresvergleich war das BIP
im 3. Quartal 2024 preisbereinigt um 0,1 % höher
als im 3. Quartal 2023. Preis- und
kalenderbereinigt ergab sich hingegen ein
Rückgang (-0,3 %), da ein Arbeitstag mehr zur
Verfügung stand als im Vorjahreszeitraum.
Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent
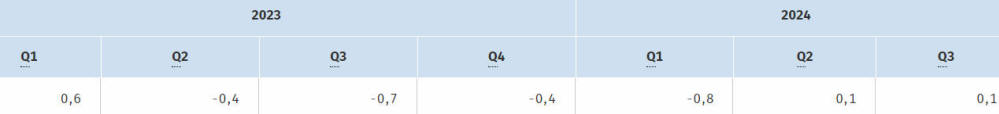
vestitionen im Vorjahresvergleich deutlich
im Minus – positive Impulse vom Staatskonsum
Wie auch in den ersten beiden Quartalen
wurde im 3. Quartal 2024 deutlich weniger
investiert als im entsprechenden
Vorjahresquartal. Die Ausrüstungsinvestitionen
gingen preisbereinigt um 5,7 % gegenüber dem 3.
Quartal 2023 zurück, was unter anderem auf einen
Basiseffekt bei den gewerblichen
Pkw-Neuzulassungen zurückzuführen war. Diese
waren im 3. Quartal 2023 wegen des Auslaufens
der staatlichen Förderung gewerblicher
Zulassungen von Elektrofahrzeugen zum 1.
September 2023 besonders stark angestiegen. Die
Investitionen in Bauten sanken preisbereinigt um
2,6 %, wobei sich der Wohnungsbau deutlich
schwächer als der Nicht-Wohnungsbau entwickelte.
Einen Anstieg zum Vorjahresquartal
verzeichneten dagegen die Konsumausgaben
insgesamt, die preisbereinigt um 0,8 % zunahmen.
Während die privaten Konsumausgaben zum
Vorjahreszeitraum nur leicht anstiegen (+0,1 %),
legte der Staatskonsum merklich um 2,5 % zu.
Ursache hierfür waren unter anderem höhere
soziale Sachleistungen der Gemeinden und
Sozialversicherungen.
Im 3. Quartal 2024
wurden preisbereinigt 0,3 % weniger Waren und
Dienstleistungen ins Ausland exportiert als ein
Jahr zuvor. Sinkenden Warenexporten (-0,6 %),
vor allem von Maschinen,
Datenverarbeitungsgeräten und
Metallerzeugnissen, stand ein Anstieg der
Dienstleistungsexporte um 1,0 % gegenüber.
Dieser war vor allem auf gestiegene Einnahmen in
den Bereichen Telekommunikations- und
Informationsdienstleistungen zurückzuführen.
Die Importe nahmen dagegen im selben
Zeitraum insgesamt um 1,2 % zu. Während die
Einfuhren von Waren, unter anderem von
Kraftwagen und Kraftwagenteilen sowie von
Maschinen, um 0,3 % sanken, nahmen die
Dienstleistungsimporte merklich zu (+4,4 %). Die
Zunahme beruht vor allem auf gestiegenen
Ausgaben für Transportdienstleistungen sowie auf
gestiegenen Gebühren für die Nutzung von
geistigem Eigentum.
Dienstleistungsbereiche stützen Wertschöpfung,
Baugewerbe mit starkem Rückgang
Die
Dienstleistungsbereiche konnten ihre
Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2024 im
Vergleich zum 3. Quartal 2023 preisbereinigt um
1,1 % steigern. Dabei verzeichneten bis auf die
Finanz- und Versicherungsdienstleister (-0,5 %)
alle dazugehörigen Bereiche ein Plus, wobei die
Bereiche Information und Kommunikation (+2,5 %)
sowie Öffentliche Dienstleister, Erziehung,
Gesundheit (+2,3 %) ihre preisbereinigte
Wertschöpfung besonders stark steigern.
Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden
Gewerbe (ohne Baugewerbe) nahm dagegen im
Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,9 % ab.
Während das Verarbeitende Gewerbe mit ‑2,0 %
erneut deutlich zurückging, konnten die
Energieversorger ihre preisbereinigte
Wertschöpfung erstmals seit dem 1. Quartal 2021
wieder erhöhen. Die stärkste Abnahme der
Wertschöpfung im Vergleich zum Vorjahresquartal
gab es im Baugewerbe mit -3,8 %. Den starken
Rückgängen im Hochbau und im Ausbaugewerbe stand
dabei ein Zuwachs im Tiefbau entgegen.
Insgesamt lag die preisbereinigte
Bruttowertschöpfung im 3. Quartal 2024 um 0,1 %
über dem Niveau des 3. Quartals 2023.
Erwerbstätigkeit entwickelt sich schwach
Die Wirtschaftsleistung wurde im 3. Quartal 2024
von rund 46,1 Millionen Erwerbstätigen mit
Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 66
000 Personen oder 0,1 % mehr als im 3. Quartal
2023. Dagegen sank die Erwerbstätigenzahl im
Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 45
000 Personen oder 0,1 %, was den ersten
saisonbereinigten Rückgang seit dem 1. Quartal
2021 darstellt (siehe Pressemitteilung Nr.
427/24 vom 15. November 2024).
Im
Durchschnitt wurden je erwerbstätiger Person
mehr Arbeitsstunden geleistet als im 3. Quartal
2023 (+0,2 %). Das gesamtwirtschaftliche
Arbeitsvolumen – also das Produkt aus der
gestiegenen Erwerbstätigenzahl und den
geleisteten Stunden je erwerbstätiger Person –
erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 0,4 %. Das
ergaben vorläufige Berechnungen des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der
Bundesagentur für Arbeit.
Die
gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität –
gemessen als preisbereinigtes BIP je
Erwerbstätigenstunde – nahm nach vorläufigen
Berechnungen gegenüber dem 3. Quartal 2023 um
0,2 % ab. Je erwerbstätiger Person stagnierte
sie im Vergleich zum Vorjahresquartal (0,0 %).
Einkommen und Konsum nominal gestiegen,
Sparquote im Vorjahresvergleich im Plus
In
jeweiligen Preisen war das BIP im 3. Quartal
2024 um 2,8 % und das Bruttonationaleinkommen um
2,6 % höher als ein Jahr zuvor. Das
Volkseinkommen war um 1,2 % höher als im 3.
Quartal 2023. Dabei stieg nach vorläufigen
Berechnungen das Arbeitnehmerentgelt um 5,2 %.
Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sanken
hingegen um 8,1 %. Die durchschnittlichen
Bruttolöhne und ‑gehälter je Arbeitnehmerin und
Arbeitnehmer lagen im 3. Quartal 2024 um 5,1 %
über dem Vorjahresquartal. Netto erhöhten sich
die Durchschnittsverdienste mit +5,0 %
geringfügig weniger.
Die Bruttolöhne und
-gehälter insgesamt waren um 5,3 % höher als im
Jahr zuvor, da sich auch die Zahl der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erneut leicht
erhöhte. Da das verfügbare Einkommen mit +4,1 %
deutlich stärker zunahm als die privaten
Konsumausgaben in jeweiligen Preisen (+2,7 %),
lag die Sparquote mit 10,6 % über dem
Vorjahreswert von 9,4 %.
Die deutsche
Wirtschaft im internationalen Vergleich
Zu
Beginn der zweiten Jahreshälfte lag die
wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands im
internationalen Vergleich leicht unterhalb des
europäischen Durchschnitts: In der Europäischen
Union (EU) insgesamt legte die
Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2024 im
Vergleich zum Vorquartal mit +0,3 % etwas
stärker zu als in Deutschland (+0,1 %).
Innerhalb der anderen großen Mitgliedstaaten der
EU stieg das preis-, saison- und
kalenderbereinigte BIP in Spanien mit +0,8 % am
stärksten. In Frankreich wuchs die
Wirtschaftsleistung um 0,4 %, während sie in
Italien im Vergleich zum Vorquartal stagnierte
(0,0 %). In den USA war die wirtschaftliche
Entwicklung mit +0,7 % zum Vorquartal deutlich
besser als in der EU. Im preis-, saison- und
kalenderbereinigten Vorjahresvergleich lag
Deutschland mit ‑0,3 % deutlich unterhalb der
Entwicklung in der EU (+1,0 %).
Bruttoinlandsprodukt, preis-, saison- und
kalenderbereinigt 3. Quartal 2024 Veränderung in
%
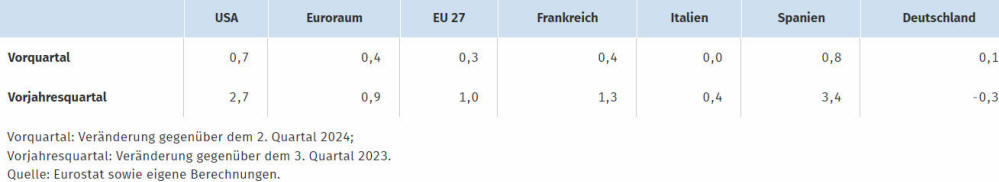
Freitag, 22. November 2024
Grundhochwasser: Stadt Dinslaken installiert
ein „Vorwarn-System“
In wenigen
Tagen jähren sich die Ereignisse um die stark
gestiegenen Grundwasserstände in Dinslaken. Im
November 2023 entdeckten die ersten Betroffenen
feuchte Stellen an ihren Kellerwänden. Etwas
später stand dann das Wasser bereits knöcheltief
in vielen Kellerräumen. Die Hausbewohner*innen
wendeten sich hilfesuchend an die Behörden und
auch an die Feuerwehr.
Statt
besinnlich die Feiertage zu genießen, mussten
die Geschädigten Möbel schleppen und Pumpen
installieren. Schläuche auf dem Gehweg mit
sprudelndem Wasser prägten einige Straßenzüge.
Der finanzielle Schaden und die Sorgen wurden
täglich größer. Insgesamt waren über 300
Haushalte betroffen. Große Ratlosigkeit machte
sich breit. Die Geschädigten und auch die
Fachleute rätselten über die Ursachen des
Grundwasserphänomens.
Nach einem
umfangreichen Gutachten und einem Antrag auf
finanzielle Hilfe für Anerkennung als
Naturkatastrophe, der vom Ministerium abgelehnt
wurde, installiert die Stadt Dinslaken nun
sieben Grundwasserbeobachtungsbrunnen als
„Vorwarn-System“. Kurz nach dem
Grundwasseranstieg organisierte die Stadt
Dinslaken Anfang Januar 2024 eine
Bürgerversammlung.
Einige der
Teilnehmenden äußerten verschiedene Vermutungen
für die Ursache des Problems. So wurden ein
örtliches Rückhaltebecken, ein abgeschaltetes
städtisches Pumpwerk, undichte Kanäle, das
Hochwasser im Rhein und insbesondere im Rotbach
oder auch das neu angelegte Emscherdelta in
Eppinghoven genannt. Zur Ursachenforschung wurde
im Anschluss an die Bürgerversammlung eine
Arbeitsgruppe, bestehend aus Fachleuten der
Stadtverwaltung und der Emschergenossenschaft
bzw. dem Lippeverband sowie von betroffenen
Anwohnern*innen, gegründet.
Die
Arbeitsgruppe hat insgesamt fünf Mal getagt.
Parallel dazu beauftragte die Stadt Dinslaken
einen Gutachter mit der Untersuchung des
Phänomens. Einige potenzielle Auslöser konnten
durch nähere Betrachtung (z.B. TV-Befahrung der
Kanäle, Begehung) direkt ausgeschlossen werden.
Auch der Kreis Wesel hatte sich zwischenzeitlich
in das Verfahren eingeschaltet. Das Gutachten
ist mittlerweile auf der städtischen
Internetseite einsehbar.
Demnach sind maßgeblich die starken
Niederschläge zwischen Oktober 2023 und Anfang
2024 verantwortlich für die übermäßige
Grundwasserneubildungsrate. Das Kalenderjahr
2023 war seit Auswertungsbeginn 1931 mit großem
Abstand das nasseste Jahr. Die
Jahresniederschlagsmenge von 1.360 mm überstieg
den langjährige Mittelwert um fast 70 Prozent.
Der Grundwasserspiegel wurde dadurch massiv
innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums
gespeist und stieg außergewöhnlich rasch und
hoch an.
Dass es sich nicht
ausschließlich um ein lokales Problem handeln
konnte, wurde im Laufe der Bearbeitung daran
ersichtlich, dass viele Regionen von Köln bis
Wesel bzw. Kamp-Lintfort bis Dortmund mit
ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten.
Um den betroffenen Privathaushalten einen ersten
Beitrag zur Unterstützung in der (auch
finanziellen) Not ermöglichen zu können, hatte
sich die Stadt Dinslaken an das Land NRW
gewandt. Die Anfrage zielte auf Anerkennung des
Grundwasser-Phänomens als Naturkatastrophe im
Sinne einer entsprechenden Richtlinie. Diesen
Antrag lehnte das Ministerium ab. Es begründet
die Ablehnung mit dem fehlenden kausalen
Zusammenhang zu der in der Richtlinie
aufgeführten Naturkatastrophen, wie Hochwasser,
Starkregen, Hagel, Sturm, Erdbeben, Erdrutsche,
usw.
Auch weitere formale
Voraussetzungen seien nicht erfüllt. Die in der
Arbeitsgruppe vorgeschlagenen baulichen
Maßnahmen zur Grundwasserabsenkung in einzelnen
Ortsteilen oder gar im gesamten Stadtgebiet
können von Seiten der Stadt nicht veranlasst
werden. Neben der Frage nach der
Finanzierbarkeit fehlt zudem die gesetzliche
Grundlage. Künftig ist die Politik gefragt, das
Thema Grundwasserbewirtschaftung im Wasserrecht
zu integrieren.
Damit kann eine
Legitimation geschaffen werden, um eine
Grundwasserregulierung zu einer staatlichen
Aufgabe zu machen wie die Abwasserbeseitigung,
den Hochwasserschutz oder die
Starkregenvorsorge. Um den Menschen in Dinslaken
helfen zu können, hat die Stadtverwaltung nun
ein „Vorwarn-System“ installiert. Dazu zählen
sieben Grundwasserbeobachtungsbrunnen, die über
das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Die
Messergebnisse können zukünftig auf der
städtischen Internetseite eingesehen werden.
(Die Stadt wird an dieser Stelle darauf
hinweisen, sobald diese online einzusehen sind)
Damit ist dann ein Vergleich zur
jeweiligen Kellersohle möglich, um die
Gefahrenlage frühzeitig zu erkennen. Das System
geht noch 2024 in Betrieb. „Ich hoffe, dass sich
die Ereignisse nicht so schnell wiederholen.
Aber der Blick auf die aktuellen
Wetterkapriolen, hervorgebracht durch den
Klimawandel, besorgt mich. Wir haben stadtweit
nun ein Beobachtungssystem installiert - als
einen ersten Schritt, um dem Grundwasser-Problem
zu begegnen und wir bleiben in stetigem
Austausch und Gespräch mit Expert*innen auf
diesem Fachgebiet“, so Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel.
Die Stadt rät ihren
Bürger*innen dringend, private Vorsorge zu
betreiben. Grundstücksbezogene Maßnahmen zur
Vermeidung eines schädlichen Grundwasserstands,
wie Ringdrainagen oder Absenkbrunnen sind
zulässig und ratsam. Das Ableiten des
geförderten Grundwassers in die städtische
Regenwasserkanalisation ist unter gewissen
Voraussetzungen bereits jetzt möglich. Die
Stadtverwaltung strebt dazu auch noch eine
entsprechende Satzungsänderung im nächsten Jahr
an.
Gegebenenfalls sind auch
nachträgliche Abdichtungsarbeiten der
Kellerwände geeignet. Für alle privat geplanten
Maßnahmen rät die Stadtverwaltung unbedingt zur
Beteiligung geeigneter Fachleute, um
finanzierbare und effektive Lösungen zu finden.
Der Umbau der vorhandenen Kellergeschosse als
sogenannte „Weiße Wanne“ (=
wasserundurchlässiges Bauwerk aus Beton) ist bei
Bestandsgebäuden nicht möglich.
Die
überwiegende Anzahl der Häuser mit einer solchen
Ausstattung hatten keine Probleme mit dem hohen
Grundwasserstand. Beim Neubau ist die
Berücksichtigung der möglichen
Grundwasserhöchststände für die am Bau
Beteiligten eine wichtige Aufgabe. Nur so kann
eine für Jahrzehnte wichtige Entscheidung über
die fachgerechte Herstellung – oder sogar den
Verzicht – eines Kellergeschosses getroffen
werden.
Ankündigung der
Klimaschutzflaggenverleihung an die Lokale
Agenda 21 Dinslaken und den Agenda-Rat
Das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel
zeichnet die Lokale Agenda 21 Dinslaken und den
Agenda-Rat am Samstag, den 23.11.2024 ab 12 Uhr,
am Grünzug Rabenkamp in Dinslaken, mit der
Klimaschutzflagge des Kreises Wesel aus.
Bereits seit 25 Jahren engagieren sich
ehrenamtliche Bürger*innen für eine nachhaltige
Entwicklung in Dinslaken.
Unter dem
Motto „global Denken - lokal Handeln“ schlossen
sie sich zur Lokalen Agenda 21 Dinslaken
zusammen, um gemeinsam im Sinne der
Nachhaltigkeit und der globalen Verantwortung
Projekte in der Stadt zu gestalten.
Mit
der Verleihung der Klimaschutzflagge werden
Initiativen, Unternehmen und Vereine im Kreis
Wesel geehrt, die sich im besonderen Maße dem
Klimaschutz widmen. Zu dieser Ehrung sind alle
Weggefährten der Lokalen Agenda 21 Dinslaken der
letzten 25 Jahre herzlich eingeladen.
Neues Amtsblatt
Am 20.
November 2024 ist ein neues Amtsblatt der Stadt
Dinslaken erschienen. Es enthält eine
öffentliche Bekanntmachung. Das Amtsblatt kann
auch auf der städtischen Homepage eingesehen
werden: www.dinslaken.de/stadt-buergerservice/aktuelles/amtsblatt.
Moers: Hauptausschuss diskutiert
über neue Hebesätze
Die
Grundsteuerhebesätze für das kommende Jahr sind
Thema des Hauptausschusses am Mittwoch, 27.
November. Die Sitzung findet ab 16 Uhr im
Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1, statt.
Hintergrund bildet eine Empfehlung des Landes
NRW, dass die neuen Hebesätze nach der
Grundsteuerreform ‚aufkommensneutral‘ sein
sollen. Das bedeutet, dass die Stadt keine Mehr-
oder Mindereinnahmen erzielen sollte.
Nach den Berechnungen des Landes müsste die
Stadt Moers ab dem kommenden Jahr den Hebesatz
der Grundsteuer A auf 521 Prozent und der
Grundsteuer B auf 947 Prozent festlegen. Wegen
der komplexen Gesamtthematik und der noch
ausstehenden Klärung der verfassungsrechtlichen
Zulässigkeit, will die Stadt vorerst darauf
verzichten, differenzierte Hebesätze
festzulegen.
Grundsätzlich wäre eine
Unterscheidung zwischen Gebäuden für Wohnen oder
beispielsweise Gewerbe möglich. Weitere Themen
sind unter anderem verschiedene Satzungen der
ENNI, die Erprobung eines Bürgerinnen- und
Bürger-Rates in Moers und der
Tagesstättenbedarfsplan 2024 – 2027. Die Sitzung
ist öffentlich.
Rekordwert: Fläche für
Naturschutzförderung in Landwirtschaft steigt
auf 43.000 Hektar Rund 33,6 Millionen Euro für
Naturschutz in Äckern und Grünland, Streuobst-
und Heckenpflege
Landwirtinnen und
Landwirte haben die Naturschutzförderung des
Landes in diesem Jahr so stark genutzt wie nie
zuvor. Mit Angeboten des sogenannten
Vertragsnaturschutzes hat das Umweltministerium
in diesem Jahr Schutzmaßnahmen auf rund 43.000
Hektar gefördert. Noch im Jahr 2022 betrug die
Förderfläche rund 39.000 Hektar.
Mit der
Förderung unterstützt das Umweltministerium eine
extensive Bewirtschaftung von Äckern und
Grünland sowie die Pflege von Streuobstbeständen
und Hecken. Maßnahmen mit einem Fördervolumen
von rund 33,6 Millionen Euro wurden in diesem
Jahr zur Auszahlung beantragt. Für die Umsetzung
stehen Mittel der Europäischen Union und des
Landes zur Verfügung.
„Neben
möglichst ursprünglichen Naturlandschaften sind
auch extensiv genutzte Kulturlandschaften
wichtige Rückzugsräume für seltene und bedrohte
Arten. Mit dem Vertragsnaturschutz erhalten wir
gemeinsam mit der Landwirtschaft wertvolle
Lebensräume, die durch technische Fortschritte
und den Strukturwandel im ländlichen Raum immer
seltener geworden sind“, so Oliver Krischer,
Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen.
„Es
freut mich, dass die Landwirtinnen und Landwirte
unsere Angebote des Vertragsnaturschutzes immer
stärker nutzen. Denn davon profitieren viele
Arten, deren Lebensräume in den letzten
Jahrzehnten immer seltener geworden sind.”
Kiebitze, Rotmilane, Rebhühner und Feldhasen
profitieren von verschiedenen extensiven
Ackernutzungen und ungenutzten Brachflächen.
Maßnahmen zur Stärkung der Feldhamstervorkommen,
wie der Ernteverzicht von Getreide oder die
Stoppelbrache, werden ebenfalls gefördert.
Unterstützt werden auch Ackerränder zum
Schutz der gefährdeten Feldflora, wie zum
Beispiel dem Ackerrittersporn, sowie
Blühstreifen, die Insekten und Vögeln als
Nahrungsquelle und Lebensraum dienen. Wird in
Grünland auf Düngung und Pestizide verzichtet,
können sich nicht nur konkurrenzstarke Gräser
behaupten, sondern sich bunte Wildwiesen mit
reichem Nahrungsangebot für Insekten entwickeln.
Die extensive Nutzung in Verbindung mit späten
Mahdterminen gewährleisten den Schutz von
Wiesenbrütern wie dem Braunkehlchen oder der
Feldlerche.
Auch Biotope wie
Orchideenvorkommen und Streuobstbestände werden
über den Vertragsnaturschutz erhalten. Auf
Streuobstwiesen findet besonders der Steinkauz
ideale Brut- und Jagdmöglichkeiten. Neben dem
Netz an Schutzgebieten ist der
Vertragsnaturschutz damit ein wichtiger Baustein
zur Bewahrung des heimischen Naturerbes. Rund
8.270 Hektar der Förderfläche entfallen in
diesem Jahr auf Ackerextensivierungen, etwa
34.450 Hektar auf Grünland und 960 Hektar auf
Streuobstbestände und Hecken.
Während im Jahr 2022 insgesamt rund 23,8
Millionen Euro für Vertragsnaturschutzmaßnahmen
ausgezahlt wurden, betrug die Förderung im Jahr
2023 schon rund 29,1 Millionen Euro. Im Jahr
2024 wurden rund 33,6 Millionen Euro zur
Auszahlung beantragt. Die Biologischen
Stationen, die Unteren Naturschutzbehörden und
die Landwirtschaftskammer bieten Landwirtinnen
und Landwirte entsprechende Beratungsangebote
zur Umsetzung von Natur- und
Artenschutzmaßnahmen.
Naturerbe in
Nordrhein-Westfalen
„Der weltweite
Artenrückgang ist neben dem Klimawandel die
zweite ökologische Krise unserer Zeit. Durch
eine ambitionierte Naturschutzpolitik konnten
wir in Nordrhein-Westfalen zwar eine leichte
Verbesserung erreichen. Unsere Artenvielfalt ist
aber weiterhin dramatisch gefährdet“, so
Krischer. Nach einer vorläufigen Auswertung der
Roten Listen kommt das Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) zu dem
Ergebnis, dass rund 44,4 Prozent der
untersuchten Tier-, Pilz- und Pflanzenarten in
Nordrhein-Westfalen als gefährdet gelten. Damit
ist seit der letzten Erhebung im Jahr 2011 mit
damals 46,3 Prozent zwar eine leichte
Verbesserung festzustellen.
Für eine
Entwarnung ist es laut Umweltministerium aber zu
früh. Die Rückkehr von Tierarten wird möglich,
wenn deren Lebensräume wiederhergestellt worden
sind und damit die Tiere die entsprechenden
Rückzugsräume für ein Überleben in möglichst
naturnahen Biotopen finden. Dass ein aktiver
Naturschutz wirkt, zeigt die aktive und
erfolgreiche Wiederansiedlung von ehemals
ausgestorbenen Tierarten wie dem Uhu, dem Lachs,
dem Biber oder dem Wanderfalken.
Es
kehren aber auch viele Tiere auf natürliche Art
zurück, weil sich die Lebensräume qualitativ
verbessert haben, wie zum Beispiel die
Weißstörche, die Anfang der 1990er-Jahre in
Nordrhein-Westfalen so gut wie ausgestorben
waren und von denen im Jahr 2023 landesweit
wieder 784 Brutpaare mit insgesamt 1.491
ausgeflogenen Jungvögeln nachgewiesen werden
konnten – ein neuer Rekord für
Nordrhein-Westfalen. Zur weiteren Stärkung des
Natur- und Artenschutzes setzt die
Landesregierung auf ein umfangreiches
Maßnahmenpaket.
Weitere Bausteine
sind die Verdopplung der Landesmittel für den
Naturschutz, die Erweiterung des Netzes der
Vogelschutzgebiete, das gestartete Verfahren für
einen zweiten Nationalpark und die
Weiterentwicklung der Biodiversitätsstrategie.
Neues Förderangebot auch für Privatpersonen Mit
den Umweltschecks hat das Umweltministerium
zudem ein neues Förderangebote für den Natur-
und Artenschutz geschaffen, dass sich auch an
Privatpersonen richtet. Neben der Anlage und
Pflege von Lebensräumen sind dabei zum Beispiel
auch Angebote zur Naturschutzbildung und
Öffentlichkeitsarbeit förderfähig.
Bis zu 1.000 Umweltschecks
„Naturschutz Nordrhein-Westfalen“ in Höhe von
jeweils 2.000 Euro stellt das Umweltministerium
Nordrhein-Westfalen hierfür bereit. Gefördert
werden zum Beispiel die Anlage von Biotopen, die
Förderung von Insektenlebensräumen oder
Veranstaltungen und Mitmachaktionen des
praktischen Naturschutzes sowie
Informationsangebote im Gelände.
Mögliche Orte für Maßnahmen sind zum Beispiel
Schulhöfe, Vereinsgrundstücke oder öffentliche
Flächen, die von der Gemeinde zur Verfügung
gestellt werden. Eigenanteile sind nicht
erforderlich: Die Förderung beträgt pauschal
2.000 Euro, wenn förderfähige Ausgaben in
mindestens dieser Höhe nachgewiesen werden.
Wichtig ist, dass die Umsetzung erst nach
Antragstellung und Bewilligung erfolgt.
Was wird gefördert?
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert
Vorhaben, die sich mit Maßnahmen zum Erhalt und
zum Schutz der Natur befassen. Voraussetzung für
die Förderung ist, dass die Maßnahmen zum Schutz
der Natur beitragen oder Menschen für lokalen
und regionalen Natur- und Artenschutz
begeistern. Hierzu gehören zum Beispiel die
Anlage von Biotopen, die Förderung von
Insektenlebensräumen oder Veranstaltungen und
Mitmachaktionen des praktischen Naturschutzes
sowie Informationsangebote im Gelände.
Wichtig ist, dass die Umsetzung erst nach
Antragstellung und Bewilligung erfolgt. Die
Vorhaben müssen bis zum Ende des jeweiligen
Haushaltsjahres abgeschlossen sein. Wer ist
antragsberechtigt? Natürliche Personen und
juristische Personen des privaten Rechts.
Antragstellung/ Fristen Anträge können
vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel über das Online Portal
förderung.nrw gestellt werden. Die Antragsfrist
für dieses Jahr ist der 30.11.2024. Vollständige
Anträge werden durch das Ministerium in der
Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Die
Vorhaben müssen bis zum 31.12. des jeweiligen
Haushaltsjahres abgeschlossen sein.
Weihnachtsmarkt im Heubergpark mit
dem Weseler Hüttenzauber
Nach der
erfolgreichen Premiere des Weseler Hüttenzaubers
im letzten Jahr, wird der Heubergpark auch in
diesem Jahr wieder in weihnachtlichem Glanz
erstrahlen – vom 04. bis 08.12. „Wir freuen uns
mit dem Hüttenzauber einen weiteren
Weihnachtsmarkt in Wesel zu etablieren,“
berichtet Dagmar van der Linden,
Geschäftsführerin von WeselMarketing,
begeistert.

WeselMarketing GmbH - Simona Weber
Mit
einem kurzen Fußweg von der Eisbahn zum
Heubergpark taucht man in eine ganz besondere
Weihnachtswelt ein. Das Angebot der
Hüttenzauber-Aussteller reicht von Geschenkideen
über weihnachtliche Dekoration und Accessoires
bis hin zu Glühwein und weiteren Leckereien. 25
Ausstellerinnen und Aussteller werden bei dem
5-tägigen Weihnachtsmarkt mit ihren Produkten
und ihrem kulinarischen Angebot die
Besucherinnen und Besucher begeistern.
In diesem Jahr wird es auch eine eigene
Hütte der Stadtinformationen und WeselMarketing
geben. Hier werden passend zur Weihnachtszeit
neue Wesel Produkte zum ersten Mal angeboten.
Eröffnung mit Nikolausumzug Eröffnet wird der
Weseler Hüttenzauber am 04.12. mit einem
Nikolausumzug. Vom Großen Markt durch die
Fußgängerzone bis zum Heubergpark zieht der
Nikolaus mit seinem Gefolge.
Musikalisch wird das Ganze begleitet vom
Musikzug Lackhausen. Um 18 Uhr geht es am Großen
Markt los, jeder ist eingeladen mit dem Nikolaus
mitzulaufen. Im Park angekommen werden noch ein
paar Weihnachtslieder gesungen. WeselMarketing
lädt die Kinder ein, ihre Laternen mitzubringen.
Der Nikolausumzug ist ein Gemeinschaftsprojekt
von WeselMarketing, der Pfarrgemeinde St.
Nikolaus und der Hanse-Gilde Wesel e.V.
Viefältiges Rahmenprogramm
Ein buntes
Rahmenprogramm für Groß und Klein lädt beim
Hüttenzauber zum Verweilen ein. Ob
Märchenstunde, Esel oder Greifvögel die für
strahlende Kinderaugen sorgen oder das
musikalische Programm, das zu einem
stimmungsvollen Ambiente beiträgt. Die
Märchenerzählerinnen und -erzähler laden die
Kinder ein, sich mit ihnen auf die Bühne zu
setzen und spannenden Geschichten zu lauschen.
Im Anschluss erhält jedes Kind ein kleines
Geschenk von Westenergie. Nur so lange der
Vorrat reicht.
Freitag und Sonntag
ist das Eselteam Niederrhein mit jeweils drei
Eseln vor Ort. Die Falknerei Grieblinger trägt
mit verschiedenen Greifvögeln und vielen
Informationen einen spannenden Programmpunkt zum
Hüttenzauber bei. Wie im letzten Jahr bauen die
Pfadfinder vom Fusternberg ihre Jurte auf. Sie
laden dazu ein, es sich am Feuer gemütlich zu
machen und und gegen eine Spende ein Stockbrot
zu grillen.
Auch eine
Kinder-Eisenbahn findet Platz im Heubergpark.
Musikalisches Bühnenprogramm Musikalisch wird es
natürlich auch. Hier bedankt sich WeselMarketing
bei dem Team vom EselRock e.V., dass bestehende
Kontakte genutzt hat und das Programm auf die
Beine gestellt hat. Das Duo Noah & Angelina wird
Donnerstag, Samstag und Sonntag sowohl auf der
Bühne als auch an verschiedenen Stellen im Park
musikalisch in Aktion treten. Sie präsentieren
eigene Kreationen und bekannte Songs.
Zusätzlich singt am Donnerstag der Chor des
städtischen Musikvereins um 18 Uhr. Die fast 60
Mitsingenden begeistern mit adventlichem und
weihnachtlichem Programm und laden ein kräftig
mitzusingen. Am Freitag werden die unter der
Leitung von Stephan Marten Colorsounds ab 19 Uhr
auf der Bühne stehen. Die Colorsounds singen
eigens arrangierte Versionen bekannter Pop- und
Rocksongs sowie moderne Worship Songs. Der
Gospelchor der Evanglischen Kirchengemeinde
GospelTrain präsentiert am Sonntag ab 14.30 Uhr
adventliche Gospelsongs.
Öffnungszeiten
im Überblick
Mittwoch und Donnerstag von 16
bis 20 Uhr
Freitag von 16 bis 21 Uhr
Samstag von 13 bis 21 Uhr
Sonntag von 13 bis
20 Uhr
Enni liest Zähler bei 4.600
Kunden ab: Ableseteam ist im Dezember in der
Moerser Stadtmitte unterwegs
Das
Ableseteam der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein
(Enni) ist im Zuge des sogenannten rollierenden
Ableseverfahrens im Dezember in der Moerser
Stadtmitte unterwegs. „Dieses Mal erfassen wir
dort bei etwa 4.600 Haushaltskunden rund 7.100
Strom-, Gas- und Wasserzählerstände. Dabei
unterstützt uns die Dienstleistungsgesellschaft
ASL Services“, informiert Lisa Bruns als
zuständige Mitarbeiterin der Enni.
Sind vereinzelte Zähler nicht für die Ableser
der ASL zugänglich, hinterlassen sie eine
Informationskarte im Briefkasten. „Die Bewohner
finden darauf die Telefonnummer und die
E-Mail-Adresse, an die sie die Zählerstände
selbst mitteilen können“, so Bruns. Wichtiger
Hinweis: Die Ablesung erfolgt jährlich. Als
wiederkehrendes Ereignis informiert die Enni die
Kunden nicht gesondert darüber.
Dennoch hofft Lisa Bruns auf deren
Unterstützung: „Wichtig für uns ist, dass die
Zähler frei zugänglich sind. Nur so ist ein
schneller und reibungsloser Ablauf
gewährleistet.“ Übrigens: Damit keine schwarzen
Schafe in die Häuser gelangen, haben alle durch
Enni beauftragten Ableser einen Dienstausweis.
Bruns: „Den sollten sich Kunden zeigen lassen,
damit keine ungebetenen Gäste ins Haus
gelangen.“ Im Zweifel sollten sich Kunden bei
der Enni unter der kostenlosen Service-Rufnummer
0800 222 1040 informieren.
Wo am Tag der offenen Tür an der
Ida-Noddack Gesamtschule (Samstag, 23. November)
geparkt werden kann
Wer in Wesel
gerne zum Einkaufen oder Spazieren kommt, nutzt
eine der vielen Parkgelegenheiten. So können
Besucher*innen an Wochenenden (und werktags ab
16 Uhr) viele öffentliche Parkflächen kostenlos
nutzen, unter anderem an der Ida-Noddack
Gesamtschule.
Da am kommenden Samstag,
23. November 2024, an der Ida-Noddack
Gesamtschule ein Tag der offenen Tür
stattfindet, steht der Schulhof (in der
unterrichtsfreien Zeit als zusätzliche
Parkfläche) für Fahrzeuge nicht zur Verfügung.
Wer dennoch in der Nähe des Rathauses parken
möchte und keinen freien Parkplatz findet, kann
für zwei Euro ganztägig auf dem Martini-Parkdeck
(unmittelbar vor dem Rathaus) parken.

Martinistraße 12 Quelle: Flaggschiff Film
Wartungsarbeiten beim Rechenzentrum:
Einige Online-Dienste zeitweise nicht verfügbar
Am kommenden Wochenende, 23. und 24. November
2024, stehen einige Online-Dienste des Kreises
Wesel zeitweise nicht zur Verfügung. Das
Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) führt
routinemäßige Wartungsarbeiten an seinen Servern
durch.
Ab Montag, 25. November 2024, sollen
alle Online-Services wie gewohnt zur Verfügung
stehen.
B58: Wesel Ortsumgehung Büderich -
Gehölzpflege am Samstag
Am Samstag (23.11.) werden durch die
Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein
Gehölzpflegearbeiten entlang der B 58
Ortsumgehung Wesel-Büderich (Xantener
Straße/Weseler Straße) durchgeführt. Die
Arbeiten betreffen in erster Linie die Fällungen
der starkwüchsigen und teilweise
verkehrsgefährdenden Pappeln.
In den
Arbeitsbereichen der Wanderbaustelle wird die
Fahrbahn verengt und die Geschwindigkeit für die
Verkehrsteilnehmer reduziert. Zusätzlich sollte
mit Verschmutzungen der Fahrbahn gerechnet
werden. Gearbeitet wird zwischen Sonnenauf- und
Sonnenuntergang. Die Arbeiten wurden im Vorfeld
mit der „Unteren Naturschutzbehörde Wesel“
abgestimmt.

Krankenhausaufenthalte:
Höchster Anstieg der Patientenzahl unter den
zehn häufigsten Diagnosekapiteln waren
Krankheiten des Atmungssystems (+11,2 Prozent).
Im Jahr 2023 sind 4,2 Millionen Menschen
(einschließlich Neugeborene) aus
Nordrhein-Westfalen aus einer vollstationären
Behandlung in Krankenhäusern entlassen worden.
Wie das Statistische Landesamt mitteilt, waren
das 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2022:
4,1 Millionen).
Wie in den Jahren
zuvor waren Krankheiten des Kreislaufsystems
(633 000 Fälle), Krankheiten des
Verdauungssystems (424 100 Fälle) und
Neubildungen (410 900 Fälle) die drei
Diagnosekapitel mit den meisten
Behandlungsfällen. Der höchste Patientenanstieg
bei den zehn häufigsten Diagnosekapiteln wurde
für die Krankheiten des Atmungssystems ermittelt
(+11,2 Prozent).
Herzinsuffizienz
war die häufigste Diagnose für vollstationäre
Krankenhausaufenthalte
Bei den
Einzeldiagnosen war Herzinsuffizienz mit 106 600
Fällen der häufigste Grund für einen
vollstationären Krankenhausaufenthalt
(+6,0 Prozent). Herzinsuffizienz war in 44 der
53 nordrhein-westfälischen kreisfreien Städte
und Kreise häufigster Anlass für vollstationäre
Krankenhausaufenthalte.
Zweithäufigste Diagnose war
Vorhofflattern/-flimmern (89 200 Fälle;
+10,1 Prozent) gefolgt von sonstiger chronischer
obstruktiver Lungenkrankheit (60 700 Fälle;
+12,5 Prozent). Bei Patientinnen und Patienten
aus Bonn, Leverkusen, dem Kreis Euskirchen, dem
Kreis Heinsberg, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis
dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Kreis Coesfeld und aus
Münster, war Vorhofflattern/-flimmern die
häufigste Diagnose für eine stationäre
Krankenhausbehandlung.
Im Kreis
Warendorf waren Herzinsuffizienz und
Vorhofflattern/-flimmern mit der gleichen Anzahl
an Behandlungen häufigster Anlass für eine
vollstationäre Behandlung. Krankheiten des
Muskel-Skelett-Systems waren der häufigste
Anlass für stationäre
Rehabilitationsbehandlungen Häufigster Anlass
für eine stationäre Behandlung in Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen (mit mehr als 100
Betten) waren für Menschen aus
Nordrhein-Westfalen auch im Jahr 2023
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des
Bindegewebes (99 000 Fälle; 30,6 Prozent),
gefolgt von psychischen und Verhaltensstörungen
(62 600 Fälle; 19,4 Prozent) und Krankheiten des
Kreislaufsystems (46 300; 14,3 Prozent).
Mit 35,8 Tagen dauerte der stationäre
Aufenthalt bei psychischen und
Verhaltensstörungen am längsten. Die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei
stationären Behandlungen in Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen betrug 26,0 Tage.
IT.NRW als Statistisches Landesamt erhebt und
veröffentlicht zuverlässige und objektive Daten
für das Bundesland Nordrhein-Westfalen für mehr
als 300 Statistiken auf gesetzlicher Grundlage.
(IT.NRW)
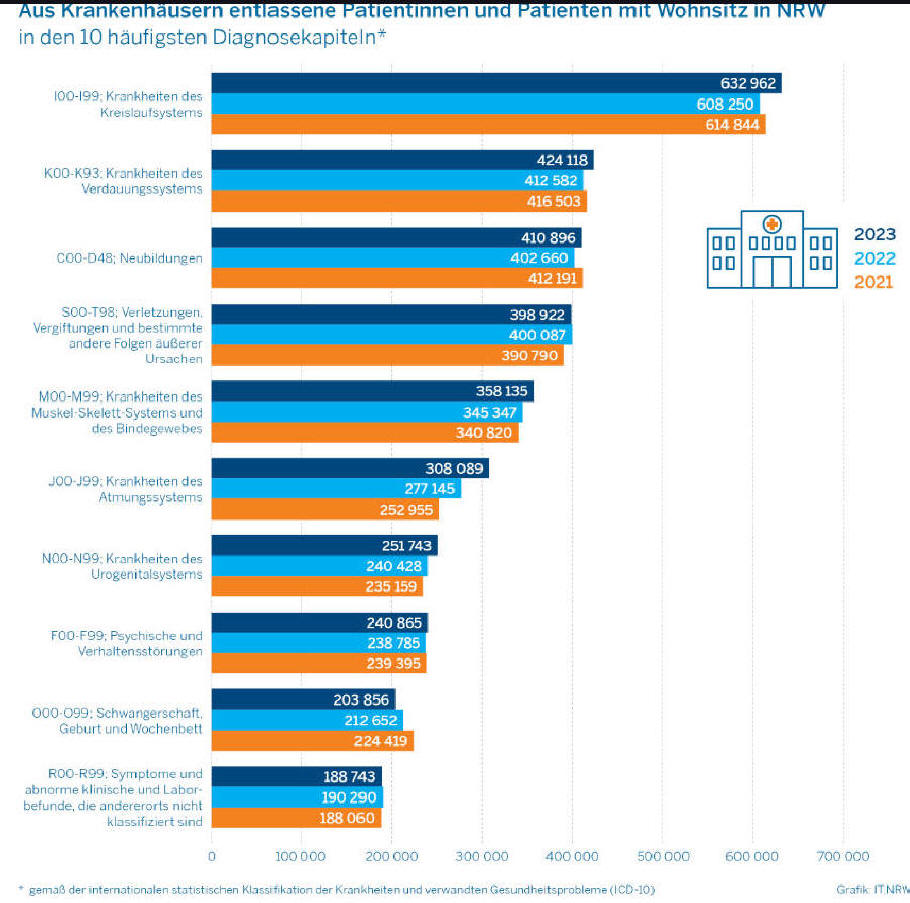
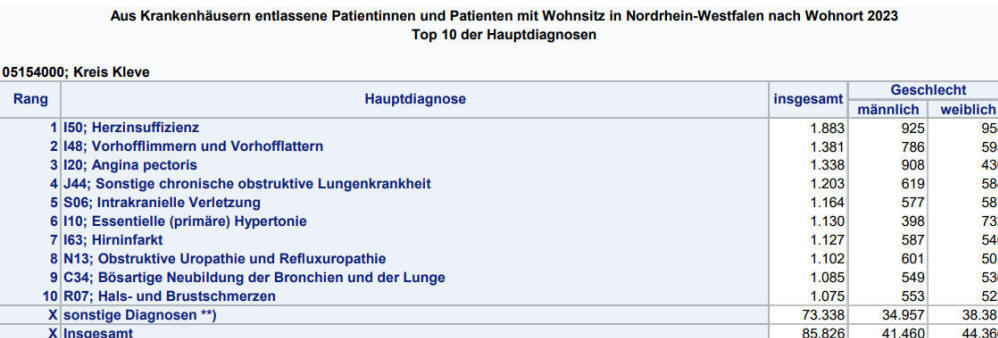
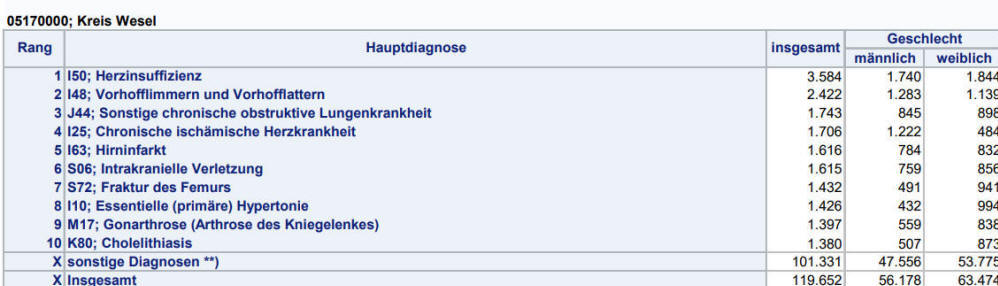
NRW-Industrie: Absatzproduktion von
Wasserstoff 2023 um 21,5 Prozent gesunken
Im Jahr 2023 sind in 29 der 9 901
produzierenden Betriebe des
nordrhein-westfälischen Verarbeitenden Gewerbes
zum Absatz bestimmte Industriegase im Wert von
690,6 Millionen Euro hergestellt worden. Das
waren nominal 50,8 Millionen Euro bzw.
6,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
Gegenüber dem Jahr 2019 stieg der Absatzwert um
233,8 Millionen Euro (+51,2 Prozent).
Produktion von Wasserstoff und Sauerstoff
gesunken
Im vergangenen Jahr wurden u. a. in
13 nordrhein-westfälischen Betrieben
3,1 Milliarden Kubikmeter Stickstoff
(+0,7 Prozent gegenüber 2022) mit einem
nominalen Absatzwert von 191,6 Millionen Euro
(+15,6 Prozent) hergestellt. 13 Betriebe
erzeugten 2,7 Milliarden Kubikmeter Sauerstoff
(−4,5 Prozent) im Wert von 266,8 Millionen Euro
(+2,7 Prozent) und in 12 Betrieben wurden
618,3 Millionen Kubikmeter Wasserstoff
(−21,5 Prozent) im Wert von 107,6 Millionen Euro
(−37,1 Prozent) zum Absatz produziert.
NRW-Betriebe erzielten 41 Prozent des
bundesweiten Absatzwertes; fast 20 Prozent
entfiel auf Betriebe im Regierungsbezirk
Düsseldorf Bundesweit lag der Absatzwert von
Industriegasen im Jahr 2023 bei 1,7 Milliarden
Euro (−4,7 Prozent gegenüber 2022); der
NRW-Anteil am bundesweiten Absatzwert lag bei
41,0 Prozent (2022: 42,0 Prozent). 47,7 Prozent
des NRW und 19,6 Prozent des Bundesabsatzwertes
der 2023 in NRW produzierten Industriegase wurde
in Betrieben des Regierungsbezirks Düsseldorf
erzielt..
Absatzwert auch im ersten
Halbjahr 2024 gesunken
Im ersten Halbjahr
2024 produzierten nach vorläufigen Ergebnissen
27 nordrhein-westfälische Betriebe zum Absatz
bestimmte Industriegase im Wert von
316,1 Millionen Euro (−13,4 Prozent gegenüber
dem entsprechenden Vorjahreszeitraum). Gegenüber
dem ersten Halbjahr 2019 stieg der Absatzwert
dagegen nominal um 35,7 Prozent.
Die
genannten Ergebnisse beziehen sich auf Betriebe
von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes mit
im Allgemeinen 20 oder mehr Beschäftigten. Der
Wert der zum Absatz bestimmten Produktion wird
unter Zugrundelegung des im Berichtszeitraum
erzielten oder zum Zeitpunkt des Absatzes
erzielbaren Verkaufspreises (ohne Umsatz- und
Verbrauchsteuer) ab Werk berechnet.
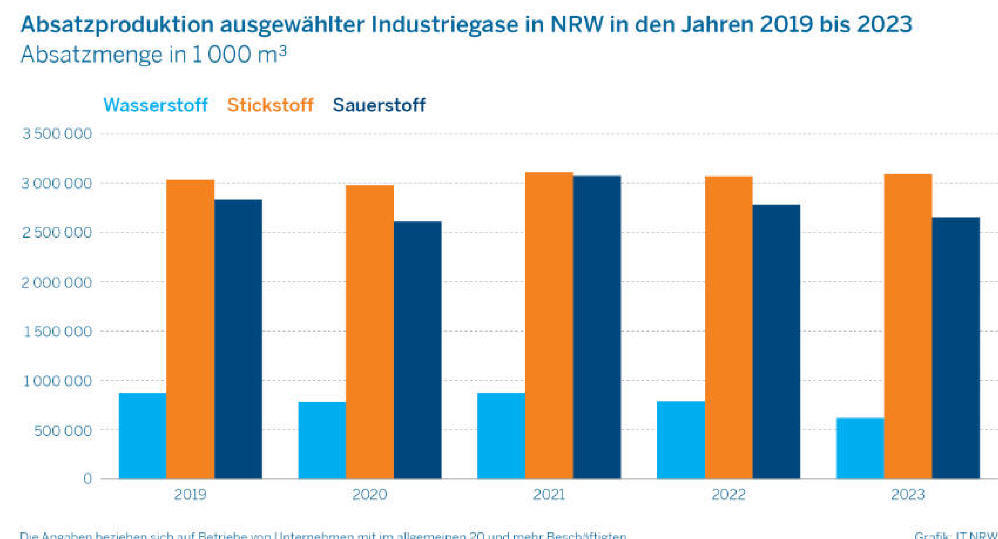
Donnerstag, 21. November 2024
Schneetreiben am Niederrhein...

... und am Sonntag zweistellige Plusgrade
Bundestagswahl 2025: Konstituierung des
Bundeswahlausschusses ist erfolgt
Wie die Bundeswahlleiterin mitteilt, ist die
Konstituierung des Bundeswahlausschusses für die
Wahl zum 21. Deutschen Bundestag erfolgt. Der
Bundeswahlausschuss besteht aus der
Bundeswahlleiterin als Vorsitzende sowie acht
von ihr berufenen Wahlberechtigten als
Beisitzende und zwei Richterinnen
beziehungsweise Richtern des
Bundesverwaltungsgerichts, für die jeweils eine
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter
vorgesehen ist. Die Beisitzenden werden auf
Vorschlag der Parteien von der
Bundeswahlleiterin berufen.
Der Bundeswahlausschuss zur Bundestagwahl 2025
setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Geänderte Öffnungszeiten wegen
Personalversammlung am 21.11.
Wegen der jährlichen Personalversammlung sind
die Dienststellen der Dinslakener
Stadtverwaltung am Donnerstag, den 21. November
2024, für den Publikumsverkehr nur bis 12 Uhr
geöffnet. Das gilt auch für Bürgerbüro,
Stadtbibliothek, Archiv, Stadtinformation und
Wertstoffhof.
Die städtischen Kitas
schließen auch früher, hier muss die Kundgabe in
der KiTa beachtet werden. Die Bücherstube
Lohberg öffnet an diesem Tag nicht. Die
Stadtverwaltung bittet um Verständnis.
Hauptausschuss tagt
Am Dienstag, den 3. Dezember 2024, tagt der
Hauptausschuss der Stadt Dinslaken. Die Sitzung
beginnt um 17:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Tagesordnungen
sowie Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen
sind grundsätzlich auch online im
Ratsinformationssystem einsehbar.
Förderprogramm: Das NiederrheinRad
wird digital
In den kommenden Monaten erfolgt die Umrüstung
auf Schlösser, die sich per App entsperren
lassen. Unterstützt wird das Projekt von den
Bundestagsabgeordneten Udo Schiefner und Dr.
Martin Plum. Rund 300 Räder an 30
Verleihstationen – das NiederrheinRad hat sich
in den vergangenen 15 Jahren zu einem
Erfolgsmodell in der Region entwickelt.
Die grünen Räder – ob „klassisch“ oder mit
elektrischer Unterstützung – können flexibel
ausgeliehen und wieder abgegeben werden. Nun
erfolgt die „Digitalisierung des Verleihsystems
NiederrheinRad“. Unter dieser Überschrift
startet ein Projekt zur Umrüstung der Räder. „Im
Laufe der nächsten Monate werden sie mit
digitalen Schlössern ausgestattet“, erklärt
Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der
Niederrhein Tourismus GmbH. Die modernen
Schlösser ermöglichen die Anbindung an eine App.
„Künftig können die Räder ganz
einfach per Smartphone von berechtigten Personen
entsperrt werden“, so Baumgärtner. Auf dieser
Basis sind Reservierung, Vertragsabwicklung und
Bezahlung komplett digital möglich, was zur
Entlastung der Betriebe beiträgt, die als
Verleihstation fungieren (unter anderem Hotels,
Ausflugsziele und kommunale
Tourist-Informationen).
„Und für die
Nutzerinnen und Nutzer bietet die geplante
Umrüstung noch mehr Flexibilität bei der
Freizeitgestaltung als bisher“, sagt
Baumgärtner. Die erforderlichen
Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund
127.800 Euro. Rund 44.700 Euro an Eigenmitteln
sind vorgesehen. Dieses Projekt wird durch das
Bundesministerium für Digitales und Verkehr im
Rahmen des Förderprogramms „Digitalisierung
kommunaler Verkehrssysteme“ finanziert.
Die Zuwendungen betragen rund 83.000 Euro.
„Nur dadurch ist eine Realisierung möglich“,
betont Baumgärtner. Unterstützt worden war der
Antrag der Niederrhein Tourismus in Berlin von
den niederrheinischen Bundestagsabgeordneten Dr.
Martin Plum und Udo Schiefner. „Das Projekt
verfolgt zwei Ziele: nachhaltigen Tourismus und
klimaneutrale Mobilität – damit ist es eindeutig
unterstützenswert“, so Plum.
„Bundesmittel sind gut angelegt, wenn es darum
geht, den heute schon starken Tourismus am
Niederrhein weiterzuentwickeln“, sagt Schiefner.
Die Umrüstung der Räder sowie die Installation
soll Anfang des Jahres beginnen. Im Frühjahr,
zum Start der NiederrheinRad-Saison, könnte die
Entsperrung per Smartphone also bereits
angewendet werden. Die Akquise und Errichtung
neuer Stationen sind ebenfalls Bestandteil des
Projekts mit einer Laufzeit bis Ende Februar
2026.
„Wir streben damit auch die
Systemerweiterung auf den öffentlichen Raum an“,
so die NT-Geschäftsführerin. Hinzu komme die
verstärkte Nutzung außerhalb touristischer
Zusammenhänge: „Mobilstationen für die
Alltagsmobilität sind für die Zukunft denkbar.“

Freuen sich über den positiven Förderbescheid
aus Berlin: die Bundestagsabgeordneten Udo
Schiefer (l.) und Dr. Martin Plum sowie Martina
Baumgärtner (r.) und Kathrin Peters von
Niederrhein Tourismus. Foto: NT
Wesel:
Adventmarkt traditionell am ersten
Adventwochenende
Am ersten Dezemberwochenende, 29.11.–01.12.,
lädt der Adventmarkt am Dom mit verkaufsoffenem
Sonntag zu einem weihnachtlichen Bummel in die
Stadt ein. Der beliebte Markt präsentiert, wie
in jedem Jahr, das vielfältige Angebot der
Weseler Vereine. Von Glühwein über Plätzchen bis
hin zu Holzarbeiten wird das Angebot so
vielfältig sein wie die Weseler
Vereinslandschaft. Mit Unterstützung der
Volksbank Rhein-Lippe sind 53 Vereine in diesem
Jahr zum Start in den Advent auf dem Großen
Markt vertreten.

Quelle: Flaggschiff Film
Start mit
Pre-Opening Der Adventmarkt startet auch in
diesem Jahr mit dem Pre-Opening am Freitagabend
von 18 bis 21 Uhr. Am Samstag und Sonntag geht
es jeweils um 11 Uhr los. Gemeinsames Singen am
Samstag Ein Highlight ist in jedem Jahr das
gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern am
Samstagnachmittag um 17 Uhr mit Unterstützung
durch die Bläserklasse, dem Schulchor des
Andreas Vesalius Gymnasiums sowie dem
GospelTrain.
Liedhefte mit den
Liedern, die gesungen werden, sind am Samstag
bei allen Adventmarkt Teilnehmern zu bekommen.
Vorab wird der Adventmarkt offiziell eröffnet.
Hierzu lädt WeselMarketing herzlich ein.
Vielfältiges Angebot Viele Vereine sind bereits
seit Beginn mit dabei und locken jedes Jahr aufs
Neue mit ihrem Angebot – so dürfen sich die
Besucher*innen auf Handarbeiten,
Selbstgebasteltes, Handgemachte Dekoartikel aus
Holz- und Gießbeton, Weihnachtsdeko, Plätzchen,
Marmelade, Adventskränze, Laserarbeiten aus
Holz, Kerzen, Gestricktes und vielem Mehr
freuen.
Neu dabei sind in diesem
Jahr: Inner Wheel Club Wesel-Dinslaken-Walsum,
Kreis-Landfrauen Wesel, Krachgarten Kultur e.V.,
Segelclub Niederrhein, Kunst - und Kulturverein
Wesel e.V. Und auch kulinarisch kommen alle
wieder auf ihre Kosten: Grünkohl, Glühwein,
Waffeln, fruchtigen Punsch, Flammkuchen,
Popcorn, Currywurst, Suppen, Pizza, Butterbier
uvm. wartet darauf verspeist zu werden.
Verkaufsoffener Sonntag
Am Sonntag
öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag
ab 13 Uhr für eine weihnachtliche Einkaufstour.
Öffnungszeiten im Überblick
Freitag, 29.11.,
18 bis 21 Uhr
Samstag, 30.11. 11 bis 20 Uhr,
17 Uhr gemeinsames Singen
Sonntag, 01.12. 11
bis 18 Uhr, 17 Uhr
Prämierung kreativstes
Gesamtbild
Verkaufsoffener Sonntag, 13-18
Uhr
Alfa-Mobil zu Gast in Wesel:
Gemeinsam für mehr Lese- und Schreibkompetenz
Bereits zum dritten Mal machte das Alfa-Mobil
auf Einladung des Weseler Netzwerks Lesen und
Schreiben Station in Wesel. Das Netzwerk setzt
sich für erwachsene Menschen ein, die
Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben
haben. Am Infostand im Esplanade Center hatten
Besucher die Gelegenheit, sich über
Unterstützungsangebote, Lernmöglichkeiten und
Ursachen zu informieren.
Gemeinsam
mit den Netzwerkpartnern vhs Wesel, dem
Mehrgenerationenhaus des Sozialdienstes
katholischer Frauen, der Stadtbücherei, der
Stadt Wesel und der Koordinierungs-, Kontakt-
und Beratungsstelle (KoKoBe) klärten die
Vertreter des Alfa-Mobils vor Ort über das Thema
Alphabetisierung auf. Unterstützt wurden sie von
Betroffenen aus der Selbsthilfegruppe
Buchstabenbrücke für Erwachsene mit Lese- und
Schreibschwierigkeiten, die ihre Erfahrungen
teilten und wertvolle Einblicke in die
Lebensrealität von funktionalen Analphabeten
gaben.
Vielen Besuchern des
Infostandes wurde so deutlich, wie wichtig
lokale Netzwerke und niedrigschwellige Angebote
sind, um betroffenen Menschen Mut zu machen und
Wege in ein selbstbestimmteres Leben zu
ermöglichen. Durch den intensiven Austausch am
Stand wurde das Bewusstsein für Lese- und
Schreibprobleme gestärkt– ein wichtiges Ziel auf
dem Weg zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe und
Chancengleichheit. Im Rahmen der Kampagne
„Besser lesen und schreiben macht stolz“ ist das
ALFA-Mobil bundesweit mit dem Thema
Analphabetismus unterwegs.
Mit den
ALFA-Mobil Aktionen sollen Betroffene sowohl
direkt als auch indirekt über eine breite
Öffentlichkeit angesprochen werden. Das Projekt
wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung. Etwa 6,2 Millionen Erwachsene
können in Deutschland nicht ausreichend lesen
und schreiben, um uneingeschränkt am
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. In Wesel
sind es runtergerecht rund 4.000 Menschen.
Schulsozialarbeit: 6.400
Schülerinnen und Schüler in Kleve profitieren
von „Sozial-Profis“ in Klassenzimmern
Ein Klassenraum von innen. Zu sehen sind leere
Stühle und eine Tafel. Rund 6.400 Kinder und
Jugendliche profitieren in der Stadt Kleve von
der Schulsozialarbeit an ihren Schulen.
Geleistet wird sie von derzeit 13
„Sozial-Profis“.
Für das Jugendamt
stehen sie hoch im Kurs: „Die Expertinnen und
Experten mit sozialpädagogischem Hintergrund
kümmern sich um Probleme, die an Schulen
auftauchen – von der Jugendgewalt über das
Schulschwänzen bis hin zur Drogen-, Alkohol-
oder Internet-Sucht“, sagt Markus Koch,
kommissarischer Leiter des Jugendamtes der Stadt
Kleve.

Ebenso um das, was Kindern und Jugendlichen
im Alltag auf den Nägeln brenne – von
finanziellen Belangen bis zum Liebeskummer. Für
ihn ist die Schulsozialarbeit eine Art „soziale
Feuerwehr“, die zu 90 Prozent Brandvermeidung
leiste, also Prävention. „Nur bei 10 Prozent
geht es wirklich ums Löschen. Die
Schulsozialarbeit kommt dabei im Klassenzimmer
und auf dem Schulhof genauso zum Einsatz wie im
Lehrerzimmer. Denn sie glättet auch die Wogen,
wenn es einmal Ärger mit Lehrerinnen oder
Lehrern gibt. Und natürlich auch dann, wenn der
Haussegen schief hängt – wenn Kinder und
Jugendliche Probleme mit den Eltern haben“, so
Koch.
Die Fachkräfte an den Schulen
arbeiten auch gezielt mit Gruppenangeboten, um
das soziale Lernen zu stärken. So gehört die
Ausbildung von Streitschlichtern oder die
Unterstützung im Klassenrat zu den regelmäßigen
Aufgaben. Die überwiegend von der Stadt Kleve
finanzierte Schulsozialarbeit wird vom
Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. als
anerkannter freier Träger der Jugendhilfe
geleistet. Vier weitere volle Stellen bringen
die Schulen selbst über Landesmittel ein.
Das Jugendamt und das Land NRW setzen
mit den sozialpädagogischen Fachkräften auch
wahre Integrationsprofis an den Schulen ein, die
immer dann zur Stelle sind, wenn es um
Ausgrenzung, Kränkung oder Gewalt geht. Und sie
unterstützen Schülerinnen und Schüler: „Ob es
darum geht, einen schulischen Durchhänger zu
meistern oder die optimale Schulkarriere zu
planen, die Schulsozialarbeit in Kleve ist
längst zum Qualitätsmerkmal für die
Klassenzimmer geworden“, sagt Markus Koch.
Die Schule sei schließlich mehr als ein
bloßer Ort der Wissensvermittlung. Es gehe um
mehr als das Pauken von ABC und Algebra. Mit den
sozialpädagogischen Fachkräften investiere das
Jugendamt gezielt in die Startchancen von
Kindern und Jugendlichen. Die Schulsozialarbeit
leistet also einen wichtigen Beitrag dazu, dass
keiner zu kurz kommt.
„Sie dreht an
unterschiedlichen Stellschrauben, damit
Benachteiligungen verschwinden und ist dann zur
Stelle, wenn Leistungs- und Wettbewerbsdruck
überhandnehmen“, so Markus Koch. Gerade für
Schulabgänger seien die Fachkräfte wichtig:
„Immerhin begleiten sie bei vielen den Übergang
von der Schule in Ausbildung und Beruf.“
Auch bei Kriminalität,
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus
seien die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
wichtige Ansprechpartner für die Jugendlichen.
„Mit ihrer präventiven Arbeit bieten die
Fachkräfte eine enorme Hilfe für die
Schülerinnen und Schüler. Darin sehen wir einen
Gewinn für das Schulklima.“, so Koch.
Moers: Städtische Baumaßnahmen im
Ausschuss am 25. November
Berichte zu Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden
und Einrichtungen erhalten die Mitglieder des
Ausschusses für Bauen, Wirtschaft und
Liegenschaften am Montag, 25. November.
Die
Sitzung startet um 16 Uhr im Ratssaal des
Rathauses, Rathausplatz 1. An dem Nachmittag
stellt das Zentrale Gebäudemanagement auch
seinen Jahresbericht und seinen Geschäftsbericht
für das Jahr 2023 vor. Die Sitzung ist
öffentlich.
RWI-Studie: Pflegenotstand in Heimen
erhöht Verweildauer von Krankenhauspatienten
Wenn alte Patienten nach ihrer Behandlung im
Krankenhaus auf einen Pflegeheimplatz angewiesen
sind, haben sie aufgrund des Personalmangels in
deutschen Pflegeheimen oftmals Schwierigkeiten,
einen Platz zu finden. Dadurch erhöht sich die
Verweildauer in den Krankenhäusern um bis zu 40
Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommt eine
aktuelle Studie des RWI – Leibniz-Instituts für
Wirtschaftsforschung in Essen.
Infolge des Mangels an Pflegeheimplätzen bleiben
Betroffene im Durchschnitt drei bis vier
zusätzliche Tage im Krankenhaus. Dieser
verlängerte Aufenthalt führt zu zusätzlich
abgerechneten Krankenhauskosten von rund 400
Euro pro Patienten. Aufgrund der Fallpauschalen
verringern sich die abrechenbaren Kosten mit
steigender Verweildauer, weshalb die tatsächlich
anfallenden Kosten deutlich höher liegen
dürften.
Patienten mit höherem Pflegegrad sind
besonders benachteiligt. Heime bevorzugen
aufgrund des Personalmangels die Aufnahme von
Menschen mit geringerem Pflegebedarf. Dies führt
dazu, dass die am stärksten pflegebedürftigen
Menschen am längsten im Krankenhaus auf einen
Platz warten müssen. idr
Bauhofleitung (m/w/d)
Der Fachdienst Immobilienmanagement
(FD 65) des Kreises Wesel sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Alpen eine
Bauhofleitung (m/w/d) Weitere Informationen zur
Stellenausschreibung und die Möglichkeit zur
Onlinebewerbung ergeben sich über unser Bewerbungsportal.
Dinnerkrimi 2024 in Kalkar: Neue spannende
Fälle und aufregende Ermittlungen
Das erfolgreiche Dinnerkrimi-Format
geht 2024 in die nächste Runde und
präsentiert neue, spannende Fälle, die es zu
lösen gilt. An über 450 Standorten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
wurden bereits zahlreiche Morde ermittelt
und aufgeklärt. Auch das landhaus Beckmann
in Kalkar - Kehrum / Kleve wird nun zum
Tatort, an dem schon bald ein schreckliches
Verbrechen geschehen wird.

Landhaus Beckmann
Die Ermittlungen zu einem aufregenden
Kriminalfall, angeleitet von professionellen
Schauspielern, finden am 22. November 2024
um 19:00 Uhr statt – Tickets erhältlich
unter
www.dinnerkrimi.de! Landhaus Beckmann
Dinnerkrimi 2024 in Kalkar - Kehrum: Neue
spannende Fälle und aufregende
Ermittlungen. Willkommen beim
„Dinnerkrimi“, eine spannende Kombination
aus interaktivem Theater und kulinarischem
Genuss!
Während eines köstlichen Mehr-Gänge-Menüs
entfaltet sich eine fesselnde
Kriminalgeschichte. Doch Vorsicht ist
geboten: Unter den Gästen befindet sich ein
Mörder. Gemeinsam mit dem Schauspielteam
gilt es den Mordfall zu ermitteln, um dabei
den Täter zu entlarven.
Das Konzept des Dinnerkrimis hat sich
bereits an über 450 Standorten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
bewährt. Auch das Landhaus Beckmann wird zum
Tatort, an dem sich schon bald ein
Kriminalfall ereignen wird.
Termin: Freitag, 22. November 2024
Beginn:19:00 Uhr / Einlass ab 18:30 Uhr.
Eintrittskarten sind ab 94,90 € an allen
bekannten Vorverkaufsstellen oder online
unter
www.dinnerkrimi.de erhältlich.
Kleve: Musik mit Atem, Herzschlag
und Stimme
Oboist Juri Vallentin & Cembalistin Elina
Albach Cembalistin Elina Albach & Oboist
Juri Vallentin Konzert mit Oboist Juri
Vallentin & Cembalistin Elina Albach im
Museum Kurhaus Atem, Stimme und Herzschlag
sind eng miteinander verbunden. Die drei
Grundelemente des menschlichen Körpers und
der Musik pulsieren durch dieses intensive
Konzertprogramm, interpretiert von zwei
meisterhaften Könnern ihres Instruments.

Cembalistin Elina Albach & Oboist Juri
Vallentin
Oboist Juri Vallentin und Elina Albach am
Cembalo kehren zurück in die Klever
Konzertreihe und gastieren mit ihrem
bewegenden Duo-Konzert am Sonntag, 24.
November, 18 Uhr, im Museum Kurhaus. Beide
stehen für Programmkonzepte, die über den
Tellerrand schauen, das Vertraute neu denken
und Alte Musik in spannende Zusammenhänge
bringen.
„Breath. Respiro“ ist der atmende Titel des
Konzertes und auch Name eines Solowerkes für
Oboe aus Vallentins Feder, er steht für die
internationalität und die unterschiedlichen
Epochen der Musikauswahl. Solistisch und
gemeinsam folgen Juri Vallentin mit
konzentriertem Luftstrom und Elina Albach
mit kapriziösem Saitenspiel ihres Cembalos
Atemzügen, Klang- und Lebenslinien in der
Musik nach.
In prächtigen Barocksonaten und virtuoser
Gegenwartsmusik loten sie die Grenzen
zwischen Konzert und Performance aus.
„Dieses Programm ist auch beeinflusst durch
die Musikauffassung von Joseph Beuys“, so
Juri Vallentin, der sich darauf freut, es an
dessen ehemaliger Wirkungsstätte
aufzuführen. Der Oboist eröffnet das
Programm mit einem Solo-Prelude des
arabischen Klarinettisten und Komponisten
Kinan Azmeh. Pulsierende Metren und Herztöne
durchziehen die beschwingten Sonaten von
Antonio Vivaldi und die Musik der
bekanntesten Barock-Komponistin Élisabeth
Jacquet de la Guerre.
Ihr Zeitgenosse Johann Christoph Pez griff
als gefragter Kapellmeister bei Hofe
italienische und französische Elemente auf.
Solistische Akzente setzen dazwischen eine
Sequenza des Italieners Luciano Berio sowie
Heinz Holligers „Cardiophonie“, in der der
Schweizer Meister-Oboist Herzschlag und Atem
des Spielers abnimmt und klanglich
verarbeitet.
„Musikalische Gedanken nach ihrem wahren
Inhalte und Affect dem Gehör empfindlich zu
machen“ war Anspruch des berühmten
Bach-Sohnes und Tastenkünstlers Carl Philipp
Emanuel Bach. Eine Sonate dieses Meisters
der Empfindsamkeit rundet den durchpulsten
und vielleicht auch atemraubenden
Konzertabend ab. Konzertkarten (12 €/
Schüler + Studenten 5 €) gibt es unter
www.kleve.reservix.de, an allen
Reservix-VVK-Stellen (Buchhandlung Hintzen,
Niederrhein Nachrichten, Klever
Rathaus-Info), Einlass: 17.30 Uhr, Konzert
mit Pause.
Kammerorchester-Konzert: Vom Baltikum bis
zur Ukraine
Am 24. November findet ab 18 Uhr
ein Konzert des Dinslakener Kammerorchesters
in der Kathrin-Türks-Halle statt. Darin
erzählt das Kammerorchester von Blumen,
Wäldern, Hochzeit, Frieden und Nussknackern.
Hierzulande ist er eher ein Unbekannter, in
Litauen dagegen ein Nationalheld: Der
Komponist Mikolajus Konstantinas Èiurlonis
schrieb spätromantische Musik, malte aber
auch Bilder, die im ihm gewidmeten Museum in
Kaunas hängen.
Am Sonntag, den 24. November, um 18 Uhr wird
in der Kathrin-Türks-Halle seine Tondichtung
Miške erklingen. Um das Jahr 1900 herum
komponierten neben Èiurlonis auch Wassili
Kalinnikow sein tanzinspiriertes Intermezzo
und natürlich Peter Tschaikowsky seine
Ballettmusiken, unter denen sich vor allem
der „Nussknacker“ besonderer Beliebtheit
erfreut. Das Dinslakener Kammerorchester
spielt daraus die Konzertsuite und lässt
damit ebenso die Zucker-fee wie die fernen
Länder vor dem geistigen Auge und Ohr
erstehen.
Abgerundet wird das Programm durch Werke zweier Komponisten dieser Zeit,
die in ihrer gemäßigt modernen Tonsprache um
Frieden bitten, wie der Este Arvo Pärt (Da
pacem Domine) oder Brücken in die
Vergangenheit bauen wie der Ukrainer
Valentin Silvestrov (Zwei Dialoge mit
Nachwort). Dirigent Sebastian Rakow führt
gewohnt kenntnisreich durch das Programm.
Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro
(ermäßigt 8 Euro) bei der Buchhandlung Korn,
in der Stadtinformation, bei den
Mitwirkenden oder online unter
stadt-dinslaken.reservix.de (hier fallen
zusätzliche Gebühren an), sowie an der
Abendkasse ebenfalls für 15 Euro. Kinder bis
10 Jahre haben freien Eintritt.
52 Prozent aller Beschäftigten
bekommen Weihnachtsgeld, deutlich mehr mit
Tarifvertrag – Tarifliche
Weihnachtsgeldzahlungen zwischen 250 und mehr
als 4.000 Euro
Für viele
Beschäftigte gibt es in diesen Wochen beim Blick
auf den Kontoauszug einen Grund zur Freude: Das
Weihnachtsgeld wird ausgezahlt. Dessen Höhe kann
zwischen 250 und mehr als 4.000 Euro variieren,
wie eine neue Analyse des Tarifarchivs des
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zeigt.
Allerdings profitieren längst nicht alle
Arbeitnehmer*innen von der Sonderzahlung, denn
nur gut die Hälfte (52 Prozent) bekommt
Weihnachtsgeld.

Den größten Unterschied macht, ob der
Arbeitgeber an einen Tarifvertrag gebunden ist
oder nicht: Von den Beschäftigten mit Tarif
bekommen 77 Prozent Weihnachtsgeld – fast
doppelt so viele wie in Betrieben ohne
Tarifvertrag, wo lediglich 41 Prozent der
Beschäftigten eine solche Zahlung erhalten. Das
ist das Ergebnis einer neuen Auswertung des
Internetportals Lohnspiegel.de, das vom WSI
betreut wird. Sie beruht auf einer
Online-Befragung, an der sich zwischen Anfang
November 2023 und Ende Oktober 2024 mehr als
62.000 Beschäftigte beteiligt haben.

Die Zahlung von Weihnachtsgeld wird entweder
durch Tarifverträge geregelt oder beruht auf
„freiwilligen“ Leistungen des Arbeitgebers, die
bei mehrjährigen Wiederholungen auch zum
Gewohnheitsrecht werden können und damit
verpflichtend sind. In der Praxis wird jedoch in
Unternehmen ohne Tarifvertrag deutlich seltener
Weihnachtsgeld ausgezahlt, denn den festen
tariflichen Anspruch auf Weihnachtsgeld haben
Gewerkschaften und ihre Mitglieder über
Jahrzehnte durchgesetzt.
„Beschäftigte in Unternehmen mit Tarifvertrag
sind demnach gleich doppelt im Vorteil,“ sagt
der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Prof. Dr.
Thorsten Schulten. „Zum einen erhalten
tarifgebundene Beschäftigte in der Regel ein
höheres Grundgehalt, zum anderen bekommen sie
deutlich häufiger Zusatzleistungen wie das
Weihnachtsgeld“, so Schulten. „Auch wenn sich
die Inflationsraten wieder normalisiert haben,
ist das Preisniveau höher als vor dem
Teuerungsschub. Eine Bezahlung nach Tarif, die
unter anderem Weihnachtsgeld garantiert, ist da
besonders wichtig“, sagt Prof. Dr. Bettina
Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des
WSI.
„Tarifbindung wirksam zu
stärken, bleibt deshalb eine Aufgabe auch der
Politik.“ Weihnachtsgeld für verschiedene
Beschäftigtengruppen Neben der Tarifbindung
lassen sich eine Reihe weiterer Merkmale
identifizieren, die die Chancen auf
Weihnachtsgeld beeinflussen (siehe auch die
Abbildung 1 in der pdf-Version dieser
Pressemitteilung; Link unten): - West/Ost: Nach
wie vor gibt es bedeutsame Unterschiede zwischen
Ost- und Westdeutschland. In Westdeutschland
bekommen 53 Prozent, in Ostdeutschland nur 41
Prozent der Befragten Weihnachtsgeld.
Dies hängt auch damit zusammen, dass die
Tarifbindung in Ostdeutschland deutlich
niedriger ist als im Westen. -
Vollzeit/Teilzeit: Unterschiede existieren auch
hinsichtlich des Beschäftigtenstatus: Unter
Vollzeitbeschäftigten ist Weihnachtsgeld mit 53
Prozent etwas verbreiteter als bei
Teilzeitbeschäftigten, von denen 47 Prozent eine
entsprechende Sonderzahlung bekommen.
-
Befristet/unbefristet: Ähnlich ausgeprägt sind
die Unterschiede zwischen Beschäftigten mit
einem befristeten oder einem unbefristeten
Arbeitsvertrag. Während lediglich 47 Prozent der
Befragten mit Befristung Weihnachtsgeld
erhalten, sind es bei den Unbefristeten 52
Prozent.
- Männer/Frauen: Männer erhalten
mit 54 Prozent immer noch etwas häufiger
Weihnachtsgeld als Frauen, von denen 48 Prozent
diese Sonderzahlung bekommen.
• Große
Unterschiede bei der Höhe des tarifvertraglichen
Weihnachtsgeldes
In den meisten großen
Tarifbranchen existieren gültige
tarifvertragliche Bestimmungen zum
Weihnachtsgeld oder einer ähnlichen
Sonderzahlung, die zum Jahresende fällig wird.
Dies zeigt eine aktuelle Auswertung des
WSI-Tarifarchivs von 23 ausgewählten größeren
Branchen (siehe die ausführliche Tabelle in der
pdf-Version dieser Pressemitteilung).
Die Höhe der tarifvertraglich vereinbarten
Sonderzahlung unterscheidet sich dabei
erheblich: Bei den mittleren Entgeltgruppen
reicht sie von 250 Euro in der Landwirtschaft
bis zu 4.039 Euro in der Chemischen Industrie.
Nur wenige Branchen haben beim Weihnachtsgeld
einen Pauschalbetrag festgelegt. In den meisten
Fällen wird das Weihnachtsgeld als fester
Prozentsatz vom Monatsentgelt berechnet. In
Branchen, in denen für 2024 höhere Tarifentgelte
vereinbart wurden, hat sich auch das
Weihnachtsgeld entsprechend erhöht.
Am
stärksten stieg das Weihnachtsgeld 2024
gegenüber dem Vorjahr mit 14,1 Prozent im
Brandenburgischen Einzelhandel, um 13,8 Prozent
bei der Deutschen Bahn AG und um 12,1 Prozent im
Öffentlichen Dienst (Gemeinden). Ein klassisches
13. Monatsentgelt im Sinne einer Sonderzahlung
von 100 Prozent eines Monatsentgeltes erhalten
die Beschäftigten in der Chemischen Industrie,
Teilen der Energiewirtschaft, in der
Süßwarenindustrie, bei der Deutschen Bahn AG, im
Privaten Bankgewerbe sowie in einzelnen
westdeutschen Tarifregionen der Textilindustrie
und dem privaten Transport- und Verkehrsgewerbe.
In der Eisen- und Stahlindustrie werden
sogar 110 Prozent eines Monatsentgeltes gezahlt,
wobei hier Weihnachts- und Urlaubsgeld zu einer
Jahressonderzahlung zusammengelegt wurden. Mit
95 Prozent eines Monatsentgeltes liegt das
Weihnachtsgeld in der Druckindustrie und in der
Papier und Pappe verarbeitenden Industrie leicht
unterhalb eines vollen 13. Monatsentgeltes.
Im Versicherungsgewerbe werden 80 Prozent eines
Monatsgehalts gezahlt, im Einzelhandel in den
westdeutschen Tarifbereichen vorwiegend 62,5
Prozent, in den Tarifgebieten der westdeutschen
Metallindustrie überwiegend zwischen 25 und 55
Prozent und im Hotel- und Gaststättengewerbe in
Bayern 50 Prozent.
Im Öffentlichen
Dienst (Gemeinden) beträgt die
Jahressonderzahlung, die an die Stelle des
früher üblichen Weihnachts- und Urlaubsgeldes
getreten ist, je nach Vergütungsgruppe zwischen
52 und 85 Prozent des Monatsentgeltes. Zwischen
den ost- und westdeutschen Tarifgebieten
bestehen in einigen Branchen nach wie vor
erhebliche Unterschiede. Ein (annähernd) gleich
hohes Weihnachtsgeld wird im Bank- und
Versicherungsgewerbe, in der Eisen- und
Stahlindustrie, bei der Deutschen Bahn AG, in
der Papier und Pappe verarbeitenden Industrie
(Arbeiter), dem Kfz-Gewerbe, im Öffentlichen
Dienst (Gemeinden) und der Landwirtschaft
gezahlt.
In anderen Branchen können die
Unterschiede mehrere hundert Euro, in
Einzelfällen wie im Bauhauptgewerbe auch noch
über tausend Euro ausmachen. Unter den großen
Wirtschaftszweigen sind Tarifbranchen ohne
Weihnachtsgeld oder eine vergleichbare
Sonderzahlung die Ausnahme. Nach wie vor kein
Weihnachtsgeld gibt es im
Gebäudereinigungshandwerk. Dasselbe trifft auf
das ostdeutsche Bewachungsgewerbe zu, während in
einigen Regionen Westdeutschlands das
Weihnachtsgeld erst nach einer bestimmten Anzahl
von Berufsjahren gewährt wird.

NRW: Preise für Fahrschule und
Führerscheingebühr 5,3 Prozent höher als ein
Jahr zuvor
Die Preise für die Fahrschule und
Führerscheingebühr sind in Nordrhein-Westfalen
zwischen Oktober 2023 und Oktober 2024 um
5,3 Prozent gestiegen. Wie das Statistische
Landesamt Nordrhein-Westfalen mitteilt, mussten
Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen
Monat auch für die Anschaffung eines neuen Autos
sowie den Unterhalt und Betrieb eines Fahrzeuges
mehr Geld ausgeben als ein Jahr zuvor.
Wer sich nach bestandener
Führerscheinprüfung einen neuen Pkw anschaffen
möchte, musste im vergangenen Monat 2,3 Prozent
mehr ausgeben als im Oktober 2023. Gebrauchte
Pkw dagegen wurden um 1,8 Prozent günstiger
angeboten. Die Verbraucherpreise insgesamt sind
im selben Zeitraum um 2,0 Prozent gestiegen.
Beiträge für KFZ-Versicherung
überdurchschnittlich gestiegen
Einen
besonders starken Preisanstieg zwischen Oktober
2023 und Oktober 2024 verzeichneten die Beiträge
zur Kraftfahrzeugversicherung mit 33,6 Prozent.
Die Höhe der Kraftfahrzeugsteuer blieb indes
konstant (±0,0 Prozent). Preise für TÜV und
Inspektionen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen
Für die Hauptuntersuchung (+7,3 Prozent)
inklusive der Abgasuntersuchung für
Kraftfahrzeuge (+6,3 Prozent), umgangssprachlich
auch als „TÜV-Untersuchung” bezeichnet, mussten
Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen
Monat mehr Geld ausgeben als noch ein Jahr
zuvor.
Die Preise für Wartungen und
Reparaturen von Fahrzeugen, darunter z. B.
Inspektionen (+4,3 Prozent) und der Wechsel von
Bremsflüssigkeiten (+9,3 Prozent), stiegen
durchschnittlich um 5,8 Prozent.
Unterschiedliche Preisentwicklungen zeigten sich
bei Ersatzteilen und Zubehör für Fahrzeuge: So
verteuerten sich zum Beispiel Autobatterien
(+4,0 Prozent) und Pkw-Reifen (+1,6 Prozent),
während die Preise für Wischerblätter o. a.
Einzel- und Ersatzteile für Pkw um 2,7 Prozent
günstiger angeboten wurden.
Preisrückgang
bei Kraftstoffen, darunter insbesondere
Dieselkraftstoff Kraftstoffe verzeichneten
zwischen Oktober 2023 und Oktober 2024 einen
erkennbaren Preisrückgang. Insgesamt wurden
Kraftstoffe 9,0 Prozent günstiger angeboten;
darunter sanken sowohl die Preise für
Dieselkraftstoffe (−13,0 Prozent) als auch für
Superbenzin (−7,7 Prozent). (IT.NRW)

Fernsehgeräte im Oktober 2024 um 4,4 %
günstiger als im Vorjahresmonat
Fernseher haben sich für Verbraucherinnen und
Verbraucher deutlich verbilligt. Im Oktober 2024
waren Fernsehgeräte 4,4 % günstiger als im
Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) zum weltweiten Tag des Fernsehens am
21. November mitteilt. Zum Vergleich: Im selben
Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise insgesamt
um 2,0 %.
Bereits in den Vorjahren
waren die Preise für Fernsehgeräte gesunken: Im
Jahr 2023 mussten Verbraucherinnen und
Verbraucher dafür 3,4 % weniger zahlen als im
Vorjahr und 10,2 % weniger als im Jahr 2020. Die
Verbraucherpreise insgesamt stiegen 2023
gegenüber dem Vorjahr um 5,9 % und lagen um 16,7
% höher als im Jahr 2020.

Durchschnittliche Fernsehdauer steigt mit
zunehmendem Alter
Fernsehgeräte
fanden sich 2022 in 96,5 % aller Haushalte. Wie
viel Zeit die Menschen mit Fernsehen verbringen
– egal ob lineares Fernsehen, Streaming oder
Video-On-Demand-Nutzung –, ist aber je nach
Alter sehr unterschiedlich. Die
durchschnittliche Fernsehdauer steigt
kontinuierlich mit zunehmendem Alter: Kinder im
Alter von 10 bis 13 Jahren sehen nach
Ergebnissen der Zeitverwendungserhebung 2022 mit
1 Stunde und 16 Minuten pro Tag im Schnitt am
wenigsten fern.
Die meiste Zeit
verbringen Menschen ab 65 Jahren vor dem
Fernseher mit 2 Stunden und 54 Minuten pro Tag.
Insgesamt verbringen Menschen ab 10 Jahren
hierzulande durchschnittlich 2 Stunden und 8
Minuten pro Tag mit Fernsehen. Das sind 4
Minuten mehr als 2012/13. Frauen schauen im
Schnitt etwas weniger fern (2 Stunden und 3
Minuten) als Männer (2 Stunden und 14 Minuten).
Auftragsbestand im Verarbeitenden
Gewerbe im September 2024: +1,6 % zum Vormonat
Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe,
September 2024 +1,6 % real zum Vormonat (saison-
und kalenderbereinigt) -2,6 % real zum
Vorjahresmonat (kalenderbereinigt) Reichweite
des Auftragsbestands 7,3 Monate
Der
reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im
Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen
Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis)
im September 2024 gegenüber August 2024 saison-
und kalenderbereinigt um 1,6 % gestiegen. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat September 2023 lag
der Auftragsbestand im September 2024
kalenderbereinigt 2,6 % niedriger.

Zum Anstieg des Auftragsbestands im
September 2024 trug insbesondere die Entwicklung
im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe,
Züge, Militärfahrzeuge) bei. Hier lag der
Auftragsbestand aufgrund mehrerer Großaufträge
saison- und kalenderbereinigt um 3,0 % höher als
im Vormonat. Auch der Anstieg im Bereich
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
(+1,2 %) wirkte sich positiv aus. In den
weiteren Branchen des Verarbeitenden Gewerbes
waren die Veränderungen des Auftragsbestands zum
Vormonat gering.
Die offenen
Aufträge aus dem Inland stiegen im September
2024 gegenüber August 2024 um 1,5 %, der Bestand
an Aufträgen aus dem Ausland um 1,4 %. Bei den
Herstellern von Investitionsgütern nahm der
Auftragsbestand um 1,7 % zu, bei den
Konsumgütern um 1,3 %. Im Bereich der
Vorleistungsgüter wuchs der Auftragsbestand um
0,8 %.
Reichweite des
Auftragsbestands konstant bei 7,3 Monaten
Im September 2024 blieb die Reichweite des
Auftragsbestands mit 7,3 Monaten im Vergleich
zum August 2024 unverändert. Bei den Herstellern
von Investitionsgütern erhöhte sich die
Reichweite von 9,8 Monaten auf 9,9 Monate. Bei
den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb sie
konstant bei 4,1 Monaten. Bei den Konsumgütern
blieb die Reichweite im September 2024 bei
3,6 Monaten.
Die Reichweite gibt an,
wie viele Monate die Betriebe bei
gleichbleibendem Umsatz ohne neue
Auftragseingänge theoretisch produzieren
müssten, um die vorhandenen Aufträge
abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus
aktuellem Auftragsbestand und mittlerem Umsatz
der vergangenen zwölf Monate berechnet.
Mittwoch, 20. November 2024
1000 Tage russischer Angriffskrieg gegen die
Ukraine
Statement von
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
Brüssel, 19. November
2024 - Vor genau 1000 Tagen hat Russland seine
grundlose und ungerechtfertigte militärische
Aggression gegen die Ukraine begonnen.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen sagte in einem Videostatement: „Russland
muss für tausend Tage Verbrechen und Zerstörung
bezahlen. Heute ist ein Tag der Trauer, aber
auch ein Tag der Verheißung. Wir versprechen,
ihnen zur Seite zu stehen, so lange es nötig
ist. Die Zukunft der Ukraine liegt in unserer
Union. Ihre Freiheit ist unsere Freiheit. Und
unsere Union ist ihre Heimat."
Seit
Beginn der groß angelegten Invasion haben die EU
und ihre Mitgliedstaaten beispiellose
wirtschaftliche, humanitäre und militärische
Hilfe für die Ukraine mobilisiert, die sich
bisher auf insgesamt rund 124 Milliarden Euro
beläuft. Die EU hat 4 Millionen Menschen, die
vor dem Krieg geflohen sind, Schutz gewährt, die
internationalen Bemühungen zur Unterstützung der
Souveränität, Sicherheit und des Wiederaufbaus
der Ukraine angeführt und Russland zur
Verantwortung gezogen. Außerdem wurden eine
Reihe weitreichender
Sanktionen gegen Russland und seine Führung
verhängt.
Weitere EU-Unterstützung
für Ukraine Ursula von der Leyen sicherte der
Ukraine in ihrem Statement die kontinuierliche
Unterstützung Europas und des Westens zu: „50
Milliarden Euro bis 2027 von der Europäischen
Union sowie 50 Milliarden Dollar bis 2026 von
den G7-Staaten und der EU. Und jetzt nutzen wir
die Erlöse aus den eingefrorenen russischen
Vermögenswerten, um die Militärproduktion in der
Ukraine zu steigern und die Energieinfrastruktur
vor dem Winter zu reparieren.“ Die
Kommissionspräsidentin kündigte zudem an,
weitere 65 Millionen Euro bereit zu stellen, um
die Initiative der ukrainischen First Lady Olena
Zelenska zum Kauf von Schulmahlzeiten für
ukrainische Kinder zu unterstützen.
Bundesweite Aktionen zum Tag der
Kinderrechte am 20. November
UNICEF-Aktionen in
Deutschland
im Zeichen der
Demokratie
Zum 35. Geburtstag der
UN-Kinderrechtskonvention steht bei allen
nationalen Aktionen das Motto „Kinderrechte
leben. Demokratie stärken.“ im Fokus. Denn die
konsequente Verwirklichung der Kinderrechte ist
nicht nur von entscheidender Bedeutung für das
Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen, sondern
auch ein wertvoller Beitrag zur Stärkung unserer
freiheitlich-demokratischen Gesellschaft.
„Kinder in Deutschland stärken, sie an
Entscheidungen beteiligen, ihre Teilhabe sichern
und sie vor Diskriminierung schützen – das ist
vielleicht der wichtigste Hebel, um unsere
Demokratie zu stützen und Fremdenfeindlichkeit,
Ausgrenzung und Zweifel an der demokratischen
Grundordnung etwas entgegenzusetzen. Denn
Demokratie braucht Nachwuchs“, sagt Christian
Schneider, Geschäftsführer von UNICEF
Deutschland.

© UNICEF/UNI595628/Stroisch
UNICEF - ein
❤
für Kinder
Prominente unterstützen bundesweite Kampagne
In der zweiten Runde der
diesjährigen Kinderrechte-Kampagne rund um den
20.11. rufen prominente
UNICEF-Unterstützer*innen dazu auf, die
Kinderrechte in Deutschland konsequenter als
bislang umzusetzen und so auch einen Beitrag zur
Stärkung der Demokratie zu leisten. In ganz
Deutschland werden erneut Statements der
Prominenten auf Ströer-Infoscreens an Straßen,
auf Bahnhöfen, in U-Bahnen und Einkaufzentren zu
sehen sein.
Neben Entertainer Riccardo
Simonetti, ESA-Astronaut Alexander Gerst, Model
Franziska Knuppe, Fußball-Weltmeister Julian
Draxler und Zehnkämpfer Leo Neugebauer ist
Schauspielerin und Autorin Katja Riemann Teil
der bundesweiten Kampagne „Kinderrechte leben.
Demokratie stärken.“ von UNICEF Deutschland und
dem Unternehmen für Außenwerbung und digitale
Kommunikation Ströer.
Im Rahmen der
bundesweiten Mitmachaktion 2024 machen sich über
eine Viertelmillion Schülerinnen und Schüler in
ganz Deutschland mit UNICEF für ihre Rechte
stark. Gemeinsam setzen sie dabei ein Zeichen
für Vielfalt und einen starken Zusammenhalt in
ihrer Stadt und füllen die Message "Du gehörst
dazu" an ihrer Schule mit Leben. Auch
UNICEF-Engagierte werden in allen Teilen des
Landes aktiv, führen Ortsgespräche mit
Entscheider*innen aus Politik und Wirtschaft und
machen auf die Kinderrechte aufmerksam.
Dinslaken, Ehrensache: Bürgermeisterin
Eislöffel lud zu Preisverleihung ein
Viele Ehrenamtler*innen waren am 15.11.2024 in
der Kathrin-Türks-Halle dabei und genossen den
Abend. Am Freitag, 15.11.2024, fand in der
Kathrin-Türks-Halle die Preisverleihung
"Dinslaken, Ehrensache" statt.

Ausgezeichnet wurde ehrenamtliches Engagement.
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel dankte allen
Anwesenden für ihren Einsatz: "Ehrenamtliches
Engagement ist eine unverzichtbare Säule unserer
Gesellschaft. Durch Sie ist unser Zusammenleben
reicher, vielfältiger und besonders lebenswert.
Sie sind es, die mit Ihrem Einsatz und Ihrer
Hingabe das soziale Gefüge stärken und unsere
Stadt zu einem besseren Ort machen."
Bei der Verleihung der Ehrenamtspreise, die
2024 zum dritten Mal in Folge vergeben wurden,
zeichneten zahlreiche Laudatoren Dinslakens
Ehrenamtler*innen aus, die sich das ganze Jahr
für andere Menschen einsetzen. Bei der bunten
und unterhaltsamen Veranstaltung wurde der mit
jeweils 500 Euro dotierte Maria-Euthymia-Preis
mit seinen drei Genres Kultur, Sport und
Soziales, ergänzt durch ein weiteres Genre
Kinder/Jugend, sowie ein mit 750 Euro dotierter
Sonderpreis für besondere Verdienste im
ehrenamtlichen Sektor, vergeben.
• Im
Bereich Kultur ging die Auszeichnung an den IG
Altstadt Dinslaken e.V., die Laudatio hielt
Ronny Schneider. Die Interessengemeinschaft
wurde ausgezeichnet, weil sie ein gutes Beispiel
dafür ist, dass beharrliches, kontinuierliches,
kreatives und ehrenamtliches Engagement von
Bürger*innen für ihren Stadtteil erfolgreich
sein kann.
• Said
Chengafe konnte sich als Einzelperson über die
Auszeichnung im Bereich Soziales freuen. Er
engagiert sich bereits seit zehn Jahren
ehrenamtlich als Dolmetscher und Begleiter für
Flüchtlinge und nimmt dabei eine wichtige
Brückenfunktion ein, um den neu angekommenen
Geflüchteten zu helfen, sich in der deutschen
Gesellschaft zurechtzufinden. Die Laudatio für
den studierten Diplom-Ingenieur aus Marokko
hielt der Integrationsratsvorsitzende Turhan
Tuncel.
• Preisträger
im Bereich Kinder/Jugend sind
die Kinderfeuerwehr Dinslaken und
die Jugendfeuerwehr Dinslaken. Sarah Toepper und
Marcel Peplau übergaben die Auszeichnungen, weil
die beiden Organisationen schon früh den
Grundstein für die ehrenamtliche Arbeit zum
Schutz unserer Gesellschaft legen und den
Mitgliedern schon früh beigebracht wird, wie
wichtig es ist, dass niemand im Stich gelassen
wird.
• Im
Bereich Sport ging die Auszeichnung an Sport mit
Herz Dinslaken e.V. Der Verein macht sich seit
Jahren für Sportangebote für Menschen mit
Herzerkrankungen stark. Übergeben wurde der
Preis durch den Allgemeinmediziner aus
Dinslaken, Dr. Johannes Hermens.
• Den
Maria-Euthymia-Sonderpreis erhielt Frank
Kempe für die Ausübung seiner langjährigen
Funktion als 1. Vorsitzender des Stadtverbandes
der Kleingärtner Dinslaken-Voerde. Seit über 15
Jahren betreut er die mittlerweile elf an den
Stadtverband angeschlossenen Vereine und
investiert unzählige Stunden, um mit Pächtern
ins Gespräch zu kommen und konstruktive Lösungen
zu finden. Übergeben wurde die Auszeichnung von
Ingo Saemann.
• Im
Rahmen von „Dinslaken, Ehrensache!“ wurde auch
der Heimat-Preis NRW 2024 vergeben: Der erste
Heimatpreis ging an die AG musischer
Vereinigungen in Dinslaken 1985. Herbert
Freikamp, der 30 Jahre im Vorstand der AG war
und bis 2019 den Vorsitz innehatte, sowie
Reinhard Hüsken, der erste Vorsitzende seit
2019, nahmen den mit 2.500 Euro dotierten Preis
entgegen.
• Den
zweiten Preis in Höhe von 1.500 Euro übergab
Dinslakens ehemalige Bürgermeisterin Sabine
Weiss an Heinz Brandt, der im Forum Lohberg
aktiv war und sich für den Erhalt des
Ledigenheims engagiert hat. Auf seine Initiative
hin wurde die Stiftung Ledigenheim gegründet,
die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen
feiert.
• Der
mit 1.500 Euro dotierte dritte Preis würdigte
wieder die musikalische Seite Dinslakens. Anja
Kebaier von DIN-Event verlieh dem
Musiker Friedhelm Dickmann, dem ehemaligen
Vorsitzenden des MGV Liederkranz Barmingholten
und Komponisten der „Hymne“ der Stadt Dinslaken
„Dinslaken, du Stadt im Grünen“, die
Auszeichnung.
Moderiert wurde die
Preisverleihung von Thomas Pieperhoff und Filiz
Göcer. Unter den vorgeschlagenen
Teilnehmer*innen für den Ehrenamtspreis, die
nicht gewonnen hatten, wurden drei 100 Euro
Einkaufs-Gutscheine verlost.
Stadtrat tagt
Am Dienstag,
den 26. November 2024, tagt der Rat der Stadt
Dinslaken. Die Sitzung beginnt um 18:00 Uhr im
Ratssaal des Rathauses. Tagesordnungen
sowie Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen
sind grundsätzlich auch online im
Ratsinformationssystem einsehbar.
Sie sind Eltern geworden? Wir
möchten Ihre Babys willkommen heißen!
Am 21.11.24 findet die zweite Weseler
Baby-Begrüßungsparty statt - ein Treffen für die
im Jahr 2024 geborenen Babys und ihre
Familien. Bei Kaffee und Kuchen können sich die
Eltern in gemütlicher Atmosphäre kennenlernen
und austauschen. Sie erhalten Informationen zur
Kinderbetreuung, zur kindlichen Entwicklung und
zu Spielangeboten in Wesel und können die
Akteure der Frühen Hilfen in Wesel persönlich
kennenlernen und bei Fragen ansprechen.

Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr und
endet gegen 12.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus
Bogen, Pastor-Janßen-Straße 7, 46483 Wesel. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme
ist kostenlos. Ansprechpartner
Frau Przybyla Telefon: 02
81 / 2 03 25 55 E-Mail: fruehehilfen@wesel.de
Frau Grobe Telefon: 02
81 / 2 03 25 66 E-Mail: fruehehilfen@wesel.de
Stalking - weit mehr als bloße Belästigung!
Vortrag am 25. November 2024, dem
„Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ im
Ratssaal der Stadt Wesel
Stalking ist eine oft unterschätzte Form der
Belästigung und kann das Leben von Betroffenen
in vielerlei Hinsicht schwerwiegend
beeinträchtigen. Der Begriff "Stalking" stammt
aus der Jagd und bedeutet "sich anschleichen".
Stalkende suchen den ständigen
Kontakt gegen den Willen eines Menschen. Sie
versuchen dadurch, Macht und Kontrolle über eine
andere Person zu erlangen. Ihre unangemessenen
Verfolgungen können sich über Monate oder gar
Jahre hinziehen und reichen von subtilen
Belästigungen bis hin zu bedrohlicher Gewalt.
Stalking kann auch am Arbeitsplatz auftreten und
verlagert die Problematik aus dem privaten
Umfeld in den beruflichen Alltag. Grundsätzlich
kann jeder Mensch Opfer von Stalking werden,
unabhängig von Geschlecht, Beruf, Alter oder
Religion.
Studien zeigen
allerdings, dass Frauen in 80 Prozent der Fälle
zu den Betroffenen zählen und damit besonders
häufig dieser extremen Form der Belästigung
ausgesetzt sind. Im März 2007 wurde Stalking mit
der Einführung des § 238 in das Strafgesetzbuch
(StGB) aufgenommen. Damit hat der Gesetzgeber
festgelegt, dass Stalking keine Privatsache,
sondern eine Straftat ist. Im Rahmen des
Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen
lädt die Gleichstellungsstelle der Stadt Wesel
am 25. November 2024 um 14:00 Uhr zu einem
Vortrag in den Ratssaal ein.
Tanja
Lange, Kriminalhauptkommissarin und
Opferschutzbeauftragte der Kreispolizeibehörde
Wesel, hält den Vortrag "Stalking - weit mehr
als bloße Belästigung!". Interessierte können
sich bis zum 25. November 2024 verbindlich
unter: gleichstellung@wesel.de anmelden.
Der Vortrag ist kostenlos. Links
Frauen und Gleichstellung
Gruppe für Kinder aus Trennungs- und
Scheidungsfamilien in Kamp-Lintfort
Kamp-Lintfort - Die Beratungsstelle für Eltern,
Jugendliche und Kinder des Kreises Wesel in
Kamp-Lintfort bietet für Mädchen und Jungen, die
aus Trennungs- und Scheidungsfamilien kommen und
zwischen 8 und 11 Jahre alt sind, ein
kostenfreies Gruppenangebot an.
Der
Kurs findet ab Mittwoch, 15. Januar 2025,
achtmal jeweils mittwochs nachmittags von 16 Uhr
bis 17.30 Uhr statt. Die Gruppe wird von Barbara
Krebs-Markus (Dipl.- Sozialarbeiterin) und
Andrea Trojansky (Dipl.-Sozialarbeiterin und
Heilpädagogin) geleitet. Für Kinder ist das
Auseinandergehen der Eltern eine leidvolle
Trennungserfahrung und es kostet sie viel Kraft,
um für sich damit umzugehen.
Oft
macht es die Kinder wütend und auch traurig,
dass Papa und Mama auseinandergegangen sind.
Auch Kinder, die keine besonderen Reaktionen
zeigen, leiden häufig. Kinder brauchen in dieser
Situation manchmal fachliche Unterstützung und
Anregung, um mit den Veränderungen
zurechtzukommen.
In der Gruppe
haben sie die Möglichkeit, ihre Ängste und
Hoffnungen auszudrücken. Sie erfahren, dass sie
nicht alleine dastehen und dass es anderen
Kindern ähnlich ergeht wie ihnen. In
erlebnisorientierter Weise können sich die
Kinder mit Hilfe kreativer Medien sowie Rollen-
und Interaktionsspielen erfahren und ihre Kräfte
und Fähigkeiten einbringen.
Anmeldungen
und weitere Informationen erhalten Sie bei der
Erziehungsberatungsstelle Kamp-Lintfort (siehe
Kontakt). Anmeldungen können bis spätestens zum
8. Januar 2025 entgegen genommen
werden. Adresse: Kamperdickstraße 10-12,
Kamp-Lintfort
Stiftung Bethanien: Neues
Fortbildungsangebot für Arztpraxen startet
Moers - Erster Termin der
„Mittwochssprechstunde“ am 20. November 2024
Mit einem neuen Schulungsangebot wendet sich die
Stiftung Bethanien Moers an Arztpraxen aus der
Umgebung und ihre Mitarbeiter:innen.
Die „Mittwochssprechstunde“ findet an
verschiedenen Terminen mittwochs in der Zeit von
14 bis 16.30 Uhr in der Bethanien Akademie
(Bethanienstraße 15, 47441 Moers) statt. Bei der
ersten Veranstaltung am Mittwoch, dem 20.
November 2024, dreht sich alles um das Thema
„Basic Life Support – BLS“. Schwerpunkte sind
ein Reanimationstraining und das Verhalten in
kritischen Situationen.
Neben
weiteren Schulungen rund um Hygiene oder
Arbeitssicherheit, die Praxismitarbeiter:innen
regelmäßig absolvieren müssen, werden darüber
hinaus Themenkomplexe angeboten, die Praxisteams
in ihrem Berufsalltag unterstützen können. Je
Termin und Person fallen Kosten in Höhe von 30
Euro an. Um eine vorherige Anmeldung per E-Mail
an akademie@bethanienmoers.de und unter Angabe
der gewählten Termine und jeweiligen
Personenanzahl wird gebeten.
Weitere Termine des neuen Schulungsangebots
finden wie folgt statt: Am 27. November 2024
beschäftigen sich die Teilnehmer:innen der
„Mittwochssprechstunde“ mit dem
„Hygienemanagement im Praxisalltag“. Um
„Barrierefreie Kommunikation“, beispielsweise am
Telefon und in schwierigen Situationen im
Praxisalltag, geht es am 04. Dezember 2024. Die
Schulung am 11. Dezember setzt sich mit den
Themen „Arbeitssicherheit & Brandschutz“,
inklusive praktischer Brandschutzübung,
auseinander.

Ab dem 20. November 2024 startet das neue
Fortbildungsangebot „Mittwochssprechstunde“ der
Stiftung Bethanien Moers für
Praxismitarbeiter:innen. (Symbolbild)
"#UnserReWIR – Jugendliche entwickeln Ideen
für Demokratie" – Hackathon bringt
beeindruckende Projektideen hervor
Rund 50 Schülerinnen und Schüler nahmen am
Hackathon teil 11 Teams entwickelten Vorschläge
für mehr Demokratie im Ruhrgebiet Siegerteam
„Future4“ möchte eine App entwickeln, die schon
den Jüngsten Demokratiewissen vermittelt Jury
zeigte sich beeindruckt vom Engagement der
jungen Menschen
Junge Menschen wollen
und sollen mitreden! Genau das konnten sie am
vergangenen Wochenende auf dem UNESCO-Welterbe
Zollverein. Die RAG-Stiftung hatte Jugendliche
zwischen 14 und 18 Jahren am 16. und 17.
November zum Hackathon „#UnserReWIR –
Jugendliche entwickeln Ideen für Demokratie“
eingeladen.
Gesucht wurden konkrete
Vorschläge für mehr Demokratie in der eigenen
Schule, im Stadtteil oder im ganzen Ruhrgebiet.
Und die Ideen sprudelten nur so, nachdem rund 50
Schülerinnen und Schüler von Schulen aus 13
Städten des Ruhrgebiets der Einladung der
Stiftung gefolgt waren. Insgesamt 11 Teams
bestehend aus vier bis sechs Teammitgliedern
brüteten am vergangenen Samstag und Sonntag vor
der beeindruckenden Kulisse der Kokerei
Zollverein über der Fragestellung, wie
Demokratieförderung gelingen und beispielsweise
gegen Hass und Hetze, Antisemitismus oder
Fake-News vorgegangen werden kann.
Inspiration erhielten die angetretenen Teams
dabei durch spannende Kurzvorträge zum Thema
Demokratie. Für das leibliche Wohl war ebenso
gesorgt wie für kreative Pausen. Die über zwei
intensive Tage erarbeiteten Ideen für mehr
Demokratie wurden dann am Sonntagnachmittag in
jeweils fünfminütigen Präsentationen einer
hochkarätig besetzten Jury vorgestellt,
moderiert von der Influencerin und Investorin
Diana zur Löwen.
Am Ende konnte sich
jedes Mitglied der drei Siegerteams über ein
Preisgeld in Höhe von 500 Euro (1. Preis), 400
Euro (2. Preis) oder 300 Euro (3. Preis) freuen
und darauf, dass ihre Ideen nicht nur graue
Theorie bleiben, sondern auch zur Umsetzung
gebracht werden sollen. Dafür stellt die
RAG-Stiftung insgesamt bis zu 150.000 Euro
bereit. Aber auch alle weiteren Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, die mit ihrer Idee keinen der
ersten drei Plätze belegen konnten, durften sich
als Gewinner fühlen. Sie erhielten für ihren
Einsatz beim Hackathon neben viel Lob zusätzlich
100 Euro.
„Wir dürfen unsere
Demokratie nicht als selbstverständlich
hinnehmen. Wir müssen sie wahren und schützen.
Als größter Bildungsförderer der Region haben
wir das Thema Demokratieförderung schon lange in
unseren Förderrichtlinien verankert. Beim
Hackathon wollten wir Jugendlichen die
Möglichkeit geben, sich mit ihren ganz eigenen
Ideen zur Demokratieförderung einzubringen. Es
hat mich persönlich sehr beeindruckt, zu sehen,
mit welcher Motivation die jungen Teams die
Herausforderung angegangen sind“, so Bärbel
Bergerhoff-Wodopia, Mitglied im Vorstand der
RAG-Stiftung und Vorsitzende der Hackathon-Jury.
Die Jury, der auch der Präsident des
Landtags Nordrhein-Westfalen, André Kuper,
angehörte, hatte es bei ihrer Entscheidung für
die drei Siegerideen nicht leicht. „Die Vielzahl
an großartigen Ideen zeigt, dass junge Menschen
Verantwortung übernehmen und die Zukunft unserer
Gesellschaft mitgestalten. Es ist beeindruckend
zu sehen, wie engagiert und kreativ sie beim
Hackathon ihre Visionen für eine lebendige
Demokratie entwickelt haben. Mit ihrem Einsatz
sind sie Botschafter der Demokratie,“ sagte
Kuper.
Auch Schulministerin und
Jurymitglied Dorothee Feller, lobte die
Schülerinnen und Schüler: „Demokratie lebt von
den Ideen und dem Engagement junger Menschen.
Dieser Hackathon zeigt, dass Schülerinnen und
Schüler bereit sind Verantwortung zu übernehmen
und unsere Gesellschaft mit Ideen für die
Zukunft der Demokratie bereichern.“
Die Sieger
Den 1. Platz des Ideenwettbewerbs
belegte das Team „Future4“.
Die Schülerinnen
Christabell, Keren, Lena und Maja vom Essener
Burggymnasium und dem Bischöflichen Gymnasium am
Stoppenberg aus Essen möchten eine App
entwickeln, bei der "Timmy der Außerirdische"
Schülerinnen und Schülern der Klassen drei bis
sechs spielerisch erklärt, was Demokratie
bedeutet, was sie bedroht und wie man sie
schützen kann.
Über den 2. Platz
freute sich nach zwei Tagen intensiver
Kreativarbeit das Team „Talente der Zukunft –
TdZ“, das sich aus Schülerinnen und Schülern des
RuhrTalente-Programms zusammensetzte. Die
Teammitglieder Ali, Asya, Bayar, Jwanzeen,
Lamija und Laureen planen die Produktion eines
Kurzfilms, der unter anderem über Social Media
Kinder und Jugendliche erreichen und sie dazu
aufrufen soll, sich für Politik und Demokratie
zu interessieren und zu engagieren.
Als 3. Platz gingen die „Adolfinis“ aus dem
Hackathon hervor. Coralie, Joyce, Leonie und
Timo vom Gymnasium Adolfinum aus Moers planen
einen Kompass für Kommunalpolitik, um
Jugendlichen Regionalpolitik verständlicher zu
machen und ihnen ihre konkreten
Mitsprachemöglichkeiten aufzuzeigen. Denn nur
wer sich einbringt, kann etwas verändern.

Die Sieger des 3. Platzes zusammen mit Dorothee
Feller, NRW-Ministerin für Schule und Bildung -
Foto Thomas Stachelhaus
Ein
Sonderpreis in Form eines Projekttages zum Thema
Demokratie und Mitbestimmung an ihrer Schule
ging an das Team der Quinoa-Schule Herne. Die
Jury: Bärbel Bergerhoff-Wodopia (Vorsitz),
Mitglied des Vorstands der RAG-Stiftung, André
Kuper, Präsident des NRW-Landtags Dorothee
Feller, NRW-Ministerin für Schule und Bildung
Marcus Kottmann, NRW-Zentrum für Talentförderung
Simon Schnetzer, Jugendforscher Suat Yilmaz,
Leiter der Landesweiten Koordinierungsstelle
Kommunale Integrationszentren Weitere
Informationen zum Hackathon:
www.unser-rewir.de
Neubau: Durchlass auf der Liederner
Straße (K27) in Hamminkeln
Der Kreis Wesel gibt bekannt, dass auf der
Kreisstraße 27 zwischen der Bocholter Straße
(L602) und der Einmündung Brunnenfeld in
Hamminkeln die Erneuerung eines Durchlasses
notwendig wird. Da der vorhandene Durchlass
beschädigt ist, kann eine ordnungsgemäße
Entwässerung nicht mehr gewährleistet werden.
Die Bauarbeiten beginnen nach derzeitiger
Planung am Donnerstag, 21. November, und sollen
bis Freitag, 20. Dezember 2024, abgeschlossen
werden.
Während der Bauarbeiten
wird die Straße für den motorisierten
Individualverkehr voll gesperrt. Für die
Verkehrsteilnehmenden wird eine weiträumige
Umleitung über das umliegende Straßennetz –
Bocholter Straße (L602), Hüttemannstraße (L896),
Provinzialstraße (L896), Mussumer Straße (L505)
und Alfred-Flender-Straße (L505) - eingerichtet.
Radfahrer und Fußgänger können das Baufeld
ortsnah umgehen.
Mit den
Sanierungsarbeiten wurde nach einer öffentlichen
Ausschreibung die Firma Siebers aus Goch
beauftragt. Der Kreis Wesel bedankt sich bei den
Verkehrsbeteiligten für ihr Verständnis und ihre
Geduld während der Bauarbeiten.
Moers: Feuerwehrausschuss tagt am
kommenden Freitag
Einen Vortrag zum Rettungsdienstbedarfsplan
durch den Kreis Wesel erhalten die Mitglieder
des Feuerwehrausschusses am Freitag, 22.
November. Die Sitzung findet um 16 Uhr im
Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1, statt.
An dem Nachmittag diskutieren die
Mitglieder außerdem das Einvernehmen zur
Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes.
Zudem stehen Berichte zu Baumaßnahmen an
Feuerwehrgebäuden auf der Tagesordnung.

NRW: Positive Entwicklung der Reallöhne
setzt sich auch im dritten Quartal 2024 fort
Die effektiven Bruttomonatsverdienste der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in
Nordrhein-Westfalen im dritten Quartal 2024 real
– also preisbereinigt – um 2,6 Prozent höher
gewesen als im Vorjahreszeitraum. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, übertraf der
Anstieg der Nominallöhne (+4,4 Prozent) den der
Verbraucherpreise (+1,8 Prozent). Damit setzt
sich die seit dem zweiten Quartal 2023 positive
Entwicklung der Reallöhne weiter fort.

Die Kanalisation in NRW reicht mehr als
zwei Mal um den Erdball
waren die Abwasserkanäle in Nordrhein-Westfalen
rund 102 000 Kilometer lang. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, entsprach die
Länge der öffentlichen Kanalisation, die das
Abwasser und Niederschlagswasser sammelt und zur
Kläranlage ableitet, damit gut dem
Zweieinhalbfachen des Erdumfangs am Äquator.
Nahezu alle Personen in NRW sind an die
öffentliche Kanalisation angeschlossen; so lag
der Anschlussgrad 2022 bei 98,2 Prozent.
Für jede Einwohnerin und jeden Einwohner
halten die Kommunen rein rechnerisch 5,7 Meter
Kanalisation vor. Die in den kommunalen
Kläranlagen behandelte Menge an Abwasser passt
13-mal in den Biggesee In den kommunalen
Kläranlagen in NRW wurden 2022 insgesamt
1 967 Millionen Kubikmeter Abwasser behandelt.
Das ist gut 13-mal so viel wie das
Fassungsvermögen des Biggesees (150,1 Millionen
Kubikmeter), der größten Talsperre in NRW. Mit
1 237 Millionen Kubikmetern war mehr als die
Hälfte (62,9 Prozent) davon häusliches und
gewerbliches Abwasser.
Weitere
22,8 Prozent waren von versiegelten Flächen
eingeleitetes Niederschlagswasser (449 Millionen
Kubikmeter). 14,2 Prozent gingen zurück auf
Fremdwasser (280 Millionen Kubikmeter), darunter
fällt z. B. durch Undichtigkeiten in die
Kanalisation eindringendes Grundwasser.
Kläranlagen reduzierten anorganischen Stickstoff
und Phosphor im Abwasser; rund fünf bzw. zehn
Prozent weniger in Gewässer gelangt als 2019 Im
Jahr 2022 reduzierten 502 der insgesamt 585
kommunalen Kläranlagen in NRW zusätzlich zu den
abbaubaren organischen Stoffen sowohl Stickstoff
(Denitrifikation) als auch Phosphor im Abwasser.
Diese überwiegend größeren
Kläranlagen behandelten rund 98 Prozent der
Abwassermenge im Land. Seit 2019 gingen die in
den Kläranlagen nicht abgebauten und in das
Gewässer gelangenden Frachten an anorganischem
Stickstoff (Nges) um 4,6 Prozent und an Phosphor
(Pges) um 9,9 Prozent zurück. Der Gewässerschutz
wurde in den letzten Jahrzehnten durch den
Anschluss von ländlichen Gebieten an die
öffentliche Kanalisation, den Bau zentraler
Kläranlagen und deren Ausrichtung auf neue
Anforderungen kontinuierlich verbessert. IT.NRW
erhebt und veröffentlicht als Statistisches
Landesamt zuverlässige und objektive Daten für
das Bundesland Nordrhein-Westfalen für mehr als
300 Statistiken auf gesetzlicher Grundlage.
Dies ist dank der zuverlässigen Meldungen
der Befragten möglich, die damit einen wichtigen
Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.
Aussagekräftige statistische Daten dienen als
Grundlage für politische, wirtschaftliche und
soziale Entscheidungen. Sie stehen auch der
Wissenschaft und allen Bürgerinnen und Bürgern
zur Verfügung. (IT.NRW)

Dienstag. 19. November 2024
Eis am Niederrhein: Enni-Winterdienst
steht in den Startlöchern
In Sachen Winter sind sich Meteorologen derzeit
noch nicht einig. Auch wenn am Niederrhein von
Schnee und Eis noch keine Spur ist, könnte es
zur Wochenmitte hier erstmals Temperaturen um
den Gefrierpunkt geben. Wie es auch kommt: Der
Winterdienst der ENNI Stadt & Service
Niederrhein (Enni) ist seit Mitte November in
Rufbereitschaft und übt in diesen Tagen mit
seinen Räumfahrzeugen auf dem Betriebshof am
Jostenhof schon mal den Ernstfall.
Das Team des zuständigen Abteilungsleiters
Ulrich Kempken hat die rund 400 Kilometer des
Moerser Straßennetzes nun bis zum Frühjahr stets
im Auge und wird je nach den Prognosen deutscher
Wetterdienste sicher bald auch mit
Streufahrzeugen ausrücken. „Autofahrer sollten
aber bereits jetzt in der jetzigen Übergangszeit
sehr vorsichtig unterwegs sein“, mahnt Kempken,
dass Straßen vor allem morgens und abends in
Sekunden überfrieren und gepaart mit dem derzeit
rieselnden Laub plötzlich zu gefährlichen
Rutschbahnen werden könnten.
Bislang war der Winterdienst in Moers aber noch
nicht gefordert. Für den Fall der Fälle hat
Kempken das Salzlager am Jostenhof mit rund 900
Tonnen wieder gut gefüllt. Neun Einsatzfahrzeuge
stehen bereit, von denen drei speziell auch für
den Einsatz auf Radwegen geeignet sind.
Übrigens: Enni testet in diesem Winter mit zwei
Streufahrzeugen die Straßen überwiegend mit Sole
statt mit reinem Salz zu streuen.
„Damit wollen wir zukünftig die ausgebrachten
Salzmengen und somit Kosten reduzieren und
umweltverträglicher arbeiten.“ Aktuell gehört
zur Routine, dass ein Mitarbeiter bei
angekündigten Temperaturen unter drei Grad
Celsius morgens gegen drei Uhr bekannte
Problemstellen, wie Brücken und Unterführungen,
abfährt und auf Glätte kontrolliert. Stellt er
eine Rutschgefahr fest, alarmiert er sofort den
Bereitschaftsdienst, der dann je nach Einsatz
mit bis zu 60 Kollegen zeitgleich ausrückt.
„Je nach Stärke des Wintereinbruchs
haben wir unterschiedliche Szenarien eingespielt
und Abläufe fest geregelt“, sei es laut Kempken
das Ziel, dass der Verkehr stets weiter rollen
kann. Dazu gehört, dass der Winterdienst
Prioritäten setzt. Heißt: In jedem Fall befreien
die Einsatzfahrzeuge immer zunächst die rund 160
Kilometer langen Hauptverkehrsstraßen sowie
Schulbuslinien und 51 Kilometer priorisierte
Radwege von Schnee und Eis.
„Wenn es
langanhaltend schneien sollte, geschieht dies
täglich auch zweimal.“ Parallel kümmert sich
Enni dann auch um Gehwege zu städtischen
Einrichtungen, etwa rund um Friedhöfe,
Parkanlagen sowie an Kindergärten und Schulen.
„Sind dann noch Kapazitäten frei und lassen es
Einsatzzeiten noch zu, räumen wir Nebenstraßen
der sogenannten Priorität 2.“
Es
gibt auch Straßen, in denen es keinen
öffentlichen Winterdienst gibt. Jene, die nicht
der Streupflicht unterliegen, müssen Bürger auch
in Moers im Winter stets selbst die Gehwege von
Schnee und Eis befreien. „Wie und wo Bürger
ihrer Kehrpflicht nachkommen müssen und wie dies
geschehen muss, ist in der
Straßenreinigungssatzung festgelegt, die wir im
Internet veröffentlicht haben.“
Auf
Kundenwunsch bietet Enni für private und
gewerbliche Kunden auch einen individuellen
Winterdienst an. Fragen zum Winterdienst
beantwortet die Enni zudem unter der kostenlosen
Servicenummer 0800 222 1040.
Moerser ‚Schlosspark im Wandel‘: Infos über
Schlossparksanierung
Natur erhalten, Zukunft gestalten, Geschichte
bewahren: Unter diesem Motto wird der
Schlosspark ab Januar fit gemacht für die
nächsten Generationen. Mehr über Anlass, Ablauf
und die Hintergründe hat die Stadt Moers auf
ihrer Homepage und ihrem YouTube-Kanal
zusammengestellt.
Zu Wort kommen
neben Verantwortlichen aus der Verwaltung, der
beauftragte Landschaftsarchitekt und ein
Vertreter des BUND (Bund für Umwelt und
Naturschutz). Zusätzlich liegt ein Flyer an
verschiedenen Stellen (Rathaus, Enni
Kundencenter, Sparkassenfilialen, Moers
Marketing) aus.

Von den circa 600 Bäumen im Schlosspark leiden
ungefähr 220 unter Trockenheit und Krankheiten
als Folge des Klimawandels. Andere stehen zu eng
und entziehen sich Licht und Nährstoffe. Etwa
130 Bäume müssen deshalb gefällt werden, 100
neue werden gepflanzt. Neue Wege, Bänke und
Brücken verbessern künftig die
Aufenthaltsqualität. Aus rund 18 Prozent der
versiegelten Flächen wird Rasen. Alle Infos sind
unter
www.moers.de/schlosspark und www.youtube.com/stadtmoers abrufbar.
Nützlicher Alltags-Helfer:
Abfallkalender 2025 auf dem Weg in Moerser
Haushalte
Gelbe Säcke, Restabfall, Bio- und Papiertonne
oder am Kreislaufwirtschaftshof; In Moers haben
Bürger viele Möglichkeiten, ihren Abfall richtig
zu entsorgen. Auch im neuen Jahr gibt der
Abfallkalender hier einen Überblick. Die ENNI
Stadt & Service Niederrhein (Enni) verschickt ab
dem 25. November deswegen erneut rund 55.000
Exemplare per Post an alle Haushalte. Tanja
Neervort, Leiterin der Enni-Kundenzentren, weiß,
dass viele Moerser bereits darauf warten.
„Der Kalender ist ein beliebter
Familienplaner, durch den Moerser nicht nur
Abfuhrtermine sondern auch einige große
Stadt-Events im Blick haben. „Da Enni durch das
Entsorgungsunternehmen Schönmackers auch in den
kommenden drei Jahren mit der Abfuhr der
Verpackungsabfälle für die Dualen Systeme in
Moers beauftragt wurde, wird es 2025 einen neuen
Zuschnitt der Abfuhrbezirke geben“, rät Neervort
deswegen in der Neuauflage des Kalenders ganz
genau hinzuschauen.
Denn Ulrich
Kempken habe als zuständiger Abteilungsleiter
die Touren über viele Abfallarten nochmals
optimiert. Einige Straßen bekommen dadurch neue
Bezirksnummern und die Abfuhr der Biotonnen und
gelben Säcke kann zu anderen als den gewohnten
Wochentagen erfolgen. „Gerade beim Jahreswechsel
kann sich einmalig auch der Abfuhrrhythmus
ändern und es beim Bioabfall und den gelben
Säcken statt zwei schon mal drei Wochen bis zur
nächsten Leerung dauern.“
Der
Abfallkalender ist heute für viele Moerser ein
praktischer Alltagshelfer, der neben den
übersichtlichen Abfuhrterminen auch
Informationen etwa zur Weihnachtsbaumabfuhr, zur
Straßenreinigung oder zur Entsorgung von
Sperrgut gibt. Auch Sonderaktionen, wie die
Laubsammlung an mobilen Standorten oder die
Altkleidersammlung an Haustüren, sind hier
aufgeführt.
Alte Kleider oder Schuhe
wird Enni auch 2025 nach vorheriger Anmeldung
über die Enni-Homepage bis zu viermal direkt bei
Kunden abholen. Genau wie dieser Service haben
sich auch die digitalen Angebote am neuen
Kreislaufwirtschaftshof bewährt. Vor allem die
verlängerten Öffnungszeiten mit online buchbaren
festen Entsorgungsterminen kommen gut an.
Hierdurch können Moerser Abfälle, Strauchschnitt
oder Sperrmüll täglich bereits ab 6 Uhr morgens
anliefern.
„Auch abends verlängern
sich die Annahmezeiten“, sagt Neervort. „Mit
einem festen Termin können Moerser den
Kreislaufwirtschaft wochentags auch von 16 bis
19 Uhr und samstags von 14 bis 16 Uhr
ansteuern.“
Wer die Informationen
lieber auf dem elektronischen Wege mag, kann
auch im neuen Jahr die App „Meine Enni“ oder den
elektronischen Abfallkalender mit
Erinnerungsdienst nutzen, der Kunden automatisch
über Abholtermine informiert. „Kunden können
sich Termine mit wenigen Klicks unter
www.enni.de
auch auf ihre persönlichen elektronischen
Kalender übertragen“, sei auch dies mittlerweile
ein Angebot, das tausende Moerser nutzen.
Stellenplan ist Thema im Ausschuss
am 20. November
Der Stellenplan 2025 der Stadt Moers ist Thema
im Ausschuss für Personal und Digitalisierung am
Mittwoch, 20. November. Die Sitzung findet um 16
Uhr im Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1,
statt.
In dem Zusammenhang beraten die
Mitglieder des Ausschusses auch den Antrag von
zwei Fraktionen, das Personal im Zentralen
Außendienst des Ordnungsamtes aufzustocken. Die
Verwaltung schlägt vor, die Anzahl der Stellen
nicht zu erhöhen.
Umgang
mit Obdachlosigkeit in Eindhoven ist Thema im
Moerser Sozialausschuss
Wie die Stadt Eindhoven mit Obdachlosigkeit
umgeht, erfahren Mitglieder und Gäste des
Sozialausschusses am Dienstag, 19. November. Ein
weiteres Thema ist das geplante Bürgerzentrum in
der Barbarastraße in Meerbeck.
Die
öffentliche Sitzung beginnt um 16 Uhr im
Ratssaal des Rathauses Moers (Rathausplatz 1).
Zur selben Zeit beginnt dort zwei Tage später
(Donnerstag, 21. November) der
Jugendhilfeausschuss. Hier geht es u. a. um die
Arbeit des Kinder- und Jugendzentrums Eick und
den Tagesstättenbedarfsplan 2024 bis 2027.
Moers: Streichelzootiere werden
während des Umbaus artgerecht untergebracht
Im nächsten Jahr beginnt der Umbau des
Streichelzoos. In der etwa zweijährigen Bauzeit
werden die Tiere extern untergebracht, hat der
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und
Umwelt am Donnerstag, 14. November, beschlossen.
Aus Sicht des Tierwohls und aus Kostengründen
ist die Variante besser als der Bau von
provisorischen Gehegen auf der Bolzplatzwiese
(Höhe Krefelder Straße).
Ebenfalls
im nächsten Jahr soll die Umprogrammierung der
sogenannten ‚Bettelampeln‘ für Radfahrer
beginnen. An elf Kreuzungen soll der Radverkehr
dann ohne Drücken eines Tasters mit dem
Autoverkehr ‚mitlaufen‘. Dort, wo ein Umbau von
Ampelanlagen dafür notwendig ist, wird dieser
Aspekt bei der Neuplanung von Kreuzungsbereichen
berücksichtigt.
Nicht tätig werden kann
die Stadt bei Landesstraßen (z. B. Venloer
Straße). Die Sanierung der Baerler Straße
zwischen Klever Straße und Bahnübergang, den
Umbau der Ehrenmalstraße zwischen Schulstraße
und Grafschafter Rad- und Wanderweg und die
Eintragung der ehemaligen Zeche Rheinpreußen
Schacht 5/9 in die Denkmalliste hat der
Ausschuss ebenfalls beschlossen.
Er
befürwortet außerdem die Pläne von Enni zur
Ausgestaltung des künftigen Grillareals im
hinteren Bereich des Freibades Solimare. 40 Euro
soll das Grillen für 4,5 Stunden kosten.
Moers-Pass-Inhaber zahlen die Hälfte. Hier
sollen zudem eine Hundewiese und ein Kletterpark
gebaut werden.
Neu_Meerbeck:
Interkulturelles Kaffeetrinken für Frauen
Zum Interkulturellen Kaffeetrinken lädt das
Stadtteilbüro Neu_Meerbeck Frauen aus Meerbeck
und Hochstraß am Mittwoch, 20. November, 16.30
bis 18 Uhr, ein. Mit Mitarbeiterin Eva Zurek
können sie sich in gemütlicher Runde über Themen
austauschen, die alle Frauen wichtig und
interessant finden.
Herkunft,
kultureller und religiöser Hintergrund spielen
keine Rolle. Für Kaffee und Knabbereien sorgt
das Team des Stadtteilbüros. Jede Frau darf aber
auch gerne etwas mitbringen. Das Kaffeetrinken
für Frauen findet im Stadtteilbüro Neu_Meerbeck,
Bismarckstraße 43b, statt. Telefonische
Rückfragen für Interessentinnen an Eva Zurek: 0
28 41 / 201-528.
Theater: Weltreise
Kleve: Um 17 Uhr
begeben wir uns im Theater im Fluss in der
Ackerstraße 50-56 auf Weltreise. Wie immer sind
besonders Kinder und ihre Eltern aus allen
Herkunftsländern eingeladen! Jede*r ist
willkommen. Der Eintritt ist kostenlos und eine
Anmeldung wird auch nicht benötigt. Kommt
einfach vorbei und schnuppert rein. Wohin es
geht, bestimmt das Publikum.

Reisebegleiter sind unter anderem die Musikanten
Mohamad Al Tenawi mit der arabischen Laute und
Thomas Ruffmann an der Fiedel. Mit dabei sind
außerdem der Künstler Bassam Alkhouri und das
Team vom Theater im Fluss.
Für die
Kinder gibt es ein kleines, wechselndes Programm
und die Köchinnen aus unserem Quartier zaubern
wieder etwas zu unserem internationalen Büffet
herbei. Wir möchten auch auf kulinarische
Weltreise gehen und wer mag, kann Speisen aus
der eigenen Heimat oder Herkunftsregion
mitbringen und die Anderen probieren lassen. Wie
immer sind besonders Kinder und ihre Eltern aus
allen Herkunftsländern eingeladen. Alle sind
willkommen.
Der Eintritt ist kostenlos,
Spenden sind erwünscht und eine Anmeldung ist
nicht nötig. Kommt einfach vorbei und schnuppert
rein. Mi., 20.11.2024 - 17:00 - 19:30 Uhr
Kleve: Filmvorführung mit
Podiumsdiskussion "Expedition Depression"
Wie erkennt man eine Depression? Welche Formen
kann sie annehmen, und welche
Unterstützungsangebote gibt es besonders für
junge Menschen? Am 26. November 2024 laden
Studierende des Masterstudiengangs
Gesundheitswissenschaften und -management in
Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg zu
einer Filmvorführung mit anschließender
Podiumsdiskussion ein.

Im Zentrum der Veranstaltung steht der
Dokumentarfilm "Expedition Depression", der die
persönlichen Erfahrungen von fünf jungen
Erwachsenen mit der Erkrankung beleuchtet.
Anmeldung online möglich über AOK.
Di., 26.11.2024 - 18:30 - 21:00 Uhr
Bundesweiter Vorlesetag: Moerser
Bürgermeister las vor
Auch in diesem Jahr hat sich Bürgermeister
Christoph Fleischhauer wieder am bundesweiten
Vorlesetag am Freitag, 15. November, beteiligt.
Er las Kindern der St. Marien-Schule in Meerbeck
aus einem Kinderbuch vor, das ihn schon in
seiner Kindheit begeisterte: ,Die Kinder aus
Bullerbü‘ von Astrid Lindgren.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer liest
Kindern der St. Marien-Schule vor (Foto: pst)
Moers: Grafschafter Museum zeigt den
Film ‚Schwarzer Zucker, rotes Blut‘
Der Film ‚Schwarzer Zucker, rotes Blut‘ erzählt
die Geschichte von Anna Strishkowa aus Kyjiw,
die 1943 als Kleinkind an der Rampe von
Auschwitz stand und bis heute weder die Namen
ihrer Eltern noch ihre Geburtsstadt kennt. Das
Grafschafter Museum zeigt den Film des
Mannheimer Fotografen und Filmemachers Luigi
Toscana am Dienstag, 26. November, um 19.30 Uhr,
in Kooperation mit dem Verein Erinnern für die
Zukunft im Alten Landratsamt, Kastell 5.

(Foto: Luigi Toscano)
Toscano lernte
Anna Strishkowa 2015 im Rahmen seines Projektes
‚Gegen das Vergessen‘ in Babyn Jar kennen.
Seitdem ließ ihn ihr Schicksal nicht mehr los.
Toscano ging auf Spurensuche Die Spurensuche
nach Annas Herkunft führte Toscano von Auschwitz
in das weißrussische Dorf Pronino, zum Lager
Potulice-Lebrechtsdorf in Polen, nach Kyiv und
Drohobytsch in der Ukraine, bis nach Unna in
Nordrhein-Westfalen. Anna Strishkowa ist
inzwischen 85 Jahre alt.
Anwesend
sind an dem Abend Anna Strishkowa, Filmemacher
Luigi Toscana und zwei weitere Angehörige Annas,
von deren Existenz Anna erst über die
Filmrecherche erfahren hat und die sie an diesem
Tag in Moers kennenlernt. Die Anreise und der
Aufenthalt von Anna Strishkova werden gefördert
von der Stiftung „Erinnerung Verantwortung
Zukunft (EVZ)“ in Berlin.
Weitere
Unterstützung erhält die Veranstaltung von der
ENNI und der Sparkasse am Niederrhein Da die
Veranstaltung kostenlos ist, die Plätze aber
begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung
telefonisch unter 0 28 41/201 – 6 82 00
unbedingt erforderlich.
Moers: Bestseller-Autorin Tanja Köhler liest zu
‚Rauhnächten‘
‚Rauhnächte‘ sind besondere Tage, um zur Ruhe zu
kommen und das vergangene Jahr zu reflektieren.
Die Zeit zwischen Weihnachten und dem
Dreikönigstag entdecken immer mehr Menschen für
sich. Am Samstag, 23. November, 19.30 Uhr, lädt
die Bibliothek Moers zu einer besonderen
Event-Lesung mit der erfolgreichen Autorin Tanja
Köhler ein.
Sie nimmt ihre
Zuhörer mit auf eine Reise in die Welt der
Rauhnächte – ohne Esoterik und Aberglaube, dafür
mit fundierten Hintergründen und spannenden
Geschichten. Sie liest aus ihrem
Spiegel-Bestseller und stellt ihr neues Buch
‚Rauhnächte für Paare‘ vor. Der Eintritt zur
Lesung in der Bibliothek Moers,
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, kostet 15 Euro.
Karten sind im Vorverkauf in der
Bibliothek sowie in der Neukirchener
Buchhandlung, Andreas-Bräm-Straße 18/20, 47506
Neukirchen-Vluyn, erhältlich. Eine frühzeitige
Reservierung wird empfohlen. Weitere
Informationen zur Veranstaltung gibt es unter bibliothek@moers.de oder
0 28 41 / 201-759.

Baugenehmigungen für Wohnungen im September
2024: -23,1 % zum Vorjahresmonat
Baugenehmigungen von Januar bis September 2024
zum Vorjahreszeitraum: -19,7 % Baugenehmigungen
in Neubauten von Januar bis September 2024 zum
Vorjahreszeitraum: -25,7 % bei
Einfamilienhäusern -13,0 % bei
Zweifamilienhäusern -21,7 % bei
Mehrfamilienhäusern
Im September 2024
wurde in Deutschland der Bau von 15 300
Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 23,1 %
oder 4 600 Baugenehmigungen weniger als im
September 2023. Im Zeitraum von Januar bis
September 2024 wurden 157 200 Wohnungen
genehmigt.
Das waren 19,7 % oder 38 500
weniger als im Vorjahreszeitraum. In diesen
Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen für
Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden
als auch für neue Wohnungen in bestehenden
Gebäuden enthalten.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden
im September 2024 insgesamt 11 400 Wohnungen
genehmigt. Das waren 31,1 % oder 5 100 Wohnungen
weniger als im Vorjahresmonat. Von Januar bis
September 2024 wurden 128 400 Neubauwohnungen
genehmigt und damit 22,2 % oder 36 600 weniger
als im Vorjahreszeitraum.
Dabei ging die
Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser
um 25,7 % (-9 800) auf 28 300 zurück. Bei den
Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter
Wohnungen um 13,0 % (-1 500) auf 9 700. Auch bei
der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, den
Mehrfamilienhäusern, verringerte sich die Zahl
der genehmigten Wohnungen deutlich um 21,7 %
(-22 800) auf 82 400 Wohnungen.
1,8 % weniger Gewerbeaufgaben größerer
Betriebe von Januar bis September 2024
• Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben
steigt um 1,3 %
• Gründungen größerer
Betriebe nehmen um 0,8 % ab • Neugründungen
insgesamt sinken um 0,9 %
Von Januar bis
September 2024 wurden in Deutschland rund 90 700
Betriebe gegründet, deren Rechtsform und
Beschäftigtenzahl auf eine größere
wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
waren das 0,8 % weniger neu gegründete größere
Betriebe als von Januar bis September 2023.
Gleichzeitig sank die Zahl der vollständigen
Aufgaben von Betrieben mit größerer
wirtschaftlicher Bedeutung um 1,8 % auf rund 70
900.
Neugründungen insgesamt sinken
um 0,9 %
Die Neugründungen von Gewerben
waren von Januar bis September 2024 mit rund
456 000 um 0,9 % niedriger als im entsprechenden
Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der
Gewerbeanmeldungen sank um 1,0 % auf rund
547 500. Zu den Gewerbeanmeldungen zählen neben
Neugründungen von Gewerbebetrieben auch
Betriebsübernahmen (zum Beispiel Kauf oder
Gesellschaftereintritt), Umwandlungen (zum
Beispiel Verschmelzung oder Ausgliederung) und
Zuzüge aus anderen Meldebezirken. 1,3 % mehr
vollständige Gewerbeaufgaben
Die
Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben war
von Januar bis September 2024 mit rund 356 800
um 1,3 % höher als von Januar bis September
2023. Die Gesamtzahl der Gewerbeabmeldungen
stieg um 0,7 % auf rund 443 000. Dabei handelt
es sich nicht nur um Gewerbeaufgaben, sondern
auch um Betriebsübergaben (zum Beispiel Verkauf
oder Gesellschafteraustritt), Umwandlungen oder
Fortzüge in andere Meldebezirke.

21,0 Millionen Liter wassergefährdende
Stoffe im Jahr 2023 bei Unfällen ausgetreten
• Ausgetretene Schadstoffmenge gegenüber dem
Vorjahr fast verdreifacht, Zahl der Unfälle
dagegen auf niedrigstem Stand seit Beginn der
Zeitreihe
• 3,3 Millionen Liter ausgetretene
Schadstoffe in der Umwelt verblieben
• Über
900 Gewässerverunreinigungen, darunter 46 Mal
Grundwasser betroffen
Im Jahr 2023 sind
in Deutschland bei Unfällen mit
wassergefährdenden Stoffen rund 21,0 Millionen
Liter Schadstoffe unkontrolliert in die Umwelt
ausgetreten. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, konnten davon rund 3,3
Millionen Liter (15,9 %) nicht wiedergewonnen
werden und verblieben dauerhaft in der Umwelt.
Mit 21,0 Millionen Litern war die ausgetretene
Schadstoffmenge fast dreimal so groß wie im
Vorjahr (2022: 7,1 Millionen Liter) und die
größte Menge seit 2019 (31,2 Millionen Liter).
Solche starken Schwankungen sind
nicht ungewöhnlich, da die ausgetretene
Schadstoffmenge stark abhängig ist von der Art
und Schwere der Unfälle. So kann rund die Hälfte
der im Jahr 2023 freigesetzten Schadstoffe auf
nur vier Unfälle zurückgeführt werden. Die Zahl
der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen blieb
dagegen mit 1 876 im Vorjahresvergleich nahezu
unverändert (-0,1 %) und erreichte den
niedrigsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im
Jahr 1997.

115 000 Liter „stark wassergefährdende“
Stoffe richteten dauerhaften Schaden an
Wassergefährdende Stoffe werden nach ihrem
Schadenspotenzial als „allgemein
wassergefährdend“ deklariert oder in eine von
drei Wassergefährdungsklassen (WGK) eingeteilt.
Unter den im Jahr 2023 insgesamt
3,3 Millionen Litern dauerhaft in der Umwelt
verbliebenen Schadstoffen entfiel der größte
Anteil mit 2,6 Millionen Litern (79,1 %) auf
„allgemein wassergefährdende“ Stoffe.
Mit 2,4 Millionen Litern waren das
insbesondere Jauche, Gülle und Silagesickersaft.
308 000 Liter (9,3 %) bei Unfällen ausgetretene
„schwach wassergefährdende“ Stoffe (WGK 1)
konnten nicht wiedergewonnen werden. Zu dieser
Wassergefährdungsklasse zählen Stoffe wie
Ethanol oder Natronlauge. Weitere 121 000 Liter
(3,7 %) in der Umwelt verbliebene Schadstoffe
waren „deutlich wassergefährdende“ Stoffe (WGK
2). In dieser Kategorie sind Mineralölprodukte
wie Heizöl oder Dieselkraftstoff eingruppiert.
Die gefährlichsten Stoffe sind die
„stark wassergefährdenden“ Stoffe (WGK 3),
darunter Quecksilber oder Benzin. Im Jahr 2023
richteten 115 000 Liter (3,5 %) solcher
Schadstoffe dauerhaften Schaden in der Umwelt
an. 907 Gewässerverunreinigungen durch
721 Unfälle Im Jahr 2023 ereigneten sich
721 Unfälle, bei denen mindestens ein Gewässer
direkt von freigesetzten Schadstoffen
verunreinigt worden ist. In 441 Fällen gelangten
Schadstoffe in ein Oberflächengewässer,
beispielsweise einen Fluss oder einen See. In
416 Fällen war die Kanalisation betroffen.
Insgesamt 46 Mal wurde das Grundwasser
verunreinigt und in vier Fällen unmittelbar die
Wasserversorgung. Insgesamt wurde demnach durch
721 Unfälle 907 Mal ein Gewässer verunreinigt,
da durch 180 Unfälle mehrere Gewässerarten
gleichzeitig betroffen waren.
Montag, 18. November
2024
"Stopp Gewalt gegen Frauen“ -
Veranstaltungsflyer: #16Days vom 25. November
bis 10. Dezember 2024 im Kreis Wesel
Am 25. November jährt sich der Internationale
Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen
Frauen. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist eine
der häufigsten Menschenrechtsverletzungen
weltweit. Sie kann überall auftreten: in jedem
Land, auf der Straße oder zuhause.
Es gibt verschiedene Formen von Gewalt. Neben
häuslicher Gewalt und Vergewaltigung gehören
auch Stalking und Belästigung dazu. In
Deutschland ist jede dritte Frau mindestens
einmal in ihrem Leben von körperlicher und/oder
sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede
vierte Frau wird mindestens einmal Opfer von
körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch
den aktuellen oder einen früheren Partner.
Erschreckend ist, dass nur etwa 20 Prozent der
Frauen, die von Gewalt betroffen sind, auch
tatsächlich Hilfe bei einer Beratungsstelle
suchen.
Rund um den „Internationalen
Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" am
25. November finden jährlich zahlreiche
Kampagnen und Veranstaltungen statt, um die
Öffentlichkeit auf das Thema Gewalt gegen Frauen
aufmerksam zu machen. Ziel ist es, Frauen Mut zu
machen, sich kompetente Hilfe zu holen. Aus
diesem Grund veranstalten verschiedene
Akteur*innen auch in diesem Jahr wieder Aktionen
und Veranstaltungen im Kreis Wesel.
Neben den Gleichstellungsstellen der Städte
Wesel, Hamminkeln, Xanten, Kamp-Lintfort und
Moers engagieren sich außerdem in Wesel der Club
Soroptimist und die Frauenberatungsstelle der
AWO. In dem Veranstaltungs-Flyer: #16Days vom
25. November bis 10. Dezember 2024 im Kreis
Wesel (www.wesel.de/StoppGewalt) können sich
Interessierte über alle Aktivitäten und Events
informieren.
Alle Aktionen tragen
die eine wichtige Botschaft für Betroffene:
Unterstützung ist für euch da, sobald ihr den
Mut aufbringt, euch an eine Hilfestelle zu
wenden. Links
Internationaler Tag zur Beendigung der Gewalt
gegen Frauen #16Days vom 25. November bis 10.
Dezember 202 (1.19 MB)
Unterbringung, Beratung und Betreuung
von Flüchtlingen in der Stadt Wesel
Die Stadt Wesel schreibt die Unterbringung,
Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der
Stadt Wesel in einem Verhandlungsverfahren mit
vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb europaweit
aus.
2024-11-15_eu_bk_unterbringung_beratung_u_betreuung_v._fluechtlingen.pdf (95.94
KB)
Aktion
„Weihnachts-Wunsch“ startet wieder im Kreishaus
Der Kreis Wesel lädt auch in diesem Jahr alle
Besucherinnen und Besucher des Kreishauses ein,
sich an der Aktion „Weihnachts-Wunsch“ zu
beteiligen. Ab Mittwoch, 20. November 2024, ab
10 Uhr, können alle, die mitmachen möchten,
einen Wunschzettel vom Weihnachtsbaum im Foyer
des Kreishauses nehmen und einen Wunsch
erfüllen. Die Aktion findet zugunsten der
Bewohnerinnen und Bewohner des Lühlerheims in
Schermbeck statt, das ganzheitliche Wohn-,
Lebens- und Eingliederungshilfe leistet.
Landrat Ingo Brohl freut sich auf die
weihnachtliche Aktion: „Weihnachten ist das Fest
der Nächstenliebe und der Gemeinschaft. Mit der
Aktion ‚Weihnachts-Wunsch‘ können wir diese
Werte ganz konkret leben, indem wir den
Bewohnerinnen und Bewohnern des Lühlerheims eine
Freude bereiten. Es sind oft die kleinen Gesten,
die in dieser besonderen Zeit ein großes Zeichen
setzen. Indem wir einen Wunsch erfüllen,
schenken wir nicht nur materielle Dinge, sondern
auch Aufmerksamkeit, Mitgefühl und Hoffnung –
Werte, die den Geist von Weihnachten ausmachen.“
Die Wünsche haben einen Wert von
maximal 25 Euro. Neben der Erfüllung von
Wünschen besteht auch die Möglichkeit, sich mit
einer Geldspende an der Aktion zu beteiligen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die
verpackten Geschenke mitsamt Wunschzettel bis
Freitag, 13. Dezember, um 12 Uhr bei den
persönlichen Referenten abgeben, Kreishaus
Wesel, Reeser Landstraße 31, Raum 139. Von dort
aus werden die Geschenke ans Lühlerheim
übergeben.
Wer sich mit einer Spende
beteiligen möchte, kann mit folgenden Kontodaten
an das Lühlerheim spenden: KD-Bank Dortmund,
IBAN: DE76 3506 0190 1010 3610 16, BIC:
GENODED1DKD oder Verbandssparkasse Wesel, IBAN:
DE32 3565 0000 0000 2204 67, BIC: WELADED1WES.
Dinslaken: Aktion Ofenführerschein geht weiter
Die Stadt Dinslaken setzt in diesem
Herbst und Winter die Kampagne „Richtig Heizen
mit Holz“ fort. Ziel ist es, private
Betreiber*innen in einer optimierten Bedienung
ihrer Holzöfen und Kamine zu schulen. Wer bei
der Ofenführerschein-Aktion mitmacht, kann nicht
nur Brennholz sparen und seinen Wartungsaufwand
senken, sondern gleichzeitig Gutes für die
Nachbarn und die Umwelt tun, da durch den
richtigen Betrieb des Holzofens Emissionen
eingespart werden können.
Der Kurs
richte sich dabei nicht nur an diejenigen, die
gerade neu in das Thema „Heizen mit Holz“
einsteigen: „Der Großteil unserer
Kursteilnehmenden heizt bereits seit vielen
Jahren mit Holz. In einer Umfrage unter unseren
Kurs-Absolventen konnten wir dabei feststellen,
dass gerade diese Zielgruppe trotzdem neue
Erkenntnisse aus dem Kurs gewinnen konnte - wie
beispielsweise die Technik, das Kaminfeuer von
oben anzuzünden“, erzählt Max Kummrow, Gründer
und Geschäftsführer der Ofenakademie.de.
Für die zweite Heizsaison sind noch
ausreichend Ofenführerscheine frei. Wer den
Ofenführerschein kostenlos absolvieren will,
geht dazu auf folgende Internetseite: www.ofenakademie.de/dinslaken oder
nimmt den Umweg über die städtische Homepage www.dinslaken.de/ofenfuehrerschein#
Konrad-Adenauer-Straße:
Kanäle werden fit für die Zukunft gemacht
Dinslaken - Unsere bestehende
Kanalisation ist teilweise über 60 Jahr alt und
weist erhebliche bauliche Mängel auf. Um
künftige Schäden und damit verbundene, mögliche
Schadstoffaustritte in Grundwasser und Boden zu
vermeiden, werden die Rohre umfänglich saniert.
Gleichzeitig werden die Regenwasserkanäle
vergrößert, um den Anforderungen des
Klimawandels gerecht zu werden. Durch die
Vergrößerung der Durchmesser fließt das Wasser
fließt schneller.

Interaktive Karte informiert über Baustellen
Übersichtsplan Konrad-Adenauer-Straße
Die Stadt Dinslaken beginnt
am 18. November 2024 mit der Sanierung und
Vergrößerung der Schmutz- und
Regenwasserkanalisation in der
Konrad-Adenauer-Straße. Die Bauarbeiten starten
am Kreisverkehr Duisburger Straße und wandern
dann bis zur Willy-Brandt-Straße (B8). Sowohl
die Kanäle in der Straße selbst als auch alle
Hausanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze
werden fit für die Zukunft gemacht. In der
Straße befinden sich einige
Hauptversorgungsleitungen (Fernwärme,
Thyssengas) sowie weitere Strom-, Wasser- und
Telekommunikations-Leitungen.
Die
beengten Verhältnisse gestalten den
Kanalaustausch aufwendig. Den Anwohnern*innen
soll die Erreichbarkeit der Grundstücke während
der Baumaßnahmen weitestgehend ermöglicht werden
und die Bauarbeiten mit möglichst geringen
Einschränkungen einhergehen. Die Bauzeit dauert
daher insgesamt voraussichtlich bis ins 1.
Quartal 2026. Mit der Baumaßnahme gehen
Sperrungen und Umleitungen für den Verkehr
einher. Die Bauarbeiten werden dabei
abschnittsweise ausgeführt.
Notwendige
Umleitungen werden ausgeschildert.
Zunächst
ergeben sich Einschränkungen für die
Verkehrsführung im Kreisverkehr. Hier erfolgt
eine Ampelreglung für die Duisburger Straße in
beide Fahrtrichtungen. Die Kreisverkehrsreglung
wird damit aufgehoben, von der Innenstadt
kommend kann dann der Kreisverkehr auch
„gegenläufig“ befahren werden. Eine Einfahrt ist
in alle Straßen außer der Konrad-Adenauer-Straße
möglich. Hier wird die Ein- und Ausfahrt
zunächst bis Jahresende komplett gesperrt.
Darüber hinaus ist bis zum Jahresende
die Einfahrt aus der Kreuzstraße und der
Heinrich-Nottebaum-Straße in den Kreisverkehr
hinein nicht möglich. Umleitungen werden
ausgeschildert. Der Rad- und Fußverkehr ist
weitgehend von den Sperrungen ausgenommen. Die
weitere Verkehrsführung für die anschließenden
Arbeiten in der Konrad-Adenauer-Straße im
nächsten Jahr wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Auch die betroffenen Anwohner*innen erhalten
dann schriftliche Informationen über den
Baufortschritt und über die o.a. möglichen
Einschränkungen.
Auf der städtischen
Homepage gibt es zudem eine neue interaktive
Karte. Diese informiert Interessierte über
aktuelle Baustellen und Umleitungen. Mit einem
Klick kann man sich unter anderem über Art und
Dauer der jeweiligen Baustelle informieren und
einen Überblick erhalten. Der Direkt-Link zur
Baustellenübersicht ist: www.dinslaken.de/stadt-buergerservice/dienstleistungen/aktuelle-baustellen
Neues Amtsblatt
Am 15. November 2024 ist ein neues
Amtsblatt der Stadt Dinslaken erschienen. Es
enthält unter anderem zwei Bekanntmachung zu den
Gas- und Strompreisen sowie eine öffentliche
Zustellung. Das Amtsblatt kann auch auf der
städtischen Homepage eingesehen werden: www.dinslaken.de/stadt-buergerservice/aktuelles/amtsblatt.
Musikschule:
Weihnachtsgeschenk für Musikinteressierte
Geschenkidee für Musikinteressierte: Die
Sonderabonnements der Moerser Musikschule sind
ab sofort wieder erhältlich. Unter dem Motto
‚Zusammen‘ gibt es im Martinstift wieder ein
abwechslungsreiches und spannendes Programm
voller Höhepunkte zu erleben. Fester Bestandteil
der Reihe ist das Niederrheinische
Kammerorchester Moers, das mit dem einzigartigen
Miteinander von professionellen und
ambitionierten Amateurmusikern und -musikerinnen
das gemeinsame Musizieren auf seine ganz
besondere Art lebt.
Kammermusik,
Neujahrskonzert und Liednacht
Kammermusik
der Extraklasse versprechen Mona und Rica Bard
unter dem Motto: Vier Hände, zwei Schwestern,
ein Puls! - wenn sie vierhändige Klaviermusik
präsentieren. Nicht minder aufregend ist die
Cello-Sensation Cello Duello, bei der sich zwei
Cellovirtuosen einen musikalischen Wettstreit
liefern. Das schon zum Kult geworden
Neujahrskonzert mit der Meisterklasse Lindner
aus Köln, sowie strahlende Trompetenklänge aus
Frankreich runden die zweite Jahreshälfte ab.
Höhepunkt und Abschluss ist die
lange Liednacht, wenn es über Lesung,
Liederabend und dem Special Guest William Wahl
nicht nur Töne, sondern auch Kulinarik in
entspannter Form zu genießen gibt. Das Sonderabo
ist ausschließlich über die Moerser Musikschule
erhältlich: Filder Straße 126, Telefon: 0 28 41
/ 201-6 81 00, E-Mail: moerser.musikschule@moers.de.
Das Sonderabonnement ist für 76,50 Euro
erhältlich, Inhaberinnen und Inhaber des
Moers-Pass´ oder der Ehrenamtskarte erhalten 50
Prozent Ermäßigung.
Workshop
„Die Welt Matarés in einem Leparello“ im Museum
Kurhaus Kleve
Am Samstag, dem 23.
November 2024 von 11–13 Uhr werden bei einem
Rundgang durch die Ausstellung „Ewald Mataré:
KOSMOS“ anhand von Skizzen besondere Eindrücke
festgehalten. Zurück in der WunderKammer falten
die Teilnehmer:innen einen Leporello.

Der Workshop richtet sich an Kinder und
Jugendliche ab 7 Jahren, die Teilnahmegebühr
beträgt 13 Euro. Bitte anmelden beim Empfang des
Museum Kurhaus Kleve (Tel. +49-(0)2821 / 750 10,
empfang@mkk.art).
Am 1.
Advent: ‚Die Weihnachtsgeschichte‘ als Lesung im
Alten Landratsamt
Moers - England im
19. Jahrhundert: Ein eisiger Wind weht durch die
verschneiten Londoner Straßen. Vor diesem
Hintergrund spielt die wohl berühmteste
Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Das
Grafschafter Museum präsentiert am 1.
Adventsonntag, 1. Dezember, gemeinsam mit der
Moerser Gesellschaft zur Förderung des
literarischen Lebens ab 11 Uhr die Erzählung als
Weihnachtslesung im Alten Landratsamt, Kastell
5.

Foto: Die Vorleser
Die beiden
Schauspieler Saskia Leder und Sebastian Coors
haben die Geschichte neu entdeckt und tragen sie
im Rahmen eines Live-Hörbuchs vor. Mit Spaß am
Gruseligen und Schaurigen werden die
Zuhörerinnen und Zuhörer in die Geschichte der
drei Geister, die den alten Geizhals Scrooge am
Weihnachtsabend besuchen, entführt. Kleine
Geräusche und musikalische Klänge unterstützen
die stimmungsvolle Atmosphäre der Lesung und
leiten so durch Dickens weihnachtliche
Geistergeschichte.
Verkaufsstart der RUHR.TOPCARD 2025 in der
Stadtinformation Dinslaken
Die von
der Ruhr Tourismus GmbH herausgegebene
RUHR.TOPCARD für das Jahr 2025 ist ab dem 19.
November in der Stadtinformation am Rittertor
erhältlich. Sie ermöglicht Inhaber*innen den
kostenfreien Zugang zu 97 Freizeitattraktionen
in der Metropole Ruhr und den angrenzenden
Regionen und somit eine potenzielle
Gesamtersparnis von über 800 Euro.
Zu den neuen Zielen, die einmalig den
kostenlosen Eintritt bieten, zählen der Kalisto
Tierpark Kamp-Lintfort, Stadtführungen in
Recklinghausen, das Freibad Annen in Witten, die
MS Schwalbe Witten, die Ruhrorter
Personenschifffahrt Duisburg und die
Oberschlesisches Landesmuseum-Ausstellung in
Ratingen.
Die neuen „Halber
Preis“-Ausflugsziele sind 2025 die Attraktionen
Kletterwald Freischütz Schwerte, SimRacing
Essen, Oberschlesisches Landesmuseum-Escape
Rooms Ratingen, Saunadorf Lüdenscheid, Mining
Adventure World/Gold Chamber Dorsten, Metronom
Theater Oberhausen und Einfach Klettern im Easy
Climb Essen. Besucher*innen profitieren dabei
von einer Ermäßigung von 50 Prozent auf den
Eintrittspreis bei 59 Freizeit-Attraktionen,
großteils sogar mehrmals im Kalenderjahr 2025.
Auch in diesem Jahr gibt es wieder
eine Weihnachtsaktion zum Vorverkaufsstart. Vom
19. November bis 31. Dezember 2024 ist die
RUHR.TOPCARD 2025 mit einem Rabatt von 10 Euro
erhältlich. Sie kostet in diesem Zeitraum für
Kinder 33,- (Geburtsjahrgang 2011 – 2020) und
für Erwachsene 59,- Euro. Ab dem 1. Januar
beträgt der Preis 69,- Euro für Erwachsene und
43,- Euro für Kinder.
Straßen.NRW startet in die
Wintersaison
Straßen.NRW in Gelsenkirchen hat
sich für den Winter vorbereitet: In den 56
Meistereien und 128 Salzlagerhallen lagert der
Straßenbetrieb rund 80.000 Tonnen Streusalz.
Zusätzlich befindet sich eine Reserve von 10.000
Tonnen im Zentrallager Rheinberg.

Mit rund 550 Streu- und Räumfahrzeugen - Foto
Straßen.NRW - halten 1.200 Mitarbeiter bei
Bedarf rund 16.000 Kilometer Bundes- und
Landesstraßen sowie wichtige Radwege frei.
Priorität haben stark frequentierte Straßen
sowie gefährliche Abschnitte wie Steigungs- und
Gefällestrecken oder von Verwehungen bedrohte
Bereiche.
Die Einsatzplanung
Die
Straßenmeistereien stellen im Vorfeld zum Winter
Rufbereitschaftspläne im Schichtbetrieb auf. Von
November bis April – im Bedarfsfall auch schon
früher oder später – nutzen sie die
Wettervorhersagen- und Prognosen des Deutschen
Wetterdienstes, um die Einsätze zu planen.
Deutet sich nach den Wettervorhersagen eine
winterliche Lage außerhalb der regelmäßigen
Arbeitszeiten an, wird die Rufbereitschaft
eingesetzt, damit die Befahrbarkeit der
wichtigen Straßen für den überörtlichen Verkehr
zwischen 6 bis 22 Uhr beziehungsweise auf
Streckenabschnitten, die im Zusammenhang mit dem
Autobahnnetz eine herausragende Verkehrsfunktion
erfüllen, 24 Stunden täglich, gewährleistet ist.
Die Beobachtung der Wetterlage im Einklang
mit einer oft langjährigen Erfahrung zeichnet
einen guten Winterdienst aus.
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst
Der Deutsche Wetterdienst und Straßen.NRW
haben 1987 und in den Folgejahren ein System
entwickelt, das eine regionale (Straßen-)
Wettervorhersage- und Prognose anbietet - das
"Straßenzustands- und Wetterinformationssystem
(SWIS)". Mittlerweile wird SWIS, das eine
regionale Prognose der Wetterentwicklung
ermöglicht, bundesweit von den
Winterdienstorganisationen genutzt. Basis des
SWIS sind neben den nationalen und
internationalen meteorologischen Daten die
Messwerte der Straßenwetterstationen der
Bundesländer. idr
ACV gibt
Rat, um Pannen und Startprobleme in der kalten
Jahreszeit zu vermeiden

Klare Sicht im Winter ist unerlässlich: Alle
Scheiben und Spiegel eines Fahrzeugs müssen vor
Fahrtantritt vollständig frei von Eis und
Beschlag sein. Foto @bogdanhoda
Wenn
die Temperaturen fallen, nehmen typische
Winterprobleme für Autofahrerinnen und
Autofahrer zu. Ob beschlagene Scheiben, schwache
Batterien oder festgefrorene Türen – diese
Ärgernisse sind nicht nur lästig, sondern können
auch das Fahrzeug beschädigen und die
Fahrsicherheit beeinträchtigen. Der ACV
Automobil-Club Verkehr gibt wertvolle Tipps, um
diese und weitere Winterprobleme zu vermeiden
und sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen.
1. Schwachstelle Batterie: Winterpannen
effektiv vorbeugen Ein Blick in die ACV
Einsatzstatistik zeigt: Leere oder defekte
Batterien gehören zu den häufigsten Gründen,
warum Mitglieder die Pannenhilfe des
Automobilclubs in Anspruch nehmen. Kälte
beeinträchtigt die Batterieleistung deutlich –
besonders bei Temperaturen unter null Grad.
Batterien, die älter als fünf Jahre sind,
verlieren dabei besonders stark an Leistung und
sollten häufiger überprüft werden.
Auch Kurzstreckenfahrten können problematisch
sein, da sich die Batterie dabei nicht
vollständig auflädt. Wer sein Auto gelegentlich
im Freien parkt, riskiert zudem durch die kalten
Temperaturen und Stillstand eine schwache
Batterie.
ACV Tipp: Für Fahrzeuge, die
überwiegend für Kurzstrecken genutzt werden oder
längere Standzeiten haben, ist ein regelmäßiges
Aufladen sinnvoll. Eine Fahrt von mindestens 20
bis 30 Minuten hilft, die Batterie aufzuladen
und so die Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Alternativ kann ein Ladegerät oder
Erhaltungsladegerät genutzt werden, besonders
bei Autos, die oft im Freien stehen.
Bei
Elektroautos kommt zur Hochvoltbatterie für den
Antrieb eine separate 12-Volt-Batterie hinzu,
die Bordelektronik und wichtige Funktionen wie
Türverriegelung und Licht versorgt. Auch diese
kleinere Batterie ist kälteempfindlich und
sollte regelmäßig gewartet werden, um Ausfälle
zu vermeiden. Energiesparender Umgang mit
stromintensiven Verbrauchern wie Heizung und
Beleuchtung kann ebenfalls helfen, die
Batterieleistung zu schonen.
Der ACV
empfiehlt: Ein Starthilfekabel im Auto ist im
Winter ein wertvolles Notfall-Tool für alle
Fahrzeugtypen und sollte immer griffbereit sein.
2. Klare Sicht im Winter
Im
Winter ist klare Sicht unerlässlich – nicht nur
für die eigene Sicherheit, sondern auch aus
gesetzlicher Sicht. Die Straßenverkehrsordnung
schreibt vor, dass alle Scheiben und Spiegel
eines Fahrzeugs vor Fahrtantritt vollständig
frei von Eis und Beschlag sein müssen. Fahren
mit vereisten oder beschlagenen Scheiben kann
nicht nur Bußgelder nach sich ziehen, sondern
bei Unfällen auch eine Mitschuld begründen, da
die eingeschränkte Sicht die Reaktionsfähigkeit
beeinträchtigt. Dies kann zudem als grobe
Fahrlässigkeit bewertet werden, was Kürzungen
bei der Kaskoversicherung zur Folge haben kann.
Wartung und Pflege der
Scheibenwischer: Vor der Wintersaison sollten
Scheibenwischerblätter auf Risse und Abnutzung
geprüft und gegebenenfalls ersetzt werden.
Abgenutzte Wischer hinterlassen Schlieren, die
die Sicht erheblich beeinträchtigen. Der
Füllstand des Scheibenwischwassers ist
regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf
aufzufüllen, idealerweise mit einem
Frostschutzmittel, das mindestens bis -20°C
wirksam ist. So bleibt das Waschwasser
zuverlässig flüssig und verhindert ein
Einfrieren der Spritzdüsen.
Innenbeschlag vorbeugen: Beschlagene Scheiben
entstehen häufig durch eingeschaltete
Umluftfunktion oder Feuchtigkeit, die durch
Schnee, nasse Kleidung oder Regenschirme ins
Fahrzeug gelangt. Zur Vorbeugung ist es
hilfreich, auch im Winter gelegentlich die
Klimaanlage zu nutzen, die Umluftfunktion zu
deaktivieren und feuchte Gegenstände aus dem
Fahrzeug zu entfernen. Fußmatten trocknen besser
außerhalb des Fahrzeugs. Das Gebläse sollte
gezielt auf die Scheiben gerichtet werden, und
ein Antibeschlagtuch im Handschuhfach hilft,
Feuchtigkeit schnell abzuwischen.
Scheiben richtig enteisen: Heißes Wasser ist zum
Enteisen ungeeignet, da der plötzliche
Temperaturwechsel Spannungsrisse verursachen
kann. Auch das Warmlaufenlassen des Fahrzeugs,
um Scheiben zu enteisen, ist laut
Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt. Der ACV
empfiehlt einen stabilen Eiskratzer und
Enteisungsspray für eine sichere und effektive
Lösung.
3. Türdichtungen und
Schlösser vor Frost schützen
Festgefrorene
Türen und Schlösser sind im Winter nicht nur
ärgerlich, sondern können auch Schäden
verursachen. Der Versuch, eine zugefrorene
Autotür mit Gewalt zu öffnen, kann
Gummidichtungen reißen oder Türgriffe und
Mechanismen beschädigen. Wer seine
Gummidichtungen geschmeidig halten und ein
Festfrieren verhindern möchte, sollte diese
regelmäßig mit Silikonspray oder Glycerin
pflegen. Falls die Tür bereits zugefroren ist,
hilft es, die Tür vorsichtig anzudrücken, statt
sofort zu ziehen – das kann das Eis lösen. Ein
auf die betroffenen Dichtungen und Schlösser
gesprühtes Enteisungsspray sorgt ebenfalls für
schnelle Abhilfe.
Bei zugefrorenen
Türschlössern wird oft warmes Wasser empfohlen,
um das Eis zu schmelzen. Der ACV rät jedoch
davon ab, da das Wasser schnell wieder gefrieren
und das Schloss noch stärker vereisen kann.
Stattdessen sollten Türschlösser vorbeugend mit
einem silikon- oder graphitbasierten Spray
behandelt werden, um das Eindringen von
Feuchtigkeit zu verhindern. Für ältere Fahrzeuge
kann ein Türschlossenteiser hilfreich sein –
dieser sollte jedoch stets außerhalb des
Fahrzeugs, etwa in der Jacke oder Handtasche,
aufbewahrt werden.
4. Winterreifen
regelmäßig prüfen
Winterreifen bieten bei
niedrigen Temperaturen und winterlichen
Straßenverhältnissen den nötigen Grip. Die
gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 mm ist im
Winter oft unzureichend – der ACV empfiehlt
daher eine Profiltiefe von mindestens 4 mm, um
den Bremsweg auf glatten Straßen zu verkürzen.
Der Reifendruck sollte regelmäßig überprüft
werden, da er bei Kälte um bis zu 0,2 bar sinken
kann. Auch das Reserverad verdient im Winter
Aufmerksamkeit: Profil und Reifendruck sollten
hier ebenfalls kontrolliert werden.
5. Basis- und Notfallausrüstung für den Winter
Ein gut ausgestattetes Winter-Kit ist
unverzichtbar, um in der kalten Jahreszeit
sicher unterwegs zu sein und das Auto jederzeit
schnell von Schnee und Eis befreien zu können.
Zum Basiszubehör gehören Eiskratzer, Handschuhe,
Enteisungsspray und ein kleiner Handfeger für
größere Schneemengen. Eine vollständige
Notfallausrüstung ist besonders bei längeren
Fahrten, in abgelegenen Gegenden oder bei
starken winterlichen Bedingungen sinnvoll. In
solchen Fällen sind zusätzliche
Ausrüstungsgegenstände wie eine warme Decke,
Starthilfekabel, ein Abschleppseil und eine
Taschenlampe mit Ersatzbatterien empfehlenswert,
um auch bei unerwarteten Pannen gut vorbereitet
zu sein.
Für Fahrten in stark
verschneite Regionen sind Schneeketten ratsam –
ihre Montage sollte vor der Abfahrt geübt
werden, um im Ernstfall vorbereitet zu sein. ACV
Tipp: Bei längeren Fahrten in verschneite
Gebiete ist es sinnvoll, etwas Verpflegung wie
Nüsse, Energieriegel und Wasser mitzunehmen,
falls es zu unerwarteten Staus kommt. Eine
Powerbank für das Handy ist ebenfalls ratsam, um
bei leerer Autobatterie erreichbar zu bleiben –
zum Beispiel für den Pannendienst. Weitere
nützliche Tipps und umfassende Informationen
rund um Mobilität stellt der ACV auf seiner
Website im
Ratgeber-Bereich zur Verfügung.

In NRW haben mehr als 40 Prozent der Kommunen
den Hebesatz der Grundsteuer B innerhalb der
letzten zwölf Monate erhöht
Rund
43 Prozent der Kommunen in Nordrhein-Westfalen
haben bis zum 30. Juni 2024 den Hebesatz der
Grundsteuer B erhöht. Hierbei wird der
Grundbesitz von unbebauten und bebauten
Grundstücken besteuert, der nicht der Land- und
Forstwirtschaft zuzuordnen ist. Wie Information
und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt mitteilt, lag am
Stichtag 30. Juni 2024 der Hebesatz in 173
Kommunen über dem Wert des Vorjahres.
In 222 Kommunen blieb er unverändert. Büren
im Kreis Paderborn war die einzige Gemeinde, in
welcher der Hebesatz der Grundsteuer B
geringfügig (−1 Prozentpunkt) niedriger war als
Ende Juni 2023. Damit setzten bis zum 30. Juni
2024 mehr Kommunen den Hebesatz der Grundsteuer
B hoch als in den Jahren zuvor. 2022 und 2023
hatten jeweils rund ein Viertel der Kommunen die
Grundsteuer B erhöht; in den Corona-Jahren 2020
und 2021 hatte es Anhebungen in etwa jeder
zehnten Gemeinde gegeben (jeweils bis zum
Stichtag 30.06.).
Anders war es
zuletzt in den Jahren 2015 und 2016 gewesen: In
diesen Jahren hatten 210 bzw. 189 Kommunen – und
damit mehr Gemeinden als 2024 – den Hebesatz der
Grundsteuer B bis zum 30. Juni erhöht. Die
Gemeinde Niederkassel hatte mit einem Plus von
410 Prozentpunkten die höchste Steigerung des
Hebesatzes der Grundsteuer B NRW-weit die
höchste Steigerung des Hebesatzes der
Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr wurde zum
Stichtag 30. Juni 2024 in der Gemeinde
Niederkassel im Rhein-Sieg-Kreis verzeichnet.
Hier stieg der Hebesatz der
Grundsteuer B von 690 auf 1 100 Prozent
(+410 Prozentpunkte). Es folgten die Gemeinden
Eschweiler in der Städteregion Aachen
(+375 Prozentpunkte auf 895 Prozent), Meckenheim
ebenfalls im Rhein-Sieg-Kreis
(+324 Prozentpunkte auf 895 Prozent) und Xanten
im Kreis Wesel (+315 Prozentpunkte auf
965 Prozent). Gewogener Durchschnittshebesatz
zum Stichtag 30.06.2024 bei 614 Prozent Der sog.
gewogene Durchschnittshebesatz der Grundsteuer B
lag in NRW Ende Juni 2024 bei 614 Prozent und
war damit um 20 Prozentpunkte höher als zum
Stichtag 2023 (damals: 594 Prozent).
Seit 2013 hatte sich der gewogene
Durchschnittshebesatz jährlich erhöht. Den
größten Zuwachs hatte es zwischen Juli 2014 und
Juni 2015 gegeben (+34 Prozentpunkte). Die
niedrigsten Hebesätze der Grundsteuer B in
Nordrhein-Westfalen hatten am 30. Juni 2024 Verl
(170 Prozent), Schloss Holte-Stukenbrock
(280 Prozent; beide im Kreis Gütersloh) und
Monheim am Rhein im Kreis Mettmann mit
282 Prozent.
Die höchsten Hebesätze
wiesen Niederkassel mit 1 100 Prozent, Alfter im
Rhein-Sieg-Kreis mit 995 Prozent und Xanten mit
965 Prozent auf. Das Statistische Landesamt
weist darauf hin, dass der Hebesatz von der
jeweiligen Gemeinde selbst festgesetzt wird, die
dadurch die Höhe des Steueraufkommens aus der
Grundsteuer B beeinflussen kann. Bei der
Berechnung des gewogenen Durchschnittshebesatzes
wird das unterschiedliche Istaufkommen der
Grundsteuer B in den Städten und Gemeinden
berücksichtigt.
Die Betrachtung in
dieser PM bezieht sich auf den Stichtag
30. Juni, da laut Grundsteuergesetz (§ 25 GrStG)
Hebesätze jeweils bis zu diesem Datum für das
laufende Jahr angehoben werden können; danach
können sie für das laufende Jahr nur noch
gesenkt werden. Die Daten entstammen der
vierteljährlichen Kassenstatistik (2. Quartal
der jeweiligen Jahre). (IT.NRW)

NRW: Anstieg der Todesfälle durch nicht
natürliche Todesursachen im Jahr 2023
Im Jahr 2023 verstarben laut Todesbescheinigung
insgesamt 10 446 Personen (4 665 Frauen und
5 781 Männer) und damit 4,6 Prozent der
insgesamt 226 034 Verstorbenen in
Nordrhein-Westfalen aufgrund einer nicht
natürlichen Todesursache. Das entspricht einem
Anstieg von 13,3 Prozent gegenüber dem
Vorjahreswert (2022: 9 223 Personen).
Wie das tatistische Landesamt mitteilt, waren
mindestens zwei Drittel (66,2 Prozent bzw..
6 920 Todesfälle) der nicht natürlichen
Todesfälle auf einen Unfall zurückzuführen.
Weiterhin verstarben 839 Personen (8,0 Prozent)
an Folgezuständen nach länger zurückliegenden
Transportmittelunfällen oder sonstigen Unfällen.
Neben den unfallbedingten äußeren Todesursachen
nahmen Suizide mit 15,6 Prozent einen
erheblichen Anteil unter den nicht natürlichen
Todesursachen ein.

8,4 Prozent der nicht natürlichen
Todesursachen werden als Ereignisse, deren
nähere Umstände unbestimmt sind, eingestuft.
Zahl der nicht natürlichen Todesfälle durch
Stürze (meist im häuslichen Umfeld) hat sich im
Zehnjahresvergleich mehr als verdoppelt. Mehr
als zwei Drittel (68,8 Prozent) der Unfälle
resultierten aus einem Sturz im Rahmen eines
Unfallgeschehens. Insgesamt 4 760 Personen,
davon 2 441 Frauen und 2 319 Männer, kamen durch
einen Sturz zu Tode. Davon ereigneten sich 3 105
im häuslichen Umfeld mit einem
Durchschnittsalter der Betroffenen von
84,7 Jahren.
Die Anzahl der nicht
natürlichen Todesfälle durch Stürze hat sich im
Vergleich zu 2013 mehr als verdoppelt (2013:
2 088 Fälle); gegenüber 2022 war ein Anstieg um
7,4 Prozent zu verzeichnen. Suizide gegenüber
2022 um 13,1 Prozent angestiegen; im
Zehnjahresvergleich ist die Zahl der
freiwilligen Selbsttötung jedoch rückläufig Im
Jahr 2023 begingen laut Todesbescheinigung 1 631
Menschen (1 173 Männern und 458 Frauen) einen
Suizid.
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte
sich die Zahl der freiwilligen Selbsttötungen um
13,1 Prozent. Im Zehnjahresvergleich sank sie
jedoch um 5,6 Prozent (2013: 1 727 Fälle). Mehr
als zwei Drittel (71,9 Prozent) der Suizidopfer
waren männlich. Das durchschnittliche
Sterbealter lag bei 60,7 Jahren.

|