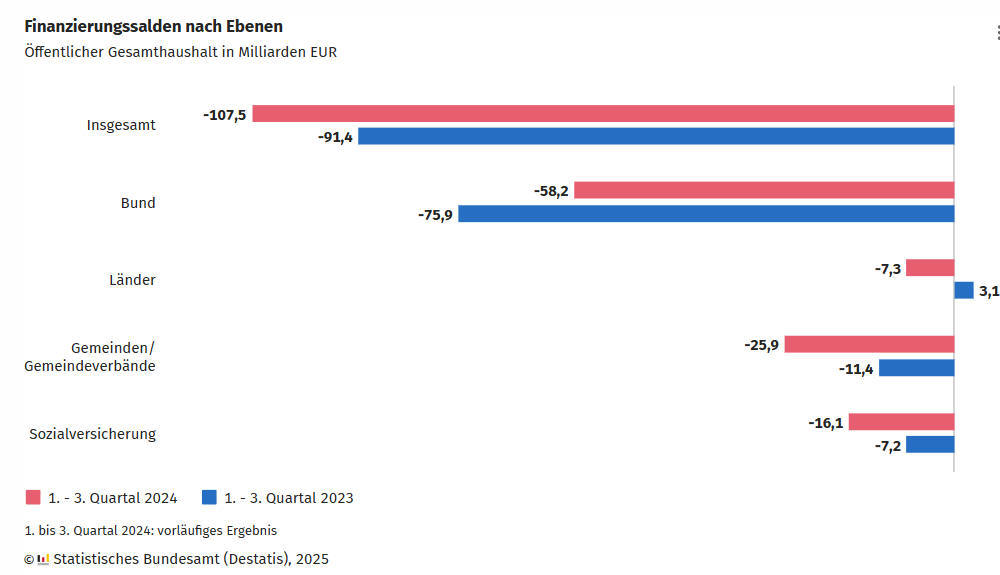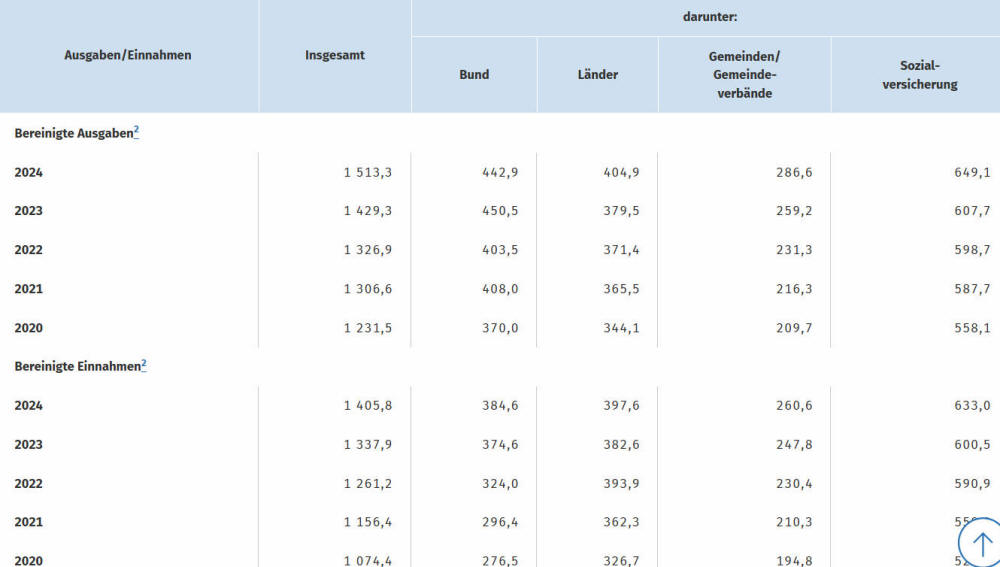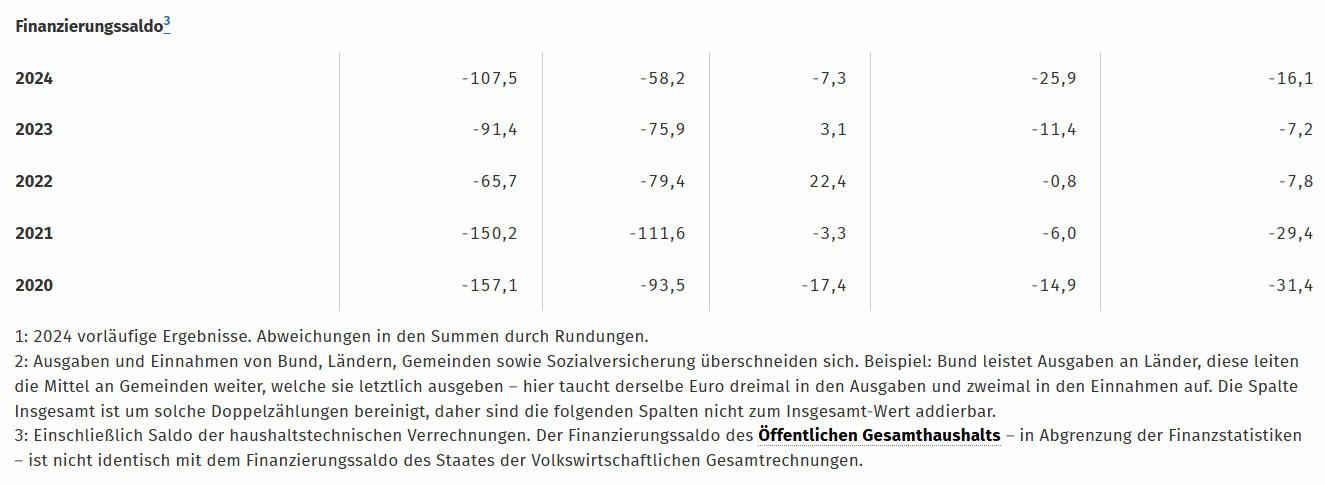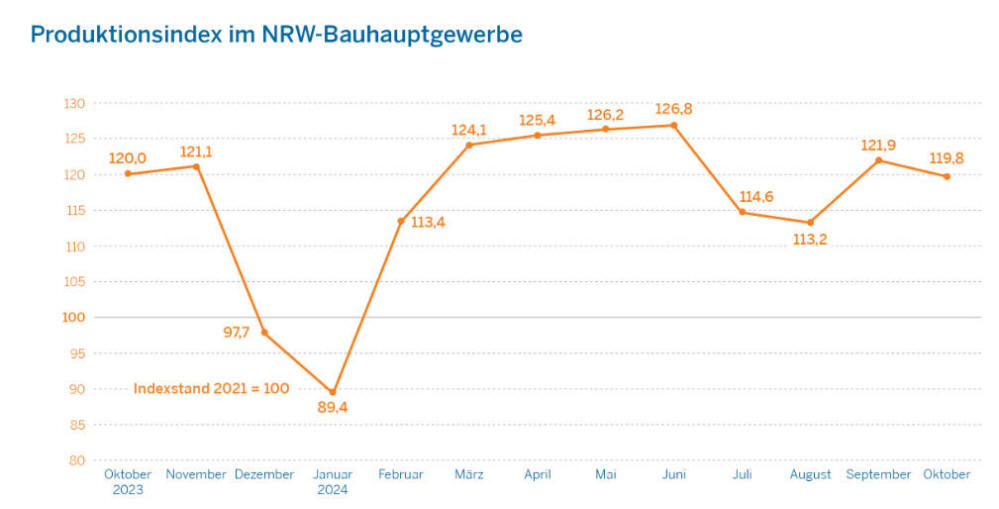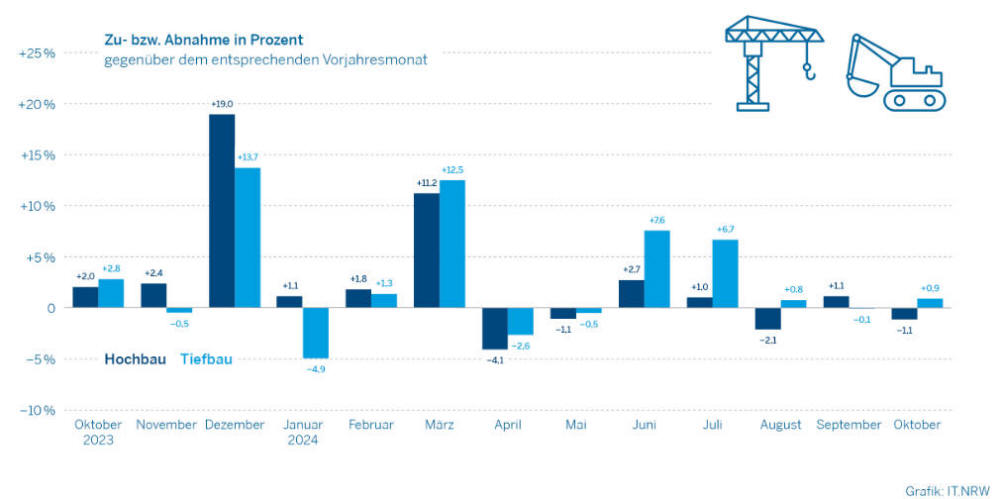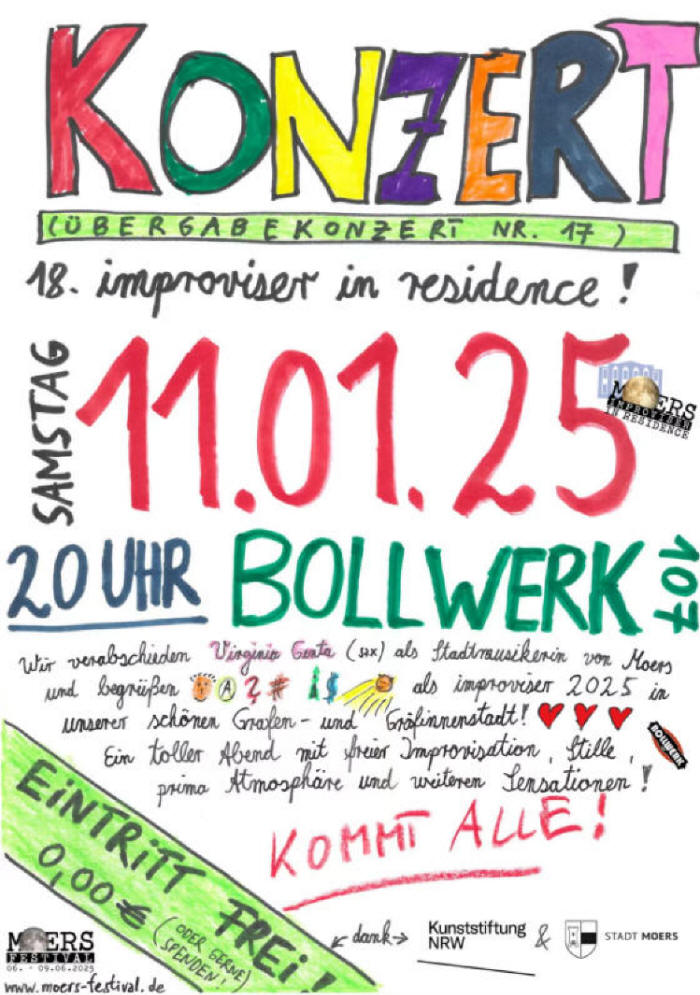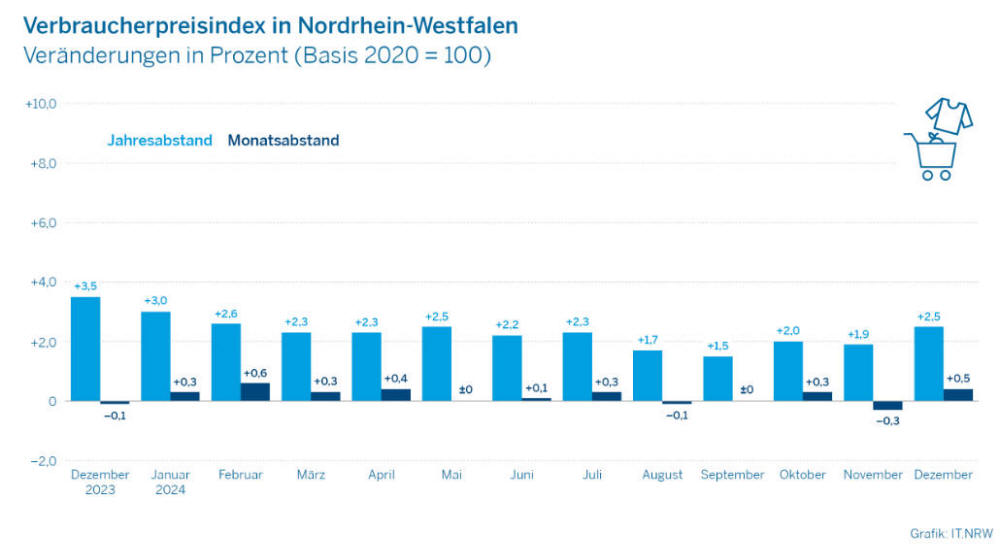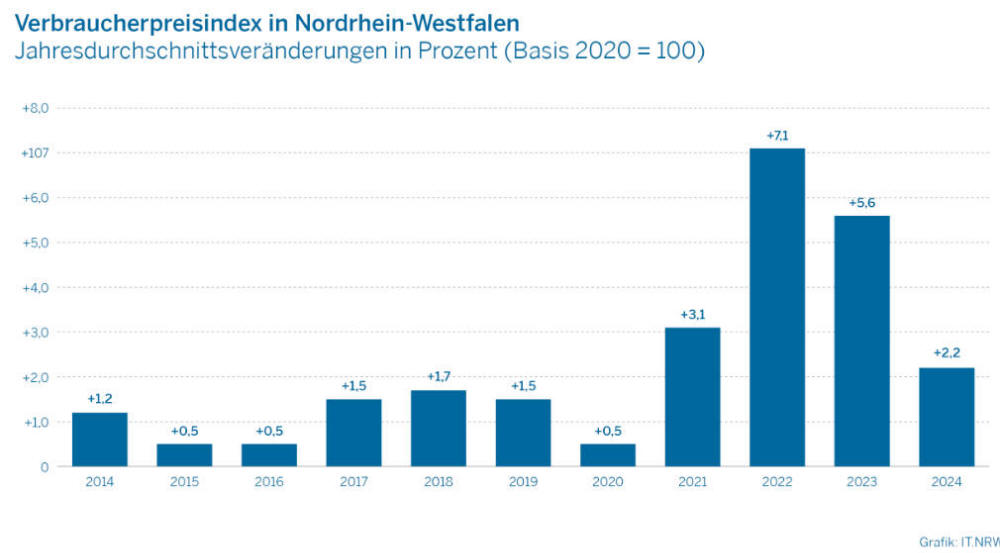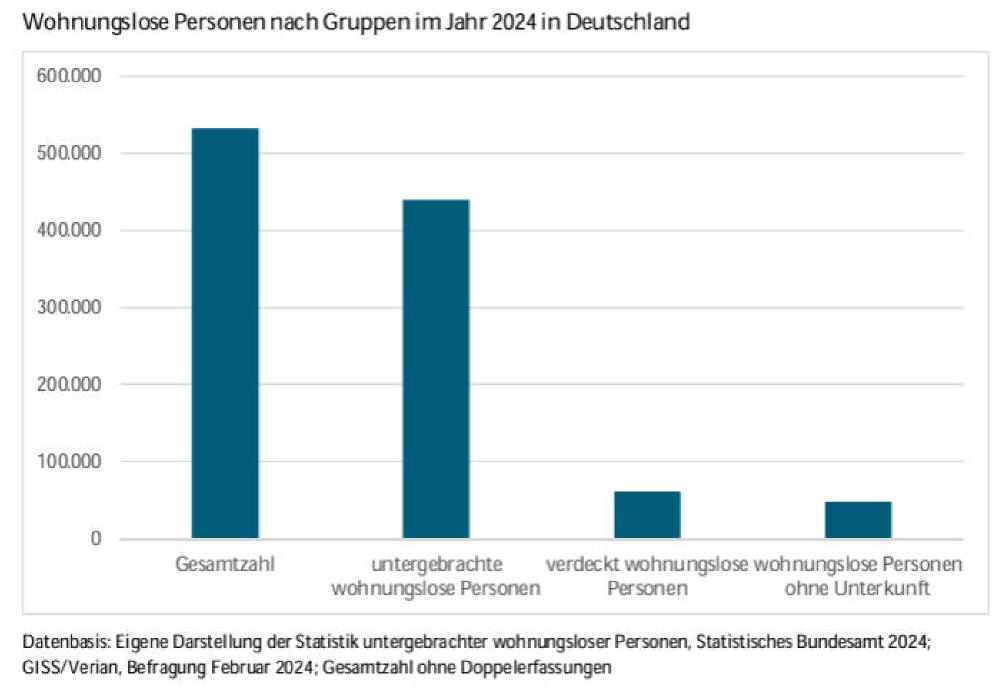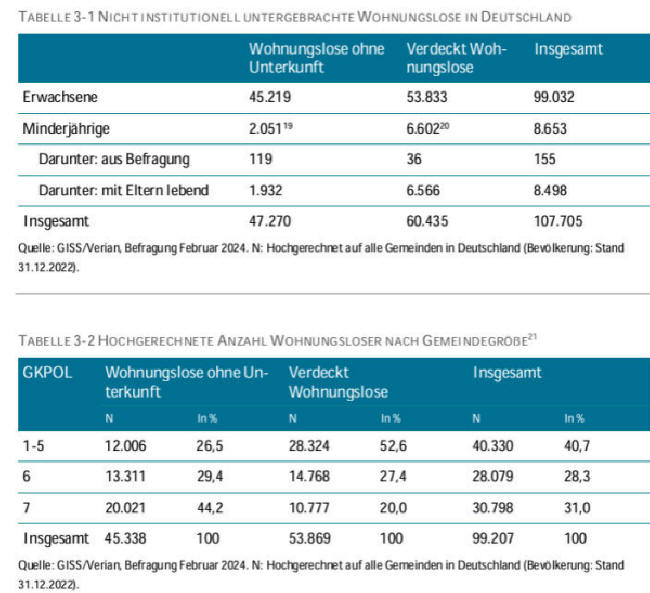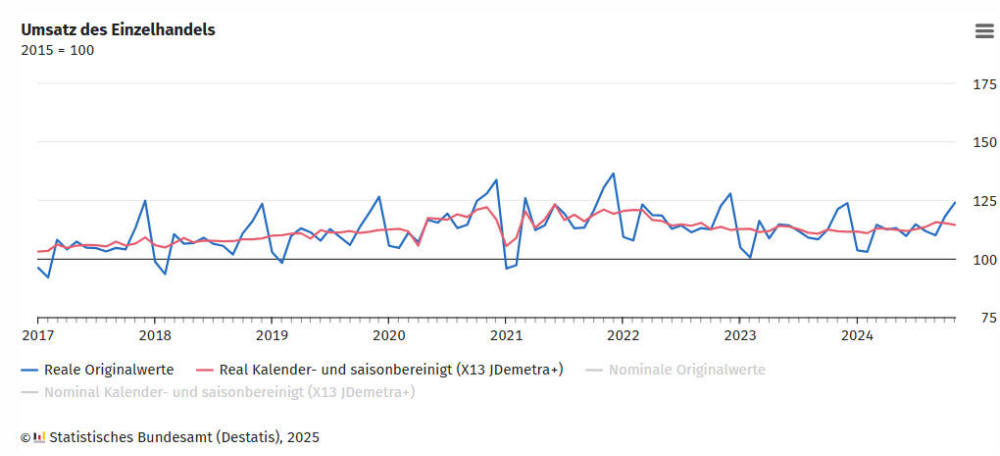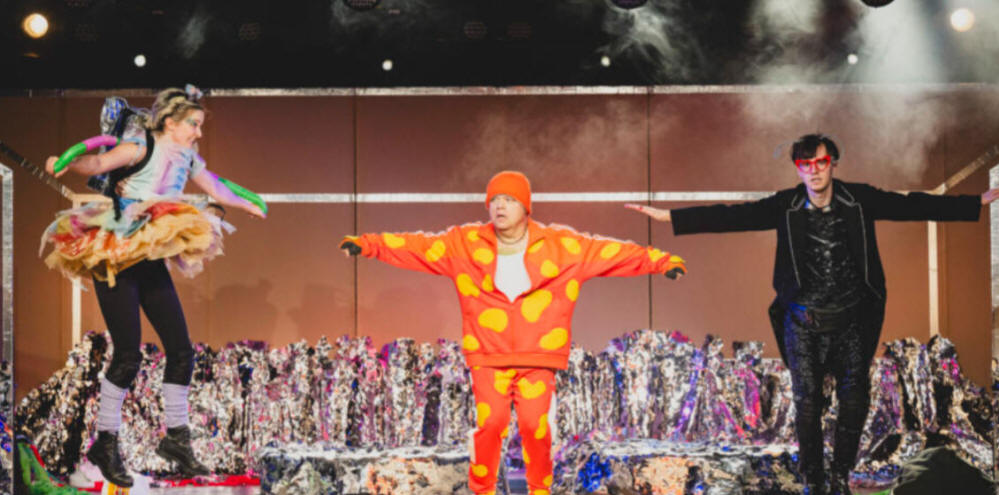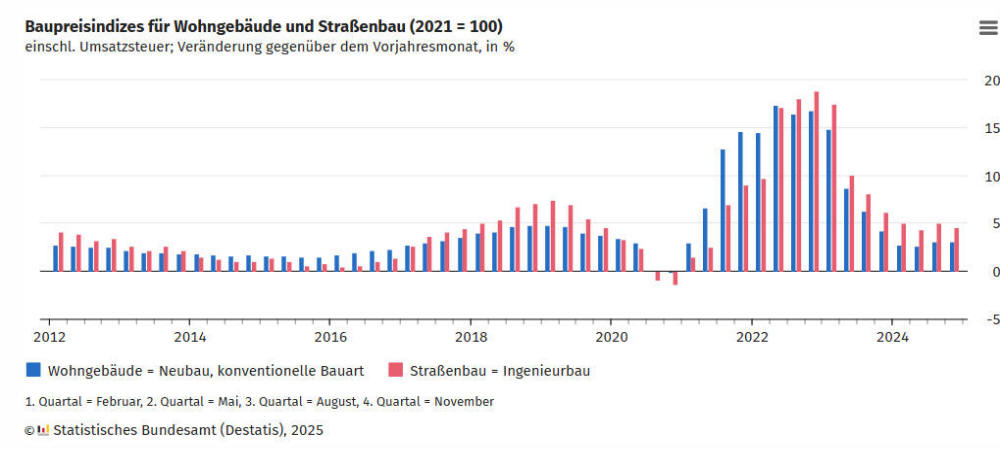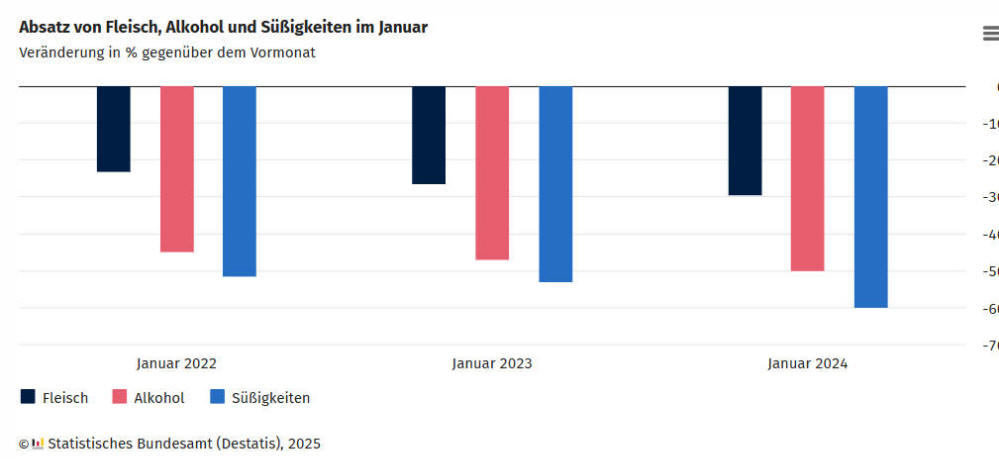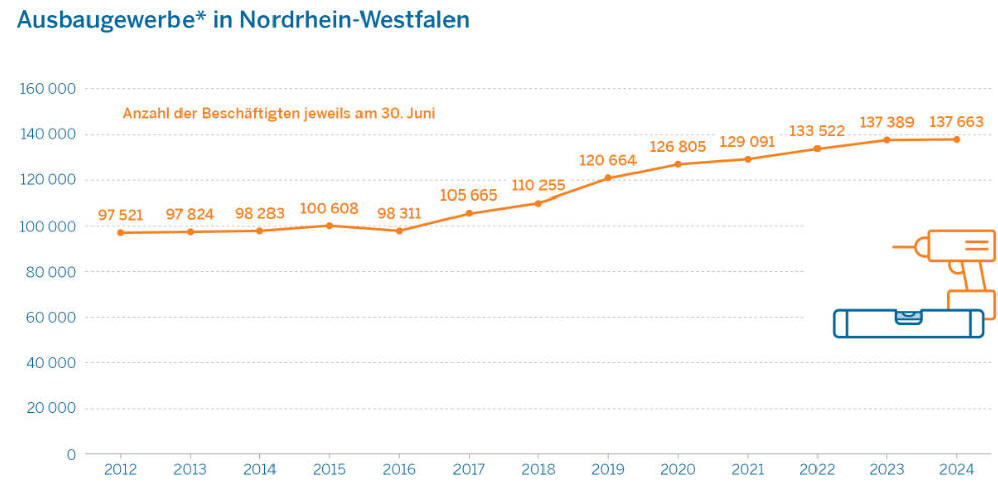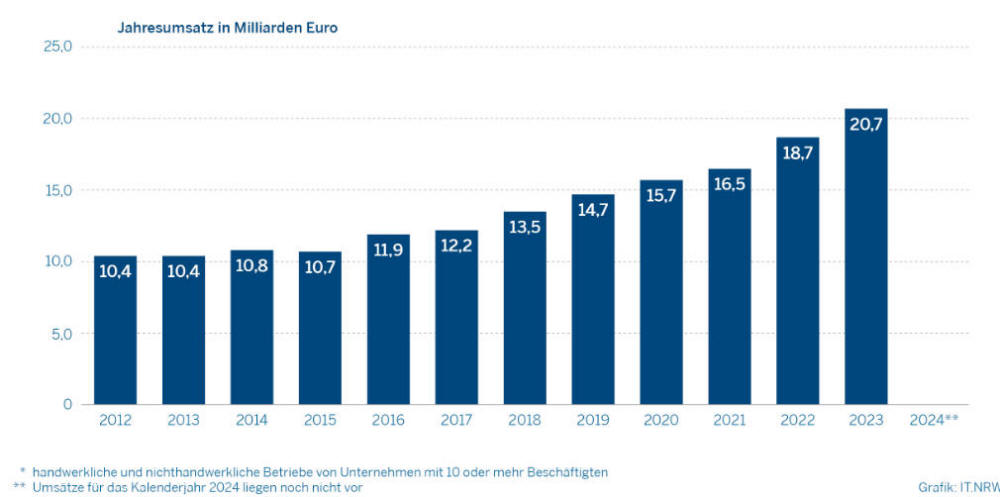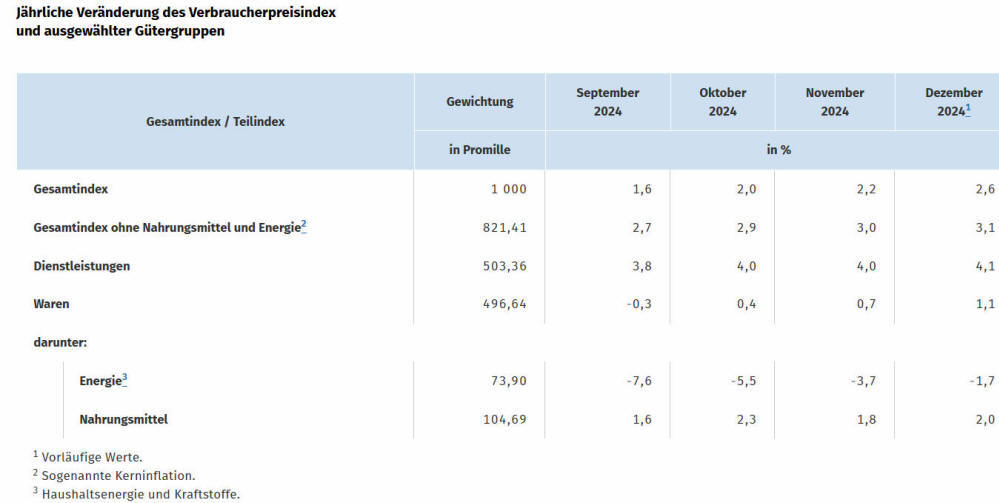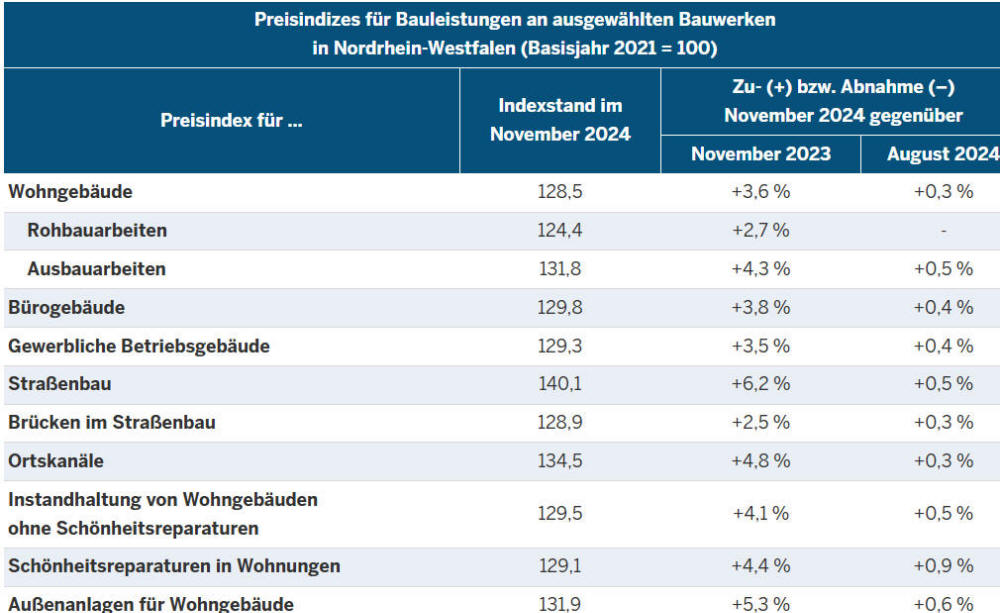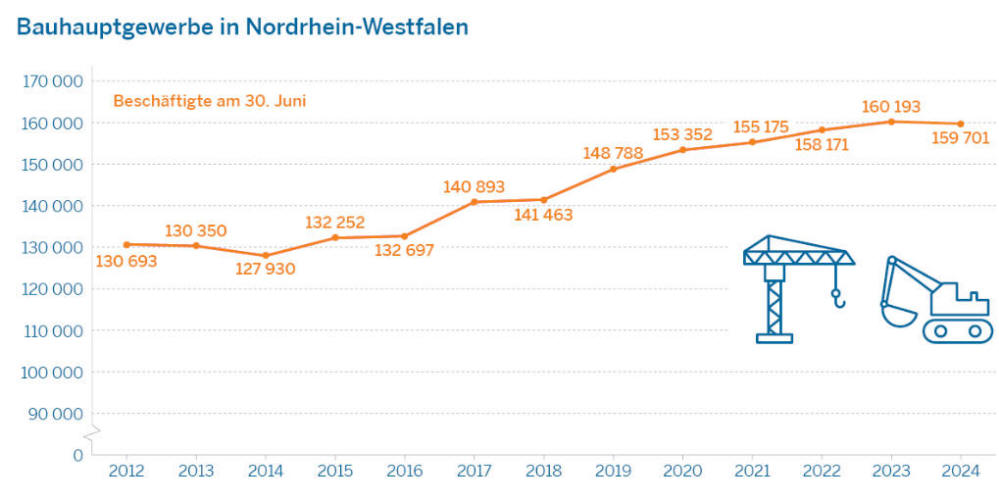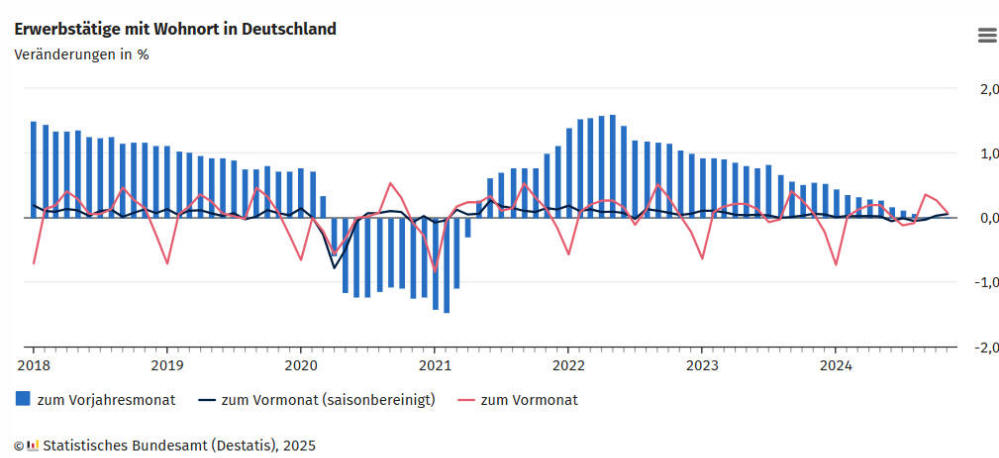|
Samstag, 11., Sonntag, 12. Januar 2025
Dinslaken: Bescheide über Grundbesitzabgaben
werden verschickt
Ab dem 10. Januar
2025 versendet die Stadt Dinslaken die
Grundbesitzabgabenbescheide 2025.
Erfahrungsgemäß kommt es in der Zeit nach dem
Versand der rund 20.000 Bescheide zu Rückfragen.
Die Stadt bittet darum, Anfragen möglichst per
E-Mail an gba@dinslaken.de zu senden. Diese
werden dann schnellstmöglich beantwortet.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden,
hat die Verwaltung den Bescheiden ein
Informationsschreiben mit entsprechenden
Änderungen für das Jahr 2025 beigefügt. Außerdem
sind weitere Informationen auf der städtischen
Homepage zusammengestellt: www.dinslaken.de/stadt-buergerservice/dienstleistungen/grundbesitzabgaben
Stadt Hamminkeln und Gelsenwasser
gründen gemeinsam Stadtwerke
Die
Stadt Hamminkeln im Kreis Wesel und das
Versorgungsunternehmen Gelsenwasser wollen
gemeinsam Stadtwerke gründen. Die Zusammenarbeit
wurde Ende des letzten Jahres besiegelt, jetzt
muss die Kommunalaufsicht das Vorhaben noch
genehmigen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird
u.a. der Bereich Abwasser geregelt.
Das Abwassernetz bleibt im Eigentum der Stadt,
während Betrieb, Substanzerhalt und
Neuinvestition bei der neu gegründeten
Stadtwerke Hamminkeln GmbH & Co. KG liegen. Über
die Dachgesellschaft ist die Stadt zu 51 Prozent
an dieser Gesellschaft beteiligt, Gelsenwasser
zu 49 Prozent.
Weiteres wichtiges
Handlungsfeld der Stadtwerke Hamminkeln wird die
Wärme- und Energiewende sein. Auf der Agenda
stehen zum Beispiel der Ausbau der
Netzinfrastruktur zur Stärkung erneuerbarer
Energien und die Transformation der
Gasnetzinfrastruktur. Dachgesellschaft des
Kooperationsprojekts ist die Hamminkeln
Beteiligungs GmbH, die zu 100 Prozent der Stadt
gehört. Informationen:
http://www.hamminkeln.de und
http://www.gw-energienetze.de
Copernicus-Bericht: 2024 war das
wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen
Das Jahr 2024 war das wärmste Jahr seit Beginn
der Aufzeichnungen und das erste Jahr, in dem
die globale Jahres-Durchschnittstemperatur 1,5
Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau
lag. Das zeigt der Bericht „Global Climate
Highlights 2024“ des Erdbeobachtungssystems
Copernicus der EU. Die Erwärmung des
europäischen Kontinents ist seit den 1980er
Jahren doppelt so schnell vorangeschritten wie
der globale Durchschnitt.
Er ist
damit der sich am schnellsten erwärmende
Kontinent der Erde. Das zeigen auch der
europäische Bericht
über den Zustand des Klimas 2023 und die
europäische Klimarisikobewertung. Extreme
Wetterereignisse nehmen zu Insgesamt nehmen
Häufigkeit und Schwere der extremen
Wetterereignisse zu. Die
Meeresoberflächentemperaturen sind nach wie vor
außergewöhnlich hoch, wobei der Zeitraum Juli
bis Dezember 2024 der zweitwärmste nach 2023
war.
EU-Klimapolitik
Die EU hat
sich verpflichtet, die globalen
Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen und bis
2050 klimaneutral zu werden. Sie hat sich auf Ziele
und Rechtsvorschriften geeinigt, um die
Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55
Prozent zu senken, und die Kommission hat
bereits ein Ziel von 90 Prozent für die
Nettoverringerung der Treibhausgasemissionen bis
2040 empfohlen.
Die Kommission hat im
April 2024 eine
Mitteilung darüber veröffentlicht, wie die
EU wirksam auf Klimarisiken vorbereitet und eine
größere Klimaresilienz aufgebaut werden kann.
Copernicus Copernicus ist die
Erdbeobachtungskomponente des Weltraumprogramms
der Europäischen Union. Das von der EU
finanzierte Programm ist ein einzigartiges
Instrument zur Beobachtung unseres Planeten und
seiner Umwelt.
Neues Amtsblatt
Am 8. Januar
2025 ist ein neues Amtsblatt der Stadt Dinslaken
erschienen. Es enthält eine öffentliche
Bekanntmachung zu 65 Grabstätten auf dem
Friedhof Im Nist, dem Parkfriedhof und dem
Waldfriedhof Oberlohberg. Hier werden Angehörige
gesucht, die die jeweiligen Grabstätten
fortführen. Sollte sich innerhalb von sechs
Monaten keine Person finden, welche die
Grabstätte fortführen möchte, geht das
Nutzungsrecht auf die Stadt Dinslaken über.
Außerdem enthält das Amtsblatt eine
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den
Wahlkreis 116 Oberhausen - Wesel III. Konkret
geht es um die Aufforderung zur Einreichung von
Kreiswahlvorschlägen zur Bundestagswahl am 23.
Februar. Die Amtsblätter der Stadt Dinslaken
können auf der städtischen Homepage nachgelesen
werden: www.dinslaken.de.
Infoabend: Stadt Moers sucht Pflegefamilien
Keine Erziehung, Förderung,
Versorgung – die Gründe, warum manche Kinder
nicht in ihren Familien leben können, sind
vielfältig. Hier kommt der Pflegekinderdienst
der Stadt Moers ins Spiel.

Kinder sollen unbeschwert aufwachsen können.
Pflegefamilien bieten einen verlässlichen
Lebensort. (Foto: Bubble 1971)
Um
Kindern in Not zu helfen, werden Pflegefamilien
gesucht. Herzliche, geduldige, positiv
eingestellte und flexible Menschen sollten es
sein, die diese bereichernde Aufgabe übernehmen
wollen und einen verlässlichen Lebensort bieten
können. Interessierte erhalten am Dienstag, 14.
Januar, ab 18.30 Uhr ausführliche Informationen
über die spannende Tätigkeit. Der Infoabend
findet in den Räumen des Pflegekinderdienstes in
Utfort, Rathausallee 141, statt.
Schulungen und Zusatzleistungen
Aktuell
betreut der Pflegekinderdienst etwa 120 Kinder
in Bereitschafts- und Dauerpflegefamilien. Neben
fachlicher Beratung und Begleitung durch
persönliche Ansprechpartnerinnen und -partner
bietet er Schulungen, Fortbildungen, Pflegegeld
und Zusatzleistungen.
Welche Bedürfnisse
haben Kinder, die nicht in ihren leiblichen
Familien aufwachsen können? Diese und viele
weitere Fragen beantwortet das Team beim
Infoabend und gibt einen Einblick in die
Voraussetzungen, die eine Pflegefamilie
mitbringen sollte.
50 Jahre Kreis Wesel – Start des
Jubiläumsjahres mit Eröffnungskonzert
Im Jahr 2025 feiert der Kreis Wesel sein
50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass findet am
Donnerstag, 23. Januar 2025, um 19 Uhr ein
Eröffnungskonzert im Willibrordi-Dom am Großen
Markt in Wesel statt.
Das
abwechslungsreiche, musikalische Programm wird
gestaltet von den „Lohberg Voices“ aus
Dinslaken, den „Colorsounds“ aus Wesel und „Die
Hedwigskapelle“ aus Hünxe. Landrat Ingo Brohl
lädt alle Menschen im Kreis Wesel herzlich zum
Eröffnungskonzert ein: „Der Kreis Wesel wird in
diesem Jahr 50 Jahre alt. Und das ist wirklich
ein Grund, zu feiern: Unsere Vielfältigkeit,
aber auch unsere Gemeinsamkeiten.
Die Menschen im Kreis Wesel erwartet ein tolles
Jahresprogramm, unter anderem mit einer
Blaulichtmeile am Kreishaus und der
Kreispolizeibehörde in der Mitte des Jahres. Ich
freue mich darauf, möglichst vielen Bürgerinnen
und Bürgern bei unseren Veranstaltungen im
Niederrhein Kreis Wesel zu begegnen.“
Der Eintritt für das Konzert ist frei, die
Platzzahl ist begrenzt. Zur besseren Planbarkeit
wird um Anmeldung bis zum 16.01.2025 unter https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1010371 gebeten.
Mit dem Eröffnungskonzert beginnt das
Jubiläums-Programm, das durch die
Kreisverwaltung Wesel über das ganze Jahr 2025
geplant und organisiert wurde. Unter anderem
wird der Kreisausschuss in Anlehnung der beiden
Altkreise Dinslaken und Moers am 3. April eine
Sitzung in Dinslaken und am 3. Juli eine Sitzung
in Moers abhalten.
Am 28. Juni wird
eine Politische Feierstunde anlässlich des
Jubiläums-Jahres im Weseler Kreishaus
stattfinden, an die sich eine bunte
Blaulichtmeile rund um Kreishaus und
Kreispolizeibehörde anschließt. Auch die
verschiedenen Fachdienste der Kreisverwaltung
werden sich über das ganze Jahr verteilt mit
verschiedenen Aktionen präsentieren, bevor am 7.
Dezember mit einem Konzert im Xantener Dom das
Jubiläums-Programm offiziell beendet wird.
Noch stehen nicht alle Termine fest, die
Kreisverwaltung wird im Rahmen auf ihren Social
Media Kanälen, über Pressemitteilungen und auf
ihrer Homepage www.kreis-wesel.de das
Programm zu „50 Jahren Kreis Wesel“ regelmäßig
aktualisieren.
Kreis Wesel ist neues Mitglied der
AGFS NRW - Gutes Teamwork und Unterstützung der
Kommunen
Der Kreis Wesel ist das 112. Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und
fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise
in Nordrhein-Westfalen e. V. (AGFS NRW). Landrat
Ingo Brohl erhielt am 9. Januar 2025 die
Mitgliedsurkunde von Oliver Krischer, Minister
für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, und
Christine Fuchs, Vorstand der AGFS NRW. „Der
Rad- und Fußverkehr sind tragende Säulen für
eine nachhaltige Mobilität.
Die
Landesregierung setzt sich deshalb konsequent
für ihren Erhalt und Ausbau ein. Der Austausch
zwischen engagierten Kommunen ist ein wichtiger
Baustein, um die Nahmobilität weiter zu stärken.
Der Kreis Wesel ist in vielen Bereichen aktiv
und unterstützt seine Kommunen vorbildlich bei
der Fuß- und Radverkehrsförderung. Zukünftig
wird er von der AGFS NRW und deren vielfältigen
Erfahrungen profitieren, um das vorhandene
Potenzial zu heben," sagte Umwelt- und
Verkehrsminister Oliver Krischer bei der
offiziellen Aufnahme des Kreises.
Vorbildliche Wegeweisung und fahrradfreundlicher
Arbeitgeber Eine Auswahlkommission unter
Federführung des Landes NRW überzeugte sich im
Oktober 2024 von den Maßnahmen und Aktivitäten
vor Ort und empfahl schließlich dem Minister,
den Kreis als fußgänger- und fahrradfreundlich
auszuzeichnen. Neben der guten Vernetzung der
unterschiedlichen Fachbereiche, die für
Mobilität zuständig sind, und einem engagierten
Team stach bei der Bereisung die vorbildliche
Wegweisung für den Radverkehr hervor: 570 km
Radwege sind bereits mit dem Knotenpunktsystem
ausgeschildert - im nächsten Jahr sollen es 800
km werden.
Auch Christine Fuchs,
Vorstand der AGFS NRW äußerte sich positiv: „Die
Verwaltung hat glaubhaft dargestellt, dass der
Fuß- und Radverkehr im Kreis Wesel eine hohe
Priorität haben. Das Engagement fängt bei der
Unterstützung der Kommunen an und geht mit der
Aktivierung der Mitarbeitenden weiter, wie die
Auszeichnung als fahrradfreundlicher Arbeitgeber
zeigt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und
den Austausch mit unserem neuesten Mitglied.“
Mitglieder profitieren von
zahlreichen Angeboten „Der Kreis Wesel setzt
sich schon lange konsequent für guten Fuß- und
Radverkehr ein, denn gerade hier am Niederrhein
gibt es zahlreiche Möglichkeiten, einen
ausgewogenen Mobilitätsmix zu etablieren. Die
Aufnahme in die AGFS NRW ist für uns der nächste
logische Schritt und wir sind sehr zufrieden,
dass unser Engagement mit der Auszeichnung als
fußgänger- und fahrradfreundlichen Kreis
gewürdigt wird.
Besonders freuen wir
uns auf den Austausch mit den anderen
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft und auf neue
Anregungen für unsere kontinuierliche Arbeit an
einem ausgewogenen modernen Mobilitätsmix,“ so
Landrat Ingo Brohl. Mitglieder der AGFS NRW
können beispielsweise auf besondere Fördermittel
des Landes zugreifen, verschiedene Broschüren
sowie Aktionsmaterialien nutzen oder an
Facharbeitskreisen und Workshops teilnehmen.
Auch der Austausch und die gute Vernetzung mit
anderen AGFS-Mitgliedern sind ein wesentlicher
Gewinn.
Angelegt ist die
Mitgliedschaft für einen Zeitraum von sieben
Jahren, danach wird eine Neubewertung
vorgenommen. Die AGFS NRW Die
Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und
fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise
in Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS NRW) setzt
sich seit 1993 für die Förderung aktiver
Mobilität ein. Die Basis dafür bildet eine
sichere, durchgängige und komfortable
Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehr.
Bei deren Umsetzung unterstützt der
kommunale Verein seine Mitglieder mit
Fachinformationen, Beratungsangeboten, Kampagnen
sowie Aktionen und bietet ihnen die Möglichkeit
zum Erfahrungsaustausch. Als Sprachrohr vertritt
die AGFS NRW die Interessen ihrer Mitglieder
gegenüber der Landes- und Bundespolitik und
steht zudem im intensiven Austausch mit
Akteurinnen und Akteuren der Wirtschaft, der
Wissenschaft und anderer Verbände.

Minister Oliver Krischer und Christine Fuchs vom
AGFS unterzeichneten gemeinsam mit Landrat Ingo
Brohl die Urkunde zur Aufnahme des Kreises Wesel
in die AGFS NRW.
Mehr Wärme für den Moerser Norden
Enni verlegt neue Fernwärmeleitung jetzt unter
den Jungbornpark
Die Wärmewende ist in vollem Gange. Um die
Versorgungssicher-heit zu erhöhen und Potential
für den Bedarf neuer Kunden zu erhalten, baut
die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein (Enni)
seit November das Fernwärmenetz in Moers-Repelen
zwischen dem ENNI Sportpark Rheinkamp und der
Stormstraße aus. Im Außengelände des Sportparks
fallen bereits die riesigen Leitungsrohre auf,
die die Monteure dort vorgefertigt, geschweißt
und so für den Einbau vorbereitet haben.
Im nächsten Bauschritt wird Enni den
neuen Lei-tungsabschnitt nun weitgehend im
Spül-Bohr-Verfahren durch den Jungbornpark und
auch in bis zu sechs Metern Tiefe unter das
Repelener Meer verlegen. „Hierdurch kommen wir
in diesem Bereich weitgehend ohne
Tiefbaumaßnahmen aus und müssen nicht in das
natürliche Umfeld der Freizeitanlage
eingreifen“, sagt Projektleiter Dirk
Schlathölter. Dabei werden die Monteure die
beiden jeweils 144 Meter langen neuen
Leitungsteile in den Jungbornpark einziehen.
Während der Arbeiten wird Enni ab dem 20. Januar
für zwei Wochen von montags bis freitags auch
einen Teil der Wanderwege durch den Jungborpark
vorsichtshalber sperren.
„Wenn die
Arbeiten an den beiden Wochenenden ruhen, können
die Besucher den Park wieder nutzen“, verspricht
Schlathölter. Die Straße Am Jungbornpark wird ab
Montag, 13. Januar, aber bis in den März hinein
für den Autoverkehr gesperrt sein. Hier startet
eine der zwei notwendigen Spülbohrungen und
unterqueren die neuen Leitungen im
Kreuzungsbereich zur Straße „Im Meerholz“ die
Straße im Tiefbau. Während der rund
sechswöchigen Sperrung ist für Autofahrer dann
in beide Fahrtrichtungen über die Kamper-,
Storm- und Felkestraße eine Umleitung
ausgeschildert.
Ab März wandert die
Baustelle in die Straße „Am Meerholz“, in der
Enni die neue Leitung dann geplant bis zur
nächsten Heizperiode im September in kleineren
Abschnitten bis zum vorhandenen Wärmenetz in der
Stormstraße verlegt. Vor dem jeweiligen Baufeld
wird die Straße dann zur Sackgasse. Bei der mit
der Stadt Moers, der Polizei und der Feuerwehr
abgestimmten Baumaßnahme können Anwohner ihre
Häuser aber auch dann weitgehend erreichen,
Radfahrer und Fußgänger die Baufelder passieren.
Fragen zu der Baumaßnahme beantwortet
Enni am Baustellentelefon unter 02841/104-600.
Wer sich für einen Anschluss an das
Fernwärmenetz interessiert und so frühzeitig die
Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes
erfüllen will, kann sich schon jetzt unter der
02841 104136 an einen der Energieberater der
Enni wenden.
Hagsche Straße in
Kleve: Kanalreparatur unter Vollsperrung ab
Montag
An der Hagschen Straße in der Klever Innenstadt,
auf Höhe der Hausnummer Hagsche Straße 20, sind
kurzfristig Reparaturmaßnahmen am Schmutz- und
Regenwasserkanal notwendig. Zur Ausführung der
dringenden Arbeiten muss die Hagsche Straße in
diesem Bereich ab Montag, den 13. Januar 2025,
voll gesperrt werden.
Während der
Bauarbeiten können Fußgängerinnen und Fußgänger
die Baustelle passieren. Sowohl für
Kraftfahrzeuge als auch für Fahrräder ist die
Hagsche Straße an dieser Stelle ab dem 13.
Januar allerdings gesperrt. Eine Umleitung für
den KFZ-Verkehr wird über die Straßen Hagsche
Poort und Stechbahn ausgeschildert. Fahrräder
werden währenddessen über die Kapitelstraße,
Nassauerstraße und Kirchstraße umgeleitet.

Sperrung Hagsche Straße 2025
Lieferverkehr wird zwar während der
Baustellenzeit aus beiden Richtungen bis
unmittelbar an das Baufeld heranfahren können,
eine Wendemöglichkeit kann allerdings nicht
eingerichtet werden. Planmäßig werden die
Arbeiten bis Ende Januar beendet, sodass die
Hagsche Straße dann wieder wie gewohnt nutzbar
ist.
Kleve: Spyckstraße: Straßenbaustelle
wird ab dem 13. Januar fortgeführt
Nachdem die Baustelle zur Erneuerung der
Kanalisation sowie der Fahrbahn auf der
Spyckstraße über den Jahreswechsel geruht hat,
werden die Arbeiten ab Montag, den 13. Januar
2025, wieder aufgenommen. Ab dem 13. Januar 2025
muss die Spyckstraße daher von der Einmündung
Flutstraße bis zur Hausnummer Spyckstraße 3 voll
gesperrt werden.
Der
Kreuzungsbereich von Flutstraße und Spyckstraße
bleibt während der Bauarbeiten befahrbar, sodass
die Herderstraße, Goethestraße und
Schillerstraße von dort aus erreichbar sind. Die
Mitte November 2024 wieder aufgestellten
Sperrpfosten an der Europaradbahn unterhalb der
Spyckbrücke bleiben nach wie vor installiert. An
dieser Stelle können Autos die Europaradbahn
also weiterhin nicht überqueren.

Sperrung Spyckstraße 2025 Karte der Sperrung und
der ausgeschilderten Umleitung.
Für den südlichen Teil der Spyckstraße von
der Einmündung Kavarinerstraße bis zur
Hausnummer Spyckstraße 3 wird die aktuell
geltende Einbahnstraßenregelung für die Zeit der
Bauarbeiten aufgehoben. Die dortigen Häuser
können ab dem 13. Januar also aus Richtung
Kavarinerstraße als Rechtsabbieger angefahren
werden.
Ein Linksabbiegen in die Spyckstraße aus
Richtung Tiergartenstraße wird unterdessen durch
Sperrbaken verhindert. Um insbesondere einen
gesicherten Schulweg zur Montessorischule zu
gewährleisten, bleibt entlang der
Baustellenbereiche immer zumindest eine Seite
des Gehweges frei.
Umleitungen für den KFZ-Verkehr werden über
die Flutstraße, Ludwig-Jahn-Straße, Hafenstraße
und Kavarinerstraße ausgeschildert. Im Laufe des
Jahres 2025 wird die Baustelle erneut
weiterziehen. Dann wird das letzte Teilstück der
Spyckstraße zwischen der Hausnummer Spyckstraße
3 und der Einmündung Kavarinerstraße erneuert.
Planmäßig dauern die Bauarbeiten auf der
Spyckstraße noch bis zum Ende des Jahres 2025
an.

Apfelernte 2024: Mit 872 000 Tonnen
zweitniedrigste Ernte der vergangenen zehn Jahre
• Anbau leidet unter ungünstiger Witterung:
Apfelernte 12,4 % unter dem zehnjährigen
Durchschnitt, aber besser als zunächst erwartet
• Starke regionale Unterschiede:
Baden-Württemberg mit vergleichsweise guter
Ernte, dagegen Ausfälle von bis zu 90 % in
östlichen Bundesländern
• Pflaumenernte
bleibt mit 43 800 Tonnen konstant zum Vorjahr
und nur knapp unter dem Zehnjahresdurchschnitt
Der Apfel ist weiterhin das mit
Abstand am meisten geerntete Baumobst in
Deutschland. Allerdings verzeichneten die
Obstbaubetriebe im Jahr 2024 mit 872 000 Tonnen
eine stark unterdurchschnittliche Apfelernte.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, wurden 2024 etwa 122 900 Tonnen oder
12,4 % weniger Äpfel geerntet als im
Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Das war
nach dem Jahr 2017 mit 596 700 Tonnen die
zweitniedrigste Erntemenge seit 2014.
Die ebenfalls geringe Ernte des Jahres 2023
wurde um 69 200 Tonnen oder 7,4 %
unterschritten. Grund für die geringe Apfelernte
waren in erster Linie ungünstige
Witterungsverhältnisse, die vor allem in den
östlichen Bundesländern erhebliche Ernteausfälle
von bis zu 90 % gegenüber dem zehnjährigen
Durchschnitt verursachten.
Auf
Spätfröste und Hagel folgen feuchtkühle
Witterung und starke Niederschläge
Im
Frühjahr führten Spätfröste und Hagelschläge in
vielen Obstanlagen zu Frostschäden und einem
schlechten Fruchtansatz. Im weiteren
Vegetationsverlauf wirkten sich eine feuchtkühle
Witterung und regional auftretende starke
Niederschläge negativ auf die Fruchtentwicklung
aus und begünstigten das Auftreten von
Krankheiten.
Nach endgültigen Zahlen
waren die Auswirkungen jedoch geringer als im
Rahmen vorläufiger Ernteschätzungen
prognostiziert. Bei der ersten Ernteschätzung im
Juli 2024 war noch erwartet worden, dass die
Apfelernte im Jahr 2024 sogar um 26,3 % oder
261 300 Tonnen geringer ausfallen würde als im
zehnjährigen Durchschnitt.
Größtes
Apfel-Anbauland Baden-Württemberg erzielt
überdurchschnittliche Ernte
Regional gab es
mitunter große Unterschiede. Während die Menge
geernteter Äpfel in nahezu allen Bundesländern
deutlich unter dem Niveau der vergangenen Jahre
lag, erzielten die Obstbaubetriebe in
Baden-Württemberg, dem bedeutendsten Bundesland
für den heimischen Apfelanbau, eine
vergleichsweise gute Apfelernte. Diese lag mit
395 400 Tonnen etwa 19,4 % über dem zehnjährigen
Durchschnitt und machte damit rund 45,3 % der
bundesweit geernteten Äpfel aus.
Die
Obstbaubetriebe in Niedersachsen belegten mit
258 200 Tonnen Platz zwei der bedeutendsten
Anbauregionen und ernteten 29,6 % der deutschen
Äpfel. In Niedersachsen lag die diesjährige
Apfelernte 10,3 % unter dem zehnjährigen
Durchschnitt. Die prozentual stärksten
Ernteeinbußen gegenüber dem
Zehnjahresdurchschnitt verzeichneten die
Anbaubetriebe in Sachsen (-92,6 %) und
Brandenburg (-82,2 %).
Die meisten Äpfel
werden als Tafelobst verkauft
Etwa drei
Viertel (73,2 % bzw. 638 900 Tonnen) der im Jahr
2024 geernteten Äpfel waren zur Vermarktung als
Tafelobst vorgesehen. Als Verwertungs- oder
Industrieobst, etwa zur Produktion von
Fruchtsaft, Konserven oder Apfelwein, wurde rund
ein Viertel der Ernte (25,8 % bzw.
225 200 Tonnen) verwendet. Der Rest (0,9 % bzw.
7 900 Tonnen) konnte aufgrund von Lager- oder
Verarbeitungsverlusten nicht vermarktet werden.
Auch bei Pflaumenernte deutliche
regionale Unterschiede
Die Menge geernteter
Pflaumen und Zwetschen lag 2024 mit
43 800 Tonnen auf Vorjahresniveau. Die
durchschnittliche Erntemenge der vergangenen
zehn Jahre (45 000 Tonnen) wurde damit um 2,7 %
unterschritten. Je nach Anbauregion fiel die
Pflaumenernte aber sehr unterschiedlich aus. In
nahezu allen Bundesländern lagen die Erntemengen
deutlich unter dem Niveau der vergangenen Jahre.
Durch Spätfröste und das regenreiche Frühjahr
kam es in vielen Obstanlagen zu erheblichen
Schäden bis hin zu Totalausfällen.
Nur in Baden-Württemberg, dem mit 1 700 Hektar
bedeutendsten Bundesland für den Pflaumenanbau,
wurden 25 600 Tonnen Pflaumen mehr geerntet als
im zehnjährigen Durchschnitt (+52,9 %). Die
Obstbaubetriebe in Rheinland-Pfalz, dem
Bundesland mit dem zweitgrößten Pflaumenanbau
(900 Hektar), brachten mit 7 500 Tonnen eine um
31,6 % geringere Erntemenge als im Durchschnitt
der vergangenen zehn Jahre ein. Vorwiegend
aufgrund der überdurchschnittlich guten Ernte in
Baden-Württemberg erzeugten die Obstbaubetriebe
dieser beiden Bundesländer im Jahr 2024 auf
63,2 % der Anbaufläche 75,6 % aller deutschen
Pflaumen.
Bundesweit wurden im Jahr
2024 auf einer Fläche von 4 100 Hektar Pflaumen
und Zwetschen für den Marktobstanbau angebaut.
Dabei machte die Vermarktung als Tafelobst mit
85,5 % (37 400 Tonnen) den größten Anteil aus.
Zur Nutzung als Verwertungs- oder Industrieobst
wurden nur 4 800 Tonnen (10,9 %) verwendet.
Unter die Kategorie „nicht vermarktet“ fielen
1 600 Tonnen und damit 3,6 % der Früchte.
Äpfel machen fast 90 % der deutschen
Baumobsternte aus
An der gesamten erfassten
Erntemenge von 995 600 Tonnen Baumobst im Jahr
2024 hatten Äpfel einen Anteil von rund 87,6 %.
Der Anteil von Pflaumen und Zwetschen lag bei
4,4 %. Zusätzlich wurden in Deutschland
39 000 Tonnen Birnen (3,9 %), 27 900 Tonnen
Süßkirschen (2,8 %), 7 500 Tonnen Sauerkirschen
(0,8 %) sowie 5 500 Tonnen Mirabellen und
Renekloden (0,6 %) geerntet.
Öffentliches Finanzierungsdefizit
steigt im 1. bis 3. Quartal 2024 auf 108
Milliarden Euro
• Defizite der Gemeinden und der
Sozialversicherung gegenüber dem
Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt
•
Bund, Gemeinden sowie Kranken-, Renten- und
Pflegeversicherung deutlich im Minus – Länder
nach Überschuss im Vorjahreszeitraum ebenfalls
defizitär
Der Öffentliche Gesamthaushalt
hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024
rund 5,9 % mehr ausgegeben und rund 5,1 % mehr
eingenommen als im Vorjahreszeitraum: Einnahmen
von 1 405,8 Milliarden Euro standen Ausgaben von
1 513,3 Milliarden Euro gegenüber. Damit
verzeichneten die Kern- und Extrahaushalte von
Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung
in den ersten drei Quartalen 2024 ein – in
Abgrenzung der Finanzstatistik errechnetes –
Finanzierungsdefizit von rund 108 Milliarden
Euro.
Damit war das Defizit rund
16,1 Milliarden Euro höher als im
Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der
vierteljährlichen Kassenstatistik weiter
mitteilt, verzeichneten alle Ebenen des
Öffentlichen Gesamthaushalts − Bund, Länder,
Gemeinden und Sozialversicherung – ein Minus.
Zwar trug der Bund wie schon seit 2020 den
größten Anteil des Gesamtdefizits, jedoch sind
die Finanzierungsdefizite vor allem bei den
Gemeinden, aber auch bei den Ländern und der
Sozialversicherung gewachsen.
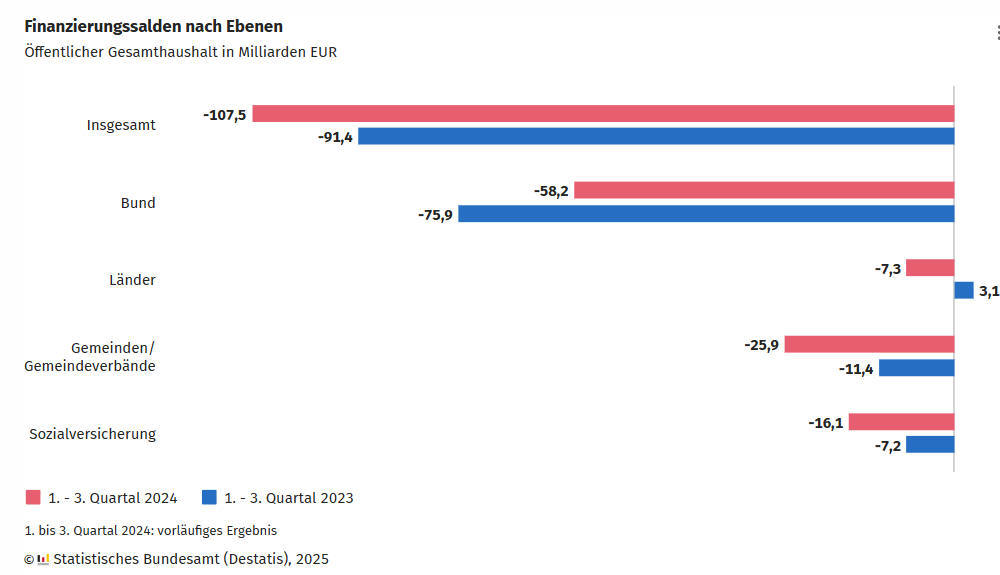
Aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben
wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres
2024 rund 1 200,4 Milliarden Euro eingenommen
(+4,3 %). Kräftig wuchsen hier die
Beitragseinnahmen der Sozialversicherung
(+7,0 %) und die Einnahmen aus der
Abgeltungsteuer. Letztere nahmen wegen des
gestiegenen Zinsniveaus mit 6,1 Milliarden Euro
etwa das Zweieinhalbfache des Vorjahreswertes
ein (+146,5 %).
Beim Bund spiegeln
sich unter anderem Verkäufe von Beteiligungen an
der Commerzbank und von Aktien der Deutschen
Post AG in einem Anstieg der Einnahmen aus
Veräußerungen von Beteiligungen um
4,7 Milliarden Euro. Zugleich stiegen die
Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen um
3,5 Milliarden Euro, maßgeblich durch die
Aufstockung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn
AG.
Aufnahme von ÖPNV-Einheiten in
den Gesamthaushalt sorgt für Sondereffekte
Wegen der Einführung des Deutschlandtickets und
der damit verbundenen größeren Abhängigkeit von
öffentlichen Zuweisungen wurden ab dem 2.
Quartal 2023 etwa 440 Unternehmen des
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als
Extrahaushalte in den Öffentlichen
Gesamthaushalt einbezogen. Das Hinzurechnen der
Ausgaben und Einnahmen dieser Einheiten sorgte
für Sondereffekte: Überproportional gestiegene
Personal- und Sachausgaben bei zugleich höheren
“sonstigen laufenden Einnahmen“ durch die
Fahrentgelte.
Dieser Effekt ist beim
Bund besonders deutlich, dem einige große
Verkehrsunternehmen wegen ihrer
Beteiligungsverhältnisse zugerechnet werden
(etwa die S-Bahnen in Berlin und Hamburg, die DB
Regio und die DB InfraGO). Alle Ebenen des
Öffentlichen Gesamthaushalts defizitär Die
Ausgaben des Bundes in den ersten drei Quartalen
2024 betrugen 442,9 Milliarden Euro, das waren
1,7 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei um
2,7 % auf 384,6 Milliarden Euro gestiegenen
Einnahmen ergab sich ein Finanzierungsdefizit
von 58,2 Milliarden Euro, das waren
17,7 Milliarden Euro weniger als im
Vorjahreszeitraum.
Bei den Ländern
ergab sich mit Einnahmen von
397,6 Milliarden Euro (+3,9 %) bei Ausgaben von
404,9 Milliarden Euro (+6,7 %) ein Defizit von
7,3 Milliarden Euro, nachdem es im
Vorjahreszeitraum noch einen Überschuss von
3,1 Milliarden Euro gegeben hatte. Hier gehen
die Defizite überwiegend auf Extrahaushalte
zurück. Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden
wuchsen die Ausgaben (+10,6 % auf
286,6 Milliarden Euro) weiter deutlich stärker
als die Einnahmen (+5,2 % auf
260,6 Milliarden Euro).
Das
Finanzierungsdefizit vergrößerte sich auf
25,9 Milliarden Euro, das waren
14,5 Milliarden Euro mehr als im
Vorjahreszeitraum. Für die Sozialversicherung
ergab sich ein Finanzierungsdefizit von
16,1 Milliarden Euro, das waren
8,9 Milliarden Euro mehr als im
Vorjahreszeitraum. Davon entfielen mit
11,0 Milliarden Euro etwa zwei Drittel auf die
Krankenversicherung, 4,4 Milliarden auf die
allgemeine Rentenversicherung und 1,6 Milliarden
auf die Pflegeversicherung. Die Ausgaben stiegen
um 6,8 % auf 649,1 Milliarden Euro und damit
etwas stärker als die Einnahmen
(633,0 Milliarden Euro; +5,4 %).
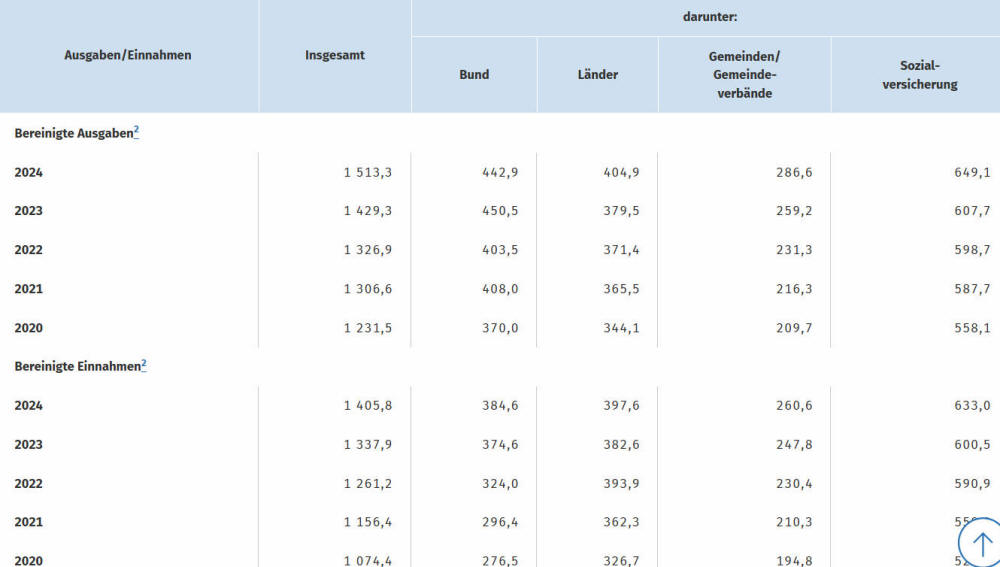
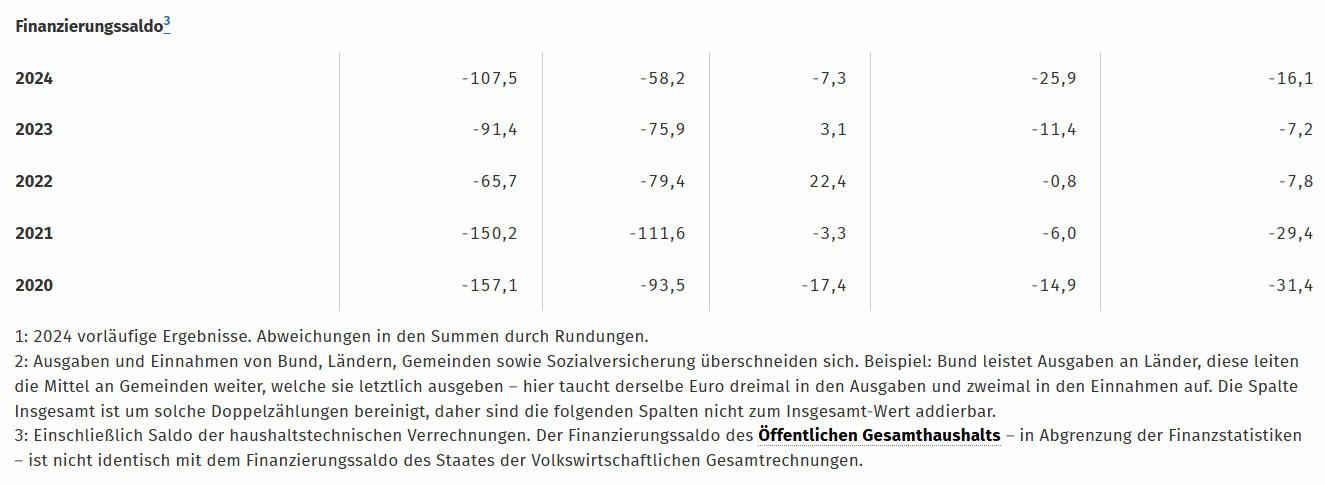
NRW-Bauproduktion im Oktober um
0,1 Prozent gesunken
Die Produktion im nordrhein-westfälischen
Bauhauptgewerbe ist im Oktober 2024 um
0,1 Prozent niedriger gewesen als ein Jahr
zuvor. Wie das Statistische Landesamt mitteilt,
war die Produktion im Hochbau um 1,1 Prozent
niedriger und im Tiefbau um 0,9 Prozent höher
als im Oktober 2023.
Im Bereich des
Hochbaus ermittelten die Statistiker im Oktober
2024 unterschiedliche Entwicklungen in den
einzelnen Bausparten: Im öffentlichen Hochbau
war ein Anstieg der Bauproduktion gegenüber dem
vergleichbaren Vorjahresmonat zu konstatieren
(+5,5 Prozent). Im gewerblichen und
industriellen Hochbau (−1,7 Prozent) sowie im
Wohnungsbau (−1,7 Prozent) fiel die
Bauproduktion niedriger als im Oktober 2023 aus.
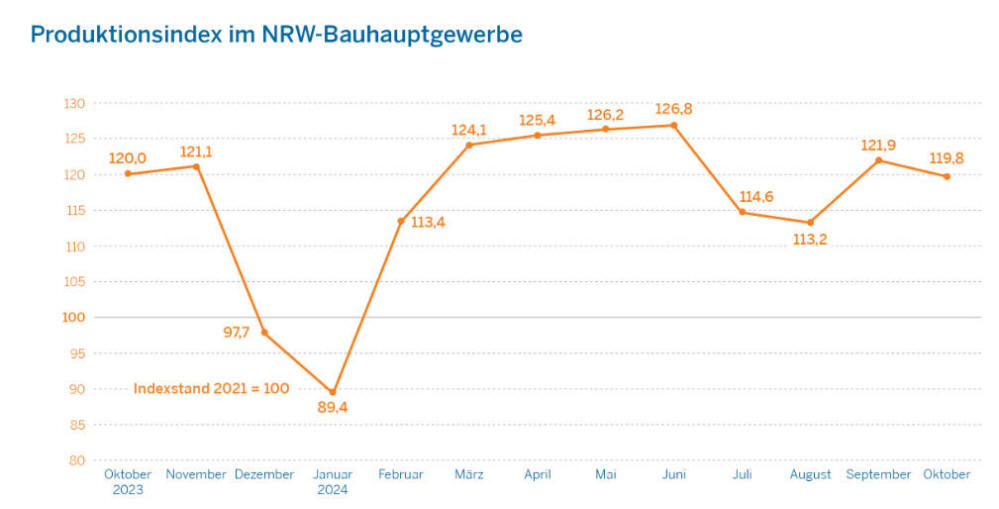
Innerhalb des Tiefbaus entwickelten sich die
Bauleistungen in den einzelnen Bausparten
ebenfalls unterschiedlich: Im sonstigen
öffentlichen Tiefbau stieg die Bauproduktion
(+11,0 Prozent) verglichen mit Oktober 2023.
Dagegen wurden im gewerblichen und industriellen
Tiefbau (−3,3 Prozent) sowie im Straßenbau
(−3,0 Prozent) Rückgänge gegenüber dem
Vorjahresmonat verzeichnet.
Bauhauptgewerbe: Anstieg von über 40 Prozent im
Vergleich zu 2019
Im Oktober 2024
ermittelten die Statistiker im Vergleich zum
entsprechenden Monatsergebnis des Jahres 2019
einen Anstieg der Bauproduktion im
Bauhauptgewerbe (+41,5 Prozent). Sowohl im
Hochbau (+26,1 Prozent) als auch im Tiefbau
(+63,4 Prozent) lag die Bauproduktion über dem
Niveau von Oktober 2019. Das kumulierte Ergebnis
der Bauproduktion für die ersten zehn Monate des
Jahres 2024 war um 1,6−Prozent höher als in der
entsprechenden Vergleichsperiode 2023.
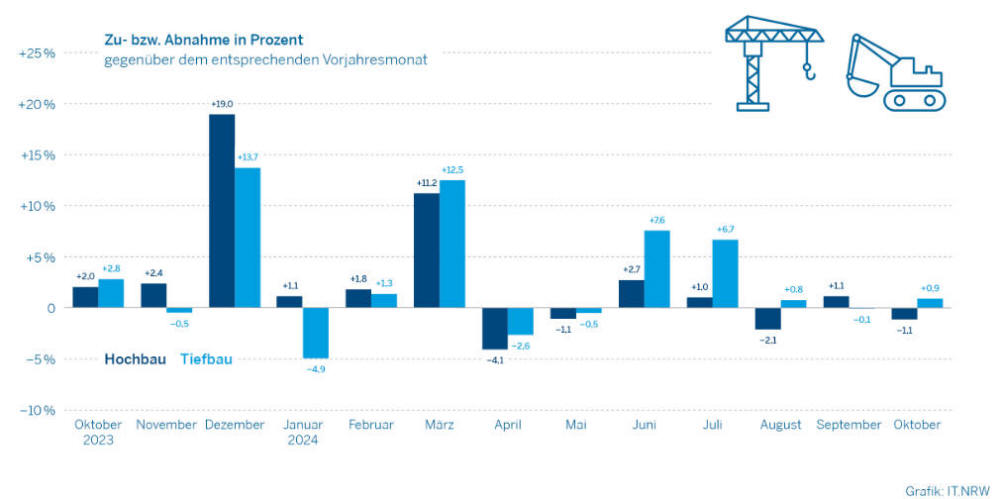
Freitag, 10.
Januar 2025
Stadt informiert über mögliche Ausfälle
bei der Auszahlung des Unterhaltsvorschusses
Die Stadt Dinslaken informiert, dass es aufgrund
von krankheitsbedingten Personalausfällen
derzeit in einigen Fällen zu Verzögerungen bei
der Auszahlung von Unterhaltsvorschuss kommen
kann. Auch ist eine Bearbeitung neuer
Antragsstellungen derzeit nicht möglich. Die
Stadtverwaltung bedauert diese Situation und
entschuldigt sich bei betroffenen Menschen für
mögliche Unannehmlichkeiten.
Es wird
mit Hochdruck daran gearbeitet, die Auszahlungen
so schnell wie möglich zu bearbeiten und den
regulären Ablauf wiederherzustellen. Die Stadt
versichert, dass alle Anspruchsberechtigten ihre
Leistungen erhalten werden. Für dringende Fälle
steht die Unterhaltsvorschussstelle unter der
E-Mail-Adresse uvg@dinslaken.de zur Verfügung.
In Notfällen ist zudem eine telefonische
Erreichbarkeit dienstags bis freitags von 9 bis
12 Uhr sowie zusätzlich donnerstags von 13 bis
16 Uhr unter der Telefonnummer 02064/66-592
sichergestellt.
Bundestagswahl
2025: Wahlberechtigte sollten verkürzten
Briefwahlzeitraum beachten
Bundeswahlleiterin Ruth Brand wirbt für eine
hohe Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl
2025: „Jede abgegebene Stimme ist ein Zeichen
für eine starke Demokratie.“
Dabei stehen
den Wahlberechtigten wie bei jeder
Bundestagswahl zwei Wege der Stimmabgabe offen.
Die Urnenwahl am Wahltag selbst ist in
Deutschland nach wie vor das
verfassungsrechtliche Leitbild und der
vorrangige Weg der Stimmabgabe. Das Wahlrecht
ermöglicht es den Wahlberechtigten aber ebenso,
per Briefwahl zu wählen, wenn man am Wahltag
nicht ins Wahllokal gehen kann oder möchte. Die
Bundeswahlleiterin weist darauf hin, dass
Wahlberechtigte, die bei der vorgezogenen Wahl
zum Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 ihre
Stimme per Briefwahl abgeben möchten, den
verkürzten Briefwahlzeitraum berücksichtigen
sollten.
Sie müssen ihre
Briefwahlunterlagen schneller bei ihrer Gemeinde
beantragen, ausfüllen und zurücksenden, als dies
bei einer Bundestagswahl zum regulären Ende
einer Legislaturperiode der Fall ist.
Voraussichtlich nur rund zwei Wochen Zeit für
die Briefwahl
Der verkürzte Briefwahlzeitraum
ist unmittelbare und logische Konsequenz einer
vorgezogenen Neuwahl, die innerhalb der vom
Grundgesetz vorgegebenen Frist erfolgen muss.
Die gesamte Wahlorganisation folgt dabei engen,
per Rechtsverordnung festgelegten Fristen, die
gegenüber einer Wahl zum regulären Ende einer
Legislaturperiode verkürzt sind.
Entsprechend bereiten sich die meisten Wahlämter
in Deutschland auf einen Beginn der Briefwahl
zwischen dem 6. und 10. Februar 2025 vor. Ein
früherer Beginn wird in den meisten der 299
Wahlkreise nicht möglich sein, da die
Stimmzettel erst gedruckt werden können, wenn
die Wahlvorschläge zugelassen sind und am 30.
Januar 2025 die Landeswahlausschüsse und der
Bundeswahlausschuss über etwaige Beschwerden
entschieden haben. Der Druck der Stimmzettel und
ihre Auslieferung an die Gemeindebehörden werden
dann einige Tage in Anspruch nehmen, bevor die
Briefwahl beginnen kann.
Rechtzeitiger
Eingang der Briefwahlunterlagen entscheidend
Die Wahlbriefe müssen spätestens am Wahltag, dem
23. Februar 2025, um 18 Uhr bei der auf dem
Wahlbrief aufgedruckten zuständigen Stelle
eingegangen sein. Hierfür tragen nach dem
Bundeswahlgesetz die Wählerinnen und Wähler
selbst die Verantwortung. Verspätet eingehende
Wahlbriefe können bei der Auszählung der Stimmen
nicht berücksichtigt werden.
Die
Bundeswahlleiterin empfiehlt Wahlberechtigten,
die ihre Stimme per Briefwahl abgeben möchten,
sich frühzeitig darum zum kümmern: Den für die
Briefwahl nötigen Wahlschein können sie bei der
Gemeinde ihres Hauptwohnortes persönlich oder
schriftlich, zum Beispiel auch per Fax oder
E-Mail, beantragen. Bei vielen Gemeinden kann
man die Unterlagen online anfordern; eine
telefonische Antragstellung ist jedoch nicht
möglich. Der Antrag kann auch vor dem Erhalt der
Wahlbenachrichtigung gestellt werden. Die
Wahlberechtigten können sich hierüber bei ihrer
Gemeinde informieren, beispielsweise in deren
Internetangebot.
Bei entsprechend
frühzeitiger Beantragung sollten die
Briefwahlunterlagen in der Regel von den
Wahlämtern den jeweiligen Postdienstleistern bis
spätestens 10. Februar 2025 übergeben sein und
die Wahlberechtigten innerhalb weniger Tage
erreichen. So kann auch eine Rücksendung
rechtzeitig vor dem Wahltag erfolgen.
Die
Deutsche Post stellt sicher, dass Wahlbriefe,
die bis spätestens Donnerstag, den 20. Februar
2025, vor der letzten Leerung des jeweiligen
Briefkastens eingeworfen beziehungsweise in
einer Postfiliale abgegeben werden, rechtzeitig
die auf dem Wahlbrief aufgedruckte Stelle
erreichen.
Weitere Handlungsoptionen der
Wahlberechtigten bei Briefwahl
Wer die mit
den Postlaufzeiten verbundenen Unsicherheiten
vermeiden möchte oder bis zur letzten
Briefkastenleerung am Donnerstag vor der Wahl
den Wahlbrief nicht absenden kann, sollte den
Wahlbrief direkt bei der auf dem Umschlag
aufgedruckten Stelle abgeben oder jemanden
bitten, dies zu übernehmen.
Alternativ
kann man sich trotz beantragter Briefwahl auch
noch dazu entscheiden, am Wahltag im Wahllokal
zu wählen. Dafür muss man den Wahlschein, der
den Briefwahlunterlagen beiliegt, und einen
Lichtbildausweis ins Wahllokal mitbringen. Wer
einmal einen Wahlschein beantragt hat, kann nur
noch mit diesem wählen, und zwar per Briefwahl
oder aber am Wahltag in jedem beliebigen
Wahlraum des eigenen Wahlkreises.
Wer den
Erhalt der Briefwahlunterlagen per Post nicht
abwarten möchte, kann im Antrag auf Erteilung
eines Wahlscheins auch angeben, die
Briefwahlunterlagen direkt beim Wahlamt
abzuholen, oder den Antrag persönlich dort
stellen. Vor Ort kann man den Stimmzettel
ausfüllen und den Wahlbrief direkt abgeben. So
werden gleich zwei Postwege eingespart.
Wer dagegen seine Briefwahlunterlagen nicht
rechtzeitig erhält oder verloren hat, kann
spätestens bis zum Samstag vor der Wahl (22.
Februar 2025) um 12 Uhr zu seinem Wahlamt gehen.
Wenn man dort glaubhaft versichert, dass man die
Briefwahlunterlagen nicht erhalten oder verloren
hat, wird ein neuer Wahlschein erteilt. Der
vorherige Wahlschein wird in diesem Fall für
ungültig erklärt.
Bei Fragen zum Prozedere
oder zu den Öffnungszeiten des Wahlamts vor Ort
helfen die Gemeinden gerne weiter.
Bevölkerungsstatistik: 106.150 Personen lebten
Ende 2024 in Moers
Ende des Jahres
2024 lebten 106.150 Personen in Moers. Das sind
nur 91 Personen weniger als im Jahr davor. Mit
51,3 Prozent liegt der Frauenanteil etwas über
dem der Männer. Altersmäßig ist die Gruppe der
45- bis 64-jährigen mit 29.930 Personen am
stärksten vertreten, gefolgt von den 25- bis
44-jährigen (25.859 Personen).
Bei
den Ortsteilen gewinnt Rheinkamp-Mitte hinzu
(2,6 Prozent), während Utfort und Moers-Ost
jeweils rund 1 Prozent verlieren. Sterbefälle
gab es im vergangenen Jahr in Moers 1.317.
Insgesamt zogen 4.807 Personen neu in die
Grafenstadt, wohingegen es 4.565 Wegzüge gab.
Der Statistik zugrunde liegen die Zahlen des
städtischen Melderegisters. Wie in vielen
anderen Städten auch, sind diese nicht
deckungsgleich mit den Zensus-Zahlen des
Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen.
Erneut mehr Eheschließungen in Moers
443 Paare haben sich im Jahr 2024 in Moers
standesamtlich trauen lassen - 27 mehr als im
Vorjahr (plus 7 Prozent). 2022 gab es 384
Eheschließungen. Sehr beliebt sind die
Samstagstrauungen an besonderen Orten. In
diesem Jahr sind die Standesbeamtinnen und
–beamten wieder im Moerser Schloss, im
Kammermusiksaal Martinsstift, im Alten
Landratsamt, im Peschkenhaus, im Hotel Van der
Valk, im Schloss Lauersfort und im
Fördermaschinenhaus der ehemalige Zeche
Rheinpreußen/Schacht IV im Einsatz.
Weitere Informationen über Eheschließungen und
die Samstagstermine gibt es unter den
Stichworten ‚Eheschließungen‘ und ‚Trauungen an
Samstagen‘ oder telefonisch unter 0 28 41/
201-679 und 201-690. Eine Online-Beratung ist
per E-Mail an eheschliessungen@moers.de möglich.
Stadtführungen 2025: Moers charmant
bis märchenhaft erleben
Der neue
Flyer für die Moerser Stadtführungen ist da!
Interessierte können auch 2025 wieder erleben,
was die Gästeführerinnen und Gästeführer aus der
facettenreichen, mehr als 700-jährigen
Geschichte der Grafenstadt berichten. Auf 33
verschiedenen Thementouren hören die
Teilnehmenden spannende Erlebnisse, treffen
historische Persönlichkeiten oder gehen auf
kulinarische Erlebnisreisen durch die Innenstadt
und die Ortsteile.
Über 80 feste
Termine sind geplant. Die Touren werden teils
auf dem Rad oder zu Fuß angeboten – und sind
ausgelegt von einer ca. 45-minütigen Stippvisite
bis zur fünfstündigen ausgedehnten Wanderung.
Neue und beliebte Touren für jeden Geschmack
Auch für das neue Jahr ist wieder Spannendes und
Unterhaltsames dabei.
„Wir sind
immer wieder erfreut, wie vielfältig die Themen
sind, die unsere Gästeführerinnen und
Gästeführer einbringen – und wie unterschiedlich
die Touren gestaltet sind. Da ist für jeden
Geschmack etwas dabei, und auch dieses Mal
findet sich wieder Überraschendes und Neues“,
erläutert Jens Heidenreich, Wirtschaftsförderer
der Stadt. Neu sind die drei ‚Kurzgeschichte(n)
Mittag‘ an den früheren Standorten der alten
Moerser Stadttore. Charmant wird es auf der
Zeitreise mit dem Moerser Meisje, das zum
Schmunzeln und Lachen einlädt.
Märchenhaftes begegnet Interessierten beim
interaktiven Spaziergang durch den Schlosspark.
Der ist auch Thema bei der neuen Tour ‚Grüne
Oase im Herzen von Moers‘ mit der historischen
Figur Lena Nepix. Als Radangebot steht die
römische Tour ‚Asciburgium‘ wieder auf dem
Programm. Darüber hinaus bieten die
Stadtführerinnen und Stadtführer beliebte
Rundgänge an, zum Beispiel über den ‚Lehmpastor‘
Felke.
Weiterhin auf dem Programm
stehen zudem erfolgreiche Angebote wie die
Moerser Stadtteilhäppchen, bei dem die
Gästeführerin Unterhaltsames mit Kulinarischem
‚würzt‘. Ausblick auf den Januar Die neue
Broschüre listet für die verbleibenden
Januartage noch zwei Klassiker auf: Am Sonntag,
12. Januar, und am Samstag, 25. Januar, nimmt
Erika Ollefs ihre Gäste mit auf ihre beliebte
Nachwächterführung durch die Moerser Altstadt.
Die Teilnehmenden verfolgen mit ihr
durch die Alt- und Neustadt die Spuren des
letzten Nachtwächters Franz Stöber. Start ist
nach Einbruch der Dunkelheit um 17 bzw. 18 Uhr
am Denkmal am Neumarkt. Am Sonntag, 12. Januar,
um 18.30 Uhr geht es bei Vollmond auf große
Nachtwanderung zum Geleucht. Treffpunkt ist das
Clubhaus der Freien Schwimmer am Baerler Busch.
Hier ist festes Schuhwerk nötig.
Der Flyer wird von der Wirtschaftsförderung der
Stadt Moers herausgegeben und ist ab sofort in
vielen öffentlichen Einrichtungen erhältlich.
Alle Führungen sind auch unter 'Stadtführungen'
zu finden.
Einen Vorgeschmack auf die
Führungen bekommen Interessierte auf der
interaktiven Internetseite www.moerser-stadtfuehrungen.de.
Voraussetzung zur Teilnahme bei allen Touren ist
die verbindliche Voranmeldung bei der Stadt- und
Touristinformation von Moers Marketing.
Kontakt: Kirchstraße 27a/b, Telefon 0 28 41 / 88
22 6-0.
Belgischer
Jazztrompeter wird "Improviser in Residence"
beim Moers Festival
Das Moers
Festival hat am 9. Januar den "Improviser in
Residence" bekanntgegeben und heißt in diesem
Jahr den belgischen Jazztrompeter Bart Maris
willkommen. In seiner Rolle als Gast-Musiker
soll Maris eigene Projekte entwickeln, die die
lokale Kulturszene beleben und das
internationale Netzwerk des Festivals stärken.
Veranstaltet werden intime
Mini-Konzerte, Kooperationen mit dem
Schlosstheater sowie eigene Projekte und
Auftritte während des Festivals. Auch die
musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
steht im Fokus der Kooperation.
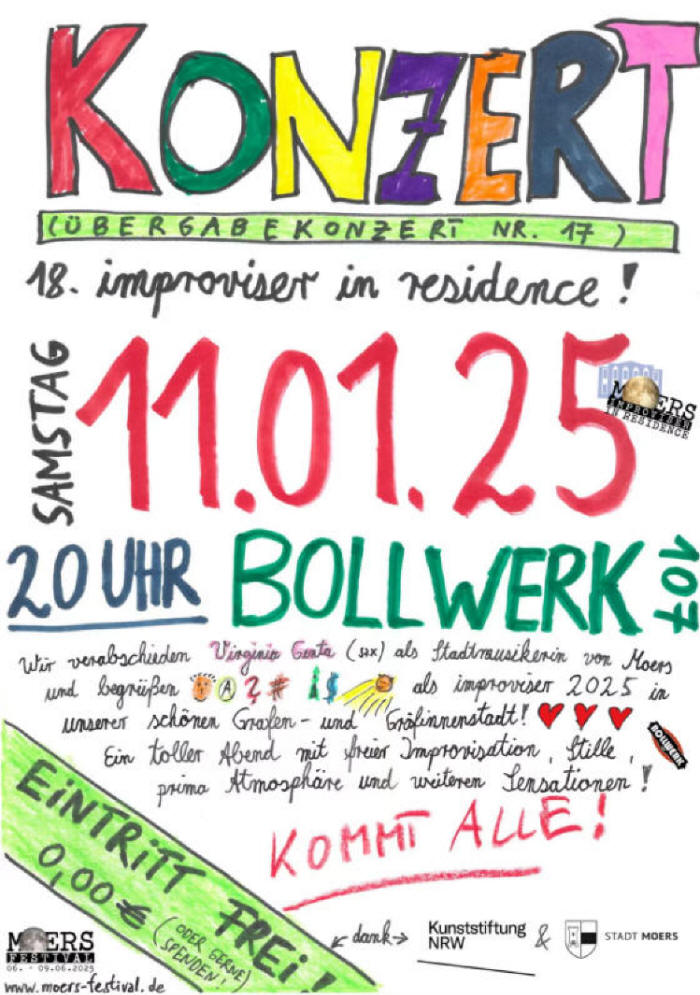
Bei einem kostenfreien Übergabekonzert im
Bollwerk 107 am Samstag, 11. Januar, um 20 Uhr
reicht Virginia Genta, Improviser in Residence
2024, die Stimmgabel an Bart Maris weiter.
Anschließend werden die beiden "Improviser" in
Moers gemeinsam auftreten. Weitere
internationale Künstlerinnen und Künstler
ergänzen das Programm.
Bart Maris wurde
1965 geboren und lebt in Gent, Belgien. Der
Musiker wurde u. a. mit dem Zamu-Preis für den
besten belgischen Musiker sowie den Kulturpreis
der Stadt Gent ausgezeichnet.
Der Improviser
in Residence ist ein Projekt des Moers Festivals
und wird gefördert durch die Kunststiftung NRW
und die Stadt Moers. idr - Informationen:
https://www.moers-festival.de/
Aktuelles Eurobarometer zeigt große
Unterstützung für die EU-Agrarpolitik
Mehr Europäerinnen und Europäer als je zuvor
kennen die Gemeinsame Agrarpolitik der
Europäischen Union (GAP), und mehr als 90
Prozent meinen, dass die Landwirtschaft und die
ländlichen Räume in der EU wichtig oder sehr
wichtig für unsere Zukunft sind. Das zeigt das
aktuelle Eurobarometer zur Landwirtschaft.
Mehr als 70 Prozent der Befragten in der
EU (71 Prozent) und Deutschland (73 Prozent)
stimmen darin überein, dass die EU durch die GAP
ihre Rolle bei der Bereitstellung sicherer,
gesunder und nachhaltiger Lebensmittel von hoher
Qualität erfüllt. In Deutschland ist eine
Mehrheit der Befragten hingegen unzufrieden mit
dem Zugang zu schnellen Internetverbindungen im
ländlichen Raum: während EU-weit 37 Prozent der
Befragten diesen als schlecht oder sehr schlecht
bewerteten, sind es in Deutschland 62 Prozent.
Christophe Hansen, EU-Kommissar für
Landwirtschaft und Ernährung, der in
der kommenden Woche die Internationale Grüne
Woche in Berlin besuchen wird, sagte über
die Gemeinsame Agrarpolitik der EU: „Sie ist zu
einem echten Baustein der europäischen
Integration geworden und zeigt die Bedeutung der
Landwirtinnen und Landwirte und der
Landwirtschaft in unserer Gesellschaft. Dies ist
eine echte europäische Erfolgsgeschichte, die
eine nachhaltige Zukunft für alle gestaltet.“
Ergebnisse zur Höhe der
Unterstützung für Landwirte 70 Prozent der
Befragten in den EU27 und 72 Prozent in
Deutschland geben an, dass von der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) der EU alle EU-Bürgerinnen
und Bürger profitieren. Mehr als die Hälfte (56
Prozent) gibt an, dass die Höhe der finanziellen
Unterstützung der EU für Landwirte zur
Stabilisierung ihres Einkommens angemessen ist,
was einem Anstieg um zehn Prozentpunkte seit
2022 und dem höchsten Stand seit 2013
entspricht.
In Deutschland sagen
dies 61 Prozent der Befragten. Klimawandel und
Landwirtschaft Die Ergebnisse zeigen auch, dass
62 Prozent der Befragten EU-weit zustimmen, dass
die Landwirtschaft bereits einen wichtigen
Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels
geleistet hat (Deutschland: 61 Prozent).
Extremwetterereignisse und der Klimawandel
werden als größtes Risiko für die
Ernährungssicherheit in der EU gesehen (EU27: 49
Prozent, Deutschland: 54 Prozent).
Handelsabkommen
Die EU-Handelsabkommen
werden von den Europäerinnen und Europäer
weithin als Erfolg bewertet: Eine große Mehrheit
ist der Ansicht, dass sie der Landwirtschaft
(EU: 71 Prozent, Deutschland: 74 Prozent) und
den Verbraucherinnen und Verbrauchern in der EU
(EU und Deutschland: 66 Prozent) erhebliche
Vorteile bringen.
76 Prozent
EU-weit stimmen darin überein, dass diese
Abkommen die Diversifizierung der Märkte und der
Versorgung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen
in der EU gewährleisten. Mehr als sieben von
zehn Befragten sind der Ansicht, dass diese
Handelsabkommen die Ausfuhren
landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus der EU
weltweit steigern (73 Prozent) und dass sie die
Arbeits- und Umweltstandards der EU fördern,
einschließlich des Tierschutzes für die
landwirtschaftliche Produktion in anderen
Ländern (71 Prozent).
Hintergrund
Dies ist die achte Eurobarometer-Umfrage zum
Thema „Die Europäer, die Landwirtschaft und die
GAP“. Sie wurde zwischen dem 13. Juni und dem 8.
Juli 2024 in allen 27 EU-Mitgliedstaaten
durchgeführt. 26.349 Befragte aus verschiedenen
sozialen und demografischen Gruppen wurden in
ihrer Landessprache befragt. Die Umfrage gibt
einen umfassenden Überblick über die Einstellung
der Europäer zur Landwirtschaft und zur GAP.
Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss tagen
Am Montag, 20. Januar 2025, tagen
der Jugendhilfeausschuss und der Schulausschuss
der Stadt Dinslaken. Die Sitzung beginnt um
17:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Tagesordnungen
und Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen
finden Interessierte grundsätzlich im
Ratsinformationssystem.
Kinder- und Jugendparlament tagt
Am
Dienstag, 21. Januar 2025, tagt das Kinder- und
Jugendparlament der Stadt Dinslaken. Die Sitzung
beginnt um 18:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Tagesordnungen
und Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen
finden Interessierte grundsätzlich im
Ratsinformationssystem.

NRW-Inflationsrate lag im Dezember 2024 bei
2,5 Prozent
Der
Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen
ist von Dezember 2023 bis Dezember 2024 um
2,5 Prozent gestiegen (Basisjahr 2020 = 100).
Wie dass Statistische Landesamt anhand
endgültiger Ergebnisse mitteilt, stiegen die
Preise gegenüber dem Vormonat (November 2024)
durchschnittlich um 0,5 Prozent. Im
Jahresdurchschnitt 2024 lag die Inflationsrate
bei 2,2 Prozent. Das war die geringste Rate seit
2020 (damals: +0,5 Prozent).
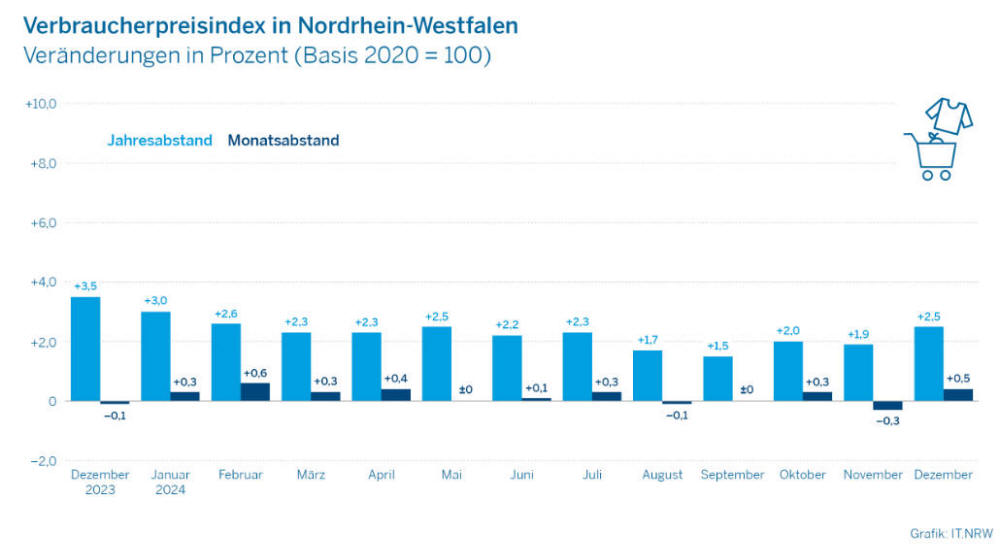
Die niedrigste monatliche Inflationsrate im
Jahr 2024 wurde im September verzeichnet
Im
Januar 2024 lag die Inflationsrate in NRW bei
3,0 Prozent. In den Folgemonaten schwankte sie
bis Juli 2024 oberhalb der Zwei-Prozent-Marke
zwischen +2,2 Prozent und +2,6 Prozent. Der
geringste Preisanstieg im Jahr 2024 wurde im
September 2024 mit +1,5 Prozent verzeichnet. Im
Jahresdurchschnitt 2024 wurden Gaststätten- und
Beherbergungsdienstleistungen um 6,7 Prozent
teurer angeboten als 2023 Zwischen 2023 und 2024
stiegen die Preise für Gaststätten- und
Beherbergungsdienstleistungen
überdurchschnittlich stark an (+6,7 Prozent).
Der Bereich „andere Waren und
Dienstleistungen” verzeichnete ebenfalls einen
deutlichen Preisanstieg (+6,3 Prozent).
Preistreiber waren dabei insbesondere die
Versicherungsdienstleistungen (+12,7 Prozent),
die stationäre Pflege für privat Versicherte
(+11,5 Prozent) und gesetzlich Versicherte
(+10,5 Prozent). Gemüse wurde 2024 günstiger,
die Butterpreise stiegen um 18,2 Prozent Die
Nahrungsmittelpreise sind zwischen 2023 und 2024
um durchschnittlich 1,4 Prozent gestiegen.
Günstiger angeboten wurden Molkereiprodukte und
Eier (−1,7 Prozent) und Gemüse (−2,0 Prozent).
Die Preise für Speisefette und -öle
(+11,4 Prozent; darunter Butter +18,2 Prozent)
stiegen ebenso wie die für Obst (+4,5 Prozent).
Unterschiedliche Preisentwicklungen bei
Haushaltsenergien im Jahr 2024 Prägend für die
Inflationsrate im Jahr 2024 war die Entwicklung
im Bereich Haushaltsenergien (−2,7 Prozent). Die
Preise für Heizöl einschließlich Betriebskosten
sanken um 8,1 Prozent, für Strom um 5,9 Prozent
und für Gas einschließlich Betriebskosten um
3,0 Prozent.
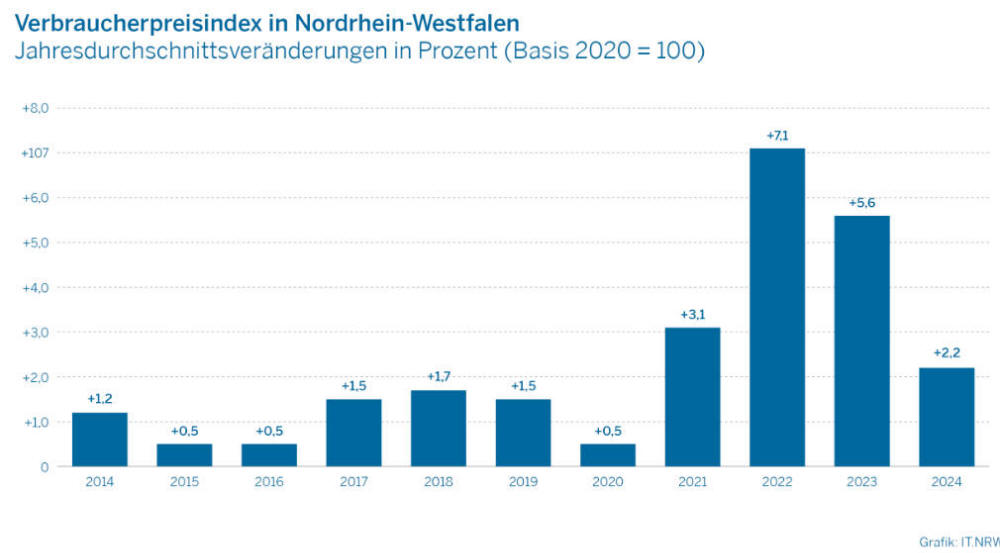
Die Preise für Fernwärme zogen indes
überdurchschnittlich an (+33,6 Prozent).
Kraftstoffpreise sind im Vergleich zu 2023 um
2,7 Prozent gefallen Die Kosten für Mobilität
(Verkehr) sind im Durchschnitt um 1,1 Prozent
gestiegen. Preistreibend war u. a. die Wartung
und Reparatur von Fahrzeugen (+6,5 Prozent).
Preisrückgänge gab es bei der kombinierten
Personenbeförderung (−8,8 Prozent), u. a. vor
dem Hintergrund der Einführung des
Deutschlandtickets im Mai 2023. Im Vergleich zu
2023 wurden 2024 Kraftstoffe ebenfalls günstiger
angeboten (Diesel −3,6 Prozent, Benzin
−2,5 Prozent).
NRW-Industrie: Energieintensive Produktion
im November 2024 um 2,1 Prozent gestiegen
Die Produktion der
NRW-Industrie ist im November 2024 nach
vorläufigen Ergebnissen kalender- und
saisonbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber Oktober
2024 gestiegen. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, stieg die Produktion in den
energieintensiven Wirtschaftszeigen um
2,1 Prozent.
Die Produktion in der
restlichen Industrie ging gegenüber dem
entsprechenden Vormonat um 0,5 Prozent zurück.
Verglichen mit dem Vorjahresmonat sank die
Produktion um 0,9 Prozent (+1,9 Prozent in der
energieintensiven und −2,3 Prozent in der
übrigen Industrie). Überwiegend
•
Produktionsanstiege in den energieintensiven
Branchen
Im Vergleich zu Oktober 2024 waren
in NRW für die energieintensiven Branchen im
November 2024 überwiegend positive Entwicklungen
zu beobachten: Innerhalb der energieintensiven
Branchen wurde für die Metallerzeugung und
Metallbearbeitung ein Produktionsanstieg von
1,8 Prozent (+1,2 Prozent ggü. dem
Vorjahresmonat) ermittelt. In der chemischen
Industrie stieg die Produktion um 0,7 Prozent
(+0,4 Prozent ggü. dem Vorjahresmonat). Die
Herstellung von Glas- und Glaswaren, Keramik
sowie Verarbeitung von Steinen und Erden
konstatierte dagegen einen Produktionsrückgang
von 2,2 Prozent (−1,0 Prozent ggü. dem
Vorjahresmonat).

• Gemischtes Bild in den übrigen Branchen
In den Branchen der übrigen Industrie waren
unterschiedliche Entwicklungen zu erkennen: Die
Produktionsleistung in der Herstellung von
Bekleidung stieg um 18,1 Prozent (−0,5 Prozent
ggü. dem Vorjahresmonat). Im Bereich Herstellung
von elektrischer Ausrüstung wurde ein
Produktionsplus von 6,0 Prozent verzeichnet
(−7,6 Prozent ggü. dem Vorjahresmonat). Im
Bereich Herstellung von
Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und
optischen Erzeugnissen stieg die Produktion um
5,5 Prozent (−0,9 Prozent ggü. dem
Vorjahresmonat).
Die Herstellung von
Kraftwagen und Kraftwagenteilen vermeldete
dagegen einen Produktionsrückgang von
4,4 Prozent (+29,6 Prozent ggü. dem
Vorjahresmonat). Auch der Maschinenbau musste
einen Produktionsrückgang von 2,1 Prozent
hinnehmen (−13,2 Prozent ggü. dem
Vorjahresmonat). Rückläufige Werte im Vergleich
zu Februar 2022 sowohl in der energieintensiven
als auch in der übrigen Industrie
• Im
Vergleich zu Februar 2022, zu Beginn des Krieges
in der Ukraine, sank die Produktion im November
2024 insgesamt um 11,2 Prozent (−14,4 Prozent in
der energieintensiven Industrie; −9,4 Prozent in
der übrigen Industrie). Diese Pressemitteilung
zur Entwicklung der Produktionsindizes in der
NRW-Industrie ist auf Basis vorläufiger
Ergebnisse erstellt.
Aufgrund der
Folgen der Corona-Krise und des Krieges in der
Ukraine kann es zu sehr unterschiedlichen
Ergebnissen im Vormonats- und Vorjahresvergleich
kommen. Energieintensive Industriebereiche sind
Wirtschaftszweige mit einem vergleichsweise
hohen Energieverbrauch je produzierter Einheit.
Hierzu zählen die Herstellung von
chemischen Erzeugnissen, die Metallerzeugung,
die Kokerei und Mineralölverarbeitung, die
Herstellung von Glas- und Glaswaren, Keramik,
Verarbeitung von Steinen und Erden, die
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
sowie die Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb-
und Korkwaren (ohne Möbel). Alle übrigen
Industriebranchen wurden hier als nicht
energieintensiv eingestuft.
Donnerstag, 9.
Januar 2025
Bundesregierung
beschließt Wohnungslosenbericht 2024
Bericht
gibt Auskunft über die Anzahl der in Deutschland
wohnungslosen Menschen
Das
Bundeskabinett hat am 8. Januar 2025 den vom
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen vorgelegten Wohnungslosenbericht
2024 beschlossen. Mit diesem wird nach 2022 zum
zweiten Mal ein gesamtdeutscher Überblick über
die Situation wohnungsloser Menschen vorgelegt.
Der Bericht enthält Informationen und Analysen
über Umfang und Struktur von Wohnungslosigkeit
im Bundesgebiet.

Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen: „Der Bericht
zeigt, dass die Obdach- und Wohnungslosigkeit in
Deutschland unterschiedliche Formen und Ursachen
hat und bei weitem kein rein städtisches Problem
darstellt. Mit dem Nationalen Aktionsplan gegen
Wohnungslosigkeit hat der Bund daher den Weg
geebnet, abgestimmt mit den Ländern, Kommunen
und der Zivilgesellschaft, die Herausforderung
der Bekämpfung der Obdachlosigkeit langfristig
anzugehen.
Hierfür haben wir im letzten
Jahr eine Kompetenzstelle des Bundes beim BBSR
eingerichtet. Derzeit werden dort Maßnahmen
erarbeitet, um zum Beispiel Frauen und Kinder in
Obdachlosenunterkünften durch bessere Standards
zu schützen. Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen und damit auch Menschen, die
gegenwärtig wohnungs- und obdachlos sind, eine
Wohnung zu ermöglichen, investiert der Bund bis
2028 mehr als 20 Milliarden Euro in den sozialen
Wohnungsbau.
Auch die neue
Wohngemeinnützigkeit, die am 1. Januar 2025
gestartet ist, kann hierbei helfen. Und mit der
Erhöhung des Wohngeldes zu Jahresbeginn um
durchschnittlich 15% unterstützt der Bund
präventiv Menschen, die durch hohe Miet- und
Energiekosten stark belastet werden.“
Zum Wohnungslosenbericht
Im Mittelpunkt des
Berichtes stehen drei Gruppen von wohnungslosen
Personen: Die untergebrachten wohnungslosen
Personen, über die das Statistische Bundesamt
Daten erhebt und jährlich eine Statistik
erstellt, des Weiteren die Gruppen der verdeckt
wohnungslosen Personen und die der wohnungslosen
Menschen ohne Unterkunft, zu denen das
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen einen empirischen Forschungsauftrag
vergeben hat, um mittels einer hochgerechneten
Stichprobe entsprechende Informationen zu
gewinnen.
laut der Statistik und der
empirischen Erhebung waren Ende Januar/Anfang
Februar 2024 rund 439.500 Personen im System der
Wohnungsnotfallhilfe untergebracht, weitere rund
60.400 Personen bei Angehörigen, Freunden oder
Bekannten untergekommen (verdeckt wohnungslose
Personen).
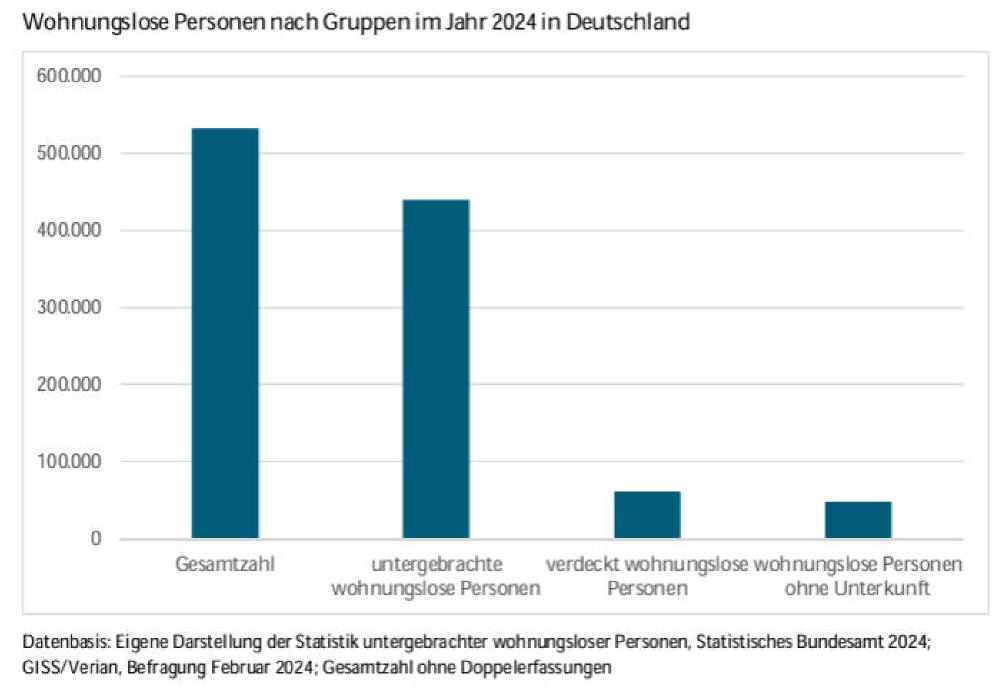
Rund 47.300 Personen lebten auf der Straße
oder in Behelfsunterkünften. Berücksichtigt man
rund 15.600 Doppelerfassungen, leben in
Deutschland damit insgesamt rund 531.600
wohnungslose Menschen. Dabei umfasst die
Statistik untergebrachter wohnungsloser Menschen
gemäß gesetzlicher Definition von
Wohnungslosigkeit auch in Unterkünften für
Geflüchtete untergebrachte Personen, wenn ihr
Asylverfahren positiv abgeschlossen wurde (z. B.
Asylberechtigung, Flüchtlingseigenschaft,
subsidiärer Schutz) und sie zur Vermeidung von
ansonsten eintretender Wohnungslosigkeit in der
Unterkunft verbleiben.
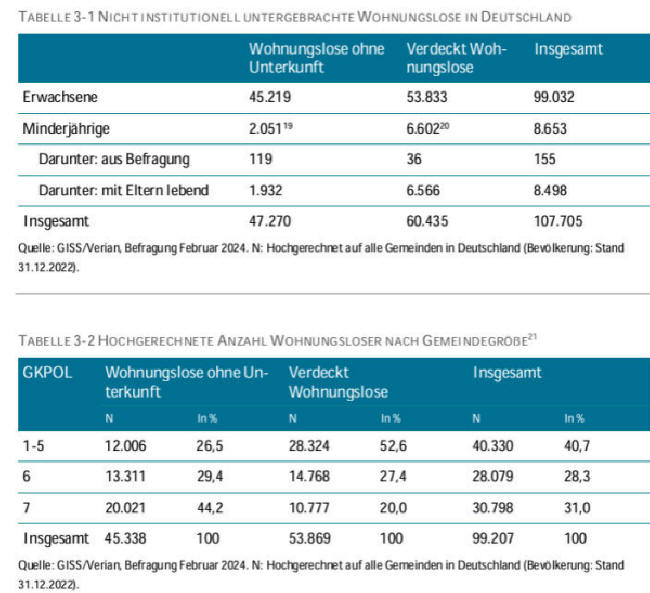
Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis über
das Chancen-Aufenthaltsrecht erhalten haben, und
Geflüchtete aus der Ukraine, die im Rahmen einer
Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz
nach § 24 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
aufgenommen wurden, sind ebenfalls in der
Statistik berücksichtigt, wenn sie untergebracht
sind und nicht über einen Mietvertrag oder
Ähnliches verfügen.
All dies sowie die
Ausweitung der Gemeindestichprobe in der
aktuellen empirischen Erhebung in Verbindung mit
der Verringerung von Untererfassungen in der
Statistik führt dazu, dass im Vergleich zu 2022
ein Anstieg der Wohnungslosenzahlen zu
verzeichnen ist.
Die Bundesregierung
sieht sich in der Verantwortung, zum Ziel der
Überwindung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit
beizutragen und hat deshalb in Übereinstimmung
mit den Initiativen der Europäischen Union, das
Ziel bekräftigt, die Wohnungs- und
Obdachlosigkeit bis zum Jahr 2030 in Deutschland
zu überwinden. Hierfür wurde am 24. April 2024
der Nationale Aktionsplan gegen
Wohnungslosigkeit beschlossen, der als
bundesweiter Handlungsleitfaden erstmals die
gemeinschaftlichen Anstrengungen aller Ebenen
zur Überwindung der Wohnungs- und
Obdachlosigkeit in Deutschland abbildet.
Er identifiziert Rahmenbedingungen und
Herausforderungen. Mit seinen inhaltlichen
Leitlinien und den Leitlinien zum Verfahren gibt
es einen von allen beteiligten Akteuren
akzeptierten und abgestimmten Handlungsrahmen.
Mehr Informationen zum Nationalen Aktionsplan
gegen Wohnungslosigkeit finden Sie
hier. Den Wohnungslosenbericht 2024 können
Sie
hier einsehen.
Bundestagswahl 2025: Bundeswahlausschuss
entscheidet über Anerkennung von Parteien
In einer öffentlichen Sitzung entscheidet der
Bundeswahlausschuss über die Anerkennung von
politischen Vereinigungen als Parteien zur
Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Die Sitzung
findet am 13. und 14. Januar 2025, jeweils ab
9:00 Uhr im Deutschen Bundestag in Berlin,
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (Eingang
Adele-Schreiber-Krieger-Straße 1), Raum 3.101
(Anhörungssaal) statt.
Der
Bundeswahlausschuss stellt für alle Wahlorgane
zur bevorstehenden Bundestagswahl verbindlich
fest, welche Parteien im Deutschen Bundestag
oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl
aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen
mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten
waren. Diese Parteien können Wahlvorschläge bei
den Landes- und Kreiswahlleitungen einreichen,
ohne Unterstützungsunterschriften vorlegen zu
müssen.
Welche sonstigen Vereinigungen,
die der Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung an
der Wahl des 21. Deutschen Bundestages angezeigt
haben, für diese Wahl als Parteien im Sinne des
§ 2 Parteiengesetz anzuerkennen sind und damit
Wahlvorschläge bei den Landes- und
Kreiswahlleitungen einreichen können, für die
sie unter anderem entsprechende
Unterstützungsunterschriften nachweisen müssen.
Gegen eine Feststellung des
Bundeswahlausschusses kann eine Partei oder
Vereinigung innerhalb von vier Tagen nach
Bekanntgabe eine Beschwerde an das
Bundesverfassungsgericht erheben.
Das Bundesverfassungsgericht muss dann bis zum
23. Januar 2025 über die Beschwerden
entscheiden. Bis zur Entscheidung müssen die
Wahlorgane die Partei oder Vereinigung wie eine
wahlvorschlagsberechtigte Partei behandeln. Bis
zum Ablauf der Einreichungsfrist am
7. Januar 2025, 18:00 Uhr haben 56 Vereinigungen
der Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung
an der Bundestagswahl 2025 angezeigt (2021:
87 Beteiligungsanzeigen).
Die Sitzung
wird live im Internet (www.bundestag.de)
übertragen. Im Nachgang ist sie in der Mediathek
des Bundestages (www.bundestag.de/mediathek)
abrufbar.
Bundestagswahl: 56
Parteien und politische Vereinigungen haben
Beteiligung angezeigt
Bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am
7. Januar 2025, 18:00 Uhr haben 56 Parteien und
politische Vereinigungen der Bundeswahlleiterin
angezeigt, dass sie sich an der Bundestagswahl
2025 beteiligen wollen. Wie die
Bundeswahlleiterin weiter mitteilt, ist dies für
die meisten Parteien und politischen
Vereinigungen Voraussetzung für die Teilnahme an
der Bundestagswahl.
Nur Parteien,
die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag
seit deren letzter Wahl aufgrund eigener
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens
fünf Abgeordneten vertreten sind, können ihre
Wahlvorschläge direkt bei den zuständigen
Landes- beziehungsweise Kreiswahlleitungen
einreichen. Alle übrigen Parteien und
politischen Vereinigungen müssen zuvor der
Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung schriftlich
anzeigen.
Im Einzelnen haben
folgende Parteien und politischen Vereinigungen
ihre Beteiligungsanzeige bei der
Bundeswahlleiterin eingereicht (Reihenfolge nach
Eingang): Kurzbezeichnung Parteiname
Zusatzbezeichnung (nur, wenn im Wahlverfahren
verwendet)
1 PfM Partei für Motorsport
2
BP Bayernpartei
3 Bündnis GRAL BündnisGRAL -
Ganzheitliches Recht Auf Leben
4 MLPD
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
5 IBD Identitäre Bewegung e.V.
6 PDR
Partei der Rentner Landesverband Berlin
7
BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität
8 APPD
Anarchische Pogo-Partei Deutschlands
9
Anarchie-Partei
10 Anarcho-Partei
11
iNSDAP interNationalSozialistische Deutsche
ArbeiterPartei
12 Ultranation
13
Gartenpartei Gartenpartei
14 PdH Partei der
Humanisten Fakten, Freiheit, Fortschritt
15
Vereinigte Direktkandidaten
16 dieBasis
Basisdemokratische Partei Deutschland
17 Die
Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer
18
MENSCHLICHE WELT Menschliche Welt für das Wohl
und Glücklichsein aller
19 PDR Partei der
Rentner
20 ZRSD Bundeszentralrat der
Schwarzen in Deutschland
21 Bündnis C
Bündnis C - Christen für Deutschland
22 DG
Die Guten
23 BÜNDNIS DEUTSCHLAND BÜNDNIS
DEUTSCHLAND
24 UNABHÄNGIGE UNABHÄNGIGE für
bürgernahe Demokratie
25 Partei Orange
26 DE2040 Deutschland 2040
27 Die PARTEI
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz,
Elitenförderung und basisdemokratische
Initiative
28 FREIE SACHSEN FREIE SACHSEN
29 Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT
TIERSCHUTZ
30 Volksabstimmung Ab
jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung Politik
für die Menschen
31 CSC Cannabis Social Club
32 MERA25 MERA25 - Gemeinsam für Europäische
Unabhängigkeit
33 ÖDP
Ökologisch-Demokratische Partei Die
Naturschutzpartei
34 VPD
Volksstimmen-Partei-Deutschland
35 SSW
Südschleswigscher Wählerverband
36 IDA
Initiative für Demokratie und Aufklärung
37
LD Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen
38 Die LIEBE Die LIEBE Europäische Partei
39
Volt Volt Deutschland
40 WerteUnion
WerteUnion
41 DAVA Demokratische Allianz für
Vielfalt und Aufbruch
42 SGP Sozialistische
Gleichheitspartei, Vierte Internationale
43
Verjüngungsforschung Partei für
Verjüngungsforschung
44 THP Thüringer
Heimatpartei
45 A L AL ( Partei )
46 PdF
Partei des Fortschritts
47 sonstige DIE
SONSTIGEN X
48 DrA Dr. Ansay Partei
49
DIE NEUE MITTE DIE NEUE MITTE Zurück zur
Vernunft.
50 V-Partei³ V-Partei³ - Partei für
Veränderung, Vegetarier und Veganer
51 Bund
Köln
52 PIRATEN Piratenpartei Deutschland
53 Unity Party of Germany
54 SAI4Paris
Brücke Partei
55 Döner Partei Deutsche
Partei für die ökonomische Neuordnung
essentieller Ressourcen
56 Wachstumswandel
Über die Anerkennung dieser
Vereinigungen als Parteien für die
Bundestagswahl als Voraussetzung für die
Einreichung von Wahlvorschlägen entscheidet der
Bundeswahlausschuss spätestens am 40. Tag vor
der Bundestagswahl (§ 18 Absatz 4
Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 1
Ziffer 1 b) Verordnung über die Abkürzung von
Fristen im Bundeswahlgesetz für die Wahl zum 21.
Deutschen Bundestag).
Die
öffentliche Sitzung des Bundeswahlausschusses
findet daher spätestens am 14. Januar 2025 im
Deutschen Bundestag in Berlin,
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (Eingang
Adele-Schreiber-Krieger-Straße 1), Raum 3.101
(Anhörungssaal) statt. Hierüber informiert die
Bundeswahlleiterin in einer gesonderten
Pressemitteilung am 8. Januar 2025.
Wahlvorschläge von Parteien müssen bis zum
20. Januar 2025, 18:00 Uhr eingereicht werden,
und zwar als Landeslisten bei den zuständigen
Landeswahlleitungen oder als Kreiswahlvorschläge
bei den zuständigen Kreiswahlleitungen.
Aber nicht nur Parteien können
Wahlkreisbewerbende nominieren; auch Gruppen von
Wahlberechtigten eines Wahlkreises können andere
Kreiswahlvorschläge für sogenannte
„Einzelbewerbende“ bis zum 20. Januar 2025,
18:00 Uhr bei den Kreiswahlleitungen einreichen.
Über die Zulassung der Wahlvorschläge
entscheiden je nach Zuständigkeit die Landes-
oder Kreiswahlausschüsse am 24. Januar 2025.
Gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 und § 26 Absatz 1
Satz 3 Bundeswahlgesetz können
Kreiswahlvorschläge einer Partei nur dann
zugelassen werden, wenn für die Partei in dem
betreffenden Land eine Landesliste zugelassen
wird.
2024 war das wärmste
Jahr an Emscher und Lippe seit 1931
Die Niederschlagsbilanz von
Emschergenossenschaft und Lippeverband für den
Dezember 2024 fällt unterdurchschnittlich aus –
anders als noch ein Jahr zuvor, als es infolge
von anhaltendem Dauerregen zu wochenlangen
Hochwässern in der Region kam. Die Bilanz für
das gesamte Kalenderjahr 2024 fällt dagegen
wiederum überdurchschnittlich nass aus.
Eine neue Rekordmarke erreichte die
durchschnittliche Jahrestemperatur: Mit im
Mittel 12,3 Grad war 2024 das wärmste bisher
aufgezeichnete Jahr an Emscher und Lippe seit
1931. Der Dezember 2024 ist mit 62,7 mm im
Emscher-Gebiet und 57,2 mm im Lippe-Gebiet nur
unterdurchschnittlich nass gewesen. Ein
Millimeter entspricht einem Liter Regen pro
Quadratmeter.
Der größte
Tagesniederschlag fiel in beiden
Flusseinzugsgebieten jeweils am 5. Dezember
2024. An diesem Tag fielen im Emscher-Gebiet
maximal 22,3 mm an der Station Mülheim an der
Ruhr-Frohnhauser Weg. Im Gebiet des
Lippeverbandes fiel der maximale
Tagesniederschlag an der Station Hünxe-Schacht
Lohberg. Dort fielen 21,7 mm innerhalb eines
Tages. Im Dezember gab es zwei längere Phasen
ohne oder mit kaum Niederschlag. Einmal vier
Tage vom 10. bis zum 13. Dezember und einmal
sieben Tage vom 25.12. bis zum 31. Dezember.
Das Monatsmittel der Lufttemperatur im
Dezember betrug 5,1 Grad. Damit liegt der
Dezember 1,2 Grad über dem langjährigen Mittel
von 3,9 Grad. Kalenderjahr 2024 Der Niederschlag
im Kalenderjahr 2024 war im Gegensatz zum
Dezember-Monat überdurchschnittlich nass. Im
Emscher-Gebiet liegt der Jahresniederschlag mit
931 mm deutlich über dem 130-jährigen Mittel von
799 mm.
Damit landet das
Kalenderjahr 2024 auf Platz 13 der vergangenen
94 Kalenderjahre. Im Gebiet des Lippeverbandes
liegt der Jahresniederschlag bei 874 mm und
somit auch deutlich über dem 130-jährigen Mittel
von 766 mm. Das bedeutet im Lippe-Gebiet Platz
20 der vergangenen 94 Kalenderjahre. Es folgt
also auf das Rekordjahr 2023 ein weiteres
überdurchschnittlich nasses Jahr.
Wie bereits bei der Auswertung des
Wasserwirtschaftsjahres 2024 (November 2023 bis
Oktober 2024) war der Mai im Kalenderjahr 2024
der Monat mit dem meisten Niederschlag. Deutlich
nasser als das Mittel waren auch der Februar und
der April. Einzig die Monate Juli und Dezember
waren unterdurchschnittlich. Das Jahresmittel
der Lufttemperatur lag bei 12,3 Grad
(langjähriges Mittel: 10,7 Grad) und knackt
somit den bisherigen Höchstwert aus dem
vorherigen Jahr von 12,2 Grad.
Damit
ist das Kalenderjahr 2024 im EGLV-Gebiet das
wärmste bisher aufgezeichnete Kalenderjahr ab
1931. Emschergenossenschaft und Lippeverband
Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV)
sind öffentlich-rechtliche
Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee
des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip
leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten
Emschergenossenschaft sind unter anderem die
Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung
und -reinigung sowie der Hochwasserschutz.
Der 1926 gegründete Lippeverband
bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe
im nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem
den Lippe-Zufluss Seseke naturnah um. Gemeinsam
haben Emschergenossenschaft und Lippeverband
rund 1.700 Beschäftigte und sind Deutschlands
größter Abwasserentsorger und Betreiber von
Kläranlagen und Pumpwerken (rund 782 Kilometer
Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle,
546 Pumpwerke und 59 Kläranlagen). www.eglv.de
Trauer um Bürgermeisterin a.D. Sonja
Northing: Kondolenzbuch liegt öffentlich aus
Im Klever Rathaus liegt ein Kondolenzbuch für
Bürgermeisterin a.D. Sonja Northing aus. Foto:
Markus van Offern. Das
Kondolenzbuch liegt im Rathausfoyer, 1.
Obergeschoss vor dem Ratssaal, aus.

Foto: Markus van Offern
Die Stadt Kleve
trauert um ihre Bürgermeisterin a.D. und
Kollegin Sonja Northing. Überraschend ist sie am
Montag, den 16. Dezember 2024, im Alter von nur
56 Jahren verstorben. Viele Menschen in Kleve
hat ihr Tod tief bewegt. Zahlreiche Bürgerinnen
und Bürger drückten in den vergangenen Wochen
ihre Anteilnahme aus. Viele möchten Abschied
nehmen von Kleves erster Bürgermeisterin.
Seit dem 2. Januar 2025 liegt daher im
Klever Rathaus, 1. Etage, im Foyer vor dem
Ratssaal, ein Kondolenzbuch öffentlich aus.
Während der Öffnungszeiten des Rathauses können
alle Bürgerinnen und Bürger, die Sonja Northing
einen letzten Gruß zukommen lassen möchten, eine
persönliche Botschaft in das Kondolenzbuch
eintragen. Das Buch wird dort noch bis Freitag,
den 31. Januar 2025, ausliegen. Anschließend
wird es den Angehörigen übergeben.
Sonja
Northing wurde am 13. September 2015 zur ersten
Bürgermeisterin der Stadt Kleve gewählt. Einer
Aufgabe, der sie stets mit Freude, Offenheit und
viel Herzblut nachgegangen ist. Ihr war der
Dialog und der Austausch mit der Politik sowie
eine konstruktive und zielorientierte
Zusammenarbeit stets wichtig, damit für ihre
Heimatstadt Kleve, die sie so sehr liebte, die
besten Lösungen gefunden werden konnten. Bei der
Bewältigung der großen Fluchtbewegungen 2015
übernahm sie eine federführende Rolle, zeigte
Tatkraft und Pragmatismus. Sie war stolz auf die
gelebte Willkommenskultur, auf das gelebte
Engagement, die Hilfe und Nächstenliebe in
Kleve. Sie setzte wichtige Impulse im Bereich
Klimaschutz und nicht zuletzt fiel auch die
Corona-Pandemie in ihre Amtszeit. Vor ihrer Wahl
zur Bürgermeisterin stand sie bereits 28 Jahre
lang im Dienst der Stadt Kleve.
Spatenstich für das Pilotprojekt „Alleen 3“:
Agroforst in den Galleien mit der HSRW auf dem
Weg zur LAGA 2029 in Kleve
In den
Klever Galleien wurde am 6. Januar 2025 der
Spatenstich für die Schaffung einer
Agroforst-Demonstrationsfläche gesetzt.
Professor Oliver Locker-Grütjen, Präsident der
Hochschule-Rhein-Waal, Karl Werring, Präsident
der Landwirtschaftskammer NRW, und Wolfgang
Gebing, Bürgermeister der Stadt Kleve, gaben den
Startschuss für dieses Pilotprojekt zur
innovativen Landwirtschaft in der Region
Niederrhein.

Mit dem ersten Spatenstich setzten Wolfgang
Gebing, Bürgermeister der Stadt Kleve, Christian
Bomblat, Technischer Beigeordneter der Stadt
Kleve, Karl Werring, Präsident der
Landwirtschaftskammer NRW und Peter Kisters,
Vizepräsident für Forschung, Innovation und
Wissenstransfer der HSRW sowie Projektleiter des
Projekts TransRegINT, (v.l.n.r.) den Beginn der
Pflanzung für das Pilotprojekt „Alleen 3“. Bild:
HSRW / Florian Gaisrucker
Mit
Christoph Gerwers, Landrat des Kreises Kleve,
nahm auch ein Mitglied des
Transformationsbeirats der Hochschule Rhein-Waal
teil. Professor Dr.-Ing. Peter Kisters,
Vizepräsident für Forschung, Innovation und
Wissenstransfer der HSRW sowie Projektleiter des
Projekts TransRegINT, moderierte die
Veranstaltung. Agroforstsysteme kombinieren und
bewirtschaften Ackerbau oder Dauergrünland, mit
oder ohne Tierhaltung, gemeinsam mit Gehölzen
auf einer Fläche.
Das Projekt, auch
„Alleen 3“ genannt, ist eine Kooperation der
Hochschule Rhein-Waal mit der Stadt Kleve und
dem Landwirtschaftlichen Versuchszentrum Haus
Riswick. Für die HSRW koordiniert das Agroforst
Reallabor, eingebettet in das Vorhaben
TransRegINT - Transformation der Region
Niederrhein: Innovation, Nachhaltigkeit und
Teilhabe, das Projekt. Neben Bewirtschaftung,
Forschung und Lehre durch Haus Riswick und die
HSRW wird die Agroforst-Demonstrationsfläche
perspektivisch auch Teil der Landesgartenschau
2029, die in Kleve stattfinden wird. Ab 2025
sind vom Team des Agroforst Reallabors
Aktivitäten geplant, die sowohl die Studierenden
der HSRW als auch die Bürger*innen der Region
einbeziehen werden.
Umwandlung von
Ackerland in Agroforst Auf der 3,3 Hektar großen
Fläche, die sich im Eigentum der Stadt Kleve
befindet, werden auf insgesamt sechs
Agroforst-Baumstreifen in mehreren Pflanzphasen
insgesamt 349 Gehölze gepflanzt. Die
Gehölzstreifen sind in Breiten von drei bis fünf
Metern angelegt, um unterschiedlich stark- bzw.
breitwüchsige Gehölze zu pflanzen.
Die Agroforststreifen werden zwischen den
Gehölzen gemulcht und frei von Beikräutern,
umgangssprachlich auch als Unkraut bekannt,
gehalten. Seitlich der Gehölze, jedoch noch
innerhalb der Gehölzstreifen, werden
standortangepasste Blühmischungen ausgebracht.
Diese sollen die Biodiversität in dem System
steigern, die Konkurrenz stark vermehrender
Arten unterdrücken und einen ästhetischen
Mehrwert bringen. Die Ackerfläche zwischen den
Gehölzstreifen wird, wie bisher auch, von Haus
Riswick bewirtschaftet.
Gehölze im
Agroforst Der Pflanzplan und die damit
verbundene Gehölzauswahl wurde mit Unterstützung
des Agroforst-Experten Burkhard Kayser, Berater
für nachhaltige Landnutzung und Permakultur,
präzise ausgearbeitet. Alleen 3 ist Teil des
Galleien Parkteils des von Johann Moritz von
Nassau-Siegen geschaffenen Alten Tiergartens.
Die in der Kermisdahl-Niederung gelegene Fläche
ist im Oktober 2024 als Gartendenkmal in die
Denkmalliste der Stadt Kleve eingetragen worden.
Besondere Beachtung galt daher der
Einhaltung der Sichtachse zwischen Schwanenburg
und dem Aussichtspunkt am Papenberg in der Nähe
der Grabanlage des Prinzen Johann-Moritz von
Nassau-Siegen. Ein zentrales Anliegen aller
Beteiligten ist, die besten Kombinationen von
Gehölzen und Streifenbreiten für den Niederrhein
zu erproben. Zudem sollen die direkten Kosten
von Agroforststreifen ermittelt werden, denn sie
haben eine direkte Auswirkung auf die
Betriebsführung, stehen bisher jedoch selten im
Fokus von Forschungsvorhaben.
Ein
wichtiger Aspekt hierbei: die Wirtschaftlichkeit
der Pflege. Ein weiteres Kriterium für die
Gehölzwahl und den Pflanzplan ist die Gestaltung
der Fläche als biodiverses System. Gerade
Agroforstsystemen wird eine wichtige Rolle bei
der Steigerung der biologischen Vielfalt
zugesprochen, da sie unterschiedlichsten
Lebewesen einen Lebensraum bieten. Mit den
ausgewählten Gehölzen wird versucht, eine
Balance zwischen Vielfalt und Wirtschaftlichkeit
zu gewährleisten. Auch der Klimawandel und seine
Folgen für den Niederrhein haben die
Gehölzauswahl beeinflusst, Stichwort
Trockenheits- und Hitzetoleranz.
Der
Pflanzplan versucht zudem zu vermeiden, dass die
Gehölze zu stark in Konkurrenz um Platz, Licht
und Wasser geraten. Der Schwerpunkt der
Pflanzung liegt auf Industrie- und Werthölzern.
Hierbei wird unterschieden zwischen
schnellwachsenden Gehölzen und Stammholz.
Schnellwachsende Gehölze werden für den
sogenannten mittleren Umtrieb, also einen
Ernterhythmus alle sechs bis acht Jahre,
gepflanzt. Man spricht in diesem Zusammenhang
auch von ‚einmal pflanzen, mehrfach ernten‘.
Beispiele hierfür sind Esskastanie, Traubeneiche
und Winterlinde.
Das geerntete Holz
wird als Bauholz verwendet. Im Kontrast hierzu
stehen Stamm- und Werthölzer wie beispielsweise
Baumhasel, Elsbeere oder Kulturbirne. Sie sind
für die Verwendung in der Säge- und
Furnierindustrie vorgesehen. Für eine
größtmögliche biologische Vielfalt werden zudem
schwachwachsende Straucharten wie etwa
Eberesche, Himbeere und Besenginster
gepflanzt. Da die Agroforst-Demonstrationsfläche
Teil der Landesgartenschau 2029 wird, ergänzen
aus ästhetischen Gründen auch Gehölze mit
Zierwert wie etwa Rosen und Blasenstrauch die
Pflanzung.
Ausblick
Nach
Abschluss der Pflanzung wird die Fläche
klassisch bewirtschaftet sowie für
Forschungszwecke und landwirtschaftliche
Praxisdemonstrationen genutzt. Zur Sicherung des
Anwuchses in den ersten Jahren werden die
Gehölze bewässert. Dies geschieht mittels
Tröpfchenbewässerung, um sicherzustellen, dass
die Wurzeln in die Tiefe wachsen. Wer nicht bis
zur Landesgartenschau im Jahr 2029 warten
möchte, um die Agroforst-Demonstrationsfläche
kennenzulernen, darf sich ab Sommer 2025 auf
sogenannte Feldtage freuen.
Das Team
des Agroforst Reallabors der HSRW wird geführte
Exkursionen anbieten, um Forschung, Pflanzung
und auch die Vorteile von Agroforstsystemen
genauer zu erläutern. Hintergrund Das
Agroforst Reallabor ist als
Transformationsprojekt Teil vom Projekt
‚TransRegINT - Transformation der Region
Niederrhein: Innovation, Nachhaltigkeit und
Teilhabe‘. Es soll an die Region Niederrhein
angepasste Agroforstsysteme umsetzen und ein
regionales Netzwerk der verschiedenen
Akteur*innen schaffen.
Das Team
Agroforst Reallabor begleitet die Umsetzungen
wissenschaftlich, um Daten zu den ökologischen,
ökonomischen und sozialen Leistungen dieser
Systeme zu erheben. Mit dem Projekt ‚TransRegINT
hat sich die Hochschule Rhein-Waal zum Ziel
gesetzt, den nachhaltigen Wandel in der Region
wissenschaftsbasiert mitzugestalten.
Gefördert wird das Projekt durch das
Programm ‚Innovative Hochschule‘ des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
Diese Förderinitiative unterstützt Hochschulen
dabei, aus Forschungserkenntnissen kreative
Lösungen für die drängenden Herausforderungen
unserer Zeit zu finden. Bis Ende 2027 wird
‚TransRegINT‘ mit Fördergeldern in Höhe von
knapp zehn Millionen Euro gefördert. Dies
ermöglicht es, Lösungen zu erarbeiten, um die
Zukunft in der Region im Sinne der 17
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu
gestalten.
Kleve: Mythisches
Nordlicht in Musik und Videokunst
Das Nordlicht ist ein uraltes Faszinosum, von
ganz eigenen Tönen geprägt, einem Zusammenspiel
von Licht, Schatten und Dämmerung. Die optischen
Naturereignisse am Firmament vermitteln
mythische Botschaften an die menschliche
Existenz und haben Tonsetzer zu schillernden
Kompositionen inspiriert.

Breeze Wind Quintett Foto: Joelle van Autreve
Das international besetzte BREEZE
Bläserquintett pustet damit frischen Wind in den
Klever Konzertsaal und eröffnet im
WDR-Live-Konzert am Dienstag, 14. Januar, 20 Uhr
in der Klever Stadthalle das neue Konzertjahr.
Die Musik der nordischen Komponisten wirkt
frisch und erhellend wie klare Winterluft. Für
vibrierendes Flimmern und luzide Transparenz
bespielt das Bläserquintett die ideale
Klangpalette.
Die fünf
Bläsersolisten des BREEZE Quintetts sind
Flötistin Jill Jeschek, Oboist Juri Vallentin,
Klarinettistin Annelien van Wauwe, Hornist
Premysl Vojta und Fagottist Marceau Lefèvre. In
Solo- und Ensemble-Werken tauchen sie das
Publikum mit Musik aus Island und Skandinavien
in schimmerndes Nordlicht. Hauptwerk ist das
klassische Bläserquintett des Dänen Carl
Nielsen, dazu kommt Musik des Schweden Anders
Hilborg sowie Solowerke von Kaija Saariaho aus
Finnland, Kaja Bjornvedt aus Norwegen und Sigurd
Berge aus Schweden für unterschiedliche
Holzblasinstrumente.
Die Stimme der
isländischen Avant-Pop-Ikone Björk zieht sich
wie ein Silberfaden durch das Konzert, ihre
Songs- und Filmmusikwerke wurden eigens für die
BREEZE-Besetzung arrangiert. Ein „Dreiklang“
prägt in mehrfacher Hinsicht das Konzertprogramm
von „Northern Lights“: Drei Songs von Björk
wechseln mit drei Solo-Werken und den
Holzbläserquintetten.
Mit dieser
Ordnung bezieht sich das Ensemble auf den
skandinavischen Mythos der Triskele der Götter
Odin, Thor und Freya, aber auch auf die
christliche Trinität von Vater, Sohn und
Heiliger Geist. So verbinden sich an diesem
Abend Musik und Spiritualität, Licht und Natur.
BREEZE will frischen Wind in das Konzertleben
pusten und mit Kreativität und Abenteuer Musik
für Blasinstrumente gestalten.
Die
befreundeten Instrumentalisten sind Preisträger
internationaler Wettbewerbe und kommen aus
Belgien, Deutschland, Frankreich und Tschechien.
Für faszinierende Visuals aus Borealis-Farben
und pulsierenden Projektionen sorgt während der
Live-Musik Videokünstler Paul Bießmann. So wird
der Abend zu einem Gesamtkunstwerk, das alle
Sinne anspricht. Um 19 Uhr gibt Andreas Daams im
Gespräch mit Künstlern des Abends die
Konzerteinführung "Das dritte Ohr".
Der WDR nimmt auf und sendet live aus der
Stadthalle. Das Konzertprojekt wird vom
Kultursekretariat NRW Gütersloh gefördert. .
Konzertkarten (18€/16€/Schüler, Studenten 5 €)
gibt es im VVK unter www.kleve.reservix.de, an
allen Reservix-VVK-Stellen (Buchhandlung
Hintzen, Niederrhein Nachrichten) und an der
Klever Rathaus-Info. Einlass: kurz vor 19 Uhr.
Moers: Herderstraße wird
während der Reparatur eine Woche zur Sackgasse
Bei einer Routineuntersuchung mit einer
Kamerabefahrung hat die ENNI Stadt & Service
Niederrhein (Enni) in der Herderstraße in
Moers-Eick eine Verstopfung im Regenwasser-kanal
entdeckt, die die Monteure nicht freispülen
können. Ein hierauf spezialisiertes
Partnerunternehmen der Enni wird den Kanal
deswegen ab Montag, 13. Januar, freifräsen und
dabei untersuchen, ob er im späteren Verlauf
saniert werden muss. Da die Eingangsschächte in
der Fahrbahnmitte liegen, wird die Straße für
die Bauzeit für Autofahrer in Höhe der
Hausnum-mer 14 zur Sackgasse.
Fußgänger können die Baustelle jederzeit
passieren, Anlieger ihre Häuser während der
Arbeiten erreichen. Für den Durchgangsverkehr
wird Enni in beide Fahrtrichtungen eine
Umleitung über die Fontanestraße, die Orsoyer
Allee sowie die Dessauer- und die Schillerstraße
aus-schildern. Hiervon ist auch der dort
pendelnde Linienbus der NIAG betroffen.
Die Verkehrsbetriebe heben während der
einwöchigen Bauzeit die Bushaltestelle in der
Herderstraße auf und richten in der Dessauer
Straße in Höhe der Hausnummer 6 eine
Ersatzhaltestelle ein. Wie üblich hat Enni die
Arbeiten auch hier mit der Stadt Moers, der
Polizei und der Feuerwehr abgestimmt. Läuft
alles nach Plan, sollen die Arbeiten bereits am
17. Januar abgeschlossen sein. Fragen
beantwortet Enni unter der Rufnummer 104-600.
Für junge Eltern: Neues
Eltern-Kind-Spielangebot in Wesel-Jugendzentrum
KARO
Sie sind junge Eltern unter 25
Jahre und suchen ein Eltern-Kind-Angebot, bei
dem Sie in lockerer Atmosphäre andere junge
Eltern treffen können? Sie würden gerne mal mit
ihren Freunden das Jugendzentrum Karo besuchen?
Oder Sie suchen eine Spielgruppe für ihr Kind
und sich, in der alle Eltern ungefähr im
gleichen Alter sind? Dann sind Sie hier genau
richtig.
Das neue Angebot „Auszeit
mit Kind“ startet ab dem 13.01.2025 und findet
immer montags in der Zeit von 10.00 Uhr bis
11.30 Uhr im Jugendzentrum Karo, Herzogenring 12
in 46483 Wesel, statt. Trauen Sie sich und
schauen doch einfach mal unverbindlich vorbei.
Eine Anmeldung für das kostenfreie
Angebot ist nicht erforderlich. Die
Spielgruppenleitung freut sich bereits auf Sie
und ihr Kind. Bei Rückfragen stehen die
Mitarbeiterinnen der Koordinationsstelle Frühen
Hilfen unter folgender Rufnummer zur Verfügung:
0281/203-2555 und 2566.
Schutz vor „K.o.-Mieten“ im Alter durch
Wohneigentum – Aktuelle Fakten zum Wohneigentum
für den Bund, alle Bundesländer, Städte und
Kreise
Die eigenen vier Wände – für
einen Haushalt mit Durchschnittseinkommen:
Fehlanzeige. Die meisten Menschen haben keine
Chance auf eine Eigentumswohnung, ein Reihenhaus
oder ein Einfamilienhaus. Besonders kritisch
wird das im Alter. Denn Wohneigentum schützt vor
Altersarmut. Viele drohen deshalb in die
„Wohn-Armut“ zu rutschen: Altersarmut durch
„K.o.-Mieten“. Hier hat die Bundespolitik
versagt. Sie hat jetzt schon einer ganzen
Generation die Chance auf Wohneigentum verbaut.
Es wird deshalb höchste Zeit, dass die neue
Bundesregierung das Ruder herumreißt.
Das ist das Fazit der aktuellen
Wohnungsbau-Studie, die das Pestel-Institut
(Hannover) auf einer Hybrid-Pressekonferenz zum
Auftakt der Fachmesse BAU in München am
kommenden Montag (13. Januar) vorstellen wird.
Titel der Studie:
Schutzschirm vor
Altersarmut: Wohneigentum in Deutschland
Mit
Zahlen für den Bund, für alle Bundesländer, für
Städte und Kreise
Konkrete Zahlen, Fakten
und Daten zum „Wohneigentum in Deutschland“ wird
das Pestel-Institut bei der Vorstellung der
Studie auf der Hybrid-Pressekonferenz
präsentieren – für Deutschland, alle
Bundesländer sowie für Städte und Kreise. Dabei
wird es u.a. auch um diese Inhalte gehen:
Deutschland-Ranking – Wohneigentums-Quote
§
TOP 10 der Mieter-Städte – TOP 10 der
Eigentümer-Städte
§ Eigentümer-/Mieterquote –
Zahlen für alle kreisfreien Städte in
Deutschland (über 100 Städte)
§ Trends und
Entwicklungen in Deutschland – mit
Europa-Vergleich
Deutschland-Check (für
alle Städte und Kreise): Miete oder
Wohneigentum?
§ Analyse für alle kreisfreien
Städte und Kreise: Mieten oder Wohnungskauf/
Hausbau – wo ist wie viel Wohneigentum machbar?
„Preis-Explosion“
§ Welche Kostensprünge hat
es in nur 10 Jahren beim Wohneigentum gegeben? –
Mit einem Vergleich zur allgemeinen
Preisentwicklung.
§ Hemmnisse: Woran
scheitert die Anschaffung (Bau und Kauf) eines
Eigenheims bzw. einer eigenen Wohnung?
„Machbarkeits-Check Wohneigentum“
§
Eigentümer-Profil: Wer kann sich Wohneigentum
noch leisten – in welchem Alter, mit welchem
Einkommen?
§ Kosten von Einfamilienhäusern
(100 m²) für alle Städte und Kreise
(Angebotspreise)
Eigentümer-Quote erhöhen
§ Förderung fürs Eigenheim und für die
Eigentumswohnung:
Wie müsste eine effektive
Unterstützung vom Staat aussehen?
§
Kalkulation für einen Muster-Haushalt mit
durchschnittlichem Einkommen
Altersvorsorge
Wohneigentum
§ Haus und Eigentumswohnung
versus Gefahr von Grundsicherung im Alter durch
hohe Mieten
§ Dazu der Renten-Check: Wie ist
die aktuelle und die künftige
Einkommenssituation der Senioren?
Prognose
§ Wie würde mehr Wohneigentum die
Mieten ins Rutschen bringen?
Polit-Positionen
im Bundestagswahlkampf
§ Wie stehen die
Parteien zum Wohneigentum?
§ „Merz-Mini-Haus“
im Check: Wissenschaftler beurteilen das
Wahlversprechen von CDU/CSU-Kanzlerkandidat
Friedrich Merz zum „Bau-Turbo-Programm“ für
erschwingliche Mini-Häuser.

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2024 real
voraussichtlich um 1,3 % höher als 2023
Einzelhandelsumsatz, Jahresergebnis 2024
(Schätzung, vorläufig)
+1,3 % im Jahr 2024
gegenüber 2023 (real, Originalwerte)
+2,7 %
im Jahr 2024 gegenüber 2023 (nominal,
Originalwerte)
+1,1 % im Jahr 2024 gegenüber
2023 (real, kalender- und saisonbereinigt)
+2,5 % im Jahr 2024 gegenüber 2023 (nominal,
kalender- und saisonbereinigt)
Einzelhandelsumsatz, November 2024 (vorläufig,
kalender- und saisonbereinigt)
-0,6 % zum
Vormonat (real)
-0,6 % zum Vormonat (nominal)
+2,5 % zum Vorjahresmonat (real)
+3,5 % zum
Vorjahresmonat (nominal)
Der
Einzelhandel in Deutschland hat nach einer
Schätzung des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) im Jahr 2024 real (preisbereinigt)
1,3 % und nominal (nicht preisbereinigt) 2,7 %
mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2023.
Nachdem die reale Umsatzentwicklung im
Einzelhandel im 1. Halbjahr 2024 gegenüber dem
Vorjahreszeitraum rückläufig war (-0,4 %),
verzeichneten die realen Umsätze im 2. Halbjahr
einen Zuwachs von schätzungsweise 3,0 %.
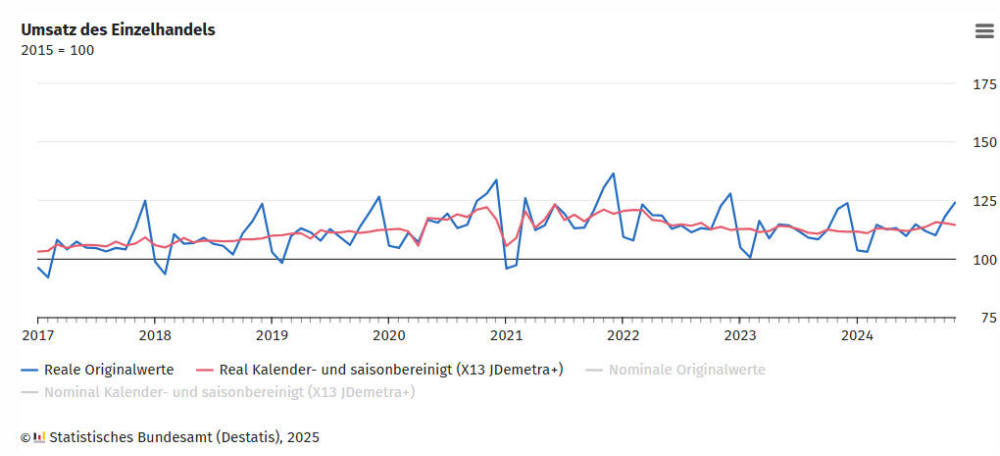
Im Vergleich zu 2021, als der deutsche
Einzelhandel den bisher höchsten Umsatz seit
Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994 erzielte, lag
der reale Jahresumsatz 2024 voraussichtlich um
2,7 % niedriger. Während der Corona-Pandemie im
Jahr 2020 hatte der Einzelhandel, unter anderem
getragen durch den Internet- und Versandhandel,
einen hohen realen Umsatzzuwachs von 4,8 %
gegenüber dem Vorjahr erzielt, 2021 war der
Umsatz nochmals um real 0,6 % gestiegen.
Im Gegensatz hierzu war die reale
Umsatzentwicklung in den Jahren 2022 und 2023
aufgrund der hohen Preissteigerungen rückläufig
(-0,7 % bzw. -3,3 %). Dennoch lagen die realen
Umsätze im Jahr 2024 voraussichtlich 2,6 % über
dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019.
• Weihnachtsgeschäft
im November 2024: Umsatz real 2,5 % höher als im
Vorjahresmonat
In den vergangenen Jahren hat
sich ein Teil des Weihnachtsgeschäfts durch
Sonderaktionen in den Tagen rund um den „Black
Friday“ oder den „Cyber Monday“, vor allem im
Internet- und Versandhandel, zunehmend in den
November vorverlagert. Im November 2024 setzten
die Einzelhandelsunternehmen nach vorläufigen
Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real
2,5 % und nominal 3,5 % mehr um als im November
2023.
Im Vormonatsvergleich sank der
kalender- und saisonbereinigte Umsatz im
November 2024 gegenüber Oktober 2024 sowohl
nominal als auch real um 0,6 %. Umsätze im
Einzelhandel mit Lebensmitteln sowie mit
Nicht-Lebensmitteln mit Zuwächsen am Jahresende
Im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg der
kalender- und saisonbereinigte Umsatz im
November 2024 im Vergleich zum November 2023
real um 1,7 % und nominal um 4,1 %.
Bereits im Oktober 2024 hatte der Umsatz im
Lebensmitteleinzelhandel gegenüber dem
Vorjahresmonat einen Anstieg von real 1,2 % und
nominal 3,8 % verzeichnet. Nachdem die Umsätze
von Januar bis September 2024 nur leicht über
denen des Vorjahreszeitraums gelegen hatten
(real +0,3 %), legte die Umsatzentwicklung im
Einzelhandel mit Lebensmitteln zum Jahresende
somit deutlich zu. Im Vormonatsvergleich stieg
der Umsatz im November 2024 mit real +0,1 % und
nominal +0,2 % gegenüber Oktober 2024 nur
leicht.
Eine ähnliche Entwicklung
zeigt sich auch im Einzelhandel mit
Nicht-Lebensmitteln. Hier stieg der kalender-
und saisonbereinigte Umsatz im November 2024
real um 2,3 % und nominal um 2,5 % gegenüber dem
Vorjahresmonat. Bereits im September 2024 und
Oktober 2024 hatte der reale Umsatz gegenüber
dem jeweiligen Vorjahresmonat einen deutlichen
Anstieg erfahren (+7,8 % und +2,3 %), nachdem
die Umsätze von Januar bis August 2024 real
0,7 % unter denen des Vorjahreszeitraums gelegen
hatten.
Im Vormonatsvergleich sank
der reale Umsatz im Einzelhandel mit
Nicht-Lebensmittel im November 2024 gegenüber
Oktober 2024 real um 1,8 % und nominal um 1,7 %.
Diese Entwicklung wurde getragen vom Internet-
und Versandhandel, der im November 2024 einen
realen Umsatzanstieg von 9,7 % zum November 2023
erzielte, jedoch gegenüber Oktober 2024 einen
realen kalender- und saisonbereinigten
Umsatzrückgang von 1,2 % verzeichnete.
Mittwoch, 8.
Januar 2025
#Böllerciao: PETA
übergibt zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe
und weiteren Organisationen offenen Brief für
Feuerwerksverbot an Innenministerin Nancy Faeser
Böllerverbot jetzt: Als Teil des Bündnisses der
Deutschen Umwelthilfe hat PETA gestern zusammen
mit 34 weiteren Organisationen den
offenen Brief samt Unterschriften für ein
Böllerverbot in Deutschland übergeben. In dem
Schreiben fordern die Organisationen
Innenministerin Nancy Faeser auf, die erste
Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) zu
überarbeiten und den privaten Kauf und Gebrauch
von Pyrotechnik zu Silvester dauerhaft zu
beenden.

Foto Peta/DUH
Insbesondere für Wildtiere,
aber auch für tierische Mitbewohner bedeutet der
lautstarke Jahreswechsel immensen Stress und
mitunter Lebensgefahr. Viele Tiere entlaufen,
geraten in Panik oder verletzen sich in Folge
von Angst und Fluchtversuchen. Zudem schaden die
Feuerwerkskörper der Umwelt und sind auch für
Menschen eine Gefahr. Die Tierrechtsorganisation
appelliert an die Bevölkerung, aus
Rücksichtnahme auf Mensch und Tier von Kauf und
Nutzung der Feuerwerkskörper abzusehen.
„Auch zum diesjährigen Jahreswechsel litten
Millionen Tiere unter dem Krach, den grellen
Blitzen und den unbekannten Gerüchen, die durch
Knallkörper an Silvester entstehen. Dieses
traumatische Erlebnis kann zu Angstzuständen und
im schlimmsten Fall zum Tod führen“, so Björn
Thun, Fachreferent bei PETA. „Um Tiere, Menschen
und die Umwelt zu schützen, fordern wir Nancy
Faeser dazu auf, endlich Verantwortung zu
übernehmen, ein dauerhaftes Nutzungs- und
Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern nicht
weiter zu verhindern und den Tieren den
Silvesterhorror zu ersparen.“
Bevölkerung unterstützt mehreren Umfragen
zufolge ein Verbot
Die meisten Umfragen
stimmen für ein Silvesterfeuerwerkverbot. Einer
im Oktober 2023 veröffentlichten forsa-Studie zufolge
sprechen sich fast Dreiviertel der befragten
Frauen sowie knapp die Hälfte der Männer für ein
deutschlandweites Verbot privater
Silvesterfeuerwerke aus – was insgesamt einer
Mehrheit von etwa 60 Prozent entspricht.
In einer ebenfalls 2023 erhobenen YouGov-Umfrage zeichnete
sich eine ähnliche Tendenz ab. Demnach wünschen
sich 41 Prozent der Befragten ein Verbot,
wogegen nur 17 Prozent die private Verwendung
der Pyrotechnik weiterhin befürworten. Laut
einer bereits 2018 von PETA beauftragten GfK-Umfrage würden
58,2 Prozent der Befragten gerne auf knallendes
Feuerwerk in der Neujahrsnacht verzichten.
Mehrere große Baumarktketten wie Hornbach,
Globus Baumärkte, Obi und Bauhaus gingen mit
gutem Beispiel voran und haben
Silvesterfeuerwerk bereits ausgelistet.
Insbesondere Wildtiere leiden aufgrund der
lauten Feuerwerkskörper unter massivem Stress.
Sie reagieren besonders empfindlich auf die
extreme Geräuschkulisse. Bei drohender Gefahr
flüchten sie in der Regel. Der außergewöhnliche
Stress kann die Tiere im schlimmsten Fall so
schwächen, dass sie die Wintermonate nicht
überleben. Gerade im Winter müssen Wildtiere gut
mit ihren Kräften haushalten, da sie nur
begrenzte Energie- und Nahrungsreserven zur
Verfügung haben.
Ein hoher
Energieverlust durch Störungen oder panisches
Flüchten kann lebensbedrohliche Folgen haben.
Rauchschwaden und helle Leuchtraketen können
außerdem zu Desorientierung führen, ihnen die
Sicht nehmen und sie blenden, sodass sie
Hindernissen nicht mehr rechtzeitig ausweichen
können. [1] Es dauert häufig Tage oder sogar
Wochen, bis sie sich von diesem Schock erholt
haben. Auch Hunde, Katzen, Vögel und viele
andere tierische Mitbewohner sind beim
Jahreswechsel häufig großem Stress ausgesetzt.
Jedes Jahr verzeichnen Tierkliniken
zahlreiche Fälle von Tieren, die während der
Silvesternacht behandelt werden müssen. Infolge
der Angst und Fluchtversuche verletzen sie sich
die Gliedmaßen, brechen sich die Knochen oder
ziehen sich andere Verletzungen zu. Zudem führen
die lauten Feuerwerkskörper immer wieder zu
zahlreichen Unfällen. So liefen in den
vergangenen Jahren beispielsweise oftmals Pferde
auf Straßen. Panische Kraniche und Gänse flogen
in Autos, weil sie die Orientierung verloren
hatten.
Zudem leidet die Umwelt
unter den Feuerwerkskörpern. Am ersten Tag des
neuen Jahres ist die Feinstaub-Konzentration
vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr
nicht. Die Folgen für die menschliche Gesundheit
reichen von vorübergehenden Beeinträchtigungen
der Atemwege über einen erhöhten
Medikamentenbedarf bei Asthmatikern bis zu
Atemwegserkrankungen und
Herz-Kreislauf-Problemen.
PETAs Motto
lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an
ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen,
sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner
anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt
sich gegen Speziesismus ein
– eine Form von Diskriminierung, bei der Tiere
aufgrund ihrer Artzugehörigkeit abgewertet
werden.
Sternsinger*innen zu
Gast im Rathaus Wesel
25
Sternsinger*innen und ihre Betreuer*innen
besuchten am Freitag, 03.01.2025,
Bürgermeisterin Ulrike Westkamp im Rathaus
Wesel. Ulrike Westkamp bedankte sich bei den
Kindern und ihren Begleiter*innen. Ohne die
Sternsinger*innen könnten viele wichtige
Projekte weltweit nicht angestoßen werden, so
die Bürgermeisterin.

Im Gespräch berichteten die engagierten Mädchen
und Jungen im Alter von 6 bis 18 Jahren der
Katholischen Kirchengemeinde Sankt Nikolaus
Wesel von ihren Erlebnissen der letzten Jahre.
Die meisten Menschen freuten sich,
Sternsinger*innen zu sehen und zu spenden.
Kinder haben Grundrechte
„Erhebt eure
Stimme! - Sternsingen für Kinderrechte“ lautet
das Motto des diesjährigen Dreikönigssingens.
Mit dem gesammelten Geld werden Kinder im Norden
Kenias und in Kolumbien unterstützt.
Im
Norden Kenias haben Kinder kaum Zugang zu
Schulen oder medizinischer Versorgung. Eine
Partnerorganisation macht sich für die
Kinderrechte auf Gesundheit, Ernährung und
Bildung stark und betreibt unter anderem
Schulen. In Kolumbien setzt sich der
Sternsinger-Projektpartner für die Rechte von
Kindern auf Schutz, Bildung und Mitbestimmung
ein. Denn viel zu oft müssen Kinder hier Gewalt
und Vernachlässigung erleben.
Die
Sternsinger*innen ziehen bis einschließlich
Sonntag durch die Straßen Wesels, um die frohe
Botschaft zu verkünden und Spenden zu sammeln.
Dinslaken: Weihnachtsbäume werden
abgeholt
In dieser Woche (bis zum
10. Januar 2025) sammelt der DIN-Service der
Stadt Dinslaken die Weihnachtstannenbäume ein.
Wichtig ist, dass diese vollständig abgeschmückt
sind und – frühestens einen Tag vor der Abholung
– an demselben Platz abgelegt werden, an dem die
Restmülltonnen zur Abfuhr stehen.
Die jeweiligen Abholtermine stehen, wie immer,
im Abfallkalender, sind aber auch online zu
finden unter. Insgesamt sind elf Mitarbeiter
des DIN-Service mit vier Fahrzeugen im Einsatz.
Dabei handelt es sich um zwei Müllwagen, einen
Lkw und einen Lkw mit Häcksler. Die Bäume werden
dann zu Biomasse verarbeitet.
Übrigens: Wer seinen Baum länger zu Hause stehen
lassen möchte, kann ihn auch gerne später
kostenlos beim Wertstoffhof an der Krengelstraße
109 abgeben. Dieser ist zu folgenden Zeiten
geöffnet: dienstags: 8.00 bis 15.30 Uhr
mittwochs: 8.00 bis 15.30 Uhr donnerstags: 11.00
bis 19.00 Uhr freitags: 8.00 bis 15.30 Uhr
samstags: 8.00 bis 15 Uhr.
Gute Vorsätze: auch an Früherkennung denken
Weniger Süßes, mehr Sport
Der
Jahreswechsel ist für viele ein guter Anlass,
die eigene Gesundheit in den Blick zu nehmen.
Neben einem gesunden Lebensstil bietet die
Krebsfrüherkennung gesundheitliche Chancen. Zu
den Angeboten informieren der
Krebsinformationsdienst des Deutschen
Krebsforschungszentrums (DKFZ) und der
Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan
Schwartze, MdB.
Krebsfrüherkennungsuntersuchungen richten sich
an Menschen, die keine Beschwerden haben.
Das Ziel ist es, den Krebs so früh zu
erkennen, dass er erfolgreich behandelt werden
kann. Das Screening erhöht somit die
Heilungschancen. Oft sind bei frühem Krebs
Therapien möglich, die weniger belastend sind.
Das hilft, die Lebensqualität zu bewahren.
Stefan Schwartze weiß aus eigener Erfahrung, wie
wichtig Früherkennungsuntersuchungen sind: „Im
vergangenen Frühjahr habe ich anlässlich des
Hautkrebsmonats Mai an einer
Hautkrebsfrüherkennung teilgenommen – der ersten
für mich überhaupt. Ein auffälliger Befund
führte zu einem kurzen operativen Eingriff.“
•
Ab 35 Jahren kann
jeder alle zwei Jahre eine
Hautkrebsfrüherkennung in Anspruch nehmen.
Angebote zur Krebsfrüherkennung – für jeden In
Deutschland gibt es ein gesetzliches
Krebsfrüherkennungsprogramm. Jeder gesetzlich
Versicherte kann ab einem bestimmten Alter und
in festgelegten Zeitabständen die einzelnen
Untersuchungen wahrnehmen. Die Teilnahme an den
Untersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs,
Darmkrebs, Brustkrebs, Hautkrebs und
Prostatakrebs ist freiwillig und kostenlos.
•
Für Frauen: Ab 20
Jahren können sie regelmäßig an gynäkologischen
Untersuchungen zur Früherkennung von
Gebärmutterhalskrebs teilnehmen, ab 35 Jahre
wird zusätzlich ein Test auf Humane
Papillomviren (HPV) alle 3 Jahre angeboten. In
Bezug auf Brustkrebs kann ab 30 Jahren jährlich
das Abtasten der Brust wahrgenommen werden und
zwischen 50 und 75 Jahren alle zwei Jahre ein
Mammographie-Screening.
•
Für Männer: Ab 45
Jahren können sich Männer jährlich im Hinblick
auf Prostatakrebs untersuchen lassen. Für Alle:
Ab 35 Jahren kann jeder alle zwei Jahre seine
Haut im Hinblick auf Hautkrebs betrachten
lassen. Zur Früherkennung von Darmkrebs haben
Männer ab 50 Jahren und Frauen ab 55 Jahren
Anspruch auf eine Darmspiegelung. Alternativ
kann ab 50 Jahren regelmäßig ein Test auf
verborgenes Blut im Stuhl durchgeführt werden.
•
Zu den
Früherkennungsuntersuchungen von Brustkrebs,
Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs laden die
gesetzlichen Krankenkassen in regelmäßigen
Abständen persönlich und schriftlich ein. Mit
der Einladung erhalten die Versicherten ein
Informationsschreiben, das über Nutzen und
Risiken der jeweiligen Untersuchung aufklärt.
Das Krebsfrüherkennungsprogramm ist nicht starr:
Gibt es neuere Erkenntnisse aus aussagekräftigen
Studien, können sich die Empfehlungen daran
anpassen.
So wurde zum Beispiel erst
im letzten Jahr das Mammographie-Screening für
Frauen im Alter von 70 bis 75 Jahren erweitert.
Früherkennung kann auch Vorsorge sein Von
Krebsvorsorge spricht man, wenn durch die
Früherkennungsuntersuchung bereits Vorstufen von
Krebs erkannt werden, etwa erste
Gewebeveränderungen. Solche Untersuchungen sind
bislang nur bei der Früherkennung von
Gebärmutterhalskrebs, Hautkrebs und Darmkrebs
möglich.
Besonders überzeugend ist
die Darmspiegelung: Während der Untersuchung
können nicht nur Darmkrebs und Krebsvorstufen
(Polypen) erkannt werden – zudem ist eine
Entfernung der noch gutartigen Polypen direkt
möglich. Das verhindert wirksam, dass bösartiger
Darmkrebs entsteht. „In Deutschland sind die
Darmkrebs-Neuerkrankungen seit Einführung der
Vorsorge-Koloskopie im Jahr 2002 bereits um etwa
30 Prozent zurückgegangen. Dennoch erkranken pro
Jahr immer noch ca. 55.000 Menschen an
Darmkrebs. Bei einer besseren Nutzung der
Darmkrebs-Vorsorge könnten noch sehr viel mehr
Darmkrebsfälle verhindert werden“, sagt Dr.
Susanne Weg-Remers. Sie leitet den
Krebsinformationsdienst des Deutschen
Krebsforschungszentrums.
Über die
Hälfte der Erwachsenen im Alter ab 50 Jahren hat
in Deutschland innerhalb der letzten zehn Jahre
eine Koloskopie in Anspruch genommen (52,6 %);
etwa 15 % zur Früherkennung, der überwiegende
Anteil zur Abklärung von Beschwerden. Als
nachteilig wird der relativ hohe Aufwand, vor
allem auch bei der Vorbereitung (Darmreinigung
am Vorabend) empfunden. Zudem besteht ein sehr
geringes Risiko von Komplikationen bei der
Untersuchung.
„Ich möchte alle
Menschen ausdrücklich dazu ermutigen, eine
Darmspiegelung in Anspruch zu nehmen. Auch wenn
der Gedanke daran zunächst abschreckend wirken
mag, ist es eine wichtige und effektive Maßnahme
zur Vorsorge und Früherkennung von ernsthaften
Erkrankungen“, betont Stefan Schwartze.
Informieren und dann? Neben den Vorteilen der
Früherkennung können mit ihr auch Nachteile und
Belastungen verbunden sein. Keine Methode ist
hundertprozentig zuverlässig: Fehlalarm und
Überdiagnose kommen vor und führen zu
weitergehenden Untersuchungen und unter
Umständen sogar Krebstherapien.
Auch
wenn eine frühe Diagnose die Aussicht auf
Heilung erhöht, eine Garantie für Heilung bietet
sie nicht. Neutrale, wissenschaftlich
abgesicherte und gut verständliche Informationen
können bei der Entscheidung für oder gegen eine
Krebsfrüherkennungsmaßnahme helfen.
Umfassende Informationen bieten:
Krebsinformationsdienst:
Krebsvorsorge und Krebsfrüherkennung
Bundesministerium für Gesundheit:
Krebsfrüherkennung
Früherkennung kann
Leben retten Eine regelmäßige Teilnahme an
Früherkennungsuntersuchungen erhöht die Chancen
für den Einzelnen, dass eine Krebserkrankung
geheilt werden kann – da sie rechtzeitig
entdeckt wurde. Und für das neue Jahr: Eine
gesunde Ernährung und Bewegung fördern die
Gesundheit zusätzlich!
Land
NRW und RVR unterzeichnen Regionale
Kulturstrategie Ruhr / Sechs Millionen Euro
jährlich für neue und bewährte Projekte
In der Folge der Kulturhauptstadt Europas
RUHR.2010 hatten das Land NRW und der
Regionalverband Ruhr (RVR) eine
Nachhaltigkeitsvereinbarung geschlossen, um die
positive Entwicklung zu verstetigen. Jetzt haben
das NRW-Kulturministerium und der RVR eine
Folgevereinbarung unterzeichnet. Mit der
Regionalen Kulturstrategie Ruhr stellen das Land
und der Regionalverband Ruhr gemeinsam sechs
Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung, um neue
Impulse für die regionale Entwicklung zu setzen
und bewährte Strukturen, Netzwerke und Projekte
für die Zukunft zu sichern.
Der RVR
nimmt eine zentrale Rolle in der
Kulturkoordination im Ruhrgebiet ein und
verantwortet Aufgaben im Bereich Vernetzung und
Förderung sowie der Initiierung und Umsetzung
von regionalen Kooperationsprojekten. "Mit der
Regionalen Kulturstrategie Ruhr unterstützen wir
die weitere Vernetzung von Kulturorten, die zum
Markenkern des Kulturstandorts Ruhrgebiet
gehört", so NRW-Kulturministerin Ina Brandes.

RVR-Regionaldirektor Garrelt Duin: "Schon
heute prägen etablierte Netzwerke wie die
RuhrKunstMuseen oder die RuhrBühnen das
Ruhrgebiet als wichtigen Kunst- und
Kulturstandort. Wir freuen uns sehr über das
Vertrauen in die kulturellen Potenziale der
Region und die finanzielle Unterstützung durch
das Land Nordrhein-Westfalen."
Die
Regionale Kulturstrategie Ruhr umfasst mehrere
Projekte und Initiativen: Die Kulturkonferenz
Ruhr wird durch den RVR als Plattform für den
kulturpolitischen Dialog fortgeführt und um
weitere unterjährige Formate ergänzt. Die
Aktivitäten zur kulturellen Vernetzung der
Region werden gestärkt. In diesem Rahmen
übernimmt der RVR eine moderierende,
koordinierende bzw. fördernde Funktion. Das
Förderprogramm Kreativ.Quartiere Ruhr des
NRW-Kulturministeriums wird ab dem Jahr 2026 vom
RVR umgesetzt.
Der Emscherkunstweg
wird als Kooperation von Emschergenossenschaft
und Regionalverband Ruhr mit Blick auf die IGA
2027 fortgeführt. Das Förderprogramm von
Interkultur Ruhr wird ausgebaut und um
Stipendien ergänzt. Die Sichtbarkeit des
Projektes soll durch ein Festivalformat, das in
Kooperation mit Akteurinnen und Akteuren der
Region entwickelt wird, ausgebaut werden.
Die Förderung der Urbanen Künste Ruhr als
eigenständige Programmsäule der Kultur Ruhr GmbH
wird fortgesetzt. Die Ruhr Tourismus GmbH (RTG)
bleibt zuständig für die Entwicklung eines
eigenständigen kulturtouristischen Profils für
das Ruhrgebiet. Sie wird sich dabei stärker auf
die Ansprache neuer und junger Zielgruppen
fokussieren. Die Event-Formate ExtraSchicht und
Tag der Trinkhallen werden weiterentwickelt. idr
Wesel: Ein Dach, das schützt und Sonne
speichert – Neues PV-Carport am
Energie-Innovationsstandort Gesamtschule Am
Lauerhaas
Wer Strom mit erneuerbaren
Energien selber produziert, spart Geld und
schont die Umwelt. An der Gesamtschule Am
Lauerhaas steht seit diesem Jahr ein neuartiges
Photovoltaik-Carport. 28 Stellplätze stehen zur
Verfügung, die gleichzeitig – unabhängig davon,
ob ein Auto dort parkt oder nicht – Strom
erzeugen. Das Dach des Carports dient als
Solarfläche. Der Standort eignet sich gut, da
der Bereich so gut wie gar nicht verschattet
wird.

Der neue Strom produzierende Unterstand reiht
sich in eine Reihe von Maßnahmen zur
Stromerzeugung am Standort der Gesamtschule Am
Lauerhaas. Dort gibt es bereits mehrere
Photovoltaikanlagen auf dem Schulgebäude. Zudem
erzeugt eine schuleigene Windkraftanlage Strom.
Die neue Anlage hat rund 180.000 Euro gekostet.
Eröffnung der Ausstellung
„Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge der
Polizei NRW“
Im Rahmen des 50.
Jubiläumsjahres des Kreises Wesel findet von
Mittwoch, 15. Januar, bis zum 17. Februar 20205
Ausstellung „Zentrum für ethische Bildung und
Seelsorge in der Polizei NRW“ im Foyer des
Weseler Kreishauses statt.
Zur
Eröffnung am Dienstag, 14. Januar 2025, um 18:00
Uhr im Kreishaus-Foyer lädt Landrat Ingo Brohl
herzlich alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger ein. Neben Landrat Ingo Brohl sind auch
Vertreter von Polizei, Kreisverwaltung und
Politik eingeladen.
Lina und Noah sind die beliebtesten Babynamen
Die beliebtesten Babynamen 2024 in
Moers sind Lina und Noah. Eltern haben sie im
vergangenen Jahr 20-mal und 19-mal vergeben. Auf
Platz zwei und drei liegen bei den Mädchen Emma
(17) und Malia (16) sowie Adam (17) und Milan
(16) bei den Jungen.
Lina war bereits
2023 beliebteste Vorname. Bei den Jungen war es
Emil. Insgesamt hat das Moerser Standesamt im
vergangenen Jahr 2.348 Geburten beurkundet. Für
das Jahr 2023 waren es noch 2.399
Geburtsanmeldungen.
Moers:
Spieleabend Du hast Lust mal wieder zu zocken?
Aber nicht am PC, sondern gemütlich
bei uns in der Kneipe? Dann komm zu unserem
offenen Spieleabend. Egal ob Brett-, Karten-
oder Rollenspiele – Hier bist du richtig! Als
Spieleerklärer und Tippgeber steht euch unser
Spiele-Experte Nöh mit Rat und Tricks zur Seite!
Veranstaltungsdatum 09.01.2025 - 20:30
Uhr - 22:30 Uhr. Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107. 47441 Moers.
Moers:
Erstes Reparatur-Café im neuen Jahr am 15.
Januar
Reparieren statt neu kaufen
schont Umwelt und Geldbeutel gleichermaßen. Beim
nächsten Reparatur-Café in St. Ida/Rheinkamp
(Eicker Grund 102) am Mittwoch, 15. Januar,
helfen Ehrenamtliche den Besitzerinnen und
Besitzer von beschädigten Dingen aus den
Bereichen Elektro, IT, Schneiderei, Fahrrad und
Holzarbeiten bei der Instandsetzung. Das Angebot
läuft von 16 bis 18.30 Uhr. Dazu gibt es Kaffee
und Kuchen.
Das Reparatur-Café ist eine
Kooperation des Quartierzentrums AWO-Caritas mit
der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus
und KoKoBe Moers. Weitere Infos gibt es
telefonisch unter 0 28 41/8 87 86 06 sowie per
E-Mail unter tanja-reckers@caritas-moers-xanten.de
Moers:
Senatorenball
Die 1. Große
Grafschafter Karnevalsgesellschaft "Fidelio"
1951 e.V. veranstaltet einen Senatorenball im
Kulturzentrum Rheinkamp.
Veranstaltungsdatum 11.01.2025 - 18:30
Uhr - 12.01.2025 - 03:00 Uhr. Veranstaltungsort
Kopernikusstraße 9, 47445 Moers. Veranstalter
GGKG Fidelio Moers Adresse Am Geldermannshof 1,
47443 Moers.
Moers: Harold
und Maude
- Von: Colin Higgins
Der
neunzehnjährige Harold hat eine große
Ingenieursbegabung und nutzt diese für sein
noch größeres Interesse am Morbiden. Aus dem
Internat geworfen, besucht er in seiner
übermäßig vorhandenen Freizeit Schrottplätze
und Beerdigungen und schafft sich als Gefährt
einen Leichenwagen an. Um von seiner
egozentrischen Mutter Gefühlsreaktionen zu
erhalten, konstruiert er aufwendige
Vorrichtungen, mit denen er verschiedenste
Suizid-Szenarien fingiert.

(Foto: Schlosstheater Moers)
Die Mutter
weiß sich nur noch mit einem Psychoanalytiker
und einer Dating-Plattform zu helfen. Harold
soll heiraten und normal werden. Während er die
Versuche der Mutter spektakulär mit seiner
Trickkiste sabotiert, begegnet er auf einer
Beerdigung der lebensfrohen und energischen
Maude. Kurzerhand befindet sich Harold inmitten
der Abenteuer der fast achtzigjährigen
Ex-Aktivistin und erfährt so die Möglichkeiten
des Lebens. Bald wird aus einer Freundschaft
eine Liebesgeschichte.
Eintritt: 22
Euro, ermäßigt 8 Euro Tickets unter: Tel.: 0 28
41 / 8 83 41 10 oder www.schlosstheater-moers.de
Veranstaltungsdatum 11.01.2025 - 19:30
Uhr - 21:15 Uhr .Veranstaltungsort
Schlosstheater - Kapelle Rheinberger Straße 14,
47441 Moers
Moers: Es rappelt
im Karton
- Dita Zipfel und
Finn-Ole Heinrich
Wer Heike für ein
gewöhnliches Glühwürmchen hält, irrt sich
gewaltig. Vielmehr ist Heike eine Leuchtkäferin
mit himmelsstürmenden Absichten: Sie will
fliegen lernen! Dumm nur, dass bei Leuchtkäfern
ausschließlich die Männchen mit Flügeln auf die
Welt kommen. Heikes bester Freund, der Frosch
Robert-Robert, hat ebenfalls beschlossen, den
Regeln der Natur nicht mehr zu folgen.
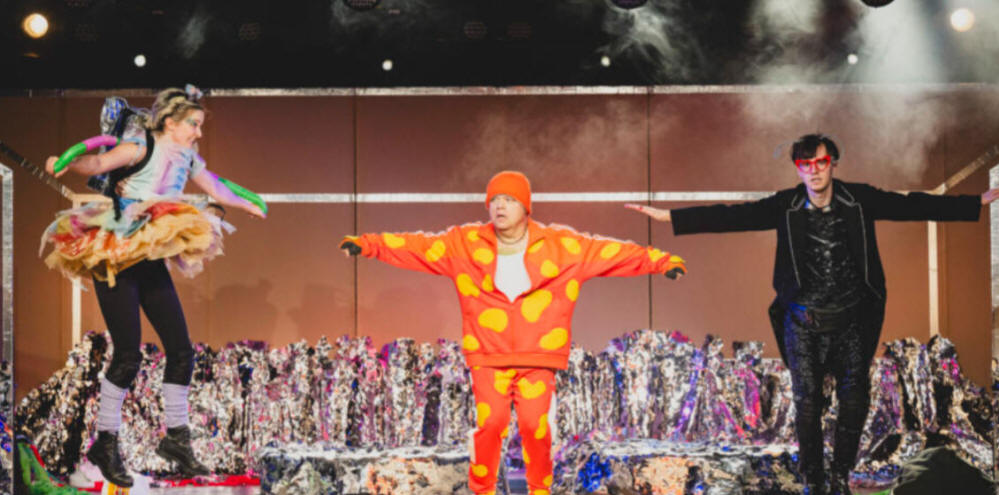
Seine beste Freundin fressen? Niemals!
Lieber stellt er seine Ernährung um und lebt
fortan als Vegetarier. Dieses tolle Team könnte
so viel erreichen, wenn sie nicht plötzlich in
eine missliche Lage geraten würden: Gefangen in
einem Pappkarton, zusammen mit der seltsamen
Fliege Jack. Wo sind sie? Wie kommen sie wieder
heraus? Jack findet zur Erleuchtung,
Robert-Robert findet die Situation eigentlich
ganz gemütlich und Heike findet zu ihrer Mission
als Revoluzzerin. Was ist die Freiheit wert,
wenn andere unfrei sind? Wie weit würden wir für
Freundschaft gehen oder fliegen?
Eintritt: 10 Euro, ermäßigt: 5 Euro Anmeldung
unter 0 28 41 / 88 34-110 oder www.schlosstheater-moers.de
Veranstaltungsdatum 12.01.2025 - 15:00
Uhr - 16:00 Uhr. Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107, 47441 Moers.
Das
"Geleucht"
Hoch über Moers thront
auf der Halde Rheinpreußen das größte
Montankunstwerk weltweit: das „Geleucht" von
Otto Piene. Die Aussichtsplattform der riesigen
Grubenlampe bietet „Himmelsstürmern" imposante
Ausblicke tief ins Ruhrgebiet und den
Niederrhein. Die 2-stündige, 3,5 km lange Tour
lohnt besonders in einer Vollmondnacht, wenn
Teile der Halde in glutrotes Licht eintauchen.

Diese Führung begleitet Karl Brand.
Treffpunkt: Clubhaus der Freien Schwimmer
(Römerstraße 790) Hinweis: Gute Kondition /
festes Schuhwerk erforderlich. Auf Anfrage
weitere Gruppentouren bei Tag & Nacht.
Weitere Infos zu den Stadtführungen.
Kosten: 8 Euro. Veranstaltungsdatum 12.01.2025 -
18:30 Uhr - 20:30 Uhr. Veranstaltungsort
Clubhaus der Freien Schwimmer Rheinkamp, Adresse
Römerstraße 790, 47443 Moers.
Nachtwächterführung
Wer Moers aus ganz
anderer Perspektive kennenlernen möchte,
begleite uns auf dieser abendlichen Führung.
Wandeln Sie auf den Spuren der Nachtwächter der
ehemals befestigten Stadt. Lassen Sie nach
Einbruch der Dunkelheit die Geschichte von Moers
wieder lebendig werden – und lauschen Sie
spannenden Erzählungen aus früheren Zeiten.
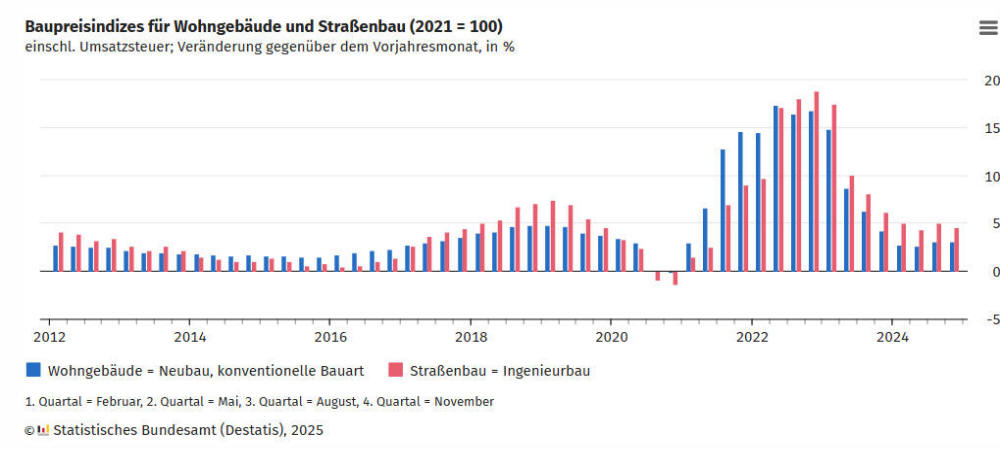
Diese Führung begleitet Erika Ollefs.
Treffpunkt: Denkmal Friedrich I. Neumarkt
Weitere Infos zu den Stadtführungen Kosten:
8 Euro. Veranstaltungsdatum 12.01.2025 - 17:00
Uhr -19:00 Uhr. Veranstaltungsort Denkmal am
Neumarkt, 47441 Moers

Dry January: 50 % weniger Alkohol im
Januar 2024 gekauft als im Dezember 2023
Im Januar 2024 lag der Absatz von Alkohol 32,0 %
unter dem Jahresdurchschnitt 2023 WIESBADEN –
Mit Aktionen wie dem Dry January (trockener
Januar) oder dem Veganuary (veganer Januar) hat
der Konsum von Alkohol und Fleisch im Januar
über die letzten Jahre spürbar abgenommen. Das
zeigt sich auch im Einkaufsverhalten vieler
Menschen an den Kassen großer Supermarktketten.
Im Januar 2024 wurde 49,7 % weniger
Alkohol gekauft als im Dezember 2023, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von
Scannerdaten aus dem Lebensmitteleinzelhandel
mitteilt. Der Absatz von Fleisch ging im selben
Zeitraum um 29,4 % zurück. Gegenüber dem
Jahresdurchschnitt 2023 fiel der Absatz von
Alkohol im Januar 2024 um 32,0 % geringer aus,
der Absatz von Fleisch war 12,5 % niedriger als
im Jahresschnitt 2023.
Nach der Völlerei
in der Advents- und Weihnachtszeit treten viele
Menschen beim Konsum von Süßem zum Start ins
neue Jahr offenbar noch stärker auf die Bremse:
Im Januar 2024 wurden weniger als halb so viele
Süßigkeiten wie Schokolade oder Kekse gekauft
als im Dezember 2023 (-59,6 %). Zum Vergleich:
Gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2023 ging der
Absatz von Süßigkeiten im Januar 2024 um 42,5 %
zurück.
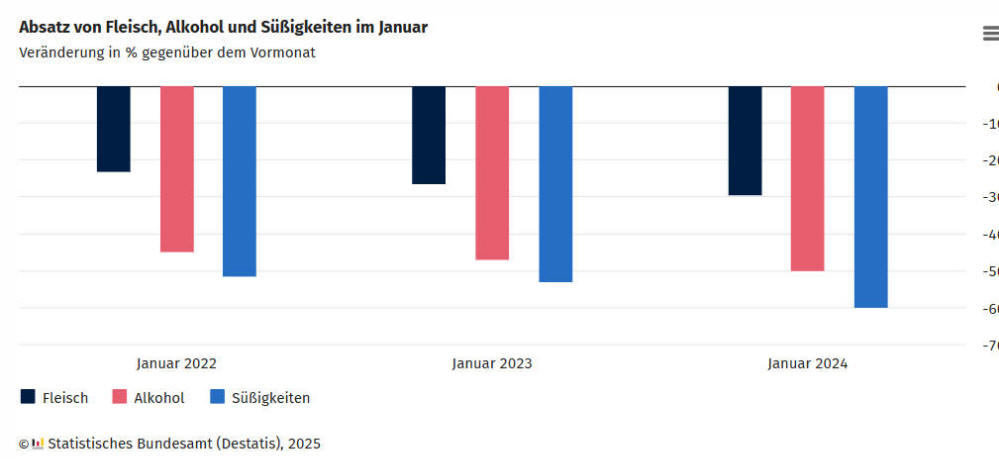
Dass im Januar viele auf Alkohol,
Süßigkeiten oder Fleisch verzichten, ist ein
relativ stabiles Muster im Konsumverhalten, das
sich in den letzten Jahren weiter verstärkt hat.
So war der Einbruch des entsprechenden Konsums
bereits im Januar 2023 und im Januar 2022
deutlich ausgefallen. Zum Jahresbeginn 2024
zeigte er sich jedoch noch stärker als in den
beiden Jahren zuvor.
Zum Vergleich:
Zum Jahresbeginn 2023 waren 46,9 % weniger
Alkohol, 26,1 % weniger Fleisch und 52,7 %
weniger Süßigkeiten gekauft worden als im
Dezember davor. Januar der absatzschwächste
Monat bei Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch,
Dezember der absatzstärkste Monat Mit dem
Advent, Weihnachten und Silvester sowie den
dazugehörigen Feierlichkeiten und Familienfesten
ist der Dezember traditionell der Monat mit dem
höchsten Absatz an Alkohol, Süßigkeiten und
Fleisch: Im Dezember 2023 verkauften Supermärkte
24,0 % mehr Fleisch, 35,3 % mehr Alkohol und
42,4 % mehr Süßigkeiten als im
Jahresdurchschnitt 2023.
Demgegenüber war der Januar 2023 der
absatzschwächste Monat des Jahres 2023: Der
Absatz von Fleisch lag 12,5 % unter dem
Jahresschnitt, der von Alkohol 26,8 % und der
von Süßigkeiten 34,8 %. Neben Neujahrsvorsätzen
können auch andere Faktoren wie Kalendereffekte
oder saisonale Schwankungen durch das Ausbleiben
feierlicher Anlässe sowie die Entwicklung der
Verbraucherpreise beim Absatz im
Lebensmitteleinzelhandel eine Rolle spielen.
NRW-Ausbaugewerbe 2023: Zahl der
Beschäftigten auf höchstem Stand seit 2012
Mitte des Jahres 2024 waren in den 5 467
Betrieben des nordrhein-westfälischen
Ausbaugewerbes insgesamt 137 663 Personen
beschäftigt. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als statistisches Landesamt
mitteilt, sank die Zahl der Betriebe gegenüber
dem Vorjahr um 21 (−0,4 Prozent). Die Zahl der
Beschäftigten erhöhte sich um 274 (+0,2 Prozent)
und ist damit auf dem höchsten Stand seit dem
Jahr 2012. Damals waren im Ausbaugewerbe noch 97
521 Personen beschäftigt.
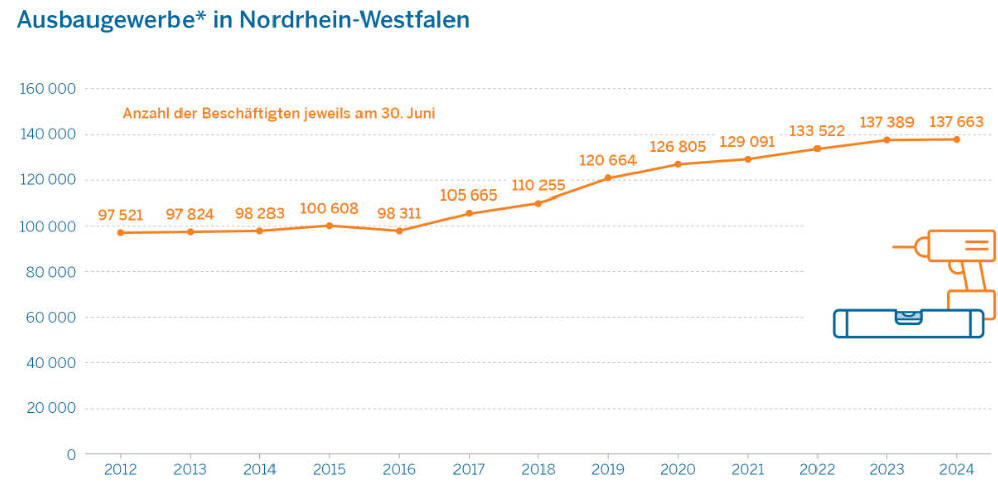
Nominaler Umsatz im letzten Jahr über zehn
Prozent gestiegen – im Vergleich zu 2012 mehr
als verdoppelt Der nominale ausbaugewerbliche
Umsatz (Umsatz aus Bauleistungen) lag im Jahr
2023 mit rund 20,4 Milliarden Euro (+10,8
Prozent) über dem Vorjahresniveau. Der
Pro-Kopf-Umsatz erhöhte sich 2023 um 14 152 Euro
(+10,5 Prozent) auf 148 457 Euro je
Beschäftigten (2022: 134 305).
Der
Gesamtumsatz (einschl. Handels- und sonstiger
Umsätze) des NRW-Ausbaugewerbes war mit 20,7
Milliarden Euro um 10,6 Prozent höher als ein
Jahr zuvor (2022: 18,7 Milliarden Euro). Im
Vergleich zu 2012 ist der Gesamtumsatz um 98,3
Prozent gestiegen. Der Pro-Kopf-Umsatz hat sich
in diesem Zeitraum um 43 861 Euro erhöht (+41,9
Prozent).
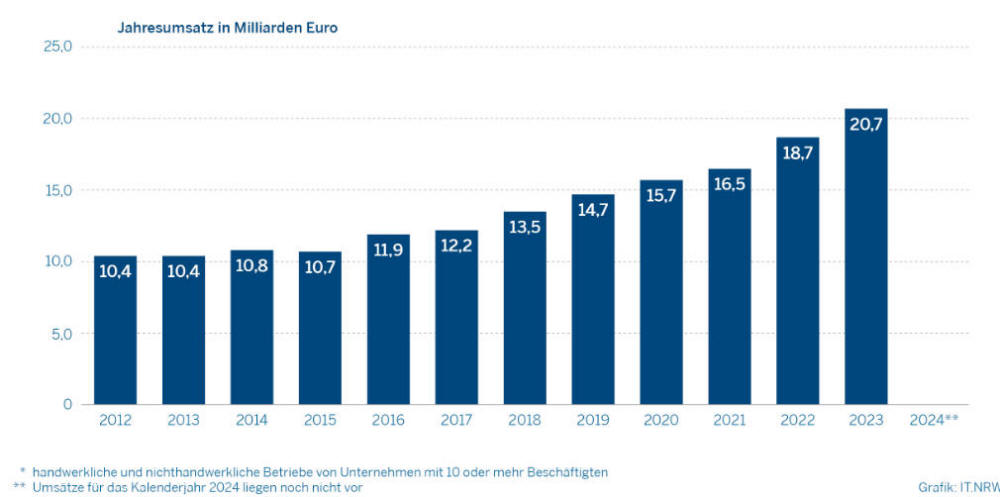
Dienstag, 7.
Januar 2025
A40: Vollsperrung im
Bereich des Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg
in beiden Fahrtrichtungen
Von
Freitag (17.01.) um 21 Uhr bis Montag (20.01.)
um 5 Uhr wird die A40 im Bereich des
Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg in beiden
Fahrtrichtungen vollgesperrt. Im Zuge dieser
Sperrung werden Streifenfundamente für
Schutzsysteme als vorbereitende Baumaßnahme für
den anstehenden Neubau des Brückenbauwerks 2
hergestellt.
A3 beide Fahrtrichtungen:
Die Ausfahrt der A3 auf die A40 in Fahrtrichtung
Venlo ist gesperrt. Die Ausfahrt der A3 auf die
A40 in Fahrtrichtung Essen ist möglich. Die
Autobahn GmbH: Wir empfehlen, den gesperrten
Streckenbereich großräumig zu umfahren.
Bundestagswahl 2025: Am 2.
Februar endet die Antragsfrist für Deutsche im
Ausland
Am 2. Februar 2025 endet
die Frist für Deutsche im Ausland für die
Eintragung in das Wählerverzeichnis. Die
Eintragung ins Wählerverzeichnis ist
Voraussetzung, um an der Bundestagswahl am 23.
Februar 2025 teilnehmen zu können.
Regenwasserreinigung in Moers-Hülsdonk:
Finaler Bauabschnitt auf der Geldernschen Straße
läuft bis Ende März
Die ENNI
Stadt & Service Niederrhein (Enni) startet am
kommenden Montag, 13. Januar, in der
Geldernschen Straße die abschließenden
Bauarbeiten für eine moderne
Regenwasserreinigungsanlage in Moers-Hülsdonk.
Wie in der ersten Bauphase im Vorjahr muss
Projektleiter Knut Wiesten die Straße hierzu in
Höhe des Hauptfriedhofes noch einmal für rund
zwölf Wochen sperren.
„Der
Autoverkehr wird hierbei erneut über den
Taxusweg und den Parkplatz des Friedhofes
umgeleitet“, habe sich dies laut Wiesten im
Vorjahr bewährt. Auch während der jetzigen
Bauzeit bleibt der Parkplatz für Besucher der
umliegenden Geschäfte und des Friedhofs
zugänglich. Wie in einigen anderen Bereichen der
Stadt setzt Enni auch in der Geldernschen Straße
die gesetzlichen Auflagen zur Abwasserreinigung
im Zuge eines mit den Genehmigungsbehörden
abgestimmten Konzeptes baulich um.
Das hier zur Einleitung in den Hülsdonker
Flutgraben vorgesehene Regenwasser fließt diesem
Vorfluter an dieser Stelle von zwei Seiten zu.
Vor der Einleitung wird es zukünftig durch
technische und mechanische Vorrichtungen
gereinigt, um Verschmutzungen vom
Oberflächenwasser abzuhalten, Die
herausgefilterten Rückstände werden durch Enni
fachgerecht entsorgt.
Der finale
Bauabschnitt wird voraussichtlich Ende März
abgeschlossen sein. Wie bei allen Baumaßnahmen
hat Knut Wiesten die Planungen wieder eng mit
den zuständigen Stellen der Stadt Moers, der
Polizei, der Feuerwehr und der NIAG abgestimmt.
Busse können die Haltestelle auf dem
Friedhofsgelände weiter uneingeschränkt
anfahren. Fragen zur aktuellen Baustelle
beantwortet Enni wie gewohnt unter der Rufnummer
104600.
Moers: Erstes
Reparatur-Café im neuen Jahr am 15. Januar
Reparieren statt neu kaufen schont Umwelt und
Geldbeutel gleichermaßen. Beim nächsten
Reparatur-Café in St. Ida/Rheinkamp (Eicker
Grund 102) am Mittwoch, 15. Januar, helfen
Ehrenamtliche den Besitzerinnen und Besitzer von
beschädigten Dingen aus den Bereichen Elektro,
IT, Schneiderei, Fahrrad und Holzarbeiten bei
der Instandsetzung.
Das Angebot
läuft von 16 bis 18.30 Uhr. Dazu gibt es Kaffee
und Kuchen. Das Reparatur-Café ist eine
Kooperation des Quartierzentrums AWO-Caritas mit
der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus
und KoKoBe Moers. Weitere Infos gibt es
telefonisch unter 0 28 41/8 87 86 06 sowie per
E-Mail unter tanja-reckers@caritas-moers-xanten.de
Wie wir künftig heizen: Projekt
analysiert Umrüstung von bestehenden Gebäuden
Rund 80 Prozent der Heizenergie in
Deutschland stammt noch aus fossilen Quellen,
meist importierten Energieträgern wie Gas und
Öl.* Doch laut dem aktuellen
Wärmeplanungsgesetz sind Kommunen
verpflichtet, abhängig von der Einwohnerzahl bis
2026 bzw. 2028 einen Wärmeplan zu erstellen:
Womit kann künftig nachhaltig geheizt werden,
und wie kann das in der Praxis funktionieren? Im
Projekt KliWinBa schauen Forschende der
Universität Duisburg-Essen hier genauer hin.
Das Projekt Klimaneutrale Wärme in
industriell geprägten Ballungsräumen (KliWinBa)
wird geleitet von Prof. Dr. Christoph Weber vom
Lehrstuhl für Energiewirtschaft der Universität
Duisburg-Essen (UDE). Sein Team analysiert
bisherige Erfahrungen mit klimafreundlichen
Heizsystemen und untersucht exemplarisch die
Optionen in zwei Kommunen mit unterschiedlichen
Siedlungsstrukturen: das großstädtisch geprägte
Duisburg sowie Gevelsberg als urbanes Umfeld
mittlerer Größe.
Wie ist dort eine
verlässliche, bezahlbare und nachhaltige
Wärmeversorgung in bestehenden
Mehrfamilienhäusern sicherzustellen?
Dazu
untersuchen die Forschenden die
Rahmenbedingungen in unterschiedlichen
Stadtteilen und bei verschiedenen Arten von
Immobilien: Sie bewerten Technologieoptionen,
vergleichen Umbauzeiten, berechnen Emissionen
und die Leistung der verschiedenen Heizvarianten
unter normalen Bedingungen und bei hohen
Belastungen durch sehr kalte Wintertage.
Geförderte Projektpartner sind das
Wohnungsunternehmen Vonovia sowie die AVU
Serviceplus GmbH. Gemeinsam mit den assoziierten
Partnern Netze Duisburg, Stadtwerke Duisburg und
Bosch Home Comfort bringen sie nicht nur
relevante Daten, sondern auch ihre praktischen
Erfahrungen ein, bewerten Ergebnisse und
unterstützen die Entwicklung praxisnaher
Lösungen für die Analysen an der UDE.
Das Team um Christoph Weber erarbeitet
daraus ein Analyseraster, das bei der
Entscheidung hilft: Sind
Hochtemperatur-Wärmepumpen, Wärmenetze mit
Kraftwärmekopplung, Power-to-Heat-Anlagen und
Speicher oder tiefengeothermische Ressourcen im
konkreten Fall umsetzbar und ökonomisch
vorteilhaft? „Siedlungen mit
Mehrfamilienhäusern, speziell in urbanen Räumen,
benötigen tendenziell größere Heiztechnologien,
bieten aber nicht unbedingt den Platz dafür, und
teure Technologien sind in Gegenden mit
niedrigen Immobilienpreisen nicht ohne weiteres
zu finanzieren“, erklärt Weber einige der
Aspekte, die in die Studie einfließen.
Mit ihren Analysen wollen die Projektpartner
Immobilieneigentümer:innen, Planer:innen sowie
Netz- und Anlagenbetreiber bei ihren
Investitionsentscheidungen unterstützen. Zudem
erhalten Kommunen und andere staatliche Behörden
konkrete Empfehlungen, wie sie ihre Regularien
anpassen und Förderbedingungen definieren
sollten, damit der grundlegende Umbau auf
nachhaltige Wärme flächendeckend und zügig
gelingt. Das Projekt ist angelegt auf drei Jahre
und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz (BMWK) mit rund 596.000 Euro
gefördert; davon gehen rund 455.000 Euro an die
UDE. *
Quelle:
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen
Geldern: Fröhlicher Wettstreit und
musikalische Klage: Dreikönigskonzert des
Collegium Musicum - So., 12.01.2025 - 18:00 -
20:00 Uhr
Mit dem festlichen „Einzug der Königin von Saba“
aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Salomo“
eröffnet das Collegium Musicum sein
traditionelles Dreikönigskonzert. Am Sonntag,
dem 12. Januar 2025, spielt das Orchester um 18
Uhr unter der Leitung von Johannes Feldmann in
der Christus-König-Kirche.

Weltberühmt wurde der barocke Königinnen-Einzug
spätestens durch die Olympischen Spiele 2012:
Anlässlich der Londoner Eröffnungsfeier
geleitete James Bond alias Daniel Craig die
englische Königin Elisabeth II. aus dem
Buckingham Palace zu ihrem Helikopter –
untermalt von Händels strahlender
Orchestermusik.
Als langjährige
Konzertmeisterin verleiht die Bonner Geigerin
Marie-Luise Hartmann dem Streicherklang des
Collegium Musicum einen besonderen Glanz.
Gemeinsam mit dem Oboisten Lourens Kujper, der
in Amsterdam und Köln studierte und in namhaften
niederländischen Orchestern mitwirkte, musiziert
sie Johann Sebastian Bachs farbenfrohes
Doppelkonzert für Violine und Oboe d-moll BWV
1060.
Einen fröhlichen musikalischen
Wettstreit liefert sich die Sologeige mit
verschiedensten Bläsersolisten und dem Orchester
in Bachs Brandenburgischem Konzert Nr. 1 F-Dur.
Neben Oboen und Fagotten kommen darin auch zwei
Hörner mit virtuosen Solopartien zur Geltung.
Ganz andere Welten lotet der Romantiker Max
Bruch in seinem hochemotionalen Stück „Kol
Nidrei“ für Solocello und Orchester aus.
Inspiriert hatte den protestantischen
Komponisten das jüdische Gebet Kol Nidre, das am
Vorabend des Feiertags Jom Kippur gebetet wird.
Solistin dieser traumhaft schönen Klage ist
Mirjam Hardenberg. Das ursprünglich für
Sinfonieorchester komponierte Werk erklingt hier
in einer filigranen Streicherfassung.
Karten für das Dreikönigskonzert gibt es zum
Preis von 15 Euro in der Buchhandlung Hintzen
(Hagsche Str. 46), in der Apotheke Rhein-Waal
(im Edeka Brüggemeier, Ludwig-Jahn-Str. 7-15)
sowie an der Abendkasse. Für Kinder bis 12 Jahre
ist der Eintritt frei.
Kleve:
William Shakespeare - Was Ihr Wollt
Fr., 17.01.2025 - 18:00 - Fr., 17.01.2025 -
20:00 Uhr
Nach einem Schiffsunglück strandet
Viola an der Küste Illyriens; das Land des
Herzogs Orsino. Kurzentschlossen verkleidet sie
sich als Mann und bewirbt sich am Hofe Orsinos
als Diener. Dort verliebt sie sich heimlich in
ihn, während Orsino um die Zuneigung der schönen
Gräfin Olivia wirbt.
Doch Olivia
entbrennt in Liebe zu Viola – oder besser
gesagt, zu ihrer männlichen Verkleidung.
Währenddessen treiben die Bediensteten der
Gräfin mit ihrem Haushofmeister Malvolio ihr
Unwesen und sorgen dadurch nicht nur bei ihm für
Verwirrung.

Es spielt: Homo Dramaticus
Antonio Anouk
Altenstädter
Tobias von Rülp Alex Döhmen
Maria Ellen Döhmen
Malvolio Taimi Duismann
Olivia Ina Erdmann
Orsino Laureen Fuchs
Viola/Cesario Lia Giesen
Fabio/Hauptmann
Jonathan Lange
Curio/Gerichtsdiener Mareike
Oestreich
Sebastian Arne Peters
der Narr
Kai Przibyczin
Christoph von Bleichenwang Mo
Reckers
Regie: Yannis van Soest
Technik:
Lucas Hans
Kleve: Biberspuren
im Silberwald - Tour durch ein ganz besonderes
Naturschutzgebiet
Sa., 18.01.2025 -
13:00 - Sa., 18.01.2025 - 16:00 Uhr
Diese
Tour ist eine Erlebniswanderung durch eines der
schönsten Naturschutzgebiete am Niederrhein auf
niederländischer Seite: die Millingerwaard. Dort
gibt es mächtige Silberweiden und typische
Spuren des Bibers zu entdecken: durchgebissene
Gehölze, kunstvoll gestaltete Biberburgen sowie
ihre Ein- und Ausstiege aus Gewässern, die
sogenannten Biberrutschen.

Foto: Otto de Zoete
Leitung:
Niederrhein-Guide Christian Theunissen
Treffpunkt: vor dem Wilderniscafé "De Waard van
Kekerdom", Weverstraat 94, Kekerdom (NL)
Anmeldung: Tel.: 02821/7139880 oder
https://www.nabu-naturschutzstation.de/exkursionen-und-veranstaltungen/Mitbringen
Empfohlen werden lange Hosen und ein
langärmeliges Oberteil, feste Schuhe, die
schmutzig werden dürfen, Fernglas (soweit
vorhanden)

Inflationsrate im Dezember 2024
voraussichtlich +2,6 % Inflationsrate
Jahresdurchschnitt 2024 voraussichtlich +2,2 %
Verbraucherpreisindex, Dezember 2024: +2,6 %
zum Vorjahresmonat (vorläufig)
+2,8 % zum
Vorjahresmonat (vorläufig)
Die
Inflationsrate in Deutschland wird im Dezember
2024 voraussichtlich +2,6 % betragen. Gemessen
wird sie als Veränderung des
Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach
bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt,
stiegen die Verbraucherpreise gegenüber November
2024 um 0,4 %.
Im Jahresdurchschnitt
2024 wird die Inflationsrate voraussichtlich bei
+2,2 % liegen. Die Inflationsrate ohne
Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als
Kerninflation bezeichnet, beträgt im Dezember
2024 voraussichtlich +3,1 %.
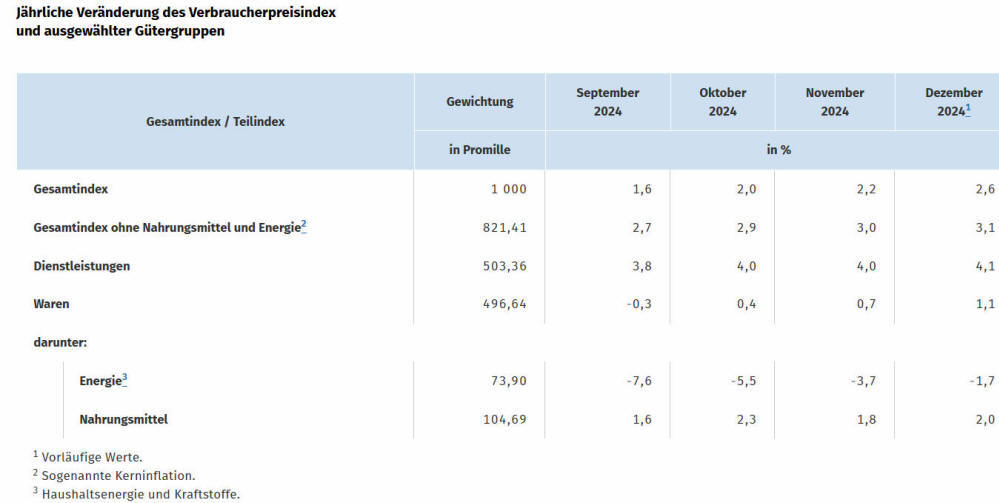
Inflationsrechner gibt Auskunft über
persönliche Inflationsrate:
Mit dem persönlichen
Inflationsrechner des Statistischen
Bundesamtes können Verbraucherinnen und
Verbraucher ihre monatlichen Konsumausgaben für
einzelne Güterbereiche entsprechend des eigenen
Verbrauchsverhaltens anpassen und eine
persönliche Inflationsrate berechnen.
NRW: Baupreise für Wohngebäude
erneut gestiegen
Die Baupreise für
Wohngebäude (Bauleistungen am Bauwerk) in
Nordrhein-Westfalen waren im November 2024 um
3,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Wie
Information und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt mitteilt, ist der
Baupreisindex im Vergleich zu August 2024 um
0,3 Prozent gestiegen. Preise für Rohbauarbeiten
um 2,7 Prozent gestiegen Für den Bau von
Wohngebäuden verteuerten sich die Rohbauarbeiten
im November 2024 gegenüber November 2023 um
2,7 Prozent.
Den stärksten
Preisanstieg um 7,1 Prozent gegenüber dem
Vorjahresmonat gab es in diesem Bereich bei
Gerüstarbeiten, gefolgt von Ramm-, Rüttel- und
Pressarbeiten, die um 5,2 Prozent teurer wurden.
Günstiger als im Jahr zuvor waren
Stahlbauarbeiten (−0,6 Prozent). Preise für
Ausbauarbeiten um 4,3 Prozent gestiegen Die
Preise für Ausbauarbeiten bei Wohngebäuden
stiegen im November 2024 gegenüber dem
Vorjahresmonat um 4,3 Prozent.
Wärmedämm-Verbundsysteme verzeichneten in diesem
Bereich den höchsten Preisanstieg mit
9,4 Prozent. Überdurchschnittlich mehr musste
u. a. auch für Beschlagarbeiten (+8,5 Prozent)
und Betonwerksteinarbeiten (+8,2 Prozent)
bezahlt werden. Die Preise für Rolladenarbeiten
(+1,0 Prozent), Bodenbelagsarbeiten
(+1,3 Prozent) und Naturwerksteinarbeiten
(+1,5 Prozent) stiegen im gleichen Zeitraum
unterdurchschnittlich.
Die Preise
für Aufzugsanlagen und Fahrtreppen
(−1,5 Prozent) waren leicht rückläufig. Auch die
Preise für Straßenbau, Außenanlagen und
Schönheitsreparaturen sind gestiegen Der
Straßenbau wies von allen Bauwerksarten mit
6,2 Prozent den höchsten Preisanstieg von
November 2023 bis November 2024 auf.. Weiter
verteuerten sich im genannten Zeitraum auch die
Preise für Außenanlagen für Wohngebäude
(+5,3 Prozent), Ortskanäle (+4,8 Prozent) und
Schönheitsreparaturen in Wohnungen
(+4,4 Prozent).
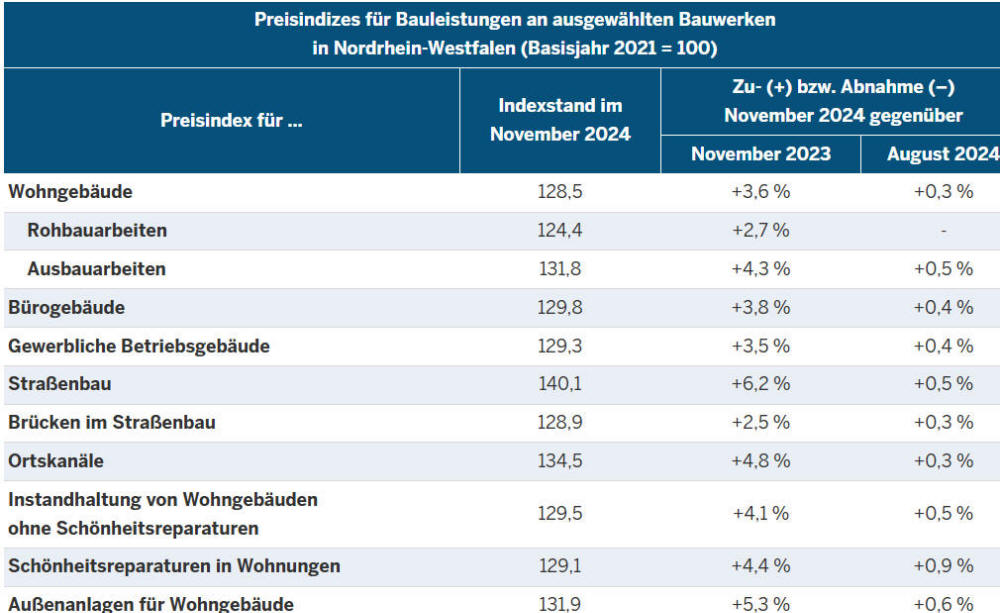
Montag, 6.
Januar 2025
Führerscheinservice in Moers und Wesel am 6. und
7. Januar geschlossen
Der
Führerscheinservice im Dienstleistungszentrum
Moers sowie in der Führerschein- und
Zulassungsstelle des Kreises Wesel steht am
Montag, 6. Januar 2025, und am Dienstag, 7.
Januar 2025, nicht zur Verfügung. Grund dafür
sind Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen der
Mitarbeitenden. Ab Mittwoch, 8. Januar 2025,
steht der Service wieder wie gewohnt zur
Verfügung.
Bund Bund
und Länder verbessern Finanzierung der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz“
Bundeskanzler Olaf Scholz und die
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten
der Länder haben sich im Umlaufverfahren auf ein
neues Finanzierungsabkommen für die Stiftung
Preußischer Kulturbesitz (SPK) geeinigt. Danach
werden Bund und Länder ihre jährlichen Beiträge
zur Finanzierung der SPK ab 2026 um insgesamt 12
Mio. € erhöhen, wovon der Bund 9 Mio. € tragen
wird.
Kulturstaatsministerin Claudia
Roth: „Das neue Finanzierungsabkommen ist ein
klares, parteiübergreifendes Bekenntnis von Bund
und Ländern zur größten deutschen
Kultureinrichtung. Damit stellen wir die SPK auf
eine solide finanzielle Grundlage und erreichen
ein wichtiges Ziel der laufenden Reform. Durch
die Mittelerhöhung stärken Bund und Länder auch
die Kulturlandschaft Berlins. Das ist gerade in
diesen Zeiten angespannter Länderhaushalte ein
wichtiges politisches Zeichen.
Jetzt
wäre es wichtig, dass das noch zum Ende des
Jahres in den Bundestag eingebrachte Gesetz zur
Reform der SPK, das gemeinsam mit den Ländern
erarbeitet wurde, dort nun auch eine ebenso
breite parteiübergreifende Unterstützung
bekommt. Dieses wichtige Gesetz kann und sollte
unbedingt noch in dieser Legislaturperiode
verabschiedet werden. Dafür werbe ich bei allen
demokratischen Fraktionen.“ Die SPK ist mit
ihren 25 Museen, Bibliotheken, Archiven und
Forschungsinstituten die größte
Kultureinrichtung Deutschlands und eine der
bedeutendsten weltweit.
Ihre
gesamtstaatliche Bedeutung zeigt sich auch in
der gemeinsamen Finanzierung von Bund und
Ländern. Dabei trägt der Bund drei Viertel der
laufenden Betriebskosten sowie die Baukosten in
vollem Umfang. In den vergangenen Jahren ist
jedoch auch deutlich geworden, dass die SPK ihr
Potenzial noch nicht in vollem Umfang
ausschöpfen kann und mit ihren herausragenden
Sammlungen noch erfolgreicher ein breites
Publikum hierzulande und weltweit ansprechen
könnte. Neben den bisherigen Strukturen der
Stiftung ist ein Grund hierfür das bislang noch
gültige Finanzierungsabkommen, das aus dem Jahr
1996 stammt und seitdem nicht angepasst wurde.
Nach einer Beteiligung der
Länderparlamente soll das neue
Finanzierungsabkommen bis zum 12. März 2025 vom
Bundeskanzler sowie den Ministerpräsidentinnen
und Ministerpräsidenten der Länder unterzeichnet
werden und zum 1. Januar 2026 in Kraft treten.
Das Finanzierungsabkommen ist Teil des
umfangreichen Reformprozesses, den Bund und
Länder gemeinsam mit der SPK angestoßen haben.
Das Bundeskabinett hat den Regierungsentwurf für
ein neues SPK-Gesetz am 13. November 2024
beschlossen. Dieses wurde bereits in den
Bundestag eingebracht.
Museum Kurhaus Kleve und Tiergarten Kleve
stellen offiziell Kombitickets vor
Tiergartenleiter Martin Polotzek und
Museumsdirektor Prof. Harald Kunde stellen die
Kombitickets vor. Tiergartenleiter Martin
Polotzek und Museumsdirektor Prof. Harald Kunde
stellen die Kombitickets vor. Tickets für einen
Besuch beider Einrichtungen sind ab 1.1.25 zum
Vorzugspreis von 14,90 € erhältlich.
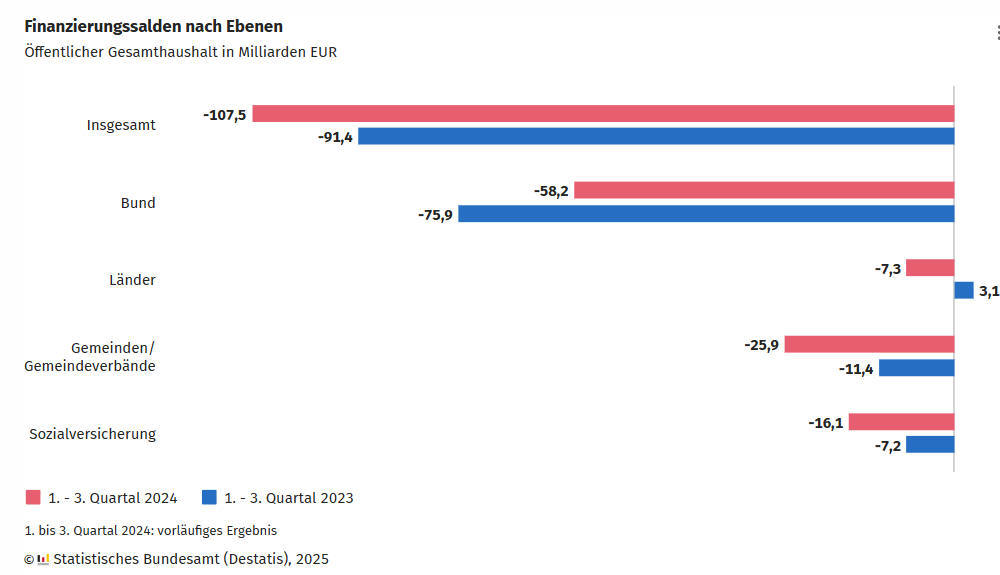
„Wir sind der Meinung, dass Kleve tierisch
vielfältig ist“, sagt Tiergartenleiter Martin
Polotzek beim offiziellen Pressetermin zur
Vorstellung der Kombitickets zwischen zwei der
beliebtesten Freizeiteinrichtungen in Kleve: Dem
Museum Kurhaus Kleve sowie dem Tiergarten Kleve.
„Daher freuen wir uns sehr, dass ab Januar 2025
Kombitickets für beide Einrichtungen zum
Vorzugspreis von 14,90 € erhältlich sein werden
und unseren Gästen rund 25 % Ersparnis bieten.“
Zunächst in einer Testphase werden
erstmals vom 01.01.2025 bis zum 30.06.2025
Kombitickets für die beiden Aushängeschilder
Kleves erhältlich sein. Für 14,90 € kann man
sich dann ein Ticket kaufen, mit dem man auch zu
verschiedenen Tagen innerhalb dieses Zeitraums
beide Einrichtungen einmal besuchen kann.
Erhältlich sind die Kombitickets ab Januar
sowohl an der Museums- als auch an der
Tiergartenkasse und sollen Kleve sowohl für die
Einheimischen als auch für die Touristen sowie
Tagesgäste noch attraktiver machen.
„Die tolle Zusammenarbeit zwischen unseren
beiden Einrichtungen sieht man nicht nur an den
Kombitickets“, so Museumsdirektor Prof. Harald
Kunde, „sondern beispielsweise auch an der
tollen Aktion zur Mataré-Eröffnung, bei der uns
der Tiergarten mit zwei Alpakas besucht und
sogar die Ministerin Brandes begeistert hat.
Außerdem ragen unsere Gemeinsamkeiten auch weit
bis zu Johann Moritz von Nassau Siegen zurück,
dessen Tierillustrationen südamerikanischer
Tiere wir hier im Museum deponiert haben und die
der Tiergarten im Rahmen des geplanten
Südamerikahauses zukünftig halten möchte.“
Beide Einrichtungen an der
Tiergartenstraße versprechen diesen Winter einen
tierisch tollen Tag, denn das Museum Kurhaus
Kleve zeigt noch bis zum 9. März 2025 die
Ausstellung „Ewald Mataré: KOSMOS“, in der über
600 Kunstwerke Matarés zu sehen sind, von denen
sicherlich mehr als die Hälfte Tiere darstellen.
Das Museum hat dafür täglich (außer
montags) von 11-17 Uhr geöffnet. Auch der
benachbarte Tiergarten Kleve ist ein lohnendes
Ausflugsziel im Winter und begeistert seine
Gäste täglich von 9 bis 17 Uhr mit über 300
Tieren, darunter auch Besucherliebling Faultier
Carlo sowie die neuen Rentiere. Weitere
Informationen unter www.tiergarten-kleve.de und
www.mkk.art
Moers: Weitere Veranstaltung der Reihe
„Campus-Café“ am 08. Januar 2025
Austausch, Information und Beisammensein für
pflegende An- und Zugehörige Am 08. Januar
2025 geht es in die nächste Runde des
„Campus-Cafés“ im Krankenhaus Bethanien Moers.
Zur Veranstaltung, die alle zwei Monate jeden
zweiten Mittwoch von 16 bis 18 Uhr stattfindet,
laden die Organisator:innen alle pflegenden
Zugehörigen herzlich in die Bethanien Akademie
(Bethanienstraße 15, 47441 Moers) zu Austausch,
Kaffee und Kuchen ein.
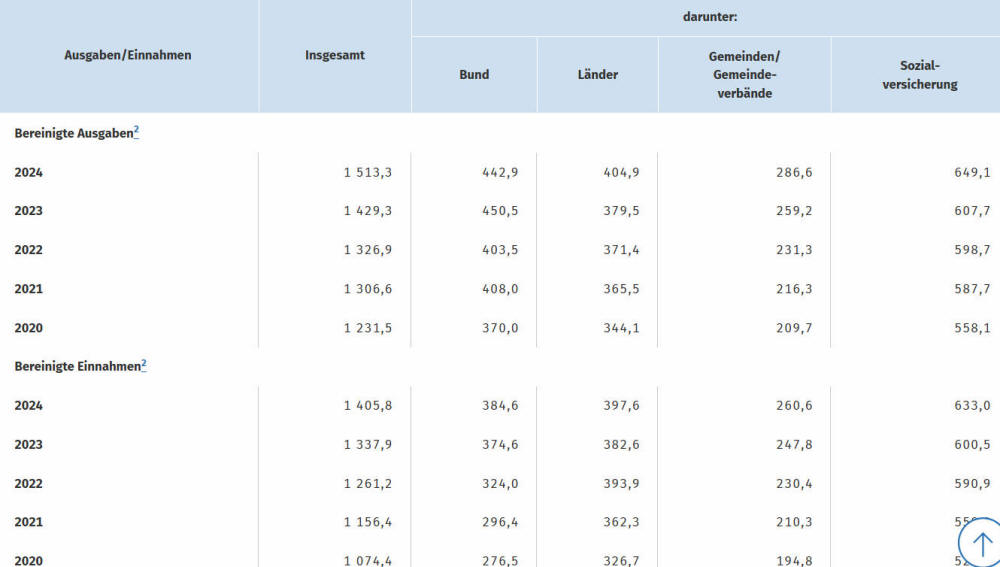
Das Krankenhaus Bethanien Moers lädt am 08.
Januar 2025 zum zweiten Termin der
Veranstaltungsreihe „Campus-Café“ ein.
Am zweiten Termin des „Campus-Cafés“
geht es um das Thema „Erkältung & Co. – Kinder
gut durch den Winter bringen“. Dr. Sarah
Czerwinski von der Klinik für Kinder- &
Jugendmedizin spricht in ihrem Vortrag über
Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Kind gut durch die
Infektzeit begleiten und der Endlosschleife rund
um Erkältung und Schnupfen entkommen können.
An einem weiteren Termin am 12. März
2025 dreht sich alles um die „Möglichkeiten der
mobilen Sauerstoffversorgung auf Reisen.“
Um vorherige Anmeldung zur jeweiligen
Veranstaltung wird gebeten unter
campuscafe@bethanienmoers.de oder
telefonisch unter +49 (0) 2841 200 2338 bzw. +49
(0) 2841 200 20420.
Frauen in Aufsichtsräten: Neue EU-Regeln für
ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis sind
in Kraft
Die EU-Regelung über die
ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in
Leitungsorganen von börsennotierten Unternehmen
ist Ende 2024 in allen Mitgliedstaaten in Kraft
getreten. Hadja Lahbib, EU-Kommissarin für
Gleichstellung, Vorsorge und Krisenmanagement,
bezeichnete die Richtlinie als bedeutenden
Meilenstein.
„Ich werde Folgemaßnahmen
ergreifen, um sicherzustellen, dass diese
wichtigen Rechtsvorschriften von den
Mitgliedstaaten ordnungsgemäß umgesetzt und
sorgfältig angewandt werden. Gemeinsam können
wir die gläserne Decke durchbrechen.“
Geschlechtergerechtigkeit bedeutet Fairness
für alle In der Richtlinie wird für große
börsennotierte Unternehmen in der EU ein Ziel
von 40 Prozent des unterrepräsentierten
Geschlechts unter ihren nicht geschäftsführenden
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern und von 33
Prozent unter allen
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern festgelegt.
Da Frauen im EU-Durchschnitt nur 33
Prozent der Mitglieder in den Leitungsorganen
börsennotierter Unternehmen vertreten, wird dies
in der Praxis dazu beitragen, den Anteil von
Frauen in diesen Führungspositionen zu erhöhen.
Die Frist für die Umsetzung durch die
Mitgliedstaaten endete am 28. Dezember 2024, die
Unternehmen müssen die Ziele bis zum 30. Juni
2026 erreichen.
Mehr
Chancengleichheit in allen Lebensbereichen
Bisher müssen die Mitgliedstaaten unter anderem
Vorschriften über spezifische verbindliche
Maßnahmen für das Auswahlverfahren für
Verwaltungsratsmitglieder mit transparenten und
geschlechtsneutralen Kriterien und die
Offenlegung von Qualifikationskriterien auf
Antrag eines nicht erfolgreichen Bewerbers
umgesetzt haben.
Im November
2012 hat die Kommission die Richtlinie über
ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in den
Leitungsorganen von Unternehmen vorgeschlagen.
Nach zehnjährigen Beratungen erzielten das
Europäische Parlament und der Rat im Juni
2022 eine politische Einigung. Die
Kommission wird die Mitteilungen der
Mitgliedstaaten über ihre Umsetzungsmaßnahmen
prüfen und begutachten, ob diese Maßnahmen den
Bestimmungen der Richtlinie ordnungsgemäß
folgen. Die Kommission unterstützte die
Mitgliedstaaten bei der Gewährleistung der
ordnungsgemäßen Umsetzung in nationales Recht,
beispielsweise durch Workshops und bilaterale
Konsultationen.
Strategischer Dialog über die Zukunft der
europäischen Automobilindustrie beginnt im
Januar
Der Strategischen Dialog
über die Zukunft der Automobilindustrie in
Europa wird bereits im kommenden Monat offiziell
starten. Bei der Wahl der EU-Kommission am 27.
November 2024 hatte EU-Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen vor dem Europäischen
Parlament angekündigt, einen solchen Dialog
einzuberufen. Es sollen rasch Maßnahmen
vorgeschlagen und umgesetzt werden, die der
Sektor dringend benötigt.
Präsidentin Ursula von der Leyen sagte: „Die
Automobilindustrie ist eine europäische
Erfolgsgeschichte und entscheidend für den
Wohlstand Europas. Sie treibt Innovationen
voran, sichert Millionen von Arbeitsplätzen und
ist der größte private Investor in Forschung und
Entwicklung. Jeder Sektor hat spezielle
Bedürfnisse, und es liegt in unserer
Verantwortung, Lösungen zu finden, die sowohl
sauber als auch wettbewerbsfähig sind.
Wir müssen diese Branche beim bevorstehenden
tiefgreifenden und bahnbrechenden Wandel
unterstützen. Und wir müssen sicherstellen, dass
die Zukunft des Autos fest in Europa verankert
bleibt. Deshalb habe ich einen Strategischen
Dialog über die Zukunft der europäischen
Automobilindustrie vorgeschlagen. Wir werden
diesen Dialog bereits im Januar beginnen, um
zusammen unsere gemeinsame Zukunft zu
gestalten."
Schwerpunkte
Der
Strategische Dialog wird konkrete Strategien und
Lösungen zur Unterstützung der globalen
Wettbewerbsfähigkeit der Automobilherstellung in
Europa entwickeln. Der Schwerpunkt wird
insbesondere auf folgenden Themen liegen:
-
Förderung datengestützter Innovation und
Digitalisierung auf der Grundlage
zukunftsweisender Technologien wie KI und
autonomes Fahren;
- Unterstützung der
Dekarbonisierung des Sektors in einem offenen
technologischen Ansatz;
- Arbeitsplätze,
Kompetenzen und weitere soziale Aspekte;
-
Vereinfachung und Modernisierung des
Rechtsrahmens;
- Steigerung der Nachfrage,
Stärkung der finanziellen Ressourcen des Sektors
und seiner Widerstandsfähigkeit und
Wertschöpfungskette in einem zunehmend
wettbewerbsorientierten internationalen Umfeld.
Teilnehmende
Der Strategische
Dialog bringt wichtige Interessengruppen aus der
gesamten Branche zusammen, darunter europäische
Automobilunternehmen, Infrastrukturanbieter,
Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände sowie
Teile der Wertschöpfungskette der
Automobilindustrie und andere Interessengruppen.
Weiterer Ablauf
Auf den offiziellen
Start unter der persönlichen Leitung der
Präsidentin folgt eine Reihe thematischer
Treffen unter dem Vorsitz von Mitgliedern der
EU-Kommission. Diese Treffen werden in einer
Reihe von Empfehlungen münden, die dazu
beitragen, eine ganzheitliche EU-Strategie für
den Sektor zu entwickeln, um die verschiedenen
Herausforderungen zu bewältigen und den
geltenden EU-Rechtsrahmen bei Bedarf
entsprechend anzupassen.
Auf
Gipfeltreffen unter der Leitung der Präsidentin
werden die erzielten Fortschritte überprüft und
die notwendigen politischen Impulse für die
weitere Arbeit gegeben. Der Rat und das
Europäische Parlament werden eng in den Prozess
eingebunden und regelmäßig über den Dialog
informiert und dazu konsultiert.

NRW-Bauhauptgewerbe: Beschäftigung zum
ersten Mal seit 2015 gesunken
Mitte 2024 waren in den 13 729 Betrieben des
nordrhein-westfälischen Bauhauptgewerbes
159 701 Personen beschäftigt. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, waren das 209
bzw. 1,5 Prozent weniger Betriebe als im
Juni 2023. Die Zahl der Beschäftigten war um
492 Personen bzw. 0,3 Prozent niedriger als ein
Jahr zuvor. Damit ist die Zahl der Beschäftigten
im NRW-Bauhauptgewerbe zum ersten Mal seit acht
Jahren gesunken.
Anzahl kleinerer
Betriebe rückläufig, Anzahl größerer leicht
gestiegen
Die Zahl der kleineren Betriebe
(bis 19 tätige Personen) war Ende Juni 2024 in
Nordrhein-Westfalen um 1,7 Prozent niedriger als
ein Jahr zuvor. Die Zahl der größeren Betriebe
(ab 20 tätige Personen) erhöhte sich dagegen um
0,2 Prozent. Kleinere Betriebe beschäftigten
Mitte 2023 mit 67 447 knapp die Hälfte
(42,2 Prozent) aller tätigen Personen des
gesamten Bauhauptgewerbes in NRW. Ihre Zahl war
aber um 933 Personen bzw. 1,4 Prozent niedriger
als ein Jahr zuvor.
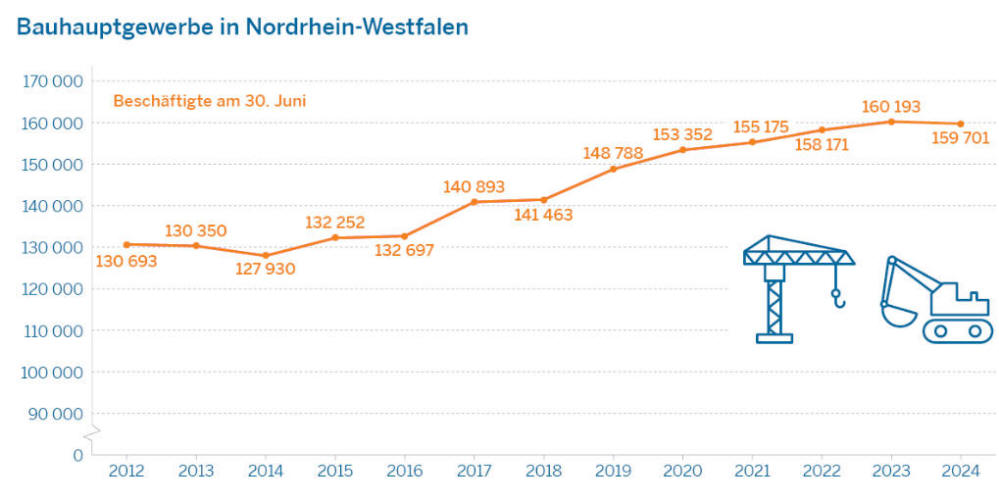
Bei den größeren Betrieben war die
Beschäftigtenzahl dagegen mit 92 254 um
441 Personen bzw. 0,5 Prozent höher als am
30. Juni 2023. Nominaler Umsatz gestiegen Der
ominale Gesamtumsatz der Betriebe des
nordrhein-westfälischen Bauhauptgewerbes belief
sich im Jahr 2023 auf rund 28,7 Milliarden Euro.
Das waren 6,7 Prozent mehr als im Jahr 2022.
Kleinere Betriebe erwirtschafteten mit
8,3 Milliarden Euro in etwa ein Drittel
(29,0 Prozent) des Gesamtumsatzes des Jahres
2023 (−1,0 Prozent gegenüber 2022). (IT.NRW)

Erwerbstätigkeit im November 2024 etwas
höher als im Vormonat
Erwerbstätigenzahl gegenüber Vorjahresmonat kaum
verändert
Erwerbstätige mit Wohnort in
Deutschland, November 2024 +0,1 % zum Vormonat
(saisonbereinigt) +0,1 % zum Vormonat (nicht
saisonbereinigt) 0,0 % zum Vorjahresmonat
Im November 2024 waren rund 46,1 Millionen
Menschen mit Wohnort in Deutschland
erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg die
Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt
gegenüber dem Vormonat leicht um 24 000 Personen
(+0,1 %). Im Oktober war die Erwerbstätigkeit um
12 000 Personen angestiegen. Damit hat sich die
Beschäftigung nach den saisonbereinigten
Rückgängen in den Monaten Juni bis September
2024 von durchschnittlich jeweils -19 000
Personen zuletzt wieder leicht positiv
entwickelt.
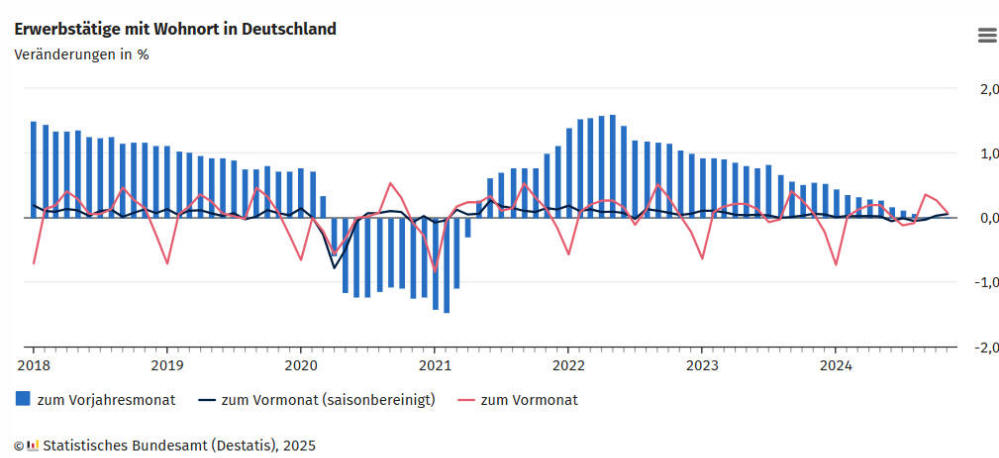
Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der
Erwerbstätigen im November 2024 gegenüber
Oktober 2024 um 31 000 Personen (+0,1 %) zu.
Dieser Anstieg gegenüber dem Vormonat lag über
dem November-Durchschnitt der Jahre 2022 und
2023 (+20 000 Personen). Erwerbstätigenzahl auf
Vorjahresniveau Gegenüber November 2023 hat sich
die Zahl der Erwerbstätigen im November 2024
kaum verändert (0,0 % bzw. +10 000 Personen).
Die Beschäftigung lag damit im
dritten Monat nacheinander auf dem
Vorjahresniveau; die Veränderungsraten im
September und Oktober 2024 betrugen ebenfalls
jeweils 0,0 %. Bereinigte Erwerbslosenquote im
November 2024 bei 3,4 % Im November 2024 waren
nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung
1,49 Millionen Personen erwerbslos. Das waren
138 000 Personen oder 10,1 % mehr als im
November 2023.
Die Erwerbslosenquote
stieg auf 3,3 % (November 2023: 3,1 %).
Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte
lag die Erwerbslosenzahl im November 2024 bei
1,52 Millionen Personen und damit um
2 000 Personen geringfügig niedriger als im
Vormonat Oktober 2024 (-0,1 %). Die bereinigte
Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum Vormonat
unverändert bei 3,4 %.
|