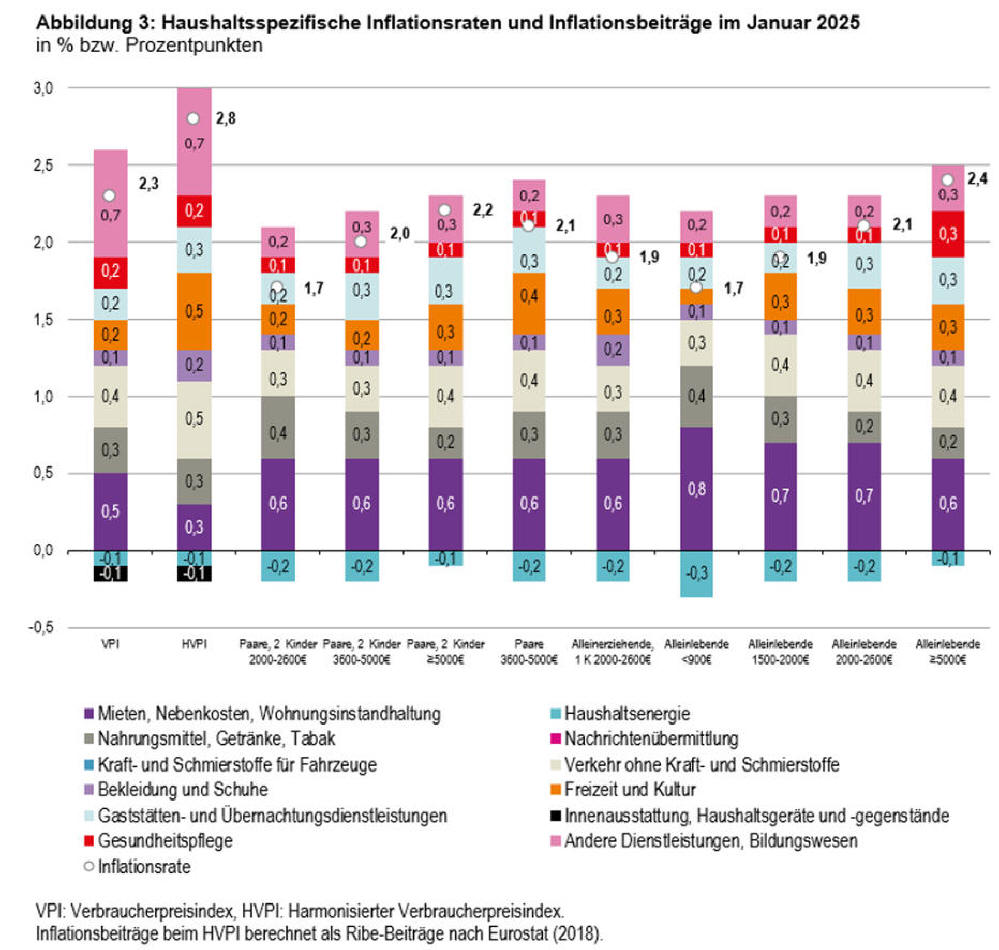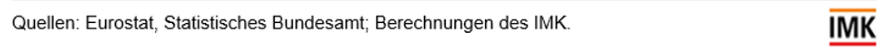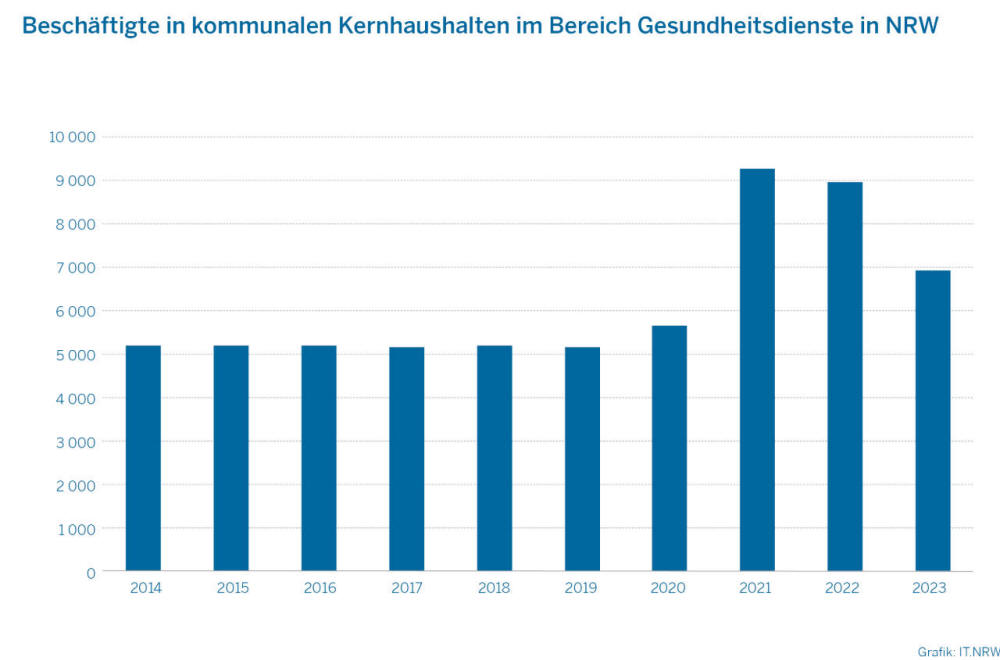|
Samstag, 1. März, Sonntag, 2. März 2025 - Zero
Discrimination Day am 1. März
Landesgartenschau Kleve: Bezirksregierung gibt
grünes Licht für den Start der Planungen
Nachdem die Landesgartenschau 2029 in Kleve seit
Anfang Februar ein Logo und eine visuelle
Identität hat, können nun auch die Arbeiten am
Gelände der Landesgartenschau richtig beginnen:
Die Stadt Kleve hat von der Bezirksregierung
Düsseldorf die Erlaubnis zum sogenannten
„vorzeitigen Maßnahmenbeginn“ erhalten.
Hintergrund sind Förderanträge, die durch die
Stadt Kleve gestellt wurden. Für gewöhnlich
dürfen Planungs- und Baumaßnahmen, für die eine
öffentliche Förderung beantragt wird, erst nach
Erteilung des Bewilligungsbescheides begonnen
werden. Da die eingereichten Förderanträge zur
Landesgartenschau jedoch umfangreich sind und
deren Prüfung einige Zeit in Anspruch nimmt, hat
die Stadt Kleve gleichzeitig die Zulassung eines
vorzeitigen Maßnahmenbeginns beantragt.
Durch die nun vorliegende Erlaubnis muss die
Stadt Kleve nicht auf den endgültigen
Bewilligungsbescheid warten, sondern darf ab
sofort Aufträge für die Landesgartenschau 2029
in Kleve vergeben, ohne die Förderung zu
riskieren.

Landesgartenschau LAGA Kermisdahl
Voraussichtlich unterstützt das Land NRW die
Landesgartenschau in Kleve mit einer
Pauschalförderung von 6 Mio. Euro. Die Förderung
ist für die Daueranlagen innerhalb des
eintrittspflichtigen Bereiches der
Landesgartenschau einzusetzen. Förderanträge für
sonstige Flächen und Programme werden im Zuge
der weiteren Planung gestellt.
In einem
ersten Schritt soll nun ein Planungswettbewerb
für das Gelände der Landesgartenschau
durchgeführt werden. Planungsbüros haben im
Rahmen des Wettbewerbs die Gelegenheit, ihre
kreativen Ideen für die Landesgartenschau in
Kleve auszuarbeiten. Eine Jury wird aus allen
eingereichten Entwürfen die beste Gestaltung
küren. Der Gewinnerentwurf ist anschließend die
Grundlage für die Landesgartenschau in Kleve.
Um einen Planungswettbewerb dieser Dimension
rechtssicher durchführen zu können, wird die
Stadt Kleve ein externes Wettbewerbsmanagement
einsetzen. Der Fokus des Wettbewerbs liegt auf
den sogenannten Daueranlagen; das sind die
Anlagen, die auch nach der Landesgartenschau
bestehen bleiben und das Stadtbild nachhaltig
prägen. Im Rahmen des Wettbewerbs werden aber
auch die vorgesehenen Flächen für
Ausstellungsbeiträge zugewiesen und geplant.
Die Flächen für die Landesgartenschau stehen
inzwischen größtenteils fest und werden zur
Vorbereitung des Planungswettbewerbs zeitnah
vermessen. Die Veranstaltung wird überwiegend
auf städtischen Flächen stattfinden. Für die
landwirtschaftlich genutzten Flächen in den
Galleien konnte in den Verhandlungen zwischen
der Stadt Kleve und dem Flächeneigentümer keine
Einigung erzielt werden, sodass nicht alle
landwirtschaftlich genutzten Flächen Teil der
Landesgartenschau werden können.
Da
Planungssicherheit jedoch eine zwingende
Voraussetzung für die weiteren Schritte der
Umsetzung sowie für die Ausschreibung des
Planungswettbewerbs ist, wird künftig mit den
verfügbaren Flächen weitergearbeitet.
In
der Bewerbungsbroschüre waren die betroffenen
Flächen für Ausstellungsbeiträge der
Landwirtschaft vorgesehen. Eine Ausstellung der
niederrheinischen Landwirtschaft in der
ursprünglich vorgesehenen Größenordnung wird
demnach nicht möglich sein. Gleichwohl ist der
Stadt Kleve eine Integration des Themas in die
Landesgartenschau auf den übrigen Flächen
wichtig, sodass es bei den anstehenden Planungen
stets mitgedacht wird.
Als Fläche für die
geplanten Themengärten werden die Flächen rund
um das ehemalige Hallenbad, insbesondere der im
Süden angrenzende Bolzplatz, eingeplant. Die
Fläche befindet sich im Eigentum der Stadt Kleve
und kann demnach auf diese Weise auch dauerhaft
aufgewertet werden.
Pädagogische Mitarbeiter*innen für den
Kinderschutz an Schulen fit gemacht
Insgesamt 20 Lehrer*innen,
Schulsozialarbeiter*innen, Sonderpädagogen*innen
und Erzieher*innen im Ganztag haben die
neuntägige Ausbildung zur Fachkraft für
Intervention und Prävention bei sexualisierter
Gewalt an Schulen (FFIPS) erfolgreich
absolviert.
Die Teilnehmer*innen aus
Bottrop, Gelsenkirchen, Duisburg, Kamp-Lintfort,
Mülheim und Oberhausen durchliefen ein
Schulungskonzept aus fünf Modulen mit den Themen
"Basiswissen sexualisierte Gewalt",
"Schutzkonzept", "Intervention bei
sexualisierter Gewalt", "Prävention" und
"Reflektion und Prüfung". Durchgeführt wurden
die Module durch Fachberater*innen aus
verschiedenen Beratungsstellen aus dem
Ruhrgebiet.
Die Fortbildung ist eine
Initiative der Deutschen Kinderschutzstiftung
Hänsel + Gretel und wird gefördert durch die
Stiftung der Sparda-Bank West. Im Rahmen einer
kleinen Feierstunde im Schulungsort Haus
Ripshorst in Oberhausen erhielten die
Teilnehmer*innen ihre Abschlusszertifikate und
können nun in ihren eigenen Schulen die Themen
als Multiplikatoren*innen ins Kollegium tragen.

Bildnachweis: © Deutsche Kinderschutzstiftung
Hänsel + Gretel
Auslöser für FFIPS waren
u.a. Umfragen, die gezeigt haben, dass die mit
der Fortbildung angesprochenen Zielgruppen
zumeist keine ausreichenden Vorkenntnisse im
Bereich des präventiven Schutzes von Kindern vor
sexualisierter Gewalt oder auch in der
Intervention haben, sagt der ehemalige Lehrer
und für die FFIPS-Organisation verantwortliche
Alfred Seidensticker, Deutsche
Kinderschutzstiftung Hänsel + Gretel.
"Sowohl in der universitären Ausbildung, als
auch in der zweiten Ausbildungsphase in den
Studienseminaren bei den Lehrer*innen sind diese
Inhalte nicht fest verankert", ergänzt Anja
Krebs, eine der FFiPS-Coaches.
FFIPS
vermittelte mit dieser Fortbildung über mehrere
Monate verteilt, fundiertes Fachwissen zum
Themenkomplex der sexualisierten Gewalt. Vom
notwendigen Basiswissen über Präventionskonzepte
zur Intervention werden alle für
Schulpraktiker*innen relevanten Themen gelehrt.
Dabei bleibt FFIPS nicht stehen, sondern zeigt
auch konkrete Schritte auf, wie ein
Schutzkonzept für die eigene Schule aussehen
kann. Es wird zudem ein Praxisprojekt
realisiert, das in der eigenen Schule zum
Einsatz kommen kann.
Die Teilnehmenden
erhielten jetzt ihr Zertifikat zur "Fachkraft
für Intervention und Prävention bei
sexualisierter Gewalt an Schulen". Die nächste
Fortbildung startet nach den Sommerferien wieder
im Haus Ripshorst. Interessierte finden
Informationen auf der Webseite www.ffips.net
Die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der
Sparda-Bank West
Die Stiftung Kunst, Kultur
und Soziales der Sparda-Bank West engagiert sich
bereits seit 2004 in Nordrhein-Westfalen. Seit
ihrer Gründung hat sie insgesamt fast 700
gemeinnützige Projekte mit mehr als 24 Millionen
Euro gefördert. Allein im vergangenen Jahr
unterstützte sie mit 1,16 Millionen Euro 33
Projekte.
Das soziale Engagement der
Stiftung leitet sich nicht zuletzt aus dem
Anspruch ab, die Gemeinschaft heute und in
Zukunft zu stärken. Ziel ist immer, das
Gemeinwohl zu fördern und sich in den drei
Bereichen Kunst, Kultur und Soziales langfristig
für die Menschen vor Ort einzusetzen.
Im
Fokus steht dabei die Unterstützung von Kindern,
Jugendlichen sowie älteren Menschen. Motivation
ist es, die verschiedenen Projekte als Partner
mit voranzubringen. Mehr über die
Sparda-Stiftung und ihre Werte unter
www.stiftung-sparda-west.de und bei Social
Media.
Aktion Mensch-Studie
zum Zero Discrimination Day am 1. März:
Jugendliche mit Beeinträchtigung besonders
häufig von Mobbing betroffen
Mehr
als ein Drittel der jungen Menschen mit
Beeinträchtigung hat bereits Erfahrung mit
Cybermobbing gemacht – bei jungen Menschen ohne
Beeinträchtigung ist es nur ein Fünftel
Mobbingerfahrung am Lernort Schule: Jugendliche
mit Beeinträchtigung werden deutlich häufiger
von Mitschüler*innen oder Lehrkräften gemobbt
Aktion Mensch fordert Sensibilisierungs- und
Aufklärungsangebote für junge Menschen, die eine
Kultur des inklusiven Miteinanders fördern
Ausgrenzung findet häufig dort statt, wo
sich die Generation Z im Alltag regelmäßig
aufhält – wie in sozialen Medien oder der
Schule. So gibt mehr als ein Drittel der
Jugendlichen mit Beeinträchtigung (35 Prozent)
an, bereits Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht
zu haben. Dagegen bestätigt das nur rund ein
Fünftel der Befragten ohne Beeinträchtigung (22
Prozent). Am häufigsten mit Cybermobbing
konfrontiert sehen sich weibliche Befragte mit
Beeinträchtigung.
Auf diese
alarmierenden Ergebnisse aus dem
Inklusionsbarometer Jugend, der ersten
bundesweiten Vergleichsstudie zu Teilhabechancen
von jungen Menschen im Alter von 14 bis 27
Jahren mit und ohne Beeinträchtigung, macht die
Aktion Mensch anlässlich des Zero Discrimination
Day am kommenden Samstag aufmerksam. Der
Aktionstag wurde von den Vereinten Nationen ins
Leben gerufen und soll auf Diskriminierung und
Vorurteile aufmerksam machen sowie dazu
aufrufen, sich für Toleranz und Akzeptanz aller
Menschen starkzumachen.
Mobbing an
Schulen: Jugendliche mit Beeinträchtigung
deutlich häufiger betroffen
Dass junge
Menschen mit Beeinträchtigung häufiger Opfer von
Mobbing werden, spiegelt sich auch in den
Erfahrungen am Lernort Schule wider. So geben 44
Prozent an, bereits von Schüler*innen oder
Lehrkräften gemobbt worden zu sein. Bei den
Befragten ohne Beeinträchtigung sind es im
Vergleich nur 16 Prozent.
Beeinträchtigungsspezifisch werden dabei
Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen wesentlich
weniger gemobbt, als wenn eine Beeinträchtigung
in den Bereichen Psyche oder Sucht vorliegt.
Hier berichtet jeweils ein Anteil von 65
beziehungsweise 52 Prozent von
Mobbingerfahrungen. Ebenso wird oder wurde fast
die Hälfte der jungen Menschen mit einer
Beeinträchtigung beim Sprechen, Bewegen oder
einer kognitiven Beeinträchtigung gemobbt (47
Prozent, 46 Prozent und 46 Prozent).
Aktion Mensch fordert Inklusion und Teilhabe
von Anfang an
Nur etwas mehr als die Hälfte
(55 Prozent) der befragten jungen Menschen mit
Beeinträchtigung fühlt sich von Gleichaltrigen
akzeptiert und unterstützt. Bei den Befragten
ohne Beeinträchtigung geben dies fast drei
Viertel an (71 Prozent). „Die Zahlen
verdeutlichen: Solange der Umgang mit Vielfalt
keine Selbstverständlichkeit ist, können
zwischen jungen Menschen Vorurteile entstehen,
die Ausgrenzung und Mobbing befördern“, erklärt
Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch.
„Wenn junge Menschen jedoch früh in
ihrem Leben mit inklusiven Umfeldern in
Berührung kommen, wachsen sie deutlich
selbstverständlicher in eine gleichberechtigte
Gesellschaft hinein. Wer von klein auf lernt,
sich mit Respekt und Empathie zu begegnen und
Vielfalt als Mehrwert begreift, tut dies auch
mit großer Wahrscheinlichkeit in späteren Phasen
des Lebens.“ Neben dem Elternhaus sind auch
Schulen, Freizeit- und Sportvereine sowie
Akteure der außerschulischen Jugendarbeit
gefragt, Anti-Mobbing-Angebote – online wie
offline – sicherzustellen und ein inklusives
Miteinander proaktiv zu fördern.
Inklusionsbarometer Jugend
Im Rahmen der
ersten bundesweiten Vergleichsstudie befragte
die Aktion Mensch 1.442 junge Menschen im Alter
von 14 bis 27 Jahren, davon 718 mit
Beeinträchtigung und 724 ohne Beeinträchtigung.
Die persönlichen Befragungen wurden in
Zusammenarbeit mit Ipsos Public Affairs zwischen
November 2023 und Februar 2024 durchgeführt. Aus
den Umfrageergebnissen wurde ein Teilhabeindex
errechnet. Ziel der partizipativ angelegten
Studie ist es, ungleiche Teilhabechancen von
jungen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zu
identifizieren, um auf Basis der gewonnenen
Erkenntnisse Inklusion weiter voranzutreiben.
Auf unserer Landingpage finden Sie die
vollständige Studie:
www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/inklusionsbarometer-jugend
Aktion Mensch e.V.
Die Aktion Mensch
ist die größte private Förderorganisation im
sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer
Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als fünf
Milliarden Euro an soziale Projekte
weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die
Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung,
Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das
selbstverständliche Miteinander in der
Gesellschaft zu fördern.
Mit den
Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die
Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000 Projekte.
Möglich machen dies rund vier Millionen
Lotterieteilnehmer*innen. Zu den Mitgliedern
gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas,
Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer
Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle
der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist
Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion
Mensch.
www.aktion-mensch.de
VRR
lichtet den Tarifdschungel
Der
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat seine
angekündigte Tarifreform umgesetzt und das
Ticketsortiment um rund 75 Prozent reduziert.
Künftig bietet der Verbund statt bisher sieben
nur noch drei Preisstufen an. Rund 500 von 650
Ticketoptionen fallen künftig weg. Tragende
Säulen der Reform sind das DeutschlandTicket und
das digitale Angebot eezy.nrw.
Der
NRW-weit gültige Tarif eezy.nrw ist eine
Alternative für Fahrgäste, die nur gelegentlich
mit Bus und Bahn unterwegs sind und kein Abo
eingehen möchten. Hier werden digital nur die
jeweils zurückgelegten Luftlinienkilometer
berechnet. Nach eigenen Angaben vereinfacht der
VRR als erster Verbund in Deutschland seine
Tarife und Strukturen.
Die Reform sei
eine Konsequenz aus der Einführung des
DeutschlandTickets. Über 95 Prozent der
Stammkundinnen und -kunden sind laut Verbund in
die DeutschlandTicket-Produktfamilie gewechselt.
idr - Informationen:
https://www.vrr.de/
Start Bewerbungsphase
Förderpreis Helfende Hand 2025
Das
Bundesministerium des Innern und für Heimat ruft
bundesweit zur Bewerbung um den Förderpreis
Helfende Hand 2025 auf. Von Anfang März bis Ende
Juni können Bewerbungen in den Kategorien
Innovative Konzepte, Nachwuchsarbeit sowie
Unterstützung des Ehrenamtes für den Förderpreis
eingereicht werden.
In diesem Jahr wird
zudem ein Sonderpreis zum Thema Inklusion im
Bevölkerungsschutz ausgelobt. Eine Jury aus
Expertinnen und Experten des
Bevölkerungsschutzes wählt die Nominierten aus.
Dieses Jahr wird die Helfende Hand zum 17. Mal
verliehen. Ab dem 1. März 2025 können sich
Ehrenamtliche im Bevölkerungsschutz mit ihrem
Projekt auf den Förderpreis Helfende Hand
bewerben, der in diesem Jahr vom
Bundesministerium des Innern und für Heimat
(BMI) bereits zum 17. Mal verliehen wird.

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 30. Juni
2025. Mit der Auszeichnung werden jährlich
Projekte von Organisationen, Unternehmen sowie
Einzelpersonen gewürdigt, die sich auf besondere
Weise ehrenamtlich im Bevölkerungsschutz
engagiert haben. Online bewerben Grundsätzlich
können sich alle Organisationen, Unternehmen
oder Einzelpersonen mit ihrem Projekt auf die
Helfende Hand bewerben, sofern sie mit ihrem
Einsatz das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz
stärken.
Die Bewerbung kann einfach
online unter
http://www.helfende-hand-foerderpreis.de/
eingereicht werden. Als Hilfestellung für das
Ausfüllen des Formulars stehen eine
Musterbewerbung sowie ein Erklärvideo auf der
Website zur Verfügung. Drei Kategorien, ein
Sonderpreis und ein Publikumspreis Der
Förderpreis Helfende Hand wird in den Kategorien
Innovative Konzepte, Nachwuchsarbeit und
Unterstützung des Ehrenamtes verliehen.
Die Jury wählt unter allen Einreichungen in
jeder Kategorie fünf Nominierte aus. Zusätzlich
wird in 2025 ein Sonderpreis für Inklusion im
ehrenamtlichen Bevölkerungsschutz vergeben.
Projekte, die das Thema Inklusion im
Bevölkerungsschutz stärken, sichtbar machen oder
erfolgreich umsetzen, können sich auf die
besondere Auszeichnung bewerben. Außerdem wird
unter allen Nominierungen ein Publikumspreis
verliehen.
Alle Informationen zu den
Kategorien sind auf der Website der Helfenden
Hand zu finden. Die Bedeutung des Ehrenamtes Mit
dem Förderpreis würdigt das Bundesministerium
des Innern und für Heimat jährlich die im
Bevölkerungsschutz aktiven Ehrenamtlichen und
fördert das Bewusstsein für ehrenamtliches
Engagement als Treiber für den Zusammenhalt in
der Gesellschaft.
Der Förderpreis
bietet die Möglichkeit, sich bei ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern zu bedanken und die
Begeisterung für das Ehrenamt zu fördern. Im
Jahr 2024 wurden insgesamt 15 Projekte mit dem
Förderpreis ausgezeichnet. Eine Übersicht über
alle Gewinnerprojekte gibt es hier. Der Film zur
Verleihung zeigt außerdem Eindrücke der
Veranstaltung und stellt die Gewinnerinnen und
Gewinner vor. Neuigkeiten rund um die Helfende
Hand gibt es auch auf Facebook und Instagram.
Grafschafter Cup in der Moerser Eishalle -
Öffentliche Laufzeit fällt während der
Wettkämpfe aus
Die Moerser
Eishalle ist erneut Ausrichtungsstätte des
traditionsreichen Grafschafter Cups. Am 8. März
suchen hunderte Eislauftalente aus ganz
Nordrhein-Westfalen hier ihre Meister. Die
Eishalle ist an diesem Tag ausschließlich für
den Grafschafter Schlittschuh Club als
Ausrichter reserviert.
Die sonst übliche
öffentliche Laufzeit fällt daher an diesem
Samstag aus. Am darauffolgenden Sonntag ist das
Eislaufen für die Öffentlichkeit dann wieder
zwischen 10 und 17 Uhr möglich.
Moers: Bürgermeister ‚tauschte‘
Rathausschlüssel gegen Kochlöffel
Christoph Fleischhauer und Robert Nitz Dieser
Rathaussturm machte seinem Namen alle Ehre! Auch
wenn sich Bürgermeister Christoph Fleischhauer
gewehrt hat und von Robert Nitz, Amtskollege aus
der brandenburgischen Partnerstadt Seelow und
seiner Delegation unterstützt wurde: Die Möhnen
des ‚Kulturausschuss Grafschafter Karneval‘
waren in der Überzahl und haben den
Rathausschlüssel in Rekordzeit erobert.

Christoph Fleischhauer und Robert Nitz
Im Gegenzug bekam das Moerser Stadtoberhaupt
einen ‚karnevalistischen‘ Kochlöffel – sicher
auch eine Anspielung darauf, dass sich
Fleischhauer im September nicht mehr zur Wahl
stellt und dann mehr Zeit für Häusliches hat.
Moers: Jugendfeuerwehr Moers
hat 14 neue Mitglieder
Insgesamt 14 neue Mitglieder sind in diesem
Jahr bei der Jugendfeuerwehr Moers gestartet
(Foto: Feuerwehr Moers). Die jungen Leute lernen
in den nächsten Monaten und Jahren die
praktische Arbeit bei den Übungsdiensten und bei
Einsätzen unter fast realen Bedingungen kennen.

Wichtig für das Zusammenwachsen der Truppe sind
auch die Zeltlager, bei denen die jungen
Menschen ihre Leistungen zeigen können, und die
Ferienfreizeit im Sommer. Dafür gibt der
Förderverein jährlich einen größeren Zuschuss.
In der Regel stammen über 50 Prozent der
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus der
Jugendfeuerwehr.
Photovoltaik-Anlagen: Oberhausen und Duisburg
mit höchsten Wachstumsraten
Die
Zahl der Photovoltaik-Anlagen in der Region
wächst rasant: Im Jahr 2024 sind im
Regierungsbezirk Düsseldorf mehr als 48.000 neue
Anlagen in Betrieb gegangen. Das sind 36,8
Prozent mehr als noch Ende des Jahres 2023. Die
größten prozentualen Zuwachsraten verzeichnen
Oberhausen und Duisburg. In absoluten Zahlen
liegt der Kreis Wesel mit fast 6.800 neuen
Anlagen im Jahr 2024 ganz vorn.
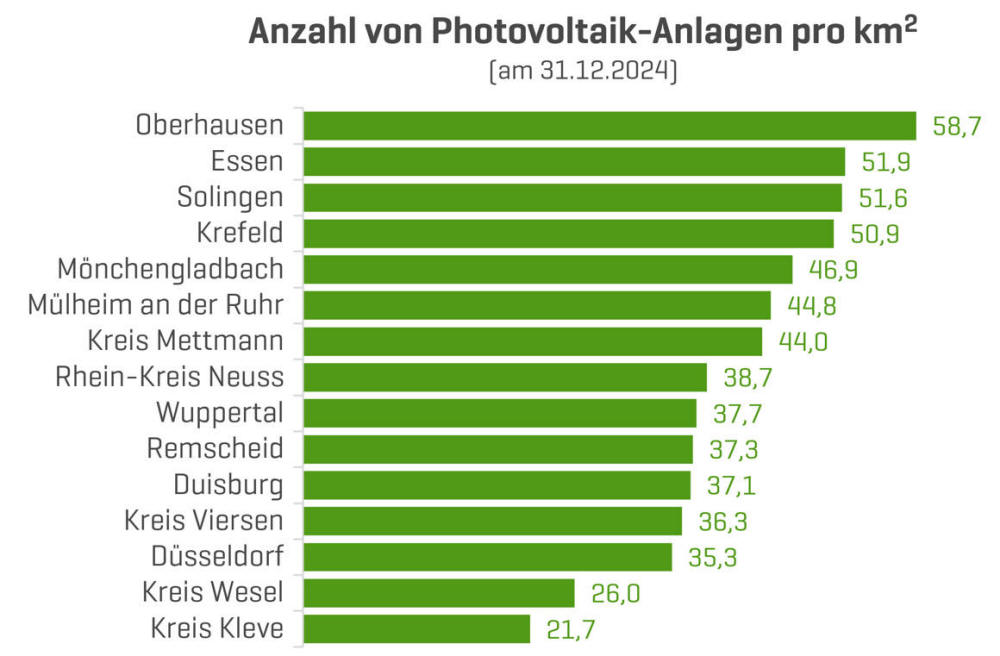
Alle Grafiken Stadtwerke Duisburg
Das zeigt eine Regionalanalyse der
Stadtwerke Duisburg, die dazu Daten aus dem
Marktstammdatenregister sowie des Statistischen
Bundesamtes ausgewertet haben. In die Statistik
fließen alle Anlagen ein, die solare Strahlung
als Energieträger zur Stromerzeugung nutzen.
Dazu zählen sowohl alle registrierten
Kleinanlagen wie Balkonkraftwerke als auch große
Anlagen mit Leistungen jenseits der Marke von 1
Megawatt Peak (MWp).
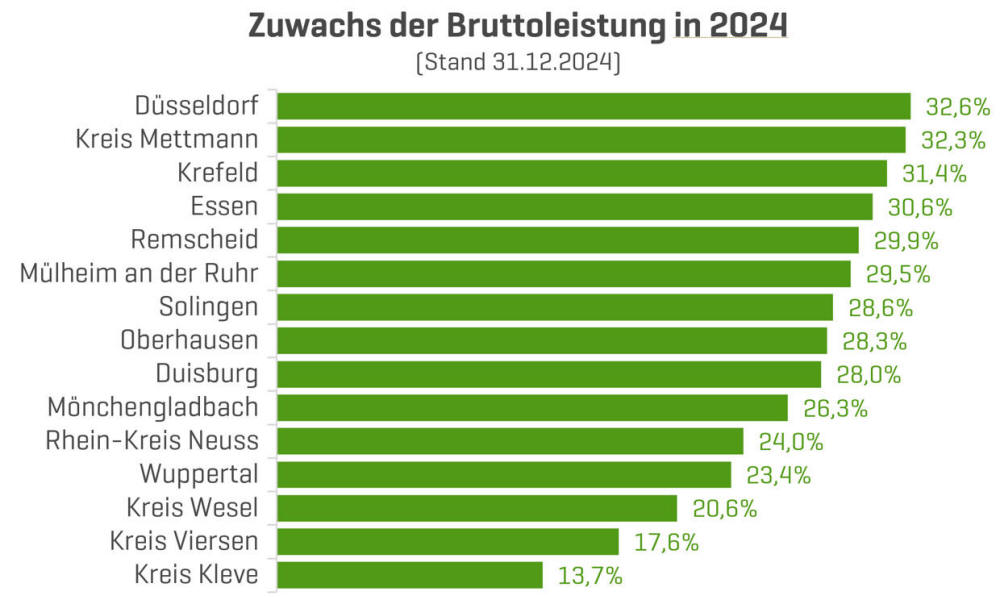
Spitzenreiter bei der Wachstumsrate sind
Oberhausen und Duisburg. In Oberhausen sind im
vergangenen Jahr 1.566 neue Anlagen ans Netz
gegangen, das entspricht einem Zuwachs von 52,9
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Duisburg
sind 2.892 neue Photovoltaik-Anlagen in Betrieb
gegangen, was einem Zuwachs von 50,3 Prozent
entspricht.
Die Stadt an Rhein und Ruhr
befindet sich im Aufbruch und hat sich
ambitionierte Klimaziele gesetzt: Duisburg will
bis zum Jahr 2035 in der städtischen
Infrastruktur komplett CO2-neutral unterwegs
sein. Photovoltaik spielt dabei bei der
Energieerzeugung eine bedeutende Rolle.
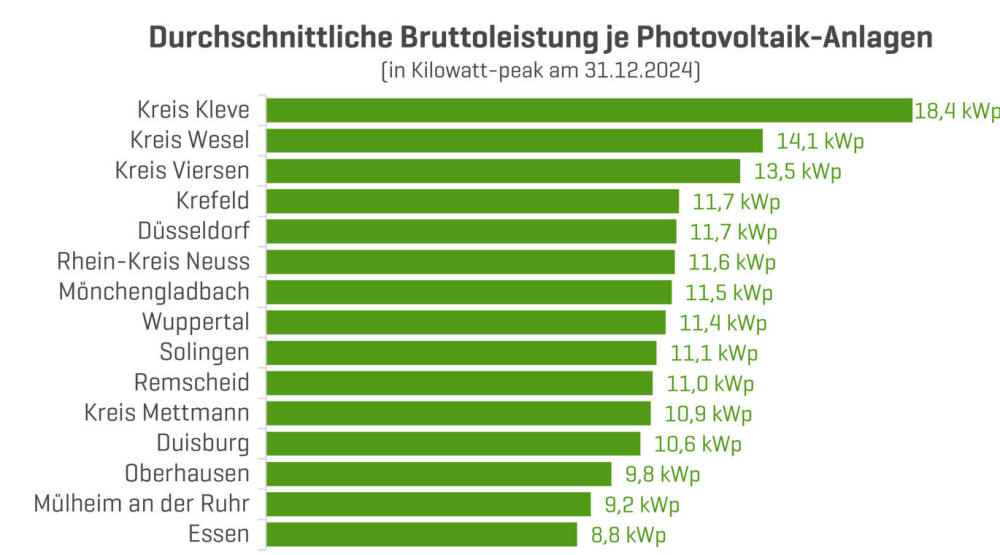
Nach absoluten Zahlen hat im Jahr 2024 der
Kreis Wesel die Nase vorn: 6.774 neue Anlagen
sind dort in Betrieb gegangen, die insgesamt
eine Bruttoleistung von 65,4 Megawatt peak (MWp)
liefern.
Der Kreis Kleve dagegen weist
mit Abstand die höchste Pro-Kopf-Leistung auf
Basis solarer Strahlungsenergie auf: 1,5
Kilowatt Peak (kWp) sind das umgerechnet pro
Einwohner, der darauf folgende Kreis Viersen mit
einer vergleichbaren Einwohnerzahl kommt auf 0,9
kWp. Im Kreis Kleve ist aktuell die meiste
solare Erzeugungskapazität installiert. Die
Anlagen dort haben insgesamt eine Leistung von
491,8 MWp. Zum Vergleich: Die Stadt Düsseldorf
mit fast doppelt so vielen Einwohnern kommt auf
eine PV-Bruttoleistung von 89,3 MWp.
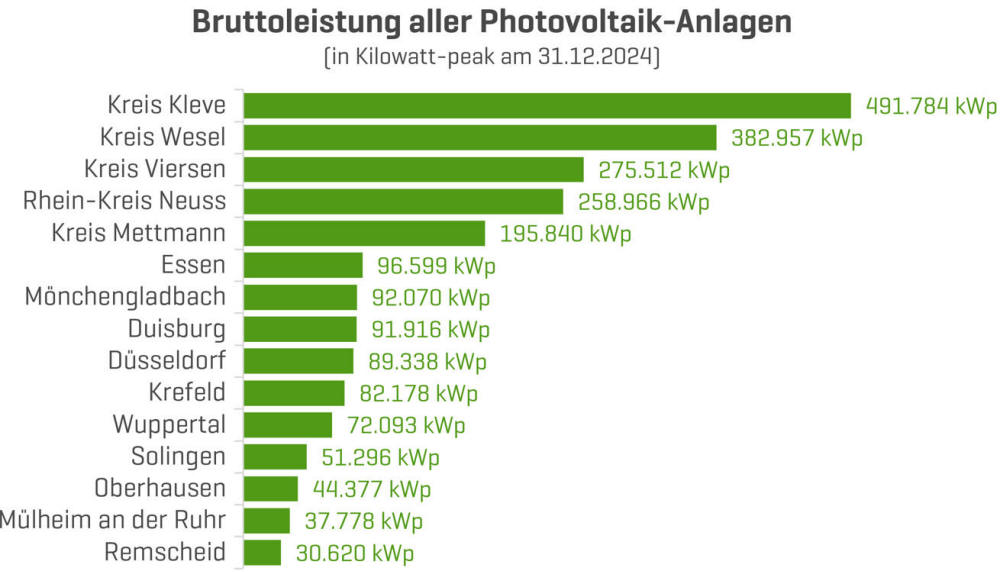
Anlagen in Kreisen größer als in den
Städten
Der Unterschied zwischen kreisfreien
Städten und Kreisen lässt sich auch an der Zahl
der Anlagen nach Fläche erkennen: So kommt die
Stadt Oberhausen aktuell auf 58,7 PV-Anlagen pro
Quadratkilometer, während es im Kreis Kleve mit
21,7 Anlagen weniger als die Hälfte sind.
Dementsprechend sind die Anlagen in den Kreisen
im Schnitt größer dimensioniert als in den
Städten: Während der Kreis Kleve auf eine
durchschnittliche Bruttoleistung von 18,4 kWp
pro Anlage kommt und damit das Ranking anführt,
liegt der Durchschnitt in Essen am unteren Ende
der Vergleichsskala dieser Kategorie mit 8,8 kWp
pro Anlage bei weniger als der Hälfte.
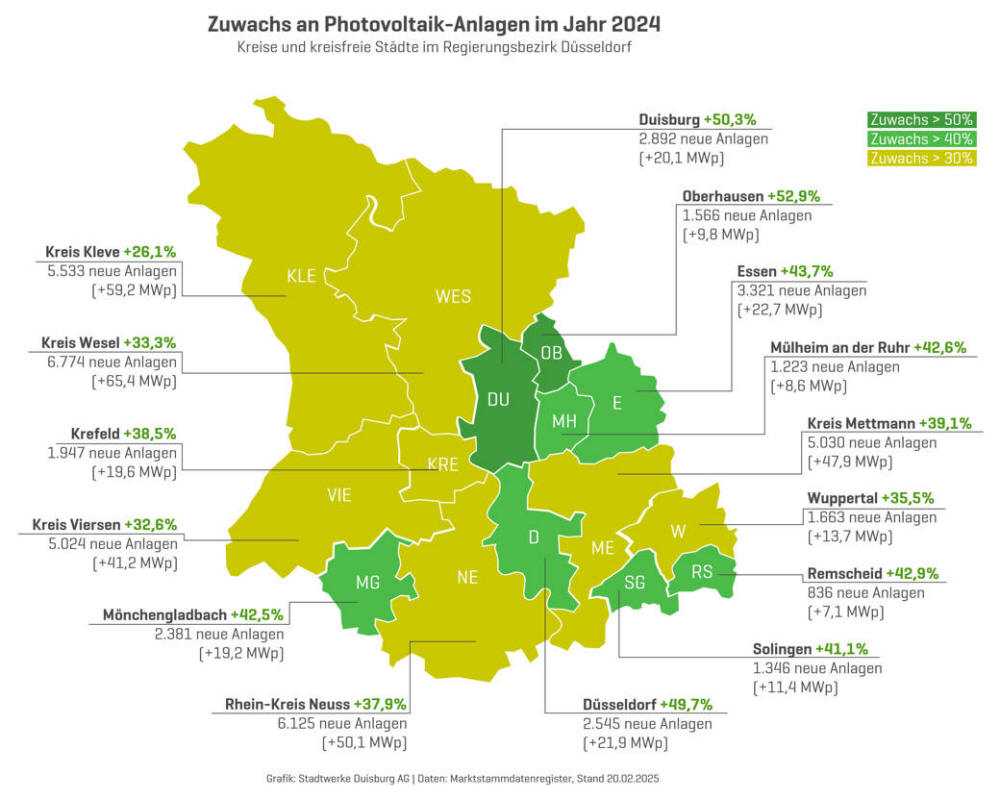
Insgesamt wurden im Regierungsbezirk Düsseldorf
im Jahr 2024 rund 1.111 MWp an Photovoltaik
zugebaut, so dass sich alle zum Stichtag 31.
Dezember 2024 in Betrieb befindlichen Anlagen
auf eine Gesamt-Bruttoleistung von 2,3 Gigawatt
(GW) summieren.
Die Stadtwerke
Duisburg sind als Energieversorger erster
Ansprechpartner für Photovoltaik in Duisburg und
der Region. Sie bieten von der Beratung, Planung
und Hilfe bei der Finanzierung über die
Installation bis zum Service während des
Betriebs alle Schritte aus einer Hand an.
Das Spektrum reicht von Balkonkraftwerken,
Solar-Carports und PV-Komplettpaketen bis zu
Ergänzungslösungen wie Batteriespeicher,
Wärmepumpen und Wallboxen. Auf der Internetseite
swdu.de/pv finden sich neben allen Infos rund um
das Thema Photovoltaik auch ein Selbstcheck mit
Zugriff auf das Solardachkataster sowie auf die
Fördermitteldatenbank.
Moers: Museum
zeigt Dokumentarfilm über Gleichberechtigung in
der DDR
Anlässlich des
Internationalen Frauentages zeigt das
Grafschafter Museum bereits am Donnerstag, 6.
März, einen Dokumentarfilm über
Gleichberechtigung in der DDR. Der Film ist ab
19.30 Uhr im Alten Landratsamt, Kastell 5, zu
sehen und wird in Kooperation mit der
Gleichstellungsstelle der Stadt Moers sowie der
vhs Moers – Kamp-Lintfort präsentiert.
Gezeichnet wird ein lebendiges Gruppenporträt
ostdeutscher Frauen aus den verschiedensten
Gesellschaftsbereichen der DDR: 15
selbstbewusste Frauen erzählen, wie auch im Land
der staatlich verordneten Gleichberechtigung
trotzdem das Patriarchat regierte.
Sie schaffen damit ein
kraftvolles Kaleidoskop der
Geschlechterbeziehungen im Arbeiter- und
Bauernstaat. Der Film bietet den beeindruckenden
Lebensleistungen der ostdeutschen Frauen und
ihrem Kampf um Chancengleichheit eine fesselnde
Bühne. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der
Titel nicht genannt werden.
Anlässlich des Weltfrauentages (Samstag,
8. März 2025) hat
die Gleichstellungsstelle der Stadt Moers
gemeinsam mit den weiteren
Gleichstellungsstellen des Kreises ein
vielfältiges Programm inklusive
Ratgeberbroschüre zusammengestellt.
Entsprechende Informationen gibt es bei den
jeweiligen Städten.
Der Eintritt ist frei.
Um eine vorherige telefonische Anmeldung unter 0
28 41/201-6 82 00 wird gebeten.
"Ab jetzt finanziell unabhängig" -
Neuerscheinung der Verbraucherzentrale
Frauen arbeiten häufiger Teilzeit,
sodass sie schon deshalb weniger verdienen als
Männer. Dafür haben sie bei Care-Arbeit die Nase
vorn: Ob Kinder oder pflegebedürftige Angehörige
– die Stelle für die Betreuung der
Familienmitglieder ist meist weiblich besetzt.
Spätestens beim Blick auf die
Renteninformation wird klar: Die gängige
Biografie von Frauen endet vielfach in
Altersarmut. Dass das kein unabänderliches
Schicksal sein muss, zeigt der neue Ratgeber „Ab
jetzt finanziell unabhängig: Ein nachhaltiger
Finanzplaner für Frauen“ der
Verbraucherzentrale.
Das Buch
behandelt die Themen:
- Warum Rentenlücken
entstehen und wie der Kassensturz klappt -
Welche Stellschrauben für eine gute
Altersvorsorge wichtig sind
- Geldanlage
individuell: Risikoneigung, Anlagehorizont und
persönliche Ziele - Versicherungen: Passende
Absicherung in verschiedenen Lebensphasen
-
Was bei Trennung und Scheidung in Sachen
Finanzen zu regeln ist - Finanzen in
Patchworkfamilien - Erbschaften – nicht immer
ein finanzielles Plus
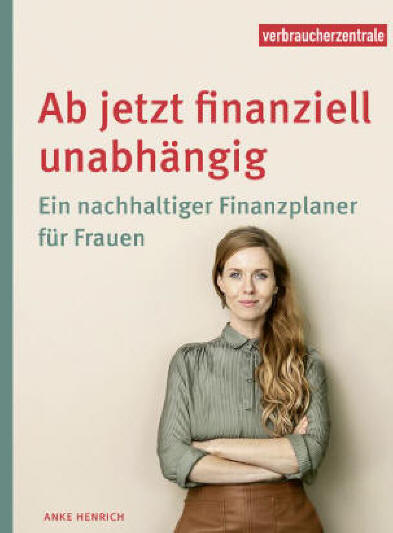
Ab jetzt finanziell unabhängig: Ein
Finanzratgeber für Frauen 1. Auflage 2025, 208
Seiten, 20,- Euro, als E-Book 15,99 Euro
www.verbraucherzentrale.de/buecher-und-ebooks/frauenfinanzplaner
Dinslaken: Tauschen, säen, ernten:
Saatgut-Bibliothek startet in die
Frühjahrssaison
Die Stadtbibliothek
Dinslaken startet am 13. März in die nächste
Runde ihrer Saatgut-Bibliothek und lädt alle
Interessierten herzlich ein, sich wieder aktiv
am Saatguttausch zu beteiligen und so gemeinsam
für mehr Artenvielfalt zu sorgen. Wer Saatgut
erntet und in die Bibliothek bringt, kann im
Gegenzug neues Saatgut mitnehmen – so entsteht
ein nachhaltiger Kreislauf, von dem alle
profitieren.
Das Konzept der
Saatgut-Bibliothek basiert auf dem Prinzip des
Tauschens: Besucher*innen können Tütchen mit
Gemüse-, Kräuter- oder Blumensamen mitnehmen und
diese auf dem Balkon, der Fensterbank oder im
Garten aussäen. Die Ernte kann dann genutzt
werden, um neues Saatgut sorgfältig verpackt und
beschriftet in die Bibliothek zurückzubringen.
So wächst die Saatgut-Bibliothek kontinuierlich
und trägt zum Erhalt einer vielfältigen
Pflanzenwelt bei.
Gesucht wird
Saatgut von sortenreinen und selbst gezogenen
Pflanzen, sowohl von Blühpflanzen als auch von
Gemüsesorten. Besonders wichtig ist, dass das
gespendete Saatgut samenfest ist und aus
natürlicher Züchtung stammt.
Das zum
Tausch angebotene Saatgut umfasst eine große
Auswahl an Pflanzen: Von einfach zu ziehenden
Kräutern wie Kresse bis hin zu Tomaten, die
vorgezogen werden müssen. Viele der angebotenen
Sorten sind ideal für die Aussaat im Frühjahr
und ermöglichen einen gelungenen Start in die
Gartensaison.
Dinslaken: Zu Fuß
durch die Vergangenheit
Zum
Stadtrundgang "Zu Fuß durch die Vergangenheit"
am Donnerstag, 13.03.2025, um 17 Uhr lädt Ronny
Schneider Interessierte. Burg, Stadtgründung,
Privilegien und Pflichten der Bürger, Stadttore,
Zollwesen, Mühlenteich und Dinslakener Mühle,
der die ganze Altstadt querende Rotbach und
Pumpennachbarschaften sind nur einige
Stichwörter und Stationen dieses Rundgangs durch
die Dinslakener Innenstadt.
Die
Teilnahme kostet 5 Euro pro Person. Treffpunkt
zur Führung ist vor der Stadtinformation am
Rittertor. Verbindliche Anmeldungen für diesen
Rundgang nimmt das Team der Stadtinformation am
Rittertor entgegen – telefonisch unter 02064-66
222 oder per E-Mail stadtinformation@dinslaken.de gerne
entgegen.

NRW-Inflationsrate liegt im Februar 2025 bei
1,9 Prozent
Der
Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen
ist von Februar 2024 bis Februar 2025 um
1,9 Prozent gestiegen (Basisjahr 2020 = 100).
Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen
als Statistisches Landesamt mitteilt, stieg der
Preisindex gegenüber dem Vormonat (Januar 2025)
um 0,4 Prozent.
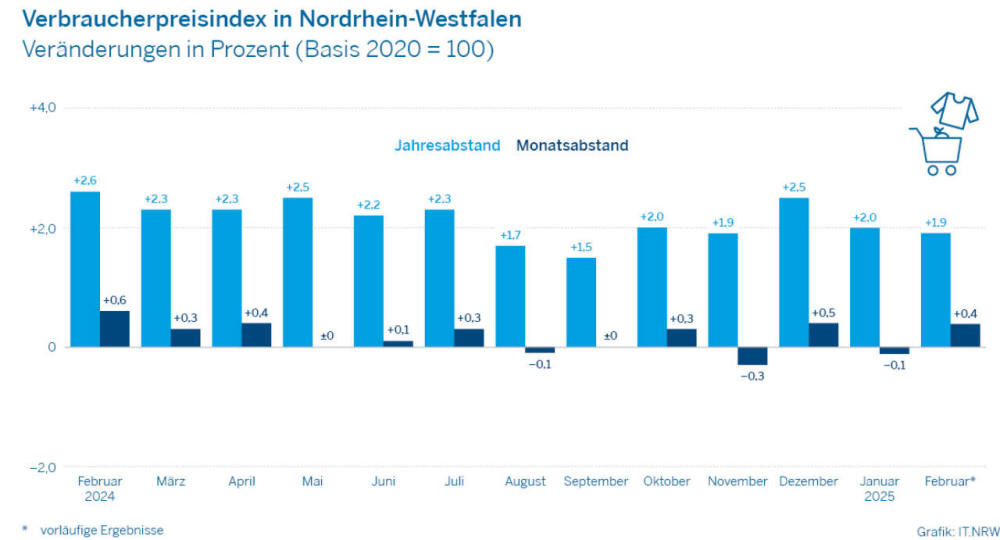
Vormonatsvergleich: Paprika sind um 15,4
Prozent teurer als im Januar 2025 Zwischen
Februar 2024 und Februar 2025 stiegen u. a. die
Preise für Nahrungsmittel (+2,0 Prozent). Hier
verteuerten sich insbesondere Butter
(+25,6 Prozent), Tomaten (+22,2 Prozent),
Schokoladentafeln (+21,8 Prozent), Gurken
(+19,3 Prozent) und Paprika (+17,2 Prozent).
Günstiger waren Möhren (−15,7 Prozent) und
Kartoffeln (−11,9 Prozent).
Die
Energiepreise (Kraftstoffe und
Haushaltsenergien) sanken im Vergleich zum
Vorjahresmonat im Durchschnitt um 2,0 Prozent.
Überdurchschnittliche Preissteigerungen
verzeichneten die Dienstleistungen für
Altenwohnheime und ähnliche Einrichtungen
(+9,9 Prozent).
Vormonatsvergleich:
Paprika sind um 15,4 Prozent teurer als im
Januar 2025 Zwischen Januar 2025 und
Februar 2025 verteuerten sich Nahrungsmittel um
durchschnittlich 1,2 Prozent. Die Preise für
Paprika (+15,4 Prozent), Tomaten (+13,6 Prozent)
und Schokoladentafeln (+12,5 Prozent) zogen
überdurchschnittlich an.
Preisrückgänge
verzeichneten u. a. Gurken (−4,4 Prozent) sowie
verschiedene Bekleidungsartikel, u. a.
Damennachthemd/-schlafanzug (−4,6 Prozent) sowie
Strümpfe, Socken oder Strumpfhosen für Damen
(−4,3 Prozent).
Gemüseernte 2024 um 6 % gegenüber dem
Vorjahr gestiegen
• Zahl der
Betriebe gegenüber 2020 um gut 4 % gesunken,
gegenüber 2012 um 19 % • 15 % der gesamten
Gemüseanbaufläche wurden ökologisch
bewirtschaftet W
Im Jahr 2024 haben die
landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland
insgesamt 4,2 Millionen Tonnen Gemüse geerntet.
Die Gesamterntemenge ist damit um 6,1 %
gegenüber 2023 gestiegen und lag auf dem
zweithöchsten Stand seit 2012. Nur im Jahr 2021
wurde mit 4,3 Millionen Tonnen mehr Gemüse
geerntet. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, stieg die gesamte
Anbaufläche für Gemüse um 3,2 % gegenüber dem
Vorjahr auf 126 800 Hektar.
Die
Anbaufläche von 2024 lag damit 2,9 % über dem
langjährigen Mittel (2012 bis 2023). Die Zahl
der Gemüse erzeugenden Betriebe nahm gegenüber
der letzten Vollerhebung im Jahr 2020 von 6 100
auf 5 830 ab (-4,4 %). Seit 2012 ist die Anzahl
dieser Betriebe um 19,0 % gesunken.
Freilandanbauflächen um gut 3 % gewachsen
Im
Freiland erzeugten 5 630 Betriebe im Jahr 2024
auf 125 550 Hektar Gemüse. Dies entsprach einem
Anstieg der Freilandanbauflächen um 3,3 %
gegenüber dem Vorjahr. Regional wurden 2024 die
größten Anbauflächen im Freiland in
Nordrhein-Westfalen mit 28 200 Hektar,
Niedersachsen mit 24 400 Hektar, Bayern mit
16 500 Hektar und Rheinland-Pfalz mit 16 400
Hektar bewirtschaftet. Karotten mit größter
Erntemenge vor Speisezwiebeln und Weißkohl –
Spargel mit größter Anbaufläche Möhren
beziehungsweise Karotten waren im Freiland mit
850 600 Tonnen im Jahr 2024 wie in den Vorjahren
die Gemüseart mit der größten Erntemenge in
Deutschland.
Bei einer Ausweitung
der Anbaufläche um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr
nahm die Erntemenge um 6,8 % zu. Die Gemüseart
mit der zweitgrößten Erntemenge waren erneut
Speisezwiebeln mit 744 400 Tonnen (+11,7 %
gegenüber 2023), gefolgt von Weißkohl mit
427 100 Tonnen (+7,2 %), Einlegegurken mit
213 700 Tonnen (+10,3 %) und Eissalat mit
127 800 Tonnen (+5,4 %).
Im Hinblick
auf die gesamte Gemüseanbaufläche im Freiland
lagen Karotten 2024 mit einer Fläche von 13 800
Hektar an dritter Stelle hinter Spargel mit
19 760 Hektar ertragsfähiger Fläche (-3,0 %),
und Speisezwiebeln mit 17 700 Hektar (+17,4 %).
Danach folgten Weißkohl mit 6 150 Hektar
(+15,9 %), und Speisekürbisse mit 5 260 Hektar
(-0,7 %).
Ökologische Gemüseernte um
gut 10 % gestiegen
Ökologisch wirtschaftende
Betriebe erzeugten auf 19 350 Hektar insgesamt
529 800 Tonnen Gemüse. Das entspricht 15,3 % der
gesamten Gemüseanbaufläche und 12,7 % der
gesamten Erntemenge. Gegenüber 2023 stieg die
ökologisch bewirtschaftete Anbaufläche um 5,0 %
und die zugehörige Erntemenge um 10,4 %. Die
größte Anbaufläche im ökologischen Gemüseanbau
entfiel auch 2024 auf Karotten mit 3 350 Hektar
(17,3 %).
Speisekürbisse wurden auf
2 020 Hektar (10,4 %) angebaut und
Speisezwiebeln auf 1 880 Hektar (9,7 %), gefolgt
von Spargel (im Ertrag) mit einer Anbaufläche
von 1 780 Hektar (9,2 %). Besonders hohe Anteile
ökologischer Erzeugung an der Gesamterntemenge
zeigten sich bei den Gemüsearten Rote Bete mit
40,8 %, Speisekürbisse mit 36,3 %, Zucchini mit
33,0 % sowie Frischerbsen mit 23,4 % und
Karotten mit 22,8 %.
Tomaten und
Salatgurken mit den größten Anbauflächen in
Gewächshäusern
Die Anbauflächen von Gemüse
unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen, zum
Beispiel in Gewächshäusern oder unter hohen
Folienabdeckungen, sind 2024 im
Vorjahresvergleich um 2,6 % gesunken. Dennoch
haben 1 540 Betriebe auf 1 240 Hektar mit
210 000 Tonnen Gemüse die größte Erntemenge seit
2012 erzielt.
In den letzten 12
Jahren ist die Anzahl der Betriebe, die Gemüse
unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen
anbauen, um nahezu ein Viertel (-24,1 %)
gesunken, während die entsprechenden
Gemüseanbauflächen in dieser Zeit zwischen 1 200
und 1 320 Hektar schwankten. Die größten
Anbauflächen entfielen 2024 auf Tomaten mit 390
Hektar und Salatgurken mit 240 Hektar.
Während der Anbau von insbesondere Feldsalat
(-46,9 % auf 150 Hektar) und Kopfsalat (-27,9 %
auf 60 Hektar) seit 2012 immer weiter reduziert
wurde, nahm der Anbau von Tomaten (+22,4 %),
Salatgurken (+10,1 %) und vor allem Paprika
(+84,9 % auf 120 Hektar) deutlich zu. Parallel
ist die Erntemenge von Tomaten um 76,5 % auf
108 000 Tonnen und von Paprika um 214,8 % auf
16 500 Tonnen gestiegen. Dies zeigt eine
erhebliche Intensivierung des Anbaus dieser
Kulturen in den letzten Jahren.
Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte
in vielen Mangelberufen überdurchschnittlich
stark vertreten
Anteil im Aus- und
Trockenbau 2023 bei 67 %, in der
Lebensmittelproduktion bei 51 %, bei Bus- und
Straßenbahnfahrer/-innen bei 46 % – gegenüber 26
% in der Gesamtwirtschaft
Ob im Bau, in
der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, der
Pflege oder im Personen- und Güterverkehr: In
vielen Engpassberufen sind Beschäftigte mit
Einwanderungsgeschichte überdurchschnittlich
stark vertreten. So hatten zwei von drei (67 %)
Beschäftigten im Aus- und Trockenbau 2023 eine
Einwanderungsgeschichte, wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) auf Basis von Ergebnissen
des Mikrozensus mitteilt.
In der
Lebensmittelherstellung traf dies auf mehr als
die Hälfte der Beschäftigten zu (51 %).
Überdurchschnittlich hoch war der Anteil auch in
der Berufsgruppe der Fliesenleger/-innen (47 %),
unter den Fahrer/-innen von Bussen und
Straßenbahnen (46 %) sowie unter Servicekräften
in der Gastronomie (45 %).
In der
Gesamtwirtschaft hatte gut ein Viertel (26 %)
aller abhängig Beschäftigten eine
Einwanderungsgeschichte, war also selbst seit
dem Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert oder
beide Elternteile waren seither zugewandert. In
sogenannten Engpassberufen herrscht oder droht
laut Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit
(BA) ein Fachkräftemangel.
Knapp ein Drittel der Beschäftigten in der
Altenpflege hat eine Einwanderungsgeschichte
Deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen
Durchschnitt liegt der Anteil der Beschäftigten
mit Einwanderungsgeschichte auch in weiteren
Mangelberufen: so etwa in der
Fleischverarbeitung (42 %), im Verkauf von
Lebensmitteln (41 %), bei
Berufskraftfahrer/-innen im Güterverkehr (37 %),
in der Altenpflege (31 %) sowie im Metallbau
oder der Elektrotechnik (je 30 %).
Den Engpassberuf mit dem geringsten Anteil an
Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte
stellten Versicherungskaufleute dar (13 %). Auch
wenn es sich im Folgenden nicht um Mangelberufe
laut Engpassanalyse der BA handelt, sind
Menschen mit Einwanderungsgeschichte in einigen
Berufsgruppen noch stärker unterrepräsentiert:
Das trifft vor allem auf den
Polizeivollzugsdienst (6 %), die Berufe in der
öffentlichen Verwaltung (9 %), auf Lehrkräfte
(Primarstufe: 9 %, Sekundarstufe: 11 %) sowie
die kaufmännische und technische
Betriebswirtschaft (12 %) zu.
Beschäftige mit Einwanderungsgeschichte in
ausgewählten Engpassberufen 2023 Bar chart with
16 bars. Anteil an allen abhängig Beschäftigten
je Beruf in % Klassifikation der Berufe 2010
(KldB 2010); Berufsuntergruppen.
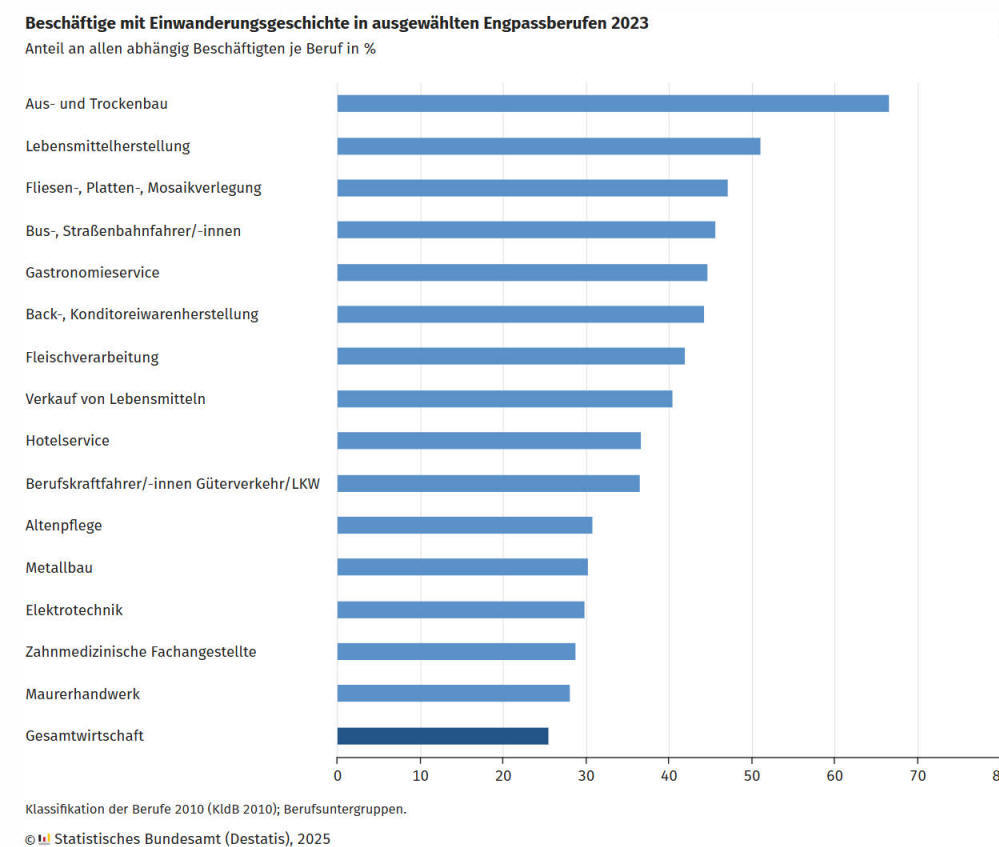
Branchen: Gastronomie und Gebäudebetreuung
anteilig mit den meisten Beschäftigten mit
Einwanderungsgeschichte
Nicht allein in
vielen Mangelberufen ist der Anteil der Menschen
mit Einwanderungsgeschichte hoch. Einige
Branchen sind insgesamt in besonderem Maße auf
Arbeitskräfte angewiesen, die selbst oder deren
beide Elternteile zugewandert sind. Das ist vor
allem in der Gastronomie der Fall – gefolgt von
der Gebäudebetreuung sowie der Lagerei und den
sonstigen Verkehrsdienstleistungen.
2023 hatte mehr als die Hälfte (54 %) aller
abhängig Beschäftigten in der Gastronomie,
unabhängig vom jeweils ausgeübten Beruf, eine
Einwanderungsgeschichte. In der
Gebäudebetreuung, die zum Großteil aus
Gebäudereinigung besteht, zu der aber auch
Garten- und Landschaftsbau zählen, hatte knapp
die Hälfte (49 %) der Beschäftigten eine
Einwanderungsgeschichte.
Im Bereich
Lagerei und sonstige Verkehrsdienstleistungen
waren es 41 %. Einen überdurchschnittlich großen
Anteil hatten Beschäftigte mit
Einwanderungsgeschichte auch in Post-, Kurier-
und Expressdiensten sowie in der Beherbergung
(jeweils 40 %). In der
Kraftwagenproduktion (31 %) sowie in Alten- und
Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen (30 %),
beides beschäftigungsstarke Bereiche mit jeweils
mehr als einer Million Beschäftigten, lag der
Anteil ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt
in der Gesamtwirtschaft (26 %).
Deutlich unterrepräsentiert waren Menschen mit
Einwanderungsgeschichte 2023 dagegen im Bereich
öffentliche Verwaltung, Verteidigung und
Sozialversicherung (10 %), bei
Versicherungen (13 %), in der
Energieversorgung (14 %), in
Finanzdienstleistungen (15 %) sowie in Erziehung
und Unterricht (17 %).
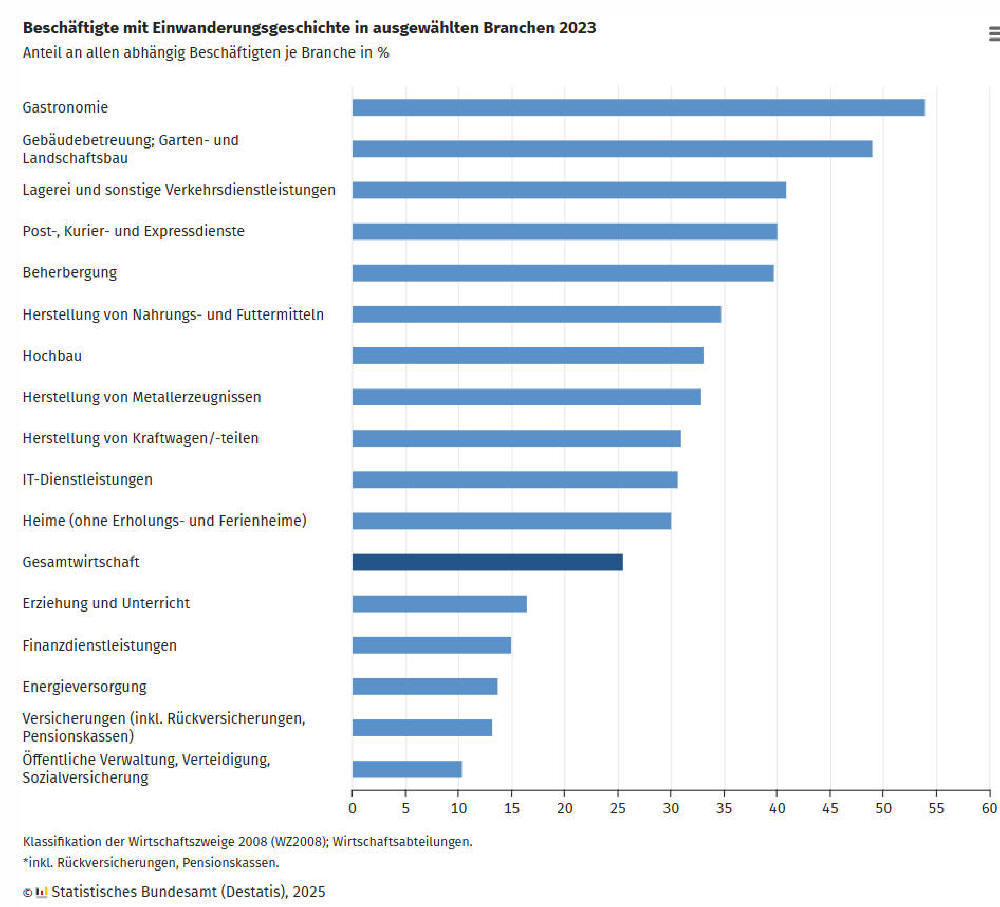
Freitag, 28.
Februar 2025 -
Tag der seltenen Erkrankungen
Stadt Dinslaken will in der
Haushaltssicherung auf Einführung der
Bezahlkarte verzichten
Die Stadt
Dinslaken hat entschieden, vorerst von der
Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete zum
1. Januar 2026 abzusehen und nutzt dabei, wie
unter anderem die Städte Düsseldorf, Duisburg,
Münster, Köln und Krefeld, die sogenannte
Opt-Out-Möglichkeit. Diese Entscheidung wurde
nach sorgfältiger Prüfung der finanziellen und
organisatorischen Folgen getroffen.
Die Verwaltung kritisiert, dass das Land
Nordrhein-Westfalen wieder Aufgaben auf die
Kommunen abwälzt, ohne eine auskömmliche
Finanzierung sicherzustellen. Die Stadt
Dinslaken befindet sich derzeit in einem
Haushaltssicherungsprozess. Eine Einführung der
Bezahlkarte würde zusätzlich finanzielle und vor
allem personelle Belastungen mit sich bringen.
So rechnet die Stadt mit einer Vorfinanzierung
im fünfstelligen Bereich und laufenden Kosten
pro Monat im dreistelligen Bereich.
Darüber hinaus müsste die Stadt das gesamte
Personal für die Verwaltung der Karten,
einschließlich Schulungen und Organisation, ohne
Finanzierung des Mehraufwands bereitstellen, was
gerade bei der Einführung der Karte einen
erheblichen Aufwand bedeutet. In Zeiten der
Haushaltssicherung würde dies die Verwaltung
finanziell und personell zusätzlich fordern.
Dinslaken leidet, wie viele Kommunen in
Deutschland, unter der Last von Aufgaben, die
von Bund und Land entschieden wurden, ohne eine
angemessene Finanzierung der Kommunen
abzusichern. Im ersten Halbjahr 2024 waren die
Sozialausgaben in Deutschland insgesamt um mehr
als zwölf Prozent gestiegen, worauf das
Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“
bereits hingewiesen hatte.
Die
Kommunen sind gezwungen für diese neuen
finanziellen Belastungen neue Kredite aufnehmen,
um diese neuen Pflichten zu erfüllen. Derartiges
Vorgehen belastet die Haushalte der Kommunen
erheblich und gefährdet ihre finanzielle
Handlungsfähigkeit. Bei dem Vorgehen ist es
vorhersehbar, dass in Zukunft immer mehr
Kommunen in finanzielle Schieflage geraten.
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel
betont: „Es ist nicht länger hinnehmbar, dass
die Kommunen, die die Kommunen als
"Krisenbewältiger" vor Ort durch immer mehr
Aufgaben von Bund und Land belastet werden, ohne
die notwendigen finanziellen Mittel dafür zu
bekommen. Wir brauchen eine faire Verteilung der
Lasten und eine auskömmliche Finanzierung, um
unsere Aufgaben erfüllen zu können.
Die
Kommunen sind das Rückgrat unserer Gesellschaft
und dürfen nicht unter der Last der Finanzierung
zusammenbrechen. Wir fordern den Bund und das
Land auf, endlich Verantwortung zu übernehmen
und uns die notwendigen Mittel zur Verfügung zu
stellen, um unsere Aufgaben wahrnehmen zu
können. Eine umfassende Lösung für die
Altschulden und eine Reform der Förderpolitik
sind dringend erforderlich, um die
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen
Regionen zu gewährleisten.“
Die
Stadtverwaltung wird eine entsprechende
Beschlussvorlage zur Bezahlkarte für die nächste
Sitzung des Stadtrates erstellen, die am 25.
März 2025 stattfinden wird. Mit dieser
Entscheidung setzt Dinslaken ein Zeichen für
eine faire und nachhaltige Finanzpolitik und
fordert Bund und Land auf, ihre Verantwortung
wahrzunehmen einheitliche Rahmenbedingungen
abzusichern und auch die Kosten zur
Bereitstellung des Personals zu übernehmen.
Kleve: Kanal- und Straßenbauarbeiten
auf dem Ulmenweg ab 4. März 2025
Ab
Dienstag, 4. März 2025, werden auf dem Ulmenweg
in Kleve-Kellen Kanal- und Straßenbauarbeiten
ausgeführt. Im Zuge einer notwendigen
Kanalsanierung erfolgt direkt auch eine
Erneuerung der Fahrbahndecke des Ulmenweges samt
Unterbau und der angrenzenden Gehwege.
Zudem wird die alte Straßenbeleuchtung auf
dem Ulmenweg demontiert und durch eine moderne
Beleuchtungsanlage in LED-Technik samt neuer
Verkabelung ersetzt. Auch die Baumscheiben der
Straßenbäume im Gehwegbereich erhalten eine
Überarbeitung und werden vergrößert, um den
Bäumen bessere Bedingungen zu bieten.

Sperrung Ulmenweg
Im Rahmen der Arbeiten muss der
Ulmenweg ab Dienstag, 4. März 2025, voll
gesperrt werden. Eine Durchfahrt von der
Schulstraße auf die Lindenstraße und umgekehrt
ist dann nicht mehr möglich. Zu einem späteren
Zeitpunkt, voraussichtlich gegen Sommer, werden
auch die Einmündung des Ulmenweges auf die
Lindenstraße sowie die Einmündung auf die
Schulstraße neu gepflastert. Für diese Arbeiten
sind zusätzliche Sperrungen notwendig, die
wiederum rechtzeitig durch die Stadt Kleve
angekündigt werden.
Insgesamt dauern die
Arbeiten auf dem Ulmenweg voraussichtlich bis
zum 30. Juli 2025 an. Anwohnerinnen und Anwohner
des Bereiches sowie die Schulleitungen der nahen
Willibrordschule sowie der Karl Kisters
Realschule werden durch die Stadt Kleve über die
Baumaßnahme und die damit verbundenen
Einschränkungen informiert.
Moers: Wirtschaftsförderung unterstützt
Vermieter von privaten Unterkünften
Die Wirtschaftsförderung der Stadt Moers
unterstützt die Vermieterinnen und Vermieter von
Ferienwohnungen, Apartments oder Gästezimmern.
Sie legen - im Vergleich zu vielen Hotels – viel
Wert auf ein individuelles Ambiente, das gezielt
beworben werden kann. Neben einer Seite Übernachtung,
in dem Reisende Privatunterkünfte finden können,
bietet auch die Moers-Broschüre eine eigene
Rubrik für privat initiierte Angebote.
Bis 7. März melden
Die Broschüre wird
gerade neu aufgelegt. Deshalb bittet die Stadt
Moerser Gastgeberinnen und Gastgeber, die bisher
noch nicht erfasst sind, sich bis spätestens
Freitag, 7. März, zu melden.
Benötigt
werden folgende Daten: Name der Anbietenden
bzw. der Unterkunft Kontaktdaten (Telefon
Festnetz / mobil / E-Mail / ggf. Adresse)
Angebot in wenigen Stichworten (Art des
Angebots, ggf. Größe, Gästezahl, besondere
Einrichtungen wie Küche, eigenes Bad, Balkon,
Gartennutzung o.ä.) Adresse Online-Auftritt
Interessierte können sich bei Mareike Filzmoser
von der Wirtschaftsförderung Moers per E-Mail
an mareike.filzmoser@moers.de oder
telefonisch unter 0 28 41 / 201-276 melden.
Stadtarchiv Moers benötigt Unterstützung bei
Recherche
Das Stadtarchiv Moers
bittet um Hilfe bei einer Recherche. Für die
Dokumentation ‚Kriegsalben‘ (niederländisch
‚Oorlogsalbums‘) untersucht das Team der
niederländischen Fernseh-Produktion De Haaien
anonyme Fotoalben von deutschen, amerikanischen
und britischen Soldaten aus dem Zweiten
Weltkrieg.
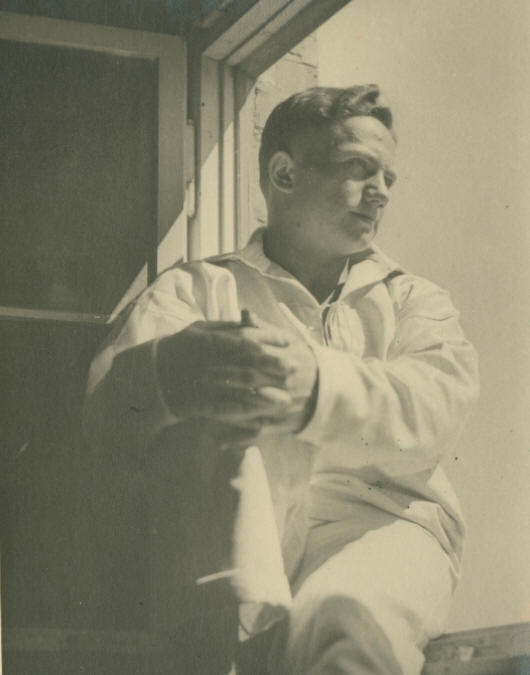
Fotos privat
Derzeit prüft das Team ein
Fotoalbum eines deutschen Soldaten, der 1939 in
Utfort gewesen ist. Mehrere Fotos wurden dort
aufgenommen, weshalb das Stadtarchiv vermutet,
dass er in dem Stadtteil für längere Zeit bei
einer Familie gelebt hat oder vielleicht sogar
aus Utfort stammt. Anhand seiner Uniform ist
bekannt, dass er im Flak-Regiment 231 (I.
Abteilung, 4. Leichte Batterie) gewesen sein
musste.
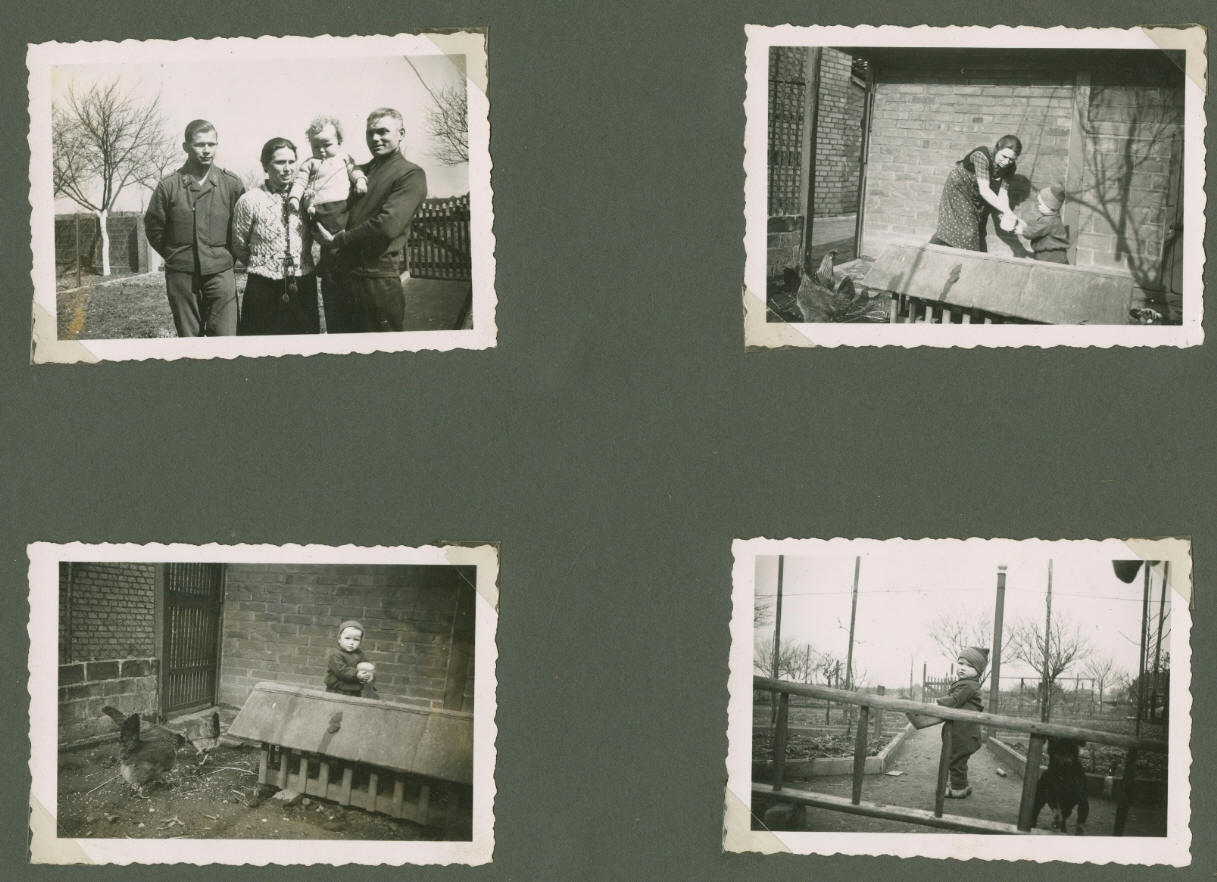
Wer die Personen auf den Bildern erkennt oder
Informationen über deutsche Soldaten hat, die
1939 in Utfort einquartiert waren, kann sich bei
beim Stadtarchiv Moers melden. Grundsätzlich
bieten die Kriegsalben einen persönlichen und
einzigartigen Einblick in ihre Erlebnisse.
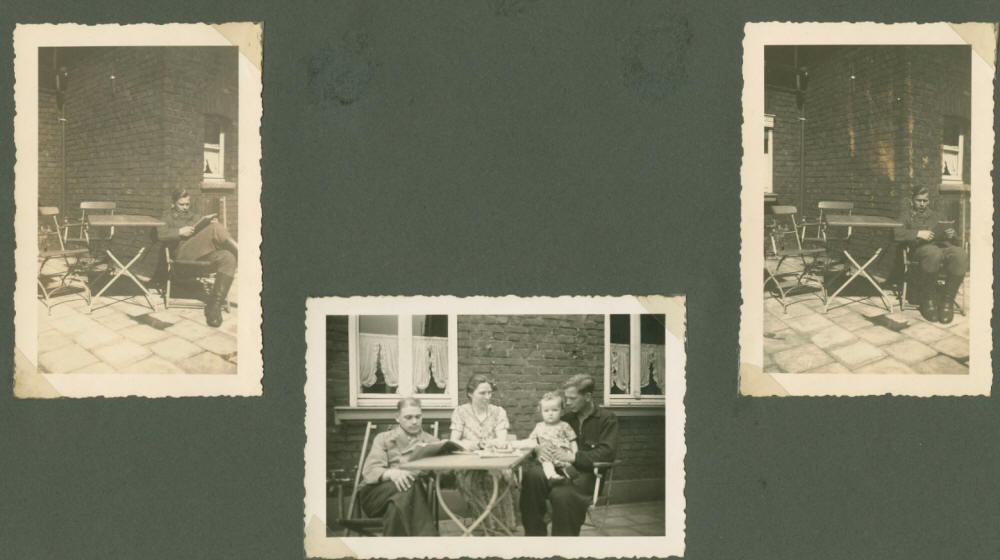
Im Rahmen der Sendung versucht das Team um
die Journalistin Yaël van der Schelde, die
Identität und individuellen Kriegsgeschichten
der Soldaten zu rekonstruieren und sie in einen
größeren historischen Zusammenhang einzuordnen.
Außerdem werden die Angehörigen gesucht, denen
sie diese Alben zurückgeben können.
Das Stadtarchiv nimmt gerne Hinweise telefonisch
unter 0 28 41 / 201 – 736 oder per E-Mail unter stadtarchiv@moers.de entgegen.
Auch persönliche Besuche im
Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum
(Wilhelm-Schroeder-Straße 10) sind möglich.
vhs Moers – Kamp-Lintfort: SEminar
Wege aus der Einsamkeit
Einsamkeit
ist ein immer größer werdendes
gesellschaftliches Problem. Deshalb widmet sich
ein Seminar der vhs Moers – Kamp-Lintfort diesem
Thema und zeigt ‚Wege aus der Einsamkeit‘ auf.
An vier Terminen geht es um die Facetten des
Alleinseins, aber auch um individuelle
Möglichkeiten, dieses Gefühl zu überwinden.
Der Kurs startet am Samstag, 8. März, um
10 Uhr in der vhs Moers,
Wilhelm-Schroeder-Straße 10. Wer an dem Seminar
teilnehmen möchte, kann sich telefonisch unter 0
28 41/201 – 565 und online unter www.vhs-moers.de anmelden.
Dinslaken: Gemeinschaftskonzert am
9. März: Übers Meer und unter Tage MGV Concordia
des Bergwerks Lohberg
Ein weiteres
Gemeinschaftskonzert von musischen Dinslakener
Vereinen steht für Sonntag, den 9. März, 17 Uhr,
auf dem Programm. In der Kathrin-Türks-Halle
werden der Shanty-Chor Hiesfeld und der MGV
Concordia des Bergwerks Lohberg 1916 abwechselnd
neue und alte Seemanns- und Bergmannslieder
singen. Im zweiten Konzertteil interpretieren
die Chöre auch einige beliebte Schlager und
Popsongs.
Die musikalischen Leiter
Thomas B. Baumann für den Shantychor und Juri
Dadiani für den MGV Concordia haben eine
Liederauswahl getroffen, die die Besucher
begeistern wird. Dafür werden auch Kerstin
Siewek und Reinhold Kämmerer sorgen, die als
Solisten auftreten. Der Bergmannschor erhält
zudem auch wieder musikalische Unterstützung von
der Pianistin Gabriele Kortas-Zens.
Der Shantychor hat ebenfalls viele
Instrumentalisten mit Rhythmus- und
Melodieinstrumenten dabei, die die klassischen
Seemannslieder begleiten. Beginn des Konzerts
ist um 17 Uhr, Saaleinlass 16:30 Uhr. Karten zum
Preis ab 10 Euro sind bei den teilnehmenden
Vereinen, der Stadtinformation am Rittertor,
allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder online
unter stadt-dinslaken.reservix.de zu erhalten.
Zum 150.
Geburtstag von Hans Böckler: DGB,
Hans-Böckler-Stiftung und Köln ehren ersten
DGB-Vorsitzenden
26. Februar: vor
150 Jahren wurde der erste Vorsitzende des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Hans
Böckler, geboren. Mit einer gemeinsamen
Kranzniederlegung ehren die Stadt Köln, der DGB
und die Hans-Böckler-Stiftung ihn auf dem
Melaten-Friedhof in Köln. Hans Böckler gilt als
Vater der Montanmitbestimmung und Begründer der
Einheitsgewerkschaft. Viele Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmer*innen
gehen auf seinen Einsatz zurück.
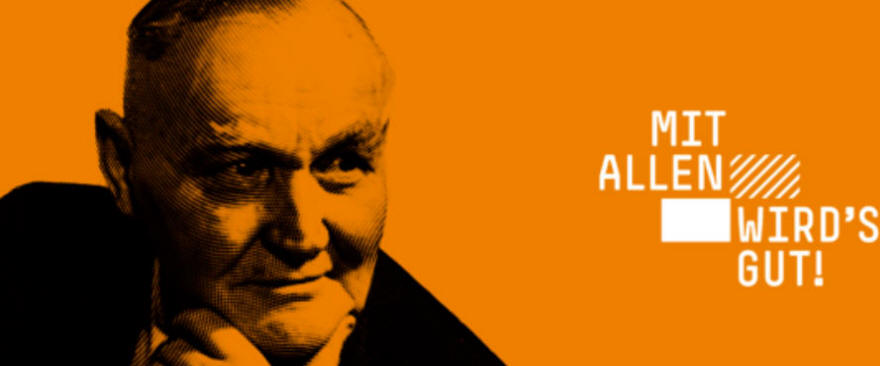
„Er hat die Mitbestimmung verankert“
Anja Weber, Vorsitzende des DGB NRW, erklärt:
„Es gibt kaum einen richtigeren Zeitpunkt als
diesen, um Hans Böckler zu gedenken. In Zeiten,
in denen die politischen Fliehkräfte zunehmen
und die Spaltung der Gesellschaft wächst, hat
uns der erste DGB-Vorsitzende Wichtiges zu
sagen. Einheit und Solidarität waren die Werte,
auf deren Fundament er den DGB begründete.
Und noch ein weiteres wichtiges Vermächtnis
von Hans Böckler bleibt uns: Er machte deutlich,
dass die Vernachlässigung von sozialer
Gerechtigkeit die Demokratie gravierend
schwächt. Politische und wirtschaftliche
Demokratie waren für ihn zwei Seiten einer
Medaille. Das gilt bis heute: Mitbestimmung und
Tarifverträge müssen als wichtiger Pfeiler
unserer Demokratie dringend gestärkt werden.“
Claudia Bogedan, Geschäftsführerin der
Hans-Böckler-Stiftung, sagt: „`Mit allen wird´s
gut‘, Kooperation bringt uns weiter, Egoismus
blockiert alle. Das ist eine zentrale Botschaft
von Hans Böckler für heute. Er hat die
Sozialpartnerschaft mitbegründet und die
Mitbestimmung verankert.
Nach den
Gräueln der NS-Zeit bestand er darauf, dass der
parlamentarischen Demokratie eine Demokratie in
der Wirtschaft zur Seite gestellt werden muss,
damit die Demokratie stabil ist. Heute wissen
wir, dass er recht hatte, wie Forschung
statistisch signifikant nachweist. Wertschätzung
von Wissenschaft und Bildung gehört ebenfalls
zum Erbe von Hans Böckler. Mit unserem Dreiklang
aus Forschung, Beratung und Stipendien für
begabte junge Menschen führen wir als
Hans-Böckler-Stiftung dieses Erbe fort.“
Witich Roßmann, Vorsitzender des DGB Köln: „Hans
Böckler hat unmittelbar nach der Befreiung Kölns
alle Gewerkschaftsströmungen in einer
Einheitsgewerkschaft zusammengebracht und dieses
Modell von Köln für Deutschland durchgesetzt –
noch heute ein Vorbild für die europäischen
Gewerkschaften. Mit Führungsstärke und achtsamer
Moderation. Seine unangefochtene Autorität
leitete der geborene Nordbayer und rheinische
Wahlkölner nicht aus dem Amt, sondern seiner
Persönlichkeit her.“
Hans Böckler wurde
am 26. Februar 1875 im mittelfränkischen
Trautskirchen geboren und lebte und arbeitete
seit 1920 in Köln. Er leitete den Kölner
Metallarbeiterverband (DMV) und den Landesbezirk
Rheinland des Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbundes bis zur Zerschlagung der
Gewerkschaften am 2. Mai 1933 durch die
Nationalsozialisten. Nach zahlreichen
Verhaftungen und gewaltsamen Übergriffen
überlebte Hans Böckler die Nazizeit in
Köln-Bickendorf.
Nach der Befreiung Kölns
durch die US-Armee begann der 70-Jährige mit dem
Aufbau einer „Einheitsgewerkschaft“, zunächst in
Köln, dann in allen drei Westzonen. Er
organisierte den großen Generalstreik der
DGB-Gewerkschaften im November 1948 gegen
Hunger, Schwarzmarktkriminalität, ungerechte
Verteilung, für Mitbestimmung und
Wirtschaftsdemokratie.
Der neu
gegründete Deutsche Gewerkschaftsbund wählte den
74-Jährigen 1949 mit überwältigender Mehrheit zu
seinem ersten Bundesvorsitzenden. Am 4. Januar
1951, mitten in den dramatischen Verhandlungen
mit Bundeskanzler Adenauer um die
Montanmitbestimmung, verlieh ihm die Stadt Köln
– zusammen mit Konrad Adenauer – die
Ehrenbürgerwürde. Nur wenige Tage nach der
erfolgreichen Durchsetzung der
Montanmitbestimmung starb er am 16. Februar
1951.
TÜV-Verband:
EU-Omnibus-Verordnung zur Nachhaltigkeit großer
Rückschritt
EU-Kommission will
Vorgaben zu Nachhaltigkeitsberichten und
Sorgfaltspflichten vereinfachen. Statt
zielgerichteter Bündelung der Berichtspflichten
sieht Vorschlag massive Deregulierung vor.
Nachhaltigkeitsberichte sollen nur für große
Unternehmen verpflichtend werden,
Sorgfaltspflichten nur für direkte Lieferanten
gelten. Gefahr, dass Nachhaltigkeitsziele
dadurch verfehlt werden.
Mit der
vorgestellten ersten „Omnibus-Verordnung“ legt
die EU-Kommission einen weitreichenden Vorschlag
zur Vereinfachung und Abschwächung bestehender
unternehmerischer Berichtspflichten in Europa
vor. Erklärtes Ziel ist es, den bürokratischen
Aufwand für Unternehmen zu reduzieren und die
Kohärenz der Anforderungen aus der Richtlinie
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), der
Sorgfaltspflichtenrichtlinie (CSDDD) und der
Taxonomie-Verordnung zu verbessern.
„Die in der heute veröffentlichten
Omnibus-Verordnung vorgeschlagenen Änderungen
schießen weit über das Ziel hinaus. Statt einer
zielgerichteten Bündelung und Vereinfachung der
Berichtspflichten aus den drei bestehenden
Rechtsakten senkt die EU-Kommission die
Anforderungen im großen Stil ab“, sagt Johannes
Kröhnert, Leiter des Brüsseler Büros des
TÜV-Verbands.
„Die mit den
Nachhaltigkeitsregulierungen ursprünglich
gesteckten Ziele – mehr Klimaschutz und weniger
Menschenrechtsverletzungen – werden damit
aufgeweicht. “ Die vorgeschlagenen Anpassungen
der CSRD würden den Anwendungsbereich der
Richtlinie drastisch einschränken. Statt für
Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten soll
die CSRD nun erst für Unternehmen ab 1.000
Beschäftigten gelten. Damit würde die Zahl der
erfassten Unternehmen um bis zu 85 Prozent
reduziert werden.
„Sollte der
Änderungsvorschlag umgesetzt werden, würde die
CSRD nicht nur für deutlich weniger Unternehmen
gelten als ursprünglich geplant. Sie wäre sogar
ein klarer regulatorischer Rückschritt zur
Vorgängerregelung, der Richtlinie über die
nichtfinanzielle Berichterstattung, die immerhin
für Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten
galt.“
Bei der CSDDD soll die
künftige Prüfung der Sorgfaltspflichten in der
Wertschöpfungskette nur auf direkte Lieferanten
begrenzt werden. „Ein wirksames
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz sollte
Risiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette
adressieren. Die Bereiche, in denen
Menschenrechts- und Umweltverstöße
typischerweise auftreten, sind die tieferen
Ebenen der Lieferkette. Mit dieser Begrenzung
wird ihnen nicht mehr systematisch begegnet. “,
so Kröhnert.
In der Praxis bestehe
damit die Gefahr, dass Unternehmen Risiken in
vorgelagerte Stufen der Lieferkette auslagern
und damit die eigentliche Zielsetzung der
Richtlinie unterlaufen. Dies könnte zu einem
Wettbewerbsnachteil für Unternehmen führen, die
bereits umfassendere Sorgfaltspflichten
etabliert haben. Die EU-Kommission reagiert mit
dem ersten Omnibus-Paket auf die massive Kritik
der Wirtschaft, dass die bürokratischen
Belastungen für die Unternehmen zu hoch seien.
Jedoch seien die geplanten
Änderungen auch für Unternehmen eine vertane
Chance. Kröhnert: „Berichtspflichten sind nicht
nur Last, sondern helfen dabei, die mit
Klimaschutz und Nachhaltigkeit verbundenen
Chancen und Risiken in den
Unternehmensaktivitäten zu identifizieren.
Letztlich wird dadurch resilienteres,
innovativeres und wettbewerbsfähigeres
Wirtschaften ermöglicht.“
Zudem
führten solche grundlegenden regulatorischen
Änderungen auch zu Planungsunsicherheiten und
zur Zurückhaltung bei notwendigen Investitionen
seitens der Unternehmen. Die vorgesehene
Verschiebung der verpflichtenden Anwendung der
CSRD sowie der CSDDD gibt den Mitgliedstaaten
nun mehr Zeit für die Umsetzung in nationales
Recht.
In Deutschland wurde von der
letzten Bundesregierung im Sommer 2024 ein
Entwurf für ein CSRD-Umsetzungsgesetz vorgelegt,
dieses wurde aber nach dem Koalitionsbruch nicht
mehr verabschiedet. Bis eine neue
Bundesregierung steht und der politische Betrieb
wieder anläuft, liegt auch die CSRD-Umsetzung
auf Eis. Der heute veröffentlichte
Omnibus-Verordnungsvorschlag wird nun von den
EU-Mitgliedsstaaten und dem EU-Parlament
geprüft, gegebenenfalls angepasst und
anschließend verabschiedet.
Als
Omnibus-Regulierungen werden Gesetzesvorhaben
bezeichnet, die verschiedene EU-Rechtsakte
gebündelt ändern und damit die gleichzeitige
Anpassung mehrerer Vorschriften ermöglichen.
Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V.
vertreten wir die politischen Interessen der
TÜV-Prüforganisationen und fördern den
fachlichen Austausch unserer Mitglieder.
Wir setzen uns für die technische und
digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von
Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und
Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind
allgemeingültige Standards, unabhängige
Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser
Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen
Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale
Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu
erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen
Austausch mit Politik, Behörden, Medien,
Unternehmen und Verbraucher:innen.

NRW: Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen
2024 das vierte Jahr in Folge rückläufig
Im Jahr 2024 haben die nordrhein-westfälischen
Bauämter Baugenehmigungen für 40 554 Wohnungen
erteilt – das waren 3 049 oder sieben Prozent
weniger als im Jahr 2023. Damit sank die Zahl
der Baugenehmigungen für Wohnungen bereits im
vierten Jahr in Folge. Niedriger war die Zahl
der Baugenehmigungen für Wohnungen zuletzt im
Jahr 2012 (39 989).
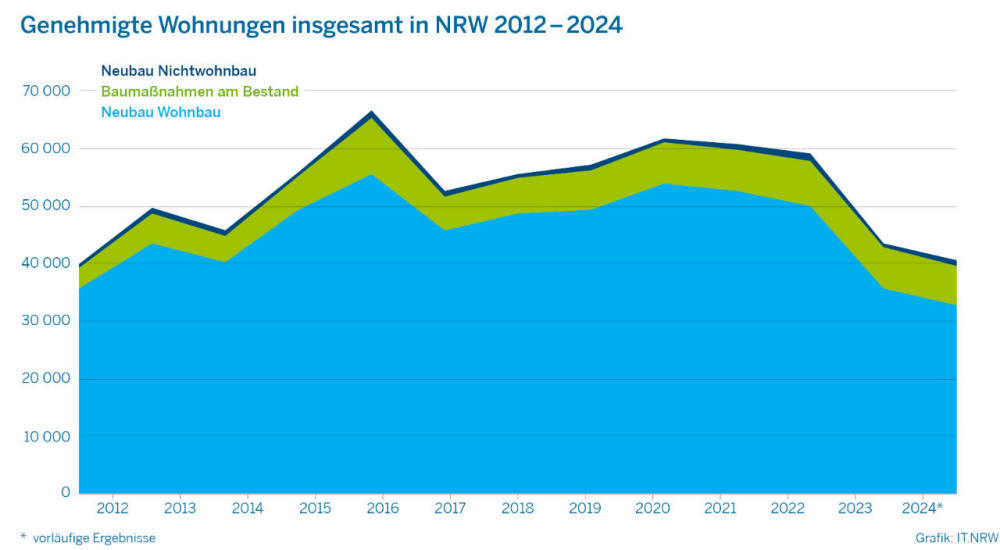
Wie das Statistische Landesamt
anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, sank die
Zahl der genehmigten Wohnungen in neu zu
errichtenden Gebäuden um 7,4 Prozent auf 33 533
– die Zahl der durch Baumaßnahmen an bereits
bestehenden Gebäuden entstehenden Wohnungen
verringerte sich um 5,1 Prozent auf 7 021.
Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser
um fast 12 Prozent gesunken
Die Zahl der
Baugenehmigungen bei den Wohnneubauten von
Einfamilienhäusern sank um 11,7 Prozent auf
5 889, bei den Zweifamilienhäusern war ein
Rückgang um 1,8 Prozent auf 1 992 Wohnungen zu
verzeichnen und die Zahl der neuen Wohnungen in
Mehrfamilienhäusern (ohne Wohnheime) reduzierte
sich im Jahr 2024 um 5,5 Prozent auf 23 427.
Darüber hinaus wurden 2024 Baugenehmigungen für
1 414 Wohnungen in Wohnheimen (2023: 2 077)
erteilt.
Weitere 811 Wohnungen
sollen in Nichtwohngebäuden (gemischt genutzte
Gebäude, die überwiegend nicht Wohnzwecken
dienen) entstehen (2023: 640). IT..NRW erhebt
und veröffentlicht als Statistisches Landesamt
zuverlässige und objektive Daten für das
Bundesland Nordrhein-Westfalen für mehr als 300
Statistiken auf gesetzlicher Grundlage.
Zahl der Studienberechtigten 2024 um
1,7 % gesunken - 373 000 Schülerinnen und
Schüler erwerben Hochschul- oder
Fachhochschulreife
Im Jahr 2024
haben rund 373 000 Schülerinnen und Schüler in
Deutschland die Hochschulreife (Abitur) oder die
Fachhochschulreife erworben. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach
vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,7
% weniger Studienberechtigte als im Vorjahr (-6
500).
Damit sank die Zahl der
Studienberechtigten bereits im dritten Jahr in
Folge. Zwar nahm die Zahl der Personen in der
relevanten Altersgruppe (17 bis 19 Jahre) zum
31. Dezember 2023 um 1,9 % gegenüber dem Vorjahr
zu. Allerdings ist dieser Anstieg auf die
Zuwanderung von Personen dieser Altersgruppe aus
dem Ausland, unter anderem aus der Ukraine,
zurückzuführen und schlägt sich nicht in einer
wachsenden Zahl der Studienberechtigen nieder.
Zahl der Studienberechtigten geht in
fast allen Bundesländern zurück Die Zahl der
Studienberechtigten ging 2024 gegenüber 2023 in
allen Bundesländern außer Bremen (+1,8 %),
Mecklenburg-Vorpommern (+0,4 %) und
Hessen (+0,2 %) zurück. Am stärksten waren die
Rückgänge in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen, die jeweils eine Abnahme der
Studienberechtigten von knapp 4 % im Vergleich
zum Vorjahr verzeichneten.
54 % der
Studienberechtigten des Jahres 2024 sind Frauen
Die Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife
erwarben vier Fünftel (81 %) der
Studienberechtigten. Ein Fünftel der
Studienberechtigten (19 %) erlangte die
Fachhochschulreife. Gut zwei Drittel (69 %) der
Studienberechtigten erwarben ihre Hochschul-
beziehungsweise Fachhochschulreife an einer
allgemeinbildenden Schule, knapp ein
Drittel (31 %) an einer beruflichen Schule.
Der Frauenanteil an den
Studienberechtigten blieb 2024 mit 54 % konstant
gegenüber dem Vorjahr. Dabei war bei den
Studienberechtigten mit Allgemeiner oder
Fachgebundener Hochschulreife der Frauenanteil
mit 55 % etwas höher, während beim Erwerb der
Fachhochschulreife das Geschlechterverhältnis
fast ausgeglichen war (51 % Frauen gegenüber
49 % Männer).
Absolventinnen und
Absolventen mit Fachhochschul- und
Hochschulreife 2024

Donnerstag,
27. Februar 2025
Ärztlicher Notdienst
an Karneval einsatzbereit – Videosprechstunde
auch für Erwachsene möglich
Wer an
den bevorstehenden Straßenkarnevalstagen im
Rheinland akute gesundheitliche Beschwerden hat,
kann den Notdienst der niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzte kontaktieren. Erste
Anlaufstellen hierfür sind die ambulanten
allgemeinen und fachärztlichen Notdienstpraxen
im Landesteil.
Informationen zu Adressen
und Öffnungszeiten der insg. gut 90
Notdienstpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung
Nordrhein (KVNO) gibt es unter
www.kvno.de/notdienst oder über die kostenlose
Servicenummer 116 117. Die Nummer ist rund um
die Uhr erreichbar. Die Telefon-Kapazitäten
werden zu Karneval noch einmal verstärkt.
Hausbesuche für nicht mobile Patientinnen
und Patienten
Erkrankte, die den Weg in eine
örtliche Notdienstpraxis nicht auf sich nehmen
können, haben die Möglichkeit, über die 116 117
einen ärztlichen Hausbesuch zu erfragen. Die
Rufnummer gibt zudem Auskunft über die
Erreichbarkeiten der regionalen Augen-, HNO-,
kinderärztlichen Notdienste im Rheinland.
Neu: Videosprechstunde künftig auch für
Erwachsene
Analog zur bereits für erkrankte
Kinder und Jugendliche etablierten
kinderärztlichen Videosprechstunde startet die
KVNO ab Samstag, den 1. März, ein digitales
Pendant für Erwachsene. Im Rahmen der
allgemeinmedizinischen Videosprechstunde haben
dann auch „große“ Erkrankte die Möglichkeit,
online eine ärztliche Erstmeinung zu erhalten.
Oftmals lässt sich schon durch diese digitale
Arztkonsultation das Aufsuchen einer ambulanten
Notdienstpraxis inklusive Anfahrt vermeiden.
Sollte die Gabe von
verschreibungspflichtigen Medikamenten notwendig
sein, ist - wie beim pädiatrischen Angebot - das
Ausstellen eines E-Rezeptes möglich. Angefragt
werden können beide Videosprechstunden-Formate
entweder telefonisch über die Servicenummer 116
117 oder online über www.kvno.de/kinder bzw.
www.kvno.de/erwachsene
Nach Erfassung
des jeweiligen gesundheitlichen Beschwerdebildes
erhalten Anrufende per E-Mail einen Termin-Link.
Wichtig: Patientinnen und Patienten sollten
unbedingt ihre Versichertendaten bzw. die des
erkrankten Kindes zur Hand haben. Um die
Videosprechstunde zu nutzen, wird neben einer
stabilen Internetverbindung ein Smartphone,
Tablet, Notebook oder einen Computer mit Kamera
und Mikrofon benötigt. Während des digitalen
Arzt-Patienten-Gesprächs sollte eine möglichst
ruhige Umgebung ohne weitere anwesende Personen
aufgesucht werden.
Die
kinderärztliche Videosprechstunde ist samstags,
sonntags und feiertags (auch Rosenmontag) von 10
bis 22 Uhr verfügbar. Das Online-Angebot für
Erwachsene ab 1. März in der Zeit von 9-21 Uhr
an Samstagen, Sonntagen sowie an Feiertagen,
ebenfalls an Rosenmontag.
Praxis-Vertretungen zwischen Altweiber und
Aschermittwoch
Zwischen dem 27. Februar
(Altweiber) und 5. März (Aschermittwoch) werden
einige Arztpraxen im Rheinland urlaubsbedingt
geschlossen bleiben. Während der
Sprechstundenzeiten übernehmen dann andere
Praxen vor Ort vertretungsweise die ambulante
Versorgung. Patientinnen und Patienten sollten
rechtzeitig auf entsprechende Praxis-Aushänge
und Angaben auf den Praxis-Anrufbeantwortern
oder Homepages achten.
Land
bringt Altschuldenentlastungsgesetz für Kommunen
auf den Weg
Das Landeskabinett hat
den Entwurf eines Gesetzes zur anteiligen
Entschuldung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen
beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 soll eine
viertel Milliarde Euro zur Verfügung stehen, um
die Städte anteilig von übermäßigen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zu
entlasten. Als nächster Schritt wird der
Gesetzentwurf in die Verbändeanhörung gegeben.
Die NRW-Städte konnten in den
vergangenen Jahren bereits einen erheblichen
Teil ihrer Liquiditätskredite tilgen, so das
Land. Sie haben von Ende 2016 bis Ende 2023
Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung um
rund 25 Prozent oder sieben Milliarden auf 20,9
Milliarden Euro reduziert. Zugleich haben die
Kommunen Finanzmittelüberschüsse aus den
vergangenen Jahren dafür eingesetzt, um in ihre
jeweilige Infrastruktur zu investieren oder
Schulden zu tilgen: 2023 überstieg der Wert der
kommunalen Investitionen erstmals zehn
Milliarden Euro.
Mit dem
Altschuldenentlastungsgesetz wird eine
wesentliche Forderung aus dem
Kommunalfinanzbericht Ruhr erfüllt, den der
Regionalverband Ruhr (RVR) jährlich vorlegt.
Auch das Aktionsbündnis "Für die Würde unserer
Städte" besteht seit langem auf Entlastung.
Die Übernahme kommunaler Kredite in die
Landesschuld werde den Städten und Gemeinden
Luft zum Atmen verschaffen, aber ohne
Beteiligung des Bundes sei die Unterstützung
nicht ausreichend, so das Bündnis. Der RVR und
die Initiative erwarten, dass der Bund seine
Zusage zur Beteiligung an einer
Kommunalentschuldung einhält. Hier richtet sich
der Appell an die neu zu formierende
Bundesregierung. idr
Dinslaken: Bürgermeisterin unterzeichnet
Beitrittserklärung zur Sicherheitskooperation
Ruhr
Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel unterzeichnete am 25.02.2025 den
Beitritt zur Sicherheitskooperation Ruhr, in der
sich die Stadt Dinslaken für eine sichere und
lebenswerte Zukunft in Dinslaken engagiert.

Im Bild neben der Bürgermeisterin: Joachim
Eschemann, Leiter der SiKo Ruhr. Dahinter
stehend von links nach rechts: Christiane Wenzel
(Leiterin Geschäftsbereich Bürgerservice, Recht,
Ordnung); Erster Beigeordneter Achim Thomae;
David Bohnes (Leiter Fachdienst Allgemeine
Ordnung, Gewerbe, Verkehr)
Die Stadt
Dinslaken setzt ein deutliches Zeichen in der
interkommunalen Zusammenarbeit gegen
Kriminalität. Bürgermeisterin Michaela Eislöffel
hat am 25. Februar 2025 die Beitrittserklärung
zur Sicherheitskooperation Ruhr (SiKo Ruhr)
unterzeichnet. Damit wird Dinslaken Teil eines
starken Netzwerks gegen Clankriminalität, das
sich der Verbesserung der Sicherheitslage im
gesamten Ruhrgebiet verschrieben hat.
Die Sicherheitskooperation Ruhr ist ein
Projekt der Landesregierung Nordrhein-Westfalens
im Rahmen der Ruhr-Konferenz. Sie verfolgt das
Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Polizei,
Strafverfolgungsbehörden, Kommunalverwaltungen
und anderen relevanten Akteuren zu
intensivieren, um Kriminalität effektiver
entgegenzutreten und die Lebensqualität im
Ruhrgebiet nachhaltig zu verbessern.
Bürgermeisterin Eislöffel betonte bei der
Unterzeichnung die Bedeutung dieses Schritts für
Dinslaken: "Durch den Beitritt zur
Sicherheitskooperation Ruhr können wir unsere
Kräfte bündeln und von den Erfahrungen anderer
Städte profitieren. Gemeinsam können wir
Kriminellen das Handwerk legen und ein sicheres
Umfeld für alle schaffen. Mir ist es ein
besonderes Anliegen, dass wir als Stadt
Dinslaken aktiv an der Gestaltung einer sicheren
Zukunft für unsere Stadt und die ganze Region
mitwirken. Die SiKo Ruhr bietet uns die ideale
Plattform, um unsere Expertise einzubringen, von
anderen zu lernen und gemeinsam innovative
Strategien gegen Kriminalität zu entwickeln."
Auch Joachim Eschemann, Leiter der
SiKo Ruhr, begrüßte den Beitritt Dinslakens
ausdrücklich: "Wir freuen uns sehr, Dinslaken
als neues Mitglied in unserer Kooperation
begrüßen zu dürfen. Kriminalität macht nicht an
Stadtgrenzen halt, daher ist eine enge
Zusammenarbeit über kommunale Grenzen hinweg
unerlässlich. Mit der Stadt Dinslaken gewinnen
wir eine engagierte Partnerin, die ihre
spezifischen Kompetenzen und Erfahrungen in
unsere gemeinsame Arbeit einbringen wird.
Nur gemeinsam können wir den kriminellen
Strukturen im Ruhrgebiet wirksam entgegentreten
und die Sicherheit für alle Menschen erhöhen."
Die Sicherheitskooperation Ruhr
setzt auf eine enge Vernetzung der beteiligten
Behörden und Institutionen. In einer gemeinsamen
Arbeitsstruktur, bestehend aus der Leitung der
Sicherheitskooperation, einer interdisziplinär
besetzten Geschäftsstelle sowie einem
Lenkungskreis, werden Informationen
ausgetauscht, Strategien entwickelt und
Maßnahmen koordiniert. Neben der Strafverfolgung
legt die SiKo Ruhr auch einen besonderen Fokus
auf die Prävention.
Arbeitsschwerpunkte waren 2024 unter anderem die
gemeinsam mit Wissenschaftler*innen sowie
Psycholog*innen entwickelten Trainings
„Bedrohungsmanagement – Professioneller Umgang
mit Konflikten und Übergriffen aus dem
Clanmilieu“ und das Thema „Prävention von
Messer- und Waffengewalt“. Bürgermeisterin
Michaela Eislöffel unterzeichnete den Beitritt
zur Sicherheitskooperation Ruhr, in der sich die
Stadt Dinslaken für eine sichere und lebenswerte
Zukunft in Dinslaken engagiert.
Moers feiert 100. Geburtstag von Hanns
Dieter Hüsch
Die Stadt Moers lässt
ihren bekannten Sohn Hanns Dieter Hüsch hoch
leben, der am 6. Mai 100 Jahre alt geworden
wäre. Der Geburtstag des Kabarettisten wird das
ganze Jahr mit mehr als 30 Veranstaltungen
gefeiert - von Ausstellungen bis hin zu Lesungen
und natürlich Kabarett.
Zu den
Höhepunkten zählt die große Hüsch-Gala am 11.
Mai. Dort sind Kabarettgrößen wie Lars Reichow,
Jochen Malmsheimer, Erwin Grosche, Kai Magnus
Sting, Wilfried Schmickler und Matthias Reuter
vertreten. Die Wegbegleiter und Freunde von
Hanns Dieter Hüschs erinnern an das Lebenswerk
des Niederrheinpoeten.
Am Geburtstag
selbst, am 6. Mai, veranstaltet das Kulturbüro
unter dem Titel "Immer mittendrin" einen
Hüsch-Markt auf dem Wochenmarkt mit Lesungen,
Musik, Ständen und Begegnungen in der
Innenstadt. An den Marktständen stehen
lebensgroße Hüsch-Figuren und zu jeder vollen
Stunde startet ein literarischer Rundgang.
idr
Infos:
http://www.huesch100.de
Martha Schönhoff gewinnt den Kreisentscheid
Wesel-Nord beim Vorlesewettbewerb
Die Jury hat entschieden: Martha Schönhoff von
der Städtischen Gesamtschule Hamminkeln ist die
beste Vorleserin im Kreis Wesel-Nord. Sie
überzeugte sowohl mit dem mitgebrachten Buch
„Ihr mich auch“ von Pia Herzog als auch in der
zweiten Runde bei einem unbekannten Text und
wird nun im April auf Bezirksebene weiter um die
Wette lesen.

Kreisentscheid Wesel-Nord Siegerin Martha
Schönhoff
Der Regionalentscheid des 66.
Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels
wurde von der Stadtbücherei Wesel organisiert.
Die 14 Schulsieger*innen des Kreises Wesel-Nord
konnten in zwei Runden ihr Lesekönnen
miteinander messen. Während in der ersten Runde
ein Text aus einem selbstgewählten Buch
vorgelesen wurde, stand in der zweiten Runde mit
dem Buch „Die goldene Schreibmaschine“ von
Carsten Henn ein fremder Text an.
Doch auch diesen meisterten die Vorleser*innen
sehr gut und erschwerten so die Entscheidung der
Jury. Diese bestand aus Birgit Niesen
(Vorlesepatin der Stadtbücherei Wesel), Sandra
Berensmeier (Kulturverwaltung der Stadt Wesel),
Theresa Welsing (Kinder- und Jugendförderung der
Stadt Wesel) und Lina Schepers (Siegerin des
Kreisentscheids 2024).
Alle
teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde und
eine Sonderauflage von „Die wundersamen Talente
der Kalendario-Geschwister“ von Louisa Söllner.
Die Siegerin Martha Schönhoff darf sich
zusätzlich noch über ein zweites Buch („RES will
nach Hause“ von Jasmine Warga) freuen, was
sicher die Wartezeit bis zur nächsten Etappe des
Wettbewerbs verkürzt.
Der seit 1959
stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der
größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er wird
von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
veranstaltet und steht unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der
Wettbewerb soll die Begeisterung für Bücher in
die Öffentlichkeit tragen, Freude am Lesen
wecken und die Lesekompetenz von Kindern
stärken.
Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert den
Vorlesewettbewerb. Auch in diesem Jahr
unterstützen darüber hinaus vier
Sparda-Regionalbanken die Aktion. Aktuelles zum
66. Vorlesewettbewerb sowie alle Informationen,
Termine und Teilnehmerschulen sind auf www.vorlesewettbewerb.de zu
finden.
Studie: Besser
Lernen mit Schilddrüsenhormonen
Schilddrüsenhormone sorgen u. a. für bessere
Konzentration und leichteres Lernen. Mediziner
der Universität Duisburg-Essen untersuchen
jetzt, wie sich mit diesen Hormonen der
Arbeitsspeicher des Gehirns beeinflussen lässt.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das
Vorhaben mit 246.300 Euro.
Der Fokus ist
auf Schilddrüsenhormone im Hippocampus
gerichtet, dem lernenden Gehirn, in dem
lebenslang neue Nervenzellen gebildet werden
können. Fehlen die Hormone, funktioniert das
Gedächtnis nicht mehr so gut. Die
Wissenschaftler wollen die Prozesse verstehen,
um Substanzen zu entwickeln, die die
Neuroplastizität des Gehirns fördern. idr
EU-Kommission stellte Clean
Industrial Deal vor
Zum Clean
Industrial Deal, den die EU-Kommission am 26.
Februar vorgestellt hat, übermittelt ein
Sprechers des Bundesbauministeriums: „Die
sektorübergreifende Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft ist ein
Kernanliegen, das wir jetzt in Europa gemeinsam,
entschlossen und rasch angehen müssen. Auch die
Entwicklung der Baukosten muss bei der
industriepolitischen Neuausrichtung eine
wichtige Rolle spielen.
Das betrifft z.
B. die Förderung CO2-armer Baustoffe ebenso wie
den Ausbau von Technologien zur Abscheidung,
Nutzung oder Speicherung von CO2 in der
Baustoffproduktion. Der geplante
Bürokratieabbau, insbesondere bei Berichts- und
Dokumentationspflichten für Unternehmen, kann
die Bauwirtschaft wirksam entlasten.
Und
auch die nun vorgesehenen vereinfachten
EU-Beihilferegelungen können zu höheren
Investitionen in klimaneutrale Technologien
beitragen, etwa bei der Schaffung neuer
Produktionskapazitäten für serielle und modulare
Bauweisen.“
Weitere Information zum Clean
Industrial Deal:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_550
IHK bildet Fachexperten für
Elektromobilität aus
Die
CO2-Preise steigen. Der Klimawandel macht die
Elektromobilität dringlicher. Unternehmen, die
auf Elektroautos setzen und eigene Ladesäulen
betreiben, profitieren von den Kostenvorteilen.
Für alle, die im Unternehmen
E-Mobilitäts-Projekte vorantreiben wollen,
bietet die Niederrheinische IHK einen Lehrgang
an. Der Kurs richtet sich an Fach- und
Führungskräfte.
Ein technisches
Verständnis oder Berufserfahrung im Umfeld der
Elektrotechnik sind von Vorteil. Der
Zertifikatslehrgang findet online statt. Er
läuft vom 29. April bis 16. Juli, dienstags und
mittwochs, von 14 bis 17:30 Uhr.
IHK-Ansprechpartnerin ist Sabrina Giersemehl,
0203 2821-382, giersemehl@niederrhein.ihk.de.
Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen.
Wesel: Kreisweite
Jugendumfrage verlängert!
Der Kreis
Kleve und die Städte mit eigenem Jugendamt
befragen aktuell Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene aus dem gesamten Kreis Kleve zu ihren
Interessen. Da einige Schulen technische
Probleme zurückgemeldet haben, haben die
Initiatoren jetzt den Umfragezeitraum
verlängert: Noch bis zum 16.03.2025 können
Interessierte teilnehmen.

Die technischen Probleme sollten behoben
sein. Der Kreis Kleve hat bereits alle Schulen
im Kreisgebiet über die Verlängerung
informiert. Bislang haben rund 8.000 der
insgesamt 72.000 6- bis 27-Jährigen an der
Online-Umfrage teilgenommen. Ziel ist es, die
Wünsche und Herausforderungen der jungen
Generation besser zu verstehen und diese in die
kommunale Jugendhilfeplanung einfließen zu
lassen.
Je mehr Menschen teilnehmen,
desto exakter werden die Ergebnisse. Die Umfrage
ist einfach und kann online ausgefüllt werden.
Alle Antworten bleiben anonym. Den Link zur
Umfrage der jeweiligen Zielgruppe und weitere
Infos gibt es auf der Homepage des Kreises
Kleve: www.kreis-kleve.de/jugendumfrage
Moers: Spaziergang durch NRW für Menschen 60+
Wer gerne spazieren geht, aber
nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, für den hat
die vhs Moers – Kamp-Lintfort ein passendes
Angebot: Zweimal im Monat jeweils freitags
treffen sich Menschen über 60 Jahre und
entdecken gemeinsam Seen, botanische Gärten,
Burgen oder planen eine Schiffahrt.
Am Freitag, 7. März, kommt die Gruppe im Alten
Landratsamt, Kastell 5b, um 11 Uhr zu einer
Vorbesprechung zusammen, bei der die genauen
Termine und Ausflugsziele geplant werden.
Weitere Informationen gibt es telefonisch unter
0 28 41/201 – 565 sowie online unter www.vhs-moers.de.
Dort können sich Interessierte auch für die
Vorbesprechung anmelden.
Kreative Kurse bei der vhs Moers –
Kamp-Lintfort im März
Im März bietet
die vhs Moers – Kamp-Lintfort wieder
Kreativkurse an. Am Donnerstag, 6. März, startet
ab 17 Uhr ‚Illustrative Collagen aus bemaltem
Papier‘. Ziel ist es, persönliche Naturcollagen
mit ganz eigenem Charme zu erstellen. Der Kurs
findet insgesamt sechsmal jeweils donnerstags in
der vhs Moers an der Wilhelm-Schroeder-Straße 10
statt.

Foto: Katja Jäger
Am Samstag, 15. März,
beginnt dann um 11 Uhr ein ‚Zentangle®
Einsteigerkurs‘. Dabei handelt es sich um eine
Zeichen- und Meditationsmethode, die schnell zu
erlernen ist. Ein Zentangle ist eine Zeichnung
aus Formen mit sich wiederholenden Mustern aus
einer Kombination von Punkten, Linien, einfachen
Kurven und Kreisen. Da die Musterbestandteile
immer wiederkehren, fördert diese Zeichenmethode
die Konzentration und bietet Entspannung.
Auch dieser Workshop findet in den Räumen
der vhs Moers, Wilhelm-Schroeder-Straße 10
statt.
Eine rechtzeitige Anmeldung zu den
Kreativkursen ist erforderlich und telefonisch
unter 0 28 41/201 - 565 und online unter
www.vhs-moers.de möglich.
Moers: Vom Tatort bis zum Imperial-March aus
Star Wars: Landespolizeiorchester gastiert mit
Filmmusik aus 50 Jahren
Die
Enni-Eventhalle kann große Konzerte. Nach dem
als dem gesell-schaftlichen Ereignis zum
Jahresauftakt längst etablierten
Neujahrs-konzert dürfen sich Niederrheiner am
13. März erneut auf einen nicht alltäglichen
Musikgenuss freuen.
Das
Landespolizeiorchester NRW gastiert zum
50-jährigen Bestehen des Kreises Wesel und der
Kreis-polizeibehörde Wesel nach einigen Jahren
wieder in Moers und präsentiert ein
Frühjahrs-Benefizkonzert mit einem vielseitigen
Pro-gramm aus 50 Jahren Filmmusik. Erneut haben
die Volksbank Niederrhein und die ENNI Energie &
Umwelt Niederrhein (Enni) als Sponsoren dazu
beigetragen, ein solches Spitzenorchester in die
Grafenstadt zu holen. Noch gibt es Tickets, mit
denen das Publikum auch eine Spendenaktion
zugunsten der Polizeistiftung NRW unter-stützt.
Das Frühjahrskonzert ist ein besonderes
Geschenk der Kreispolizeibehörde an den Kreis
Wesel, der in diesem Jahr sein 50-jähriges
Bestehen feiert. Kenner wissen: Ein Orchester in
dunkelblauen Polizeiuniformen, das ist auch in
Moers nicht alltäglich.
Das
Landespolizeiorchester NRW (LPO NRW) ist das
Repräsentationsorchester der Landesregierung
NRW. Dessen 45 Berufsmusiker aus neun Nationen
werden auch in Moers mit einem vielseitigen
Repertoire und enormer musikalischer Bandbreite
von klassischer Musik über Jazz bis hin zu
modernen Kompositionen aufwarten.
Garanten dafür sind auch der renommierte
US-amerikanische Dirigent Scott Lawton sowie der
vielfach ausgezeichnete Diplom-Gitarrist,
-Komponist und -Arrangeur Hans Steinmeier, die
die musikalische Leitung übernehmen. Sie
versprechen dem niederrheinischen Publikum eine
Auswahl aus 50 Jah-ren Filmmusik. Auf dem
Programm stehen unter anderem die Melo-dien aus
dem Tatort, Das Boot, Fluch der Karibik und Star
Wars.
Wichtig dabei: „Die
Veranstaltung richtet sich an alle
musikbegeisterten Bürgerinnen und Bürger unseres
schönen Niederrheinkreises. Mit dem Besuch und
der Unterstützung des Benefizgedankens senden
Gäste auch starkes Zeichen der Solidarität mit
unseren Polizistinnen und Polizisten“, freut
sich auch Landrat Ingo Brohl darauf, in der
Eventhalle einen unvergesslichen Abend zu
erleben.
Enni-Vorstand Lutz Hormes
rechnet wieder mit einer ausverkauften
Eventhalle im Solimare. „Trotz guter Nachfrage
gibt es aktuell aber noch Tickets“, empfiehlt er
Musikliebhabern sich dennoch schnell einen der
freien Plätze zu sichern. Die Tickets gibt es
für 25 Euro zuzüglich System- und
Vorverkaufsgebühren bei der Stadt- und
Touristeninformation (MoersMarketing GmbH) in
der Steinstraße oder online unter
ti-ckets.esn-eg.de/fruehjahrskonzert.
Zum 150. Geburtstag von Hans Böckler:
DGB, Hans-Böckler-Stiftung und Köln ehren ersten
DGB-Vorsitzenden
26. Februar: vor
150 Jahren wurde der erste Vorsitzende des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Hans
Böckler, geboren. Mit einer gemeinsamen
Kranzniederlegung ehren die Stadt Köln, der DGB
und die Hans-Böckler-Stiftung ihn auf dem
Melaten-Friedhof in Köln. Hans Böckler gilt als
Vater der Montanmitbestimmung und Begründer der
Einheitsgewerkschaft. Viele Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmer*innen
gehen auf seinen Einsatz zurück.
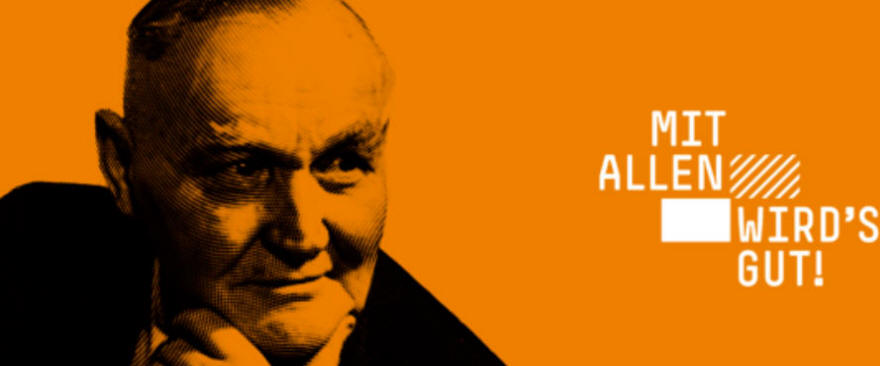
„Er hat die Mitbestimmung verankert“
Anja Weber, Vorsitzende des DGB NRW, erklärt:
„Es gibt kaum einen richtigeren Zeitpunkt als
diesen, um Hans Böckler zu gedenken. In Zeiten,
in denen die politischen Fliehkräfte zunehmen
und die Spaltung der Gesellschaft wächst, hat
uns der erste DGB-Vorsitzende Wichtiges zu
sagen. Einheit und Solidarität waren die Werte,
auf deren Fundament er den DGB begründete.
Und noch ein weiteres wichtiges Vermächtnis
von Hans Böckler bleibt uns: Er machte deutlich,
dass die Vernachlässigung von sozialer
Gerechtigkeit die Demokratie gravierend
schwächt. Politische und wirtschaftliche
Demokratie waren für ihn zwei Seiten einer
Medaille. Das gilt bis heute: Mitbestimmung und
Tarifverträge müssen als wichtiger Pfeiler
unserer Demokratie dringend gestärkt werden.“
Claudia Bogedan, Geschäftsführerin der
Hans-Böckler-Stiftung, sagt: „`Mit allen wird´s
gut‘, Kooperation bringt uns weiter, Egoismus
blockiert alle. Das ist eine zentrale Botschaft
von Hans Böckler für heute. Er hat die
Sozialpartnerschaft mitbegründet und die
Mitbestimmung verankert.
Nach den
Gräueln der NS-Zeit bestand er darauf, dass der
parlamentarischen Demokratie eine Demokratie in
der Wirtschaft zur Seite gestellt werden muss,
damit die Demokratie stabil ist. Heute wissen
wir, dass er recht hatte, wie Forschung
statistisch signifikant nachweist. Wertschätzung
von Wissenschaft und Bildung gehört ebenfalls
zum Erbe von Hans Böckler. Mit unserem Dreiklang
aus Forschung, Beratung und Stipendien für
begabte junge Menschen führen wir als
Hans-Böckler-Stiftung dieses Erbe fort.“
Witich Roßmann, Vorsitzender des DGB Köln: „Hans
Böckler hat unmittelbar nach der Befreiung Kölns
alle Gewerkschaftsströmungen in einer
Einheitsgewerkschaft zusammengebracht und dieses
Modell von Köln für Deutschland durchgesetzt –
noch heute ein Vorbild für die europäischen
Gewerkschaften. Mit Führungsstärke und achtsamer
Moderation. Seine unangefochtene Autorität
leitete der geborene Nordbayer und rheinische
Wahlkölner nicht aus dem Amt, sondern seiner
Persönlichkeit her.“
Hans Böckler wurde
am 26. Februar 1875 im mittelfränkischen
Trautskirchen geboren und lebte und arbeitete
seit 1920 in Köln. Er leitete den Kölner
Metallarbeiterverband (DMV) und den Landesbezirk
Rheinland des Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbundes bis zur Zerschlagung der
Gewerkschaften am 2. Mai 1933 durch die
Nationalsozialisten. Nach zahlreichen
Verhaftungen und gewaltsamen Übergriffen
überlebte Hans Böckler die Nazizeit in
Köln-Bickendorf.
Nach der Befreiung Kölns
durch die US-Armee begann der 70-Jährige mit dem
Aufbau einer „Einheitsgewerkschaft“, zunächst in
Köln, dann in allen drei Westzonen. Er
organisierte den großen Generalstreik der
DGB-Gewerkschaften im November 1948 gegen
Hunger, Schwarzmarktkriminalität, ungerechte
Verteilung, für Mitbestimmung und
Wirtschaftsdemokratie.
Der neu
gegründete Deutsche Gewerkschaftsbund wählte den
74-Jährigen 1949 mit überwältigender Mehrheit zu
seinem ersten Bundesvorsitzenden. Am 4. Januar
1951, mitten in den dramatischen Verhandlungen
mit Bundeskanzler Adenauer um die
Montanmitbestimmung, verlieh ihm die Stadt Köln
– zusammen mit Konrad Adenauer – die
Ehrenbürgerwürde. Nur wenige Tage nach der
erfolgreichen Durchsetzung der
Montanmitbestimmung starb er am 16. Februar
1951.
BMDV, DVR und DGUV starten
Plakatkampagne gegen Drogen und Ablenkung am
Steuer
Das Bundesministerium für
Digitales und Verkehr (BMDV),der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat (DVR) und die
Berufsgenossenschaften, Unfallkassen sowie ihr
Spitzenverband Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV) machen in einer
bundesweiten Plakatkampagne auf die Gefahren von
Alkohol, Cannabis und Smartphones am Steuer
aufmerksam. Neue Motive der „Runter vom
Gas“-Kampagne warnen auf mehr als 700 Plakaten
an Autobahnen und Raststätten.

Die Kampagne setzt auf eindringliche Bilder und
klare Botschaften, um Verkehrsteilnehmende für
drei unterschiedliche Unfallursachen zu
sensibilisieren. Die Plakate zeigen die
potenziellen Folgen von Alkohol- und
Cannabiskonsum sowie Smartphone-Nutzung am
Steuer auf und appellieren an die
Eigenverantwortung der Fahrerinnen und Fahrer.
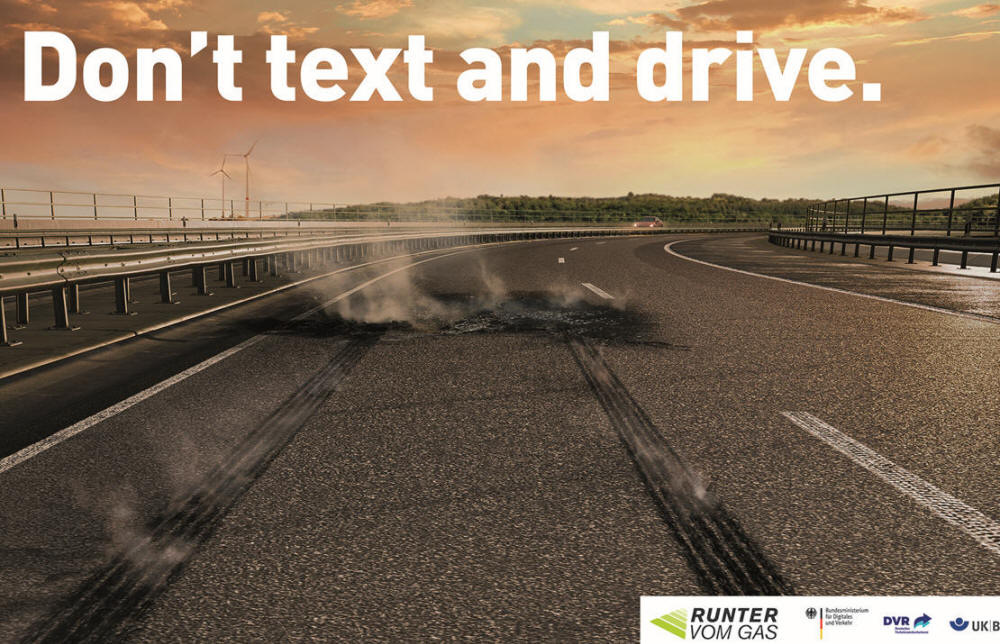
Sie zeigen international verständliche
Botschaften in englischer Sprache, um auch
Reisende und Berufskraftfahrende aus dem Ausland
zu erreichen. Auf einem der Motive versinkt etwa
ein Pkw im Bierglas, auf einem anderen fliegt
ein Unfallauto neben einem Joint durch die Luft.

Plakate appellieren: Don’t drink and drive
Bundesminister Dr. Volker Wissing: „Wer unter
dem Einfluss von Alkohol und anderen Drogen oder
abgelenkt durch sein Smartphone am
Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur
sich selbst, sondern auch andere Menschen.
Drogen und Straßenverkehr passen absolut nicht
zusammen.
Und auch das Smartphone ist Gift
für die Konzentration am Steuer. Mit unserer
neuen Plakatkampagne wollen wir die
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
eindringlich vor diesen Gefahren warnen und um
mehr Verantwortungsbewusstsein im Straßenverkehr
werben. Fahren Sie stets mit klarem Kopf und
freiem Blick!“
Darauf weist auch der DVR
als Mitinitiator der Kampagne hin. DVR-Präsident
Manfred Wirsch „Die neuen Motive der Kampagne
‚Runter vom Gas‘ sprechen eine klare Sprache:
Alkohol, Cannabis und Smartphone-Nutzung im
Straßenverkehr sind lebensgefährlich. Ganz im
Sinne der Vision Zero wollen wir ein starkes
Zeichen für mehr Sicherheit auf unseren Straßen
setzen. Wer trinkt oder kifft, fährt nicht. Und
wer sein Handy benutzen möchte, steuert den
nächsten Parkplatz an. Mit den Botschaften auf
den aktuellen Autobahnplakaten appellieren wir
an das verantwortungsvolle Handeln aller
Verkehrsteilnehmenden.“
Im Jahr 2023
ereigneten sich in Deutschland 15.652
Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter
Alkoholeinfluss. Dabei sind 198 Menschen ums
Leben gekommen, 18.686 sind verletzt worden,
davon 4.262 schwer. Hinzu kommen täglich acht
polizeilich registrierte Unfälle mit
Personenschaden durch den Einfluss weiterer
Drogen. Auch die Ablenkung am Steuer durch
elektronische Geräte wie Smartphones ist
inzwischen weit verbreitet. Wer während der
Fahrt textet, erhöht das Unfallrisiko erheblich.
Die Kampagne wird durch Informationen auf
der Website www.runtervomgas.de sowie den
Social-Media-Kanälen (Facebook:
www.facebook.com/RunterVomGas und Instagram:
www.instagram.com/runtervomgas_offiziell)
begleitet.
Zur Kampagne „Runter vom Gas“:
Initiatoren der Verkehrssicherheitskampagne
„Runter vom Gas“ sind das Bundesministerium für
Digitales und Verkehr (BMDV) und der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat (DVR). Mit klaren
Botschaften sensibilisiert „Runter vom Gas“ seit
2008 für die Risiken im Straßenverkehr sowie die
vielfältigen Unfallursachen – und trägt dadurch
zu mehr Sicherheit auf Deutschlands Straßen bei.
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung ist
Kooperationspartner der Plakatierung.

Staatsdefizit erhöht sich im Jahr 2024 auf
118,8 Milliarden Euro
Sowohl Bund,
Länder, Gemeinden als auch die
Sozialversicherung verzeichnen Defizite Das
Finanzierungsdefizit des Staates lag nach
vorläufigen Berechnungen im Jahr 2024 bei 118,8
Milliarden Euro. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, war das staatliche
Defizit somit um 15,0 Milliarden Euro höher als
im Jahr 2023. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt
(BIP) in jeweiligen Preisen errechnet sich für
das Jahr 2024 eine Defizitquote von 2,8 % (2023:
2,5 %).
Bei den Ergebnissen handelt es
sich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen
Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
(ESVG) 2010. Sie bilden die Grundlage für die
Überwachung der Haushaltslage in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) nach
dem Stabilitäts- und Wachstumspakt
(Maastricht-Kriterien) und sind nicht identisch
mit dem Finanzierungssaldo des Öffentlichen
Gesamthaushalts in Abgrenzung der
Finanzstatistiken.
Finanzierungsdefizit
des Bundes sinkt gegenüber dem Vorjahr um 30,5
Milliarden Euro
Mit 62,3 Milliarden Euro
entfiel gut die Hälfte des gesamtstaatlichen
Finanzierungsdefizits im Jahr 2024 auf den Bund.
Allerdings konnte der Bund sein
Finanzierungsdefizit damit gegenüber dem Vorjahr
um 30,5 Milliarden Euro verringern. Bei Ländern
und Gemeinden gab es hingegen deutliche
Defizitzuwächse: Das Defizit der Länder
verdreifachte sich im Vorjahresvergleich auf
27,3 Milliarden Euro (2023: 9,0 Milliarden
Euro).
Das Defizit der Gemeinden erhöhte
sich um 7,6 Milliarden Euro auf 18,6 Milliarden
Euro. Die Sozialversicherung wies im Jahr 2024
ein Finanzierungsdefizit von 10,6 Milliarden
Euro auf, nachdem sie 2023 noch einen Überschuss
von 9,0 Milliarden Euro erreicht hatte. Damit
verzeichneten erstmals seit dem Jahr 2009 alle
vier Teilsektoren des Staates ein
Finanzierungsdefizit.
Steuereinnahmen und
Sozialbeiträge steigen
Die Einnahmen des
Staates in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen betrugen 2 012,9 Milliarden
Euro und überschritten damit im Jahr 2024
erstmals die Marke von 2 Billionen Euro. Im
Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einnahmen des
Staates um 4,8 %.
Die Steuereinnahmen des
Staates erhöhten sich im Jahr 2024 um 3,5 %. Bei
der Mehrwertsteuer wurde ein Zuwachs von 2,4 %
verzeichnet, die Einnahmen aus Einkommensteuern
stiegen um 3,6 %. Die Sozialbeiträge waren um
6,5 % höher als im Vorjahr. Die Zinseinnahmen
des Staates stiegen gegenüber dem Vorjahr um
13,9 %. Höhere Einnahmen aus der Lkw-Maut
aufgrund des im Dezember 2023 eingeführten
CO2-Zuschlags trugen ebenfalls zum Anstieg der
staatlichen Einnahmen bei.
Trotz
auslaufender Energiepreisbremsen steigen die
Ausgaben stärker als die Einnahmen
Die
Ausgaben des Staates in Abgrenzung der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erhöhten
sich im Jahr 2024 um 5,3 % auf 2 131,6
Milliarden Euro. Sie stiegen damit stärker als
die Einnahmen.
Die Zinsausgaben lagen im
Jahr 2024 um 24,2 % höher als im Vorjahr. Die
monetären Sozialleistungen stiegen um 7,0 %.
Dies resultierte in erster Linie aus höheren
Ausgaben für Renten und Pensionen. Erheblich
mehr wurde auch für das Pflegegeld und für das
Bürgergeld ausgegeben.
Die sozialen
Sachleistungen nahmen um 8,0 % zu. Dies lag
unter anderem an Mehrausgaben für
Krankenhausbehandlungen, Medikamente und Pflege
sowie an höheren Ausgaben in den Bereichen der
Jugend-, Eingliederungs- und Sozialhilfe.
Dagegen sanken die Subventionen um 35,6 %, weil
die Entlastungsmaßnahmen (Energiepreisbremsen)
für hohe Energiepreise Ende 2023 endeten.
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 2024
um 0,7 % niedriger als im Vorjahr
Auftragseingang
im Bauhauptgewerbe, Jahr 2024
-0,7 % zum
Vorjahr (real)
+1,1 % zum Vorjahr (nominal)
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe,
Dezember 2024
-7,7 % zum Vormonat (real,
saison- und kalenderbereinigt)
+0,1 % zum
Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)
+0,6
% zum Vorjahresmonat (nominal)
Der reale
(preisbereinigte) Auftragseingang im
Bauhauptgewerbe ist im Jahr 2024 um 0,7 %
gegenüber dem Vorjahr gesunken. Mit einem
Volumen von 103,5 Milliarden Euro lag der
nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang
um 1,1 % über dem Vorjahresniveau und damit im
zweiten Jahr in Folge im dreistelligen
Milliardenbereich, wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt.
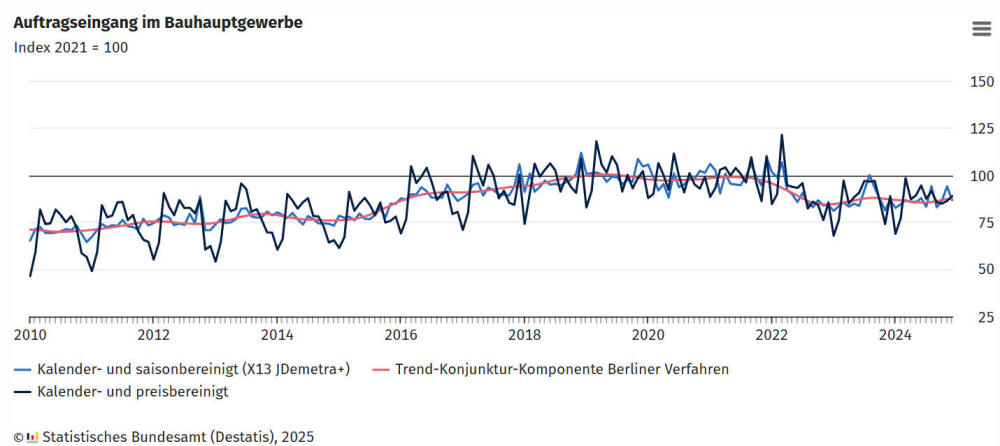
Im Hochbau lagen die Auftragseingänge
mit 47,2 Milliarden Euro real 5,0 % und nominal
4,0 % unter dem Vorjahresergebnis.
Dabei
verzeichnete der Wohnungsbau mit real -3,5 %
(nominal: -2,4 %) geringere Einbußen als der
Nichtwohnungsbau (real: -5,8 %, nominal:
-4,8 %). Der Auftragseingang im Tiefbau lag
dagegen mit 56,3 Milliarden Euro real 3,4 % und
nominal 5,7 % höher als im Vorjahr.
Großaufträge, vor allem bei der Autobahn-,
Brücken- und Tunnelsanierung und beim Ausbau des
Stromnetzes, trugen maßgeblich zum diesem
Rekordergebnis bei.
Auftragseingang
sinkt im Dezember 2024 um 7,7 % zum Vormonat
Im Dezember 2024 lag der reale (preisbereinigte)
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe kalender- und
saisonbereinigt 7,7 % unter dem November 2024.
Im Vorjahresvergleich lag der reale
Auftragseingang im Dezember 2024
kalenderbereinigt 0,1 % niedriger. Der
Auftragseingang betrug rund 8,7 Milliarden Euro.
Das waren nominal (nicht preisbereinigt) 0,6 %
mehr als im Dezember 2023.
Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe real gesunken
Der Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe lag im
Jahr 2024 real 1,0 % niedriger als im Vorjahr.
Nominal lag er 0,8 % höher und erreichte einen
neuen Höchststand von 114,8 Milliarden Euro.
Innerhalb der einzelnen Bauarten erwirtschaftete
der gewerbliche Tiefbau mit 25,1 Milliarden Euro
den höchsten Jahresumsatz, der gewerbliche
Hochbau folgte mit 24,8 Milliarden Euro.
In dieser Statistik werden alle Betriebe
von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen
erfasst. Im Jahr 2024 waren das rund
9 500 Betriebe und damit 1,5 % weniger als im
Vorjahr. Damit sank die Zahl dieser Betriebe im
Jahr 2024 erstmals nach 14 Jahren (2009:
7 000 Betriebe) kontinuierlichen Wachstums.
In den befragten Betrieben waren 2024 im
Jahresdurchschnitt 534 200 Personen tätig. Das
waren rund 2 200 oder 0,4 % weniger als im Jahr
zuvor. Die Entgelte lagen im gleichen Zeitraum
nominal 4,7 % über dem Vorjahresergebnis und
ergaben eine Gesamtsumme von 25,2 Milliarden
Euro. Dabei wurden etwa 614 Millionen
Arbeitsstunden (-0,6 % gegenüber 2023) auf
Baustellen geleistet.
Mittwoch, 26.
Februar 2025
Danke an
Wahlhelfer*innen
Die Stadt
Dinslaken dankt allen Wahlhelfer*innen für die
Unterstützung bei der Bundestagswahl 2025.
Insgesamt haben etwa 535 engagierte Menschen –
darunter rund 300 Verwaltungsmitarbeiter*innen
und rund 235 weitere freiwillige Helfer*innen
aus dem Stadtgebiet – einen unverzichtbaren
Beitrag zur Demokratie geleistet.
"Freie und faire Wahlen sind das Fundament
unserer Demokratie. Mit ihrem Engagement leisten
Wahlhelfer*innen einen unschätzbaren Dienst für
unsere Gesellschaft. Wir sind dankbar für die
gute Zusammenarbeit und die reibungslose
Durchführung der Wahl. Vielen Dank für Ihre
Bereitschaft, sich für unsere Demokratie
einzusetzen", so Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel.
Altweiber live - Die
Party in Moers!
Die mega Sause an
Altweiber! Besucht die Karnevalsfreunde
Holderberg zur wahrscheinlich größten
Altweiber-Party der Stadt! Übrigens, nicht nur
auf Frauen, jede/r ab 18 Jahren ist willkommen!

Tickets gibt es direkt online unter
https://kfh.mein-ticket.cloud/kfh.mein-ticket.cloud/
Für beste Stimmung sorgt der Kölner DJ
Toni und einige Live-Acts:
Torben Klein
Sänger und Komponist zahlreicher Kölscher Hits
wie "Für die Iwigkeit" oder "Home is where the
Dom is"), ehemaliger Frontmann der Kult-Band
Räuber.
Big Maggas
Die schönste
Boygroup der Welt! Schräge Showeinlagen und
mitreißende Animationen sorgen für allergrößten
Spaßfaktor!
Tacheles
Die Band aus Köln
nimmt ihr Publikum mit auf eine musikalische
Achterbahn, bei der man nie weiß, in welche
Richtung sie in der nächsten Sekunde abbiegt.
Rhienstädter
DIE Karnevalsband aus Krefeld!
Hier sind 111 % Karneval garantiert! Die Band
bietet eine tolle Mischung aus alten und neuen
Karnevalsliedern, gemixt mit Rock, Pop und
Schlager. Veranstaltungsdatum 27.02.2025 - 17:11
Uhr - 28.02.2025 - 02:00 Uhr. Veranstaltungsort:
Filder Straße 142.
Moers:
Einführung in den Dartsport
Hand-Augen-Koordination, Konzentration und
Zielgenauigkeit – das wird beim Dartsport
trainiert. Einen Einführungskurs in diese
Sportart bietet die vhs Moers – Kamp-Lintfort am
Samstag, 1. März, in Kooperation mit dem TV
Kapellen an. Ab 12 Uhr lernen die Teilnehmenden
die Grundlagen des Steeldarts mit einem
klassischen Pfeil, bei dem die Spitze aus Metall
besteht.
Erfahrene Ligaspieler
vermitteln beim TV Kapellen, Lauersforter Straße
2, die Spielregeln, die richtige Technik, die
Griffhaltung und erklären die Flugeigenschaften
der Pfeile. Der Kurs richtet sich sowohl an
Anfänger und Anfängerinnen als auch an
ambitionierte Hobbyspieler und –spielerinnen,
die sich verbessern möchten. Eine Anmeldung für
den Dartkurs ist telefonisch unter 0 28 41/201 –
565 sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.
Sonderabfuhr von Baum- und
Strauchschnitt Enni sammelt im März in Moers
wieder Grünbündel ein
Es ist unverkennbar; Die Natur erwacht langsam
aus ihrem Winterschlaf und erste Knospen
kündigen den Frühling an. Auch für Hobbygärtner
gilt es deswegen nun wieder, den Pflanzen,
Blumen und Bäumen ihren ersten Schliff zu
verpassen. „Beim Frühjahrsputz fällt in den
Moerser Gärten tonnenweise Grünschnitt aus
Zweigen und Ästen an“, weiß Ulrich Kempken, der
bei Enni den Entsorgungsbereich leitet.
Auch in diesem Jahr bietet er mit seinem
Entsorgungsteam deswegen Moerser Bürgern wieder
einen kostenlosen Abholservice an. „Vom 3. bis
7. März holen wir in allen Moerser Stadtteilen
den Strauchschnitt ab. Die Einteilung der
Reviere entspricht denen für die
Biotonnenabfuhr, die Abfuhr verteilt sich aber
gleichmäßig auf den Abholungszeitraum. Um genau
zu gehen, sollten Bürger in den Abfallkalender
schauen.“
Zum Auftakt der
Gartensaison ist die Grünschnittabfuhr der Enni
gerne gesehen. Denn gerade beim ersten Strauch-
und Baumschnitt des Jahres türmen sich oft
größere Mengen an Gartenabfällen. „Und die sind
in der Regel sperrig und damit nur schwer mit
dem eigenen Auto abzufahren“, begründet Kempken
den zusätzlichen Service. Dabei bittet er die
Bürger, den Strauch- und Baumschnitt zu bündeln
und dafür nur Kordeln aus Naturfasern oder
Baumwollschnüre zu verwenden.
„Die
können kompostiert werden.“ Auch Äste können bis
zu einem Durchmesser von fünf Zentimetern dabei
sein. Die Bündel sollten am Tag der Abfuhr um
sieben Uhr morgens an der Straße liegen, nicht
zu groß und zu schwer sein. „Schließlich müssen
unsere Mitarbeiter einige hundert pro Tag davon
mit der Hand verladen.“
Der erste
Rasenschnitt ist am besten in der braunen
Biotonne aufgehoben. Tausende Moerser Haushalte
entsorgen in ihr bereits ihre Küchen- sowie
Gartenabfälle und in der Frühjahrs- und
Sommerzeit eben auch den Rasen. „Die Biotonne
überzeugt durch ihre Vorteile für die Umwelt und
das Portemonnaie“, betont Kempken.
„Vor allem spart sie aber Zeit. Denn die Fahrt
zum Kreislaufwirtschaftshof (KWH) entfällt in
jedem Fall.“ Auch können Moerser Bürger
Gartenabfälle, wie Rasenschnitt hierüber
entsorgen. „Bei dem fällt am Kreislaufwirtschaft
zudem eine Gebühr an, da der Gesetzgeber einen
sogenannten Eigenkompostierabschlag fordert.“
Moers: Karnevalsparty
Im Anschluss an den Moerser Nelkensamstagszug
geht’s wieder zur legendären Karnevalsparty ins
Bollwerk 107! DJ’s sorgen für die perfekte
Partystimmung! Tickets gibt es ausschließlich
an der Abendkasse!Veranstaltungsdatum 01.03.2025
- 16:00 Uhr - 02.03.2025 - 00:00 Uhr.
Veranstaltungsort Zum Bollwerk 107, 47441 Moers.
Moers: Kinderkarneval
Die Anne-Frank Gesamtschule veranstaltet in
Zusammenarbeit mit dem KarnGes Elfenrat
Moers-Eick e.V. den Kinderkarneval im
Kulturzentrum Rheinkamp.
Veranstaltungsdatum 02.03.2025 - 14:30
Uhr - 17:15 Uhr. Veranstaltungsort
Kopernikusstraße 9, 47445 Moers .Veranstalter
Anne-Frank-Gesamtschule, Rheinkamp.
Moers: Rund um den Königlichen
Hof
Auf einem Rundgang um den Königlichen Hof kommt
die abwechslungsreiche und spannende Entwicklung
des alten und neuen Verkehrs-, Geschäfts- und
Schulzentrums zur Sprache.
Wichtige
und umkämpfte städtebauliche Projekte der
Zwischen- und Nachkriegszeit stehen im
Mittelpunkt, z.B. der im Zuge der
Altstadtsanierung autogerechte Umbau der
Stadtmitte in den 1970er Jahren und die
Problematik heutiger Planungen.
Geführt von Dr. Wilfried Scholten
Treffpunkt: Busbahnhof Königlicher Hof Kosten: 8
Euro
Weitere Infos zu den Stadtführungen
Veranstaltungsdatum 02.03.2025 - 10:30
Uhr - 12:30 Uhr .Veranstaltungsort Busbahnhof
Königlicher Hof.
18. Moerser Boogie Night
Gastgeber Jörg Hegemann aus Witten ist
musikalischer Leiter dieser Veranstaltung und
begeistert jeden Gast mit seinem Boogie Woogie
Spiel am Flügel. Martijn Schok u. Greta Holtrop
stehen für erstklassigen Boogie Woogie,
gefühlvollen Blues und sind die führenden u.
bekanntesten Vertreter dieses Genres in Holland.

Martijn Schok gilt ebenfalls als Meister des
klassischen Boogie Woogie; Sängerin Greta
Holtrop ist mit ihrer vielseitigen Stimme u.
ihrer charismatischen Bühnenpräsenz die ideale
Ergänzung zu Martijns Klavierspiel. Die
Rhythmusgruppe besteht aus Oliver Mewes am
Schlagzeug und Andreas Müller am Kontrabaß.
Schellack DJ Volker Hess führt mit
seinen BoogieTanzpaaren ergänzend Schautänze
vor. Veranstaltungsdatum 28.02.2025 - 20:00
Uhr - 22:30 Uhr. Veranstaltungsort
Kammermusiksaal - Moerser Musikschule. Filder
Straße 126, 47447 Moers.
Moers: Song Slam
Songwriterinnen und Songwriter, ein Moderator
und ein Publikum – mehr braucht es nicht für
einen guten Abend. Ein gemütliches
Wohnzimmerkonzert, bei dem die Wärme
selbstgemachter Musik auf den harten Wettbewerb
des Slams trifft. Veranstaltungsdatum 28.02.2025
- 20:00 Uhr - 22:30 Uhr. Veranstaltungsort Zum
Bollwerk 107, 47441 Moers. Veranstaltungsort
Halle.
Moers: Zenbo®
Balance Training
Zenbo® Balance ist ein sanftes Bewegungs- und
Entspannungsprogramm für Menschen jeden Alters,
das im Stehen, Sitzen und Liegen durchgeführt
wird. Es handelt sich um ein Body & Mind
Übungsprogramm, das aus drei Phasen besteht.
Silence – Ankommen und Bewusstsein herstellen:
Wir beginnen mit einer Meditation. Move –
Hauptteil: Bewegungsübungen im Stand und am
Boden, die an Qi Gong und Yoga angelehnt sind,
bilden den Bewegungsteil des Trainingsprogramms.
Relax & go – End- und
Entspannungsphase: das Body & Mind-Training wird
mit einer Entspannung aus der westlich
orientierten Welt abgerundet. Als „go“ wird den
Teilnehmenden statt eines „Original-Koans“ eine
kurze Geschichte vorgelesen, die sie dann
sozusagen „mitnehmen“ und auf sich wirken
lassen.
Bitte mitbringen: bequeme
Kleidung mittwochs, 9.30 bis 11 Uhr.
Kursleitung: Raffaella Girelli
Veranstaltungsbeginn: 26.02.2025, 10-mal
Teilnahmegebühr: 90 Euro. Veranstaltungsdatum
26.02.2025 - 09:30 Uhr - 11:00 Uhr.
Veranstaltungsort Neuer Wall 2, 47441 Moers,
Wallzentrum "Raum für dich"
Volkshochschule Moers -
Kamp-Lintfort: Lern-Treff
Viele Menschen mit Lese- und Schreibproblemen
verbergen ihre Schwierigkeiten. Sie befürchten
bloßgestellt zu werden oder ihren Arbeitsplatz
zu verlieren. Für sie heißt das, nicht
aufzufallen und die Ausbildung, Freundschaften
oder sogar ihre Partnerschaft zu riskieren.
Funktionaler Analphabetismus ist in unserer
Gesellschaft immer noch ein Tabuthema.
Deshalb bieten wir Hilfe an. Ohne Anmeldung.
Ohne Termin. Jede und jeder Erwachsene mit
Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben ist
eingeladen jeden Mittwoch, zwischen 11 und 13
Uhr in das Café Sonnenblick in der Moselstr. 55
in Meerbeck zu kommen.
Bei einer Tasse
Kaffee und einem Stück Kuchen hilft unsere
Grundbildungsexpertin bei allen
Schriftsprachproblemen (z. B. Anträge,
Bewerbungen, Rechnungen usw.), hat ein offenes
Ohr für die Probleme und findet, sofern vom
Ratsuchenden gewünscht, auch einen passenden
Lese- und Schreibkurs.
Kursleitung:
Hülya Reske unentgeltlich. Veranstaltungsdatum
26.02.2025 - 11:00 Uhr - 13:00 Uhr.
Veranstaltungsort Moselstraße 55, 47443 Moers.
Café Sonnenblick. Veranstalter Volkshochschule
Moers - Kamp-Lintfort
Moers: Krankenhaus
Bethanien: „Campus-Café“ am 12. März 2025
Austausch, Beisammensein und Information rund
ums Them „Möglichkeiten der mobilen
Sauerstoffversorgung auf Reisen“ .
Am 12.
März 2025 geht die Veranstaltungsreihe
„Campus-Café“ des Krankenhauses Bethanien Moers
in die nächste Runde.
Zur
kostenlosen Veranstaltung, die von 16 bis 18 Uhr
in der Bethanien Akademie (Bethanienstraße 15,
47441 Moers) stattfindet, laden die
Organisator:innen alle pflegenden Zugehörigen
herzlich zu Kaffee, Kuchen, Austausch und
gemütlichem Beisammensein ein.
Expert:innen beantworten auch an diesem Termin
fachliche Fragen rund ums Thema Pflege oder
Medizin. Zusätzlich geht es beim diesmaligen
Fachvortrag um die „Möglichkeiten der mobilen
Sauerstoffversorgung auf Reisen“.
Christoph Schultz von der Firma Linde Gas
Therapeutics GmbH spricht über Formen der
mobilen Sauerstoffversorgung, die es
Patient:innen ermöglichen, auch im Urlaub
weitgehend mobil zu sein – und erklärt, wie die
optimale Urlaubsplanung und -vorbereitung in
solchen Fällen aussieht. Um vorherige
Anmeldung zur Veranstaltung wird gebeten.

Entweder per E-Mail an
campuscafe@bethanienmoers.de oder
telefonisch unter +49 (0) 2841 200 2338 bzw. +49
(0) 2841 200 20420. Das Krankenhaus Bethanien
Moers lädt Interessierte am 12. März 2025
herzlich zum „Campus-Café“ ein.
Book Launch "House of Mataré" im
Museum Kurhaus Kleve
Im Rahmen der
Ausstellung House of Mataré, die noch bis 9.
März 2025 im Museum Kurhaus Kleve zu sehen ist,
findet am Sonntag, den 2. März der Book Launch
zur Ausstellung mit einem Programm der
Künstler:innen statt.
Das Event beginnt
um 13 Uhr mit dem Workshop Masken aus Papier —
Workshop für Kinder, Familien, (Groß)-Eltern und
Besucher:innen mit André Niebur, Jihye Rhii,
Sophie Isabel Urban.
Zur selben Zeit
startet in Düsseldorf ein Shuttle Bus für
Besucher:innen vor der Kunstakademie Düsseldorf
(Fritz-Roeber-Str. Ecke Eiskellerstr.) in
Richtung MKK.
Für den Nachmittag
gestaltete Fabian Friese die Arbeit Matarés Fass
– Wein war gestern. Er greift auf ein 1947 von
Ewald Mataré entworfen Weinfass zurück, das bis
heute erhalten ist. Nun weicht der Wein dem
Bier. Fabian Friese hat eine Adaption aus Papier
des historischen Fasses geschaffen und wird
daraus Kölsch von der Schreckenskammer Brauerei
zapfen.

Besucher:innen sind herzlich eingeladen, ein
frisch gezapftes Kölsch aus dem Fass zu
genießen. Um 15 Uhr geht es mit der Performance
Six Objects of Interest (in the House of Mataré)
von Nicholas Gafia und Moritz Krauth weiter, die
die beiden in Anlehnung an ihre gleichnamige
Installation entwickelten.
Von 16 bis
18 Uhr wird der zweite Teil des Workshops Masken
aus Papier — Workshop für Kinder, Familien,
(Groß)-Eltern und Besucher:innen angeboten. Die
Künstler:innen laden außerdem zu Berlinern,
belegten Brötchen und weiteren Getränke ein.
Eintritt und Workshops sind an diesem Sonntag
frei!
Europäische Verbraucherzentrum:
Ärger statt „Hygge“: Wenn der Ferienhausurlaub
zur Enttäuschung wird
Urlaub im
Ferienhaus ist und bleibt beliebt. Vor allem
deutsche Reisende zieht es ins schöne Dänemark.
Leider trüben immer mal wieder mangelhaft
instandgehaltene Ferienhäuser das
Urlaubserlebnis: Schmutzige Wohnräume,
Schimmelflecken, Müll, freiliegende Leitungen,
defekte Wasserrohre sind nur einige Probleme,
mit denen Urlauber, insbesondere aus
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und
Nordrhein-Westfalen zu kämpfen haben. Das
Europäische Verbraucherzentrum klärt auf.

Weißes Ferienhaus am Meer: Bild KI-generiert
Eigentlich sollte es ein entspannter
Urlaub an der dänischen Küste werden: ein
gemütliches Ferienhaus, idyllisch gelegen und
bestens ausgestattet – so versprachen es Katalog
und Bilder des Online-Anbieters. Doch bei der
Ankunft erlebten die Urlauber eine böse
Überraschung: Schon der Außenbereich des Hauses
war durch Müll des Vormieters in der offenen
Garageneinfahrt, Fliegen, Zigarettenstummel und
leere Flaschen auf dem Balkon alles andere als
einladend.
Drinnen sah es nicht viel
besser aus: Ein extrem verdreckter Kühlschrank,
Schimmel-Flecken an den Wänden und ein feuchter,
penetranter Rauchgeruch – obwohl das Haus als
Nichtraucherobjekt beworben worden war. Das Haus
war für die Feriengäste schlicht und ergreifend
unbewohnbar. Verärgert und enttäuscht reisten
sie nach einem Tag wieder ab.
Probleme
bei der Rückzahlung trotz offensichtlicher
Mängel
Wer nun glaubt, dass die rechtliche
Lage klar und die Erstattung des Mietpreises
kein Problem sei, liegt leider falsch. Denn eine
abweichende Beschreibung und sogar
offensichtliche Mängel allein reichen meist
nicht aus, um problemlos eine Rückzahlung zu
erhalten. „Unbedingt nötig ist es, Beschwerden
sehr schnell, meist innerhalb von 24 Stunden,
dem Anbieter zu melden.
Wer einfach
abreist, hat von vornherein das Nachsehen. Der
Anbieter muss zumindest die Chance bekommen, die
Mängel zu beseitigen, beispielsweise durch den
Umzug in ein anderes Haus“ sagt Sabine Blanke,
Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum
Deutschland.
Aber auch, wer sich, wie in
unserem Fall, korrekt verhält, muss mit Hürden
rechnen. Denn der verzweifelte Versuch der
Feriengäste, den Anbieter zu erreichen, schlug
ohne eigene Schuld fehl. Die Notfallnummer war
am Anreisetag, einem Sonntag, nämlich nicht
besetzt. Daher reklamierten sie schriftlich
einen Tag später und erhielten nach vier Wochen
die Ablehnung des Anbieters: Die Mängel seien
nicht innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden.
Leider garantiert auch das Einhalten der
Meldefrist keine Sicherheit. Dem Europäischen
Verbraucherzentrum Deutschland liegen Fälle vor,
in denen zwar Servicekräfte vor Ort anrückten,
die Reinigung aber eher oberflächlich erfolgte,
z. B. mit Chlorspray. Die eigentlichen Probleme,
wie beispielsweise Schimmel, blieben aber
weiterhin bestehen. Auch müssen Urlauber damit
rechnen, dass die Anbieter nicht alles, was die
Gäste stört, auch anerkennen und eine
Rückzahlung im Ergebnis nur sehr gering
ausfällt, wenn überhaupt.
Zu Gunsten der
Verbraucher: Das Europäische Verbraucherzentrums
Deutschland konnte helfen.
Für die Reisegäste
ging es am Ende zumindest finanziell gut aus. Da
keine Lösung in Sicht war, nahmen sie Kontakt
zum Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland
auf, das ihr Anliegen gemeinsam mit den Kollegen
aus Dänemark klären konnte. „Reisende sollten
sich unbedingt vor Buchung eines Ferienhauses
darüber informieren, was sie erwarten kann und
wie sie sich im Ernstfall am besten verhalten“,
rät Sabine Blanke.
Ebenfalls wichtig zu
wissen: Bei Ferienhäusern gelten die für
Pauschalreisen anzuwendenden Minderungstabellen
nicht. Sicher reist, wer beispielsweise
vertrauenswürdigen Empfehlungen folgt. Wenn
Familienmitglieder, Freunde, Kollegen oder
Bekannte von einem konkreten Ferienhaus
schwärmen, könnte das vielleicht das nächste
Reiseziel sein.
Tipps für den Umgang mit
Mängeln in Ferienhäusern
- Reisen Sie nicht
kommentarlos ab: Wer ohne zu reklamieren
abreist, muss mit dem kompletten Verlust des
Geldes rechnen.
- Rufen Sie alle
Notfallnummern an, die Sie haben, und verlangen
Sie sofortige Beseitigung der Mängel. Eventuell
bietet sich eine Anreise an Werktagen an, da
dies die Chance erhöhen kann, jemanden zu
erreichen.
- Machen Sie Fotos von allen
Mängeln, die Ihnen am und im Haus auffallen.
Fotografieren Sie vorsichtshalber auch die
Zählerstände für Strom und Gas.
-
Reklamieren Sie schriftlich, E-Mail ist
ausreichend. Bewahren Sie den Schriftverkehr
auf, damit Sie einen Nachweis haben. Telefonate
sind als Nachweis ungeeignet.
- Bleiben
Sie hartnäckig: Vor allem dann, wenn Sie wissen,
dass das Haus nach Ihrer Abreise weitervermietet
wurde. Kleinere Ärgernisse, wie schmutziges
Geschirr oder ein Boden mit Laufspuren, lassen
sich oft selbst schnell beheben. Bestehen Sie
dann aber darauf, die Endreinigungsgebühren zu
kürzen oder keine zu bezahlen.
- Denken
Sie über Kompromisse nach: Wenn nur ein Zimmer
unbewohnbar ist, versuchen Sie, eine Lösung zu
finden, ohne dass Sie sich sofort eine neue
Unterkunft suchen müssen. Bedenken Sie, dass ein
neues Ferienhaus nicht so einfach zu finden ist,
wie ein neues Hotelzimmer. Vor allem in der
Hauptsaison.
- Rechnen Sie mit Mahnungen:
wenn noch offene Geldbeträge in Streit stehen.
In einem solchen Fall sollten Sie zeitnah das
Europäische Verbraucherzentrum Deutschland
kontaktieren.
Kostenlose Hilfe bei
Problemen mit Ferienhäusern
Wenn Sie alleine
nicht weiterkommen und das Unternehmen seinen
Sitz in einem anderen EU-Land, Island, Norwegen
oder dem Vereinigten Königreich hat, können Sie
sich gerne an das Europäische Verbraucherzentrum
Deutschland wenden. Der Service ist kostenlos.
Reisemobil-Tourismus: Boom ist
ungebrochen
Infos rund um Stellplätze und Touren-Routen am
Niederrhein waren auf der
Reise + Camping
sehr gefragt.
Auf der Reise + Camping Messe
in Essen ist ein erneuter Rekord gefeiert
worden: Mit 42,9 Millionen Übernachtungen auf
Campingplätzen (42,3 Millionen im Jahr 2023) hat
sich der Trend hin zum Campingtourismus
verstetigt. Dabei ist und bleibt der Niederrhein
ein wichtiges Reiseziel für Reisemobil- und
Campingfans.
Entsprechend hoch war
die Nachfrage am Messestand von Niederrhein
Tourismus (NT), an dem auch die vier
Gesellschafterkreise Viersen, Kleve, Wesel und
Heinsberg (zum Teil mit einzelnen Kommunen)
sowie touristische Betriebe aus der Region
vertreten waren. „Die Messe war für den
Niederrhein Tourismus einmal mehr ein voller
Erfolg“, freut sich NT-Prokuristin Nina Jörgens
nach den ereignisreichen Tagen in Essen.
Sowohl langjährige Niederrhein-Fans als auch
interessierte Neulinge ließen sich vom Team mit
aktuellem Info-Material versorgen und suchten
auch das persönliche Gespräch, um ganz konkret
nach Touren- und Stellplatz-Tipps zu fragen.
„Ein Schwerpunkt des Interesses lag auf unseren
Kernthemen Rad- und Wandertourimus“, so Jörgens.
Die Messe diente zudem als Treffpunkt
für den Arbeitskreis „Reisemobil und Camping am
Niederrhein“. Die Runde blickte unter anderem
auf die Niederrheinischen Reisemobiltage, die
seit mehr als zehn Jahren unter der Regie von
Niederrhein Tourismus am letzten Wochenende im
April stattfinden. Viele Städte, Gemeinden,
Campingplatz- und Reisemobilstellplatzbetreiber
beteiligen sich in diesem Jahr wieder an dieser
außergewöhnlichen Aktion.
„Für
zahlreiche Camping-Fans ist es fast schon wie
ein großes Familientreffen“, meint Rainer
Niersmann, Touristiker der Stadt Geldern und
Mitglied des Arbeitskreises. In Essen sei die
Vorfreude auf das Event im April auch unter den
Stand-Besuchern deutlich spürbar gewesen.
„Als perfektes Reiseziel für alle
Generationen, mit seinen einzigartigen Natur-
und Kulturlandschaften und seinen unzähligen
Outdoor-Aktivitäten ist der Niederrhein längst
ein fester Punkt auf den Karten der
Campingfreunde und Reisemobilisten geworden“, so
Nina Jörgens. „Viele steuern uns sogar mehrmals
im Jahr an, weil sie wissen, dass sie hier
jederzeit herzlich willkommen sind.“
Link
zu den Niederrheinischen Reisemobiltagen:
www.niederrhein-tourismus.de/reisetipps/reisemobil-camping/niederrheinische-reisemobiltage

Der Arbeitskreis „Reisemobil und Camping am
Niederrhein“ warb auf der Messe auch für die
Niederrheinischen Reisemobiltage. Foto: NT

Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche
Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 4. Quartal
2024
Wirtschaftsleistung im 4. Quartal 2024 um 0,2 %
gesunken Bruttoinlandsprodukt (BIP), 4. Quartal
2024 -0,2 % zum Vorquartal (preis-, saison- und
kalenderbereinigt) -0,4 % zum Vorjahresquartal
(preisbereinigt) -0,2 % zum Vorjahresquartal
(preis- und kalenderbereinigt)
Das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal
2024 gegenüber dem 3. Quartal 2024 – preis-,
saison- und kalenderbereinigt – um 0,2 %
gesunken. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, bestätigte sich damit das
Ergebnis der Schnellmeldung vom 30. Januar 2025.
Für das gesamte Jahr 2024 haben die neuesten
Berechnungen den Rückgang der
Wirtschaftsleistung um 0,2 % zum Vorjahr
(kalenderbereinigt ebenfalls -0,2 %) bestätigt.
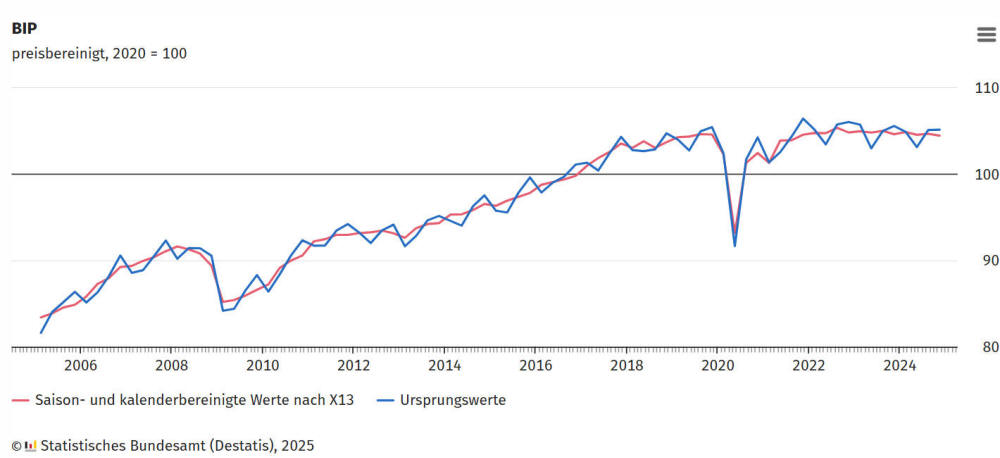
Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt
(saison- und kalenderbereinigte Werte nach
X13)die Ausfuhren zuletzt im 2. Quartal 2020
verzeichnet. Insbesondere die Warenexporte
nahmen mit -3,4 % im Vergleich zum Vorquartal
stark ab.
Demgegenüber stiegen die
Einfuhren von Waren und Dienstleistungen um
0,5 %. Sinkenden Warenimporten (-1,0 %) stand
dabei ein deutlicher Anstieg der
Dienstleistungsimporte um 4,2 % gegenüber. Die
Investitionen zeigten im 4. Quartal 2024 ein
geteiltes Bild: In Ausrüstungen – also vor allem
in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – wurde
preis‑, saison- und kalenderbereinigt 0,3 %
weniger investiert als im Vorquartal.
Dies war bereits der fünfte Rückgang in
Folge. Dagegen stiegen die Bauinvestitionen um
1,0 % gegenüber dem 3. Quartal 2024 an,
begünstigt durch die milde Witterung. Die
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt waren 0,4 %
höher als im 3. Quartal 2024. Einen Zuwachs
verzeichneten mit +0,2 % gegenüber dem
Vorquartal auch die Konsumausgaben. Der
Staatsverbrauch nahm dabei mit +0,4 % stärker zu
als die privaten Konsumausgaben (+0,1 %).
Bruttowertschöpfung in den meisten
Bereichen im Minus
Im 4. Quartal 2024 nahm
die preis-, saison- und kalenderbereinigte
Bruttowertschöpfung um 0,3 % gegenüber dem
Vorquartal ab. Im Verarbeitenden Gewerbe sank
die Wirtschaftsleistung um 0,6 %, und damit im
siebten Quartal in Folge. Insbesondere der
Maschinenbau und die Herstellung von Kraftwagen
und Kraftwagenteilen hatten starke
Produktionsrückgänge zu verzeichnen.
Die Produktion von Metallerzeugnissen sowie
von elektrischen Ausrüstungen stieg dagegen im
Vorquartalsvergleich an. Auch im Baugewerbe ging
die Wirtschaftsleistung erneut zurück, sie sank
um 0,9 %. Vor allem das weniger
witterungsabhängige Ausbaugewerbe verzeichnete
einen Rückgang. Außerhalb des Produzierenden
Gewerbes war die Bruttowertschöpfung der Finanz-
und Versicherungsdienstleister deutlich
niedriger als im Vorquartal (-2,1 %).
Unternehmensdienstleister und sonstige
Dienstleister erwirtschafteten ebenfalls weniger
als im Quartal zuvor (jeweils -0,3 %).
Demgegenüber standen Zugänge der preis-, saison-
und kalenderbereinigten Wertschöpfung in den
zusammengefassten Bereichen Handel, Verkehr,
Gastgewerbe (+0,5 %) sowie Öffentliche
Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+0,3 %).
Bruttoinlandsprodukt im
Vorjahresvergleich gesunken Im
Vorjahresvergleich war das BIP im
4. Quartal 2024 preisbereinigt um 0,4 %
niedriger als im 4. Quartal 2023. Preis- und
kalenderbereinigt war der Rückgang geringer
(-0,2 %), da ein Arbeitstag weniger zur
Verfügung stand als im Vorjahreszeitraum.
Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in
Prozent:
|
2023 |
2024 |
|
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
|
0,6 |
-0,4 |
-0,7 |
-0,4 |
-0,8 |
0,1 |
0,1 |
-0,4 |
Investitionen und Exporte gegenüber dem
Vorjahr deutlich gesunken, Staatskonsum deutlich
im Plus Die Investitionen sanken im 4. Quartal
2024 preisbereinigt um 2,7 % gegenüber dem
Vorjahresquartal. Bereits in den ersten drei
Quartalen hatte das Investitionsvolumen jeweils
unter dem Vorjahreswert gelegen.
Die
Ausrüstungsinvestitionen gingen preisbereinigt
besonders kräftig um 6,4 % gegenüber dem 4.
Quartal 2023 zurück. In Bauten wurde im
4. Quartal 2024 ebenfalls weniger investiert als
im Vorjahreszeitraum, der Rückgang war jedoch
mit -1,9 % weniger stark. Einen Anstieg zum
Vorjahresquartal verzeichneten dagegen die
privaten Konsumausgaben, die preisbereinigt um
0,3 % zunahmen. Ursache hierfür waren unter
anderem höhere Ausgaben für
Gesundheitsleistungen sowie Verbrauchsgüter.
Hierzu zählen beispielsweise Nahrungsmittel, Gas
und Kraftstoffe.
Auch der Staat
erhöhte im 4. Quartal 2024 seine Konsumausgaben,
sie stiegen deutlich um 4,0 %. Der Zuwachs im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum war insbesondere
auf höhere soziale Sachleistungen
zurückzuführen, etwa für
Krankenhausbehandlungen, Medikamente und Pflege.
Hinzu kamen höhere Ausgaben im Bereich der
Jugend-, Eingliederungs- und Sozialhilfe.
Die Entwicklungen im Außenhandel waren im
4. Quartal 2024 zweigeteilt: Die Exporte sanken
preisbereinigt um 3,2 % zum Vorjahresquartal,
vor allem weil die Ausfuhr von Waren deutlich
zurückging (-5,2 %). Ursächlich waren unter
anderem geringere Ausfuhren von Maschinen,
Kraftwagen und Kraftwagenteilen sowie von
elektrischen Ausrüstungen. Die Importe nahmen
dagegen um 2,8 % zu.
Sowohl die
Einfuhr von Waren (+1,2 %) als auch von
Dienstleistungen (+6,5 %) wuchsen dabei
gegenüber dem Vorjahresquartal. Die positive
Entwicklung der Dienstleistungsimporte war
insbesondere auf einen Anstieg von
Telekommunikations- und
Informationsdienstleistungen sowie sonstigen
unternehmensbezogenen Dienstleistungen
zurückzuführen.
Verarbeitendes Gewerbe
und Baugewerbe im Vorjahresvergleich deutlich
gesunken, Dienstleistungsbereiche im Plus Die
preisbereinigte Bruttowertschöpfung ging im
4. Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahresquartal
insgesamt um 1,6 % zurück. Dabei verlief die
Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe und im
Dienstleistungsbereich sehr unterschiedlich.
Während die Dienstleistungsbereiche
insgesamt einen Zuwachs verzeichnen konnten
(+0,4 %), sank die Wirtschaftsleistung im
Verarbeitenden Gewerbe mit -3,5 % deutlich. Im
Baugewerbe war der Rückgang mit -3,9 % sogar
noch etwas deutlicher. Anhaltend starken
Rückgängen im Hochbau und dem Ausbaugewerbe
stand dabei eine deutliche Zunahme im Tiefbau
entgegen.
Innerhalb der
Dienstleistungsbereiche erwirtschaftete im 4.
Quartal 2024 vor allem der zusammengefasste
Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung,
Gesundheit mit +2,5 % deutlich mehr als im
Vorjahreszeitraum. Auch im Bereich Information
und Kommunikation (+1,9 %) sowie bei den
sonstigen Dienstleistern (+0,3 %) legte die
preisbereinigte Wertschöpfung zu. Demgegenüber
standen Rückgänge der Finanz- und
Versicherungsdienstleister (-2,5 %) sowie der
Unternehmensdienstleister (-1,1 %).
Im
Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe sank die
Wirtschaftsleistung leicht um 0,2 % gegenüber
dem Vorjahreszeitraum, nach zuletzt zwei
Anstiegen in Folge.
Erwerbstätigenzahl
nahezu unverändert
Die Wirtschaftsleistung
wurde im 4. Quartal 2024 von rund 46,3 Millionen
Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland
erbracht. Damit blieb die Erwerbstätigenanzahl
in etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals
(-8 000 Personen; 0,0 %). Anstiege in den
Dienstleistungsbereichen kompensierten dabei die
Rückgänge im Produzierenden Gewerbe und im
Baugewerbe.
Im Durchschnitt wurden je
erwerbstätiger Person mehr Arbeitsstunden
geleistet als im 4. Quartal 2023 (+0,8 %). Das
gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen – also das
Produkt aus der Erwerbstätigenzahl und den
gestiegenen geleisteten Stunden je
erwerbstätiger Person – erhöhte sich im gleichen
Zeitraum um 0,7 %. Das ergaben vorläufige
Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für
Arbeit.
Die gesamtwirtschaftliche
Arbeitsproduktivität – gemessen als
preisbereinigtes BIP je Erwerbstätigenstunde –
nahm gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,1 % ab.
Je Erwerbstätigen gerechnet war sie nur um 0,4 %
niedriger als vor einem Jahr. Einkommen stiegen
stärker als nominaler Konsum, Sparquote höher
als im Vorjahr In jeweiligen Preisen gerechnet
waren das BIP im 4. Quartal 2024 um 2,1 % und
das Bruttonationaleinkommen um 2,7 % höher als
ein Jahr zuvor.
Das Volkseinkommen
war nur um 1,3 % höher als im 4. Quartal 2023.
Der vergleichsweise geringere Anstieg beim
Volkseinkommen ist vor allem auf einen
Basiseffekt aufgrund des Wegfalls der
Energiepreisbremsen für Strom und Gas zum
Jahresende 2023 zurückzuführen. Nach vorläufigen
Berechnungen stiegen das Arbeitnehmerentgelt wie
auch die Bruttolöhne und -gehälter insgesamt um
4,6 %, während die Unternehmens- und
Vermögenseinkommen um 8,3 % abnahmen.
Da sich die Zahl der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer geringfügig erhöhte, verzeichneten
die durchschnittlichen Bruttolöhne und -gehälter
je Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer im
4. Quartal 2024 ein Plus von 4,4 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Netto fiel der Anstieg mit
+4,1 % geringer aus. Ursache hierfür ist ein
Basiseffekt auf Grund der Zahlung von
abgabenfreien Inflationsausgleichsprämien am
Jahresende 2023.
Die Zuwachsrate zum
Vorjahresquartal bei den privaten Konsumausgaben
in jeweiligen Preisen war mit +2,7 % im 4.
Quartal 2024 ähnlich schwach wie in den
Vorquartalen. Da das verfügbare Einkommen mit
+3,6 % im Vorjahresvergleich etwas stärker
anstieg, lag die Sparquote zum Jahresende 2024
mit 10,6 % über dem Vorjahreswert von 9,9 %.
Die deutsche Wirtschaft im
internationalen Vergleich
Auch in den
anderen großen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (EU) sowie in der EU insgesamt kühlte sich
die Wirtschaft zum Jahresende ab. Während
Spanien (+0,8 %) und auch die EU insgesamt
(+0,2 %) Anstiege im Vergleich zum
3. Quartal 2024 verzeichneten, stagnierte das
preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP in
Italien (0,0 %).
In Frankreich sank die
Wirtschaftsleistung mit -0,1 % in ähnlichem
Umfang wie in Deutschland (-0,2 %). Die
Wirtschaftsleistung in den USA nahm mit +0,6 %
im Vergleich zum Vorquartal und +2,5 % gegenüber
dem 4. Quartal 2023 stärker zu als in vielen
europäischen Staaten. Deutschland liegt im
Vorjahresvergleich mit preis-, saison- und
kalenderbereinigt -0,2 % deutlich unterhalb der
Entwicklung in der EU insgesamt (+1,1 %).
Bruttoinlandsprodukt, preis-, saison- und
kalenderbereinigt 4. Quartal 2024 Veränderung in
%:
USA |
Euroraum |
EU 27 |
Frankreich |
Italien |
Spanien |
Deutschland |
Vorquartal: Veränderung gegenüber
dem 3. Quartal 2024;
Vorjahresquartal: Veränderung
gegenüber dem 4. Quartal 2023.
Quelle: Eurostat sowie eigene
Berechnungen. |
|
Vorquartal |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
-0,1 |
0,0 |
0,8 |
-0,2 |
|
Vorjahresquartal |
2,5 |
0,9 |
1,1 |
0,7 |
0,5 |
3,5 |
-0,2 |
NRW-Industrie: Produktion von Glasfaserkabel
2023 um rund ein Viertel gestiegen
Im Jahr 2023 sind in acht der 9 901
produzierenden Betriebe des
nordrhein-westfälischen Verarbeitenden Gewerbes
6 768 Tonnen Glasfaserkabel hergestellt worden.
Wie das Statistische Landesamt mitteilt, waren
das 1 347 Tonnen bzw. 24,9 Prozent mehr als ein
Jahr zuvor. Der Absatzwert war mit nominal
67,7 Millionen Euro um 10,1 Millionen Euro bzw.
17,6 Prozent höher als im Jahr 2022.

Gegenüber dem Jahr 2013 sank die Absatzmenge
um 915 Tonnen (−11,9 Prozent) und der Absatzwert
nominal um 5,1 Millionen Euro (−7,0 Prozent).
Durchschnittlicher Absatzwert je Kilogramm um 62
Cent niedriger als 2022 Der durchschnittliche
Absatzwert je Kilogramm Glasfaserkabel war im
Jahr 2023 mit 10,00 Euro um 62 Cent
(−5,8 Prozent) niedriger als ein Jahr zuvor und
um 52 Cent bzw. 5,5 Prozent höher als im Jahr
2013 (damals: 9,47 Euro).
Ein
Viertel des gesamtdeutschen Absatzwerts entfiel
auf NRW Bundesweit wurden 2023 Glasfaserkabel
mit einem Absatzwert von 270,2 Millionen Euro
(+12,4 Prozent gegenüber 2022) hergestellt; der
NRW-Anteil am bundesweiten Absatzwert lag bei
25,0 Prozent (2022: 23,9 Prozent).
Absatzwert in den ersten drei Quartalen 2024
gesunken
In den ersten drei Quartalen 2024
sind in NRW nach vorläufigen Ergebnissen in neun
Betrieben Glasfaserkabel im Wert von
44,2 Millionen Euro (−17,3 Prozent gegenüber dem
entsprechenden Vorjahreszeitraum) hergestellt
worden. Gegenüber den ersten neun Monaten 2013
sank der Absatzwert nominal um 21,1 Prozent.
Dienstag, 25.
Februar 2025
Moers: Warnstreik am Dienstag: Kitas und
Bürgerservice betroffen
Am
Dienstag, 25. Februar, findet der zweite
ver.di-Warnstreik statt, der auch die
Stadtverwaltung trifft. Der Bürgerservice bleibt
komplett geschlossen. Somit fallen alle
Sprechzeiten aus. Die Mitarbeitenden versuchen,
bereits vereinbarte Termine zu verschieben. Auch
bei den städtischen Kindertageseinrichtungen
kommt es durch den Streik zu Ausfällen.
Die städtischen Kitas
Walter-Karentz-Straße, Pusenhof, Barbarastraße
und Diergardtstraße bleiben an diesem Dienstag
geschlossen. In anderen Kindergärten oder im
Offenen Ganztag kann es eventuell zu
Einschränkungen kommen. Eltern werden direkt von
den Einrichtungen darüber informiert. Ob der
Streik sich auch auf andere Dienstleistungen der
Stadtverwaltungen auswirkt, ist zum jetzigen
Zeitpunkt nicht absehbar.
Wahl in Moers: Jan Dieren lag vorn –
Wahlkreis gewann Kerstin Radomski
Hauchdünn hat Kerstin Radomski (CDU) den
Wahlkreis Krefeld II - Wesel II gewonnen. Jan
Dieren (SPD) war in seiner Heimatstadt Moers mit
34,5 Prozent der Erststimmen klar vorn, was am
Ende aber nicht reichte. In 21 der 27 Moerser
Ratswahlbezirken stimmte die Mehrheit für den
SPD-Kandidaten.
Jan Dieren zieht
jedoch genauso wie Ulle Schauws (Grüne) über die
Landesliste erneut in den Bundestag ein. Die
Wahlbeteiligung lag in der Grafenstadt bei 81,54
Prozent. Rund 1.100 Wahlhelferinnen und –helfer
waren im Einsatz. Bürgermeister Christoph
Fleischhauer dankt allen, die für den
reibungslosen Ablauf der Wahlen und das
Auszählen der Stimmen gesorgt haben.
Moers: Bioabfälle bleiben stehen - Verdi
bestreikt Unternehmen der Enni-Gruppe
Die Streiks im Öffentlichen Dienst der
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nehmen im
Vorfeld der für Mitte März terminierten dritten
Verhandlungsrunde der Tarifparteien auch am
Niederrhein an Schärfe zu. Da Verdi hier das
öffentliche Leben empfindlich trifft, hat die
Gewerkschaft beim heutigen Warnstreik erneut
auch ihre organisierten Beschäftigten der
Enni-Unternehmensgruppe aufgerufen, sich an den
Aktionen zu beteiligen.
Die
Auswirkungen dürften am heutigen Dienstag aber
gering sein. In der Moerser Eishalle werden
Schulen und Vereine aber vor verschlossenen
Türen stehen. Da es dienstags keine öffentlichen
Laufzeiten gibt, werden Bürger die Folgen des
Warnstreiks hier ansonsten nicht spüren. In den
Bädern rechnet der Bereichsleiter der Enni,
Benjamin Beckerle, mit keinen Einschränkungen.
Hier hatten Mitarbeiter am Montagnachmittag
keine Streikmaßnahmen angekündigt.
Die Straßenreinigung und die Leerung der
öffentlichen Papierkörbe erfolgen indes nur
eingeschränkt. Die Müllabfuhr wird in Moers aber
weitgehend laufen. „Hier werden wir die
regulären Abfuhren der Rest- und Altpapiertonnen
und des angemeldeten Sperrguts sowie des
Elektroschrotts durchführen und den
Kreislaufwirtschaftshof öffnen können“, so der
zuständige Sachgebietsleiter Simon
Faust-Briganti.
„Die Abfuhr der
braunen Biotonnen wird am heutigen Dienstag aber
komplett ausfallen“, seien hiervon die Bezirke
in den Stadtteilen Vennikel, Holderberg,
Hülsdonk, Utfort und Eick-West mit einem Teil
des Gewerbegebietes Genend betroffen. Die
neuerliche Aktion ist in der aktuellen
Tarifrunde bereits der dritte Warnstreik, zum
zweiten Mal trifft es auch Dienstleistungen der
Enni. Gerade in der Abfallentsorgung kommt dies
für Enni in der Karnevalswoche zu einem
ungünstigen Zeitpunkt. Die beim Bioabfall
ausgefallenden Touren kann Enni deswegen nicht
in dieser Woche nachholen.
„Am
kommenden Samstag ist unser Entsorgungsteam
durch die umfangreichen Aufgaben beim
Nelkensamstagszug eingebunden“, sagt
Faust-Briganti, der Kunden bittet, die Biotonnen
am Dienstag nicht rauszustellen. „Hier können
wir die Tonnen erst beim nächsten regulären
Abholtermin in zwei Wochen abfahren.“
Ansonsten dürften Stand Montagabend keine
weiteren Services ausfallen. Denn auch die
Friedhofsverwaltung wird ganz regulär geöffnet
sein und der Friedhofsbetrieb uneingeschränkt
laufen.
Handlungsfähigkeit durch schnelle
Regierungsbildung herstellen. Neue
Bundesregierung muss zügig zur Sachpolitik
zurückkehren.
Wettbewerbsfähigkeit,
Innovationen und Sicherheit im Fokus. Zum
Ausgang der Bundestagswahl sagt Dr. Joachim
Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands:
„Herzlichen Glückwunsch an den Wahlsieger.
Nach einem intensiven Wahlkampf kommt es jetzt
darauf an, dass sich die demokratischen Parteien
zügig auf eine Koalition verständigen.
Deutschland muss angesichts der zahlreichen
politischen und wirtschaftlichen Krisen so
schnell wie möglich handlungsfähig werden.
Deutschland braucht jetzt eine echte
Reformkoalition – und nach den hitzigen Debatten
eine Rückkehr zur Sachpolitik.“
„Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und
Innovationen müssen jetzt Priorität haben.
Wirtschaftspolitisch muss Deutschland eine
führende Rolle in den Wachstumsmärkten
Digitalisierung und Cleantech einnehmen. Bei
Schlüsseltechnologien wie Künstlicher
Intelligenz brauchen wir einen europäischen
Ansatz, der Innovationskraft mit
unbürokratischen Lösungen für Nachhaltigkeit und
Wettbewerbsfähigkeit verbindet.
In
Bereichen wie Infrastruktur, Verteidigung oder
Bildung gibt es kein Erkenntnisproblem – die
Defizite liegen klar auf dem Tisch. Jetzt geht
es darum, grundlegende Reformen entschlossen
anzugehen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu
steigern und Wachstum zu fördern.“
„Was
wir nicht brauchen, ist aktionistischer
Kahlschlag oder Protektionismus nach dem Vorbild
von Donald Trump. Die demokratischen Parteien
dürfen sich nicht durch Populismus und
Rechtsextremismus in die Enge treiben lassen.
Sie müssen zu ihren Grundwerten stehen. Die
Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nicht
mit Hass, Abschottung oder
wirtschaftsfeindlichen Ideen wie einem
EU-Austritt bewältigen.“
Über den
TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir
die politischen Interessen der
TÜV-Prüforganisationen und fördern den
fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir
setzen uns für die technische und digitale
Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von
Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und
Dienstleistungen ein.
Grundlage
dafür sind allgemeingültige Standards,
unabhängige Prüfungen und qualifizierte
Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe
Niveau der technischen Sicherheit zu wahren,
Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und
unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind
wir im regelmäßigen Austausch mit Politik,
Behörden, Medien, Unternehmen und
Verbraucher:innen.
Thema
Wohnen besonders in den Blick nehmen
Der Verband Wohneigentum gratuliert der CDU/CSU
zum gestrigen Wahlsieg. Der gemeinnützige
Eigentümerverband fordert die Parteien vor den
anstehenden Sondierungsgesprächen dringend auf,
das Thema Wohnen besonders in den Blick zu
nehmen. Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer
Der Verband Wohneigentum appelliert an die
CDU/CSU, die im Wahlprogramm in Aussicht
gestellten Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer
zu verfolgen, um die Bildung von Wohneigentum
für Familien finanziell zu erleichtern.
Zentral sei zudem eine übersichtliche und
verlässliche Förderkulisse für die Themen Bauen
und Sanieren, die wieder – wie in der letzten
Legislatur – von einem eigenen
Bundesbauministerium vertreten werden sollten.
Ursache für gesellschaftliche Unzufriedenheit
„Wohnen ist ein Thema, das alle betrifft und an
dem sich soziale Ungleichheit deutlich
manifestiert.
Erschwerter Zugang zum
Eigenheim, steigende Mieten – dass gutes und
bezahlbares Wohnen für viele Menschen
hierzulande nicht mehr erreichbar ist, sehen wir
als eine der zentralen Ursachen für eine
wachsende gesellschaftliche Unzufriedenheit,
erklärt Peter Wegner, Präsident des bundesweit
größten Verbands für selbstnutzende
Eigentümer*innen.
Bedeutung privater
Initiative für den Wohnungsmarkt
Vor diesem
Hintergrund verweist Wegner auf die Bedeutung
privater Initiative für einen vielfältigen und
stabilen Wohnungsmarkt: „16 Millionen
selbstnutzende Eigentümer, die neuen Wohnraum
geschaffen haben, sind eine wesentliche Säule
des Wohnungsmarktes.
Wer ein Haus baut
oder ein Bestandsgebäude kauft und für seine
Familie saniert, macht eine Wohnung frei und
entlastet damit auch den Mietmarkt. Daher muss
es erschrecken, dass 2024 die Zahl der
Baugenehmigungen im dritten Jahr in Folge
gesunken ist, besonders stark bei Ein- und
Zweifamilienhäusern, die in der Regel privat
errichtet werden. Hier muss die künftige
Bundesregierung zwingend gegensteuern.“
Neuer Termin für
Agroforst-Praxisstammtisch Niederrhein und
Feldführung bei Alleen 3 in Kleve
Der für den 21. Februar vorgesehene
Agroforst-Praxisstammtisch Niederrhein wurde
krankheitsbedingt um eine Woche verschoben. Nun
wird am Freitag, 28. Februar 2025 mit einer
Feldführung in das Jahr 2025 gestartet.
Das Agroforst Reallabor vom Projekt TransRegINT
(Transformation der Region Niederrhein:
Innovation, Nachhaltigkeit und Teilhabe) der
Hochschule Rhein-Waal (HSRW) lädt zu einer
Begehung der im Januar angelegten
Agroforst-Demonstrationsfläche Alleen 3 in Kleve
ein.

Im Mittelpunkt des 5. Agroforst Praxisstammtisch Niederrhein
steht die Agroforst-Demonstrationsfläche Alleen 3 in Kleve.
Luftbild ©Jannis Menne HSRW
Moers: Rund um
die Homberger Straße geht am Nelkensamstag
nichts
Das Ein- und Ausfahren in den
markierten Bereich ist am Nelkensamstag (1.
März) ab 10 Uhr nicht mehr möglich. An vielen
Stellen gilt außerdem schon vorher ein absolutes
Halteverbot.
Übersicht der Sperrung der
Homberger Straße.
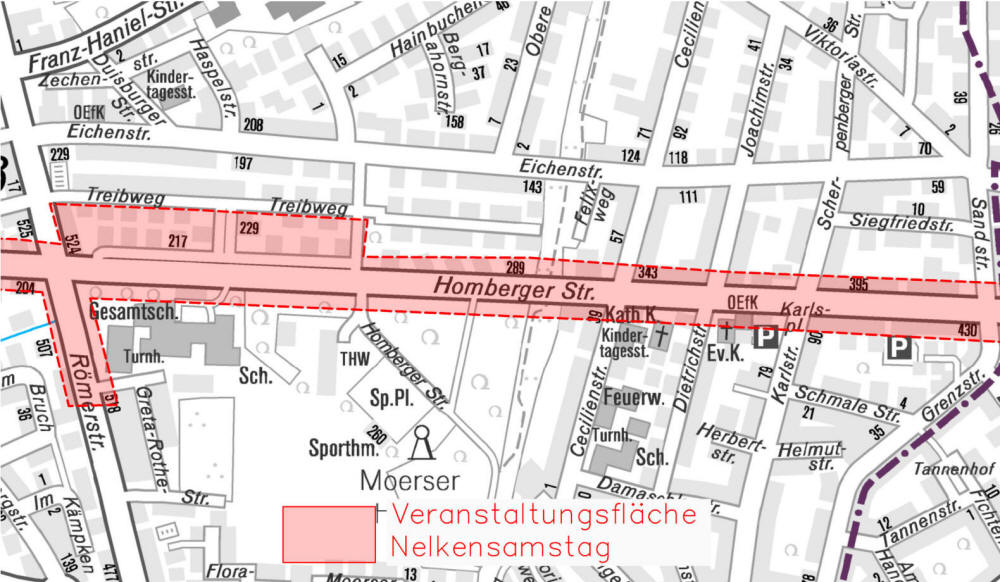
Das Ein- und Ausfahren in den markierten Bereich
ist am Nelkensamstag (1. März) ab 10 Uhr nicht
mehr möglich. An vielen Stellen gilt außerdem
schon vorher ein absolutes Halteverbot. (Grafik:
Stadt Moers) (Grafik: Stadt Moers)
Mit 3
Fahrzeugen und 5 Pitagonen (mobile Lkw-Sperren)
wird der diesjährige Nelkensamstagszug an 37
Stellen gegen ein Eindringen von Lkw und Autos
gesichert. Dadurch kommt es zu massiven
Beeinträchtigungen des Verkehrs rund um die rund
5 Kilometer lange Strecke. Betroffen ist der
gesamte Abschnitt auf Moerser Stadtgebiet
zwischen Sand-/Grenzstraße und
Friedrich-Ebert-Platz. Bereits in den frühen
Morgenstunden des 1. März werden die Sperren
aufgestellt.
Ab 10 Uhr sind die
Zufahrtsmöglichkeiten zur Homberger Straße
komplett abgebunden. Das bedeutet konkret:
Niemand kann in den Bereich des Umzugs
einfahren, niemand kommt raus. Dies muss -
anders als in den Jahren zuvor - auf dem
gesamten Abschnitt bis zum Ende so bleiben.
Übersicht der Sperrung der Homberger Straße
und Klever Straße.
Um 18 Uhr sind alle
Sperrungen aufgehoben – je nach Tempo des Zuges,
der an der Klever/Ecke Wilhelm-Schroeder-Straße
endet, eventuell etwas früher. Auch über das
Wochenende hinaus kann allerdings auf einigen
Gehwegen noch das benötigte Material stehen.
Es wird schnellstmöglich von den beauftragen
Unternehmen abgeholt. Nach den Terroranschlägen
von München und Magdeburg mussten die
Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden. Die
Polizei hatte dem Konzept im Vorfeld zugestimmt.
Übersicht der Sperrung der
Homberger Straße.
Um das Konzept umsetzen zu
können, dürfen keine Fahrzeuge entlang der
Zugstrecke und in einigen Einmündungsbereichen
der Seitenstraßen abgestellt werden. Die Stadt
Moers hat deshalb an vielen Stellen ein
absolutes Halteverbot ausgeschildert. In den
letzten Jahren konnten Falschparker meistens
rechtzeitig ermittelt werden. Durch die
Ausweitung der Sicherungsmaßnahmen ist das
zeitlich nicht mehr möglich.
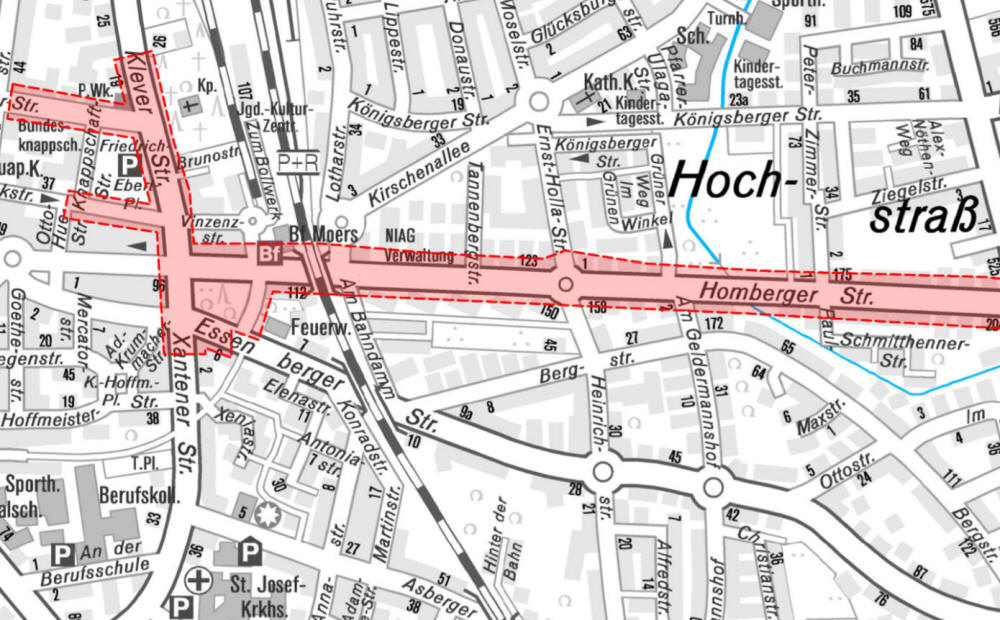
Falschparker werden abgeschleppt
Falschparkende Fahrzeuge werden abgeschleppt.
Nur durch diese Maßnahmen und das konsequente
Vorgehen ist die Durchführung des
Nelkensamstagszuges überhaupt möglich. Die Stadt
Moers bittet deshalb um Verständnis für die
Beeinträchtigungen und alle Anwohnerinnen und
Anwohner um Unterstützung.
Moerser Ehrenamtsmeile 2025 am 23.05.2025
‚Wo‘, ‚Wann‘ und ‚Wie‘? Rund um das Thema
Ehrenamt entstehen viele Fragen. Die erste
Moerser Ehrenamtsmeile findet am Sonntag, 23.
Mai, von 10.00 bis 15.00 Uhr auf dem
Schlossplatz statt. Dabei stellen Akteurinnen
und Akteure der offenen Seniorenarbeit sich und
ihr Angebot für ehrenamtlich Tätige vor, um den
Bürgern und Bürgerinnen die Vielfalt des
Ehrenamts deutlich zu machen.
Die
Leitstelle Älterwerden hat in Zusammenarbeit mit
der Freiwilligenzentrale Moers der Grafschafter
Diakonie die erste Moerser Ehrenamtsmeile
organisiert. Die stets positiven Rückmeldungen
des, in der Vergangenheit durchgeführten,
Ehrenamtsfestival Neu Meerbeck sowie die
Öffentlichkeitsarbeit der Leitstelle Älterwerden
und der Freiwilligenzentrale Moers haben
gezeigt, dass eine solche Veranstaltung auch für
das gesamte Stadtgebiet angeboten werden soll.
Daher findet die Moerser Ehrenamtsmeile, in
Kooperation mit dem Runden Tisch ‚Offene
Seniorenarbeit‘ wieder statt.
Immer länger arbeiten – geht das?
Aktuelle Entwicklungen beim Zugang in
Erwerbsminderungsrente
Gesundheitliche Einschränkungen sind ein
häufiger Grund für das vorzeitige Ausscheiden
aus dem Erwerbsleben. Mit der schrittweisen
Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre
steigt auch das Alter von Arbeitnehmer:innen,
die vorzeitig ihr Erwerbsleben beenden müssen.
Sie wechseln in eine Erwerbsminderungsrente.
Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle
Altersübergangs-Report, den das Institut Arbeit
und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen
in Kooperation mit der Hans-Böckler-Stiftung
herausgibt. Die Forschungsergebnisse und
mögliche Konsequenzen diskutieren die
Autor:innen am 24. Februar um 14:30 Uhr online
live.
Die Zugänge in Alters- und
Erwerbsminderungsrenten wurden in der Forschung
bislang aufgrund der unterschiedlichen
Voraussetzungen überwiegend getrennt betrachtet.
Der neue Altersübergangs-Report des Instituts
Arbeit und Qualifikation (IAQ) analysiert nun
die Verbindung der beiden Risiken Alter und
Gesundheit.
Hierzu wurden die Neuzugänge
in Erwerbsminderungsrente (kurz EM-Rente)
mehrerer aufeinander folgender Geburtskohorten
(1945 bis 1955) auf Datenbasis der Gesetzlichen
Rentenversicherung betrachtet und folgende Frage
gestellt: Wie entwickelt sich die
Inanspruchnahme von EM-Renten im Umfeld
steigender Altersgrenzen und welche Folgen hat
dies für die Gestaltung des Altersübergangs und
die Anforderungen an die soziale Sicherung?
Seit etwa 20 Jahren bekommen jedes Jahr
zwischen ca. 160.000 und 180.000 Personen eine
EM-Rente bewilligt. Der Anteil der EM-Renten an
allen Rentenzugängen ist seit Jahren sogar
rückläufig, wie Auswertungen des Portals
Sozialpolitik-aktuell.de zeigen. Zugleich
wechselt eine wachsende Zahl von Personen mit
fortlaufender Zeit erst in einem Alter jenseits
von 60 Jahren in EM-Rente. So machten im Jahr
2004 die EM-Rentenzugänge ab 60 Jahren nur etwa
15% aller EM-Rentenzugänge aus, im Jahr 2021
jedoch über 40%.
Die wachsende Bedeutung
der EM-Rente im Altersübergang entwickelt sich
parallel zur Schließung von
Frühverrentungsmöglichkeiten und zur Anhebung
der Altersgrenzen. In der jüngsten
Geburtskohorte (Jahrgang 1955) wechseln Personen
in einem Alter in EM-Rente, zu dem ebenso alte
Personen früherer Kohorten in eine Altersrente
hätten wechseln können.
„Offensichtlich kann ein Teil der Beschäftigten
die Erwerbsphase nicht entlang der steigenden
Altersgrenzen verlängern und scheidet
gesundheitsbedingt aus dem Erwerbsleben aus“,
ordnet Prof. Dr. Martin Brussig die
Entwicklungen ein. „Da die persönlichen
Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente
sehr streng sind, ist zu vermuten, dass es
deutlich mehr Personen gibt, die mit der
Anhebung der Altersgrenze nicht Schritt halten
können, als nur diejenigen, die tatsächlich eine
Erwerbsminderungsrente zugesprochen bekommen.“
Der Arbeitsmarktforscher regt daher eine
Verbesserung der Alterssicherung an: Bisher wird
die Erwerbsfähigkeit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt herangezogen, um zu prüfen, ob eine
weitere Erwerbstätigkeit zumutbar ist. Brussig
schlägt vor, im hören Erwerbsalter stattdessen
die gesundheitliche Leistungsfähigkeit im
langjährig ausgeübten Beruf als Maßstab
heranzuziehen.
Die Forschungsergebnisse
und mögliche Konsequenzen diskutieren Martin
Brussig und seine Kollegin Dr. Susanne Drescher
am Montag, 24. Februar um 14:30 Uhr online im
Rahmen der öffentlichen Diskussionsreihe „IAQ
debattiert“ mit Michael Popp, Referent für
Alterssicherung und gesetzliche
Unfallversicherung beim Sozialverband VdK
Deutschland e.V. und Prof. Dr. Martin Werding,
seit September 2022 Mitglied des
Sachverständigenrates für Wirtschaft und damit
einer von fünf „Wirtschaftsweisen“.
Weitere Informationen: Brussig, Martin, 2025:
Erwerbsminderungsrenten im Altersübergang:
Entwicklungstrends in einem
Umfeld steigender
Altersgrenzen. Altersübergangs-Report 2025-01.
Düsseldorf/Duisburg:
Hans-Böckler-Stiftung/Institut Arbeit und
Qualifikation (IAQ), Universität Duisburg-Essen.
Moers: Enni ist auch an Karneval im
Einsatz
Die närrischen Tage wirken
auf Öffnungszeiten und Serviceangebote. Die
heiße Phase der fünften Jahreszeit naht, und mit
dem Straßenkarneval als Höhepunkt wird das
öffentliche Leben auch in Moers wieder
beeinflusst werden. So gelten an den tollen
Tagen von Altweiber,27. Februar, bis
Rosenmontag, 03. März, auch in den Einrichtungen
der Enni-Gruppe teilweise geänderte Öffnungs-
und Servicezeiten.
Die
Abfallentsorgung läuft uneingeschränkt weiter.
Lediglich am neuen Kreislaufwirtschaftshof
können Bürgerinnen und Bürger ihren Abfall am
Altweiber-Donnerstag nur bis 12 Uhr entsorgen.
Online-Terminreservierungen sind dann nur für
den Zeitraum von 6 bis 8 Uhr möglich. Die
Friedhofsverwaltung öffnet am Altweibertag um 8
Uhr und schließt ausnahmsweise bereits um 11
Uhr.
Wegen des Karnevalsumzuges
bleibt der Friedhof an der Klever Straße am
Nelkensamstag vorsichtshalber von 10 bis 18 Uhr
geschlossen. Die Kundenzentren sind am
Karnevals-Freitag und auch am Rosenmontag wie
gewohnt geöffnet, am Altweiber-Donnerstag
schließen sie aber bereits um 16 Uhr.
Telefonisch sind die Beratungskräfte aber auch
dann bis 18 Uhr erreichbar.
Am
Nelkensamstag bleibt das Kundenzentrum in der
Moerser Innenstadt wegen des Karnevalstreibens
geschlossen. Dann sind Berater von 10 bis 13 Uhr
ausschließlich telefonisch erreichbar.
Grundsätzlich gilt an allen Karnevalstagen: Für
besondere Notfälle in der Energie- und
Wasserversorgung sowie der öffentlichen
Kanalisation oder auf den Moerser Straßen können
Kunden einen Bereitschaftsdienst jederzeit unter
der Rufnummer 02841/104-114 erreichen.
Die Moerser Eissporthalle bleibt an
allen Karnevalstagen wie gewohnt geöffnet. Am
Freitag gibt es dort von 17 bis 21 Uhr auch wie
üblich die beliebte Eisdisco, zu der die Gäste
gerne verkleidet kommen können. Am Nelkensamstag
können Kufenflitzer trotz des Umzuges in der
Innenstadt in der Eishalle von 13 bis 17 Uhr
ihre Runden drehen. An Rosenmontag ist die
Anlage geschlossen.
Auch
Schwimmerinnen und Schwimmer können dem Karneval
entfliehen und in den Bädern der Enni ihre
Bahnen ziehen. Der Enni-Sportpark in Rheinkamp
und das Aktivbad Solimare sind nur am
Rosenmontag geschlossen. Am Nelkensamstag und
Tulpensonntag sind beide Anlagen jeweils von 10
bis 17 Uhr geöffnet.
Das
Neukirchen-Vluyner Freizeitbad ist an den
Karnevalstagen regulär geöffnet. Schon
traditionell gibt es hier an diesem schulfreien
Tag zudem den „Rosenmontag-Wellness-Tag“. Dabei
erwartet die Gäste der Sauna von 10 Uhr bis 21
Uhr ein buntes Programm mit Spezial-Aufgüssen
Das Freizeitbad ist an diesem Tag nur für
textilfreies Schwimmen geöffnet.
Enni liest im März in Moers-Asberg Zähler
bei 6.000 Kunden ab
Das Ableseteam
der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein (Enni) ist
im Zuge des sogenannten rollierenden
Ableseverfahrens im März im Moerser Stadtteil
Asberg unterwegs. „Dort erfassen wir bei etwa
6.000 Haushalts- und Gewerbekunden rund 9.100
Strom-, Gas- und Wasserzählerstände. Dabei
unterstützt uns die Dienstleistungsgesellschaft
ASL Services“, informiert Lisa Bruns als
zuständige Mitarbeiterin der Enni.
Sind vereinzelte Zähler nicht für die Ableser
zugänglich, hinterlassen sie eine
Informationskarte im Briefkasten. „Die Bewohner
finden darauf die Telefonnummer und die
E-Mail-Adresse, an die sie die Zählerstände
selbst mitteilen können“, so Bruns.
Wichtiger Hinweis: Die Ablesung erfolgt
jährlich. Als wiederkehrendes Ereignis
informiert die Enni die Kunden nicht gesondert
darüber.
Dennoch hofft Lisa Bruns auf
deren Unterstützung: „Wichtig für uns ist, dass
die Zähler frei zugänglich sind. Nur so ist ein
schneller und reibungsloser Ablauf
gewährleistet.“
Übrigens: Damit keine
schwarzen Schafe in die Häuser gelangen, haben
alle durch Enni beauftragten Ableser einen
Dienstausweis. Bruns: „Den sollten sich Kunden
zeigen lassen, damit keine ungebetenen Gäste ins
Haus gelangen.“ Im Zweifel sollten sich Kunden
bei der Enni unter der kostenlosen
Service-Rufnummer 0800 222 1040 informieren.
Moers: Karnevalsalternative und die
Hits der 2000er
Auch im März gibt
es im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn mehrere
Saunatreffs
Während die Jecken feiern,
können Sauna-Fans auch in diesem Jahr wieder im
Freizeitbad Neukirchen-Vluyn entspannen: Am
Rosenmontag gibt es hier ein spezielles
Kontrastprogramm zum närrischen Treiben beim
Straßenkarneval. Zudem lädt die ENNI Sport &
Bäder Niederrhein (Enni) im März zu zwei
weiteren Saunatreffs ein.
Am
Rosenmontag, 3. März, ist das Freizeitbad von 10
bis 21 Uhr für die Saunafreunde geöffnet. Gäste
können die gesamte Anlage an dem Tag
ausschließlich textilfrei nutzen. In der
Saunalandschaft sind zahlreiche Spezialaufgüsse
geplant. Wer mag kann zudem in der Dampfsauna
selbstständig ein Salz-Peeling oder
Honiganwendungen durchführen.
Am
Samstag, 8. März, steht dann unter dem Motto
„Absolut Natürlich“ der erste reguläre
Saunatreff des Monats an, am Samstag, 22. März,
unter dem Titel „Die 2000er Hits“, findet dann
der zweite Saunaabend statt. Bei den im
14-tägigen Rhythmus angebotenen Saunatreffs gibt
es jeweils von 18 bis 24 Uhr spezielle
Duftkompositionen wie Lavendel, Granatapfel,
Lemongras, Honig-Melone, Fichtennadeln oder Blue
Ice.
Ein Banja-Birkenzweig-Ritual oder
durchblutungsfördernde Anwendungen mit
Franz-Branntwein komplettieren das Programm.
Während der Saunatreffs können die Gäste auch
das Freizeitbad ausschließlich textilfrei
nutzen. Weitere Informationen – auch zu den
Eintrittspreisen – gibt es unter
www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de
Graffiti-Kunst im Klever Stadtbild:
Flächen und Fassaden gesucht!
Aus
vielen deutschen und internationalen Städten ist
diese Kunstform kaum mehr wegzudenken:
Überlebensgroße Graffiti-Kunstwerke haben sich
längst an vielen Orten auf der Welt fest in der
Kunstszene etabliert. Durch verschiedene Farben,
Formen und Techniken schaffen es die
Künstlerinnen und Künstler, mitunter große
Flächen und ganze Fassaden optisch aufzuwerten
und zu verschönern.
Durch Graffiti wird
das Nachdenken angeregt. Oftmals bringen
Künstlerinnen und Künstler wichtige Botschaften
in ihren Werken unter. Sie stellen nicht nur
visuell ansprechende Kunst dar, sondern
vermitteln mit den unterschiedlichen Motiven
eigene Geschichten, Botschaften, Emotionen,
Gedanken und individuelle Werte. Die Etablierung
dieser Art von Kunst kann insbesondere in der
Jugendkultur den Gemeinschaftssinn stärken, die
Identifikation mit der Heimatstadt fördern und
ein einzigartiges Stadtbild hervorbringen.
Um den Künstlerinnen und Künstlern in
Kleve eine Möglichkeit zu geben, ihre Ideen und
ihre Kreativität in der Öffentlichkeit
darzustellen, sucht die Stadt Kleve nun Flächen
und Fassaden für Graffitis. Die Stadt Kleve
freut sich darüber, wenn private Eigentümerinnen
oder Eigentümer Flächen und Fassaden für dieses
Projekt zur Verfügung stellen möchten.
In einem
ersten Schritt geht es aktuell nur darum, die
grundsätzliche Bereitschaft zur Teilnahme an dem
Projekt in Erfahrung zu bringen. Die
tatsächliche Gestaltung der Fassaden würde
anschließend stets in enger Abstimmung mit den
Eigentümerinnen und Eigentümern abgestimmt.
Wer an dem Projekt grundsätzlich interessiert
ist oder och Fragen hierzu hat, kann sich unter
folgenden Kontaktdaten bei der Stadt Kleve
melden:
Tel.: 02821-84-608, E-Mail:
julia.janssen@kleve.de

Erzeugerpreise Januar 2025: +0,5 % gegenüber
Januar 2024
Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Januar
2025 +0,5 % zum Vorjahresmonat -0,1 % zum
Vormonat
Die Erzeugerpreise gewerblicher
Produkte waren im Januar 2025 um 0,5 % höher als
im Januar 2024. Im Dezember 2024 hatte die
Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat
bei +0,8 % gelegen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die
Erzeugerpreise im Januar 2025 gegenüber dem
Vormonat um 0,1 %.
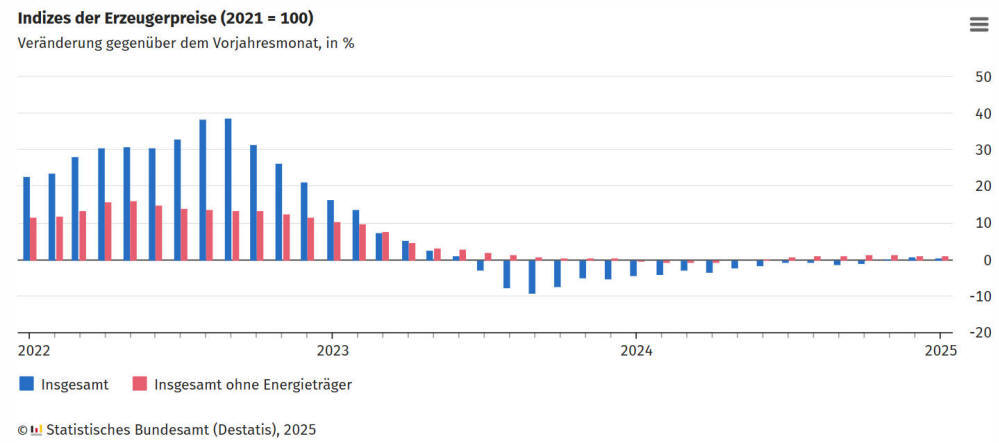
Hauptursächlich für den Anstieg der
Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat
waren im Januar 2025 die Preissteigerungen bei
den Verbrauchsgütern. Auch Investitionsgüter und
Gebrauchsgüter waren teurer als im
Vorjahresmonat, während Energie und
Vorleistungsgüter billiger waren. Ohne
Berücksichtigung von Energie stiegen die
Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat
im Januar 2025 um 1,2 %, gegenüber Dezember 2024
stiegen sie um 0,3 %.
Rückgang der
Energiepreise gegenüber Vorjahresmonat und
Vormonat
Energie war im Januar 2025 um 1,0 %
billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber
Dezember 2024 fielen die Energiepreise um 0,9 %.
Den höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate
gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten
die Preisrückgänge bei elektrischem Strom.
Über alle Abnehmergruppen betrachtet fielen
die Strompreise gegenüber Januar 2024 um 1,8 %
(-2,5 % gegenüber Dezember 2024). Erdgas in der
Verteilung kostete im Januar 2025 über alle
Abnehmergruppen hinweg 1,9 % weniger als im
Januar 2024. Gegenüber dem Vormonat Dezember
2024 sanken die Gaspreise um 2,8 %. Fernwärme
kostete 1,5 % weniger als im Januar 2024 (-1,5 %
gegenüber Dezember 2024).
Teurer als
im Vorjahresmonat waren hingegen
Mineralölerzeugnisse, die Preise stiegen
gegenüber Januar 2024 um 0,7 %, gegenüber
Dezember 2024 nahmen sie um 4,4 % zu. Leichtes
Heizöl kostete 1,9 % mehr als ein Jahr zuvor
(+10,1 % gegenüber Dezember 2024). Die Preise
für Kraftstoffe waren 0,5 % teurer (+5,6 %
gegenüber Dezember 2024).
Preisanstiege bei Verbrauchsgütern,
Gebrauchsgütern und Investitionsgütern
Verbrauchsgüter waren im Januar 2025 um 3,0 %
teurer als im Januar 2024 (+0,5 % gegenüber
Dezember 2024). Nahrungsmittel kosteten 3,5 %
mehr als im Januar 2024. Deutlich teurer im
Vergleich zum Vorjahresmonat waren Butter mit
+39,8 % (-0,3 % gegenüber Dezember 2024) und
Süßwaren mit +24,0 % (+1,2 % gegenüber Dezember
2024). Rindfleisch kostete 18,0 % mehr als im
Januar 2024 (+2,3 % gegenüber Dezember 2024).
Billiger als im Vorjahresmonat waren
im Januar 2025 dagegen insbesondere Zucker
(-33,8 %), Schweinefleisch (-8,8 %) und
Getreidemehl (-4,1 %). Gebrauchsgüter waren im
Januar 2025 um 1,1 % teurer als ein Jahr zuvor
(+0,4 % gegenüber Dezember 2024). Die Preise für
Investitionsgüter waren im Januar 2025 um 1,9 %
höher als im Vorjahresmonat (+0,8 % gegenüber
Dezember 2024).
Maschinen kosteten 1,9 %
mehr als im Januar 2024. Die Preise für
Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um 1,4 %
gegenüber Januar 2024. Leichter Preisrückgang
bei Vorleistungsgütern gegenüber Januar 2024 Die
Preise für Vorleistungsgüter waren im Januar
2024 um 0,1 % niedriger als ein Jahr zuvor.
Gegenüber dem Vormonat blieben sie unverändert
(0,0 %). Glas und Glaswaren waren 4,8 %
günstiger als im Vorjahresmonat, insbesondere
Flachglas war 16,4 % billiger als im Januar
2024.
Futtermittel für Nutztiere
waren 1,3 % günstiger als ein Jahr zuvor.
Die Preise für chemische Grundstoffe blieben
gegenüber dem Vorjahresmonat unverändert
(0,0 %). Preissteigerungen gegenüber Januar 2024
gab es unter anderem bei Natursteinen, Kies,
Sand, Ton und Kaolin (+3,4 %), Gipserzeugnissen
für den Bau (+4,6 %), elektrischen
Transformatoren (+2,3 %) sowie bei Kabeln und
elektrischem Installationsmaterial (+1,0 %).
Holz sowie Holz- und Korkwaren kosteten 2,5 %
mehr als im Januar 2024. Nadelschnittholz war
11,4 % teurer als im Januar 2024.
Dagegen war Laubschnittholz 5,7 % günstiger als
im Vorjahresmonat. Die Preise für Spanplatten
waren gegenüber dem Vorjahresmonat 1,1 %
niedriger. Die Preise für Metalle stiegen
gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,1 %, gegenüber
dem Vormonat fielen sie dagegen um 0,1 %. Die
Preise für Kupfer und Halbzeug daraus lagen mit
+9,4 % deutlich über denen des Vorjahresmonats.
Dagegen war Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen
8,9 % billiger als im Januar 2024. Die Preise
für Betonstahl sanken im Vorjahresvergleich um
2,6 %.
NRW-Tourismus:
Rekordwerte bei Gästen und Übernachtungen im
Jahr 2024
Im Jahr 2024 besuchten
rund 24,5 Millionen Gäste die
Beherbergungsbetriebe und Campingplätze in
Nordrhein-Westfalen. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, waren das 4,0 Prozent mehr als im
entsprechenden Vorjahr und entspricht einem
Rekordwert für NRW (2023: 23,6 Millionen).
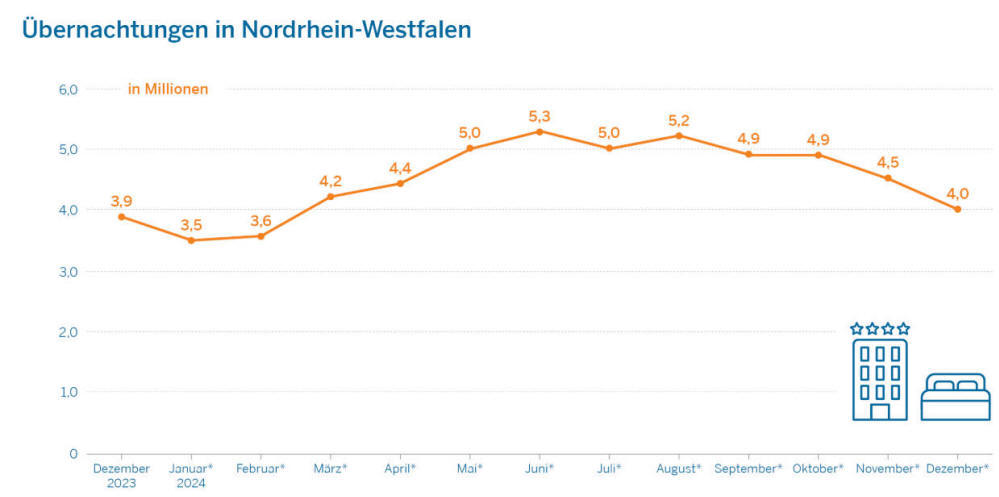
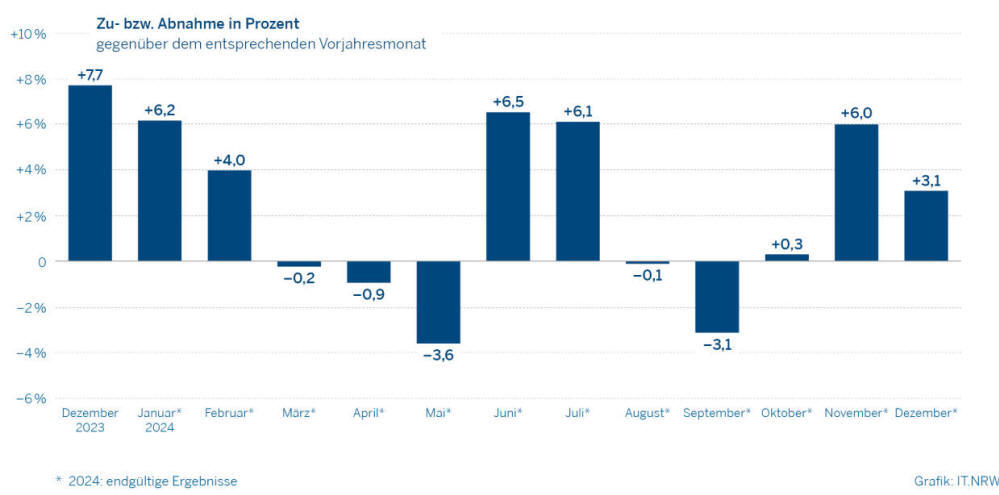
Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 ist eine
Steigerung von 0,8 Prozent bei den
Gästeankünften zu verzeichnen (2019:
24,3 Millionen). Die Zahl der Übernachtungen war
mit 54,5 Millionen um 1,7 Prozent höher als ein
Jahr zuvor und entsprach ebenfalls einem
Rekordwert (2023: 53,6 Millionen). Verglichen
mit 2019 kam es 2024 bei den Übernachtungen zu
einer Steigerung von 2,4 Prozent (2019:
53,3 Millionen). Die Zahl der Gästeankünfte fiel
im Dezember 2024 mit rund 1,9 Millionen um
3,8 Prozent höher aus als im Dezember 2023
(damals: 1,8 Millionen).
Die Zahl
der Übernachtungen war im Vergleich zum
Vorjahresmonat um 3,1 Prozent höher. Die
Übernachtungszahlen im Dezember 2024 stieg um
7,7 Prozent auf rund 4,0 Millionen (Dezember
2023: 3,9 Millionen). Steigerung bei Ankünften &
Übernachtungen ausländischer Gäste Im Jahr 2024
kam es in NRW auch zu einem Anstieg der Ankünfte
von ausländischen Gästen von 11,1 Prozent. Dies
entsprach ca. 5,6 Millionen Ankünften im Jahr
2024 und 5,0 Millionen im Jahr 2023.
Auch die Übernachtungszahlen von
ausländischen Gästen stiegen von 10,6 Millionen
Übernachtungen im Jahr 2023 um 7,0 Prozent auf
11,3 Millionen Übernachtungen im Jahr 2024. Die
Zahl der Gästeankünfte aus dem Ausland war im
Dezember 2024 mit 578 548 um 7,2 Prozent höher
als ein Jahr zuvor (damals 539 536). Die Zahl
der Übernachtungen von ausländischen Gästen
stieg um 7,3 Prozent auf rund 1 Million
(Dezember 2023: ebenfalls rund 1 Million).
Besonders hohe Nachfrage auf
Campingplätzen in NRW
Ein Blick auf die
einzelnen Betriebsarten zeigt, dass 2024
besonders die Campingplätze in NRW mit einer
hohen Zahl von Gästeankünften (ca. 997 000) und
Gästeübernachtungen (ca. 2,6 Millionen) ihre
Vorjahreswerte um ca. 5,7 Prozent (2023:
943 000) bzw. ca. 5 Prozent (2023:
2,5 Millionen) überschreiten. Im Vergleich zum
Vorkrisenjahr 2019 kam es sogar zu einer
Steigerung von 26 Prozent bei den Gästeankünften
(2019: 791 000) und ca. 33 Prozent bei den
Gästeübernachtungen (2019: ca. 2 Millionen) auf
den nordrhein-westfälischen Campingplätzen.
Montag, 24. Februar
2025
Bundestagswahl: Wahlkreise Wesel I CDU, II CDU
und III SPD
IHK zur Wahl: Vorfahrt für die
Wirtschaft - Unternehmen erwarten schnelles
Handeln Tempo gefragt.
Eine neue
Regierung muss rasch loslegen, kommentiert die
Niederrheinische IHK. Die Unternehmen am
Niederrhein fordern eine Wende in der
Wirtschaftspolitik. Das bedeutet: schneller
entscheiden und Vorfahrt für die Wachstum in der
Wirtschaft.
„Wir erwarten von der
neuen Bundesregierung, dass sie die Hängepartie
für unsere Unternehmen endlich beendet. Sonst
fallen wir im internationalen Wettbewerb weiter
zurück. Das muss die Politik verhindern. Wir
brauchen weniger Bürokratie, günstigere Energie
und eine funktionierende Infrastruktur. Und das
schnell. Die Unternehmen haben lange genug
gewartet. Jetzt ist die Zeit für einen
wirtschaftspolitischen Ruck“, fordert Werner
Schaurte-Küppers, Präsident der
Niederrheinischen IHK.
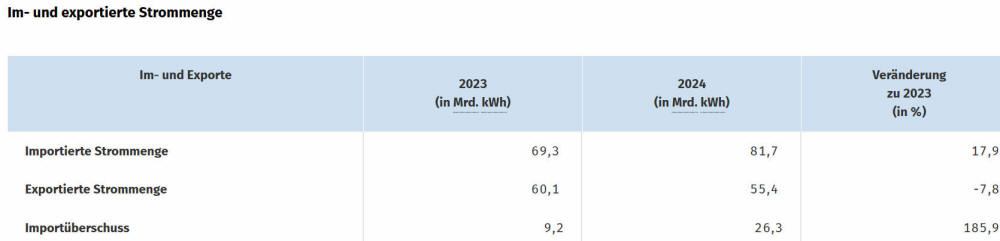
Foto: Niederrheinische IHK/Michael Neuhaus
Schließlich gehe es vor allem in Duisburg um
die Zukunft des Stahlstandortes. „Bei uns am
Niederrhein sitzt die Industrie, die am meisten
Energie benötigt. Wir könnten Vorbild für grünen
Stahl sein. Unsere Wirtschaft hat das Know-how,
die Technologie und den unternehmerischen
Willen. Die Politik sollte diese Chance nutzen.“
Unternehmen ziehen Bilanz Die
weltpolitische Lage trifft die Wirtschaft am
Niederrhein. Die IHK hat die Betriebe zu ihrer
Lage befragt. Vielen Unternehmen fehlt eine
politische Richtschnur. Mehr als 80 Prozent
berichten, dass sich die Energiekosten erhöht
hätten. Die Arbeitskosten seien gestiegen.
Top-Thema für die IHK-Unternehmen: 95 Prozent
wollen, dass die neue Regierung Bürokratie
abbaut.
Knapp zwei Drittel erwarten
Investitionen in Straßen, Brücken und Schienen.
Ebenso viele wünschen sich, dass das Geld durch
Einsparungen im Haushalt kommt. Für mehr
Staats-Schulden gibt es eine Absage.
IHK bietet Online-Lehrgang zum
Betrieblichen Klimamanager
Immer
mehr Unternehmen setzten auf Klimaneutralität.
Um das komplexe Feld zu überblicken, bildet die
Niederrheinische IHK Betriebliche Klimamanager
aus. Fach- und Führungskräfte erhalten Infos zur
Klimaentwicklung und zum Emissionsverhalten.
Darauf aufbauend lernen die Teilnehmenden, wie
sie eine CO2-Bilanz erstellen.
Ziel
ist es, ein leistungsfähiges Klimamanagement für
ihren Betrieb zu konzipieren, umzusetzen und
weiterzuentwickeln. Mit diesen Kompetenzen
beraten sie zu den Chancen und Risiken der
gewählten Klimastrategie.
Der
Online-Lehrgang findet vom 24. März bis 16 Juni
statt, immer montags und mittwochs von 14 bis 18
Uhr. IHK-Ansprechpartnerin ist Sabrina
Giersemehl, 0203 2821-382,
giersemehl@niederrhein.ihk.de. Anmeldung und
weitere Informationen gibt es unter
www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen.
Kommunale Nachhaltigkeitstagung NRW:
Die Stadt Kleve war dabei
Über 150
Teilnehmende tauschten sich auf der 11.
Kommunalen Nachhaltigkeitstagung NRW,
veranstaltet von der Landesarbeitsgemeinschaft
Agenda 21 NRW (LAG 21 NRW), im Wissenschaftspark
Gelsenkirchen zu Erfolgsstrategien für
nachhaltiges kommunales Handeln aus.
 Nachhaltigkeitstagung 2025. Foto: Sarah Rauch /
LAG 21 NRW
Nachhaltigkeitstagung 2025. Foto: Sarah Rauch /
LAG 21 NRW
Auch die Stadt Kleve war
vertreten. Mit der erfolgreichen Erstellung
einer Nachhaltigkeitsstrategie im letzten Jahr
und der anstehenden Erarbeitung eines
Nachhaltigkeitsberichts im Jahr 2025, steht die
Stadt Kleve fortlaufend in enger Kooperation mit
der LAG 21 NRW.
Auf der Tagung wurde
die Stadt Kleve durch den Technischen
Beigeordneten Christian Bomblat,
Fachbereichsleiter Klimaschutz, Umwelt und
Nachhaltigkeit Dirk Posdena,
Klimaanpassungsmanagerin Merle Gemke sowie
Nachhaltigkeitsbeauftragte Pascale van Koeverden
vertreten.
Der Tag wurde von Moritz
Schmidt (LAG 21 NRW) und Dr. Marco Kuhn
(Landkreistag NRW) eröffnet. Beide betonten die
Herausforderungen, aber auch die kommunale
Verantwortung für nachhaltige Lösungen.
NRW-Umweltminister Oliver Krischer unterstrich
in einem Impulsvortrag die Bedeutung der
Nachhaltigkeit als globaler Megatrend.
In Diskussionen und Fachforen wurden
erfolgreiche Ansätze zu Klimaanpassung,
nachhaltiger Flächennutzung,
Wirtschaftsförderung und weiteren zentralen
Themen präsentiert. Dabei wurde deutlich:
Offenheit für Dialoge und Kompromissbereitschaft
sind entscheidend für eine erfolgreiche
nachhaltige Entwicklung vor Ort. Ein besonderer
Fokus lag auf der Bedeutung gezielter
Kommunikation, um Akzeptanz und Sensibilisierung
zu fördern.
Kleve: Kanalsanierung auf der
Brabanterstraße ab Montag, 24. Februar 2025
Ab Montag werden auf der Brabanterstraße in
Kleve zwischen Hausnummer Brabanterstraße 82 und
der Einmündung Brabanterstraße und Römerstraße
Schmutz- und Regenwasserkanäle saniert. Zum
Einsatz kommt ein sogenanntes grabenloses
Verfahren. Das bedeutet, dass für die Arbeiten
keine Baugrube ausgehoben werden muss.
Im
Unterschied zur offenen Bauweise müssen also
keine Straßen oder Gehwege aufgerissen werden.
Eine Spezialfirma führt die Arbeiten stattdessen
mithilfe von Robotern durch und bringt
sogenannte Schlauchliner durch die Schachtdeckel
in den Kanal ein.
Zur Durchführung dieser
Arbeiten stehen ab Montag, 24. Februar 2025,
verschiedene Teilsperrungen der Brabanterstraße
an. Im Rahmen der Sanierung muss jeweils ein LKW
der bauausführenden Firma unmittelbar an den
Schachtdeckeln geparkt werden. An den jeweiligen
Einsatzstellen muss die Brabanterstraße daher
mindestens halbseitig, bei Schachtdeckeln in der
Mitte der Straße sogar voll gesperrt werden.
Die Gesamtdauer der Arbeiten pro
Einsatzstelle beträgt ungefähr sechs bis acht
Stunden. Im Anschluss an die Arbeiten kann die
Straße unmittelbar wieder befahren werden.
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
müssen sich für die Gesamtdauer der
Kanalarbeiten also darauf einstellen, dass sich
die Sperrungen auf der Brabanterstraße mitunter
täglich verändern.
Um Einsatzfahrten von
Feuerwehr und Rettungsdiensten ohne
Einschränkungen zu ermöglichen, werden die
Einsatzfahrzeuge über die Waldstraße geleitet.
Ähnlich wie seinerzeit zum Ausbau der Ringstraße
werden auf der Waldstraße werktags von 07:00 bis
20:00 Uhr Haltverbote eingerichtet, damit
Einsatzfahrzeuge dort ungehindert fahren können.
Im Kreuzungsbereich von Waldstraße und
Gruftgasse wird zudem ein Hinweisschild
„Feuerwehrausfahrt! Bei Stau freihalten!“
angebracht.
Die eigentlichen
Sanierungsarbeiten werden bis Mitte März
abgeschlossen sein. Anschließend stehen
allerdings noch Nacharbeiten an, für die
ebenfalls temporäre Sperrungen notwendig sind.
Insgesamt ist damit zu rechnen, dass es bis
Ostern an verschiedenen Stellen auf der
Brabanterstraße zu Einschränkungen des
Straßenverkehrs kommt.
Gastschüler*innen aus Agen zu Besuch
in Dinslaken
Bürgermeisterin
Michaela Eislöffel begrüßte sie am Donnerstag im
Ratssaal: „Im Jahr des Jubiläums unserer
50-jährigen Städtefreundschaft mit Agen, freue
ich mich ganz besonders über diesen Austausch.
In diesem Jahr haben wir gemeinsam mit dem
Städtepartnerschaftsverein ein ganz besonderes
Programm auf die Beine gestellt, um das Jubiläum
unserer 50-jährigen Freundschaft mit Agen
gebührend zu feiern.“

Die Schüler*innen aus Agen und Dinslaken
gemeinsam mit Bürgermeisterin Michaela Eislöffel
im Ratssaal. Fünf Gastschüler*innen vom Lycée
Palissy aus der Städtepartnerschaftsstadt Agen
waren in dieser Woche mit ihrer Lehrerin zu Gast
in Dinslaken.
Die Bürgermeisterin
forderte die SuS auf, sich auch zukünftig für
die Freundschaft und die enge Verbindung
einzusetzen und den Austausch zu fördern. Sie
wies darauf hin, dass der Zusammenhalt in Europa
wichtiger denn je sei. Die
Austauschschüler*innen hatten sich in diesem
Jahr unter anderem den Landschaftspark
Duisburg-Nord angesehen, eine Dinslaken-Rallye
unternommen und die Eishalle besucht.
Der Austausch fand mit fünf Schüler*innen
vom Otto-Hahn-Gymnasium statt, die sich im
Gegenzug auch die Stadt Agen angeschaut haben.
Am 23. März findet ein Festtag zum 50. Jubiläum
statt, an dem gemeinsam mit Agens Bürgermeister
Jean Dionis und seiner Delegation den Opfern des
Krieges auf beiden Seiten und der Bombardierung
Dinslakens gedacht wird. Es soll daran erinnert
werden, dass aus Feinden Freunde wurden. Das
Programm für den Tag und die herzliche Einladung
dazu werden noch veröffentlicht.
Kleve: Betreuerinnen und Betreuer
für die Sommerferien auf dem Fingerhutshof
gesucht!
Die Stadt Kleve bietet auch
in den diesjährigen Sommerferien vom 04.08.2025
bis zum 22.08.2025 wieder eine
Tagesferienfreizeit für Kinder von 6-12 Jahren
auf dem Fingerhutshof in Wissel an. Für dieses
Ferienangebot werden aktuell noch Betreuerinnen
und Betreuer gesucht. Voraussetzung ist ein
Mindestalter von 18 Jahren.

Erfahrungen im Bereich der Kinder- und
Jugendarbeit sind wünschenswert. Engagement,
Kreativität und Interesse am Umgang mit Kindern
werden bei der Bewerbung vorausgesetzt. Für die
verantwortungsvolle Betreuungstätigkeit wird
eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 75,00
Euro pro Tag gezahlt.
Interessierte können ihre Bewerbung mit
Lebenslauf an die Stadt Kleve, z. Hd. Frau
Schlaszus, Lindenallee 33, 47533 Kleve, oder per
E-Mail an folgende Adresse senden:
joanna.schlaszus@kleve.de. Für weitere
Informationen ist die Stadt Kleve zudem unter
Tel.: 0 28 21 / 84 638 erreichbar.
Inflation für 5 von 9 Haushaltstypen
bei oder unter 2 Prozent, auch staatlich
beeinflusste Preise verhinderten noch stärkeren
Rückgang
Die Inflationsrate in
Deutschland ist im Januar 2025 gegenüber
Dezember 2024 von 2,6 auf 2,3 Prozent gesunken
und liegt damit nahe beim Inflationsziel der
Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent.
Ähnlich ist das Muster, wenn man auf die
Inflationsraten verschiedener Haushaltstypen
blickt, die sich nach Einkommen und Personenzahl
unterscheiden: Vier von neun Haushaltstypen
hatten im Januar Inflationsraten etwas oberhalb
des EZB-Ziels, während sie bei fünf
Haushaltstypen unter oder bei zwei Prozent
lagen, zeigt der neue Inflationsmonitor des
Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung.*
Insgesamt
reichte die Bandbreite der haushaltsspezifischen
Inflationsraten im Januar von 1,7 bis 2,4
Prozent. Das ist ein relativ geringer
Unterschied. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt
der Inflationswelle im Herbst 2022 waren es 3,1
Prozentpunkte. Während Haushalte mit niedrigen
Einkommen während des akuten Teuerungsschubs der
Jahre 2022 und 2023 eine deutlich höhere
Inflation schultern mussten als Haushalte mit
mehr Einkommen, war ihre Inflationsrate im
Januar 2025 wie in den Vormonaten
unterdurchschnittlich: Der Warenkorb von Paaren
mit Kindern sowie der von Alleinlebenden mit
jeweils niedrigen Einkommen verteuerte sich um
je 1,7 Prozent.
Dabei wirkte sich
aus, dass sowohl aktuelle Preisrückgänge bei
Energie als auch der moderate Anstieg bei
Nahrungsmitteln im Warenkorb dieser Haushalte
ein relativ hohes Gewicht haben, weil beides
Güter des Grundbedarfs sind. Auch die Kernrate,
also die Inflation ohne die
schwankungsanfälligen Posten Nahrungsmittel (im
weiten Sinne) und Energie, sank zwischen
Dezember und Januar spürbar von 3,1 auf 2,8
Prozent.
Im Jahresverlauf 2025
dürfte sich die Inflationsrate weiter
normalisieren und bei gesamtwirtschaftlich zwei
Prozent einpendeln, so die Prognose des IMK.
Gleichzeitig schwächelt die Wirtschaft im
Euroraum, in Deutschland stagniert sie sogar.
Daher hält Dr. Silke Tober, IMK-Expertin für
Geldpolitik und Autorin des Inflationsmonitors,
weitere Zinsschritte für erforderlich.
„Da die Leitzinsen trotz der fünf
Zinssenkungen seit Juni 2024 noch auf einem
Niveau sind, das die Wirtschaft dämpft, sollte
die EZB die geldpolitischen Zügel zügig weiter
lockern“, schreibt sie. In der Pflicht sieht die
Ökonomin aber auch die künftige Bundesregierung.
Diese müsse für eine wirtschaftliche Belebung
„die Investitionen ankurbeln und die
Energiepreise senken“.
Letzteres sei
auch noch aus einem anderen Grund sehr sinnvoll,
analysiert die Geldpolitik-Expertin. Denn vor
allem staatlich beeinflusste Preise haben
verhindert, dass die Inflation zum Jahresbeginn
2025 noch stärker zurückging – und sie waren mit
verantwortlich dafür, dass der etwas anders
berechnete europäische Harmonisierte
Verbraucherpreisindex (HVPI) sogar stabil blieb.
Zu diesen „staatlich bedingten
Preiserhöhungen“ gehörten laut Tober unter
anderem die Preisanhebung beim
Deutschlandticket, bei den Netzentgelten und
beim CO2-Preis. Um „in der aktuell noch
angespannten Phase der Desinflation keine
staatlich induzierten Erhöhungen des
Preisniveaus zu bewirken und die
Verteilungswirkung zu Lasten einkommensschwacher
Haushalte zu kompensieren“ sollten Erhöhungen
„einer Lenkungssteuer wie der CO2-Preis“ an
anderer Stelle von gezielten Entlastungen
begleitet sein: „Hier bietet sich eine
Verringerung des Strompreises an“, so Tober.
Das IMK berechnet seit Anfang 2022
monatlich spezifische Teuerungsraten für neun
repräsentative Haushaltstypen, die sich nach
Zahl und Alter der Mitglieder sowie nach dem
Einkommen unterscheiden.
Die
längerfristige Betrachtung illustriert, dass
Haushalte mit niedrigem bis mittlerem Einkommen
von der starken Teuerung nach dem russischen
Überfall auf die Ukraine besonders stark
betroffen waren, weil Güter des Grundbedarfs wie
Nahrungsmittel und Energie in ihrem Budget eine
größere Rolle spielen als bei Haushalten mit
hohen Einkommen. Diese wirkten lange als die
stärksten Preistreiber, zeigt ein
längerfristiger Vergleich, den Tober in ihrem
neuen Bericht ebenfalls anstellt: Insgesamt
lagen die Verbraucherpreise im Januar 2025 um
20,5 Prozent höher als fünf Jahre zuvor.
Damit war die Teuerung fast doppelt so
stark wie mit der EZB-Zielinflation von
kumuliert 10,4 Prozent in diesem Zeitraum
vereinbar. Nahrungsmittel und alkoholfreie
Getränke verteuerten sich sogar um 34,6 Prozent,
Energie war trotz der Preisrückgänge in letzter
Zeit um 37,1 Prozent teurer als im Januar 2020.
Deutlich weniger stark, um 16,7 Prozent, haben
sich Dienstleistungen verteuert.
Auf
dem Höhepunkt der Inflationswelle im Oktober
2022 betrug die Teuerungsrate für Familien mit
niedrigen Einkommen 11 Prozent, die für ärmere
Alleinlebende 10,5 Prozent. Alleinlebende mit
sehr hohen Einkommen hatten damals mit 7,9
Prozent die mit Abstand niedrigste
Inflationsrate. Erschwerend kommt hinzu, dass
Haushalte mit niedrigeren Einkommen wenig
finanzielle Polster besitzen und sich die Güter
des Grundbedarfs, die sie vor allem nachfragen,
kaum ersetzen oder einsparen lassen.
Im Januar 2025 verteuerten sich
die spezifischen Warenkörbe von Haushalten mit
niedrigen bis mittleren Einkommen hingegen etwas
weniger stark als der Durchschnitt, weil zuletzt
vor allem die Preise für Dienstleistungen
anzogen, die mit steigendem Einkommen stärker
nachgefragt werden. Daher folgten im Vergleich
der neun Haushaltstypen auf die Familien und
Alleinlebenden mit niedrigen Einkommen (je 1,7
Prozent Inflation) die Inflationsraten von
Alleinlebenden und Alleinerziehenden mit jeweils
mittleren Einkommen (je 1,9 Prozent) sowie die
von Paarfamilien mit Kindern und mittleren
Einkommen (2,0 Prozent).
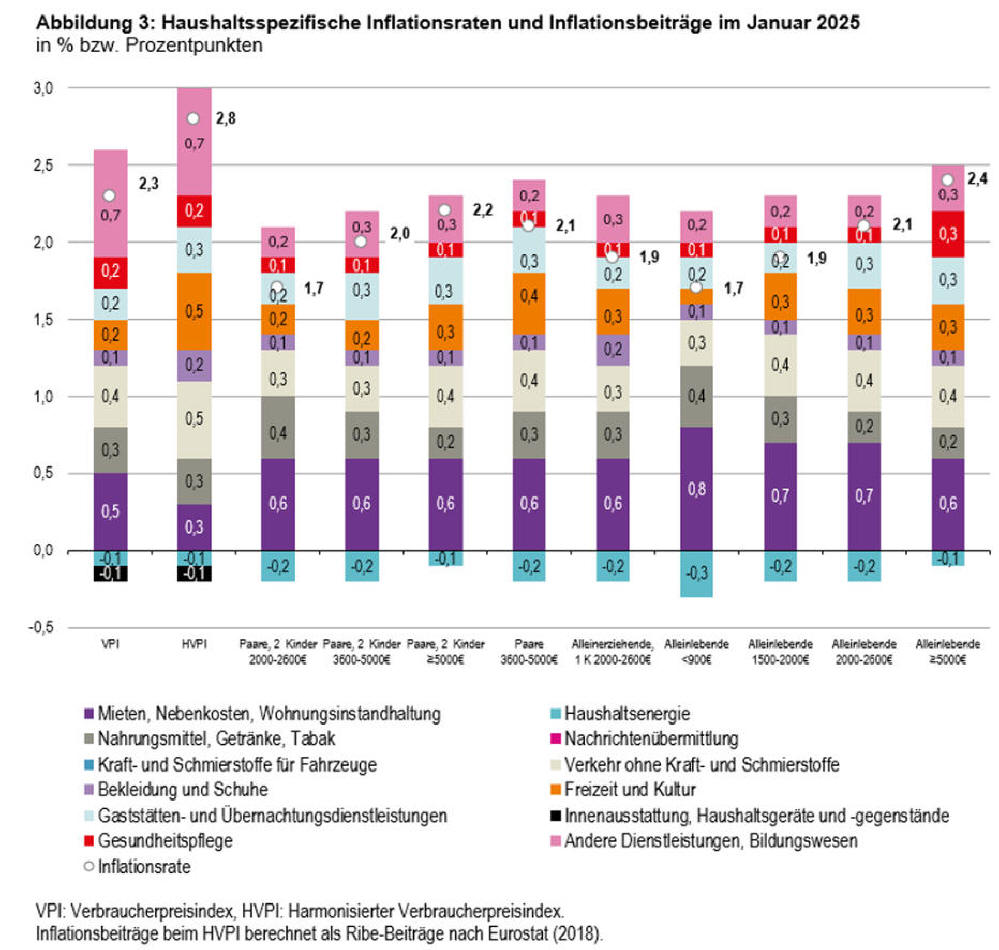
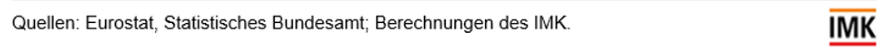
Am oberen Rand des Vergleichs lagen
Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen (2,4
Prozent) und Familien mit hohen Einkommen (2,2
Prozent), bei denen sich beispielsweise höhere
Preise für Gaststätten- und Hotelbesuche stärker
auswirkten. Dazwischen liegen Alleinlebende mit
höheren Einkommen und Paare ohne Kinder mit
mittleren Einkommen.
Kaputtlachen statt
krankärgern: Frauenkabarett mit Anka Zink
Mit ihren scharfsinnigen Beobachtungen und
schlagfertigen Kommentaren hat sich Anka Zink
(Foto: Linn Marx) in den letzten drei
Jahrzehnten einen Namen in der Comedy- und
Satire-Szene gemacht.

Ihre Bühnen-Show ‚K.O. Komplimente. Schlag sie
durch die Blume‘ präsentiert sie beim
Frauenkabarett der Gleichstellungsstelle der
Stadt Moers anlässlich des Internationalen
Frauentages am Freitag, 7. März, 20 Uhr, im
Kulturzentrum Rheinkamp, Kopernikusstraße 11.
Anka Zink bezeichnet sich als
‚Erfinderin von Comedy mit Relevanz‘. Gemäß
ihrem Motto ‚Zink, Thing Positiv!‘ schenkt sie
den Besucherinnen eine Perspektive, die heißt:
Statt sich krankzuärgern, lieber kaputtlachen!
Karten für die Veranstaltung sind ab sofort im
Vorverkauf erhältlich. Tickets gibt es bei der
Stadt- und Touristinformation von Moers
Marketing, Kirchstraße 27 a/b, Telefon 0 28
41/88 22 60, erhältlich.

Fünf Jahre Corona: Zahl der
kommunalen Beschäftigten in NRW im Bereich der
Gesundheitsdienste um ein Drittel angestiegen
Bei den Kommunen in
Nordrhein-Westfalen sind Ende Juni 2023 rund
34 Prozent mehr Personen im Bereich
Gesundheitsdienste beschäftigt gewesen als vor
Beginn der Corona-Pandemie. Zu den kommunalen
Gesundheitsdiensten zählen u. a. die
Gesundheitsämter.
Wie das Statistische
Landesamt anlässlich des Beginns der
Corona-Pandemie vor fünf Jahren mitteilt, waren
im Jahr 2023 in diesem Bereich 6 960 Personen
tätig; 2019 waren es 5 190 gewesen. In den
Vor-Corona-Jahren war die Zahl der Beschäftigten
im Bereich kommunale Gesundheitsdienste nahezu
konstant. In der Hochphase der Pandemie 2021 ist
sie dann sprunghaft auf 9 310 Personen gestiegen
und anschließend wieder gesunken.
Kontinuierliche Zuwächse bei dauerhaft
Beschäftigten
Im Detail gab es nach Beginn
der Corona-Pandemie kontinuierliche Zuwächse bei
der Zahl der dauerhaft Beschäftigten in den
kommunalen Gesundheitsdiensten in NRW. 2023
waren im genannten Bereich 6 240 Personen tätig,
das war fast ein Viertel mehr als vor der
Corona-Pandemie (2019: 5 005). 2021 hatte diese
Zahl noch bei 5 590 Personen gelegen.
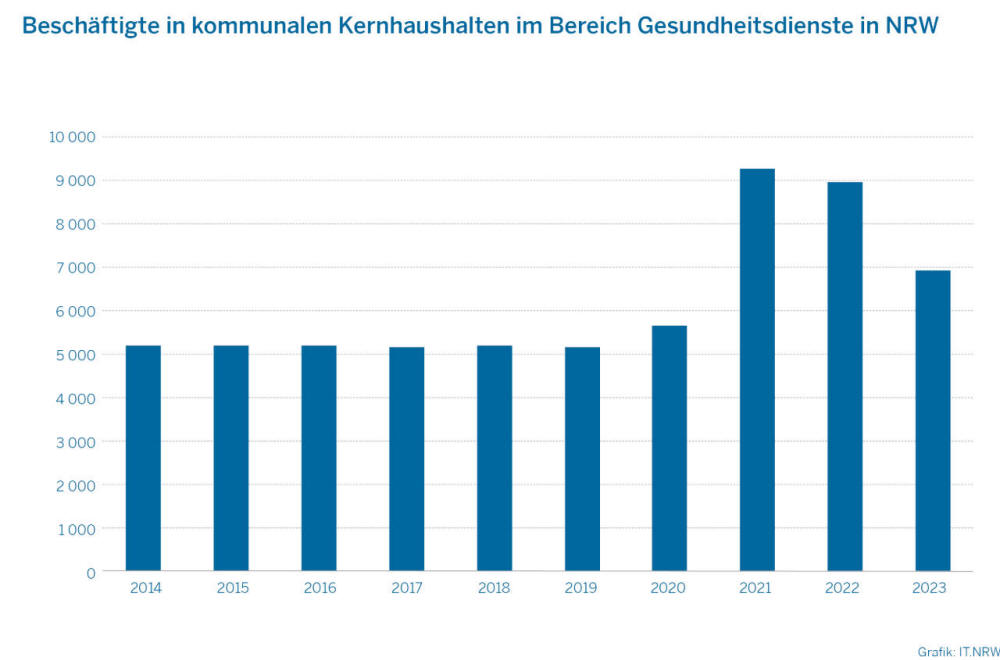
Zahl der befristet Beschäftigten war in der
Hochphase der Pandemie 22-mal höher als 2019
Auch die Zahl der Beschäftigten mit
Zeitverträgen war im Jahr 2023 mit 685 Tätigen
weiterhin höher als 2019 (damals: 170). Ganz
anders hatte es jedoch in der Hochphase der
Pandemie ausgesehen: 2021 waren 3 685 Personen
befristet beschäftigt gewesen, das waren 22-mal
so viele wie 2019 vor der Pandemie.
Das Statistische Landesamt weist darauf hin,
dass insgesamt 2,3 Prozent aller Beschäftigten
in kommunalen Kernhaushalten Ende Juni 2023 im
Bereich Gesundheitsdienste tätig waren. Im
Vor-Corona-Jahr 2019 hatte der Anteil bei
1,9 Prozent gelegen. Während der Hochphase der
Pandemie im Jahr 2021 hatte das Personal im
Bereich Gesundheitsdienste 3,2 Prozent aller
kommunalen Beschäftigten gestellt.
Deutsche Wirtschaft nutzt 12,75
Milliarden Kubikmeter Wasser in 2022
Rückgang des Wassereinsatzes um 16,7 %
gegenüber 2019 vor allem durch Stilllegung von
Kernkraftwerken
Im Jahr 2022 haben die
Betriebe in Deutschland rund 12,75 Milliarden
Kubikmeter Wasser eingesetzt. Das waren rund
2,56 Milliarden Kubikmeter oder 16,7 % weniger
als im Jahr 2019. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, ging der
Wassereinsatz hauptsächlich bei den
Energieversorgern zurück. Vor allem durch die
zwischenzeitliche Stilllegung dreier
Kernkraftwerke wurden in der Energieversorgung
im Jahr 2022 rund 2,02 Milliarden Kubikmeter
Wasser weniger genutzt als bei der vorherigen
Erhebung im Jahr 2019.
Energieversorgung
und Verarbeitendes Gewerbe verwenden am meisten
Wasser Die Betriebe der Energieversorgung
setzten trotz dieses Rückgangs weiterhin das
meiste Wasser von allen Wirtschaftsabschnitten
ein. Im Jahr 2022 benötigten sie insgesamt
6,59 Milliarden Kubikmeter Wasser. Danach folgte
das Verarbeitende Gewerbe mit einem
Wassereinsatz von 5,15 Milliarden Kubikmeter.
Innerhalb des Verarbeitenden
Gewerbes war insbesondere die Herstellung
chemischer Erzeugnisse mit
3,08 Milliarden Kubikmetern Wasser bedeutend,
mit deutlichem Abstand gefolgt von der
Metallerzeugung und -bearbeitung mit
0,61 Milliarden Kubikmetern.
Die
Landwirtschaft nutzte im Jahr 2022 rund
0,48 Milliarden Kubikmeter Wasser. Wasser wird
überwiegend für Kühlzwecke genutzt Das Wasser
wird von den Betrieben in erster Linie zur
Kühlung gebraucht. 10,57 Milliarden Kubikmeter
Wasser oder 82,9 % des gesamten Wassereinsatzes
der Betriebe wurden im Jahr 2022 in
Kühlprozessen verwendet.
Weitere
1,76 Milliarden Kubikmeter (13,8 %) dienten der
Produktion von Gütern oder wurden von der
Belegschaft verwendet. Die restlichen
0,42 Milliarden Kubikmeter wurden zur
Bewässerung eingesetzt (3,3 %).
Rund
10 500 Betriebe entnehmen selbst Wasser aus der
Natur
Im Jahr 2022 haben rund 10 500 Betriebe
selbst Wasser aus der Natur gewonnen. Die
insgesamt gewonnene Wassermenge belief sich auf
12,84 Milliarden Kubikmeter. Dieses Wasser wurde
größtenteils aus Flüssen, Seen oder Talsperren
(9,72 Milliarden Kubikmeter bzw. 75,6 %)
entnommen.
Rund
2,18 Milliarden Kubikmeter (17,0 %) stammten aus
Grundwasserressourcen. Die restliche Wassermenge
(0,94 Milliarden Kubikmeter bzw. 7,4 %) entfiel
auf andere Wasserarten, zum Beispiel
Uferfiltrat, Quellwasser oder Meer- und
Brackwasser.
Erneut mehr
Betriebsgründungen als Betriebsaufgaben im Jahr
2024
• Zahl der vollständigen
Aufgaben größerer Betriebe steigt um 2,7 % zum
Vorjahr
• Demgegenüber lediglich 2,1 % mehr
Neugründungen größerer Betriebe
Im Jahr
2024 wurden in Deutschland rund 120 900 Betriebe
gegründet, deren Rechtsform und
Beschäftigtenzahl auf eine größere
wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
waren das 2,1 % mehr neu gegründete größere
Betriebe als im Jahr 2023.
Gleichzeitig
stieg die Zahl der vollständigen Aufgaben
größerer Betriebe um 2,7 % auf rund 99 200.
Dennoch war die Zahl der Betriebsgründungen auch
2024 wie in allen Jahren seit Beginn der
Zeitreihe im Jahr 2003 höher als die Zahl der
Betriebsaufgaben.
Neugründungen
nehmen insgesamt um 0,2 % zu
Die Gesamtzahl
der Neugründungen von Gewerben war im Jahr 2024
mit rund 594 500 um 0,2 % höher als im Jahr
2023. Die Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen nahm
ebenfalls um 0,2 % auf rund 716 400 zu. Zu den
Gewerbeanmeldungen zählen neben Neugründungen
von Gewerbebetrieben auch Betriebsübernahmen
(zum Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt),
Umwandlungen (zum Beispiel Verschmelzung oder
Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen
Meldebezirken.
Vollständige Aufgaben um
3,4 % höher als im Vorjahr
Die Gesamtzahl
der vollständigen Gewerbeaufgaben war im Jahr
2024 mit rund 503 400 um 3,4 % höher als im
Vorjahr. Die Gesamtzahl der Gewerbeabmeldungen
stieg um 2,7 % auf rund 619 100. Dabei handelt
es sich nicht nur um Gewerbeaufgaben, sondern
auch um Betriebsübergaben (zum Beispiel Verkauf
oder Gesellschafteraustritt), Umwandlungen oder
Fortzüge in andere Meldebezirke.
|














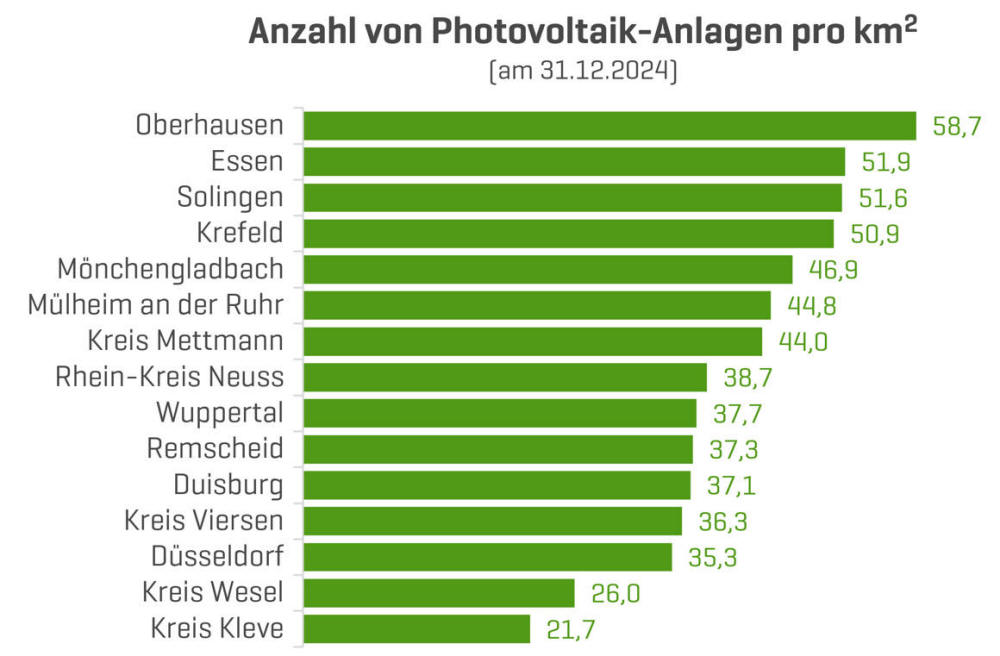
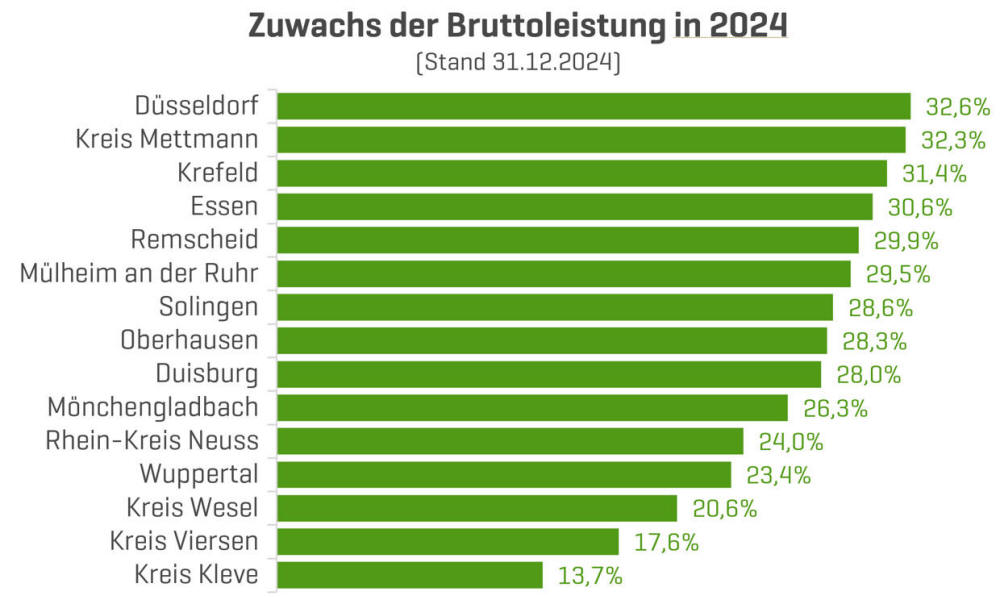
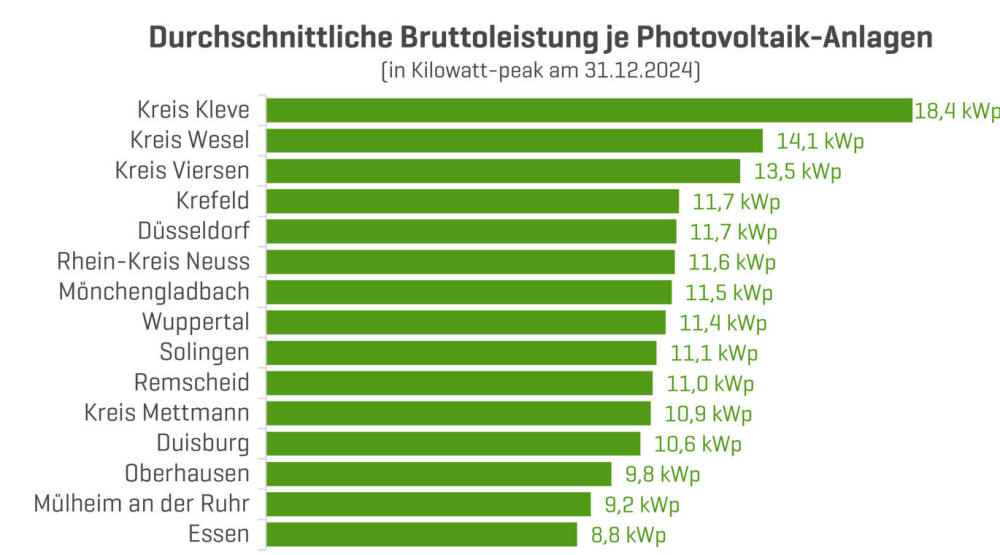
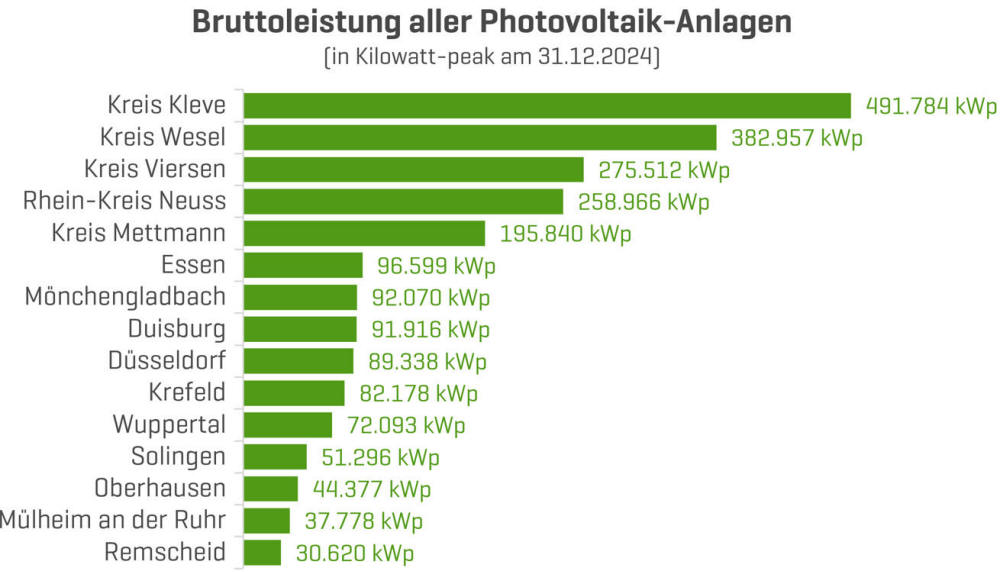
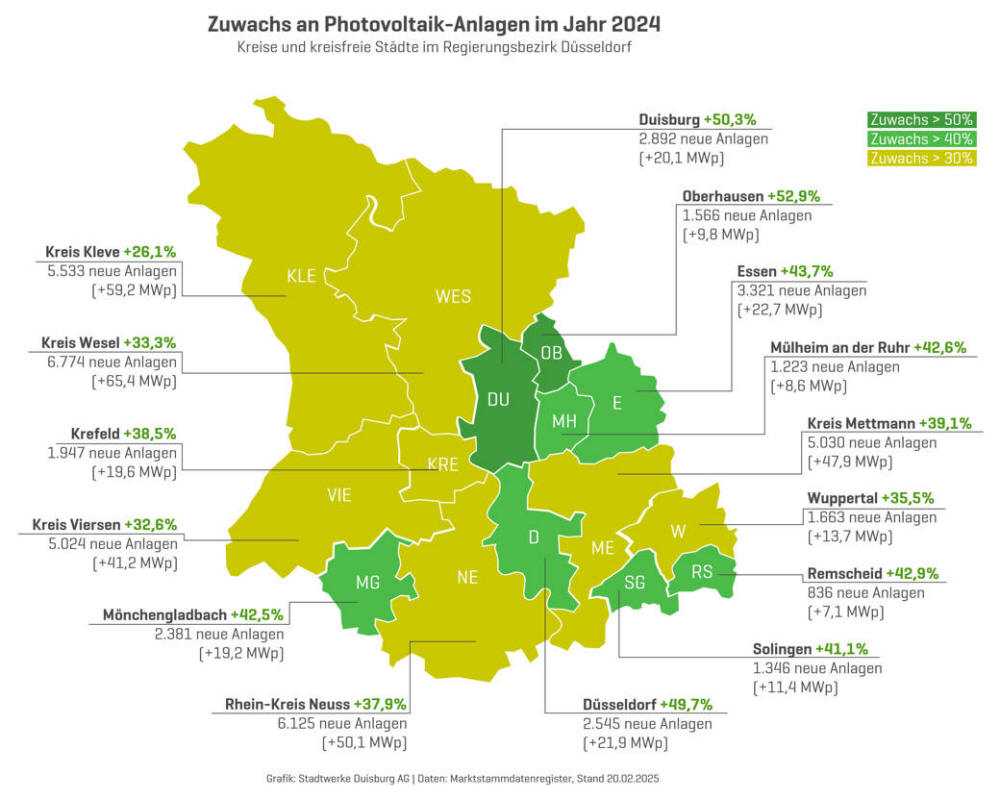
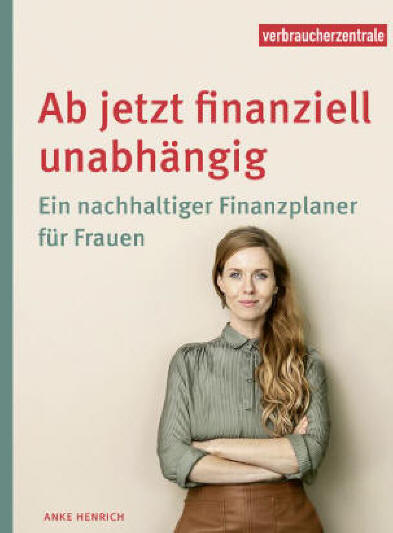

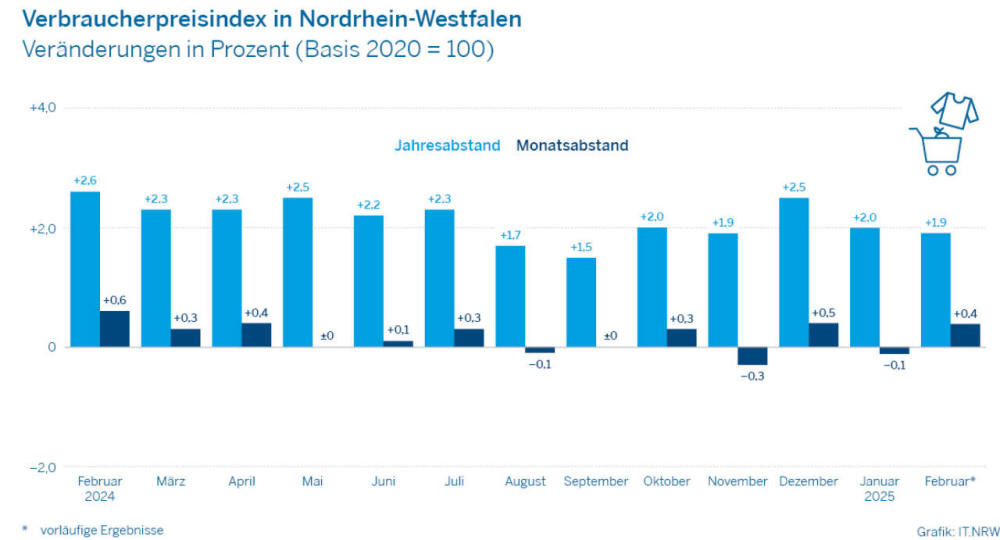
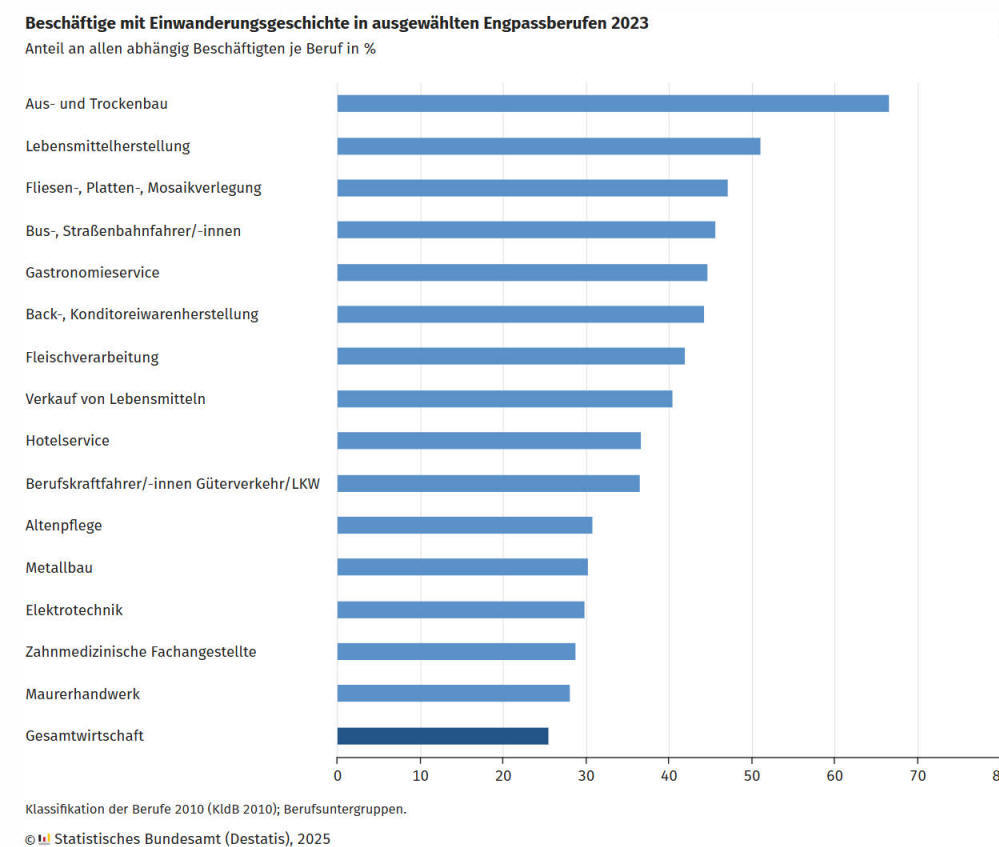
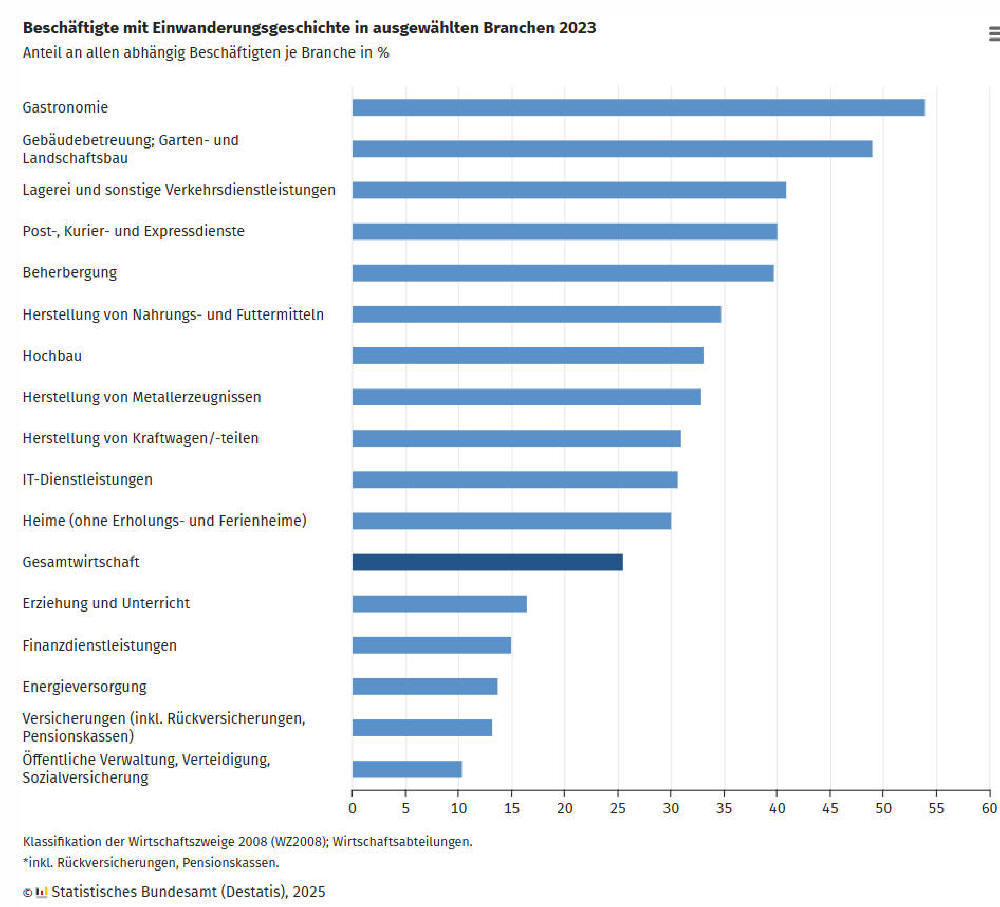

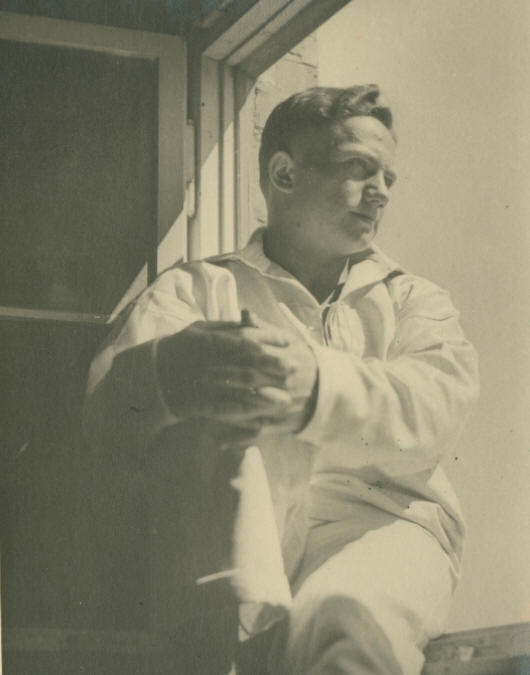
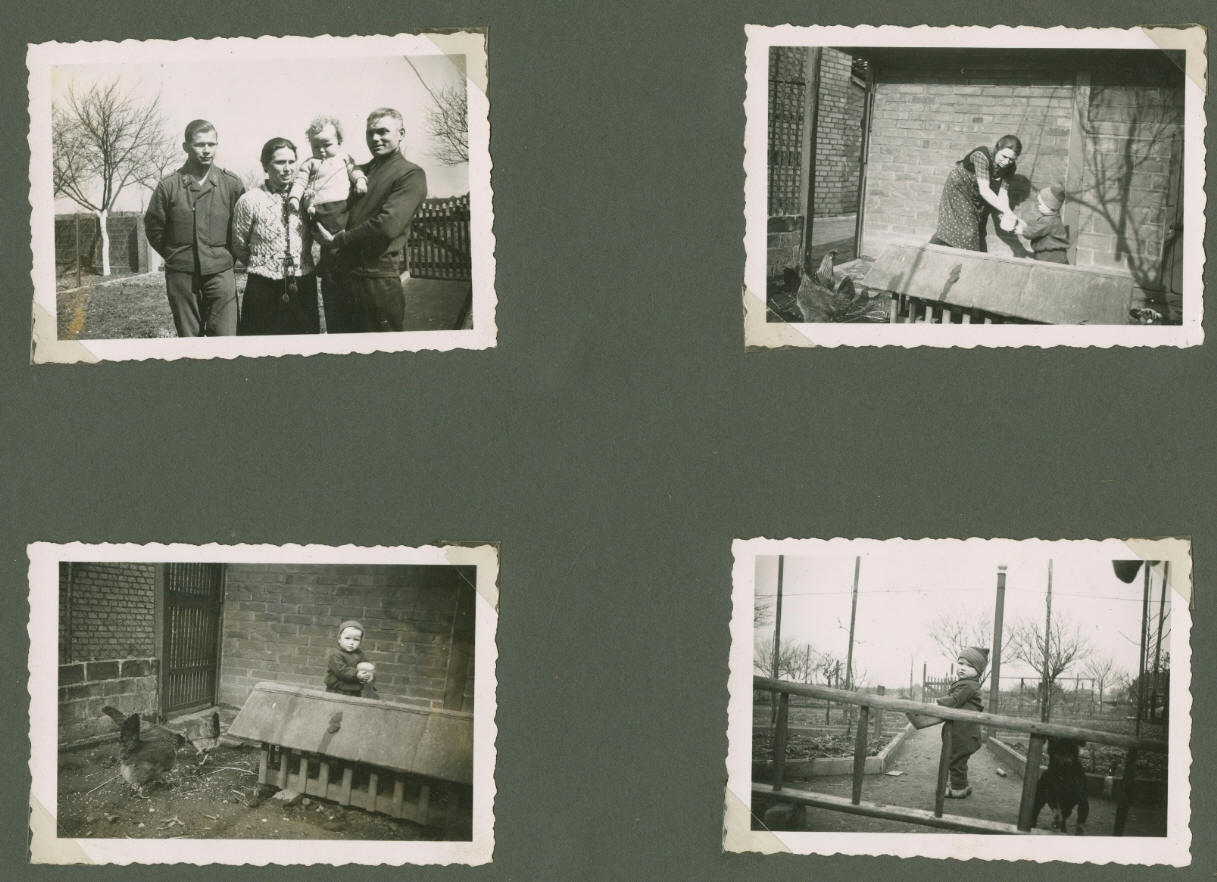
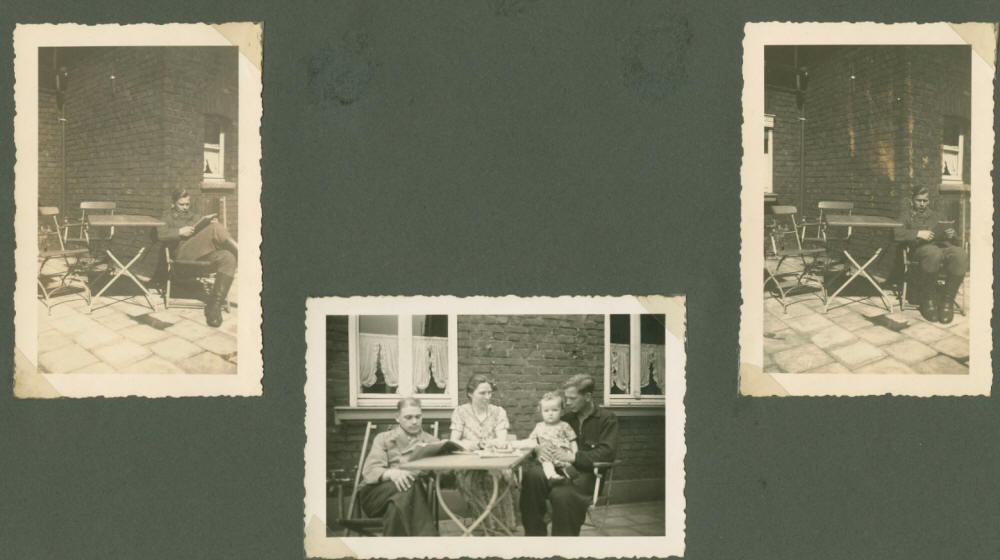
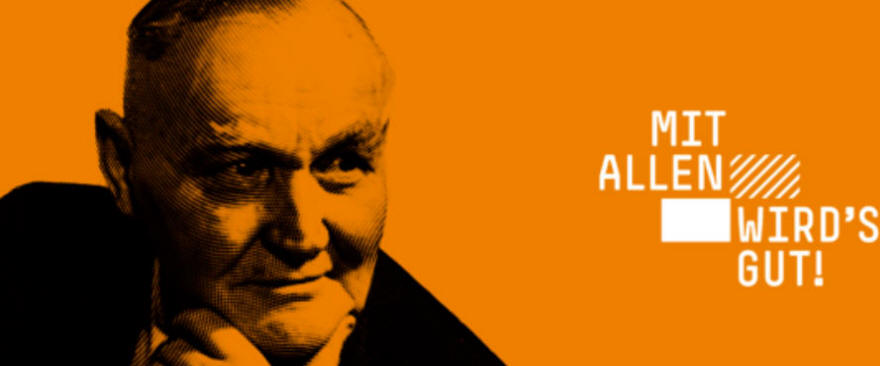
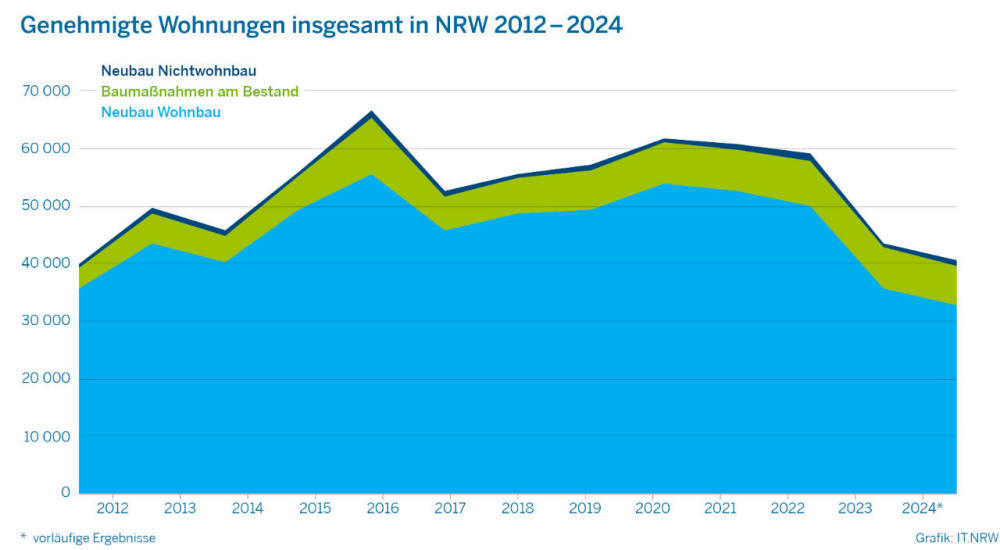






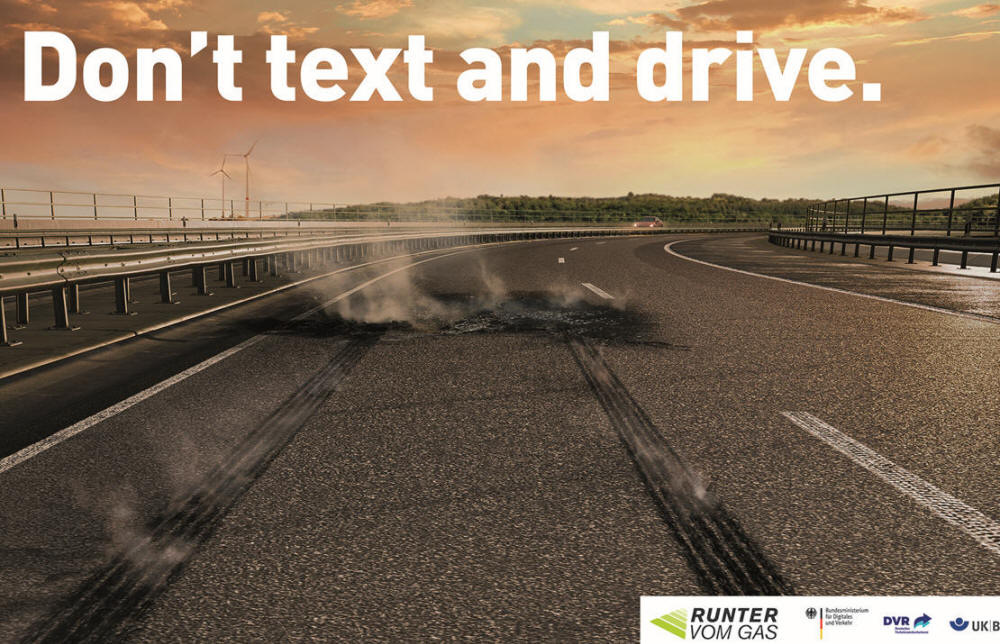

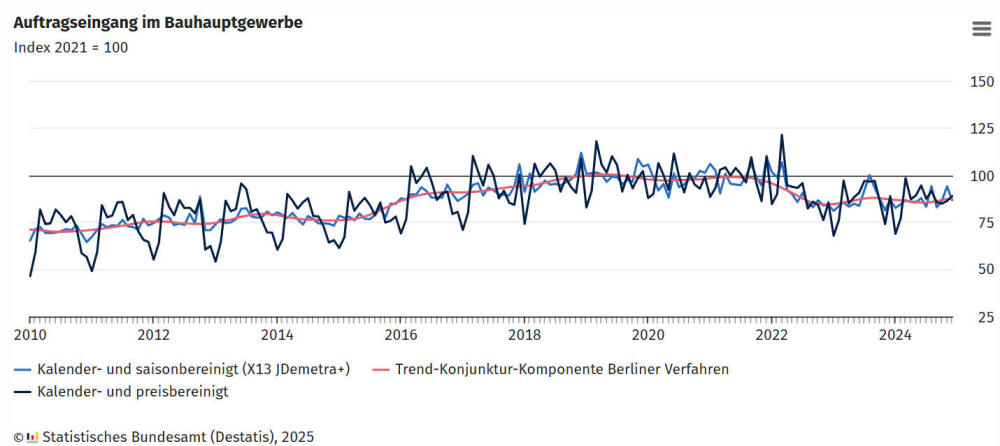






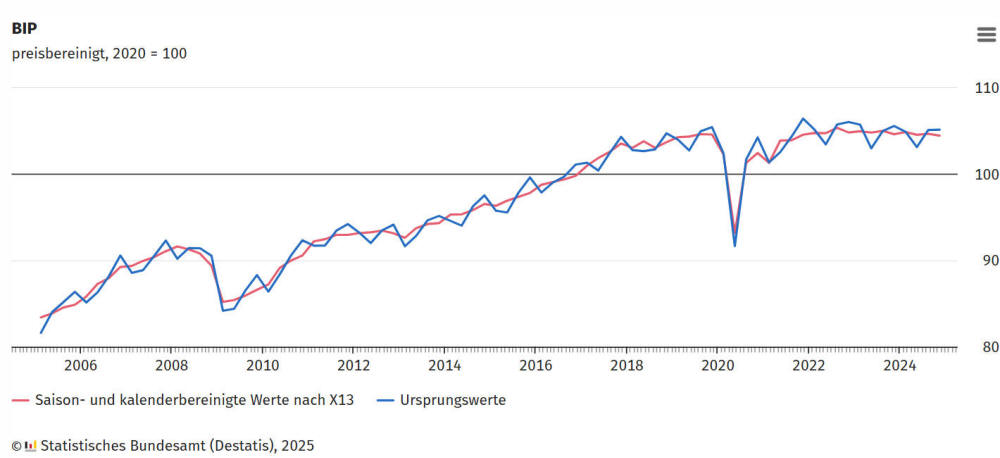


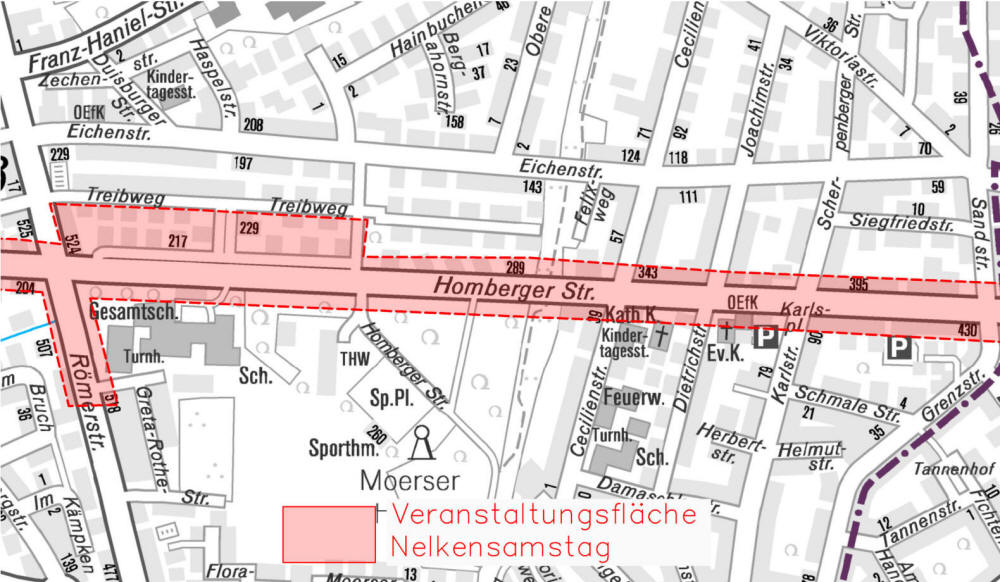
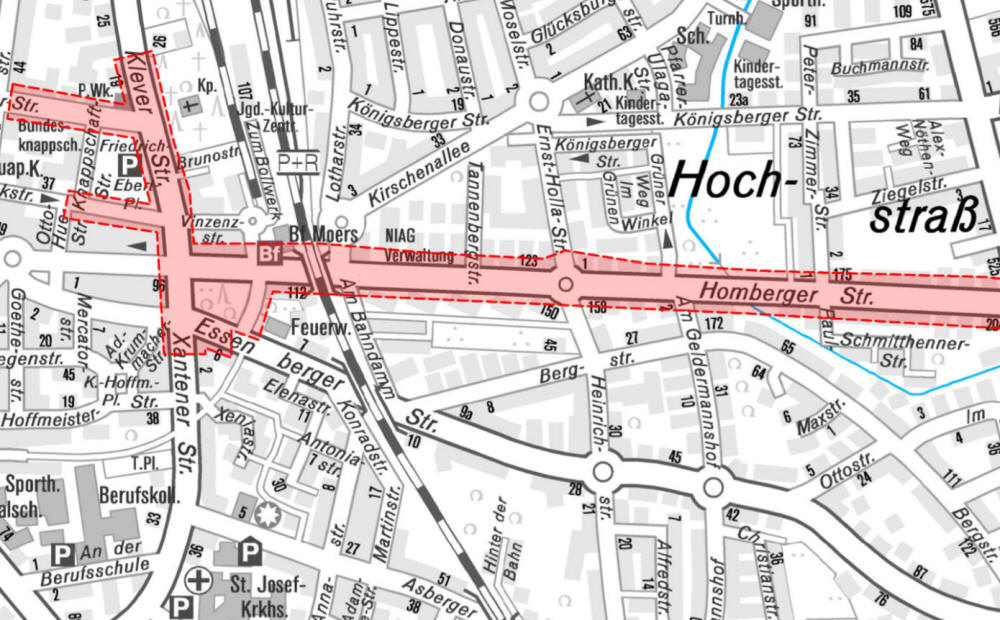
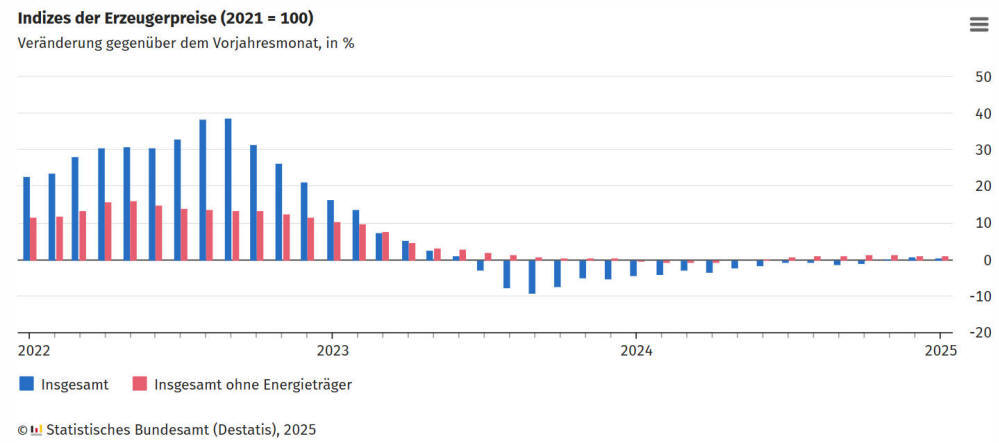
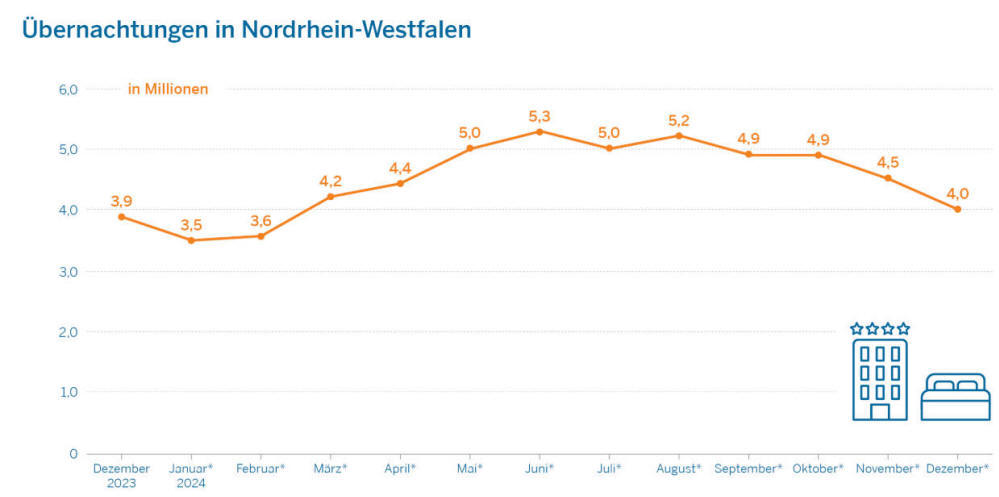
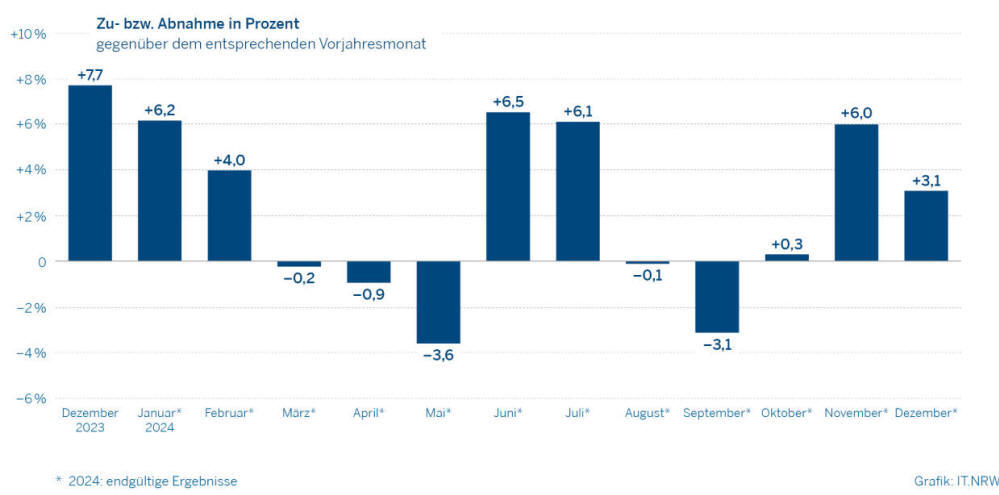
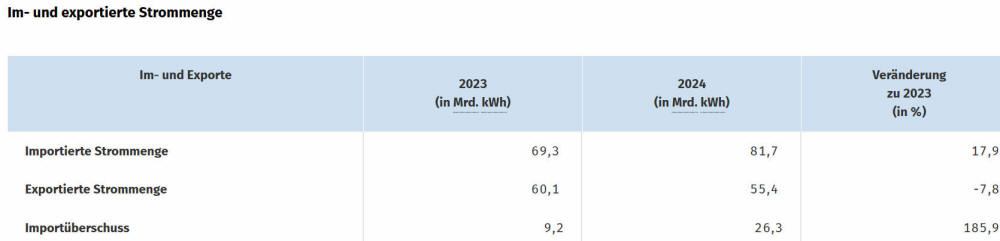
 Nachhaltigkeitstagung 2025. Foto: Sarah Rauch /
LAG 21 NRW
Nachhaltigkeitstagung 2025. Foto: Sarah Rauch /
LAG 21 NRW