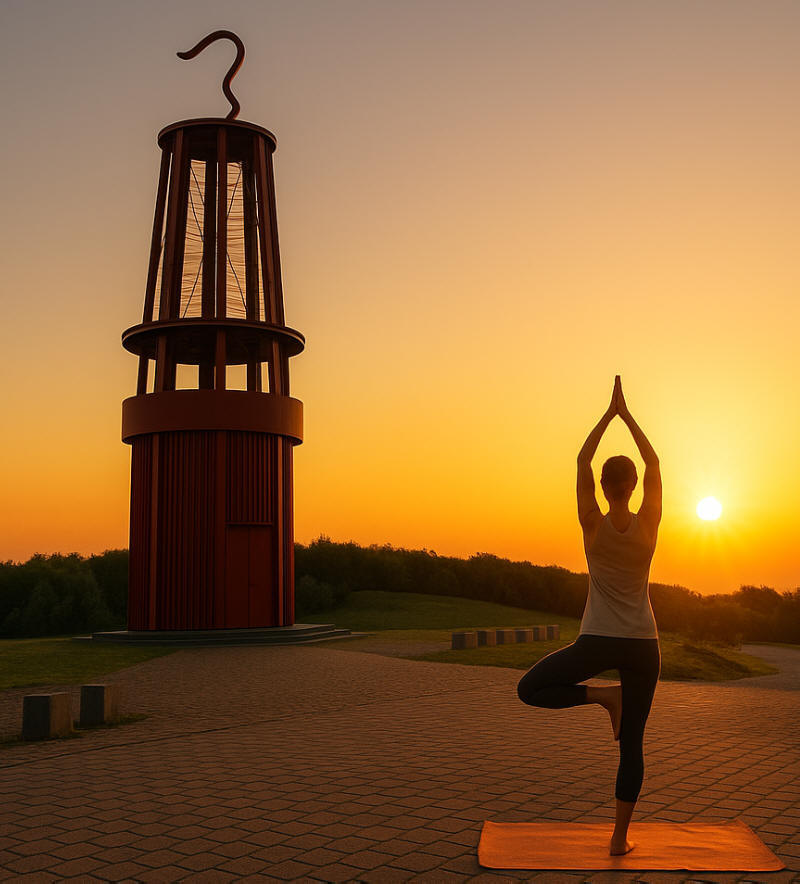|
Samstag, 7., Sonntag, 8. Juni 2025 -
Pfingstsonntag
Lippefähre muss wegen
Amprion-Projekt vorzeitig aus dem Wasser
genommen werden
Die Lippefähre „Quertreiber“ muss leider wegen
eines Amprion-Projekts bereits am Donnerstag,
12. Juni 2025, aus dem Wasser genommen werden.
Da das Bauvorhaben mehrere Monate dauert (wie
die bauausführende Firma jetzt mitteilte), wird
die Fähre in diesem Jahr leider nicht mehr ins
Wasser gelassen. Die Stadt Wesel bedauert
diesen Schritt.
NATO-Verteidigungsminister einigen sich auf neue
Fähigkeitsziele zur Stärkung des Bündnisses
Bei ihrem Treffen in Brüssel am Donnerstag, dem
5. Juni einigten sich die
NATO-Verteidigungsminister auf eine Reihe
ehrgeiziger neuer Fähigkeitsziele, um ein
stärkeres, gerechteres und tödlicheres Bündnis
aufzubauen und die Kriegsbereitschaft für die
kommenden Jahre sicherzustellen.
Auf
einer Abschlusspressekonferenz bestätigte
NATO-Generalsekretär Mark Rutte, dass die Ziele
„genau beschreiben, in welche Fähigkeiten die
Verbündeten in den kommenden Jahren investieren
müssen … um unsere Abschreckung und Verteidigung
stark zu halten und die Sicherheit unserer eine
Milliarde Menschen zu gewährleisten.“
Die Ziele bilden die Grundlage für einen neuen
Investitionsplan für die Verteidigung, der
voraussichtlich auf dem NATO-Gipfel in Den Haag
verabschiedet wird. Der Vorschlag sieht vor,
dass die Verbündeten fünf Prozent ihres BIP in
die Verteidigung investieren, davon 3,5 Prozent
in die Kernausgaben für die Verteidigung, sowie
jährlich 1,5 Prozent ihres BIP in verteidigungs-
und sicherheitsrelevante Investitionen, darunter
in Infrastruktur und Resilienz.
Der
NATO-Ukraine-Rat tagte ebenfalls am Donnerstag.
Zu den Verbündeten gehörten der ukrainische
Verteidigungsminister Rustem Umerov und die Hohe
Vertreterin der Europäischen Union für Außen-
und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas. Im
Anschluss an das Treffen bekräftigte der
Generalsekretär die Unterstützung der
Verbündeten für die Ukraine und wies darauf hin,
dass die Verbündeten allein in diesem Jahr über
20 Milliarden Euro an zusätzlicher
Sicherheitshilfe für die Ukraine zugesagt
hätten.
Er begrüßte zudem die
zusätzliche Unterstützung, die die Verbündeten
beim Treffen der
Ukraine-Verteidigungskontaktgruppe am Mittwoch
zugesagt hatten. Im Abschlusstreffen des
Ministertreffens nahmen die Bündnispartner an
einer regulären Sitzung der Nuklearen
Planungsgruppe der NATO teil. „Die nukleare
Abschreckung bleibt der Eckpfeiler der
Sicherheit des Bündnisses“, erklärte der
Generalsekretär.
„Wir werden dafür
sorgen, dass die nukleare Kapazität der NATO
stark und wirksam bleibt, um den Frieden zu
wahren, Zwang zu verhindern und Aggressionen
abzuschrecken.“

Foto NATO
Kleve trotzt dem
Landestrend: Mehr Geburten –
Kindertagesbetreuung gut aufgestellt
Entgegen dem landesweiten Trend verzeichnet die
Stadt Kleve im Jahr 2024 einen Anstieg der
Geburten. Nach Auswertungen von IT.NRW wurden
461 Kinder geboren – das sind 32 mehr als im
Vorjahr (429 Geburten), was einem Zuwachs von
rund 7,5 % entspricht. Während nach aktuellen
Zahlen in Nordrhein-Westfalen insgesamt einen
Rückgang der Geburten um 1,8 % verzeichnet,
gehört Kleve damit zu den wenigen Städten und
Kreisen, die einen gegenteiligen Trend erleben.

Die Stadt Kleve sieht in dieser Entwicklung ein
ermutigendes Signal: „Wir freuen uns über die
steigenden Geburtenzahlen in unserer Stadt – sie
sind ein Ausdruck dafür, dass sich junge
Familien in Kleve wohlfühlen und hier ihre
Zukunft sehen“, so Martina Hunting,
Jugendhilfeplanerin des Fachbereiches Jugend und
Familie.
Die Stadt Kleve ist gut auf
diese Entwicklung vorbereitet: „Dank
vorausschauender Planung und einem
kontinuierlichen Ausbau der Kindertagesbetreuung
können wir dem Bedarf an Betreuungsplätzen
begegnen. Bereits in den vergangenen Jahren
wurden zusätzliche Angebote geplant und
bestehende weiterentwickelt.“
Die Stadt
Kleve wird auch in Zukunft die Kinder- und
Jugendhilfe bedarfsgerecht weiterentwickeln, um
den Anforderungen einer wachsenden jungen
Generation gerecht zu werden.
NRW: Rückgang der Geburten setzt sich 2024 das
dritte Jahr in Folge fort
Im Jahr
2024 wurden in Nordrhein-Westfalen rund 152.700
Kinder geboren 12 Kreise und kreisfreie Städte
mit Geburtenanstieg entgegen NRW-Trend Gut 70 %
der Mütter besaßen die deutsche
Staatsangehörigkeit
Geburten
Neugeborene
Babys
In Nordrhein-Westfalen wurden
im Jahr 2024 mit 152.688 Kindern 1,8 % weniger
Babys geboren als ein Jahr zuvor (2023:
155.515). Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, sank die Geburtenzahl zum dritten Mal
in Folge. Im Jahr 2014 wurden im Vergleich dazu
noch 155.102 Kinder geboren. In den Jahren 2016
bis 2021 lag diese Zahl noch im Schnitt bei über
170.000 Lebendgeborenen.

12 Kreise und kreisfreie Städte entgegen dem
NRW-Trend mit Geburtenanstieg
In 12 Kreisen
und kreisfreien Städten kamen 2024 – entgegen
dem Trend im Landesschnitt –mehr Kinder zur Welt
als ein Jahr zuvor. Der höchste Anstieg der
Geburtenzahl konnte im Rheinisch-Bergischen
Kreis sowie im Kreis Paderborn mit je 2,9 %
verzeichnet werden.
Die größten
Rückgänge gab es in Duisburg (–8,1 %), Mülheim
an der Ruhr (–6,4 %) und Solingen (–6,2 %). Gut
70 % der Mütter besaßen die deutsche
Staatsangehörigkeit Bei 70,6 % der Neugeborenen
besaß die Mutter die deutsche
Staatsangehörigkeit. Mütter mit ausländischer
Staatsangehörigkeit waren am häufigsten
Syrerinnen (4,3 %), Türkinnen (3,3 %) oder
Rumäninnen (1,9 %).


Kleve: Abschlussprüfungen
bestanden
Zwei Auszubildende der
Stadt Kleve haben erfolgreich Ihre
Abschlussprüfungen zum / zur
Verwaltungsfachangestellten bestanden. Henrik
Dietze schloss seine Ausbildung im Juni als
Jahrgangsbester ab.
Jule Hopman schloss
Ihre Ausbildung nach einer verkürzten
Ausbildungsdauer von zweieinhalb Jahren bereits
im Januar erfolgreich ab. Der Erste Beigeordnete
und Stadtkämmerer Klaus Keysers, der
Fachbereichsleiter Zentrale Verwaltung,
Bürgerservice und Personenstand Thomas Horster
und die Ausbildungsleitung Katharina Bösl
gratulierten den beiden zur bestandenen Prüfung
und freuen sich, sie auch in Zukunft bei der
Stadt Kleve beschäftigen zu dürfen.

Im Foto (v.l.): Ausbildungsleitung Katharina
Bösl, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
Klaus Keysers, Henrik Dietze, Jule Hopman,
Fachbereichsleiter Zentrale Verwaltung,
Bürgerservice und Personenstand Thomas Horster
Kleve: Auf den Spuren von Johane
Sebus
Die Geschichte der Johanna
Sebus kann auch nach über 200 Jahren noch zu
Tränen rühren: sie rettete bei der großen
Flutkatastrophe 1809 zuerst ihre Mutter und kam
dann bei dem Versuch, weitere Menschen zu
retten, selbst ums Leben.
Bei einer
neuen Führung der Wirtschaft, Tourismus &
Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) am Samstag, den
14. Juni schlüpft die zertifizierte
Gästeführerin Hildegard Liebeton in die Rolle
von Christiane von Vernejoul, die eine Bekannte
von Goethe war und den Dichter bat, die
Geschichte in einer Ballade zu verewigen.

Gästeführerin Hildegard Liebeton als Madame de
Vernejoul „Obwohl die traurig endende Geschichte
der Johanna Sebus bereits solange her ist, finde
ich ihre heldenhafte Tat aktuell genug, um immer
wieder in Erinnerung gerufen zu werden. Es geht
um selbstlose Nächstenliebe, wovon wir auf der
Welt oft zu wenig haben“, findet die
Gästeführerin Hildegard Liebeton.
Sie
wird bei dem Spaziergang in Brienen und
Wardhausen viel vom Rheinhoch-wasser und den
verheerenden Deichbrüchen erzählen. Außerdem
führt der Rundgang zum Wegekreuz in Brienen, das
zum Gedenken an die Marienkirche errichtet
wurde, die durch den Deichbruch unterspült
wurde. Auch über die Schleuse in Brienen gibt es
spannende Geschichten zu berichten.
Die
circa 90-minütige Führung beginnt um 11 Uhr am
Johanna Sebus Denkmal in Wardhausen
(Johanna-Sebus-Straße) und kostet 9 €. Um
Anmeldung auf www.kleve-tourismus.de oder
bei der WTM Stadt Kleve (Tel.: 02821 84806) wird
gebeten.
Moers: Führung durch die
Hüsch-Sonderausstellung ‚Freiheit!‘ erleben
Hüsch mal anders: Eine
Führung am Sonntag, 15. Juni, um 15 Uhr
beleuchtet die Sonderausstellung ‚Freiheit! Das
Studio 45 und der kulturelle Neubeginn 1945‘.
Sie zeigt die Anfänge des Kabarettisten und
Poeten im Spätsommer 1945, als er und Theo van
Alst eine Gruppe junger Menschen um sich
sammelten, die sich regelmäßig trafen und „über
Gott und die Welt, Nazis und Demokratie, Kunst
und Philosophie“ diskutierten.
Hanns
Dieter Hüsch um 1945, als er eine Gruppe junger
Menschen um sich sammelte, die später das
‚Studio 45‘ gründeten.

(Foto: Hanns Dieter Hüsch Nachlass, Grafschafter
Museum)
Aus dem Club entstand das
‚Studio 45‘. Sie spielten Theater,
veranstalteten Lyrikabende und musizierten. 80
Jahre nach der Befreiung Deutschlands vom
Nationalsozialismus und zum 100. Geburtstag von
Hanns Dieter Hüsch geht die Ausstellung dieser
‚kulturellen Freiheitsbewegung‘ und dem
Lebensweg ihrer Protagonistinnen und
Protagonisten nach, die beispielhaft für den
kulturellen Neubeginn in Nordrhein-Westfalen
nach 1945 stehen.
Für die Teilnahme an
der Führung ist lediglich der reguläre
Museumseintritt zu entrichten ist. Besucherinnen
und Besucher mit gültigem Bibliotheksausweis
haben freien Eintritt.
Moers:
‚Hochamt ohne Weihrauch‘ am 15. Juni erinnert an
Hüsch
Der Satiriker und
literarische Kabarettist Wendelin Haverkamp
erinnert am Sonntag, 15. Juni, um 11.30 Uhr im
Großen Sitzungssaal des Rathauses (Rathausplatz
1, Zugang über den Innenhof des Rathauses an der
Treppe/Gebäudeübergang) an seinen Freund und
Kollegen Hanns Dieter Hüsch.

(Foto: Dieter Kaspari)
Bürgermeister
Christoph Fleischhauer hat den Künstler als
persönlichen Beitrag zum Hüsch-Jahr eingeladen.
Haverkamp findet, dass die Erinnerung an den
Niederrhein-Poeten angemessen sein muss. Deshalb
gilt: Hochamt ja, Weihrauch nein!
Es
geht in dem Vormittag unter dem Titel ‚Hochamt
ohne Weihrauch‘ um Erlebnisse aus dem Alltag der
fahrenden Künstler, wobei nicht nur das Schöne,
sondern auch das Traurige zur Sprache kommt, das
aber so mit Heiterkeit umhüllt ist, dass jeder
tragische Moment zum komischen wird.
Die
Fähigkeit zu diesem Perspektivwechsel
beherrschte kaum jemand so kunst- und liebevoll,
mit so einzigartigem, menschlichen Humor wie
Hüsch. Der Musiker Franz Brandt begleitet den
Vortrag Haverkamps musikalisch. Der Eintritt an
dem Vormittag ist frei. Da die Anzahl der Plätze
begrenzt ist, bittet das Büro des Bürgermeisters
um Anmeldungen per E-Mail an buerobm@moers.de.
Kleve: Genuss im Grünen am 15.
Juni
Gästeführerin Elisabeth
Thönnissen am Moritz Kanal Zu dieser Jahreszeit
ist ein Spaziergang durch die Klever
Gartenanlagen ein Genuss. Erst recht, wenn zum
Auge auch der Gaumen verwöhnt wird. Dieses
Erlebnis bietet die Wirtschaft, Tourismus &
Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) am Sonntag, den
15. Juni bei der Führung „Genuss im Grünen“.

Die Gästeführerin Elisabeth Thönnissen wird
durch die Parkanlage führen und die
Schlaglichter der Klever Gärten
veranschaulichen. Dabei wird sowohl die
Gestaltung des Amphitheaters mit dem
Moritz-Kanal, als auch die Anlage des
Forstgartens und die Blütezeit als Kurort „Bad
Cleve“ thematisiert. Dazu werden kleine Häppchen
gereicht.
„Die Teilnehmer dürfen sich
auf leckere Genüsschen freuen, die in Bezug zur
istorie unserer schönen Gartenanlagen stehen“
berichtet Elisabeth Thönnissen, die den Großteil
der Häppchen selbst zubereitet. Die circa
90-minütige Führung beginnt um 16 Uhr am Museum
Kurhaus Kleve (Tiergartenstraße 41) und kostet
15 €. Eine Anmeldung auf
www.kleve-tourismus.de oder bei der WTM
Stadt Kleve (Tel.: 02821 84806) ist
erforderlich.

Reallöhne im 1. Quartal 2025 um 1,2 % höher
als im Vorjahresquartal
• Nominallöhne steigen im 1. Quartal 2025 um 3,6
% zum Vorjahresquartal
• Nominallohnwachstum
bei Geringverdienenden prozentual am stärksten
Die Nominallöhne in Deutschland waren im
1. Quartal 2025 um 3,6 % höher als im
Vorjahresquartal. Dies ist der schwächste
Anstieg seit dem Jahr 2022. Die
Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um
2,3 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
weiter mitteilt, lagen die Reallöhne damit im 1.
Quartal 2025 um 1,2 % höher als im
Vorjahresquartal und stiegen somit zum achten
Mal in Folge. Verantwortlich für den
vergleichsweise moderaten Anstieg dürfte der
Wegfall der Inflationsausgleichsprämie sein.

Überdurchschnittliche nominale
Verdienststeigerungen waren im 1. Quartal 2025
in den Wirtschaftsabschnitten Energieversorgung
(+6,6 %), Erbringung von freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen
Dienstleistungen (+5,8 %) und Information und
Kommunikation (+5,8 %) festzustellen.
Demgegenüber verzeichneten die
Wirtschaftsabschnitte Erbringung von Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen (+1,5 %) und
Grundstücks- und Wohnungswesen (+1,1 %)
vergleichsweise geringe Nominallohnanstiege.
Der Wirtschaftsabschnitt Bergbau und
Gewinnung von Steinen und Erden wies mit -2,4 %
einen Nominallohnverlust auf. Geringverdienende
mit den stärksten Verdienststeigerungen
Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach
ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte das Fünftel
mit den geringsten Verdiensten (1. Quintil) mit
einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von
7,2 % zum Vorjahreszeitraum die stärksten
Verdienststeigerungen im 1. Quartal 2025.
Die Verdienste der Vollzeitkräfte insgesamt
stiegen um 3,6 % und damit genauso stark wie die
Nominallöhne in der Gesamtwirtschaft. Für das
oberste Fünftel mit den höchsten Verdiensten
unter den Vollzeitbeschäftigten (5. Quintil)
betrug der Nominallohnanstieg 2,7 %.
Auszubildende wiesen im 1. Quartal 2025 mit
4,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal ein
überdurchschnittliches Nominallohnwachstum auf.
Geringfügig Beschäftigte hingegen hatten einen
Anstieg von nur 0,7 % zu verzeichnen.
Pharmazeutisch-technische
Assistenzausbildung in NRW: Ein Drittel der
Azubis hat eine ausländische Staatsangehörigkeit
* Unter den ausländischen Azubis zur PTA
hatte jede(r) zweite die syrische
Staatsangehörigkeit
* Die Ausbildung zur
pharmazeutisch-technischen Assistenz gehört zu
den TOP 5-Berufen in der schulischen
Gesundheitsausbildung
* Nahezu neun von zehn
Personen in der pharmazeutisch-technischen
Assistenzausbildung waren weiblich
Knapp
80 % der Schulen des Gesundheitswesens in NRW
haben an einer freiwilligen Erhebung
teilgenommen und 1.350 Personen gemeldet, die
sich zum Stichtag 15.10.2024 in einer
schulischen Ausbildung zur
pharmazeutisch-technischen Assistenz (PTA)
befanden. Wie das Statistische Landesamt
anlässlich des Tags der Apotheke am 07. Juni
2025 mitteilt, hatte von diesen Auszubildenden
knapp ein Drittel eine ausländische
Staatsangehörigkeit.

Knapp jeder zweite Auszubildende mit
ausländischer Staatsangehörigkeit hatte die
syrische (48,8 %), gefolgt von der irakischen
(15,5 %) und der türkischen (7,3 %).
PTA-Ausbildung einer der TOP-Berufe an Schulen
des Gesundheitswesens Insgesamt wurden 17.435
Personen gemeldet, die sich zum Stichtag des
15. Oktober 2024 in einer schulischen
Gesundheitsausbildung befanden.

Dabei stellten neben der erwähnten
PTA-Ausbildung die Ausbildungsberufe der
Physiotherapie, der Pflegefachassistenz, der
Ergotherapie sowie der Notfallsanitäterin bzw.
-sanitäter die meisten Auszubildenden. Mit einem
Anteil von 31,5 % waren Azubis mit ausländischer
Staatsangehörigkeit in der PTA-Ausbildung
überdurchschnittlich häufig vertreten.
Zum Vergleich: Über alle Ausbildungen an den
Schulen des Gesundheitswesens hinweg lag der
Anteil ausländischer Azubis bei 14,2 %.
Frauenanteil in der PTA-Ausbildung lag bei über
85 % Auch der Frauenanteil lag in der
PTA-Ausbildung mit 85,9 % über dem Durchschnitt.
An den Schulen des Gesundheitswesens waren über
alle Ausbildungsberufe hinweg 68,9 % der Azubis
weiblich.
Freitag, 6. Juni 2025
Deponieplanung Lohmannsheide -
BUND-Informationsveranstaltung 13.06. 19 Uhr in
Baerl
DAH1 will sofortigen Vollzug vor
Gericht erstreiten, BUND hält dagegen
Informationen zur Klagebegründung des BUND im
Hauptverfahren
Klever Kinderfest am 15
Juni 2025 im Tiergarten Kleve
Am 15 Juni findet das diesjährige Klever
Kinderfest im Tiergarten Kleve statt. Im
Zeitraum von 10:00 bis 17:00 Uhr werden an
diesem Tag kreative und abwechslungsreiche
Angebote und Programme wie Spielen, Basteln,
Bewegung und viele weitere tolle Aktionen für
Kinder geboten. Der Eintritt ist an diesem Tag
für alle Besucher kostenlos.

Folgende Parkplätze können an dem Tag genutzt
werden: Tiergarten, Forstgarten, Hagebaumarkt,
Kaufland und Gesamtschule am Forstgarten. Die
Stadt Kleve bittet alle Besucherinnen und
Besucher, ausschließlich ausgewiesene Parkplätze
zu nutzen. Das Parken auf Grünflächen und
entlang der Tiergartenstraße (B9) ist nicht
gestattet.
Da erfahrungsgemäß mit einem
hohen Besucherandrang gerechnet werden kann,
empfiehlt das Kinderfestteam die Anreise mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad.
Zudem bittet das Team um etwas Geduld im
Eingangsbereich, da bei hohem Andrang ggfs.
Wartezeiten entstehen können.
Das
Kinderfest endet um 17:00 Uhr, der Tiergarten
ist jedoch regulär bis 18:00 Uhr an dem Tag
geöffnet. Das Kinderfestteam, welches aus über
100 haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern besteht, freut sich auf einen fröhlichen
Tag mit allen Kindern und Familien.
Dinslaken: Vorschläge zur Wahl des neuen
Integrationsrats können noch eingereicht werden
Am Sonntag, 14. September 2025, findet in
Dinslaken im Rahmen der Kommunalwahl auch die
Wahl des neuen Integrationsrates statt. Diese
Wahl bietet Einwohner*innen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit oder internationaler
Familienbiografie die Möglichkeit, aktiv an der
Gestaltung des städtischen Zusammenlebens
mitzuwirken.
Wählbar sind alle Menschen,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sich
seit mindestens einem Jahr rechtmäßig in
Deutschland aufhalten und seit mindestens drei
Monaten mit Hauptwohnsitz in Dinslaken gemeldet
sind. Wahlvorschläge können noch bis
einschließlich 7. Juli 2025 beim Wahlbüro der
Stadt Dinslaken eingereicht werden – sowohl als
Einzelkandidatur als auch als Liste.
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel betont die
Bedeutung der Integrationsratswahl: „Dinslaken
lebt von Vielfalt und dem Engagement aller
Menschen in unserer Stadt. Die Zusammenarbeit
zwischen Stadtverwaltung, Politik und
Integrationsrat bietet Chancen für die Umsetzung
aller Interessen. So bilden diese demokratischen
Prozesse die Grundlage dafür, unsere lebenswerte
Stadt Dinslaken gemeinsam zu gestalten. Die
Integrationsratswahl trägt zu einem
respektvollen, chancengerechten und lebendigen
Miteinander in Dinslaken bei. Bitte gehen Sie
wählen!“
Der Integrationsrat ist ein
zentrales Gremium der kommunalen Mitbestimmung,
das die Interessen von Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte vertritt und deren
Anliegen in die politischen
Entscheidungsprozesse der Stadt einbringt. Er
setzt sich für Chancengerechtigkeit, die
Stärkung politischer und sozialer Teilhabe, die
Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus
sowie für die Förderung von Mehrsprachigkeit und
Bildungschancen ein.
Darüber hinaus
begleitet der Integrationsrat unter anderem den
Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf und
engagiert sich für die Integration und Betreuung
Schutzsuchender sowie für den Zugang zu Sport-
und Vereinsangeboten für alle
Bevölkerungsgruppen. Weitere Informationen zur
Wahl, zu den Voraussetzungen für eine Kandidatur
sowie zur Stimmabgabe erhalten Interessierte
beim Wahlbüro der Stadt Dinslaken unter der
Telefonnummer 02064 66-888 oder per E-Mail an
wahlen@dinslaken.de.
Am
14. Juni Streifzüge durch die Moerser Geschichte
erleben
Geschichte ‚live‘
erleben: Auf eine Reise durch die Jahrhunderte
der Stadt Moers können sich die Teilnehmenden
der ‚Nacht der Geschichte‘ am Samstag, 14. Juni,
begeben.

Foto: Pressestelle
Ab 19 Uhr verwandelt
sich die Innenstadt in eine ‚Bühne‘, auf der
historische Figuren den Besucherinnen und
Besuchern die facettenreiche Vergangenheit der
Grafenstadt näherbringen. Der Grafschafter
Museums- und Geschichtsverein (GMGV) organisiert
in Zusammenarbeit mit Grafschafter Museum, der
städtischen Wirtschaftsförderung sowie den
Stadtführerinnen und Stadtführern die beliebte
Reihe.
„Wir begehen die Nacht der
Geschichte bereits zum siebten Mal – die
Zusammenarbeit ist bereits hervorragend
eingespielt“, erklärt Peter Boschheidgen,
GMGV-Vorsitzender. In den letzten Jahren konnten
die Partner immer eine Steigerung der
Besucherzahl erzielen. „Es macht offensichtlich
eine große Freude, Geschichte in Gemeinschaft zu
erleben“, so Boschheidgen.
Frühling
an Emscher und Lippe fiel deutlich zu trocken
aus
Sowohl der Mai 2025 als auch
der meteorologische Frühling in diesem Jahr
(März, April und Mai) fielen zu trocken aus –
das ist das Ergebnis der
Niederschlagsauswertungen der beiden
Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft
und Lippeverband. In beiden Verbandsgebieten
landet der Mai unter den Top 20 der trockensten
Mai-Monate seit 1931.
Im Emscher-Gebiet
fielen im Mittel 35,3 mm Niederschlag
(langjähriges Mittel: 60 mm) und im Lippe-Gebiet
34,5 mm (langjähriges Mittel: 58 mm). Es fiel
damit jeweils nur knapp über die Hälfte des
langjährigen Mittels. Zur Einordnung: Ein
Millimeter entspricht einem Liter pro
Quadratmeter.
Beinahe der gesamte
Monatsniederschlag fiel in der Zeit vom 23. bis
zum 31. Mai. Zwischen dem 25. April und dem 23.
Mai sind lediglich 0,7 mm Niederschlag im Mittel
im Emscher-Gebiet gefallen. Im Lippe-Gebiet
waren es in diesem Zeitraum nur 1,0 mm. Am 23.
Mai endete also eine etwa vierwöchige
Trockenphase.
Das Monatsmittel der
Lufttemperatur liegt mit 14,9 Grad Celsius über
dem langjährigen Mittel von 14,1 Grad Celsius.
Der meteorologische Frühling (März, April
und Mai) war ebenfalls deutlich zu trocken. Im
Emscher-Gebiet fielen im Mittel 112,5 mm
Niederschlag. Das entspricht dem
zwölfttrockensten Frühling seit 1931. Im
Lippe-Gebiet lag das Gebietsmittel im Frühling
bei 100,0 mm. Damit liegt der Frühling 2025 mit
Rang 8 sogar unter den zehn trockensten
Frühjahren ab 1931 im Lippe-Gebiet.
Das
Monatsmittel der Lufttemperatur lag in allen
drei Frühlingsmonaten über dem langjährigen
Mittel. Der März lag mit 7,6 Grad über ein Grad
über dem langjährigen Mittel von 6,3 Grad. Im
April lag mit 12,0 zu 9,9 Grad sogar eine
Differenz von 2,1 Grad vor. Der Mai lag, wie
bereits erwähnt, 0,8 Grad über dem langjährigen
Mittel (14,9 gegenüber 14,1).
Emschergenossenschaft und Lippeverband
Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV)
sind öffentlich-rechtliche
Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee
des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip
leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten
Emschergenossenschaft sind unter anderem die
Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung
und -reinigung sowie der Hochwasserschutz.
Der 1926 gegründete Lippeverband
bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe
im nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem
den Lippe-Zufluss Seseke naturnah um. Gemeinsam
haben Emschergenossenschaft und Lippeverband
rund 1.800 Beschäftigte und sind Deutschlands
größter Abwasserentsorger und Betreiber von
Kläranlagen und Pumpwerken (rund 782 Kilometer
Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle,
546 Pumpwerke und 59 Kläranlagen).
www.eglv.de
DMB-Vorstand Tenbieg: „Mittelstand hätte
sich mehr Mut bei der Steuersenkung erhofft“
Der am 4. Juni vom Kabinett beschlossene
Gesetzesentwurf zur steuerlichen Entlastung von
Unternehmen ist aus Sicht des Deutschen
Mittelstands-Bunds (DMB) ein Schritt in die
richtige Richtung. Verbandschef Marc S. Tenbieg
lobt insbesondere die Umsetzungsgeschwindigkeit.
Bei der Steuersenkung wäre allerdings mehr Mut
wünschenswert gewesen. Zudem gilt es, neben dem
wichtigen Thema Investitionen weitere
Entlastungsschritte für Unternehmen zügig
umzusetzen.
Tenbieg führt aus: „Positiv
hervorzuheben ist, dass die neue Bundesregierung
ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag heute
im Kabinett auf den Weg gebracht hat. Dass dies
zügig und ohne Störgeräusche passiert ist, ist
ein positives Signal an die Unternehmen.
Schwarz-Rot zeigt sich handlungsfähig und hat
erkannt, dass es unmittelbare Investitions- und
Wachstumsimpulse für Unternehmen braucht. Der
‚Booster‘ schafft Planungssicherheit für
diejenigen, die aktuell investieren können.
Mehr Mut hätte es beim Thema Steuersenkungen
gebraucht, denn hier wären krisengebeutelte
Unternehmen direkter entlastet worden. Ich
kritisiere vor allem, dass die Reduzierung der
Körperschaftsteuer erst in drei Jahren wirksam
wird und damit vom politischen Willen einer
neuen Bundesregierung abhängig ist. Hier wäre
mehr Eile geboten gewesen, um die internationale
Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands
zu verbessern.
Leider verkennt der
aktuelle Gesetzesentwurf von Schwarz-Rot die
Dringlichkeit, die für die Betriebe tagtäglich
zu spüren ist. Dennoch kann das Gesetzespaket
als Schritt in die richtige Richtung gewertet
werden. Nun müssen schnell weitere folgen: Der
DMB erhebt seit Jahren mit seinem
Mittelstands-Index die drängendsten
Herausforderungen von Unternehmen. Hier
rangieren die Themen Steuersenkungen und
Investitionen regelmäßig hinter den Top-Themen
Bürokratieabbau und Energiekosten.“
Citizen Science-Projekt „DNA macht
Schule“ Was lebt in meinem Bach?
In
NRW stehen bald Schüler:innen der Grundschule
und der Oberstufe an Bächen ihrer Umgebung. Im
Projekt
DNA
macht Schule der Universität Duisburg-Essen
nehmen sie Wasserproben und untersuchen den
Zustand der Gewässer. Dabei liefern sie auch
Daten, die behördliche Beobachtungen ergänzen
können. Am 2. Juni war der offizielle
Projektstart des vom Umweltbundsamtes
finanzierten Projekts. Lehrkräfte können ihre
Klassen oder Kurse jetzt
anmelden.

Projektlogo. © UDE
Junge Menschen für
Natur und Wissenschaft begeistern und
nützliche Daten gewinnen. Diesen Ansatz
verfolgt das Citizen Science-Projekt DNA macht
Schule. Kinder aus der Grundschule und
Schüler:innen der gymnasialen Oberstufe in NRW
untersuchen in dem Projekt ein schulnahes
Fließgewässer. Dort beurteilen sie die
Gewässerstruktur, also beispielsweise, wie der
Bach verläuft und wie seine Umgebung aussieht.
Und sie verschaffen sich einen Überblick über
die dort lebenden Tiere, indem sie u. a. Steine
umdrehen und die Arten bestimmen. Aber nicht
alle Lebewesen lassen sich leicht entdecken.
Hier kommt die innovative Forschungsmethode
DNA-Metabarcoding in Spiel: Sie funktioniert wie
ein Barcode-Leser, der auch kleinste Lebewesen
anhand genetischer Spuren im Wasser
identifizieren kann. Forscher:innen der
Aquatischen Ökosystemforschung der Universität
Duisburg-Essen (UDE) analysieren die
Gewässerproben der Schüler:innen und erstellen
Listen der nachgewiesenen Arten.
Diese
werden vom Biology Education Research and
Learning Lab, kurz BERLL, für die Auswertung in
der Schule aufbereitet und in ein
Unterrichtskonzept eingebunden. Mit den
Ergebnissen können die Schüler:innen
Rückschlüsse auf die Lebensgemeinschaften und
den ökologischen Zustand ihres Gewässers in
Schulnähe ziehen. Die so gewonnen Daten sind
auch für die Gewässerforschung sowie Behörden
interessant, denn über den ökologischen Zustand
vieler kleiner Fließgewässer in NRW gibt es nur
wenige Informationen.
Entsprechend des
Citizen Science-Ansatzes, auch
Bürgerwissenschaften genannt, arbeiten
Bürger:innen, hier Schüler:innen und Lehrkräfte,
und Wissenschaftler:innen Hand in Hand. Junge
Menschen können ihr Bewusstsein und Interesse
für den Schutz dieser fließenden Ökosysteme
weiterentwickeln sowie moderne
Forschungsmethoden kennenlernen. Gleichzeitig
entstehen relevante Daten für Wissenschaft und
Behörden. Das Projekt wird durch das
Umweltbundesamt finanziert.
Das
Kick-off-Treffen fand am 2. Juni im
Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) in
Berlin statt. Hier präsentierten und
diskutierten die Projektbeteiligten aus
Wissenschaft, Schule, Umweltbundesamt und
Bundesministerium die Projektpläne und -ziele.
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.dna-macht-schule.de
KI-Schulpreis prämiert Einsatz von Künstlicher
Intelligenz an Schulen Bewerbungen noch bis 10.
Oktober unter www.ki-schulpreis.de möglich.
Deutschland – Land der Ideen, die Deutsche
Telekom Stiftung und die Dieter Schwarz Stiftung
rufen Schulen in ganz Deutschland zur Teilnahme
am KI-Schulpreis auf. Der Wettbewerb zeichnet
Schulen aus, die Künstliche Intelligenz (KI)
innovativ im Unterricht nutzen, beispielsweise
in der Schulorganisation oder zur Unterstützung
von Lehrkräften und Schüler:innen.
Ziel
ist es, durch wegweisende Konzepte andere
Schulen zu inspirieren und den Blick auf die
Chancen von KI in der Bildung zu lenken. Die
prämierten Schulen werden als bundesweite
Vorreiter im Bereich KI sichtbar gemacht und bei
einer feierlichen Abschlussveranstaltung am 16.
Januar 2026 auf dem Bildungscampus Heilbronn
geehrt. Neben der öffentlichen Würdigung und der
Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen,
erwarten die Gewinner Geldpreise im Gesamtwert
von 100.000 Euro.

Jetzt bewerben! Noch bis 10. Oktober 2025 können
sich Primar- und Sekundarschulen mit Sitz in
Deutschland in zwei Kategorien bewerben:
KI-Gesamtkonzept: Schulen, die KI strategisch
und umfassend in verschiedenen Bereichen
einsetzen – etwa im Unterricht, zur Förderung
von Inklusion oder zur Automatisierung
administrativer Aufgaben.
KI-Teilkonzept: Schulen, die KI gezielt in einem
bestimmten Fachbereich oder für einen klar
definierten Anwendungsfall nutzen –
beispielsweise zur Bereitstellung individueller
Lernangebote oder für Pilotprojekte.
Weitere Informationen sowie Text- und
Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung
finden Sie unter www.ki-schulpreis.de.
Über die Initiative Deutschland – Land der
Ideen
2006 anlässlich der Fußball-WM von der
Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft
gegründet ist Land der Ideen die Plattform für
gute Ideen in Deutschland. Gemeinsam mit
Partnern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft
und Gesellschaft realisiert Deutschland – Land
der Ideen Ideenwettbewerbe, Publikationen,
Ausstellungen, virtuelle Formate und
internationale Dialoge, darunter aktuell das
Ostdeutsche Wirtschaftsforum (OWF) und das
afrikanisch-deutsche Young Leaders Programme
AGYLE.
Über die Deutsche Telekom
Stiftung
Die Deutsche Telekom Stiftung will
mit ihren Aktivitäten die MINT-Kompetenzen von
Kindern und Jugendlichen verbessern. Dazu
gehören auch das Arbeiten in der Kultur der
Digitalität und das Lernen mit und über
Künstliche Intelligenz. Sie will die
Bildungschancen junger Menschen erhöhen und
konzentriert sich darauf, dass die Gruppe der
leistungsstärksten Schülerinnen und Schüler
größer und die der leistungsschwächsten kleiner
wird. Sie arbeitet mit Schulen und deren
Partnern im Bildungsökosystem zusammen und
engagiert sich für bessere Rahmenbedingungen im
gesamten Bildungssystem.
Über die Dieter
Schwarz Stiftung
Die Dieter Schwarz
Stiftung gehört zu den großen Stiftungen in
Deutschland und wird dort tätig, wo Wirtschaft
und Gesellschaft Anforderungen stellen, die
staatliche Organe nicht oder nicht ausreichend
erfüllen können. „Bildung fördern, Wissen
teilen, Zukunft wagen“, ist das Credo der
Stiftung, die mit ihrem Engagement heute das
fördert, was die Gesellschaft von morgen stark
macht: Ein breites Spektrum an Bildungsangeboten
für Menschen in verschiedenen Lebensphasen.
Digitalisierung und Künstliche
Intelligenz inklusiv gestalten
BAGSO-Stellungnahme zum Regierungsprogramm von
CDU, CSU und SPD
Die BAGSO –
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen setzt sich dafür ein,
dass die Bedürfnisse und Rechte älterer Menschen
bei der voranschreitenden Digitalisierung
berücksichtigt werden. In ihrer Stellungnahme
„Digitalisierung und Künstliche Intelligenz
inklusiv gestalten – Teilhabe älterer Menschen
sichern“ zum Koalitionsvertrag der schwarz-roten
Regierung fordert sie, dass die Digitalisierung
allen zugutekommen muss.
Menschen, die
nicht über ausreichende digitale Kompetenzen
oder Unterstützungsangebote verfügen, dürfen
nicht ausgeschlossen werden. Ziel muss es sein,
die digitale Transformation barrierearm,
verständlich und generationengerecht zu
gestalten. Im Koalitionsvertrag bekennt sich die
Bundesregierung zu einer Strategie des „digital
only“ für Verwaltungsprozesse und öffentliche
Dienstleistungen.
Auch in
Gesundheitswesen und Pflege sollen verstärkt
digitale Lösungen umgesetzt werden. Um hierbei
Menschen ohne oder mit geringen digitalen
Kompetenzen nicht auszugrenzen, fordert die
BAGSO, dass weiterhin analoge Zugänge angeboten
werden. Zugleich müssen Beratungs- und
Unterstützungsangebote zur Förderung digitaler
Kompetenzen ausgebaut werden. Unter anderem muss
der DigitalPakt Alter als gemeinsame Initiative
von Bundesseniorenministerium und BAGSO
verstetigt und weiterentwickelt werden.
Die BAGSO setzt sich für einen
verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher
Intelligenz ein. In ihrer Stellungnahme weist
sie auf die Gefahren von Altersdiskriminierung
bei automatisierten Entscheidungen hin, der
entgegengewirkt werden muss. Sie fordert zudem
einen starken und transparenten Datenschutz, um
das Vertrauen von Nutzerinnen und Nutzern in
digitale Anwendungen zu erhöhen.
Nach
Ansicht der BAGSO muss die digitale
Transformation nicht nur als technisches
Modernisierungsprojekt sondern als
gesamtgesellschaftliche Gestaltungsaufgabe
verstanden werden.
Zur Stellungnahme „Digitalisierung und
Künstliche Intelligenz inklusiv gestalten –
Teilhabe älterer Menschen sichern“
Krankenhaus Bethanien: Neue
Ärztliche Leitung für das Sozialpädiatrische
Zentrum - Dr. Nadine Dierksen folgt auf Dr.
Wolfgang Poss
Seit dem 01. Mai ist
Dr. Nadine Dierksen die neue Ärztliche Leitung
des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) am
Krankenhaus Bethanien Moers. Sie übernahm die
Nachfolge von Dr. Wolfgang Poss, der sich nach
38 Jahren Bethanien und 20 Jahren als Ärztlicher
Leiter des SPZs Ende April in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet hatte.
„Ich
freue mich, gemeinsam mit meinem sehr versierten
und engagierten Team durchzustarten. Wir
arbeiten hier eng und an den Bedürfnissen der
Patientinnen und Patienten orientiert zusammen.
Noch schöner ist, dass wir das in frisch
renovierten, modernen Räumlichkeiten tun
können“, erklärt Dr. Nadine Dierksen. Seit dem
19. Mai sind die Praxisräume des SPZs im
Erdgeschoss des Hauses R auf dem Campus
Bethanien zu finden.
Die erfahrene
Pädiaterin kam aus dem Evangelischen Krankenhaus
Oberhausen, wo sie zuletzt als Oberärztin tätig
war, nach Moers. Patient:innen können von der
passionierten Triathletin, die schon während
ihrer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester
wusste, dass sie Kinder- und Jugendärztin werden
wollte, eine umfassende Betreuung und Beratung
erwarten. „Mir ist es wichtig, nicht nur die
Wünsche und Ziele der Eltern zu kennen, sondern
vor allem die Kinder und Jugendlichen danach zu
fragen, was sie sich wünschen. Das habe ich
bislang so gehandhabt und würde es gerne auch in
Moers fortführen.“ Kolleg:innen und
Mitarbeiter:innen könnten ein immer offenes Ohr
und Unterstützung in allen Situationen erwarten,
so die neue Leitung des SPZs.
„Ich habe
von Beginn an einen sehr positiven Eindruck von
der Stiftung Bethanien gewonnen.“ Auf ihre Ziele
und Pläne angesprochen, erklärt sie: „Mein
Vorgänger hat ein hervorragendes Zentrum
aufgebaut. Das möchte ich in der Form
weiterführen. Oberste Priorität hat für mich
aktuell die Kontinuität – sowohl für die
bestmögliche Versorgung unserer kleinen
Patientinnen und Patienten als auch für meine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie und ihre
jeweiligen Spezifikationen will ich in der
nächsten Zeit kennenlernen. Wenn das geschehen
ist, möchte ich das SPZ gemeinsam mit ihnen
weiterentwickeln – orientiert an den jeweiligen
Problemfeldern, die sich ergeben. Damit Familien
eine optimale Versorgung bei uns erhalten.“
Dr. Ralf Engels, Vorstand der Stiftung
Bethanien, betont: „Ich freue mich, mit Frau Dr.
Dierksen eine versierte und erfahrene Pädiaterin
als neue Leitung unseres SPZs gewonnen zu haben.
Sie bringt alles mit, um die wertvolle Arbeit
von Herrn Dr. Poss fortzuführen und auch die
Weiterentwicklung unseres Sozialpädiatrischen
Zentrums voranzutreiben.“

Dr. Nadine Dierksen hat seit dem 01. Mai 2025
die Ärztliche Leitung des SPZs am Krankenhaus
Bethanien Moers übernommen.

Mehr als zwei Drittel der im Jahr 2024
errichteten Wohngebäude heizen mit Wärmepumpen
• Anteil von Wärmepumpen als
primäre Heizung binnen zehn Jahren verdoppelt
• Baugenehmigungen: 81,0 % der 2024
genehmigten Wohngebäude sollen primär mit
Wärmepumpen heizen
• Produktion von
Wärmepumpen im Jahr 2024 deutlich rückläufig
In immer mehr neuen Wohngebäuden in
Deutschland werden Wärmepumpen zum Heizen
genutzt. Mehr als zwei Drittel (69,4 %) der
knapp 76 100 im Jahr 2024 fertiggestellten
Wohngebäude nutzen Wärmepumpen zur primären,
also überwiegend für das Heizen eingesetzten
Energie.
Gegenüber 2023 stieg der Anteil
um rund 5 Prozentpunkte, gegenüber 2014 (31,8 %)
hat er sich mehr als verdoppelt, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.
Wärmepumpen kommen vor allem in Ein- und
Zweifamilienhäusern zum Einsatz: In 74,1 % aller
2024 fertiggestellten Ein- und
Zweifamilienhäuser wurde eine Wärmepumpe zur
primären Heizenergie genutzt, deutlich seltener
war der Einsatz in Mehrfamilienhäusern (45,9 %).

In vier von fünf neuen Wohngebäuden werden
erneuerbare Energiequellen zum Heizen genutzt
Wärmepumpen nutzen zum Heizen Geo- und
Umweltthermie, die zu den erneuerbaren
Energiequellen zählen. Inzwischen wird ein
Großteil der neu errichteten Wohngebäude
hierzulande überwiegend mit erneuerbaren
Energien beheizt: In 73,9 % der 2024
fertiggestellten Wohngebäude waren erneuerbare
die primäre Energiequelle für das Heizen. 2014
lag der Anteil noch bei 38,5 %.
Zu den
erneuerbaren Energien bei Heizungen zählen neben
Erd- oder Luftwärmepumpen auch Holz, etwa in
Pelletheizungen oder Kaminöfen (Anteil als
primäre Heizenergiequelle 2024: 3,6 %),
Solarthermie (0,5 %), Biogas/Biomethan (0,2 %)
sowie sonstige Biomasse (0,2 %). Erneuerbare
Energien kommen aber auch als ergänzende
Energiequelle zum Einsatz, beispielsweise durch
einen Holzofen.
Ob als primäre oder
sekundäre Quelle – insgesamt werden erneuerbare
Energien 2024 in vier von fünf neuen
Wohngebäuden (82,3 %) zum Heizen genutzt. 2014
lag der Anteil noch bei 61,7 %. Primär mit Gas
wird in 15 % der Neubauten geheizt Als
zweitwichtigste primäre Energiequelle wurde im
Jahr 2024 in 15,0 % der Neubauten Erdgas
eingesetzt.
Der Anteil von Gasheizungen
als primäre Energiequelle hat sich binnen zehn
Jahren mehr als halbiert: 2014 hatte er noch bei
50,7 % gelegen. Primär mit Fernwärme beheizt
wurden 8,5 % der neuen Wohngebäude (2014:
7,9 %). Ölheizungen wurden nur noch in rund 230
neuen Wohnhäusern als Primärheizung eingesetzt,
das waren 0,3 % der Neubauten (2014: 1,2 %).
Mehr als drei Viertel aller genehmigten
Wohnneubauten sollen primär mit Wärmepumpen
heizen
Der Trend zum Heizen mit erneuerbaren
Energien zeigt sich auch beim Planen neuer
Wohngebäude. 84,8 % der rund 54 800 im Jahr 2024
genehmigten Wohngebäude sollen primär mit
erneuerbarer Energie beheizt werden. Meist
handelt es sich auch hier um Wärmepumpen: Sie
sollen in 81,0 % der genehmigten Neubauten als
primäre Heizung zum Einsatz kommen.
Erdgas
als häufigster konventioneller Energieträger
spielt mit einem Anteil von 3,7 % auch bei der
Planung von Wohngebäuden eine zunehmend kleinere
Rolle.
Bestehende Gebäude mit Wohnraum
werden mehrheitlich mit Gas beheizt
Bei den
bestehenden Gebäuden mit Wohnraum dominiert
Erdgas als primärer Energieträger: Laut Zensus
wurden zum Stichtag 15. Mai 2022 mehr als die
Hälfte (53,9 %) der bestehenden Gebäude mit
Wohnraum konventionell mit Erdgas beheizt. Bei
rund einem Viertel (24,7 %) der Gebäude mit
Wohnraum kam Heizöl zum Einsatz.
Erneuerbare Energiequellen zum Heizen spielen im
Gesamtbestand mit einem Anteil von 10,2 %
bislang eine untergeordnete Rolle. Mit Solar-
oder Geothermie, Umwelt- oder Abluftwärme (in
der Regel mit Wärmepumpen) wurden 4,2 % der
Gebäude mit Wohnraum beheizt.
Produktion
von Wärmepumpen 2024 gegenüber Vorjahr mehr als
halbiert
Trotz des zunehmenden Einsatzes von
Wärmepumpen in Neubauten gingen die
Produktionszahlen deutlich zurück und erreichten
den niedrigsten Stand innerhalb der letzten
sechs Jahre: Im Jahr 2024 wurden in Deutschland
rund 162 400 Wärmepumpen im Wert von 587
Millionen Euro hergestellt. Mengenmäßig waren
das 59,4 % weniger als im Jahr zuvor mit rund
400 100 Wärmepumpen im Wert von 1,2 Milliarden
Euro.

Außenhandel mit Wärmepumpen im Jahr 2024
deutlich zurückgegangen
Eine ähnliche
Entwicklung zeigt sich beim Außenhandel mit
Wärmepumpen: 2024 wurden Wärmepumpen im Wert von
755 Millionen Euro importiert, ein Rückgang
gegenüber dem Vorjahr von wertmäßig 27,9 %.
Im Jahr 2023 wurden Wärmepumpen im Wert von
rund 1,0 Milliarden Euro nach Deutschland
importiert. Noch deutlicher gingen die Exporte
von Wärmepumpen zurück: So wurden im Jahr 2024
Wärmepumpen im Wert von 480 Millionen Euro
exportiert und damit 40,2 % weniger als noch
2023.
NRW 2024: 3,7 %
weniger Betriebs-, Büro- und Verwaltungsgebäude
fertiggestellt
* 2.533 neue
Nichtwohngebäude fertiggestellt
* Baukosten
steigen um 7 %; Rauminhalt sinkt um 17,5 %
gegenüber 2023
* Handels- und Lagergebäude
deutlich von Rückgängen betroffen
Im
Jahr 2024 wurden in Nordrhein-Westfalen 2.533
neue Betriebs-, Büro- und Verwaltungsgebäude
fertiggestellt. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
auf Basis der Statistik der Baufertigstellungen
mitteilt, waren das 97 Fertigstellungen oder
3,7 % weniger als ein Jahr zuvor. Der Rauminhalt
dieser neuen sogenannten Nichtwohngebäude sank
um 17,5 % auf knapp 28 Millionen Kubikmeter.

Investiert wurden hierfür fast fünf
Milliarden Euro (4,96) – ein Zuwachs von 7 % im
Vergleich zu den Baukosten 2023, die bei
4,63 Milliarden Euro lagen. Knapp ein Drittel
der 2024 fertiggestellten Nichtwohngebäude in
NRW waren Handels- und Lagergebäude (833;
−7,4 %). Bei weiteren rund 20 % handelte es sich
um landwirtschaftliche Betriebsgebäude (518;
+0,6 %). Außerdem wurden 262 Büro- und
Verwaltungsgebäude (−0,4 %) und 249 Fabrik- und
Werkstattgebäude (−15,3 %) fertiggestellt.
Bei den übrigen 671 Nichtwohngebäuden lag
der Zuwachs bei 2,0 %, hier wurden 13 Gebäude
mehr fertiggestellt als 2023. Der Rauminhalt –
ein Indikator für die Bauaktivität bei
Nichtwohngebäuden – sank gegenüber 2023 um
17,5 % auf knapp 28 Millionen Kubikmeter.
Rückgang des Rauminhaltes von über 30 % bei
Handels- und Lagergebäuden Fast die Hälfte des
neuen umbauten Raumes entfiel mit 13,6 Millionen
Kubikmetern auf Handels- und Lagergebäude – ein
Rückgang um 32,6 % im Vergleich zum Vorjahr.
Auch bei Fabrik- und Werkstattgebäuden sank
der Rauminhalt um 10,8 % auf 2,9 Millionen
Kubikmeter. Bei den Büro- und
Verwaltungsgebäuden gab es einen Zuwachs um
20,6 % auf 3,6 Millionen Kubikmeter, bei den
landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden wurde
ebenso eine positive Entwicklung verzeichnet mit
8,9 % auf 2,9 Millionen Kubikmeter und in der
Kategorie übrige Nichtwohngebäude lag der
Anstieg bei 3,7 % auf 5,1 Millionen Kubikmeter.
Donnerstag, 5. Juni 2025
- Internationaler Tag der Umwelt 2025
Wesel:
„Demokratie lebt von Vielfalt – engagiere Dich
im Integrationsrat“
Am 14.
September 2025 findet parallel zur Kommunalwahl
die Wahl des Weseler Integrationsrates statt.
Unter dem Titel „Demokratie lebt von Vielfalt –
engagiere Dich im Integrationsrat“ lädt die
Integrationsbeauftragte der Stadt Wesel, Lotte
Goldschmidtböing, am Donnerstag, den 5. Juni
2025, von 17:00 bis 18:30 Uhr zu einer
Informationsveranstaltung ein.

Ziel der Veranstaltung ist es, über die Aufgaben
und Mitwirkungsmöglichkeiten im Integrationsrat
zu informieren und Kandidatinnen und Kandidaten
zu gewinnen, die sich für die Wahl zum
Integrationsrat aufstellen lassen.
Kandidieren können Menschen mit und ohne
internationale Familiengeschichte, die in Wesel
wohnen und sich für Vielfalt, Toleranz und
gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren
möchten. Der Integrationsrat ist ein
demokratisch gewähltes Gremium, das die
Interessen von Menschen mit internationaler
Familiengeschichte in der Weseler Stadtpolitik
vertritt.
Er bringt Themen wie
Chancengleichheit, Antidiskriminierung,
interkulturelles Miteinander und Teilhabe in
politische Entscheidungsprozesse ein. Die
Mitglieder arbeiten eng mit Verwaltung, Politik
und Zivilgesellschaft zusammen, um Wesel als
weltoffene und gerechte Stadt mitzugestalten.
Als besonderer Gast wird der Vorsitzende
des Landesintegrationsrates, Tayfun Keltek, an
der Veranstaltung teilnehmen. Er verfügt über
jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der
Integrationspolitik und gibt an diesem Abend
wertvolle Einblicke in seine Arbeit und
Perspektiven. Veranstaltungsort: Volkshochschule
Wesel „centrum“, Raum 300, Ritterstr.
10-14, 46483 Wesel.
Datum: Donnerstag,
5. Juni 2025 Uhrzeit: 17:00 bis 18:30 Uhr Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen. Eine
Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an
integration@wesel.de oder telefonisch unter 0281
203 2371.
Radwegsanierung auf der Straße Trajanring (K36)
in Xanten
Auf der
Kreisstraße 36 (K36) (Trajanring) sind Arbeiten
zur Sanierung des Radweges geplant. Dabei werden
etwa 20 schadenbehaftete Stellen im Verlauf des
Radwegs punktuell ausgebessert, um die
Sicherheit und den Komfort für Radfahrende zu
verbessern. Für die Arbeiten ist eine
Vollsperrung des Radwegs notwendig.
Im
ersten Bauabschnitt, von Mittwoch, 4. Juni 2025
bis Dienstag, 10. Juni 2025, ist der Radweg
zwischen dem Augustusring und der Urselerstraße
gesperrt. Im zweiten Bauabschnitt (10. Juni –
18. Juni) betrifft die Sperrung den Radweg von
der Urselerstraße bis zur Siegfriedstraße.
Während der Sanierungsarbeiten werden ortsnahe
Umleitungen für zu Fuß Gehende und Radfahrende
entsprechend ausgeschildert.
Die
Fahrbahn für Kraftfahrzeuge bleibt in beiden
Richtungen durchgehend befahrbar. Diese
Radwegsanierung ist ein wichtiger Schritt, um
die Verkehrsinfrastruktur im Kreis Wesel weiter
zu verbessern und die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen. Zudem wird
bereits jetzt darauf hingewiesen, dass
voraussichtlich ab Mitte Juli die Erneuerung der
Fahrbahn der K36 von der Sonsbecker Straße bis
zur Siegfriedstraße erfolgen wird.
Über
die genauen Details wird der Kreis Wesel
rechtzeitig informieren. Die
Radwegsanierungsarbeiten wurden nach einer
öffentlichen Ausschreibung an die Firma Mesken
aus Bocholt vergeben. Der Kreis Wesel bedankt
sich herzlich für das Verständnis und die Geduld
aller Verkehrsteilnehmenden während der
Bauphase.
Moers: Mutwillige
Zerstörung am BBQ-Trail: Jugendliche frustriert
und traurig
Ungefähr so sehen
sämtliche Sprunghügel aus. Die Jugendlichen sind
frustriert. Ein Projekt, das Jugendliche mit
viel Leidenschaft, Schweiß und Teamgeist über
mehrere Wochen gestaltet haben, wurde mutwillig
beschädigt: die BBQ-Trails für Dirtbikes und
BMX-Räder im Freizeitpark Moers. Sämtliche
Sprunghügel sind nicht mehr nutzbar.

Fotos Streetbox
Die Anlage war durch
Jugendliche unter Leitung der ‚Streetbox‘ des
Caritasverbandes Moers – Xanten e. V.
unterstützt durch das Kinder- und Jugendbüro der
Stadt Moers in aufwendiger Eigenarbeit neu
gestaltet worden. Über vier Wochen lang haben
sie geschaufelt, modelliert und gebaut. Seit
wenigen Tagen war die Strecke erstmals wieder
befahrbar – nun ist sie komplett unbrauchbar.
„Jeder einzelne Sprunghügel ist so
beschädigt, dass man ihn nur schwer einfach
ausbessern kann“, erklärt Lara Jackowiak von der
‚Streetbox‘. „Die Jugendlichen haben wirklich
hart gearbeitet, die Frustration ist riesig –
und das zu Recht. Die Art der Zerstörung lässt
leider nur den Schluss zu, dass es sich um
Vandalismus handelt.“
Dennoch habe man
mit ein paar Jugendlichen versucht zu retten,
was zu retten ist. Derzeit ist unklar, wann und
ob die Strecke wieder vollständig hergestellt
werden kann. „Es braucht jetzt Zeit – und
Unterstützung.“
Auch Kinder- und
Jugendbüro ist entsetzt
„Wir sind mehr als
empört über das Ausmaß dieser mutwilligen
Beschädigung“, so Mark Bochnig-Mathieu vom
Kinder- und Jugendbüro.
„Die BBQ-Trails
sind ein fest etablierter Bestandteil des
Freizeitparks und ein echtes Highlight im
Bereich Trendsport in Moers. In all den Jahren
hat es kleinere Vorfälle gegeben – aber so
etwas, in dieser Dimension, ist beispiellos.“
Das Engagement war groß – nicht nur von Seiten
der Jugendlichen: „Rund 9.000 Euro an
städtischen Mitteln sind in den Umbau geflossen,
zum Beispiel für Erdlieferungen und Maschinen.
Der Personaleinsatz von Caritas und Stadt ist da
noch nicht einmal berücksichtigt.“
Wer
das Projekt unterstützen möchte, meldet sich
gerne unter Telefon 0170 453 09 76 (Streetbox).
Die wichtigsten Regeln für die Dirtbahn:
Keine Hunde
Keine Kletterhügel
Nur mit
geeignetem Fahrrad / Sportgerät (BMX,
Mountainbike) befahrbar
Kein Spielplatz
Moers: Neuer Kletterturm im
Freizeitpark
Die große
Kletter-Rutsch-Kombination im Freizeitpark
bekommt einen neuen Rutschenturm. Der alte
musste gesperrt werden, weil er marode ist. Ab
Donnerstag, 5. Juni, wird das Element
installiert. Bei der Anlieferung kann es zu
Behinderungen auf dem Parkplatz Krefelder Straße
kommen.

Foto Pressestelle
357.063
Kilometer: Moers knackt erneut den eigenen
Stadtradeln-Rekord
Schlechtes
Wetter, aber gute Laune gab es bei der Radtour
mit Bürgermeister Christoph Fleischhauer.

(Foto:
Pressestelle)
Die Fahrräder in Moers
standen im Mai kaum still: Mit 357.063
erradelten Kilometern hat die Grafenstadt beim
diesjährigen Stadtradeln nicht nur ihr eigenes
Ergebnis aus dem Vorjahr (324.901 km)
übertroffen, sondern auch einen neuen
Stadtrekord aufgestellt. Vom 4. bis 24. Mai
traten 2.413 aktive Radelnde in 76 Teams für den
Klimaschutz, die eigene Gesundheit und die Stadt
in die Pedale.
Mit dieser Leistung
konnten rund 53 Tonnen CO₂ eingespart werden –
das sind nochmals 6 Tonnen mehr als im
vergangenen Jahr. Zum Abschluss des Stadtradelns
hatte Bürgermeister Christoph Fleischhauer zu
einer Radtour eingeladen.
18 Schulen
waren dabei
Besonders die Moerser Schulen
haben sich erneut stark beteiligt: Acht
Grundschulen und zehn weiterführende Schulen
waren mit eigenen Teams am Start und haben
wesentlich zum Erfolg beigetragen.
Besonders erfolgreich waren bei den Grundschulen
(Kilometer pro Schüler/in):
Gemeinschaftsgrundschule Eick – 115,4 km, St.
Marien Grundschule – 113,1 km, Regenbogenschule
– 37 km. Die weiterführenden Schulen führen an:
Gymnasium in den Filder Benden – 60,2 km,
Gymnasium Adolfinum – 46,1 km,
Geschwister-Scholl-Gesamtschule – 23,2 km.
Die Übergabe der Urkunden, Preise und Pokale
übernimmt auch in diesem Jahr Bürgermeister
Fleischhauer im Rathaus. Unterstützt wurde die
Aktion wie in den Vorjahren durch die Sparkasse
am Niederrhein, ‚Knappschaft‘ und Enni Sport und
Bäder. Weitere Ergebnisse, Teamwertungen und
Vergleiche mit den Vorjahren sind online
abrufbar unter www.stadtradeln.de/moers.
vhs Moers – Kamp-Lintfort
startet ihr Sommerprogramm
Mit Yoga
bei Sonnenaufgang am Geleucht auf der Halde
Rheinpreußen den jungen Tag begrüßen – das ist
nur ein Kursbeispiel aus dem neuen
Sommerprogramm der vhs Moers – Kamp-Lintfort,
das nun startet
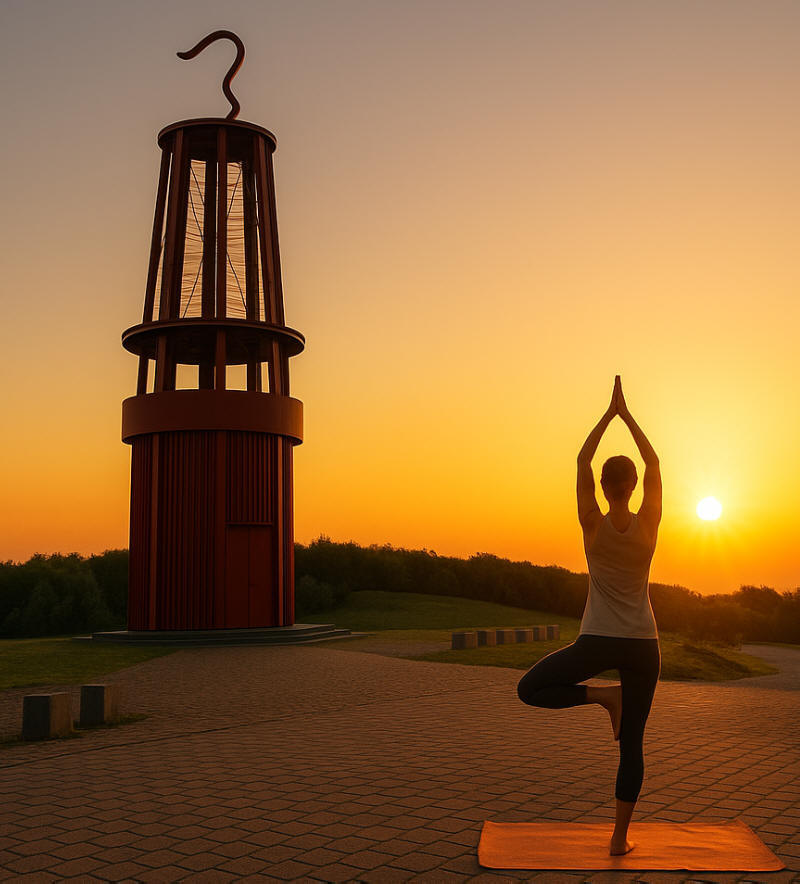
Foto:Stadt Moers, KI-generiert
Interessierte bekommen reichlich Gelegenheit,
die Sommermonate zu nutzen, um mal etwas Neues
auszuprobieren, sei es eine neue Sprache zu
lernen, sich sportlich fit zu halten oder
kreativ zu sein.
In den
Monaten von Juni bis August finden neben
Sprachkursen in Englisch, Französisch, Spanisch
und Italienisch auch Seminare in Deutscher
Gebärdensprache (DGS) statt. Dazu gibt es
entsprechende Einblicke in die Gehörlosenkultur
in Deutschland.
Die Sommerakademie
Malerei und Bildhauerei bietet im Juni insgesamt
fünfmal Gelegenheit zu künstlerischer
Kreativität. Außerdem findet ein Kurs ‚Silver
Clay‘ statt. Den Kopf einmal frei zu bekommen,
verspricht das Angebot ‚Improtheater - Workshop
zum Kennenlernen‘. Interessierte können dabei am
Freitag, 18. Juli, in verschiedene Rollen
schlüpfen und sich von den anderen Teilnehmenden
inspirieren lassen.
Yoga bei
Sonnenaufgang und Schnupper-Tauchen
Im
Bereich Gesundheit und Bewegung finden
Fitness-Begeisterte besonders viele Angebote:
von ganzheitlichem Gedächtnistraining über
verschiedene Yogakurse bis hin zu Schwertkunst,
Body Workout, Bogenschießen, Nordic Walking,
Zumba und Einführung in das Boule-Spiel.
Der neue Kurs ‚Sonnenaufgangs-Yoga‘ am 6.
Juli ist sicherlich in erster Linie für
Frühaufsteher und – steherinnen geeignet. Auch
‚Summerflow-Yoga‘ ist neu im vhs-Programm. Dabei
werden am 10. Juli am Barfußpfad des
Jungbornparks in Repelen fließende
Bewegungsabfolgen und Elemente aus dem
Ashtanga-Yoga vermittelt. Ebenfalls neu und ein
ganz besonderes Angebot dürfte der Kurs
‚Unterwasser-Erlebnis: Tauchen ausprobieren‘
sein.
In Kooperation mit dem Taucher
Kamp-Lintfort e.V. haben Interessierte hier die
seltene Gelegenheit, diesen faszinierenden Sport
für sich zu testen. Wer mitmachen möchte, sollte
sich den 18. Juli vormerken. Etwas weniger
anstrengend dürfte es beim ebenfalls neuen und
dreimal stattfindenden Kurs ‚Mama Fit Body &
Soul – Kurs für schwangere Frauen‘ ab dem 17.
Juli zugehen. Dieser Mix aus Tanz Fitness,
Entspannung und Meditation soll für ein gutes
Körpergefühl der Schwangeren sorgen.
Ist
das Baby schon da, bietet sich ab dem 17. Juni
das ‚Mama + Baby Workout‘ an, das ebenfalls
erstmals im vhs-Programm zu finden ist. Eine
komplette Übersicht über sämtliche Kurse bietet
der druckfrische Flyer der vhs, der in den
Geschäftsstellen sowie im Rathaus ausliegt.
Anmeldungen sind ab sofort möglich.
Eine
Übersicht über die Angebote gibt es auch unter www.vhs-moers.de.
Weitere Informationen sind telefonisch unter 0
28 41/201 – 565 erhältlich.
NRW
und Microsoft starten Skilling-Initiative für
Künstliche Intelligenz
Ministerpräsident Wüst, Vice chair and President
von Microsoft Smith und Schulministerin Feller
wollen KI-Qualifizierung für Lehrkräfte,
öffentliche Verwaltung und Auszubildende in die
Fläche bringen
Ein souveräner und
kompetenter Umgang mit Künstlicher Intelligenz
wird zunehmend wichtiger in Bildung, Beruf und
Verwaltung. Nordrhein-Westfalen setzt deshalb
auf umfassende Bildungsinitiativen zur
KI-Kompetenz. Die Landesregierung bekräftigt
zusammen mit Microsoft das Bestreben, allen
knapp 200.000 Lehrerinnen und Lehrern in
Nordrhein-Westfalen in den kommenden Monaten ein
Angebot zur Fortbildung für die Arbeit mit KI zu
machen.
In einem zweiten Bereich strebt
die Landesregierung ein
KI-Qualifizierungsprogramm für die rund 33.000
Beschäftigten der Finanzverwaltung an. Darüber
hinaus erklärt sich Microsoft bereit, das
KI-Training von ca. 100.000 Auszubildenden in
allen denkbaren beruflichen Anwendungsbereichen
zu unterstützen.
Ministerpräsident
Hendrik Wüst: „Investitionen in Infrastruktur
und Forschung für KI erfüllen nur dann ihren
Zweck, wenn wir auch die Menschen dazu
befähigen, die neue Technik sinnvoll anzuwenden.
In Nordrhein-Westfalen ist KI-Bildung daher ein
Schlüsselthema. Der souveräne Umgang der
Menschen mit KI muss fester Bestandteil unseres
Bildungskanons werden. Für das Angebot, einen
Qualifizierungsschub für die Menschen in
Nordrhein-Westfalen zu unterstützen, sind wir
als Land sehr dankbar.
Microsoft
bekräftigt sein Commitment für den KI-Standort
Nordrhein-Westfalen damit noch einmal auf
beeindruckende Weise. Die Umsetzung der
KI-Skilling-Initiative ist ein weiterer Schritt
auf unserem Weg von der Kohle zur KI. Wir sind
unserem Ziel, Nordrhein-Westfalen zu dem
KI-Hotspot in Europa zu machen, heute wieder ein
Stück nähergekommen.”
Vice Chair and
President von Microsoft Brad Smith: „Es ist
unerlässlich Fachkräfte weiterzubilden, damit
sie KI erfolgreich im beruflichen Umfeld nutzen
und anwenden können, gerade in einer sich rasch
wandelnden Welt. Wenn Menschen über die
richtigen Kompetenzen verfügen, reagieren sie
nicht nur auf den Wandel – sie gestalten ihn
aktiv mit.“
Die neue
KI-Skilling-Initiative verfolgt das Ziel,
Lehrkräfte praxisnah für den
verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher
Intelligenz im Schulalltag zu qualifizieren.
Rund 200.000 Lehrkräfte und Schulleitungen
sollen durch digitale Lernpfade,
Online-Sessions, Multiplikatorenformate sowie
durch praxisorientierte Materialien wie
Prompt-Bibliotheken und Mini-Videos erreicht
werden.
Die Umsetzung übernimmt der
gemeinnützige Förderverein für Jugend und
Sozialarbeit e.V. Die Schulungen sind
kostenfrei, technologieoffen und
plattformneutral – die Inhalte werden in enger
Abstimmung mit dem Land entwickelt. Das Angebot
wird datenschutzkonform ausgestaltet sein. Der
Start der Initiative erfolgt im Schuljahr
2025/26.
Ministerin Dorothee Feller: „Die
neue KI-Skilling-Initiative trägt dazu bei, dass
KI kein technisches Schlagwort bleibt, sondern
Lehrkräfte eine Vorstellung bekommen, welche
Möglichkeiten uns durch einen sinnvollen Einsatz
von KI in Schulen eröffnet werden. Die
Initiative hilft, Hemmnisse abzubauen,
Grundlagenwissen zu vermitteln und Sicherheit im
Umgang mit neuen Technologien zu geben.
Lehrkräfte erhalten neue Perspektiven für ihren
Berufsalltag und konkrete Impulse, wie KI auch
im Unterricht sinnvoll eingesetzt werden kann.
Das Angebot ist datenschutzkonform und
technologieoffen – ohne Festlegung auf ein
bestimmtes Produkt oder eine spezifische
KI-Anwendung. Die Initiative ergänzt unsere
bisherigen Aktivitäten auf diesem Feld. Wir
sorgen dafür, dass unsere Schulen die
Entwicklungen der digitalen Welt gestalten
können. Unser Ziel ist klar: Schülerinnen und
Schüler sollen lernen, wie sie KI sinnvoll
nutzen – und das gelingt am besten, wenn auch
ihre Lehrkräfte gut vorbereitet sind. Für uns
ist das der Schlüssel zu fairen Bildungschancen
in einer digitalen Welt.”
Im Rahmen der
KI-Skilling-Initiative erhalten auch die rund
33.000 Beschäftigten der nordrhein-westfälischen
Finanzverwaltung Zugang zu einem
Fortbildungsangebot im Bereich Künstliche
Intelligenz. Über die finanzverwaltungseigene
digitale Lernumgebung stehen perspektivisch
Module bereit, die grundlegende Kompetenzen im
Umgang mit KI vermitteln – flexibel, dienstlich
einsetzbar und für die Beschäftigten kostenfrei.
Dr. Marcus Optendrenk, Minister der
Finanzen: „Künstliche Intelligenz ist längst
Teil unserer Arbeit – etwa beim Einsatz von
Chatbots oder Analysewerkzeugen. Mit der neuen
Lerninitiative schaffen wir einen
flächendeckenden Zugang zu KI-Basis-Kompetenz
und machen unsere Finanzverwaltung noch
digitaler, leistungsfähiger und zukunftsfester –
und das ohne Mehrkosten.“
Die weitere
Anpassung der von Microsoft bereitgestellten
Inhalte auf die speziellen Bedarfe der
Finanzverwaltung erfolgt gemeinsam mit dem
GovTech-Campus e.V. sowie der
Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung NRW
innerhalb bestehender Strukturen. So können die
Selbstlernmodule zukünftig auch um weitere
Formate wie virtuelle Live-Seminare sowie ein
ganztägiges KI-Briefing mit Fokus auf Verwaltung
und Finanzen ergänzt werden.
Für die
berufliche Bildung hat Microsoft darüber hinaus
angeboten, ein KI-Trainingsprogramm für 100.000
Auszubildende in Nordrhein-Westfalen
bereitzustellen. Damit könnten 100.000
Nachwuchskräfte in Industrie und Handwerk
wichtige Zukunftskompetenzen in künstlicher
Intelligenz erwerben. Der Prüfungsprozess, wie
und mit welchen Partnern dieses Angebot
umgesetzt werden kann, steht allerdings noch am
Anfang.
N'Abend zusammen:
Hüsch-Geschichten und –Lieder am 13. Juni
Die Beteiligten freuen sich auf die
Kabarett-Revue ‚N'Abend zusammen!‘ zu Ehren von
Hanns Dieter Hüsch am Freitag, 13. Juni:
Jacqueline Krzykalla (vorne sitzend, Volksbank
Niederrhein), Künstler und Organisator Norbert
Knabben, Eva Marxen (Leiterin Kulturbüro Moers),
Hans Lammert (Jazztrio Take 3), Künstler Okko
Herlyn und Volksbank-Vorstandsvorsitzender Guido
Lohmann (v. l.)

(Foto: pst)
Hanns Dieter Hüschs Texte
und Lieder sind unvergessen. Seine Erzählungen
von Himmel und Erde, Komik und Tragik,
Menschlichkeit und Widerstand haben bis heute
eine erstaunliche Aktualität behalten.
Unverwechselbar vor allem seine wild wuchernden
Geschichten aus der niederrheinischen Provinz.
Vieles davon soll in der Kabarett-Revue ‚N'Abend
zusammen!‘ am Freitag, 13. Juni, um 20 Uhr im
Kulturzentrum Rheinkamp (Kopernikusstraße 11)
noch einmal lebendig werden.
Der Abend
ist Teil des Jubiläumsprogramms Hüsch100
anlässlich des 100. Geburtstags von Hanns Dieter
Hüsch. Die Veranstaltung wird durch die
Volksbank Niederrhein und die Stadt Moers
gefördert. „Hüsch ist eine der größten Moerser
Persönlichkeiten, weil er die Stadt geprägt hat.
Ich würde ihn gerne einmal in der heutigen Zeit
hören“, erklärt Guido Lohmann,
Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein.
Die Volksbank unterstützt zudem noch
zwei weitere Veranstaltungen im Hüsch-Jahr:
‚Überleben - wat sonst?!‘ von Konrad Beikircher
am 8. November und ‚Lieder meines Lebens‘ mit
dem Konstantin Wecker Trio am 12. Dezember.
Unterschiedlichen Facetten Künstlers Dabei sind
an dem Abend Okko Herlyn, Heike Kehl, Christian
Behrens, Norbert Knabben und das Jazztrio Take
3.
„Wir versuchen mit diesem Projekt,
Hüsch in unterschiedlichen Facetten zu
präsentieren“, erläutert Norbert Knabben, der
die Veranstaltung auch organisiert. Das Ensemble
präsentiert dabei den politischen und
gesellschaftskritischen Zeitgenossen, den Poeten
und nicht zuletzt den überzeugten Christen. Im
Vorfeld dieser Produktion haben dafür alle
Beteiligten ihre Lieblingssongs und Texte auf
den Tisch gelegt. Sie haben kräftig Material
gesichtet, diskutiert und aus vielen einzelnen
Texten und Liedern eine eindrucksvolle und
unterhaltsame Revue im Andenken an den großen
Niederrheiner entwickelt.
„Hüsch ist
zeitlos. Auch heute noch sind die Texte
hochaktuell, wie zum Beispiel zum Thema
Rassismus“, so Okko Herlyn abschließend. Das
gesamte Programm der Veranstaltung und des ist
im Begleitheft zum Hüsch-Jahr nachzulesen, das
in allen städtischen Einrichtungen in Moers
erhältlich ist.
Weitere Informationen
gibt es zudem auf der Internetseite www.huesch100.de.
Tickets sind in vielen bekannten
Vorverkaufsstellen erhältlich, unter anderem
bei: Stadt- und Touristinformation von Moers
Marketing (Kirchstraße 27a/b, Telefon 0 28 41 /
88 22 60), CTS Eventim und reservix. Eine
Eintrittskarte kostet 22,50 Euro.
‚NRW3x3Tour‘: Streetball-Großevent zurück in
Moers
Nach dem großen Erfolg
der Jubiläumsveranstaltung im vergangenen Jahr
kehrt das Streetball-Highlight ‚NRW3x3Tour‘
wieder nach Moers zurück.

Im letzten Jahr sorgten über 120 Teams und
hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem
Sportpark-Parkplatz für eine tolle Atmosphäre.
(Fotos: MTV)
Der Moerser Turnverein (MTV)
in Kooperation mit dem Fachdienst Sport der
Stadt Moers hat sich erneut erfolgreich um einen
Tourstopp beworben – und den Zuschlag erhalten.
Am Sonntag, 15. Juni, wird die Grafenstadt somit
erneut zum Hotspot der Streetball-Szene.
Schauplatz ist – bei gutem Wetter – wieder der
Parkplatz vor dem ENNI-Sportpark Rheinkamp.
Hier sorgten bereits im Vorjahr über 120
Teams und hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer
für eine sportlich stimmungsvolle Atmosphäre.
Sollte das Wetter nicht mitspielen, stehen die
angrenzenden Hallen des ENNI-Sportparks als
wetterfeste Ausweichmöglichkeit zur Verfügung.
Es sind noch Startplätze frei.
Fest für
die ganze Stadt
„Wir haben es wieder
geschafft und das Event nach Moers geholt!“,
freuen sich Jens Köhler (Abteilungsleiter
Basketball) und Andreas Bögner (Vorsitzender des
MTV) unisono über die Zusage zum Wunschtermin.
Die Veranstaltung ist nicht nur ein sportliches
Highlight für den MTV und seine
Basketballabteilung, sondern ein Fest für die
ganze Stadt und die Region. Streetball –
insbesondere im Format 3 gegen 3 – wird immer
beliebter und hat spätestens seit seiner
Aufnahme ins olympische Programm einen festen
Platz in der modernen Sportszene.
In 30
Jahren ‚NRW3x3Tour‘ nahmen bereits über 160.000
Spielerinnen und Spieler in rund 40.000 Teams
teil – ein klares Zeichen für die Relevanz
dieser Tour im Sportland NRW. Auch hinter den
Kulissen ist die Veranstaltung ein Kraftakt:
Rund 60 bis 80 Helferinnen und Helfer sind
nötig, um Auf- und Abbau, Court-Organisation,
Catering und Rahmenprogramm inklusive DJ auf die
Beine zu stellen – eine Aufgabe, die die
Basketballabteilung des MTV mit viel Engagement
übernimmt.
Auf dem Parkplatz des
Sportparks Rheinkamp (Am Sportzentrum 5) geht es
um 13 Uhr los (Einlass 11Uhr). Gegen 19 Uhr ist
die Veranstaltung beendet. Die Teilnahme am
Turnier ist ausschließlich über die
Online-Plattform https://play.fiba3x3.com möglich
und sollte spätestens 24 Stunden vor
Turnierbeginn erfolgen. Weitere Infos: www.nrw-tour.de
Moers: Geschmack und Heilkraft
von Wildkräutern bei Führung entdecken
Sie sind lecker und gesund: Rund um
Wildkräuter dreht sich eine Stadtführung am
Dienstag, 10. Juni, um 18 Uhr. Treffpunkt ist
vor dem Sportplatz GSV/MTV am Solimare, Filder
Straße 148. Anne-Rose Fusenig entdeckt mit den
Teilnehmenden am Moersbach essbare Wildkräuter.
Die Gruppe verkostet die heilsamen und
leckeren Pflanzen bei einer späteren Einkehr.
Auch ein ‚Gesundheitsbad‘ am fließenden Gewässer
unter besonderen Bäumen gibt es bei dem
Rundgang. Verbindliche Anmeldungen zu den
Führungen sind in der Stadt- und
Touristinformation von Moers Marketing möglich:
Kirchstraße 27a/b, Telefon 0 28 41 / 88 22 60.
Die Teilnahme kostet pro Person 12 Euro
(inklusive Einkehr).
„Bethanien rettet“
Die
Veranstaltung der ersten regelmäßigen
linksrheinischen notfallmedizinischen
Fortbildungsreihe lockte erneut viel
Fachpublikum in die Bethanien Akademie.
Fachvortrag zum Thema „Umgang mit fremd- und
selbstgefährdenden Jugendlichen in Moers“.
Mitte Mai lud die Klinik für Notfallmedizin
des Krankenhauses Bethanien Moers zu einer
weiteren Veranstaltung von „Bethanien rettet“,
der ersten und einzigen regelmäßigen
linksrheinischen notfallmedizinischen
Fortbildungsreihe, in die Bethanien Akademie
ein. Rund 70 Personen aus Rettungsdienst,
Polizei, Feuerwehr, Ärztlichem Dienst, Pflege,
Jugend- und Ordnungsamt folgten dieser.
Im Fachvortrag drehte sich alles um den Umgang
mit fremd- und selbstgefährdenden Jugendlichen
in Moers. Dr. Alexandra Dittmer, Oberärztin der
Klinik für Notfallmedizin, Stützpunktleitung des
Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF) am Standort
Bethanien sowie Initiatorin von „Bethanien
rettet“, und Bettina Speier, stellvertretende
Jugendamtsleiterin der Stadt Moers, stellten den
Teilnehmer:innen dazu die Ergebnisse aus einem
Round Table vor.
„Bei einem so
wichtigen und gleichzeitig sensiblen Thema ist
es von großer Bedeutung, dass die
Verantwortlichen wissen, an wen sie sich wenden
können und wer zuständig ist“, erklärt Dr.
Alexandra Dittmer. Konkret habe man eine
Arbeitshilfe erstellt, die ein Ablaufschema
vorschlägt.
„Oft ist im Fall von fremd-
und selbstgefährdenden Jugendlichen, bei denen
der Notarzt bzw. die Notärztin einen
psychiatrischen Behandlungsbedarf feststellt,
nicht direkt klar, wer informiert werden sollte:
Gibt es sorgeberechtigte Eltern? Sind diese
erreichbar und verfügbar? Oder gibt es einen
Betreuer bzw. eine Betreuerin – und ist dieser
bzw. diese erreichbar?
Laut Gesetz gibt
es keine Vorgabe, dass die Kinder und
Jugendlichen mit einer Begleitperson zur
Anlaufstelle für die psychiatrische Behandlung
verbracht werden müssen. Für das Wohl der Kinder
ist es jedoch besser, wenn sie eine vertraute
Begleitperson an ihrer Seite haben. Dann stellt
sich die Frage: Welche Anlaufstelle wird
angefahren? Nachts ist das die LVR-Klinik in
Bedburg-Hau.
Tagsüber bietet etwa die
Institutsambulanz für Kinder und Jugendliche
der LVR-Klinik Bedburg-Hau, die seit 2024 im
Gesundheitszentrum auf dem Campus Bethanien zu
finden ist, eine Anlaufstelle“, beschreibt Dr.
Dittmer die Situation.
„Mit der
Arbeitshilfe können wir den Ablauf für die
Einsatzkräfte optimieren. Eine bessere und
frühzeitigere Vernetzung untereinander, also
etwa zwischen Jugendamt, Ärztlichem Dienst,
Rettungsdienst, Polizei, Pflegestelle,
Ordnungsamt und Fachärztinnen und Fachärzten für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist damit
gegeben. Die Wege sind kürzer und wir sparen
Zeit.“
Die notfallmedizinische
Fortbildungsreihe „Bethanien rettet“ findet
bereits seit 2020 einmal im Quartal statt und
bietet Fachpersonal die Möglichkeit, sich zu
ausgewählten Themen zu informieren und
fortzubilden. Dr. Ralf Engels, Vorstand der
Stiftung Bethanien, betont: „Es freut mich und
macht mich stolz, dass wir einem entsprechenden
Fachpublikum die Plattform bieten können, um in
den Austausch zu gehen und Wissen zu teilen –
und das als Erste und Einzige in der Region
linker Niederrhein. Noch schöner ist es zu
sehen, dass das Angebot so gut angenommen wird.“

Die Fortbildungsreihe „Bethanien rettet“
informierte die Teilnehmer:innen zum Umgang mit
fremd- und selbstgefährdenden Jugendlichen in
Moers.

Abfallaufkommen
in Deutschland im Jahr 2023 weiter gesunken:
-4,8 % zum Vorjahr
•
Abfallaufkommen auf niedrigstem Stand seit 2010
• Erstmals seit 2012 weniger als 200
Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle
•
Abfall-Verwertungsquote stagniert seit 2019 bei
82 %
Im Jahr 2023 sind in Deutschland
nach vorläufigen Ergebnissen 380,1 Millionen
Tonnen Abfälle angefallen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) zum Internationalen Tag der
Umwelt am 5. Juni 2025 weiter mitteilt, waren
das 4,8 % oder 19,0 Millionen Tonnen Abfälle
weniger als im Vorjahr.
Damit sank das
jährliche Abfallaufkommen seit dem Höchststand
von 417,2 Millionen Tonnen im Jahr 2018
kontinuierlich. Weniger Abfälle als im Jahr 2023
waren in Deutschland zuletzt 2010 (373,0
Millionen Tonnen) angefallen. Das Aufkommen an
Bau- und Abbruchabfälle sank 2023 erstmals seit
2012 unter 200 Millionen Tonnen.
8,1 %
weniger Bau- und Abbruchabfälle als im Vorjahr
Der überdurchschnittliche Rückgang bei den
Bau- und Abbruchabfällen um 8,1 % oder
17,4 Millionen Tonnen war maßgeblich für die
Gesamtentwicklung des Abfallaufkommens im Jahr
2023. Ebenfalls deutlich verringerte sich das
Aufkommen an übrigen Abfällen (Produktions- und
Gewerbeabfälle unterschiedlichster Art), und
zwar um 3,3 % oder 1,6 Millionen Tonnen.
Auch die Abfälle aus der Gewinnung und
Behandlung von Bodenschätzen verzeichneten einen
weiteren, aber vergleichsweise geringen Rückgang
um 1,4 % oder 0,4 Millionen Tonnen. Die Menge an
Siedlungsabfällen (Abfälle aus privaten
Haushalten oder vergleichbaren Einrichtungen wie
zum Beispiel Kantinen) stieg, allerdings nur
geringfügig um 0,6 % oder 0,3 Millionen Tonnen.
Auch die bereits in einer
Abfallentsorgungsanlage behandelten sogenannten
Sekundärabfälle nahmen mit einem Anstieg um
0,3 % oder 0,2 Millionen Tonnen wieder leicht
zu.
Bau- und Abbruchabfälle machen
weiterhin über die Hälfte des Abfallaufkommens
aus Trotz des deutlichen Rückgangs machten die
Bau- und Abbruchabfälle im Jahr 2023 mit
198,8 Millionen Tonnen weiterhin den Großteil
des Gesamtabfallaufkommens aus (52), gefolgt von
den Sekundärabfällen mit 57,3 Millionen Tonnen
(15 %), den Siedlungsabfällen mit
48,9 Millionen Tonnen (13 %), den übrigen
Abfällen mit 47,0 Millionen Tonnen (12 %) und
den Abfällen aus der Gewinnung und Behandlung
von Bodenschätzen mit 28,2 Millionen Tonnen
(7 %).
Kein Trend erkennbar: Weiterhin
82 % der Abfälle stofflich oder energetisch
verwertet 313,3 Millionen Tonnen Abfälle wurden
im Jahr 2023 verwertet. Das entspricht einer
Verwertungsquote von 82 %. Damit blieb die
Verwertungsquote des Gesamtabfallaufkommens seit
dem Jahr 2019 unverändert. Die meisten der
verwerteten Abfälle (266,4 Millionen Tonnen oder
70 % aller Abfälle) wurden stofflich verwertet,
also recycelt. Auf Deponien entsorgt wurden 16 %
(59,5 Millionen Tonnen) der Abfälle.
NRW: Gesundheitswirtschaft wächst 2024 um
2,2 %
* Bruttowertschöpfung der
Gesundheitswirtschaft betrug 89,2 Milliarden
Euro
* Anteil an der gesamten
Wirtschaftsleistung des Landes betrug 11,3 %
* Jede(r) siebte Erwerbstätige hatte einen
Arbeitsplatz im Gesundheitsbereich
Die
Bruttowertschöpfung der nordrhein-westfälischen
Gesundheitswirtschaft betrug 89,2 Milliarden
Euro im Jahr 2024. Das waren 11,3 % der gesamten
Wirtschaftsleistung des Landes. Wie das
StatistischesLandesamt mitteilt, war die
Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft
damit preisbereinigt um 2,2 % höher als 2023.

Demnach war das gesundheitswirtschaftliche
Wachstum in NRW stärker als im bundesweiten
Durchschnitt (+1,4 %). In der
NRW-Gesamtwirtschaft sank die
Bruttowertschöpfung gegenüber 2023 um 0,5 %.
Jede(r) siebte Erwerbstätige hatte einen
Arbeitsplatz in der Gesundheitswirtschaft In NRW
hatten im Jahresdurchschnitt 2024 mehr als
1,3 Millionen Menschen und damit jede siebte
erwerbstätige Person (13,8 %) einen Arbeitsplatz
im Gesundheitsbereich.

Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der
Erwerbstätigen um 2,3 %. Damit setzte sich die
kontinuierliche Zunahme der Erwerbstätigenzahl
in der Gesundheitswirtschaft weiter fort. Die
Zahl der Erwerbstätigen in der
Gesundheitswirtschaft stieg im Zeitraum 2015 bis
2024 um 17,4 % Prozent, während die
Gesamtwirtschaft NRWs lediglich ein Plus von
6,3 % Prozent verzeichnen konnte.
Regenbogenfamilien: 31 000
gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern im Jahr
2024
Während des Pride Month im
Juni stehen die Rechte und Lebenswelten
lesbischer, schwuler, bisexueller, trans- und
intergeschlechtlicher sowie queerer Menschen
(LSBTIQ*) im Fokus. 31 000 gleichgeschlechtliche
Paare mit Kindern gab es im Jahr 2024 in
Deutschland, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach Erstergebnissen des Mikrozensus
2024 mitteilt.

In den sogenannten Regenbogenfamilien lebten
50 000 Kinder. Der Begriff Regenbogenfamilien
beschreibt Familien, in denen ein
gleichgeschlechtliches Paar mit minderjährigen
Kindern in einem Haushalt zusammenlebt –
unabhängig davon, ob das Paar verheiratet ist
oder nicht.
Eine von 200 Familien ist
eine Regenbogenfamilie Insgesamt gab es im Jahr
2024 in Deutschland knapp 8,4 Millionen Familien
mit minderjährigen Kindern, gut jede 200. davon
war eine Regenbogenfamilie. Gut 70 % der
Elternpaare in Regenbogenfamilien waren zwei
Frauen (22 000), knapp 30 % Männerpaare (9 000).
Von allen 208 000 gleichgeschlechtlichen
Paaren lebten 15 % als Regenbogenfamilie mit
Kindern unter 18 Jahren zusammen. Legt man einen
erweiterten Familienbegriff zugrunde, der auch
Paare mit erwachsenen Kindern umfasst, lebten in
Deutschland 38 000 Regenbogenfamilien mit
62 000 minderjährigen oder erwachsenen Kindern.
Mittwoch, 4. Juni 2025 -
Bundesweiter Hitzeaktionstag am 4. Juni 2025
10 Millionen Fahrten – eezy.nrw knackt
Rekordmarke
Bundesweit einzigartiges Angebot
Das Prinzip von „eezy.nrw“ ist
einfach: Kein Anstellen am Automaten, keine
Warteschlange, kein Tarif-Dschungel, sondern
einfach per App einchecken und losfahren. Der
Preis wird per Luftlinie berechnet und ist
gedeckelt. Teurer als 58 Euro im Monat kann es
nicht werden. Damit ist „eezy.nrw“ unschlagbar
praktisch für Gelegenheitsfahrer in
Nordrhein-Westfalen.
Jetzt hat das
digitale Ticket die Marke von 10 Millionen
Fahrten geknackt – ein neuer Meilenstein. Und
die Nachfrage steigt. Im April 2025 wurden
landesweit 601.859 Fahrten über das System
gebucht. Gegenüber dem Vormonat März 2025 ist
das ein Plus von 13,6 Prozent.
Im
Vergleich zum April vor einem Jahr hat sich die
Zahl der Fahrten fast verdoppelt (April 2024:
305.992 Fahrten). Damit erreicht der „kleine
Bruder“ vom Deutschlandticket einen neuen
Bekanntheits- und Beliebtheitswert. Bundesweit
einzigartiges Angebot Bundesweit ist der
eezy.nrw-Tarif in dieser Form für ein
Flächenland einzigartig.
Er wurde vor
dreieinhalb Jahren in Zusammenarbeit der
Verkehrsverbünde sowie Tarifgemeinschaften mit
finanzieller Unterstützung des
Verkehrsministeriums entwickelt, um mehr
Menschen den Umstieg auf Bus und Bahn zu
erleichtern. „Neben dem Deutschlandticket ist
eezy.nrw die zweite Ticketrevolution“, erklärt
NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer.
Die Preise von eezy.nrw werden automatisch über
die jeweils genutzte App berechnet – neben
mobil.nrw ist der Tarif aktuell in 47 weiteren
Apps von Verbünden und Verkehrsunternehmen
verfügbar. Pro Fahrt fällt ein Grundpreis
zwischen 1,49 und 1,84 Euro plus zurückgelegtem
Luftlinienkilometer (23 bis 29 Cent) an.
Sobald ein Gesamtpreis von 58 Euro erreicht
ist, sind alle weiteren Fahrten in
Nordrhein-Westfalen im gleichen Kalendermonat
kostenlos. Die Digitalisierung im öffentlichen
Nahverkehr ist ein wichtiger Baustein, um die
nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes
notwendige Verkehrswende erfolgreich zu
gestalten. Sie ermöglicht neue, flexible
Angebote im ÖPNV, bessere und schnelle
Informationen für die Fahrgäste und einen
einfacheren Ticketkauf, um den Einstieg in den
ÖPNV so einfach wie möglich zu machen.
Teilhabe am Arbeitsleben von
Menschen mit Behinderungen
Menschen
mit Behinderungen haben ein Recht auf inklusive
Berufsausbildung und Arbeit. Das neue Themenheft
„Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit
Behinderungen“ gibt einen Überblick über die
komplexen Rechtsgrundlagen und deren Umsetzung
in die Praxis. Instrumente wie das Budget für
Arbeit werden vorgestellt, und anhand
innovativer Projekte werden Wege in den
allgemeinen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
aufgezeigt.
Rund 175.000 Menschen mit
Schwerbehinderung waren 2024 nach der Statistik
der Bundesagentur im Jahresdurchschnitt
arbeitslos gemeldet. Dabei handelt es sich um
einen Anstieg um sechs Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Die Arbeitslosenquote liegt unter
Menschen mit Schwerbehinderung bei 11,6 Prozent
im Vergleich zu 7,3 Prozent bei der
Gesamtbevölkerung.
„Immer noch gelingt
es Menschen mit einer Behinderung trotz
vielfältiger Rehabilitations- und
Teilhabeleistungen seltener, eine Beschäftigung
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufzunehmen“,
betont Dr. Verena Staats, Vorständin des
Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge e.V. Die Vielzahl an möglichen
Instrumenten und Leistungen, deren teils
fehlende Bekanntheit und mitunter
unübersichtliche Zuständigkeit der
Leistungsträger, aber auch lange Antrags- und
Bearbeitungsverfahren stellen Hemmnisse für den
Zugang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt für
Menschen mit Behinderungen dar.
Das
Themenheft bietet einerseits einen Überblick
über die komplexen Rechtsgrundlagen und
Zuständigkeiten der Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben. Andererseits werden Projekte aus
der Praxis vorgestellt, einschließlich aus
anderen EU-Ländern, um Wege für einen
erfolgreichen Übergang auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt aufzuzeigen. Auf dieser Grundlage
werden zudem notwendige
Weiterentwicklungsbedarfe im Hinblick auf die
Gestaltung eines inklusiven Arbeitsmarktes
erörtert.
Die digitale Fachveranstaltung
Netzwerktreffen für kommunale Beauftragte für
Menschen mit Behinderungen des Deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge e.V. findet
am 24. und 25.06.2025 statt. Anmeldungen sind
noch möglich.
Ältere Menschen
vor Hitze schützen - BAGSO ruft Politik zum
Handeln auf
Zum bundesweiten
Hitzeaktionstag am 4. Juni 2025 ruft die BAGSO –
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen dazu auf, ältere Menschen
besser vor Hitze zu schützen. Im Zuge des
Klimawandels sind Hitzewellen in Europa viel
häufiger geworden.
Hitze stellt ein
Gesundheitsrisiko für alle dar. Zu den besonders
Gefährdeten zählen vor allem ältere und
pflegebedürftige Menschen. Die BAGSO fordert
deshalb von Bund, Ländern und Kommunen
umfassende und zügige Maßnahmen, um
hitzebedingten Gesundheitsgefahren
entgegenzuwirken. Die BAGSO ruft dazu auf, bis
zum Jahresende in allen Kommunen
Hitzeaktionspläne zu erstellen und damit den
Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz von
2020 umzusetzen. Diese Pläne müssen besonders
vulnerable Gruppen wie ältere und
pflegebedürftige Menschen berücksichtigen.
Die BAGSO fordert zudem Hitzeschutzpläne für
alle Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste.
Empfehlungen dazu hat der Qualitätsausschuss
Pflege, das zentrale Gremium der pflegerischen
Selbstverwaltung, bereits 2024 veröffentlicht.
Die BAGSO appelliert an die Politik, auch durch
städtebauliche Maßnahmen zum Hitzeschutz
beizutragen.
Studien zeigen, dass z.B.
durch das Anpflanzen von Bäumen und die
Schaffung von Wasser- und Grünflächen die
Hitzebelastung reduziert und die Anzahl der
hitzebedingten Todesfälle gesenkt werden kann.
Bestehende Ungerechtigkeiten in der Verteilung
von Umweltressourcen und -risiken müssen
vorrangig abgebaut werden. Kommunen benötigen
bei dieser Aufgabe finanzielle Unterstützung von
Bund und Ländern.
Gemeinsam mit dem
europäischen Dachverband der
Seniorenorganisationen, AGE Platform Europe,
fordert die BAGSO, pflegebedürftige Menschen und
Ältere insbesondere mit geringem Einkommen auch
bei europäischen Förderrichtlinien zum
Hitzeschutz zu berücksichtigen und ihnen den
Zugang zu wärmegedämmten Wohnungen zu
ermöglichen. Weiterführende Informationen
BAGSO-Positionspapier „Generationenaufgabe
Klimaschutz – für die Welt von morgen (2021)
AGE Platform Europe – Forderungen zum
Internationalen Hitzeaktionstag (2.6.2025)
Nächste Etappe der Sanierung
in der Kühlerstraße - Enni erneuert weitere
Senken und Hausanschlüsse am Mischwasserkanal
Bereits im Vorjahr hatte die ENNI
Stadt & Service Niederrhein (Enni) bei einer
Routineuntersuchung mit einer Kamerabefahrung
zahlreiche Schäden im Mischwasserkanal in der
Kühlerstraße in Moers-Repelen entdeckt und hier
bereits mehrere Kanalsenken und Hausanschlüsse
erneuert.
Ab Donnerstag, 5. Juni 2025,
geht das Unternehmen nun die zweite
Erneuerungsetappe an und saniert in einer
Wanderbaustelle in den kommenden Monaten weitere
fünf Kanalsenken und 15 Hausanschlüsse. Da der
Kanal hier in der Fahrbahnmitte in rund drei
Metern Tiefe liegt, wird die Straße erneut vor
den jeweiligen Baufeldern für den
Durchgangsverkehr zur Sackgasse.
Anlieger können ihre Häuser während der
Bauarbeiten aber jederzeit aus beiden
Fahrtrichtungen erreichen. Für Fußgänger und
Radfahrer bleiben die Baustellen durchweg
passierbar. Enni will die mit dem zuständigen
Fachbereich Straßen und Verkehr der Stadt Moers
abgestimmte Baumaßnahme möglichst bis zu den
Herbstferien im Oktober abschließen. Wer Fragen
hierzu hat, kann sich unter der Rufnummer 104600
informieren.
Lions Club
Duisburg-Hamborn spendet 3.000€ an „Klartext für
Kinder“ – Unterstützung für warme Mahlzeiten in
Moers
Große Freude beim Verein
„Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut
e.V.“: Der Lions Club Duisburg-Hamborn übergab
am 27. Juni 2025 eine Spende in Höhe von 3.000
Euro an den Verein, der sich seit vielen Jahren
für benachteiligte Kinder in Moers engagiert.
Die Mittel stammen aus einer gemeinsamen
Adventskalender-Aktion mehrerer Duisburger Lions
Clubs – mit einem besonderen Augenmerk auf die
Region Moers.
Seit vielen Jahren
verkauft der Lions Club Duisburg-Hamborn zur
Weihnachtszeit Adventskalender für den guten
Zweck. Für fünf Euro pro Stück kann jeder Käufer
nicht nur attraktive Preise gewinnen, sondern
zugleich Kinder und Jugendliche in schwierigen
Lebenslagen unterstützen. „Ein Teil der Kalender
wurde in Moers verkauft – für uns war klar, dass
auch die Erlöse hier vor Ort etwas bewirken
sollen“, erklärt Martin Menkhaus,
Medienbeauftragter des Lions Clubs
Duisburg-Hamborn.
So fiel in diesem
Jahr die Wahl auf den Verein „Klartext für
Kinder“, der mit seinem Team an verschiedenen
Standorten in Moers Kinder aus
einkommensschwachen Familien betreut und
versorgt – darunter mit warmen Mahlzeiten,
Hausaufgabenhilfe und Ausflügen. Besonders
sichtbar wird die Arbeit im sogenannten
„Klartext-Bus“, der regelmäßig in soziale
Brennpunkte fährt und vor Ort kostenloses
Mittagessen für Kinder bereitstellt.
Die
symbolische Übergabe der Spende fand direkt vor
dem bunten Vereinsbus statt. Als Zeichen der
Unterstützung überreichten die Lions zudem einen
Korb mit frischem Obst und Gemüse. „Für viele
unserer Kinder ist das warme Essen, das sie bei
uns bekommen, die einzige vollwertige Mahlzeit
am Tag“, sagte Reiner Sonntag, Vorsitzender des
Vereins. „Diese Spende kommt genau dort an, wo
sie dringend gebraucht wird – bei den Kindern.“
Auch Activity-Beauftrage Christel Tenter
betonte das Engagement des Clubs: „Mit jedem
verkauften Kalender schenken wir ein Stück
Zukunft. Es ist uns wichtig, dass unsere
Unterstützung nicht breit, sondern gezielt wirkt
– und Moers ist für uns ein fester Bestandteil
dieses Engagements.“ Der Verein „Klartext für
Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut e.V.“
informiert über seine Arbeit und Möglichkeiten
zur Unterstützung auf seiner Website:
www.klartext-fuer-kinder.de
Viele soziale
Projekte wurden in den vergangenen Jahren von
den Hamborner Lions unterstützt. Vor allem die
hilfsbedürftigen Menschen im Duisburger Norden
sind ihnen wichtig.

Symbolisch wurde ein großer Obst- und gemüsekorb
für die Kinder übergeben. V.l.: Henry Brückner,
Dagmar Feyen, Martin Menkhaus, Reiner Sonntag,
Christel Tenter (Foto: privat)
„Helfen,
wo andere nicht helfen“, und „Helfen zur
Selbsthilfe“ – unter diesen Leitgedanken stellen
sich die Mitglieder des Lions Club Duisburg
Hamborn in besonderer Weise den sozialen
Problemen im Duisburger Norden. Ein
ehrenamtliches Engagement, in dem mehr als
1.300.000,- EUR gespendet und gesammelt wurden.
Zielgruppen sind Behinderte, Alte und sozial
Benachteiligte – hier speziell die Förderung von
Duisburger Projekten.
Zuwachs im Moerser Streichelzoo: Ziegenkitz
Mogli bereichert die Herde der westafrikanischen
Zwergziegen
Freude im Moerser
Streichelzoo: Die Herde der westafrikanischen
Zwergziegen hat Nachwuchs bekommen. In der
vergangenen Woche erblickte der kleine
Ziegenbock Mogli das Licht der Welt und
begeistert seither das Zoo-Team der ENNI Stadt &
Service Niederrhein (Enni).

Aktuell lebt Mogli gemeinsam mit seiner Mutter
Minnie in einem geschützten Bereich des Geheges,
wo es in aller Ruhe seine ersten Schritte ins
Leben machen kann.
„Schon bald wird das
junge Zicklein stark genug sein, um zur
restlichen Herde zu stoßen“, erklärt Marlene
Karmann, die gemeinsam mit ihrem Team für die
Pflege der Tiere und die Betreuung des
Streichelzoos verantwortlich ist. „Bis dahin
können Zoogäste Mogli bereits aus der Ferne
beobachten.“
Die westafrikanischen
Zwergziegen gehören zu den beliebtesten
Bewohnern des Moerser Streichelzoos. Neben ihnen
sorgen Alpakas, Coburger Fuchsschafe, Hühner und
Kleinvögel für ein naturnahes und
familienfreundliches Tiererlebnis. Der
Streichelzoo ist Teil des Freizeitparks und das
ganze Jahr über frei zugänglich – ein
Ausflugsziel, das ganze Familien begeistert.

Mogli selbst wird seine Kindheit im Streichelzoo
in seiner Herde mit aktuell neun Geißen
verbringen. Mit Beginn der Geschlechtsreife wird
er dann im Jugendalter wie zuvor sein Vater
Meck-Meck die Anlage verlassen. „Wir werden ihn
dann in ein gutes Zuhause überführen, um den
Frieden in unserer dann wieder nur aus
weiblichen Ziegen bestehenden Herde
sicherzustellen“, so Marlene Karmann.
Zum Schutz der Tiere bittet die Pflegerin alle
Besucherinnen und Besucher um Rücksichtnahme:
„Bitte verzichten Sie auf das Füttern der Tiere
und helfen Sie mit, die Anlage sauber und intakt
zu halten. So bleibt der Streichelzoo ein Ort
zum Staunen, Lernen und Erleben – für große und
kleine Gäste gleichermaßen.“
In den
kommenden Jahren wird die Stadt Moers die Anlage
zu einem außerschulischen Lernort umgestalten,
in dem neben der Tierhaltung die Schwerpunkte
auf Bildung und Naturerfahrung liegen werden.
Lern-Treff Moers
Viele Menschen mit Lese- und Schreibproblemen
verbergen ihre Schwierigkeiten. Sie befürchten
bloßgestellt zu werden oder ihren Arbeitsplatz
zu verlieren. Für sie heißt das, nicht
aufzufallen und die Ausbildung, Freundschaften
oder sogar ihre Partnerschaft zu riskieren.
Funktionaler Analphabetismus ist in unserer
Gesellschaft immer noch ein Tabuthema.
Deshalb bieten wir Hilfe an. Ohne Anmeldung.
Ohne Termin. Jede und jeder Erwachsene mit
Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben ist
eingeladen jeden Mittwoch, zwischen 11 und 13
Uhr in das Café Sonnenblick in der Moselstr. 55
in Meerbeck zu kommen.
Bei einer Tasse
Kaffee und einem Stück Kuchen hilft unsere
Grundbildungsexpertin bei allen
Schriftsprachproblemen (z. B. Anträge,
Bewerbungen, Rechnungen usw.), hat ein offenes
Ohr für die Probleme und findet, sofern vom
Ratsuchenden gewünscht, auch einen passenden
Lese- und Schreibkurs. Kursleitung: Hülya Reske
unentgeltlich.
Neue
Artenvielfalt auf alten Sportplätzen - Rundgang
in den "Filder Wiesen" in Moers
In Kooperation mit dem Fachdienst Freiraum-
und Umweltplanung der Stadt Moers Von der
Grafschafter Kampfbahn zur innerstädtischen
Biodiversitätsfläche "Filder Wiesen" Die
Verlagerung der ehemaligen Sportanlagen der
Vereine MTV und GSV zum Solimare brachte die
Chance, den Freizeitpark zu erweitern.
Nach dem Rückbau der Sportplätze wurde die
weitläufige Landschaft der "Filder Wiesen"
gestaltet, die sich naturnah und artenreich
entwickeln soll. In manchen Bereichen wird die
Natur sich selbst überlassen und Pflanzen dürfen
sich selbst ansiedeln.

Bei einem Spaziergang über die Fläche werden
die Vorgeschichte und das Planungskonzept
vorgestellt. Dabei wird erläutert, wie sich die
Tier- und Pflanzenwelt ständig verändert, welche
Besonderheiten zu finden sind und warum ein
naturnaher Park manchmal auch unordentlich
aussehen muss.
Eine Anmeldung ist
erforderlich. Referentin/Referent: Nadja König,
Oliver Makrlik Kurs-Nr.: F10430C Gebühr:
unentgeltlich. Veranstaltungsdatum 04.06.2025 -
16:00 Uhr - 17:30 Uhr .Veranstaltungsort
Dr.-Hermann-Boschheidgen-Straße / An den Filder
Benden, 47441 Moers. Veranstalter
Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort Zentrale
Adresse Wilhelm-Schroeder-Straße 10 47441 Moers
Kristian Bezuidenhout - Ein
Abend mit Musik von Franz Schubert
Wie hat Schuberts Klaviermusik in den Ohren
seiner Zeitgenossen geklungen? Wenn es heute
einen Pianisten gibt, der diese Frage
beantworten könnte, dann ist es vielleicht
Kristian Bezuidenhout.

Foto: Marco Borggreve
Schon früh
entdeckte der Südafrikaner, Jahrgang 1979, seine
Leidenschaft für die Musik vergangener Epochen –
und für die Instrumente, auf denen sie gespielt
wurde. Keine Frage: Schuberts Klaviermusik passt
hervorragend zum modernen Konzertflügel. Doch
wenn Bezuidenhout sie auf einem 200 Jahre alten
Pianoforte spielt, erweckt er damit nicht nur
den Klang, sondern auch den Geist des
romantischen Genies zu neuem Leben.
Bei seinem Festival-Auftritt präsentiert er den
„unbekannten“ Schubert, der von seiner Jugend
bis zum frühen Tod mit 31 Jahren kontinuierlich
große Meisterwerke, aber auch kleine Juwelen
fürs Klavier komponierte. Eines davon ist die
c-Moll-Fantasie des 14-jährigen Konviktschülers
bei den Wiener Sängerknaben, aber auch Werke wie
das betörende Adagio in Des-Dur oder der Marsch
in der „Unvollendeten“-Tonart h-Moll kommen zur
Aufführung.
Neben diesen verborgen
gebliebenen Schubert-Schätzen baut Kristian
Bezuidenhout auch Evergreens wie die bezaubernd
schwermütige Ungarische Melodie in sein Programm
mit ein und stellt sie in Kontrast mit größer
dimensionierten Werken: In diesem Zusammenhang
stehen die Variationen auf ein (deutlich an
Beethoven angelehntes) Thema von Anselm
Hüttenbrenner und die umfangreiche
Es-Dur-Klaviersonate D. 568 aus Schuberts
mittlerer Schaffensphase im Mittelpunkt.
Biografie: Kristian Bezuidenhout ist einer
der herausragendsten und spannendsten
Tasteninstrumentalisten unserer Zeit und
gleichermaßen versiert auf dem Fortepiano,
Cembalo und modernen Klavier. Geboren 1979 in
Südafrika, begann er sein Studium in Australien,
schloss es an der Eastman School of Music ab und
lebt heute in London. Nach einer ersten
pianistischen Ausbildung bei Rebecca Penneys
widmete er sich historischen Tasteninstrumenten
und studierte Cembalo bei Arthur Haas,
Fortepiano bei Malcolm Bilson sowie
Generalbassspiel und Aufführungspraxis bei Paul
O’Dette.
Internationale Anerkennung
erlangte er erstmals im Alter von 21 Jahren, als
er den renommierten ersten Preis sowie den
Publikumspreis des Brügger
Fortepiano-Wettbewerbs gewann. Kristian ist
ein regelmäßiger Gast führender Ensembles der
Alten Musik, darunter das Freiburger
Barockorchester, Les Arts Florissants, das
Orchestra of the Age of Enlightenment, das
Orchestre des Champs-Élysées, das Koninklijk
Concertgebouworkest, das Chicago Symphony
Orchestra und das Gewandhausorchester Leipzig.
Zudem leitete er als spielender Dirigent
unter anderem The English Concert, das Orchestra
of the Eighteenth Century, Tafelmusik, Collegium
Vocale, Juilliard 415, die Kammerakademie
Potsdam sowie den Dunedin Consort (Bach:
Matthäuspassion).
Er musizierte mit
namhaften Künstlern wie John Eliot Gardiner,
Philippe Herreweghe, Bernard Haitink, Daniel
Harding, Frans Brüggen, Trevor Pinnock, Giovanni
Antonini, Jean-Guihen Queyras, Isabelle Faust,
Alina Ibragimova, Rachel Podger, Carolyn
Sampson, Anne Sofie von Otter, Mark Padmore und
Matthias Goerne. Kristians umfangreiche und
preisgekrönte Diskografie bei Harmonia Mundi
umfasst die Gesamteinspielung der Klavierwerke
Mozarts (ausgezeichnet mit dem Diapason d’Or de
l’Année, dem Preis der Deutschen
Schallplattenkritik und dem Caecilia-Preis),
sämtliche Klavierkonzerte Beethovens mit dem
Freiburger Barockorchester, Bachs Violinsonaten
mit Isabelle Faust, Mozarts Violinsonaten mit
Petra Müllejans, Klavierkonzerte von Mendelssohn
und Mozart mit dem Freiburger Barockorchester
(ECHO Klassik) sowie Lieder von Beethoven und
Mozart und Schumanns „Dichterliebe“ mit Mark
Padmore (Edison Award). 2013 wurde er von der
Zeitschrift „Gramophone“ als „Artist of the
Year“ nominiert.
Website
Klavier-Festival Ruhr: https://www.klavierfestival.de/konzerte/kristian-bezuidenhout-2025/
Ticket: https://tickets.klavierfestival.de/selection/event/date?productId=10229237761195
Kosten: 25 - 45 Euro.
Sponsor: Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein
Event details Veranstaltungsdatum 04.06.2025 -
20:00 Uhr - 22:15 Uhr. Veranstaltungsort Stadt
Moers - Moerser Musikschule, Filder Straße 126,
47447 Moers.
Das Kreuz mit dem
Kreuz – Die Geschichte des Wahlrechts
Die Geschichte des
modernen Wahlrechts in Deutschland beginnt mit
der Einführung erster Verfassungen und der
Einrichtung von politischen Vertretungen im
frühen 19. Jahrhundert. Allerdings war der
Kreis der Wahlberechtigten noch sehr
eingeschränkt und die Wahrung des
Wahlgeheimnisses keineswegs selbstverständlich.

Die Durchsetzung der heute üblichen
Wahlformen mit Stimmzettel, Kabine und Urne
musste erst mühsam erkämpft werden. Der Vortrag
beleuchtet den langen Weg zu einem geregelten
Wahlverfahren in Deutschland.
Eine
Anmeldung ist erforderlich. Referent: Thomas Ohl
Kurs-Nr.: F10107 Gebühr: 7 Euro.
Veranstaltungsdatum 05.06.2025 - 19:00
Uhr - 20:30 Uhr. Veranstaltungsort
Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort,
Wilhelm-Schroeder-Straße 10 47441 Moers
Kinoabend Moers: Fröhliche Zukunft -
Wünsche, Wunder und Visionen
Filmplakat
Fröhliche Zukunft!, TackerFilm Nichts ist
komischer als die Zukunftsvisionen von gestern!
In „Fröhliche Zukunft!“ zeigt das Team des
Kultfilms “Rendezvous unterm Nierentisch”
Zukunftsvisionen aus alten Wochenschauen,
Werbefilmen und Klassikern der 30er bis 60er
Jahre.

Filmplakat Fröhliche Zukunft!, TackerFilm
Euphorie der Technik-Wunder: Hausroboter,
Flugautos und Postraketen sollten unseren Alltag
revolutionieren. 1939 verblüffte „Elektro“, der
erste Maschinenmensch, das Publikum – er konnte
sogar rauchen! Die Deutschen landeten (zumindest
filmisch) als Erste auf dem Mars, und das Atom
galt als unser bester Freund.
Als
sprachloser Filmkritiker staunte Hanns Dieter
Hüsch - begleitet von Götz Alsmann an der
Kinoorgel. Eine irrwitzige Zeitreise ins Morgen
von gestern mit Hanns Dieter Hüsch! Eintritt
frei Reservierung: unter Telefon: 0 28 41 / 201
- 6 82 00 (Grafschafter Museum)
moers festival 2025
Das jeweils an
Pfingsten stattfindende moers festival stand und
steht für Risikobereitschaft und den Mut zu
Neuem und ist damit Garant für musikalische
Entdeckungen jenseits des Mainstream.
Abenteuerlust und Grenzüberschreitung sind die
Ziele des Festivals, und dass dabei die
musikalischen Ränder weit auseinander liegen ist
erklärte Absicht.
Zur
Homepage moers festival

Beim Moerser Urknall entstanden einst
endlose niederrheinische Assoziationsketten und
natürlich die freie Improvisation. Wenn man
Hüschs Texte laut liest oder Free Jazz hört,
dann merkt man das, einwandfrei. Ganz im Geiste
avantgardistischer Tradition feierte das moers
festival bereits 2024 Hüschs 99. Geburtstag mit
zahlreichen Bezügen zum Werk des vielleicht
größten Sohnes der Stadt.

© Moers Kultur GmbH „… denn einzig Musik hält
mit der Trauer Schritt.“
Seine
links-niederrheinischen Weisheitchen zogen sich
durch das Festival – auf Bühnen, Texttafeln und
im Programmheft. Auch in diesem Jahr gibt es
wieder vertonte Lieder und Texte von HDH zu
hören und zu entdecken: Dabei bekommt die
Zeitlosigkeit seiner Texte, durch Kinder,
Freydenkerinnen oder altgediente Klangfriede
über das ganze moers festival geflüstert,
entwaffnende Schlagkraft.
„Eine gute
Zukunft für alle, die jetzt damit beginnen!“
(Hanns Dieter Hüsch)
Tickets: Nach dem Motto
„Zahl, was du willst“ – 40, 80, 120, 160 oder
300 Euro. Vorverkauf: bei allen bekannten
Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsdatum
06.06.2025 - 00:00 Uhr - 09.06.2025 - 00:00 Uhr.
Veranstaltungsort ENNI Eventhalle, Filder Straße
142, 47447 Moers.
Asciburgium – Auf den Spuren der Römischen
Kultur
Ab 12 vor Christus
errichteten römische Legionen das Kastell
„Asciburgium“ am niedergermanischen Limesweg im
heutigen Moers-Asberg. Gemeinsam erkunden wir
die Ortsbegebenheiten des römischen Kastells,
des römischen Dorfes, der römischen Friedhöfe,
des römischen Hafens und das private römische
Museum.
Bei römischem Brot und Mulsum
lernen wir Wissenswertes über das römische
Leben. Geführt von Anne-Rose Fusenig Preis: 8
Euro
Weitere Infos zu den Stadtführungen.
Veranstaltungsdatum 07.06.2025 - 16:00
Uhr - 18:00 Uhr. Veranstaltungsort Römerbrunnen,
Römerstraße in Asberg. Veranstalter Stadt- und
Touristinformation Moers.
Grüne
Oase im Herzen von Moers
Beim
amüsanten Rundgang mit „Lena Nepix“ durch den
Schlosspark erzählt sie von wundersamen
Besuchsregeln und wundervollen Ereignissen wie
Kahnfahrten, Tennisspielen, Wäsche bleichen oder
Laternenfesten. Sie muss es ja wissen, denn sie
lebte am Rande des Parks. Geführt von Anne-Rose
Fusenig Preis: 8 Euro
Weitere Infos zu den Stadtführungen. Event
details Veranstaltungsdatum 08.06.2025 - 10:30
Uhr - 12:30 Uhr Veranstaltungsort Eingang
Schloss
Vorschläge für den
Heimat-Preis 2025 der Stadt Kleve -
Einreichungsfrist endet am 30. Juni 2025
Die Stadt Kleve erinnert daran,
dass noch bis zum 30. Juni 2025
Bewerbervorschläge für den diesjährigen
Heimat-Preis eingereicht werden können. Mit dem
Preis würdigt die Stadt besonderes Engagement
von Bürgerinnen und Bürgern, Initiativen,
Vereinen oder Organisationen, die sich in
herausragender Weise für das lokale Gemeinwohl
und das Heimatgefühl in Kleve einsetzen.

Die Auszeichnung erfolgt im Rahmen des
Förderprogramms „Heimat. Zukunft.
Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen
verbindet.“ des Ministeriums für Heimat,
Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes
Nordrhein-Westfalen. Wen können Sie vorschlagen?
Gesucht werden Personen oder Gruppen,
die durch ihr ehrenamtliches Engagement dazu
beitragen, das kulturelle Erbe zu bewahren, das
Miteinander zu stärken oder neue Impulse für das
Leben in Kleve zu setzen.
Wie reichen
Sie einen Vorschlag ein? Vorschläge können
mittels eines Formulars und einer Begründung bei
der Stadt Kleve eingereicht werden. Das Formular
und weitere Informationen zu den Kriterien und
dem Verfahren finden Sie auf der städtischen
Website unter https://www.kleve.de/heimat-preis#.
Nutzen Sie die Gelegenheit, engagierte
Mitmenschen ins Rampenlicht zu rücken und deren
Einsatz für unsere Heimatstadt zu würdigen!
Kleve: Pfingstmontag mit "De
Fraps" und Suche nach Ersatz für kommendes
Forstgartenkonzert
Am Pfingstmontag,
9. Juni 2025, lädt die Stadt Kleve zum
kostenfreien Forstgartenkonzert mit der
niederländischen Blaskapelle „De Fraps“ ein. Das
Blasorchester „De Fraps“ spielt seit mehr als 55
Jahren böhmische und märkische Blasmusik auf
hohem Niveau. Die Kapelle zählt zu den
bekanntesten Blaskapellen der Niederlande und
überzeugt mit einer bunten Mischung aus
traditioneller Blasmusik, modernen Arrangements
sowie beliebten niederländischen Evergreens. „De
Fraps“ stehen für musikalische Vielfalt und
Spielfreude.
Gleichzeitig gibt es eine
wichtige Änderung für den darauffolgenden
Sonntag. Das Senioren Orkest Nijmegen hat seinen
Auftritt am 15. Juni kurzfristig abgesagt. Die
Stadt Kleve bedauert diese Absage sehr und hofft
den Konzerttermin mit einer anderen
musikalischen Formation neu besetzen zu können.
Interessierte Ensembles oder Bands, die den
Termin am 15. Juni übernehmen möchten, sind
herzlich eingeladen, sich über die
E-Mail-Adresse kultur@kleve.de bei der
Stadtverwaltung zu melden.

Die Forstgartenkonzerte sind ein fester
Bestandteil des kulturellen Lebens in Kleve und
bieten Musikliebhabenden aller Generationen die
Möglichkeit, an entspannten Sonntagnachmittagen
hochwertige Live-Musik inmitten der grünen Natur
zu genießen. Mit über 500 Sitzplätzen und der
Möglichkeit, Picknicks mitzubringen, sind die
Open-Air-Konzerte vor allem bei schönem Wetter
ein Erlebnis für die ganze Familie.
Weitere Informationen und das vollständige
Programm sind auf der Website der Stadt Kleve
unter www.kleve.de/forstgartenkonzerte zu
finden.

Rund 84.000 mehr Zuzüge als Fortzüge nach
NRW im Jahr 2024
* Nettozuwanderung nach NRW sinkt um fast ein
Drittel
* Höchste Nettozuwanderung aus der
Ukraine
* 339 Gemeinden mit
Wanderungsgewinnen
Im Jahr 2024 sind
83.872 Personen mehr nach Nordrhein-Westfalen
zugezogen als von dort fortgezogen sind. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, ist die
Nettozuwanderung damit das zweite Jahr in Folge
gesunken. Der Wanderungsgewinn fällt gegenüber
2023 mit +122.376 um fast ein Drittel niedriger
aus, jedoch liegt die Nettozuwanderung weiterhin
auf hohem Niveau. Seit der Jahrtausendwende
bedeutet dies die fünfthöchste Nettozuwanderung.

Wanderungsgewinne aufgrund von Zuzügen aus
dem Ausland Die Wanderungsgewinne im Jahr 2024
waren – wie in den Jahren zuvor – ausschließlich
auf eine positive Wanderungsbilanz zwischen
Nordrhein-Westfalen und dem Ausland
zurückzuführen. Im Jahr 2024 sind 88.846 mehr
Personen aus dem Ausland nach
Nordrhein-Westfalen zugezogen als aus
Nordrhein-Westfalen über die Grenzen
Deutschlands fortgezogen sind.

Der Wanderungsüberschuss fiel damit um
29,9 % niedriger aus als im Jahr 2023 mit damals
+126.812. Höchste Nettozuwanderung aus der
Ukraine Auf Platz eins der Top-Herkunftsländer
steht 2024 die Ukraine mit einer
Nettozuwanderung von +32.772 Personen. Gegenüber
2023 mit +23.179 ist die Nettozuwanderung aus
der Ukraine damit wieder angestiegen.
Auf dem zweiten Platz folgt die Nettozuwanderung
aus Syrien mit +19.967 und auf dem dritten Platz
die Türkei (+8.879). Auf den Plätzen vier und
fünf folgen Indien (+6.060) und Afghanistan
(+5.181).
Negative Wanderungsbilanz
zwischen NRW und den anderen Bundesländern
Die Wanderungsbilanz zwischen NRW und den
anderen Bundesländern war im Jahr 2024 wie in
den meisten Vorjahren negativ. Der Überschuss
der Fortzüge über die Zuzüge lag mit 4.974
Personen geringfügig höher als im Vorjahr 2023
mit 4.436. Aus sieben Bundesländern – Bremen,
Hessen, Saarland, Brandenburg, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen – konnte NRW im
Jahr 2024 mehr Zu- als Fortzüge verbuchen.
Mit Blick auf die übrigen acht Bundesländer
waren Wanderungsverluste zu verzeichnen. 339
Gemeinden mit Wanderungsgewinnen im Jahr 2024
Regional betrachtet, wiesen im Jahr 2024
insgesamt 339 der 396 nordrhein-westfälischen
Städte und Gemeinden Wanderungsgewinne auf,
weitere zwei Gemeinden hatten einen exakt
ausgeglichenen Wanderungssaldo. Für 55 Städte
und Gemeinden hat das Statistische Landesamt
Wanderungsverluste errechnet.
NRW: Produktion von Fahr- und Krafträdern mit
Elektromotor 2024 um mehr als ein Drittel
gesunken
* Produktionsmenge von Fahr- und Krafträdern
ohne Motor hingegen um 38,4 % gestiegen
*
Importmenge von Fahr- und Krafträdern mit
Elektromotor um 24,1 % gesunken.
* Rein
rechnerisch kommen auf ein importiertes Fahrrad
mit Elektromotor zwei Fahrräder ohne Motor
Im Jahr 2024 sind 50.946 Fahr- und
Krafträder mit Elektromotor in Betrieben des
nordrhein-westfälischen Verarbeitenden Gewerbe
produziert worden. Wie das Statistische
Landesamt anlässlich des Europäischen Tag des
Fahrrades am 03. Juni 2025 mitteilt, wurden im
letzten Jahr 34,1 % weniger Fahr- und Krafträder
mit Elektromotor produziert als 2023.
Die Zahl der produzierten Fahrräder mit Motor
war jedoch um 30,9 % größer als noch 2019. Der
Anteil von Zweirädern u. a. Fahrrädern ohne
Motor lag 2024 mit 42.907 Stück bei 45,7 %. Hier
stieg die produzierte Menge um 38,4 % zum
Vorjahr und um 9,2 % zum Jahr 2019.
Betriebe des Regierungsbezirks Münster mit
höchstem NRW-Anteil
71,8 % der 2024 in NRW
produzierten Fahr- und Krafträder mit und ohne
Elektromotor wurden in Betrieben des
Regierungsbezirks Münster produziert. Der Anteil
der nordrhein-westfälischen Betriebe an der
gesamtdeutschen Produktionsmenge betrug 4,4 %.

Importmenge von Fahrrädern mit und ohne
Motor ist rückläufig
Die Importmenge von
Fahrrädern mit und ohne Motor ist nach
vorläufigen Ergebnissen erneut zurückgegangen.
Rund 334.000 Fahrräder mit Elektromotor sind im
Jahr 2024 nach NRW importiert worden; das waren
24 % weniger als im Vorjahr. Wie in den
Vorjahren stammte etwa jedes dritte
Elektro-Fahrrad aus Vietnam.

Die Zahl der importierten Fahrräder ohne
Motor lag im vergangenen Jahr mit 621.000
Fahrrädern um 31 % unter dem Vorjahr.
Hauptlieferland war auch im Jahr 2024 Österreich
mit einem Anteil von 27,3 %. Im Jahr 2019 hatten
23 % der importierten Fahrräder einen
Elektromotor, im Jahr 2024 stieg deren Anteil
auf 34 %.
Dienstag, 3. Juni 2025
- Bundesweiter Aktionstag gegen den Schmerz
Gesetz zur Änderung des Schülerinnen- und
Schülerdatenübermittlungsgesetzes NRW
Zukunftsbranchen im Fokus: DBI sichert Fördervolumen von 9,9
Millionen Euro für die Region Niederrhein
Kooperation mit Hochschulen stärkt den
Wissens- und Technologietransfer
Fokus auf
Künstliche Intelligenz, Kreislaufwirtschaft und
Fachkräftequalifizierung
Die Duisburg
Business & Innovation GmbH (DBI) hat gemeinsam
mit Akteur:innen aus der Region beim
Förderaufruf „Regio.NRW“ des Landes
Nordrhein-Westfalen den Zuschlag für die
Projekte „KI für KMU“ und „Circular NiederRhein“
erhalten.
„Wir wollen durch innovative
Projekte den regionalen Wissens- und
Technologietransfer effektiv unterstützen“,
erklärt DBI-Geschäftsführer Rasmus C. Beck. Auch
Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link, zugleich
Aufsichtsratsvorsitzender der DBI, zeigt sich
erfreut: „Wir brauchen diese Zukunftsbranchen,
um uns wirtschaftlich breiter und krisenfester
aufzustellen.“

Im Projekt „KI für KMU“ (Volumen: 1,9 Mio. Euro)
erfahren kleine und mittlere Unternehmen
praxisnah, wie sie durch den Einsatz Künstlicher
Intelligenz effizienter und erfolgreicher werden
können. Beteiligte Partner:innen sind die
Universität Duisburg-Essen, die Hochschule
Rhein-Waal, die Hochschule Arnheim und Nijmegen,
die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, der Kreis
Wesel sowie die DBI.
Das Projekt
„Circular NiederRhein“ (Volumen: 2,1 Mio. Euro)
bringt Expert:innen aus Deutschland und den
Niederlanden zusammen, um Kreislaufwirtschaft zu
stärken. Beteiligte Partner:innen sind die
Universität Duisburg-Essen, die Hochschule
Rhein-Waal, das Unternehmen Regenalyze sowie
erneut die DBI, die Wirtschaftsförderung Kreis
Kleve und der Kreis Wesel.
Bereits im
Jahresverlauf sicherte sich die DBI
Förderzusagen für zwei weitere EU-Projekte:
- „DU.Zirkulär“ (4,4 Mio. Euro): In
Duisburg-Ruhrort entstehen modellhafte Konzepte
für zirkuläres Wirtschaften.
-
„Zukunftskompetenzen“ (1,5 Mio. Euro): Mit sechs
europäischen Städten werden Qualifikationen für
moderne Arbeitswelten weiterentwickelt. Allein
in diesem Jahr beläuft sich das von der DBI
federführend eingeworbene Fördervolumen damit
auf 9,9 Millionen Euro – ein bedeutender Impuls
für die wirtschaftliche Entwicklung in Duisburg
und am Niederrhein. Weitere Informationen:
www.duisburg-business.de
Land legt Infrastrukturpaket für 2025
vor – Rund 600 Millionen Euro für Sanierung und
Ausbau von Straßen und Radwegen
Mit
vier Programmen und Investitionen von insgesamt
rund 600 Millionen Euro treibt das Land
Nordrhein-Westfalen auch 2025 die Sanierung und
den Ausbau seiner Verkehrsinfrastruktur voran.
Erstmals legt das Verkehrsministerium seine
größten und wichtigsten Programme gemeinsam vor.
Dabei bewegen sich die Ausgaben für das
Landesstraßenerhaltungsprogramm, das
Radwegeprogramm, das Nahmobilitätsprogramm und
das Programm zur Förderung der kommunalen
Infrastruktur auf dem hohen Niveau des
Vorjahres.
„In einem Land wie
Nordrhein-Westfalen entscheidet sich, wie eine
ganze Republik ihre in die Jahre gekommene
Infrastruktur in den Griff bekommt. Als
Drehkreuz tragen wir eine besondere
Verantwortung und haben frühzeitig die Weichen
auf Sanierung und Rekord-Investitionen
gestellt“, sagt Verkehrsminister Oliver
Krischer.
2025 sind allein für Maßnahmen
zum Erhalt von Landesstraßen 231 Millionen Euro
vorgesehen, in den Erhalt von Bundesstraßen
sollen 154 Millionen Euro fließen. Hinzu kommen
rund 39,5 Millionen Euro für den Bau und die
Sanierung von Radwegen an Landesstraßen.
103 neue Maßnahmen im
Landesstraßenerhaltungsprogramm
Das
Landesstraßenerhaltungsprogramm 2025 sieht
insgesamt 103 Einzelmaßnahmen vor. 95,82
Millionen Euro fließen in laufende und
neubegonnene Einzelprojekte an Fahrbahnen und
Brücken, 41,38 Millionen Euro in 23 Projekte des
Brückenersatzneubauprogramms jeweils inklusive
der Restabwicklungen von bereits
fertiggestellten Maßnahmen.
85 Millionen
Euro werden als sogenannte Bauamtspauschale
eingeplant, mit der flexibel und schnell auf
kleinere und unvorhergesehene Schäden reagiert
werden kann. Rund 8,8 Millionen Euro sind für
Maßnahmen des Sonderprogramms Südwestfalen
eingeplant. Mit diesem Geld sollen die Schäden
an Landesstraßen saniert werden, die durch die
Ausweichverkehre der gesperrten A 45 bei
Lüdenscheid entstanden sind.
Für den
Erhalt von Bundesstraßen hat der Bund für das
Jahr 2025 unter Vorbehalt des noch zu
verabschiedenden Bundeshaushalts 154 Millionen
Euro zur Verfügung gestellt.
Rund 40
Millionen Euro für das Radwegeprogramm
Immer wichtiger wird der Radverkehr für die
Menschen. „Umso wichtiger ist der Ausbau des
Radwegenetzes als zentrale Säule für die
Mobilitätswende“, sagt Minister Oliver Krischer.
Diese Entwicklung unterstützt das Land mit dem
diesjährigen Radwegeprogramm. Insgesamt werden
dafür rund 39,5 Millionen Euro investiert: unter
anderem rund 18,2 Millionen Euro für den Erhalt
von Radwegen an Landesstraßen, rund 7,2
Millionen Euro für den Radwegebau an
Landesstraßen, rund 6,2 Millionen Euro für das
Modellprojekt „Bürgerradwege“ und rund 7,3
Millionen Euro für die Mitfinanzierung von
Radwegen aus Maßnahmen anderer Programme.
Unterstützung für die Modernisierung der
Nahmobilität
Finanziell unterstützt werden
auch die Kommunen auf ihrem Weg, die
Nahmobilität und den nichtmotorisierten
Individualverkehr in ihren Städten und Gemeinden
zu modernisieren. Das Nahmobilitätsprogramm 2025
weist 129 Maßnahmen aus, die mit rund 38,2
Millionen Euro gefördert werden, dazu zählen
Fußverkehrsanlagen, Radverkehrsanlagen oder
Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum.
Daneben werden für 17 Maßnahmen im
Rheinischen Revier rund 12,2 Millionen Euro aus
den Strukturfördermitteln nach Kapitel 1 des
Investitionsgesetzes Kohleregionen reserviert.
In erster Linie werden Machbarkeitsstudien,
Planung und Umsetzung der übergeordneten
Vorhaben gefördert, aber auch ergänzende
Infrastruktur wie Radabstellanlagen oder
Zählstellen.
Erstmals wird die
Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und
fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise
in Nordrhein-Westfalen (AGFS NRW) als
Institution gefördert. Die AGFS NRW arbeitet eng
mit dem Verkehrsministerium zusammen und ist
eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der
Nahmobilität.
141,5 Millionen Euro für
kommunale Projekte
Unverändert hoch ist auch
der Bedarf an nachhaltiger Straßensanierung in
den Kommunen. Das Land Nordrhein-Westfalen
beteiligt sich in 2025 mit insgesamt rund 141,5
Millionen Euro an der Finanzierung von insgesamt
98 Projekten Kreise, Städte und Gemeinden. 42,6
Millionen Euro fließen in grundhafte,
nachhaltige Straßensanierungen von 45
verkehrswichtigen Straßenabschnitten.
Rund 77 Millionen Euro sind für die Förderung
des Aus- und Umbaus von Abschnitten
verkehrswichtiger Straßen eingeplant. Hier
profitieren vor allem auch Radfahrerinnen und
Radfahrer. Denn auch in den Planungen der
kommunalen Straßenbaulastträger nehmen ihre
Belange eine immer zentralere Rolle ein. Beim
Umbau von Straßenkreuzungen rückt die
Verbesserung der Verkehrssicherheit für den
Radverkehr immer stärker in den kommunalen
Fokus, was sich auch in dem Programm zur
Förderung der kommunalen Straßeninfrastruktur
abbildet.
Moers:
Geänderte Öffnungszeiten an Pfingsten
Am kommenden Pfingstsonntag und Pfingstmontag
(8. und 9. Juni) sind das Grafschafter Museum im
Moerser Schloss und das Alte Landratsamt von 11
bis 18 Uhr für seine Besucherinnen und Besucher
geöffnet.
Die Stadtverwaltung bleibt an
diesen Tagen geschlossen. Dies betrifft
ebenfalls die Bibliothek und ihre Zweigstellen,
die vhs, die Moerser Musikschule und die
Sozialraumteams des Jugendamtes in den einzelnen
Stadtteilen.
Kanalanschluss für
neues Wohnhaus: Trakehnenstraße in Moers-Utfort
wird einige Tage zur Sackgasse
Die ENNI Stadt & Service Niederrhein (Enni) wird
in der Trakehnenstraße in Moers-Utfort ab
Mittwoch, 4. Juni 2025, das neue Wohnhaus Nummer
13 g an den öffentlichen Schmutzwasserkanal
anschließen. Da Enni dabei in rund fünf Metern
Tiefe und auch in der Fahrbahnmitte arbeiten
muss, wird die Straße in Höhe der Baustelle für
Autofahrer einige Tage zur Sackgasse.
Anlieger können die Häuser der Trakehnenstraße
auch während der Bauarbeiten jederzeit
erreichen. Allerdings müssen Sie das Baufeld
wegen der gleichzeitig in der Masurenstraße
stattfindenden Arbeiten zum Bau einer neuen
Pumpstation für das Regenwasser in beiden
Fahrtrichtungen über die Liebrechtstraße, die
Straße Am Utforter Graben und ein Teilstück der
Buschstraße umfahren.
Für den
Durchgangsverkehr ist Straße während der
Bauphase gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer
bleibt die Baustelle durchweg passierbar. Enni
will die mit dem zuständigen Fachbereich Straßen
und Verkehr der Stadt Moers sowie der Polizei
und Feuerwehr abgestimmte Baumaßnahme spätestens
am 13. Juni abschließen. Wer Fragen hierzu hat,
kann sich unter der Rufnummer 104600
informieren.
Notdienst an den Feiertagen: ENNI auch an
Pfingsten jederzeit erreichbar
Die Enni-Unternehmensgruppe (Enni) ist auch an
den Pfingsttagen vom 7. bis zum 9. Juni im
Einsatz. Für besondere Notfälle in der Energie-
und Wasserversorgung sowie der öffentlichen
Kanalisation oder auf den Moerser Straßen können
Kunden einen Bereitschaftsdienst rund um die Uhr
unter der Moerser Rufnummer 02841/104-114
erreichen.
Die Kundenzentren bleiben an
allen Pfingstfeiertagen und ausnahmsweise auch
am Pfingstsamstag geschlossen. Telefonisch sind
Berater an diesem Tag aber von 10 bis 13 Uhr
erreichbar.
Abfallfreies
Pfingstfest: Moerser sollten geänderte
Abfuhrtermine beachten
Durch das Pfingstwochenende verschieben sich
auch in diesem Jahr in einigen Bezirken des
Moerser Stadtgebiets wieder die Abfuhrtermine
für Restabfall, Altpapier, die gelben Säcke und
Bioabfälle. „Da die Abfuhr durch den Feiertag am
Pfingstmontag, 9. Juni, ausfällt, fahren die
Entsorgungsfahrzeuge die Bezirke dieser Woche
jeweils einen Tag später als üblich an“, sollten
Moerser laut Ulrich Kempken, dem bei Enni für
die Entsorgung zuständigen Abteilungsleiter,
darauf achten, dass Tonnen nicht voll an Straßen
stehenbleiben.
Die Abfuhren vom
Pfingstmontag werden die Müllwerker am Dienstag,
10. Juni, nachholen, bis freitags verschieben
sich die Abfuhren in dieser Woche entsprechend
ebenfalls nach hinten. „Die Freitagsleerungen
holen wir am Samstag, 14. Juni, nach“. Um sicher
zu gehen, empfiehlt Kempken allen Moerser
Bürgern gerade vor Feiertagen stets in den
Abfallkalender zu blicken, in dem alle
Veränderungen abgedruckt sind.
Der
Kreislaufwirtschaftshof ist am Samstag vor den
Pfingsttagen regulär von 8 bis 14 Uhr geöffnet.
Online vergibt Enni seit rund einem Jahr
zusätzlich individuelle Termine von 6 Uhr bis 8
Uhr und nachmittags von 14 bis 16 Uhr. „An den
übrigen Werktagen können Moerser den aktuell
reichlich anfallenden Baum-, Grün- und
Rasenschnitt ohne Termin von 8 bis 16 Uhr
abgeben“, so Kempken.
„Auch hier können
Moerser zusätzliche Termine von 6 Uhr bis 8 Uhr
und nachmittags von 16 Uhr bis 19 Uhr im Vorfeld
unter
www.enni.de/kwh-termin online buchen.“
Kempken rät Kunden zu diesem Service. „Das spart
Zeit und gibt Kunden bereits auf dem Weg zur
Arbeit oder abends die Chance, Sperrgut,
Grünabfalle und vieles mehr entspannt zu
entsorgen. Dabei spürt der Entsorgungsexperten,
dass Moerser das Angebot mittlerweile vermehrt
nutzen.
„Nach üblichen
Anlaufschwierigkeiten gab es zuletzt monatlich
bereits über 400 Reservierungen“, sieht Kempken
hier eine gute Entwicklung.
Alle
Informationen zur rund um die Abfuhrverschiebung
gibt es im Abfallkalender der Enni. Für
Smartphone-Nutzer bietet Enni mit einer App
einen zusätzlichen Erinnerungsservice.
Stadtteiltreff Neu_Meebeck: Ohne Gift
gärtnern
‚Im Garten geht’s auch
ohne Gift‘: Das naturnahe Gärtnern ist am
Mittwoch, 14. Mai, von 16.30 bis 18 Uhr Thema
beim Stadtteiltreff Neu_Meebeck im Stadtteilbüro
(Bismarckstraße 43b). Nach einem informativen
Vortrag von Maria Madani (u. a. vhs-Biogarten)
tauschen sich die Gäste mit der Expertin darüber
aus.
Im Mittelpunkt steht der bewusste
Umgang mit Boden, Pflanzen und tierischen
Gartenbewohnern – ganz ohne chemische Keule: Wie
kann ich meinen Boden pflegen, um die
Humusschicht zu fördern? Welche Tiere sind
nützlich und wie erkenne ich sie? Was tun, wenn
Blattläuse, Schnecken oder andere ‚Plagegeister‘
auftauchen?
Die Teilnehmenden erhalten
praktische Tipps zur Vorbeugung, lernen einfache
Tricks für den naturnahen Pflanzenschutz kennen
und erfahren, was man besser bleiben lässt –
alles aus der Praxis für die Praxis.
Anmeldungen und Rückfragen im Stadtteilbüro
Neu_Meerbeck, Telefon 0 28 41 / 201-530, Mail stadtteilbuero.meerbeck@moers.de
Vorschulkinder kürten Lieblingsbuch
in der Bibliothek Moers
277 Vorschulkinder aus 20 Kitas haben in
diesem Frühjahr an der Bilderbuchjury 2025 der
Bibliothek Moers teilgenommen.
Bibliothekspädagogin Ina Wilmsmann stellte bei
insgesamt 21 Veranstaltungen zwischen dem 10.
März und dem 8. Mai Vorschulkindern aus Moers
vier aktuelle Bilderbücher vor.

(Foto: Bibliothek)
Anschließend stimmten
die Kinder eigenständig über ihren Favoriten
ab. Am häufigsten konnte ‚Die Dino-Detektive:
Das Rätsel um den Popo-Biss‘ von Johanna
Lindemann überzeugen. Das humorvolle Buch gewann
in 13 Gruppen und erhielt insgesamt 218 Stimmen.
Auf Platz zwei landete ‚Das Gute-Nacht-Hotel‘
von Esther van den Berg mit 167 Stimmen.
Die Bilderbuchjury ist nicht nur ein
Leseförderangebot, sondern gibt Kindern die
Gelegenheit, früh eigene Meinungen zu entwickeln
und selbstständig Entscheidungen zu treffen.
Integrationsratswahl: Kandidaten
können ab 6. Juni Unterlagen einreichen
Ehrenamtliches Engagement gefragt: Die
Integrationsratswahl findet am Sonntag, 14.
September, statt. Kandidieren und sich zur Wahl
stellen dürfen alle Personen, die zur
Integrationsratswahl berechtigt sind.

Foto: Gerd Altmann/Pixabay
Ebenfalls
dürfen sich alle Bürgerinnen und Bürger der
Stadt, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
sich seit mindestens einem Jahr rechtmäßig im
Bundesgebiet aufhalten und seit mindestens drei
Monaten ihren Hauptwohnsitz in Moers haben, zur
Wahl aufstellen lassen.
Wichtig: Die
Unterlagen für die Kandidatur können nur vom 6.
Juni bis 7. Juli bei der Fachgruppe Wahlen
abgegeben werden. Gutes Miteinander in der Stadt
schaffen Der Integrationsrat ist ein
demokratisch gewähltes Gremium und Teil der
Stadtpolitik. Er setzt sich aus Ratsmitgliedern
sowie direkt gewählten Mitgliedern der Menschen
mit internationaler Familiengeschichte zusammen.
Themen sind dabei unter anderem
politische Mitsprache von Menschen mit
internationaler Familiengeschichte, Maßnahmen
gegen Rassismus, Integration von neu
Eingewanderten und Chancengerechtigkeit. Damit
vertritt der Integrationsrat durch seine
gewählten Mitglieder diese Anliegen und
Interessen.
Ziel ist es insgesamt, ein
gutes Miteinander in der Stadt zu schaffen
Informationen über die Arbeit des
Integrationsrates sind bei der Geschäftsführung
des Integrationsrates erhältlich: Diana Schmitz,
Telefon 0 28 41 / 201-226, E-Mail: diana.schmitz@moers.de.
Weitere Informationen zu den Formalitäten der
Kandidatur gibt es bei der Fachgruppe Wahlen,
Telefon 0 24 81 / 201-948 oder E-Mail an wahlen@moers.de.
Kreative Kisten zurück im Freizeitpark:
Seifenkistenrennen am 14. September
In diesem Jahr ist das Seifenkistenrennen zurück
im Freizeitpark – aber mit neuer Strecke. 2018
fand das Rennen noch auf einem anderen Abschnitt
statt.

Foto: Vidreho
Wenn rasante Fahrzeuge,
fantasievoll verkleidete Fahrerinnen und Fahrer
oder kreative ‚Kisten‘ von der Rampe rollen, ist
klar: Das Moerser Seifenkistenrennen ist zurück.
Am Sonntag, 14. September, geht der beliebte
Renn- und Kreativwettbewerb in die 9. Runde –
und das endlich wieder im Freizeitpark Moers, wo
das Rennen einst begann.
„Wir sind sehr
glücklich, dass wir zurück an unseren Stammplatz
im Freizeitpark können“, sagt Mark
Bochnig-Mathieu vom Kinder- und Jugendbüro der
Stadt Moers. „Und das auf einer ganz neuen
Strecke, denn der Umbau mit der neuen Plaza ist
bis dahin abgeschlossen.“
Die neue
Rennstrecke verläuft entlang des Skateparks in
Richtung Spielplatz und führt dann an der Plaza
vorbei direkt über das modernisierte Areal –
also alter Standort, neue Strecke. Das Gelände
bietet mehr Platz für Zuschauerinnen und
Zuschauer sowie die Teams, dazu eine bessere
Infrastruktur und viele Spiel- und
Aufenthaltsmöglichkeiten für Familien.
Guter Zeitpunkt zum Bauen
Auch 2025 gilt: Mitmachen kann jede/r, der eine
eigene Kiste baut oder organisiert – z. B.
Schulen, Vereine, Firmen, Privatpersonen. Und
gut drei Monate vor dem Rennen ist der ideale
Zeitpunkt, sich an die Arbeit zu machen.
Auf dem Programm stehen zwei Wettbewerbe:
Der Moerser-Speed-Cup für die schnellsten Kisten
(7 bis 18 Jahre) und der Sparkassen-Fun-Cup (7
bis 90 Jahre) für kreative Teamideen, Designs
und Verkleidungen. Wer bei ‚Fun‘ punkten will,
sollte auf originelle Gestaltung setzen: Ein
gutes Motto, auffällige Farben und passende
Outfits kommen bei der Jury gut an.
Im
Speed-Bereich zählt die Technik: Gute Reifen,
stabile Lager und das richtige Gewicht
entscheiden über die Zeit. Gestartet wird wieder
von einer rund 2,50 Meter hohen Rampe. Die
Sparkasse am Niederrhein unterstützt das Rennen
erneut mit Sach- und Geldpreisen.
Alle Infos zum Seifenkistenrennen,
Bauvorschriften und Anmeldung. Fragen an: seifenkistenrennen@moers.de
Stadtführungen in Moers am 1.
Juni-Wochenende
Die Spuren der
römischen Kultur verfolgt die Führung mit dem
Fahrrad Samstag, 7. Juni, um 16 Uhr. Treffpunkt
ist vor dem Römerbrunnen Ecke
Römerstraße/Konstantinstraße. Ab 12 vor Christus
errichteten römische Legionen das Kastell
Asciburgium am niedergermanischen Limesweg im
heutigen Moers-Asberg. Gemeinsam mit
Gästeführerin Anne-Rose Fusenig erkunden die
Teilnehmenden die örtlichen Begebenheiten des
Kastells, des ehemaligen Dorfes, der Friedhöfe,
des früheren Hafens und das private römische
Museum.
Bei römischem Brot und Mulsum
(Wein mit Honig) lernen sie Wissenswertes über
das römische Leben. Die Teilnahme kostet pro
Person 10 Euro.
Grüne Oase im Herzen von
Moers
Durch die grüne Oase im Herzen von
Moers geht es bei der Führung am Sonntag, 8.
Juni, um 10.30 Uhr. Start ist vor dem Moerser
Schloss. Beim dem amüsanten Rundgang erzählt die
historische Figur ‚Lena Nepix‘, dargestellt von
Gästeführerin Anne-Rose Fusenig, von wundersamen
Besuchsregeln und wundervollen Ereignissen wie
Kahnfahrten, Tennisspielen, Wäschebleichen oder
Laternenfesten. Sie muss es ja wissen, denn sie
lebte damals am Rande des Parks.
Die
Teilnahme kostet pro Person 8 Euro. Verbindliche
Anmeldungen zu den Führungen sind in der Stadt-
und Touristinformation von Moers Marketing
möglich: Kirchstraße 27a/b, Telefon 0 28 41 / 88
22 60.
Nachwuchsprogramm „FuturE“ geht in eine
neue Runde
Ab sofort können sich ehrenamtlich engagierte
junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren für
die fünfte Ausgabe von „FuturE“ bewerben. Das
Nachwuchsprogramm der Deutschen Stiftung für
Engagement und Ehrenamt (DSEE) unterstützt junge
Engagierte auf ihrem Weg in ehrenamtliche
Leitungspositionen.
Bei der Freiwilligen
Feuerwehr, in einer Umweltorganisation oder im
Musikverein: Das Engagement junger Menschen ist
vielfältig, die Engagementbereitschaft hoch.
Dennoch haben 53 Prozent der Vereine und
gemeinnützigen Organisationen Probleme bei der
Besetzung von Leitungspositionen.*
Gleichzeitig sehen sie sich mit neuen
Herausforderungen konfrontiert: Der Klimawandel,
gesellschaftliche Veränderungen und die
Digitalisierung erfordern neue Lösungswege, um
weiterhin zielgerichtet und erfolgreich für das
Allgemeinwohl agieren zu können.
Hier setzt
das Programm „FuturE“ an. Das Ziel: Junge
Engagierte zu stärken, sie persönlich
weiterzubringen und fit für ehrenamtliche
Führungsaufgaben in Verein und Engagement zu
machen. „FuturE“ trägt dazu bei, Vielfalt in
Vereinen und gemeinnützigen Organisationen zu
fördern und als Chance zu verstehen.
Insbesondere Personen mit erschwertem Zugang zu
ehrenamtlichen Leitungspositionen sind zur
Bewerbung aufgerufen, darunter FLINTAQ*,
Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit
Behinderung, Nicht-Akademiker:innen sowie
Personen in ländlichen und/oder
strukturschwachen Räumen.
„Zukunftsfähiges Handeln ist auf vielfältige
Perspektiven angewiesen. Die gesellschaftliche
Vielfalt sollte sich entsprechend in
ehrenamtlichen Führungs- und Leitungsfunktionen
widerspiegeln“, so Katarina Peranić, Vorständin
der DSEE. „Mit dem Programm FuturE möchten wir
junge Menschen mit ganz unterschiedlichen
Biografien, Wissen und Hintergründen dazu
ermutigen und befähigen, in ihren Vereinen
gemeinsam mit allen Generationen Verantwortung
zu übernehmen.“
FuturE fördert junges,
diverses Engagement
In einer dreimonatigen
Intensiv-Phase erhalten die Teilnehmenden
digital und in Präsenz Wissen und Weiterbildung
in den Kernthemen Führungskompetenz,
Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation,
agiles Projektmanagement, Organisations- und
Strategieentwicklung. Dazu gehören auch wichtige
Grundlagen im Vereins- und
Gemeinnützigkeitsrecht. Zudem bietet das
Programm die Möglichkeit, junge Engagierte aus
ganz Deutschland miteinander zu vernetzen.
Sahra Rezaie (22) von Amnesty International
Deutschland e. V. war 2024 dabei: „FuturE hat
mir gezeigt, dass Führung nicht Hierarchie,
sondern Haltung ist. Das Programm hat mich
ermutigt, meine Rolle neu zu denken:
solidarisch, wirksam, empowernd. Bewirb dich und
finde heraus, was Führung für dich bedeutet.“
Bewerben kann sich, wer zwischen 18 und 27
Jahren ist und aktuell eine ehrenamtliche
Tätigkeit ausübt. Die Bewerbungsphase ist am 19.
Mai gestartet und geht bis zum 2. Juli 2025. Die
Programminhalte starten im September 2025.
Ausführliche Informationen sowie den Link zum
Bewerbungsformular finden Sie unter:
https://d-s-e-e.de/future-jetzt-bewerben.
*Quelle: ZiviZ-Survey 2023, Hauptbericht S. 34
Über die Deutsche Stiftung für Engagement
und Ehrenamt
Die Deutsche Stiftung für
Engagement und Ehrenamt (DSEE) hat im Juli 2020
ihre Arbeit in Neustrelitz aufgenommen. Mit der
Stiftung gibt es erstmals eine bundesweite
Anlaufstelle zur Förderung ehrenamtlichen
Engagements. Sie berät, qualifiziert, fördert
und vernetzt Engagierte und Ehrenamtliche und
unterstützt insbesondere in ländlichen und
strukturschwachen Räumen.
Lourdesfeier im Kölner Dom
Herzliche Einladung bundesweit an alle
Interessierten zur Lourdesfeier im Kölner Dom am
26. Oktober 2025 und anschließendem Treffen und
geselligem Beisammensein im "Früh" hier kann man
auch schon für den Sonderzug miteinander ins
Gespräch kommen und sich gemeinsam miteinander
Austauschen. Und weitere Infos erhalten

Der Lourdes Verein Köln organisiert jedes Jahr
am letzten Oktoberwochenende die Internationale
Lourdes Feier im Kölner Dom. Diese wunderschöne
Marienfeier mit Rosenkranz, heiliger Messe und
Prozession durch den Kölner Dom ist immer ein
wunderschöner Abschluss der Wallfahrtssaison und
vor allem eine wunderbare Gelegenheit nette
Menschen, die man auf der Lourdes Wallfahrt
kennengelernt hat, wiederzusehen. Und auch neue
Kontakte zu knüpfen. So treffen wir uns nach der
Feier immer im „Früh“ und können uns hier nett
austauschen.
Natürlich geht es hierbei
nicht um eine Benefizveranstaltung aber die
Kontaktpflege und Werbung neuer Wallfahrer steht
hier durchaus auch im Mittelpunkt. Dieses Jahr
findet diese Feier am 26. Oktober statt (13.45
Uhr Rosenkranzgebet / 14.30 Uhr hl. Messe). Alle
Interessierten sind natürlich herzlichst gerne
eingeladen hierfür darf auch gerne kräftig
Werbung gemacht werden!
Auch erwähnen
möchten wir, dass an jedem 2. Freitag im Monat
in St. Maria in der Kupfergasse in Köln um 18.30
Uhr eine Stiftungsmesse für die Lebenden und
Verstorbenen des DLV gefeiert wird. Auch hier
gibt es im Anschluss die Möglichkeit der
Begegnung.
- Herzliche Einladung und
Herzlich Willkommen an alle Interessierten Wir
freuen uns auf Euch
- Im Namen des
Lourdesverein Köln, des
Malteser-Lourdes-Krankendienst und der
Hospitalite.
Quelle:Malteser-Lourdes-Krankendienst Köln
Text:Phillip van Loe

NRW: Zahl der Eheschließungen im Jahr 2024
um 2,5 % gesunken
* Rund 77.250 Paare gaben sich 2024 das Ja-Wort
* Darunter waren 2.070 Paare gleichen
Geschlechts
* August war der beliebteste
Heiratsmonat
Im Jahr 2024 heirateten in
Nordrhein-Westfalen 77.247 Paare. Dies
entspricht einem Rückgang von 2,5 % im Vergleich
zu 2023. Wie das Statistische Landesamt
mitteilt, wurden 75.177 Ehen zwischen Männern
und Frauen sowie 2.070 Ehen zwischen Personen
gleichen Geschlechts geschlossen. Dabei handelte
es sich in 1.139 Fällen um weibliche und in 931
Fällen um männliche Paare; es sind auch 122
Fälle enthalten, in denen Paare ihre
eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe
umwandeln ließen.

Foto Pixabay
Die Zahl der
gleichgeschlechtlichen Eheschließungen in NRW
sank gegenüber dem Jahr 2023 um 3,7 % (2023:
2.149 Paare) und damit stärker als die
Eheschließungen zwischen Mann und Frau, deren
Zahl um 2,5 % zurückging (2023: 77.112 Paare).
Bei 84,2 % der Eheschließungen von Mann und Frau
hatten beide die deutsche Staatsangehörigkeit.
Männer sind bei der Eheschließung im
Durchschnitt älter Bei den
gemischtgeschlechtlichen Eheschließungen von
bisher ledigen Personen waren Männer mit
durchschnittlich 34,1 Jahren um gut zwei Jahre
älter als Frauen mit 31,9 Jahren. Bei den
gleichgeschlechtlichen Eheschließungen lag das
Durchschnittsalter der männlichen Ehepaare mit
43,7 Jahren ebenfalls höher als das der
weiblichen Paare mit 40,2 Jahren.

Bei Eheschließungen zwischen Männern und
Frauen war es für knapp vier Fünftel die erste
Ehe Im Jahr 2024 war es bei Eheschließungen
zwischen Männern und Frauen für knapp vier
Fünftel (80,2 % der Frauen und 79,6 % der
Männer) die erste Ehe. Rund ein Fünftel der
Eheschließenden in NRW waren vor ihrer Heirat
geschieden oder ihre Lebenspartnerschaft war
aufgehoben.
Etwa ein Prozent der
Eheschließenden war vor der standesamtlichen
Trauung verwitwet oder ihr vorheriger
Lebenspartner bzw. die vorherige Lebenspartnerin
war verstorben. Der August war 2024 der
beliebteste Heiratsmonat Wie schon in den
Vorjahren lagen die beliebtesten Heiratsmonate
in der wärmeren Jahreszeit: Am häufigsten gaben
sich die Paare 2024 im August das „Ja-Wort“
(10.294 Eheschließungen), gefolgt von den
Monaten Mai (9.165) und Juni (8.701).
Bohnenkaffee im April 2025 um 12,2 %
teurer als ein Jahr zuvor
• Rohkaffee-Importe im April 2025 um 53,1 %
gegenüber Vorjahresmonat verteuert
•
Erzeugerpreise für nicht entkoffeinierten
Röstkaffee im April 2025 um 43,3 % gegenüber
April 2024 gestiegen
• Wichtigster
Handelspartner mit Kaffee ist Brasilien
Für die Tasse Kaffee mussten die Menschen in
Deutschland zuletzt tiefer in die Tasche
greifen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, haben sich die
Verbraucherpreise für Bohnenkaffee im April 2025
um 12,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat erhöht.
Zum Vergleich: Nahrungsmittel insgesamt
verteuerten sich im selben Zeitraum um 2,8 %,
die Verbraucherpreise insgesamt um 2,1 %. Im
mittelfristigen Vergleich lagen die
Verbraucherpreise von Bohnenkaffee im April 2025
um 31,2 % höher als im April 2021. Im Vergleich
zur Teuerung bei Nahrungsmitteln insgesamt
(+31,4 %) stiegen die Preise für Bohnenkaffee
mittelfristig ähnlich stark. Die
Verbraucherpreise insgesamt stiegen im
Vergleichszeitraum April 2021 bis April 2025 um
18,8 %.

Rohkaffee-Importe verteuerten sich im April
2025 um 53,1 %
Die deutliche Erhöhung der
Verbraucherpreise für Kaffee dürfte maßgeblich
auf die Importpreise für Rohkaffee
zurückzuführen sein, welche aufgrund von
Faktoren wie Ernteausfällen durch extreme
Wetterlagen stark angestiegen sind: Im April
2025 waren die Einfuhrpreise für nicht geröstete
Kaffeebohnen 53,1 % höher als ein Jahr zuvor.
Darunter ist der Import von Rohkaffee aus
Amerika 61,8 % teurer geworden, aus Asien und
übrigen Gebieten 43,8 % und aus Afrika 23,2 %.
Die Einfuhrpreise für Kaffee,
entkoffeiniert oder geröstet, sind im April 2025
um 35,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat
gestiegen. Im mittelfristigen Vergleich lagen
die Importpreise für nicht geröstete
Kaffeebohnen im April 2025 um 147,4 % höher als
im April 2021. Kaffee, entkoffeiniert oder
geröstet, verteuerte sich im Vergleichszeitraum
um mehr als zwei Drittel (+67,3 %).
Erzeugerpreise für nicht entkoffeinierten
Röstkaffee im April 2025 um 43,3 % gestiegen
Auch bei gewerblichen Erzeugern hierzulande sind
die Preise von geröstetem Kaffee zuletzt
deutlich gestiegen: Für nicht entkoffeinierten
Röstkaffee lagen sie im April 2025 um 43,3 % und
für entkoffeinierten Röstkaffee 45,2 % höher als
ein Jahr zuvor.
Mittelfristig verteuerten
sich die Erzeugerpreise von nicht
entkoffeiniertem Röstkaffee im April 2025 um
86,1 % gegenüber dem April 2021, bei
entkoffeiniertem Röstkaffee waren es +78,7 %.
Brasilien wichtigster Handelspartner beim Import
von Kaffee Die Importmenge von Kaffee (roh und
geröstet) ist im Jahr 2024
(1,25 Millionen Tonnen) um 14,1 % gegenüber dem
Vorjahr (1,09 Millionen Tonnen) gestiegen.
Langfristig ist die Importmenge von Kaffee im
Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2015
(1,16 Millionen Tonnen) ebenfalls etwas
gestiegen (+7,9 %).
41,4 % der
importierten Kaffeemenge im Jahr 2024 kam aus
Brasilien (516 000 Tonnen), 16,2 % aus Vietnam
(202 000 Tonnen), 5,5 % aus Honduras
(68 000 Tonnen) und 4,3 % aus Kolumbien
(53 000 Tonnen). Weitere wichtige Handelspartner
beim Import von Kaffee waren mit jeweils um 4 %
der importierten Menge Uganda, Italien und Peru.
Montag, 2. Juni 2025
USA-Reise des Bundeskanzlers
Bundeskanzler Friedrich Merz reist in die USA.
Er trifft dort am Donnerstag, den 5. Juni 2025
den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald
Trump, im Weißen Haus zu einem Gespräch.
Es
ist der Antrittsbesuch des Bundeskanzlers und
das erste persönliche Treffen der beiden
Staatsmänner. Daher werden unter anderem die
Beziehungen der beiden Länder und internationale
Themen wie der russische Angriffskrieg gegen die
Ukraine, die Lage im Nahen Osten und die
Handelspolitik im Mittelpunkt des Gesprächs
stehen.
Kleve: Kamishibai in der
Stadtbücherei am 7. Juni
Am Samstag,
den 7. Juni 2025, lädt die Stadtbücherei Kleve
(Wasserstraße 30–32) ab 10:30 Uhr wieder zu
einer neuen Ausgabe der beliebten
Kamishibai-Geschichten ein.
Der Klever
Vorleseclub um Hans-Peter Bause präsentiert
diesmal Geschichten unter dem Motto „Wir sind
glücklich!“ – warmherzig, witzig und mit viel
Gefühl.
Den Anfang machen Hans-Peter
Bause und Hevida Bro mit der Geschichte „Ich bin
für dich da“: Ein mutiges Stachelschwein setzt
alles daran, eine traurige Giraffe aufzuheitern.
Mit viel Humor und Herz zeigt die Geschichte,
dass Helfen und Trösten nicht immer leicht, aber
umso wichtiger sind – denn gemeinsam ist das
Leben einfach schöner.

Im Anschluss lesen Gudrun Gladis, Luzia Brakhan,
Tina Krause, Jeroen Blok und Jan Teunissen
weitere Geschichten, die sich mit berührenden
Fragen beschäftigen:
Wie lassen sich Sorgen
kleiner machen? Was bedeutet „Zuhause“? Welche
Rituale geben Halt? Und können aus Feinden
Freunde werden? Der Eintritt ist wie immer frei,
eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Direktorenführung „Barry Le Va: In a
State of Flux“ im Museum Kurhaus Kleve
Am Mittwoch, den 4. Juni 2025 um 19.30 Uhr führt
Direktor Harald Kunde durch die Ausstellung
„Barry Le Va: In a State of Flux“.

Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem
Kunstmuseum Liechtenstein und der Fruitmarket
Gallery in Edinburgh. Es ist die erste
Retrospektive nach dem Tod des Künstlers und
konzentriert sich auf ortsspezifische
Installationen mit Glas, Filz und Kreide sowie
auf seine Zeichnungen.
Barry Le Va (1941
– 2021) gilt als Erneuerer der Skulptur nach
1960 und als ein bedeutender Vertreter der
Process Art. Die Ausstellung „In a State of
Flux“ zeigt auf, wie der Künstler die
Geschlossenheit der skulpturalen Form aufbrach
und das Prinzip der Veränderung und Instabilität
in sein Werk integrierte.
Bereits 1966
begann Le Va mit der Schaffung von sogenannten
„Scatter Pieces“ auf dem Boden, welche Künstler
wie Richard Serra entscheidend beeinflussten.
Die Radikalität dieser Arbeiten liegt darin,
dass Materialien lose auf dem Boden verteilt
werden – sie werden geworfen, gelegt, gestapelt,
gesiebt – ohne Sockel, ohne großen materiellen
Wert und gleichsam fast ohne jede materielle
Substanz.
„Die meisten seiner Stücke
entstehen vor Ort und werden nach der
Ausstellung weggekehrt, aufgesaugt oder
weggeschmissen“ beschreibt der Kölner Galerist
Rolf Ricke die Vorgehensweise des Künstlers.

Veranstalter ist der Freundeskreis Museum
Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve e.V. Die
Teilnahme an der Führung ist frei. Willkommen
sind nicht nur die Mitglieder des Vereins,
sondern auch alle diejenigen, die sich für das
Museum, den Freundeskreis und ihre Aktivitäten
interessieren. Im Anschluss an die Führung wird
es bei einem geselligen Beisammensein im Café
Moritz auf der Dachterrasse des Museum Kurhaus
Kleve Gelegenheit zum persönlichen Austausch und
zu Gesprächen geben.
vhs Moers – Kamp-Lintfort:
Foto-AG der vhs stellt aus
Mit dem
aktuellen Jahresthema der vhs Moers –
Kamp-Lintfort ‚Ziele und Wege‘ hat sich auch die
Foto-AG der vhs auseinandergesetzt. Ab Mittwoch,
11. Juni, präsentiert die Gruppe ihre Arbeiten
im Foyer des
Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums,
Wilhelm-Schroeder-Straße 10. Bis zum 9. Juli
bleiben die Werke dort ausgestellt und können
montags bis freitags täglich von 8 bis 18.30 Uhr
besichtigt werden.
Stadtteilbüro
Neu_Meerbeck: Klön-Spaziergang lädt zum
Erinnern, Erzählen und Vernetzen ein
Erinnerungen haben Beine: Wenn
Geschichten durch Straßen wandern, werden
Stadtteile lebendig. Genau das passiert am
Mittwoch, 11. Juni, wenn das Projekt
‚MACHT.mit!‘ in Kooperation mit dem
Stadtteilbüro Neu_Meerbeck zum Klön-Spaziergang
einlädt.
Unter dem Motto ‚Erzählen,
Zuhören, Mitmachen‘ geht es ab 16.30 Uhr vom
Stadtteilbüro aus (Bismarckstraße 43b) auf eine
gemütliche Runde durch Meerbeck und Hochstraß –
mit vielen Gelegenheiten, die eigene Geschichte
mit der altehrwürdigen Zechensiedlung zu
teilen.
Der Spaziergang bietet mehr als
frische Luft: Er ist eine Einladung an alle
Bürgerinnen und Bürger, gemeinsam die
Vergangenheit wachzurufen, sich auszutauschen
und mit anderen Menschen aus dem Quartier ins
Gespräch zu kommen. Gegen 18.30 Uhr klingt die
Veranstaltung mit einem kleinen Beisammensein
aus. Stimmen, Stimmungen, Perspektiven sammeln.
Hinter dem Format steht ‚MACHT.mit!‘ des
Bildungswerks ‚Frieda‘ vom evangelischen
Kirchenkreis Moers. Seit dem Frühjahr ist das
Projekt im Stadtteil unterwegs, um Stimmen,
Stimmungen und Perspektiven der Menschen zu
sammeln. Ziel ist es, Brücken zu schlagen
zwischen dem Alltag der Bewohnerinnen und
Bewohner und politischer Verantwortung –
niederschwellig, persönlich und offen.
Interessierte sind herzlich eingeladen, sich
anzumelden und mitzuspazieren. Kontakt und
Anmeldung: Stadtteilbüro Neu_Meerbeck,
Bismarckstraße 43b, Telefon: 0 28 41 / 201-530,
E-Mail: stadtteilbuero.meerbeck@moers.de.
Dinslaken: Kunst-Führung: Die
Persy-Fenster in der evangelischen Stadtkirche
Am Mittwoch, 11. Juni 2025, um 17
Uhr lädt Ronny Schneider, der langjährige
Pfarrer der evangelischen Stadtkirche, zu einer
kleinen Schule des Sehens in Dinslaken ein. Die
Fenster der evangelischen Stadtkirche, entworfen
von Werner Persy, zeigen ein Bildprogramm, bei
dem die Ich-Bin-Worte aus dem
Johannes-Evangelium auf der rechten Seite mit
Geschichten aus dem Alten Testament auf der
linken Seite thematisch und farblich in einen
Dialog treten.
Im Fenster über der Kanzel ist
der gekreuzigte und erhöhte Christus
dargestellt, als „Ruhrgebietschristus“ vor einer
Industrielandschaft mit Kühltürmen und
Hochhäusern. Die kräftigen Farben der Fenster
lassen den Kirchenraum wortwörtlich in einem
anderen Licht erscheinen. Treffpunkt zur Führung
ist an der evangelischen Stadtkirche auf der
Duisburger Straße.
Die Teilnahmegebühr beträgt 5
Euro pro Person und ist direkt vor Ort beim
Gästeführer zu entrichten. Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich und wird gerne vom
Team der Stadtinformation am Rittertor
entgegengenommen – telefonisch unter 02064-66
222 oder per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de.
„Aktionslabor“ gegen Fake News
auf Tour in Nordrhein-Westfalen
ZEIT
STIFTUNG BUCERIUS, Brost-Stiftung und
Bibliotheken fördern digitale
Nachrichtenkompetenz für Erwachsene quasi
„nebenbei“
Eine Art Bällebad für
Erwachsene: Interaktives Labor mit VR-Brille,
Games und Bonbons tourt durchs Ruhrgebiet in
Duisburg, Gladbeck, Bottrop, Dortmund und Essen;
Stationen auch in Düsseldorf und Köln.
Viele Menschen fühlen sich im digitalen Raum und
von der Informationsflut überfordert. Gerade in
Zeiten, in denen Desinformation, Fake News und
KI-generierte Bilder unser Einschätzungsvermögen
herausfordern, ist digitale Medien- und
Nachrichtenkompetenz besonders wichtig. Dies
gilt umso mehr, um informiert
verantwortungsvolle Entscheidungen etwa bei
Wahlen treffen zu können.
Genau hier
setzt das interaktive „Aktionslabor“ der ZEIT
STIFTUNG BUCERIUS an, das Besuchenden mit
VR-Station und digitalen Spielen einen völlig
neuen Zugang zu Nachrichten- und
Informationsfragen bietet. Das Labor macht aus
Nachrichten-Theorie „Praxis zum Anfassen“ und
steht niedrigschwellig und unterhaltsam genau da
zum aktiven Austesten, Informieren und
praktischen Erfahren zur Verfügung, wo sich
Bürger:innen im öffentlichen Raum aufhalten.
Hier sind unter anderem die Bibliotheken/
Büchereien ein zentraler Ort. Dort können mit
dem multimedialen Konzept alle Interessierten
quasi „nebenbei“ ihr Nachrichten-Wissen und ihre
digitalen Fähigkeiten testen und spielerisch
stärken. Kostenlos. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich. Und was „Süßes“ ist auch dabei…
Gefördert durch die Essener Brost-Stiftung
tourt das Aktionslabor derzeit durch
Nordrhein-Westfalen. Den Schwerpunkt bilden
Stationen im Ruhrgebiet, aber auch im Rheinland
gastieren die mobilen Labor-Module: Nach dem
Start in Bochum (Langendreer, Gerthe und
Zentralbibliothek), Hattingen und Düsseldorf ist
das Aktionslabor aktuell in Duisburg
(Zentralbibliothek Duisburg). Anschließend geht
es weiter nach Gladbeck, Bottrop, Mülheim an der
Ruhr,Dortmund und Essen. Weitere Stationen sind
parallel in Köln geplant.
Stationen des
Aktionslabors u.a.:
aktuell – 18. Juni 2025:
Zentralbibliothek Duisburg
Adresse:
Stadtfenster Steinsche Gasse 26, 47051 Duisburg
ZEIT STIFTUNG BUCERIUS
Die gemeinnützige
ZEIT STIFTUNG BUCERIUS mit Sitz in Hamburg ist
Förderin einer offenen, aktiven
Zivilgesellschaft und schaut dort hin, wo es
Spannungen oder Umbrüche gibt. Ob in
Wissenschaft, Kultur, Bildung, Politik,
Gesellschaft oder Medien – in über 400
Förderprojekten und eigenen Initiativen
verteidigt die Stiftung seit 1971 Freiheiten,
schafft Freiräume und gibt Orientierung, wo sie
gebraucht wird.
So befähigt sie
Menschen, Mitstreitende für eine offene
Gesellschaft zu werden, ganz im Sinne des
Stifterehepaares Gerd und Ebelin Bucerius. Die
Stärkung von Nachrichtenkompetenz und damit von
aktiver Teilhabe an Demokratie steht im Fokus
der Förderarbeit – damals wie aktuell.
Brost-Stiftung
Die Brost-Stiftung mit Sitz in
Essen wurde 2011 in Erfüllung des
testamentarischen Willens von Anneliese Brost
gegründet. Für ihr soziales Engagement wurde sie
noch zu Lebzeiten mehrfach ausgezeichnet. Nach
ihrem Willen fördert die Brost-Stiftung heute
Projekte mit Schwerpunkt in den Bereichen Kunst
und Kultur, Jugend- und Altenhilfe, Volks- und
Berufsbildung, öffentliches Gesundheitswesen und
öffentliche Gesundheitspflege, Wohlfahrtspflege
sowie mildtätige Zwecke.
Der Fokus liegt
dabei auf dem Ruhrgebiet, der Heimat von
Anneliese Brost, dessen Identität gestärkt
werden soll. Ziel der Stiftung ist, durch
Kooperation das Miteinander und die anpackende
Selbsthilfe im Ruhrgebiet zu unterstützen. Durch
die Förderung wissensbasierter,
konzeptionsstarker und zukunftsweisender
Projekte, soll eine Wirkung über das Ruhrgebiet
hinaus erzielt werden.
Freie
Berufe: Ausbildungszahlen gestiegen
Die Freien Berufe verzeichnen einen Anstieg
bei den neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen. Besonders gefragt sind
medizinische und zahnmedizinische
Ausbildungsberufe sowie die Ausbildung zum/zur
Steuerfachangestellten. BFB-Präsident Dr.
Stephan Hofmeister sagt: "Die jungen Leute
wissen ganz genau: Wenn ich eine Ausbildung bei
den Freien Berufen beginne, mache ich unsere
Gesellschaft widerstandsfähiger." Dennoch bleibt
die Fachkräftelücke mit 211.000 fehlenden
Personen erheblich.
im April berichteten
zahlreiche Medien über einen Rückgang der neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträge. Neue Zahlen
zeigen, dass es in den Freien Berufen, also u.a.
bei Ärzten, Anwältinnen, Steuerberatern,
Zahnärztinnen und weiteren
gemeinwohlorientierten Berufsgruppen, einen
gegenläufigen Trend gibt. Gute Nachrichten also
für den Wirtschaftsstandort Deutschland und den
freiberuflichen Sektor, der inzwischen mehr als
sechs Millionen Beschäftigte in umfasst.
Die Freien Berufe sind der drittgrößte
Ausbildungssektor.
Weiter unten senden wir
Ihnen eine einordnende Mitteilung dazu mit den
neuesten Zahlen. Das Portal MediaPioneer
berichtete heute bereits darüber.
Tipps für den Alltag - Mieter dürfen
Balkonkraftwerke installieren
Balkonkraftwerk: Mit Sonnenlicht Portemonnaie
entlasten
Balkonkraftwerke sind in
Hausrat- und Wohngebäudeversicherung
eingeschlossen
In Zeiten steigender
Energiepreise und wachsendem Umweltbewusstsein
suchen immer mehr Menschen nach Möglichkeiten,
ihren Strombedarf nachhaltig und kostengünstig
zu decken. Eine attraktive Lösung sind
Balkonkraftwerke, kleine Photovoltaikanlagen.
Lange Zeit hatten Mieter keine Möglichkeit,
ihre Energiekosten durch den Einbau von
Photovoltaik selbst zu reduzieren. Der Vermieter
bestimmte, ob eine Photovoltaikanlage auf das
Dach kam. Seit es Balkonkraftwerke gibt, sieht
das anders aus. Mieter können sie jederzeit auf
ihrem Balkon oder ihrer Terrasse aufstellen. Die
Erlaubnis ihres Vermieters benötigen sie nicht.
Nur bei Anlagen an der Balkonaußenseite oder der
Fassade befestigt werden, kann der Vermieter
mitreden.

Doch auf dem Balkon sind die Module
Naturgewalten wie Sturm, Hagel und Blitzschlag
ausgesetzt. Lassen sich solche Schäden
versichern? Wie die HUK-COBURG sagt, werden
diese Risiken in der Hausratversicherung mit
abgedeckt. Auch im Winter bei Eis und Schnee
können Balkonkraftwerke bedenkenlos draußen
bleiben. Manche Hausratversicherungen leisten
auch, wenn das Balkonkraftwerk gestohlen wird.
Eine andere Konstellation: Die
Minisolaranlage brennt wegen eines technischen
Defekts und schädigt einen Dritten. Solche
Schäden reguliert normalerweise die
Privathaftpflichtversicherung, vorausgesetzt,
dass die Anlage zu einer selbst bewohnten
Immobilie gehört. Dazu gehören nicht nur
Eigentumshäuser und -wohnungen, sondern auch
Mietimmobilien. Art und Umfang des
Versicherungsschutzes können variieren: Ein
persönliches Gespräch mit dem eigenen
Versicherer sorgt für Klarheit.
Doch
Balkonkraftwerke – an Außenwänden oder auf
Garagendächern – sind auch für viele
Immobilienbesitzer inzwischen eine Option.
Hängen sie fest an der Außenwand, sind sie in
der Wohngebäudeversicherung mitversichert.
Ausschlaggebend für den Umfang des
Versicherungsschutzes ist, welche Gefahren in
der eigenen Police versichert wurden. Am besten
bespricht man auch diese Frage mit seinem
Versicherer.
TÜV-Verband Presseinfo: Sommerrodelbahnen:
Fahrspaß mit Risiken
Hohe
Sicherheitsstandards und regelmäßige Prüfungen
gewährleisten hohes Schutzniveau.
Eigenverantwortung der Fahrgäste notwendig.
TÜV-Verband warnt vor Unfällen durch Leichtsinn.
Was Insassen vor und während der Fahrt beachten
sollten.
Sie heißen Alpine Coaster,
Mountain Coaster, Trapper Slider oder
Bocksbergbob: Sommerrodelbahnen gelten als
familienfreundlicher Freizeitspaß mit
Adrenalinkick. Doch auf den Bahnen kommt es
immer wieder zu Unfällen mit zum Teil schweren
Verletzungen. In der Regel sind technische
Mängel selten die Ursache, sondern Fehlverhalten
der Nutzer:innen. Vor allem Auffahrunfälle sind
ein Risiko.
„Fahrten in einer
Sommerrodelbahn wirken harmlos, sind aber
durchaus anspruchsvoll“, sagt André Siegl,
Experte für Anlagensicherheit beim TÜV-Verband.
„Häufig unterschätzen Fahrgäste die Dynamik, die
ohne Motor entstehen kann. Vermeintliche
Kleinigkeiten wie zu dichtes Auffahren, falsches
Bremsen oder zu schnelle Kurvenfahrten können
auf der Strecke fatale Folgen haben.“
Zusätzlich wirken Regen oder Nässe sich negativ
auf Fahr- und Bremsverhalten aus. Je nach
Wetterlage müssen die Bahnbetreibenden die
Anlage schließen, bis sie soweit getrocknet ist,
dass ein sicherer Betrieb möglich ist. Der
TÜV-Verband erklärt, woran Fahrgäste sichere
Anlagen erkennen und worauf es bei der Nutzung
ankommt.
Unterschiedliche Systeme: Hohe
Geschwindigkeiten auf Schienenrodelbahnen
Bei
Sommerrodelbahnen unterscheidet man zwei
Bauarten: Rinnen- oder Wannenrodelbahn und
Schienenrodelbahn. Rinnen- oder
Wannenrodelbahnen bestehen aus offenen oder
halboffenen Wannen – meist aus Edelstahl,
seltener aus Faserbeton oder Kunststoff. Die
Schlitten werden nicht geführt, sondern gleiten
frei in der Rinne. Das vermittelt ein intensives
Fahrgefühl, birgt aber auch Risiken.
„Bei zu hoher Geschwindigkeit besteht die
Gefahr, dass die Schlitten ins Schlingern
geraten oder in Kurven sogar aus der Bahn
fliegen, selbst wenn die Kurven als Steilkurven
ausgeführt sind um den Schlitten in der Bahn zu
halten“, sagt Siegl. Gebremst wird per
Handhebel: Wird der Hebel angezogen, drückt eine
Bremsklappe auf die Bahn – je nach Feingefühl
genau richtig, zu sanft oder zu heftig. „Wer
abrupt abbremst oder gar mitten in der Kurve
bremst, riskiert Kontrollverlust oder einen
Stillstand in der Bahn“, erläutert Siegl.
„Auffahrunfälle sind ein häufiges Problem, da
nachfolgende Fahrer nicht rechtzeitig reagieren
können.“
Schienenrodelbahnen sind
technisch anspruchsvoller. Die Schlitten laufen
fest auf einem zwangsgeführten Schienensystem.
Ein Herausschleudern oder Umkippen ist praktisch
ausgeschlossen, sofern die Insassen richtig
angeschnallt sind. Die Schienen erlauben eine
dynamische Fahrweise mit
Spitzengeschwindigkeiten bis zu 40 km/h.
Die Schattenseite: Auch hier sind
Auffahrunfälle möglich, zum Beispiel, wenn
Fahrgäste unvermittelt bremsen oder den
Sicherheitsabstand nicht einhalten. Moderne
Bahnen verfügen über automatische Bremssysteme
oder Überwachungseinrichtungen, um solche
Kollisionen zu verhindern. An den meisten
Fahrstrecken sind gut sichtbare Hinweisschilder,
wie z. B. „Langsam Fahren“ oder „Bremsen“
angebracht, doch ein sicheres Verhalten der
Nutzer:innen ist dadurch nicht garantiert.
Sicherheitsstandards und unabhängige
Prüfungen
In Deutschland unterliegen
Sommerrodelbahnen hohen sicherheitstechnischen
Anforderungen. Grundlage dafür ist seit 2018 die
internationale Norm DIN ISO 19202. Sie regelt
detailliert Planung, Bau, Betrieb und Prüfung –
jeweils angepasst an den jeweiligen Bahntyp.
Bevor eine Bahn erstmals in Betrieb gehen darf,
ist eine sicherheitstechnische Erstprüfung durch
eine unabhängige Prüfstelle, etwa ein
TÜV-Unternehmen, gesetzlich vorgeschrieben.
Danach folgen jährlich wiederkehrende Prüfungen,
meist vor Saisoneröffnung.
Die
Ergebnisse werden den zuständigen Bauaufsichts-
und Genehmigungsbehörden vorgelegt. Auf ihre
Funktionalität geprüft werden unter anderem
Schlitten, Bremssysteme, Rückhalteeinrichtungen
(Sicherheitsbügel und Gurte),
Not-Stopp-Vorrichtungen, Lichtschranken und
Rettungswege. Die Betreibenden sind
verantwortlich für die Beauftragung der
Prüfungen und den sicheren Betrieb der Anlagen.
„Ein Blick auf die Prüfplakette am
Einstieg zeigt, ob die Bahn regelmäßig
kontrolliert wurde“, sagt Siegl. „Doch
Sicherheit liegt nicht nur in der Technik,
sondern auch in der Verantwortung jedes
Einzelnen. Sommerrodelbahnen erfordern
Aufmerksamkeit, Rücksicht und Disziplin – nur so
wird aus einem Abenteuer ein sicheres Erlebnis.“
Was Fahrgäste beachten sollten
So
verlockend es auch ist, sich einfach
reinzusetzen und loszudüsen – ein Blick auf
Regeln und Technik kann den Unterschied zwischen
einem unbeschwerten Abenteuer und einem
missglückten Ausflug ausmachen. Damit die Fahrt
mit der Sommerrodelbahn ein sicherer
Nervenkitzel bleibt, empfiehlt der TÜV-Verband
folgende Sicherheitsmaßnahmen:
Hinweisschilder ernst nehmen und Regeln
befolgen: Vor jeder Fahrt sollten Fahrgäste die
Betriebsvorschriften und Sicherheitshinweise an
der Anlage aufmerksam lesen. Besonders wichtig
sind Hinweise zur richtigen Körperhaltung, zum
Bremsverhalten und zur Nutzung von
Sicherungssystemen – diese variieren je nach
Bauart der jeweiligen Bahn.
Abstand
halten – besonders auf Schienenanlagen: Auf
Schienenrodelbahnen gilt ein fester
Sicherheitsabstand von mindestens 25 Metern.
Wenn der vordere Schlitten plötzlich stoppt,
erhöht sich das Auffahrunfallrisiko bei zu
geringem Abstand.
Geschwindigkeit
kontrollieren – vor allem in Rinnen- oder
Wannenbahnen: In Rinnen- oder Wannenrodelbahnen
müssen die Fahrgäste ihre Geschwindigkeit selbst
steuern, da die Schlitten meist keine
automatische Begrenzung haben. Daher müssen
Fahrende besonders in Kurven und bei starkem
Gefälle auf ihr Bremsverhalten achten.
Richtig sitzen und sichern: Bei
Schienenrodelbahnen sind oft Anschnallgurte
vorgeschrieben, Rinnen- oder Wannenanlagen sind
meist mit Haltebügeln, manchmal zusätzlich noch
mit Gurten ausgerüstet. In beiden Fällen gilt:
Rückhaltesysteme nutzen, ruhig sitzen bleiben,
Füße nicht aus dem Schlitten strecken und
keinesfalls während der Fahrt filmen.
Kinder altersgerecht begleiten: Achten Sie auf
die Alters- und Größenbeschränkungen der
jeweiligen Bahn. Viele Anlagen erlauben es
Kindern bis sieben Jahren, nur in Begleitung
eines Erwachsenen zu fahren. Ab acht Jahren
dürfen Kinder in der Regel alleine fahren – aber
nur, wenn sie zuvor gut eingewiesen wurden,
insbesondere zum richtigen Bremsen und Verhalten
bei Störungen.
Alkohol- und Drogenkonsum
verboten: Alkohol- und Drogen sowie in einigen
Fällen auch Medikamente können geistige und
körperliche Koordination, Reaktionsfähigkeit und
Urteilsvermögen der Nutzer:innen
beeinträchtigen. Um die eigene Sicherheit und
die der anderen Nutzer:innen nicht zu gefährden,
gilt grundsätzlich ein Verbot.
Arbeitszeit: Regierungspläne würden Arbeitstage
von über 12 Stunden erlauben – negative Folgen
für Gesundheit und Vereinbarkeit
Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine Debatte
über die Arbeitszeit in Deutschland angestoßen.
Die Menschen müssten „wieder mehr und vor allem
effizienter arbeiten". Im Koalitionsvertrag
kündigt die neue Bundesregierung an, die
Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer
täglichen Höchstarbeitszeit zu schaffen. Das
zielt in erster Linie auf eine weitere Lockerung
des Arbeitszeitgesetzes zur Ausweitung der
täglichen Höchstarbeitszeit ab.
Dabei
erlaubt bereits das geltende Gesetz längst eine
tägliche Arbeitszeit von bis zu 10 Stunden. Das
Vorhaben der Bundesregierung würde tägliche
Höchstarbeitszeiten von über 12 Stunden
erlauben, zeigt eine neue Kurzstudie des Hugo
Sinzheimer Instituts für Arbeitsrecht (HSI) der
Hans-Böckler-Stiftung.*
Die von der
Bundesregierung angeführten Ziele –
wirtschaftliche Impulse, Interessen von
Beschäftigten an Flexibilität und Erhalt des
Arbeitsvolumens trotz demografischen Wandels –
lassen sich durch weiter deregulierte
Arbeitszeiten nicht erreichen, warnen die
HSI-Fachleute Dr. Amélie Sutterer-Kipping und
Dr. Laurens Brandt. Denn erstens könne eine
weitgehende Lockerung der täglichen Arbeitszeit
bestehende gesundheitliche Probleme in der
Erwerbsbevölkerung verschärfen, was das
Arbeitspotenzial schwächt statt stärkt. Zweitens
würde sich die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie weiter verschlechtern, was insbesondere
die Teilnahme von Frauen am Erwerbsleben
einschränkt.
„Eine
Arbeitszeitderegulierung, die Erkenntnisse von
Arbeitsmedizin und Arbeitsforschung ausblendet
und an der sozialen Realität vorbeigeht, dürfte
wirtschaftlich sogar kontraproduktiv wirken.
Denn sie würde gerade jene Entwicklungen
bremsen, die in den vergangenen Jahren
wesentlich zu Rekordwerten bei Erwerbstätigkeit
und Arbeitsvolumen beigetragen haben und
gleichzeitig Probleme bei Gesundheit und
Demografie verschärfen“, sagt Expertin
Sutterer-Kipping.
Arbeitsvolumen auf
Rekordniveau
Um sich ein vollständiges Bild
über die Entwicklung der Arbeitszeit in
Deutschland zu machen, müssen neben der
durchschnittlichen Jahresarbeitszeit auch die
Entwicklung der Erwerbstätigkeit und das
Arbeitszeitvolumen betrachtet werden. Die
HSI-Forschenden tun das mit aktuellen Daten des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB).
Die Zahlen der abhängig
Beschäftigten bzw. der Erwerbstätigen erreichten
nach dem IAB im Jahr 2023 mit einem
Jahresdurchschnitt von 42,2 bzw. 46,0 Millionen
Personen Höchststände. Auch das
Gesamtarbeitszeitvolumen verzeichnete
Rekordwerte. Insgesamt haben abhängig
Beschäftigte in Deutschland 2023 rund 54,59
Milliarden Stunden geleistet, während es 1991
noch 52,20 Milliarden Stunden waren. Inklusive
des Arbeitszeitvolumens der Selbstständigen und
mithelfenden Familienangehörigen stieg das
Arbeitszeitvolumen der Erwerbstätigen 2023 sogar
auf 61,44 Milliarden Stunden.
Im Jahr
2024 blieben beide Größen sehr nahe an diesen
Rekordwerten: Die Zahl der Erwerbstätigen stieg
noch einmal minimal an, das Arbeitsvolumen der
Erwerbstätigen ging geringfügig um 0,1 Prozent
auf 61,37 Milliarden Stunden zurück. Die
gestiegene Erwerbstätigenzahl und das gestiegene
Arbeitszeitvolumen sind wesentlich darauf
zurückzuführen, dass heute mehr Frauen einer
Erwerbstätigkeit nachgehen. So ist die
Erwerbsquote von Frauen zwischen 1991 und 2022
um 16 Prozentpunkte auf 73 Prozent gestiegen.
„Die Entwicklung der Arbeitszeit zeigt, dass
wir uns zunehmend weg vom traditionellen
Alleinverdienermodell zu einem
Zweiverdienerhaushalt hinbewegen“, analysieren
Sutterer-Kipping und Brandt. Dementsprechend
steigt das Gesamtarbeitszeitvolumen insgesamt,
während die durchschnittlichen
Jahresarbeitszeiten gesunken sind. Die
durchschnittlich geleistete Arbeitszeit der
Beschäftigten lag laut IAB 1991 noch bei rund
1.478 Stunden und im Jahr 2023 bei 1.295
Stunden.
Der Rückgang ist stark auf die
kontinuierlich gestiegenen Teilzeitquoten
zurückzuführen. Knapp ein Drittel der
Beschäftigten arbeitete 2023 in Teilzeit, unter
den erwerbstätigen Frauen sogar fast jede
zweite, und das nicht immer freiwillig. Gerade
bei Müttern schränken unbezahlte Sorgearbeit und
unzureichende Betreuungsmöglichkeiten die
Kapazitäten für den Erwerbsjob ein. Rechnerisch
senkt das die durchschnittliche
Jahresarbeitszeit pro Kopf, was zu einer im
europäischen Vergleich relativ geringen
durchschnittlichen Arbeitszeit aller
Beschäftigten von 34,7 Stunden pro Woche führt.
An diesen Zusammenhängen würde eine Aufweichung
des Arbeitszeitgesetzes nichts verbessern, im
Gegenteil.
Geltendes Recht sorgt für
erhebliche Flexibilität
Den Arbeitgebern
ermöglicht hingegen schon die geltende
Rechtslage eine erhebliche Flexibilität, betonen
die HSI-Expert*innen. Der Acht-Stunden-Tag ist
zwar seit 1918 eine Konstante im
Arbeitszeitrecht, gleichwohl ist ohne weitere
Voraussetzung eine deutliche Verlängerung
möglich. So kann die Arbeitszeit ohne
Rechtfertigung auf bis zu zehn Stunden täglich
ausgeweitet werden, wenn innerhalb von sechs
Monaten ein Ausgleich erfolgt, also die
durchschnittliche Arbeitszeit von acht Stunden
werktäglich nicht überschritten wird.
Darüber hinaus lässt das geltende
Arbeitszeitgesetz zahlreiche branchen- bzw.
tätigkeitsbezogene Abweichungen und Ausnahmen
durch Tarifvertrag, aufgrund eines
Tarifvertrages in einer Betriebs- oder
Dienstvereinbarung oder durch behördliche
Erlaubnis zu, wobei im Regelfall ein
entsprechender Zeitausgleich gewährleistet sein
muss. Das erklärt, warum z.B. in Krankenhäusern
längere Arbeitszeiten als acht bzw. zehn Stunden
möglich sind.
Überlange Arbeitszeiten
gefährden die Gesundheit
Trotz aller bereits
bestehender Flexibilisierungsmöglichkeiten: Dass
der Erwerbs-Arbeitstag im Prinzip nach acht
Stunden enden soll, ist kein Zufall, sondern
Ergebnis wissenschaftlicher Erkenntnisse zum
Gesundheitsschutz. Die Einführung einer
wöchentlichen Höchstarbeitszeit würde aber
faktisch nach Abzug der Mindestruhezeit von 11
Stunden und der entsprechenden Ruhepause von 45
Minuten eine tägliche Höchstarbeitszeit von 12
Stunden und 15 Minuten ermöglichen. Eine
Begrenzung der täglichen Arbeitszeit fände dann
nur durch die Mindestruhezeiten und Ruhepausen
statt.
Arbeitsmedizinisch ist längst
erwiesen, dass Arbeitszeiten von mehr als acht
Stunden die Gesundheit gefährden. Langfristig
kommt es häufiger zu stressbedingten
Erkrankungen, sowohl zu psychischen Leiden wie
vermehrtes Auftreten von Burnout-Symptomatik,
physischen und psychischen
Erschöpfungszuständen, als auch zu körperlichen
Erkrankungen, etwa Schlaganfälle, Diabetes und
erhöhtes Krebsrisiko. Psychische Erkrankungen
sind immer häufiger der Grund für Fehlzeiten und
vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsleben.
Die Krankheitsdauer bei psychischen
Erkrankungen lag nach Daten der DAK 2023 bei
durchschnittlich 33 Tagen. „Neben den fatalen
Folgen für Arbeitnehmende stellt dies
langfristig auch das Gesundheitssystem und
Arbeitgebende vor enorme Herausforderungen“,
betonen Sutterer-Kipping und Brandt.
Neben höheren Krankheitsrisiken zeigen
arbeitsmedizinische Erkenntnisse auch negative
Zusammenhänge zwischen langen werktäglichen
Arbeitszeiten und dem Unfallgeschehen am
Arbeitsplatz. Das Unfallrisiko steigt ab der 8.
Arbeitsstunde exponentiell an, sodass
Arbeitszeiten über 10 Stunden täglich als hoch
riskant eingestuft werden. Nach einer
Arbeitszeit von 12 Stunden ist die Unfallrate
bei der Arbeit oder bei der anschließenden Fahrt
nach Hause im Vergleich zu 8 Stunden um das
Zweifache erhöht. Dieses Risiko betrifft nicht
nur die Arbeitnehmer*innen selbst, sondern auch
Dritte, wie beispielsweise Patient*innen bei
medizinischen Tätigkeiten oder
Verkehrsteilnehmende.
Vereinbarkeit von
Beruf und Familie leidet
Weiteres
gravierendes Problem: Durch die Einführung einer
wöchentlichen Höchstarbeitszeit werden
Betreuungskonflikte nicht gelöst, sondern
verschärft, so die Forschenden. „Die
Vorhersehbarkeit und Planbarkeit von
Arbeitszeiten stellen wichtige Schlüsselfaktoren
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar.
Es droht der Effekt einer weiteren Verringerung
der Erwerbsarbeit gerade bei Frauen.“
Das schwächt nicht nur das aktuelle
Arbeitsangebot. Langfristig verhindert die
ungleiche Teilhabe am Arbeitsmarkt die
eigenständige Existenzsicherung im Lebenslauf,
schmälert nachweislich Aufstiegs- und
Weiterbildungschancen und erhöht das Risiko für
Altersarmut.
Was Arbeitnehmer*innen
hingegen wirklich helfen würde, Erwerbsarbeit
und Sorgearbeit unter einen Hut zu bringen, sei
mehr Arbeitszeitsouveränität, also Einflussnahme
auf die Verteilung der Arbeitszeit. Im
Koalitionsvertrag machen die Forschenden an
diesem Punkt aber eine Leerstelle aus. „Dort
heißt es zwar, dass sich die Beschäftigten und
Unternehmen mehr Flexibilität wünschen, der
Koalitionsvertrag sieht aber keine Einflussnahme
der Arbeitnehmenden auf die Verteilung der
Arbeitszeit vor.“
Nach geltender
Rechtslage kann sich die konkrete Lage der
Arbeitszeit aus dem Arbeitsvertrag, einer
Betriebsvereinbarung oder tarifvertraglichen
Regelungen ergeben. Sofern hier keine
Festlegungen getroffen worden sind, unterliegt
die Bestimmung der Lage der Arbeitszeit dem
Direktionsrecht der Arbeitgebenden. Sie haben
also das letzte Wort.
Auch vor diesem
Hintergrund bewerten die Fachleute die
Einführung einer wöchentlichen statt einer
täglichen Höchstarbeitszeit als „nicht
verantwortbar und die falsche Stellschraube zur
Lösung des Problems von gleichberechtigter
Sorgearbeit“. Statt diesen Irrweg einzuschlagen,
solle sich die Bundesregierung an Reformen der
bislang letzten schwarz-roten Koalition
orientieren. Mit der 2019 eingeführten
Brückenteilzeit sei ein erster Schritt gemacht
worden, um der „Teilzeitfalle“ entgegenzuwirken.
„Doch bisher gibt es noch zu viele
Einschränkungen, als dass dieses Gesetz wirklich
ein Ende der Teilzeitfalle bedeuten würde“,
schreiben die Forschenden. Gleichzeitig müsse
die institutionelle Kinderbetreuung weiter
gestärkt werden, denn die Verfügbarkeit von
Betreuungsmöglichkeiten sei ein zentraler Hebel
für die gleichberechtigte Verteilung der
Sorgearbeit.

NRW-Inflationsrate liegt im Mai 2025
bei 2,0 %
* Preise für
Übernachtungen höher als ein Jahr zuvor (+13,8
%)
* Preisrückgänge bei Kraftstoffen (–6,1
%)
Die Inflationsrate in
Nordrhein-Westfalen – gemessen als Veränderung
des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat –
liegt im Mai 2025 bei 2,0 %. Wie Information und
Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches
Landesamt mitteilt, stieg der Preisindex
gegenüber dem Vormonat (April 2025) um 0,2 %.

Vorjahresvergleich: Preise für
Übernachtungen um 13,8 % gestiegen
Zwischen
Mai 2024 und Mai 2025 stiegen u. a. die Preise
für Übernachtungen um 13,8 % und für
Versicherungsdienstleistungen um 9,2 %.
Alkoholfreie Getränke verteuerten sich um 8,9 %
und Obst um 8,6 %.
Die Energiepreise
sanken im Vergleich zum Vorjahresmonat um
durchschnittlich 3,1 %. Haushaltsenergien wurden
um 1,0 % und Kraftstoffe um 6,1 % günstiger
angeboten. Die Preise für Telefone u. a. Geräte
für Kommunikation sanken um 6,7 %.
Vormonatsvergleich: Paprika um 27,5 % günstiger
als im April 2025 Zwischen April 2025 und Mai
2025 verteuerten sich Schokoladentafeln um
10,6 %, Kaugummi, Gummibärchen o. Ä. um 5,6 %
und Kartoffeln um 5,4 %.
Verschiedene
Gemüsesorten wie z. B. Paprika (–27,5 %),
Tomaten (–22,0 %), Kopf- oder Eisbergsalat
(–12,3 %), Möhren (–5,8 %) und Gurken (–5,6 %)
verzeichneten Preisrückgänge. Wichtige
Preisveränderungen
https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/149_25.xlsx
|