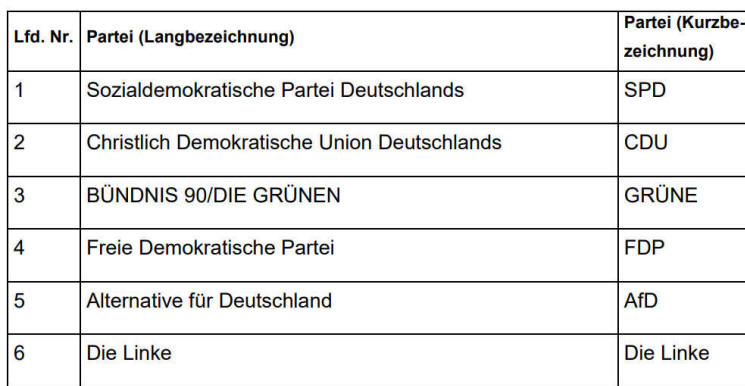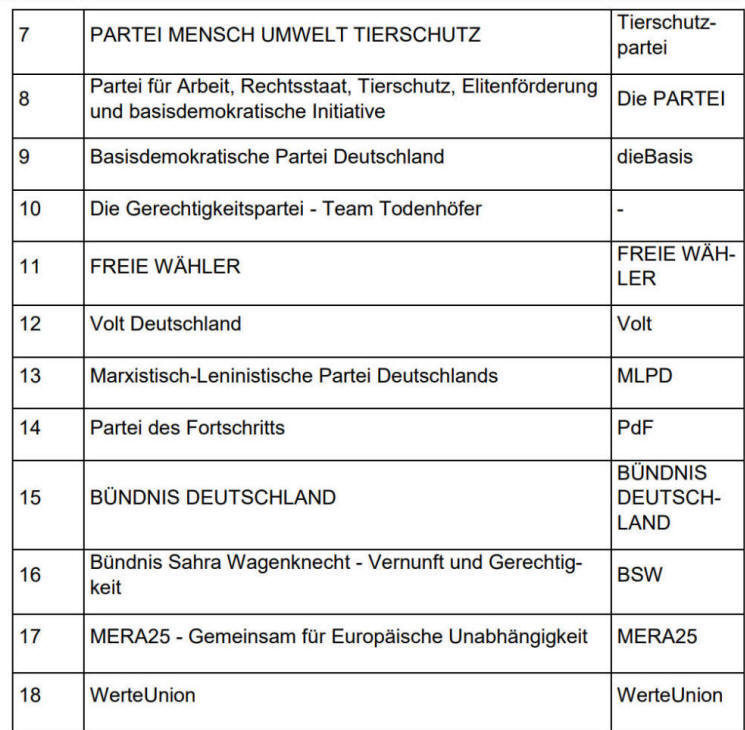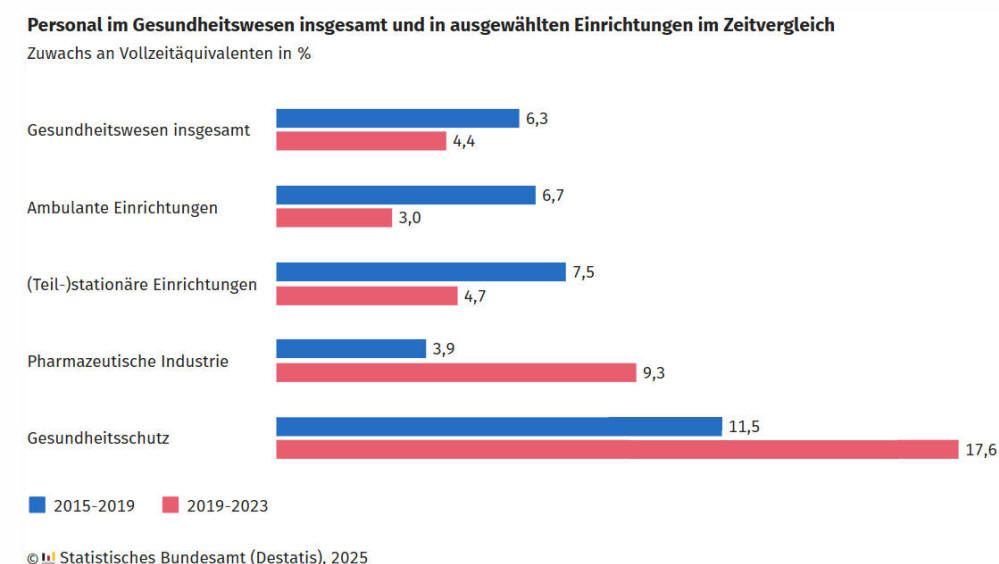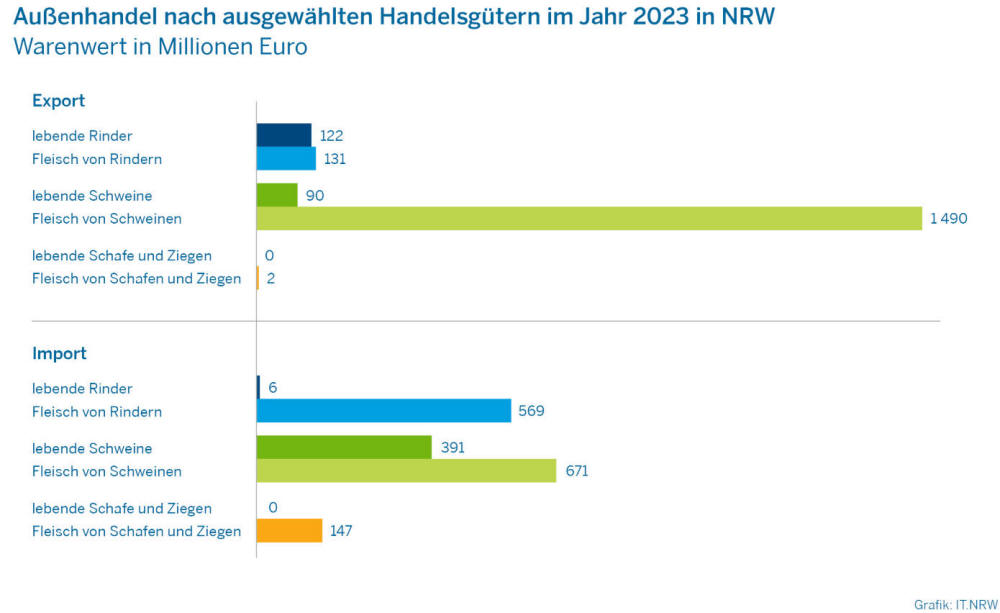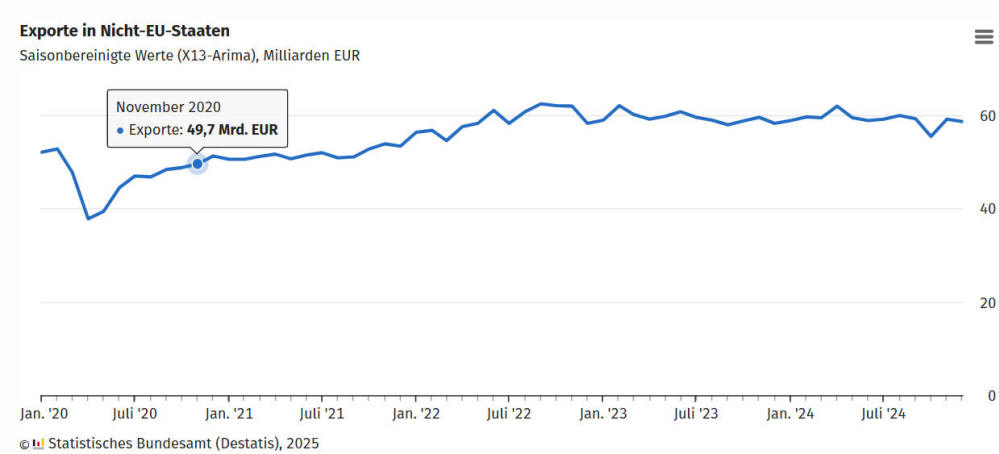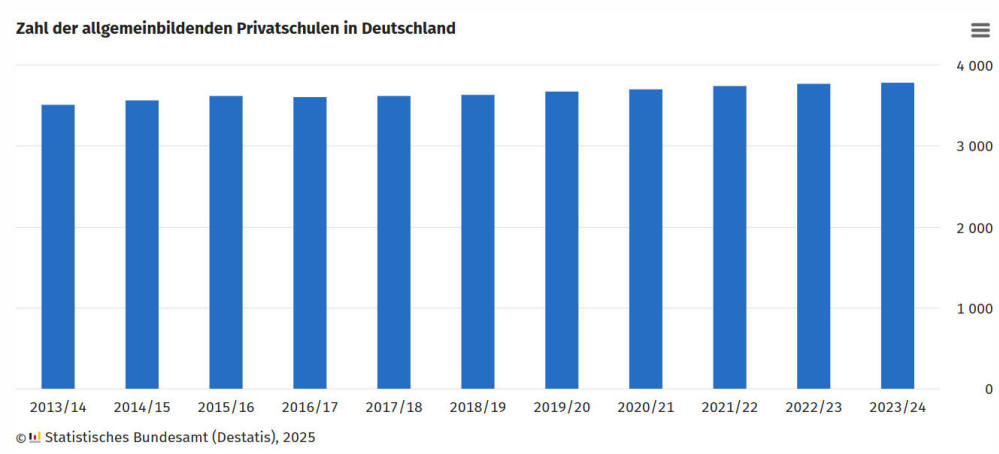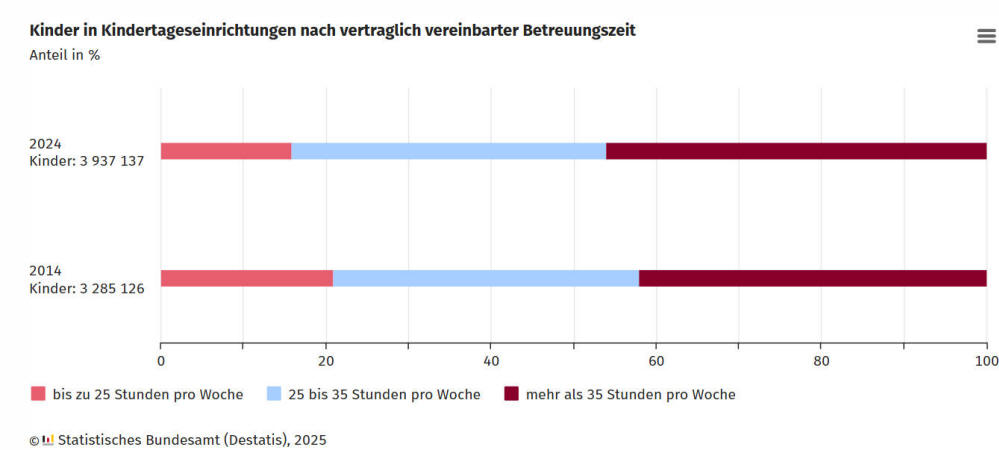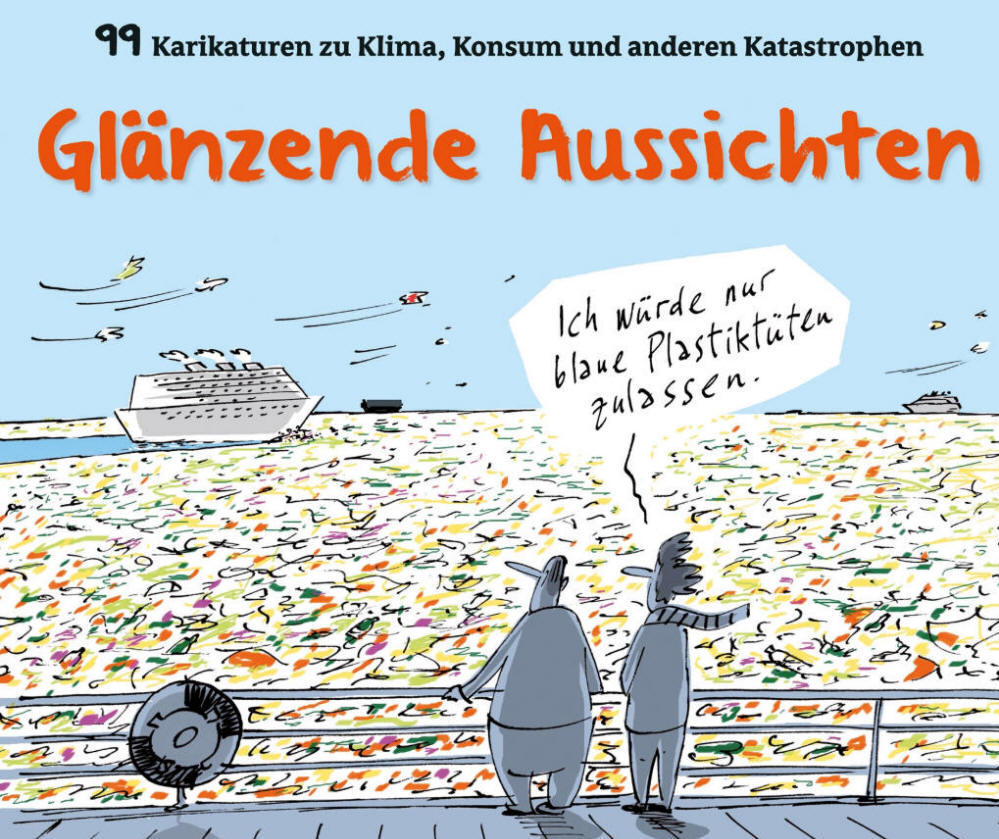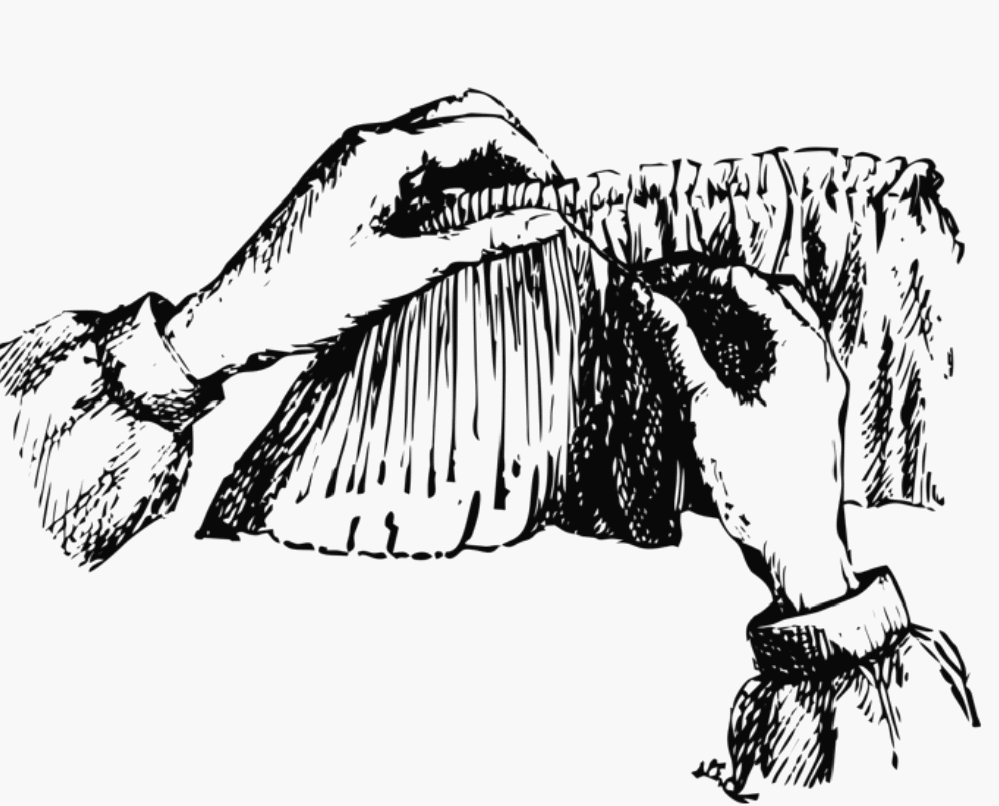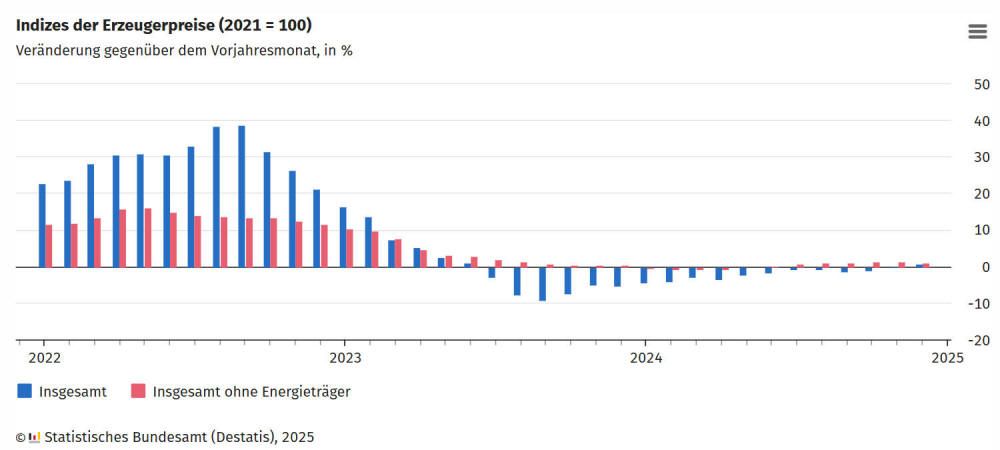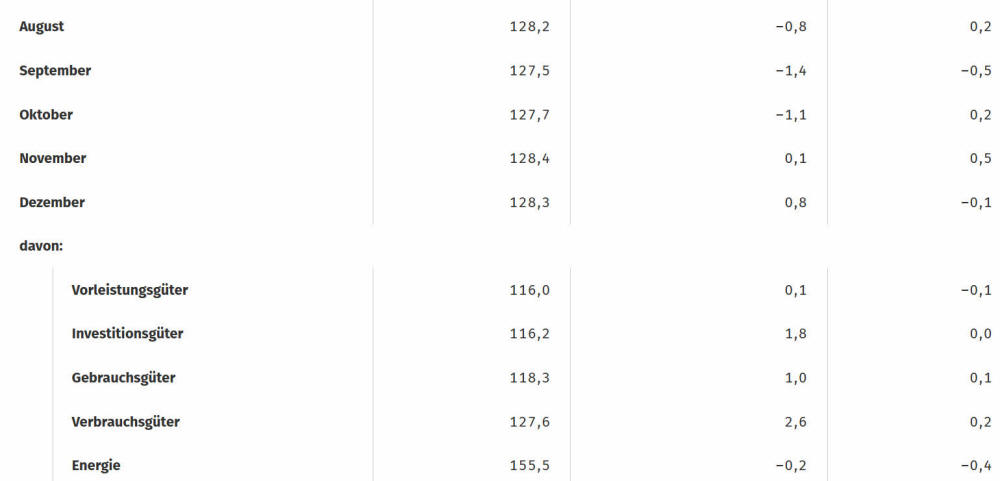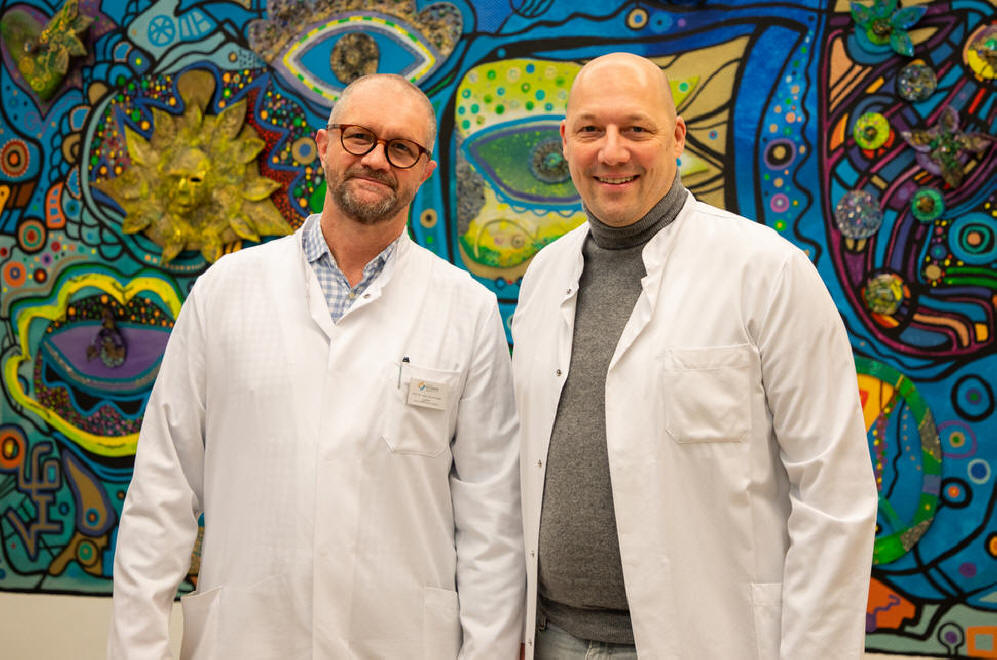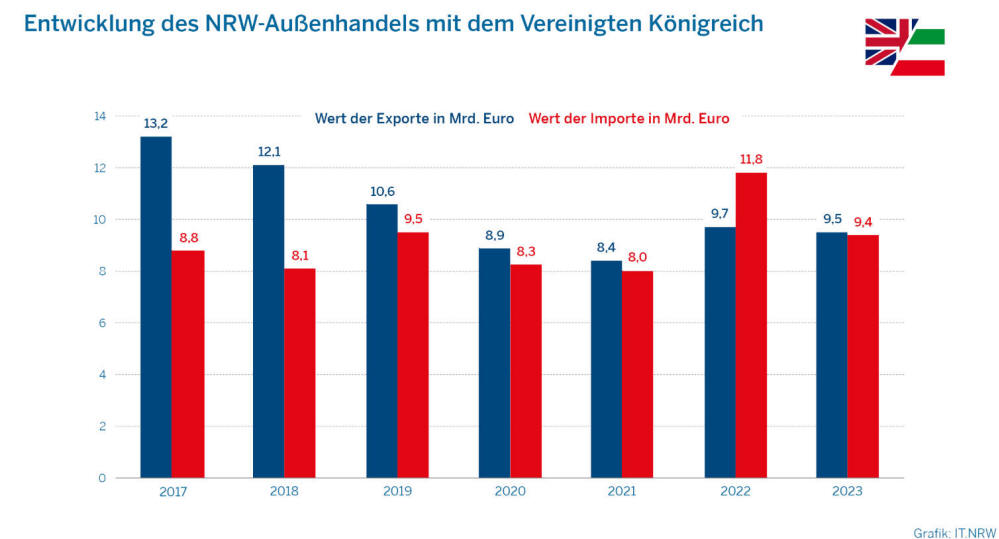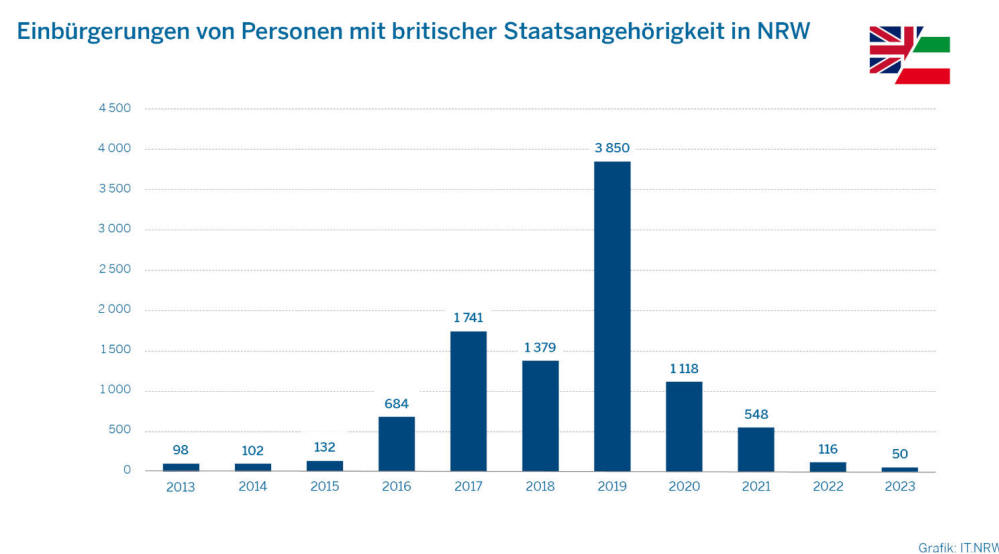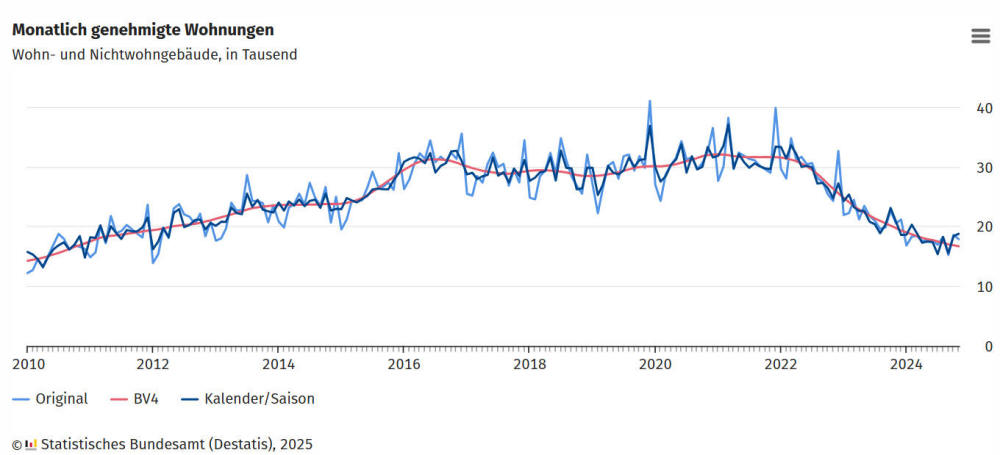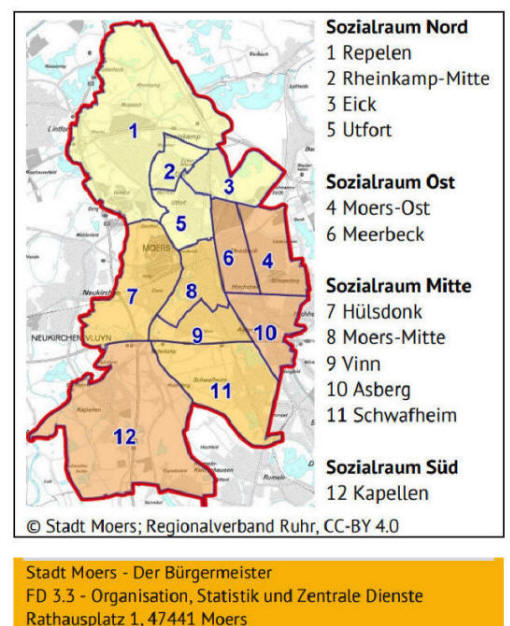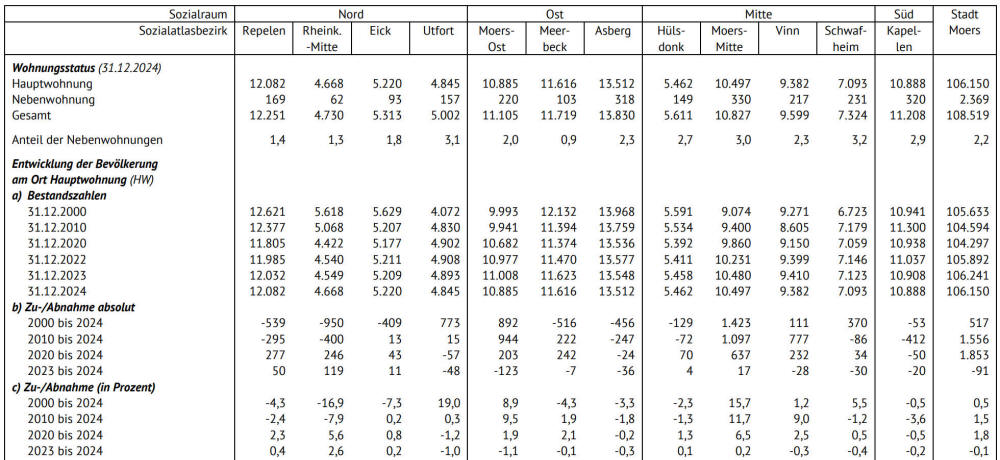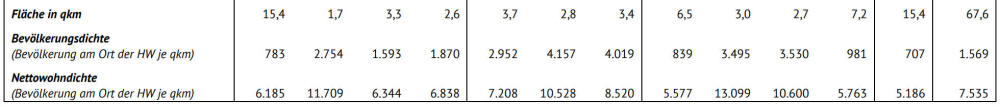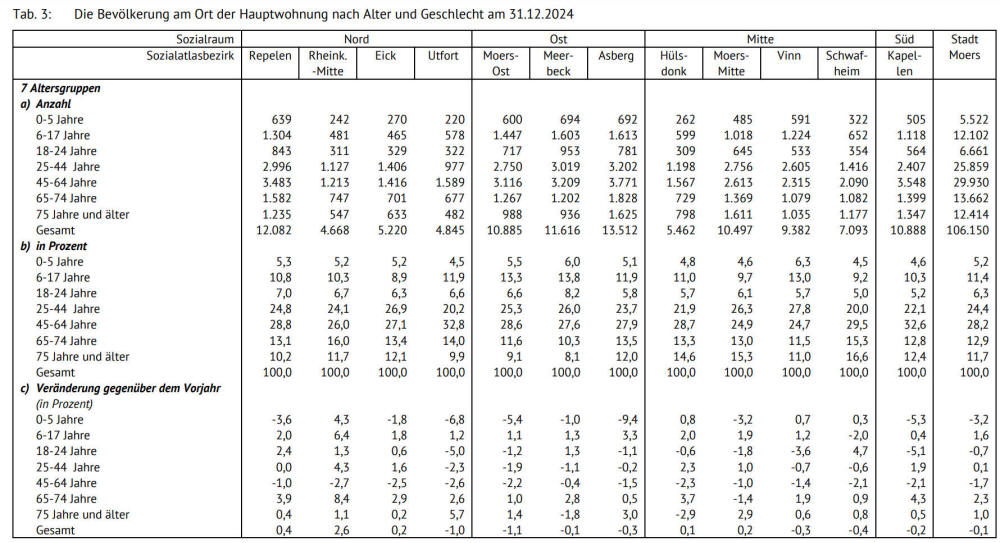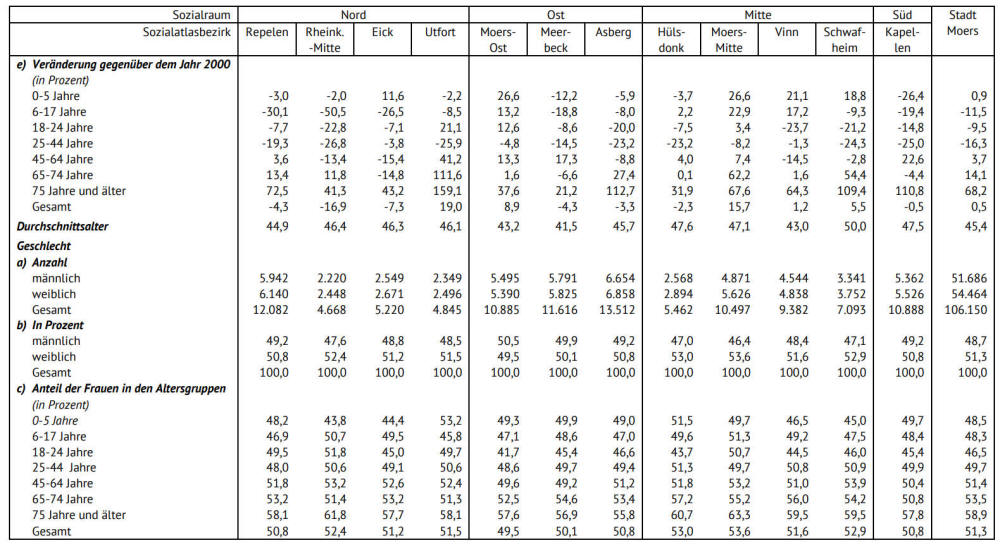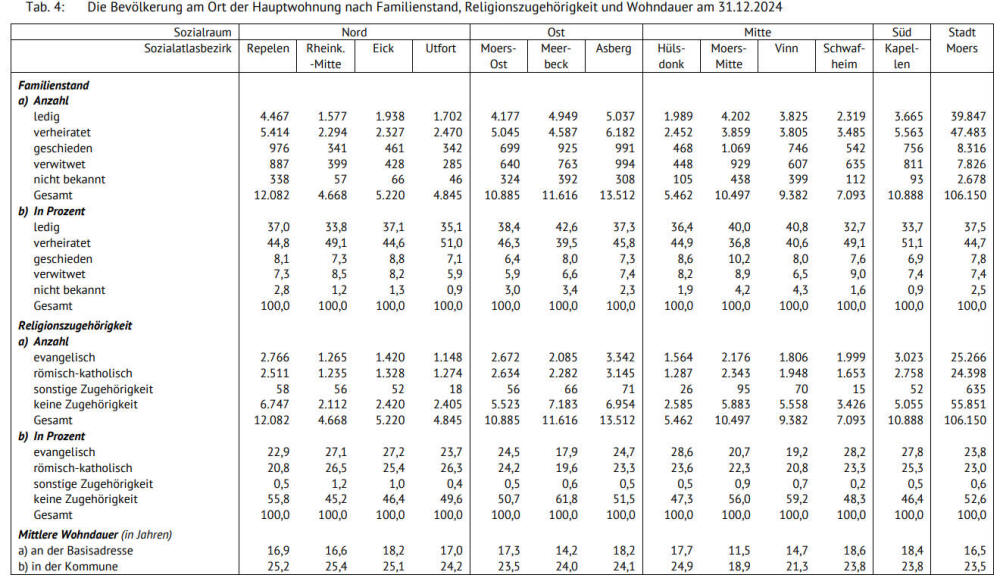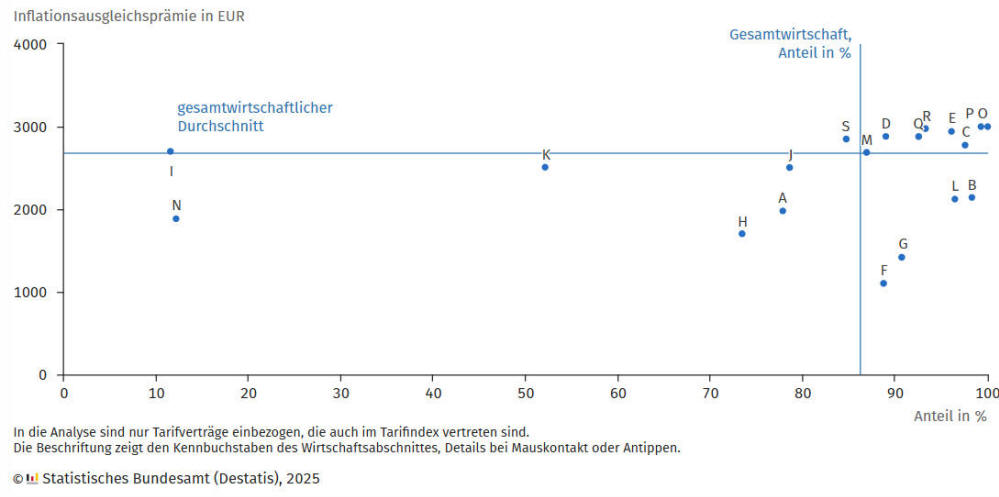|
Samstag, 25. Sonntag, 26. Januar 2025
Zugelassene Wahlvorschläge für die
Bundestagswahl am 23.02.2025 im Wahlkreis 112
Wesel I
Unter Vorsitz von
Kreiswahlleiter Dr. Lars Rentmeister hat der
Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am Freitag,
24. Januar 2025 folgende Wahlvorschläge für den
Wahlkreis 112 Wesel I (Alpen, Hamminkeln, Hünxe,
Kamp-Lintfort, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck,
Voerde, Wesel, Xanten) zugelassen:
|
Lfd. Nr. |
Familienname, Vorname, |
Partei |
|
|
Beruf |
|
|
1 |
Waldeck, Kevin |
SPD |
|
|
Dachdecker, Kamp-Lintfort |
|
|
2 |
van Beek, Sascha |
CDU |
|
|
Gesundheits- und Krankenpfleger,
Alpen |
|
|
3 |
Freckmann, Karl-Heinz |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
|
|
Diplom-Geograph, Wesel |
|
|
4 |
Reuther, Bernd |
FDP |
|
|
Bundestagsabgeordneter, Wesel |
|
|
5 |
Balten, Adam |
AfD |
|
|
Mechatronik-Ingenieur, Hamminkeln |
|
|
6 |
Bechert, Manuela |
DIE LINKE |
|
|
Journalistin, Rheinberg |
|
|
11 |
Döge, Rainer |
FREIE WÄHLER |
|
|
Projektleiter, Moers |
|
|
15 |
Dr. Heußen, Michael |
Bündnis Deutschland |
|
|
Geschäftsführer, Hünxe |
|
Hinweise: Die nicht fortlaufende
Nummerierung ergibt sich aus der Tatsache, dass
nicht alle Parteien, die Landeslisten
eingereicht haben, auch im Wahlkreis 112 Wesel I
Bewerber/innen benannt haben. Die Nummern der
nicht im Wahlkreis kandidierenden Parteien
entfallen daher – auch auf dem Stimmzettel. Der
Beschluss über die Zulassung der
Kreiswahlvorschläge steht unter dem Vorbehalt,
dass die Landesliste der einreichenden Partei
nach § 28 BWG durch den Landeswahlausschuss
ebenfalls zugelassen wird.
Bundestagswahl 2025: Landeswahlausschuss
lässt 18 Parteien zu
Der
nordrhein-westfälische Landeswahlausschuss hat
am 24. Januar 2025 über die Zulassung der
Landeslisten für das Land Nordrhein-Westfalen
zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025
entschieden.
„24 Parteien und politische
Vereinigungen hatten eine Landesliste für das
Land Nordrhein-Westfalen eingereicht. Davon
wurden 18 Landeslisten zugelassen,“ teilte
Landeswahlleiterin Monika Wißmann in Düsseldorf
mit. Die Landeslisten folgender Parteien wurden
zugelassen:
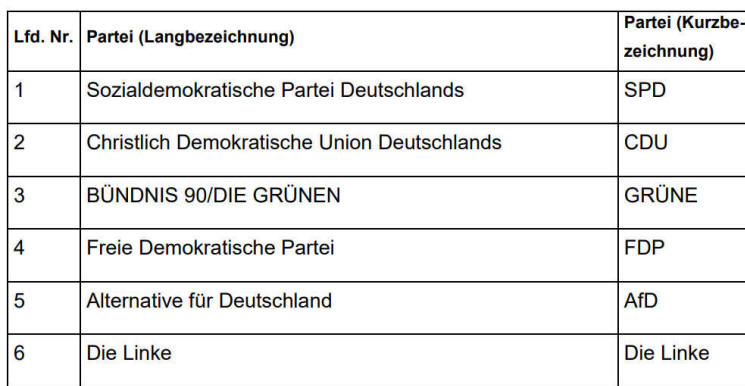
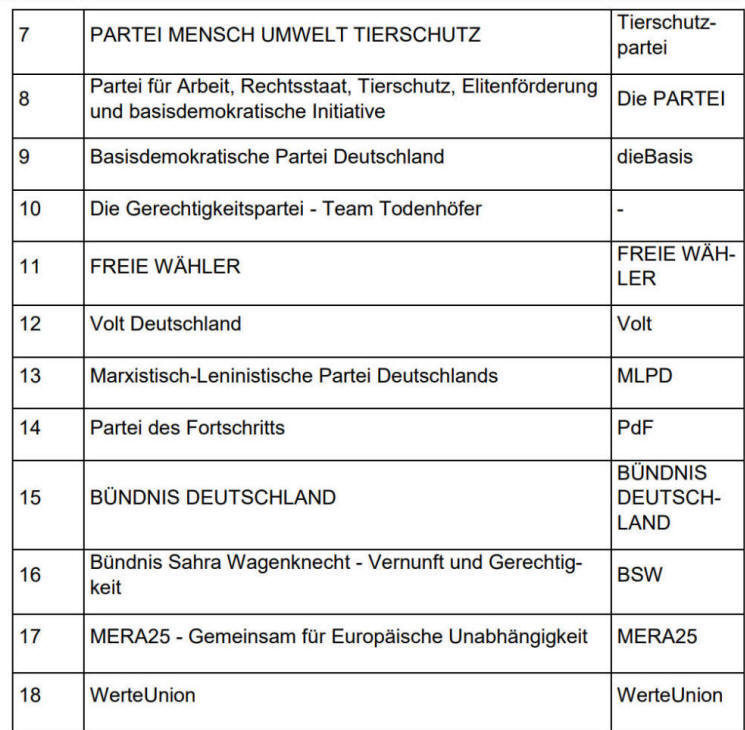
Zurückgewiesen hat der Landeswahlausschuss
die Listen folgender 6 Parteien bzw. politischer
Vereinigungen, da die wahlrechtlichen
Voraussetzungen nicht erfüllt waren:
Piratenpartei Deutschland - PIRATEN
Bündnis
C- Christen für Deutschland - Bündnis C
Ökologisch-Demokratische Partei - ÖDP
Partei der Humanisten - PdH
Ab
jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung -
Volksabstimmung
Demokratische Allianz für
Vielfalt und Aufbruch - DAVA
Gegen die
vollständige oder teilweise Nichtzulassung von
Landeslisten
kann bis zum 27. Januar 2025
Beschwerde an den Bundeswahlausschuss
eingelegt werden. In diesem Fall wird der
Bundeswahlausschuss am 30.
Januar 2025 in
Berlin abschließend entscheiden.
Ebenfalls am
30. Januar 2025 berät und beschließt der
nordrhein-westfälische Landeswahlausschuss über
Beschwerden, die gegen die
Zulassungsentscheidungen der Kreiswahlausschüsse
über Kreiswahlvorschläge eingelegt worden sind.
Diese Sitzung findet im Ministerium des Innern,
Friedrichstraße 62-80, 40217 Düsseldorf, statt.
Eröffnungskonzert des Kreises
Wesel begeistert Publikum: Mitreißende Klänge
zum Auftakt von 50 Jahre Kreis Wesel
Das Eröffnungskonzert zum 50-jährigen Jubiläum
des Kreises Wesel am 23. Januar 2025 war ein
voller Erfolg. Der Willibrordi-Dom in Wesel bot
die beeindruckende Kulisse für einen
musikalischen Abend, der die Vielfältigkeit und
den Gemeinschaftsgeist der Region
widerspiegelte.
Die über 350 Zuschauenden
erlebten ein abwechslungsreiches Programm, das
von lokalen Musikgruppen gestaltet wurde. In dem
etwa zweistündigen Konzert präsentierten die
"Lohberg Voices" aus Dinslaken, die
"Colorsounds" aus Wesel und die "Hedwigskapelle"
aus Hünxe musikalische Vielfalt von Pop-Songs
wie Angels von Robbie Williams über Musical-Hits
wie Nessaja (Tabaluga) bis hin zu Rock-Balladen
wie Dream on von Aerosmith. Dr. Lars
Rentmeister, Vorstandsmitglied der
Kreisverwaltung Wesel, führte durch das
Programm.

Landrat Ingo Brohl freute sich über den
gelungenen Auftakt und bedankte sich in seiner
Ansprache herzlich bei allen Beteiligten:
„Dieses Konzert war ein wunderbarer Start in
unser Jubiläumsjahr. Es hat gezeigt, wie
lebendig und verbunden die Menschen im Kreis
Wesel sind. Die Vielfalt der musikalischen
Beiträge steht sinnbildlich für die Stärke
unserer Region.“

Die "Lohberg Voices" sind ein Chor der
evangelischen Kirchengemeinde Dinslaken mit 20
Sängerinnen und Sängern, die unter der Leitung
von Rainer Stemmermann ein breites Repertoire
aus Jazz-, Gospel-, Pop- und Soul-Songs
erarbeiten. Der Chor feierte im Jahr 2024 sein
40-jähriges Bestehen.

Die "Hedwigskapelle" aus der Kirchengemeinde
St. Albertus Magnus in Hünxe begleitet seit 10
Jahren Familiengottesdienste mit neuem
geistlichen Liedgut. Die musikalische Leitung
liegt in den Händen von Tobias Terhardt. Der
Chor "Colorsounds", ehemals "Gospel People St.
Antonius", entstand 1992 und begeistert heute
mit über 40 Stimmen sowie einer sechsköpfigen
Band unter der Leitung von Stephan Marten und
Jan Marten. Ihr Programm verbindet schwungvolle
Musik mit Choreographie-Elementen.

Das Eröffnungskonzert markiert den Beginn
eines vielfältigen Festprogramms, das die
Kreisverwaltung Wesel für das Jahr 2025
organisiert hat. Die Kreisverwaltung wird über
Social Media, Pressemitteilungen und ihre
Website www.kreis-wesel.de regelmäßig über
aktuelle Veranstaltungen informieren.

Der Kreis Wesel bedankt sich bei allen
Mitwirkenden, Partnern und Gästen, die diesen
Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht
haben, und freut sich auf viele weitere
Begegnungen im Jubiläumsjahr!
Neue Regeln zum Gefahrstoff Asbest - wichtig
für Menschen mit älterem Haus
Die
neue Gefahrstoffverordnung stärkt den Schutz vor
den Gesundheitsgefahren durch Asbest – einem
Baustoff, der trotz Verbot seit 1993 noch in
vielen älteren Gebäuden in Putzen,
Fliesenklebern und Dämmstoffen steckt. Der
Verband Wohneigentum begrüßt die neuen Regeln
als praxisnahe Umsetzung im Sinne der
selbstnutzenden Wohneigentümer und klärt auf
über wichtige Details.
Strengere
Regeln für Bauarbeiten an älteren Häusern
Die
neue Gefahrstoffverordnung bringt vor allem
wichtige Anpassungen für Bau-Unternehmen, die
mit Gefahrstoffen arbeiten. Betriebe sind nun in
der Pflicht, vor Baumaßnahmen Erkundungen
anzustellen, wenn sie dies für angebracht
halten. Ein zentraler Punkt ist das sogenannte
„Ampel-Modell“, das Risiken beispielsweise bei
der Sanierung einer Bestandsimmobilie einstuft
und entsprechende Schutzmaßnahmen je nach Umfang
der Asbestbelastung vorgibt.
•
Neu ist auch die
Informationspflicht für Hauseigentümer: Bevor
Arbeiten starten, müssen sie dem ausführenden
Unternehmen das Alter der Immobilie und Hinweise
auf Schadstoffe, insbesondere Asbest, im Gebäude
(soweit bekannt) schriftlich oder elektronisch
mitteilen.
•
Neu:
Informationspflicht für Hauseigentümer Nach
Auskunft der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) sind die Informationen
„in einem zumutbaren Aufwand“ zu beschaffen:
„D.h. sollten sie nicht nach Sichtung der
vorhandenen Auftrags- oder Bauunterlagen
vorliegen, muss der Veranlasser durchaus beim
zuständigen Bauamt anfragen, aber nicht bei
sämtlichen Voreigentümern oder jemals an dem
Objekt arbeitenden Unternehmen.“
•
Bei Immobilien, die
vor 1993 oder nach 1996 gebaut wurden, reicht
die Angabe des Baujahrs aus. Wenn ein Haus aber
zwischen 1993 und 1996 gebaut wurde, verlangt
der Gesetzgeber, dass Wohneigentümer den
ausführenden Betrieben möglichst das genaue
Datum des Baubeginns mitteilen. Für Käufer von
Immobilien sind in der GefStoffV keine
besonderen Verpflichtungen benannt.
Verband Wohneigentum: „Keine zusätzlichen Lasten
für Eigentümer!“
Peter Wegner, Präsident des
Verbands Wohneigentum, begrüßt die neue Regelung
als wichtigen Schritt zum Schutz von Handwerkern
und Verbrauchern, betont jedoch: „Es ist
richtig, dass die ursprünglich geplante
Verpflichtung zur Asbest-Erkundung für
Hauseigentümer gestrichen wurde. Diese hätte
kleine Eigentümer unverhältnismäßig belastet und
die dringend benötigte Sanierungswelle
behindert.“
Wegner mahnt, dass
weitere Änderungen der Verordnung die Interessen
von Wohneigentümer*innen nicht aus den Augen
verlieren dürfen. „Die Verantwortung für die
Asbest-Katastrophe liegt bei der Politik und der
Industrie, nicht bei den Menschen, die in
Bestandsimmobilien leben.“
Vorsicht
statt Nachlässigkeit
Trotz des Verzichts auf
eine Erkundungspflicht sollten Eigentümer und
Eigentümerinnen verantwortungsbewusst handeln.
„Etwa ein Viertel aller vor 1993 gebauten
Gebäude enthält Asbest,“ erklärt Friederike
Hollmann, Bauberaterin im Verband Wohneigentum.
Betroffen sind oft Produkte aus Faserzement,
Heizungsrohre, Nachtspeicheröfen und
Bodenbeläge.
•
„Bei Verdacht auf
Asbest gilt: Finger weg!“ so Hollmann weiter.
„Fachbetriebe sollten hinzugezogen werden, die
Proben entnehmen und im Labor untersuchen, bevor
eine eventuelle Sanierung erfolgt. Die
Entsorgung von Asbest ist teuer und darf nur von
speziell zertifizierten Unternehmen (z.B. TÜV
oder DEKRA) durchgeführt werden, da der Umgang
mit dem Material hohe Sicherheitsanforderungen
erfordert.“
•
Finanzielle
Unterstützung nutzen
Die Sanierung und
Entsorgung asbesthaltiger Materialien ist
aufwendig und kostenintensiv. Ein Lichtblick:
Unter bestimmten Bedingungen können Eigentümer
die Kosten steuerlich als außergewöhnliche
Belastung geltend machen, wenn die Belastung
durch einen Sachverständigen bestätigt wird.
Kleve: Wasserburgallee vom 27.01. bis 31.01.
tagsüber voll gesperrt
Normalerweise
sind Platanen hervorragende Stadtbäume: Sie sind
äußerst hitze- und schnittverträglich,
stadtklimafest, spenden durch ihre ausladende
Krone viel Schatten und prägen das Stadtbild. In
jüngerer Vergangenheit leiden jedoch auch diese
grundsätzlich genügsamen Bäume zunehmend unter
dem Klimawandel. Langanhaltende Trockenperioden
bei gleichzeitig hohen Temperaturen machen
Platanen anfällig für den Massaria-Erreger.
Ein Pilz, der zu rascher Totholzbildung
in schwachwüchsigen, aber auch in Starkästen
führt. In der Folge ist die Standsicherheit der
Platane gefährdet, Äste trocknen ab, fallen zu
Boden und stellen eine Gefahr für den Verkehr
dar.
Aufgrund routinemäßiger Massariakontrollen
an den Platanen entlang der Wasserburgallee muss
die Straße zwischen den Einmündungen Landwehr
und Tiergartenstraße im Zeitraum von Montag, 27.
Januar 2025, bis Freitag, 31. Januar 2025,
tagsüber gesperrt werden.

Um die Auswirkungen auf den Straßenverkehr
so gering wie möglich zu halten, wird die
Sperrung jeweils nur während der tatsächlichen
Arbeitszeit von 07:00 bis 17:00 Uhr
eingerichtet. Anlieger werden ihre Grundstücke
weiterhin erreichen können. Für zu Fuß gehende
und Radfahrende bleibt die Wasserburgallee auch
während der Arbeitszeit nutzbar. Umleitungen
werden für die Zeit der Arbeiten über die
Tiergartenstraße, den Klever Ring und die
Landwehr ausgeschildert.
Neu_Meerbeck: Projekt von
Kindern für Kinder -Lesen ist ein großes Wunder!
Vom 8. November bis 13. Dezember
2024 haben die jungen Teilnehmenden an einem
einzigartigen Lese- und Vorleseprojekt
teilgenommen, das im Stadtteil Meerbeck ins
Leben gerufen wurde: Kinder fördern das Lesen
bei anderen Kindern.

Mit strahlenden Gesichtern und einem Stapel
frisch gelernter Fähigkeiten haben 16 Kinder im
Alter von acht bis zwölf Jahren ihre Ausbildung
zu Lesecoaches erfolgreich abgeschlossen (Foto
1: Präventionsnetzwerk Neu_Meerbeck).
Es ist nicht nur ein positives Zeichen für
das Engagement der Ehrenamtlichen in Meerbeck,
sondern auch eine Antwort auf die
besorgniserregenden Entwicklungen in der
Lesekompetenz von Kindern. Studien aus den
letzten Jahren zeigen, dass die Lesefähigkeiten
vieler Kinder abnehmen.
Vernetzte
Gemeinschaft nötig
Um diesem Trend
entgegenzuwirken, hat Ayse Sarikaya
(Koordinatorin des Präventionsnetzwerks
Neu_Meerbeck) über Initialprojekte 2024 aus
Mitteln des Landschaftsverbandes Rheinland ein
Konzept entwickelt. Die Ausbildung der
Lesecoaches fand in sechs Modulen statt, in
denen die Kinder nicht nur Lesetechniken
erlernten, sondern besonders in ihrer
sozial-emotionalen Bildung gefördert wurden.
„Damit Neugier und Lust zum Lesen
erweckt wird, brauchen wir eine vernetzte
Gemeinschaft. Wir möchten etablierte Netzwerke
und Leseförderungsinitiativen festigen, neue
Partnerschaften gründen sowie Menschen und
Institutionen aus allen gesellschaftlichen
Bereichen zusammenbringen“, erläutert Ayse
Sarikaya. Beteiligt sind das Stadtteilbüro
Neu_Meerbeck, das Spielhaus Pumpenhaus, der IKM,
das Bürgerhaus Meerbeck und der Internationale
Kulturkreis Moers e.V.
Lesen stärkt
auch Selbstbewusstsein und soziale Fähigkeiten
Die Beteiligten haben ein Programmheft für
die Schulung der Lesepaten entwickelt und einen
Lesekoffer mit Materialien, wie Projektor,
Kamishibai (Papiertheater) und Klangschale,
zusammengestellt. Das Programmheft enthält nicht
nur eine detaillierte Übersicht der
Ausbildungsinhalte, sondern zeigt auch Übungen
für Persönlichkeitsentwicklung und kreatives
Schaffen auf.
Zwei engagierte
Mitarbeiterinnen aus dem Stadtteil, Katja
Hülsbusch-Wilms und Neslihan Mintas,
unterstützten die Kinder sowohl während der
Ausbildungsphase als auch in der Vorlesephase.
Die Teilnehmenden erlebten eine Vielzahl von
Übungen und Spielen, die ihre Konzentration,
Achtsamkeit, Kooperationsfähigkeit,
Kommunikation und Teamarbeit stärkten.
„Ich fühle mich stark und kann mich auf mich
verlassen“, teilte die 12-jährige Marie
begeistert mit. Auch die Rückmeldungen der
Eltern sind durchweg positiv: Viele bedanken
sich für die Möglichkeit, an diesem besonderen
Kurs teilzunehmen, der nicht nur die
Lesekompetenz ihrer Kinder fördert, sondern auch
deren Selbstbewusstsein und soziale Fähigkeiten
stärkt.
Lesen ist nicht nur eine
Schlüsselkompetenz, sondern auch ein großes
Wunder, das es zu entdecken gilt, so das Fazit
der Beteiligten. Weitere Informationen zum
Projekt gibt es bei Ayse Sarikaya
(Präventionsnetzwerk Neu_Meerbeck) per Mail ayse.sarikaya@moers.de oder
telefonisch unter 0 28 41 / 201-297.
Wesel: Jahresempfang der
Gefahrenabwehrkräfte im Kreishaus
Am Mittwoch, 22. Januar 2025, begrüßte Landrat
Ingo Brohl die Gefahrenabwehrkräfte des Kreises
Wesel zum traditionellen Jahresempfang im
Weseler Kreishaus. Etwa 80 Gäste folgten der
Einladung, um das Engagement von Feuerwehr,
Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk (THW) und
weiteren Hilfsorganisationen zu würdigen.

„Es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie
heute hier willkommen zu heißen“, betonte
Landrat Brohl in seiner Eröffnungsrede. „Dieser
Abend gibt uns Gelegenheit, innezuhalten und
Ihnen für Ihre Arbeit und Ihren Einsatz für die
Gemeinschaft zu danken.“
Besonders die
Herausforderungen der
Fußball-Europameisterschaft 2024 hätten erneut
die Bedeutung einer gut organisierten
Gefahrenabwehr gezeigt. Dank des professionellen
Einsatzes der Kräfte leistete der Kreis Wesel
einen wichtigen Beitrag zu einem sicheren
Turnierverlauf. Ein weiteres Beispiel für die
erfolgreiche Zusammenarbeit war die Schließung
des Altenheims Am Kattewall in Rheinberg zum 1.
September 2024.
Der Malteser
Hilfsdienst und die Caritas betreuten die
Bewohner in enger Kooperation mit der
Kreisverwaltung. Landrat Brohl lobte die
Kameradschaft und das Verantwortungsbewusstsein
der Einsatzkräfte: „Sie stellen den Menschen in
den Mittelpunkt Ihres Handelns. Diese
Kameradschaft verbindet und stärkt uns in
schwierigen Momenten.“
Besonderer
Dank galt auch den Notfallseelsorge- und
Einsatznachsorgeteams sowie den Familien der
Einsatzkräfte, deren Rückhalt dieses Engagement
erst möglich mache. Ein Höhepunkt des Abends war
die Verabschiedung von Bodo Witzler, der bald in
den Ruhestand eintritt. Witzler begann 1989
seine Ausbildung beim Kreis Wesel, war zunächst
im Fachbereich Straßenverkehr tätig und übernahm
ab 2010 eine zentrale Rolle im
Katastrophenschutz.

Bodo Witzler und Landrat Ingo Brohl
Seit
2019 war er als Koordinator für den
Katastrophenschutz verantwortlich. Landrat Brohl
würdigte ihn mit einer Kreisgrafik und lobte
sein Engagement: „Bodo Witzler hat die
Gefahrenabwehr im Kreis Wesel entscheidend
mitgestaltet und nachhaltig geprägt.“
Grüne Woche: Tolles
Feedback für den Niederrhein
Die
erste NRW-Partnerregion stößt auf großes
Besucherinteresse in Berlin.
„Der Auftritt
des Niederrhein in Berlin ist – wie erwartet –
ein schöner Erfolg für die Agrar- und
Tourismuswirtschaft.“ Dieses Fazit hat Ingo
Brohl, Landrat des Kreises Wesel, nach den
ersten Tagen der Grünen Woche in Berlin gezogen.
Erstmalig ist das Land
Nordrhein-Westfalen mit einer ausgewählten
Partnerregion vertreten. Für die Premiere war
der Niederrhein ausgewählt worden. Am
Eröffnungsabend in der NRW-Halle konnten
Ministerpräsident Henrik Wüst und Silke Gorißen,
Ministerin für Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, insgesamt mehr als 100
Aussteller begrüßen, die hochwertige und
regional erzeugte Lebensmittel präsentierten –
viele davon vom Niederrhein.
Groß ist
das das Interesse an den Ständen. „Das Thema
Radfahren ist besonders gefragt. Aber auch die
Produkte, die am Niederrhein angebaut werden,
ziehen Besucher zu den Anbietern des
Niederrheins“, freut sich Nina Jörgens. Die
Prokuristin vertritt die Niederrhein Tourismus
GmbH an der Spree.
Zusammen mit den
LEADER-Regionen des Niederrheins sowie den
Vereinen „Genussregion Niederrhein e.V.“ und
„Agrobusiness Niederrhein e.V.“ präsentiert man
sich als Partnerregion. Unterstützung erfolgt
durch die Stadt Xanten, die Gemeinde Schermbeck,
den Naturpark Hohe Mark, den Naturpark
Schwalm-Nette und die WFG Kreis Viersen.
„Der Niederrhein beweist in Berlin einmal mehr,
dass er als durch und durch sympathische und
attraktive Region punkten kann“, so Christoph
Gerwers, Landrat des Kreises Kleve. Davon können
sich die Besucherinnen und Besucher der Grünen
Woche noch bis zum 26. Januar überzeugen.

Freuten sich über die Resonanz des Publikums
(v.l.): Nina Jörgens (Niederrhein Tourismus),
Pauline Becker (TIX, Touristeninformation
Xanten), Silke Gorißen, Ministerin für
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen, und Ingo Brohl, Landrat
Kreis Wesel und Aufsichtsratsvorsitzender von
Niederrhein Tourismus. Foto: Thomas Michaelis
Grüne Woche 2025 startet mit
Partnerregion Niederrhein und Bier
Die Nordrhein-Westfalenhalle der Grünen Woche
2025 stand zum Messeauftakt ganz im Zeichen des
Niederrheins, der als erstes Partnerland aus
Nordrhein-Westfalen präsentiert wurde. Die
Niederrhein-Delegation, bestehend aus
Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern und
Landräten, nutzte die Gelegenheit, sich mit
Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen
auszutauschen.
Im Mittelpunkt des
Gesprächs standen Fördermöglichkeiten für den
ländlichen Raum. Landrat Ingo Brohl betonte
dabei: „Der Niederrhein ist eine dynamische
Region, die von der Stärke der Landwirtschaft
und der gesamten landwirtschaftlichen
Wertschöpfungskette massiv profitiert und
geprägt ist. Diese Struktur zu erhalten und
auszubauen ist auch für den Erhalt der
einmaligen niederrheinischen Kulturlandschaft
wichtig. Diese ist, zusammen mit der Vielfalt,
einzigartigen Naturerlebnissen und dem Genuss in
unserer Region, Basis für den wachsenden
Niederrheintourismus.
Der
Niederrhein ist bei seinem Weg aber auch auf
Unterstützung durch Bund und Land angewiesen.
Insofern war die Tatsache, dass der Niederrhein
die erste Partnerregion in der NRW-Halle war,
Anerkennung unseres bisherigen, gemeinsamen
Engagements, eine exorbitant gute Plattform für
unsere niederrheinischen Unternehmen und auch
das Signal, dass das Land weiß, welchen Wert der
Niederrhein und seine Landwirtschaft für ganz
NRW hat.“
Im Anschluss bereiteten
die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des
Kreises Wesel in einer Kochshow auf der
NRW-Bühne die traditionelle niederrheinische
Spezialität Panhas zu. Die kross gebratenen
Panhas-Scheiben, serviert auf geschmorten Äpfeln
mit Rübenkraut, stießen nicht nur bei den
Anwesenden auf Begeisterung – viele bezeichneten
das Gericht als ihre persönliche regionale
Lieblingsspeise. Doch auch andere kulinarische
Highlights aus der Region wurden vorgestellt.

Foto Thomas Michaelis
Die
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nutzten die
Gelegenheit, auf weitere touristische
Attraktionen am Niederrhein hinzuweisen, die die
große touristische Vielfalt der Region
widerspiegeln. „Der Niederrhein ist immer eine
Reise wert“, so der einheitliche Tenor. Die
Delegation plant, den Austausch zu Themen des
ländlichen Raums weiter zu intensivieren und das
Netzwerk zu erweitern.
Parallel dazu
bot der Stand der Genussregion Niederrhein
Einblicke in nachhaltige und genussvolle
Projekte. Im Fokus standen drei Unternehmen, die
innovative Bierprodukte präsentierten. So
verfeinerte die Familie Mölders vom Büffelhof
Kragemann aus Bocholt ihren Büffelkäse mit Bier
und erzählte spannende Hofgeschichten.
Walterbräu aus Wesel stellte mit dem
Chevalier-Bier ein Produkt vor, das durch den
Anbau einer alten Braugerste zum
Grundwasserschutz beiträgt.
Besonders bemerkenswert war die Geschichte
hinter dem Malzbier der Hamminkelner
Feldschlösschen Brauerei. Helmut Ebbert
berichtete von der Entwicklung eines
kalorienarmen Malzbieres, das auch für
Diabetiker geeignet ist – eine Innovation, die
von der Familie Kloppert nach der Erkrankung von
Wilhelm Kloppert Senior ins Leben gerufen wurde.
Bei Blindverkostungen können mehr als 80 Prozent
der Teilnehmenden keinen Unterschied zum
klassischen Malzbier feststellen.
Die Genussregion Niederrhein präsentiert sich
noch bis zum kommenden Sonntag mit wechselnden
Produzenten und Projekten gemeinsam mit
Agrobusiness Niederrhein, Niederrhein Tourismus
und den niederrheinischen LEADER-Regionen. Der
gesamte Auftritt der über 100 Aussteller aus NRW
wird vom Ministerium für Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
koordiniert und vom Landesamt für Natur, Umwelt,
Klima und Verbraucherschutz umgesetzt.
Wesel:
Raumverträglichkeitsprüfung für die geplanten
Offshore-Netzanbindungssysteme der "Windader
West" - Teilstück NRW
Die
Regionalplanungsbehörden bei den
Bezirksregierungen Düsseldorf, Köln, Münster
sowie beim Regionalverband Ruhr haben unter
Federführung der Bezirksregierung Düsseldorf die
Raumverträglichkeitsprüfung für die geplanten
Offshore-Netzanbindungssysteme der „Windader
West“ – Teilstück NRW mit Übermittlung der
Gutachterlichen Stellungnahme nach § 15 Absatz 1
Satz 4 ROG an die Vorhabenträgerin (Amprion
Offshore GmbH) am 13. Dezember 2024
abgeschlossen. Die Gutachterliche
Stellungnahme einschließlich ihrer Begründung
wird für die Dauer von fünf Jahren an folgender
Stelle während der Dienstzeiten zur Einsicht
bereitgehalten:
Stadt Wesel Team 13 –
Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung
Klever-Tor-Platz 1 46483 Wesel Sie kann auch
über die nachfolgende Internetseite der
Bezirksregierung Düsseldorf eingesehen und
heruntergeladen werde: https://url.nrw/windaderwest
Wesel: Künstliche Kühe und
regionale Produkte – Bürgermeisterin Ulrike
Westkamp auf der Internationalen Grünen Woche in
Berlin
Da staunte
Bürgermeisterin Ulrike Westkamp nicht schlecht
als sie die künstlichen Kühe auf dem
Messegelände in Berlin sah. „Das nenne ich
kreativ“, lobte die Bürgermeisterin die
alternativen Kühe aus Kunststoff.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (4. v. r.)
zusammen mit Amtskollegen und der Ministerin für
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen, Silke Gorißen (Mitte), auf
der Internationalen Grünen Woche in Berlin.
Foto: Thomas Michaelis
Wegen der
Maul- und Klauenseuche dürfen in diesem Jahr
keine lebenden Rinder auf der Internationalen
Grünen Woche in Berlin gezeigt werden. Gemeinsam
mit einer Delegation des LEADER-Regionen, unter
anderem der Landrat des Kreises Wesel Ingo
Brohl, besuchte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp
die bedeutende Landwirtschafts- und
Nahrungsmittelmesse in Berlin. Die
niederrheinischen LEADER-Regionen werben
gemeinsam für den Niederrhein als touristischen
Anlaufpunkt. Gerade der Niederrhein bietet mit
seiner eindrucksvollen, naturbelassenen
Landschaft einen optimalen Erholungsraum.
Bürgermeisterin Ulrike Westkamp betont,
dass die Region vor allem mit ihren qualitativ
hochwertigen Lebensmitteln auf sich aufmerksam
macht. Die Städte und Gemeinden der
LEADER-Region erhöhen mit ihrer Präsenz auf der
internationalen Messe den Bekanntheitsgrad des
Niederrheins. Dadurch wird der heimische
Tourismus gestärkt und weiter angekurbelt. Zudem
können durch den Austausch mit Ministerien und
Vertretern anderer Regionen wichtige Kontakte
für zukünftige Projekte geknüpft werden.
Bethanien: Selbsthilfegruppe
„Lungenkrebs Netzwerk Krefeld/Moers“ startet ab
Februar 2025 - Austausch, Information und
Beisammensein – von Betroffenen für Betroffene
Ab dem 12. Februar 2025 startet ein
neues kostenloses Angebot im Krankenhaus
Bethanien Moers: Die Selbsthilfegruppe
„Lungenkrebs Netzwerk Krefeld/Moers“ von der
ebenfalls von Lungenkrebs betroffenen
Initiatorin Eva Leroy trifft sich fortan an
jedem zweiten Mittwoch im Monat von 14 bis 16
Uhr in der Cafeteria des Krankenhauses Bethanien
Moers (Bethanienstraße 21, 47441 Moers), um sich
bei Kaffee und Kuchen auszutauschen, gegenseitig
Mut zu machen und zu unterstützen.
An
Lungenkrebs erkrankte Patient:innen aus Moers
und Umgebung sind hierzu herzlich eingeladen,
genauso wie betroffene An- und Zugehörige.
„Neben dem Austausch der Betroffenen
untereinander, werden auch ich und meine
Kolleginnen aus der Psychoonkologie hin und
wieder an den Treffen teilnehmen, Fragen
beantworten und ein offenes Ohr schenken“,
erklärt Dr. Kato Kambartel, Ärztlicher
Koordinator des Lungenkrebszentrums Bethanien
und Lungenfacharzt.
„Denn es ist keine
Frage, dass die Behandlungsmöglichkeiten von
Lungenkrebs im Laufe der Jahre viel besser
geworden sind – immer mehr ist möglich, um den
Patientinnen und Patienten zu helfen.
Nichtsdestotrotz ist es eine ernsthafte
Erkrankung und der Umgang mit ihr nicht immer
einfach. Es hilft ungemein zu sehen, wie andere
Betroffene die Situation bewältigen und sich
gemeinsam in der Gruppe zu ermutigen und
füreinander da zu sein“, so der erfahrene
Mediziner.
„Es gibt sehr wenige
Selbsthilfegruppen für Lungenkrebserkrankte.
Umso schöner ist es, dass ich mein Angebot
erweitern und nun einen zusätzlichen Anlaufpunkt
in Moers schaffen kann mit dem Lungenkrebs
Netzwerk Krefeld/Moers“, beschreibt Eva Leroy
ihr Engagement.
Eine Anmeldung zu den
Treffen der Selbsthilfegruppe ist nicht
notwendig. „Wir freuen uns über jede und jeden,
die bzw. der den Weg zu uns findet“, so die
Veranstalter:innen.

Eva Leroy, Initiatorin der Selbsthilfegruppe,
und Dr. Kato Kambartel, Ärztlicher Koordinator
des Lungenkrebszentrums Bethanien, freuen sich,
Betroffenen mit dem Lungenkrebs Netzwerk
Krefeld/Moers eine Anlaufstelle für Austausch zu
bieten.

Bevölkerung im Jahr 2024 um 100 000 Menschen
gewachsen
• Fast 83,6 Millionen Menschen lebten zum
Jahresende 2024 in Deutschland
•
Nettozuwanderung gegenüber 2023 um mehr als ein
Drittel zurückgegangen
• Zahl der
Sterbefälle übersteigt Zahl der Geburten
deutlich: Geburtendefizit im dritten Jahr in
Folge größer als 300 000 Personen
Zum
Jahresende 2024 lebten fast 83,6 Millionen
Menschen in Deutschland. Nach einer ersten
Schätzung des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) wuchs die Bevölkerung Deutschlands
damit um knapp 100 000 Menschen gegenüber dem
Jahresende 2023. Auch im Jahr 2024 war die
Nettozuwanderung die alleinige Ursache des
Bevölkerungswachstums.

Wie in allen Jahren seit der deutschen
Vereinigung fiel die Bilanz der Geburten und
Sterbefälle 2024 negativ aus, da erneut mehr
Menschen starben als geboren wurden. Im Jahr
2023 war die Bevölkerung aufgrund der deutlich
höheren Nettozuwanderung noch um knapp 340 000
Personen gewachsen.
Diese Angaben
beruhen auf der Fortschreibung des
Bevölkerungsbestands auf Basis des aktuellen
Zensus 2022. Infolge des Zensus 2022 wurde die
Bevölkerungszahl zum Stichtag 15. Mai 2022 um
etwa 1,3 Millionen Personen von 84,0 Millionen
(Ergebnis auf Basis des vorherigen Zensus 2011)
auf 82,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner
(neues Ergebnis auf Basis des Zensus 2022)
angepasst.
Zahl der Geburten und
Sterbefälle leicht gesunken – weiterhin hohes
Geburtendefizit Sowohl die Zahl der Geburten als
auch die Zahl der Sterbefälle ging 2024
gegenüber dem Vorjahr um etwa 2,5 % zurück.
Ausgehend von den bereits vorliegenden Meldungen
der Standesämter ist für 2024 mit 670 000 bis
690 000 Geborenen zu rechnen (2023: 692 989).
Die Zahl der Gestorbenen betrug rund
1,00 Millionen (2023: 1,03 Millionen; zur Zahl
der Sterbefälle 2024 siehe Pressemitteilung
Nr. 017 vom 14. Januar 2025). Daraus ergibt
sich für 2024 ein Geburtendefizit (Differenz
zwischen Geburten und Sterbefällen) von 310 000
bis 330 000. Damit war das Geburtendefizit
bereits im dritten Jahr in Folge größer als 300
000 Personen. Im Jahr 2023 hatte es bei 335 217
gelegen und einen neuen Höchststand erreicht.
Zum Vergleich: Von 1991 bis 2021
hatte Deutschland ein durchschnittliches
jährliches Geburtendefizit von 137 380 Personen.
Nettozuwanderung mindestens 34 % niedriger als
im Vorjahr Die Nettozuwanderung (Saldo
aus Zu- und Fortzügen über die Grenzen
Deutschlands) wird für 2024 auf 400 000 bis
440 000 Personen geschätzt.
Sie sank
damit 2024 gegenüber dem Jahr 2023
(662 964 Personen) um mindestens 34 % und
bewegte sich auf dem Niveau der Jahre 2016 bis
2019 (durchschnittlich 410 000 Personen). Nach
vorläufigen Angaben geht diese Entwicklung auf
eine geringere Nettozuwanderung vor allem aus
Syrien, Afghanistan, der Türkei sowie aus
Staaten der Europäischen Union zurück.
Zuwachs beim Gesundheitspersonal
schwächt sich ab
• Stärkerer
Zuwachs beim Gesundheitspersonal vor der
Pandemie (2015 - 2019) als zwischen 2019 und
2023
• Anstieg des Gesundheitspersonals im
Jahr 2023 um 0,5 %
• Beschäftigungszuwachs
in Pharmazeutischer Industrie und
Gesundheitsschutz stärker als vor der Pandemie
Zum Jahresende 2023 arbeiteten knapp 6,1
Millionen Personen im Gesundheitswesen. Dies
waren 27 000 oder 0,5 % mehr als im Vorjahr. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, ist das Gesundheitspersonal zwischen
den Jahren 2019 und 2023 um 5,3 % gestiegen. Im
Vergleichszeitraum vor der Pandemie zwischen
2015 und 2019 war der Zuwachs des
Gesundheitspersonals mit 6,9 % höher.
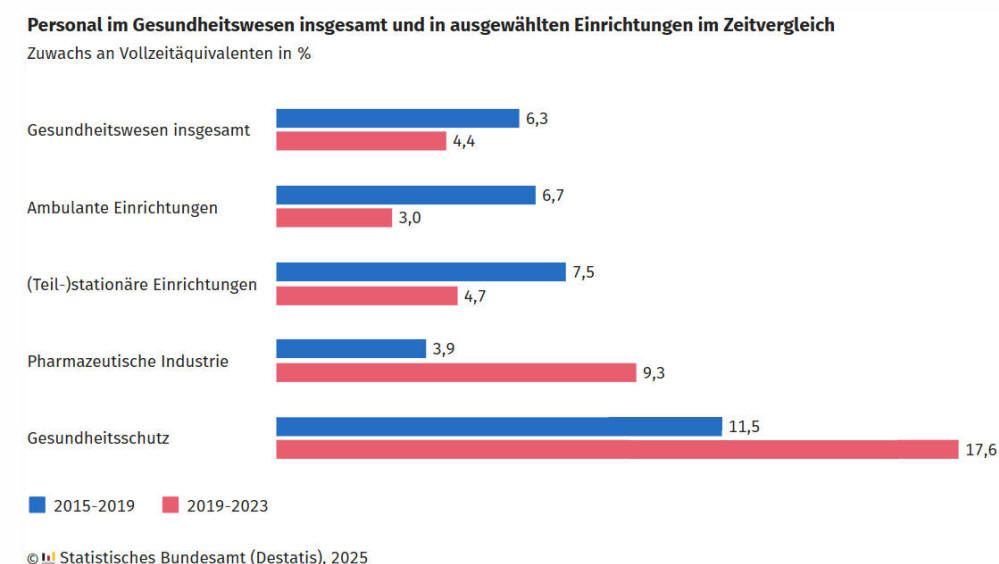
Noch stärker unterscheidet sich der Anstieg
bei der Zahl der auf die volle Arbeitszeit
umgerechneten Beschäftigten
(Vollzeitäquivalente). Die Zahl der
Vollzeitäquivalente lag Ende 2023 bei gut 4,3
Millionen und erhöhte sich gegenüber dem
Jahresende 2019 um 4,4 %. Im Vergleichszeitraum
zwischen den Jahren 2015 und 2019 stieg die Zahl
der Vollzeitäquivalente hingegen um 6,3 %.
Freitag, 24.
Januar 2025 - Tag der Bildung
Telenotarztsystem Niederrhein: Partnerkommunen
unterzeichnen Vertrag
Wer in eine Notsituation gerät, möchte
schnellstmöglich die bestmögliche Hilfe
bekommen. Doch nicht immer kann gewährleistet
werden, dass mit dem Rettungsdienst sofort ein
Notarzt zur Stelle ist. Das neue
Telenotarztsystem Niederrhein, das in
Kooperation von Gesundheitsministerium,
Ärztekammern, Krankenkassenvertretern und
kommunalen Spitzenverbänden auf den Weg gebracht
wurde, soll diese Situation künftig verbessern.

Vertragsunterzeichnung Telenotarztsystem
Niederrhein - Stadt Krefeld, Presse und
Kommunikation, Andreas Bischof
Die
Trägergemeinschaft Telenotarztsystem
Niederrhein, vertreten durch Oberbürgermeister
Sören Link, seinen Amtskollegen Frank Meyer
(Krefeld) und Felix Heinrichs (Mönchengladbach),
die Landräte Christoph Gerwers (Kreis Kleve) und
Dr. Andreas Coenen (Kreis Viersen) sowie Dr.
Lars Rentmeister (Verwaltungsvorstand Kreis
Wesel), unterzeichnete gestern im Krefelder
Rathaus die öffentlich-rechtliche
Rahmenvereinbarung.

„Mit dem Start
des gemeinschaftlichen Telenotarztsystems setzen
wir als Partnerkommunen einen Meilenstein für
eine effiziente und vernetzte Notfallversorgung.
Modernste Technologien gepaart mit der Expertise
erfahrener Rettungskräfte sorgen dafür, dass
medizinische Hilfe schneller und zielgerichteter
bei den Menschen ankommt“, betont
Oberbürgermeister Sören Link.
„Das
System Telenotarzt ist ein gutes Beispiel, wie
technische Innovationen in den Kommunen einen
unmittelbaren Unterschied im Leben der Menschen
machen können: Ich bin überzeugt, dass dieses
System die Versorgung im Notfall weiter
verbessern und Leben retten wird“, erklärt
Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer.
„Dieses Projekt wird nur durch enge
interkommunale Zusammenarbeit möglich. Es wäre
kaum zu leisten, wenn eine Stadt allein ein
solches System aufbauen wollte – aber gemeinsam
kriegen wir das hin. Dank unserer hochmodernen
und bestens ausgerüsteten Feuerwache konnten wir
die Zentrale für alle sechs Städte und
Landkreise hier in Krefeld ansiedeln.“
Was sind die nächsten Schritte?
Es wird
nun damit begonnen, die technische Ausstattung
festzulegen und anzuschaffen. Parallel dazu
beginnt die Personalakquise von Telenotärztinnen
und Telenotärzten sowie deren Dienstplanung.
Nach dem Aufbau der Telenotarztzentrale startet
der Probebetrieb, in dem die Zentrale zeitlich
begrenzt besetzt wird. Dabei sollen mögliche
Schwierigkeiten unter Realbedingungen frühzeitig
erkannt und behoben werden.
Bei
reibungslosem Ablauf werden die Betriebszeiten
der Telenotarzt-Bereitschaft schrittweise
erweitert und schließlich auf einen 24/7-
Vollbetrieb umgestellt. „Durch die Einführung
einer Telenotarztzentrale verbessern wir die
hochwertige medizinische Unterstützung für
unsere Bürgerinnen und Bürger. Für mich ist das
nicht nur ein gutes Beispiel für gelebte
interkommunale Zusammenarbeit, sondern auch
exemplarisch für die vielen Potenziale, die in
der Verwaltung durch Digitalisierung gehoben
werden können“, so Stadtdirektor, Feuerwehr- und
Digitalisierungsdezernent Martin Murrack.
Das Telenotarztsystem ermöglicht dem
Rettungsdienst am Einsatzort, einen erfahrenen
Notarzt digital zu konsultieren. Es gibt drei
Einsatzspektren: Primäreinsätze: Das
Rettungsdienstpersonal vor Ort alarmiert den
Telenotarzt in der Zentrale, der via
Echtzeit-Vitaldaten, Sprach- und ggf.
Sichtkontakt die Diagnostik absichert und
Therapien wie Medikamentengaben initiiert oder
begleitet.
Unterstützende und
überbrückende Einsätze: Stellt der
Rettungsdienst vor Ort fest, dass ein Notarzt
physisch benötigt wird und von der Leitstelle
nicht direkt mitalarmiert wurde, überbrückt der
Telenotarzt die Zeit bis zum Eintreffen des
Kollegen bzw. der Kollegin. Er kann sie zudem
auch mit einer Zweitmeinung unterstützen.
Verlegungsmanagement: Bei geforderten
Patientenverlegungen führt der Telenotarzt ein
standardisiertes Gespräch mit dem Klinikarzt, um
die Wahl des passenden Rettungsmittels/Fahrzeugs
zu prüfen und so Fehlplanungen zu vermeiden. Den
Zustand kranker oder verletzter Menschen aus der
Ferne zu beurteilen und Einsatzkräften vor Ort
in akuten Notfallsituationen ein verlässlicher
und besonnener Begleiter zu sein, stellt hohe
Ansprüche an Telenotärzte.
Die
Bezeichnung unterliegt deshalb strengen Vorgaben
des Curriculums Telenotarzt der
Bundesärztekammer (BÄK). Voraussetzungen für die
Tätigkeit als Telenotarzt sind die Anerkennung
als Facharzt sowie die Zusatzweiterbildung
Notfallmedizin, mindestens zwei Jahre
regelmäßige und andauernde Tätigkeit als Notarzt
mit wenigstens 500 eigenständig absolvierten
Notarzteinsätzen und Erfahrung in der
eigenverantwortlichen Führung von Personen.
Darauf aufbauend kann die Qualifikation
zum Telenotarzt im Rahmen eines speziellen
Lehrgangs erworben werden. Die Stadt Krefeld ist
Kernträgerin des Projekts, da die 2016 eröffnete
integrierte Leitstelle in Krefeld optimale
technische und räumliche Bedingungen für eine
Telenotarztzentrale bietet. Neben dem Betrieb
des Standorts übernimmt sie unter anderem die
Projektkoordination, Abrechnung und
Dienstplanung und führt Verhandlungen mit den
Kostenträgern.
Des Weiteren
organisiert sie die Öffentlichkeitsarbeit und
das Marketing für den Telenotarzt Niederrhein.
Außerdem ist Krefeld für die Aus- und
Fortbildung der Telenotärzte sowie die
Personalgewinnung und -verwaltung zuständig. Das
Projekt wird kollektiv von allen Mitgliedern der
Trägergemeinschaft vorangetrieben.
Duisburg/Niederrhein -
Internationaler Tag der Bildung: Kindernothilfe
appelliert an Politik, Kindern weltweit
Schulbesuch zu ermöglichen
Noch
immer können 244 Millionen Kinder und
Jugendliche nicht zur Schule gehen. Dabei haben
sich die UN-Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet,
bis 2030 allen Mädchen und Jungen weltweit einen
Bildungszugang und einen hochwertigen
Schulabschluss zu ermöglichen.
Zum
Welttag der Bildung am 24. Januar
appelliert die Kindernothilfe an die Politik,
entschieden gegen die millionenfache Verletzung
des Rechts auf Bildung vorzugehen, und mahnt
mehr Investitionen in die globale Bildung an.

Frühkindliche Bildung spielt auch in den
Projekten der Kindernothilfe eine immer stärkere
Rolle (Foto: Malte Pfau)
Jeden Tag
wird das Menschenrecht auf Bildung gebrochen.
Millionen Kindern ist der Schulbesuch verwehrt.
Laut UNESCO besuchen 87 Prozent der Kinder
weltweit eine Grundschule, nur noch 58 Prozent
eine weiterführende Schule. Armut, die Folgen
der Klimakrise und die wachsende Zahl von
Kriegen verschärfen die Situation weiter. Noch
nie waren so viele Kinder auf der Flucht wie
heute.
Malte Pfau, politischer
Referent für Bildung bei der Kindernothilfe und
Sprecher der Globalen Bildungskampagne: „Die
weltweite Bildung befindet sich in einer Krise,
die eng mit der ungerechten Verteilung von
Ressourcen verknüpft ist. Länder mit hohem
Einkommen erhalten 63 Prozent der weltweiten
Bildungsinvestitionen, obwohl nur zehn Prozent
der Weltbevölkerung im schulpflichtigen Alter
dort leben. Ländern mit niedrigem Einkommen
stehen weniger als ein Prozent der globalen
Investitionen zur Verfügung, um 25 Prozent der
schulpflichtigen Weltbevölkerung zu
unterrichten.“
Mit Blick auf die
Bundestagswahl appelliert die Kindernothilfe an
die Politik, Bildung als Schlüssel der
Entwicklungszusammenarbeit zu verstehen. Die für
den Haushalt 2025 angekündigte drastische
Kürzung des Entwicklungsetats ist aus Sicht der
Kinderrechtsorganisation gerade in Bezug auf
Bildung unverantwortlich und darf so nicht
umgesetzt werden.
Für die Kindernothilfe
ist das Recht auf Bildung ein Kernthema. Etwa 70
Prozent ihrer 503 Projekte in 36 Ländern haben
einen Bildungsbezug. Im jahrzehntelangen
erfolgreichen Wirken hat die
Kinderrechtsorganisation hier Projekte
entwickelt, die die Bildungssituation in vielen
Ländern nachhaltig verbessert hat. Auch das
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung verweist in
seinem neuen Positionspapier zur Bildung auf die
große Expertise der Kindernothilfe und stellt
ein Best-Practice-Beispiel zur frühkindlichen
Bildung in Südafrika vor.
Als eine der
größten Kinderrechtsorganisationen in Europa
unterstützt die Kindernothilfe seit mehr als 60
Jahren weltweit Kinder und Jugendliche in
schwierigen Lebenssituationen. Der
Kinderrechtsansatz der Kindernothilfe orientiert
sich an der UN-Kinderrechtskonvention. Weitere
Infos unter kindernothilfe.de
Bundesverfassungsgericht entscheidet über
vorschlagsberechtigte Parteien für die Wahl zum
21. Deutschen Bundestag
Am 13. und 14. Januar 2025 stellte der
Bundeswahlausschuss in seiner öffentlichen
Sitzung fest, welche Vereinigungen als
wahlvorschlagsberechtigte Parteien für die Wahl
zum 21. Bundestag anzuerkennen seien. Gegen die
Nichtanerkennung legte eine Vereinigung
Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein.
Diese blieb erfolglos.
Mit Beschluss vom
22. Januar 2025 hat der Zweite Senat des
Bundesverfassungsgerichts die Beschwerde der
Volksstimmen-Partei-Deutschland (VPD) verworfen,
da der Antrag mangels ordnungsgemäßer Vertretung
bereits nicht wirksam anhängig gemacht und im
Übrigen nicht ordnungsgemäß begründet worden
war. Die ebenfalls eingelegte Beschwerde gegen
die Verkürzung der Fristen für die Beibringung
von Unterstützungsunterschriften hat der Senat
ebenfalls als unzulässig verworfen.
Stadtteilbüro Neu_Meerbeck:
Infos rund ums Ehrenamt
Sich ehrenamtlich zu engagieren ist eine gute
Sache. Die Freiwilligenzentrale der Grafschafter
Diakonie informiert am Mittwoch, 5. Februar, von
10 bis 12 Uhr im Stadtteilbüro Neu_Meerbeck,
Bismarckstraße 43b, zum Thema ‚Ehrenamt‘.
Wer sich einbringen möchte, interessante
Ideen für Projekte hat oder einfach wissen
möchte, wo welche Erfahrungen gebraucht werden,
ist herzlich eingeladen vorbeizukommen.
Rückfragen sind telefonisch beim Stadtteilbüro
Neu_Meerbeck unter 0 28 41/201 – 530 sowie per
E-Mail an stadtteilbuero.meerbeck@moers.de möglich.
Stadt Dinslaken fördert den Austausch von
alten Kühlgeräten
Im Rahmen des Projekts Energiesparhaus Ruhr
des Regionalverbandes Ruhr (RVR) hat die Stadt
Dinslaken Fördergelder für den Austausch alter
Kühlgeräte erhalten. Dieser Fördertopf wurde
noch nicht vollständig abgerufen, so dass noch
Anträge eingereicht werden können.
Gefördert werden Kühlschränke,
Kühl-Gefrierkombinationen, Gefrierschränke und
Gefriertruhen, die nach Erhalt eines
Bewilligungsbescheides angeschafft werden, mit
einem Zuschuss von 100 Euro. Gerade in Zeiten
hoher Energiekosten ist der Tausch von
veralteten Kühlgeräten besonders sinnvoll, da
diese oft enorme Stromfresser sind. Insbesondere
bei Geräten, die älter als 15 Jahre sind, lohnt
sich der Austausch in der Regel bereits nach
wenigen Jahren, sowohl für das Portemonnaie als
auch für den Klimaschutz.
Anträge
können digital unter
klimafoerderung@dinslaken.de eingereicht werden.
Weitere Informationen sowie das Antragsformular
sind auf der Webseite der Stadt Dinslaken unter
www.dinslaken.de/kuehlgeraetetausch verfügbar.
Im täglichen Gebrauch lässt sich durch einfache
Maßnahmen noch weiter Energie sparen.
Ein
Kühlgerät sollte nicht in direkter
Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von
Wärmequellen wie Heizungen aufgestellt werden,
da dies den Stromverbrauch erhöht. Auch eine
optimale Temperatureinstellung ist wichtig: 7°C
im Kühlschrank reichen in der Regel aus. Ein
Grad kälter erhöht den Stromverbrauch erheblich.
Zudem sollten warme Lebensmittel vor dem
Einräumen in den Kühlschrank abgekühlt werden,
und ein voller Kühlschrank ist
energieeffizienter als ein leerer.
Besonders wichtig ist dabei, dass der
Stromverbrauch auch durch die Größe des Geräts
beeinflusst wird. Ein kleineres Gerät verbraucht
in der Regel weniger Strom. Für einen Ein- bis
Zweipersonenhaushalt sind Geräte mit einem
Nutzinhalt von 100-150 Litern empfehlenswert.
Für jede weitere Person kann man etwa 50 Liter
hinzurechnen.
Wenn möglich, ist es auch
sinnvoll, sich für ein freistehendes Gerät zu
entscheiden, da diese meist stabiler und
energiesparender arbeiten als Einbaulösungen.
Bei Fragen steht Diana Unger vom Team
Nachhaltige Entwicklung unter der E-Mail
diana.unger@dinslaken.de oder telefonisch unter
02064 66 495 zur Verfügung.
Kultur-, Partnerschafts- und Europaausschuss
tagt
Am Dienstag, 4. Februar 2025, tagt der Kultur-,
Partnerschafts- und Europaausschuss der Stadt
Dinslaken. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im
Ratssaal des Rathauses. Tagesordnungen und
Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen
finden Interessierte grundsätzlich im
Ratsinformationssystem auf www.dinslaken.de
Promi-Werbung für Cybertrading-Plattformen:
Vorsicht, dahinter stecken Betrüger aus dem
Ausland!
Mit nur 250 Euro innerhalb kurzer Zeit viel Geld
erwirtschaften? Prominente wie Peter Maffay oder
Tim Mälzer werben mit angeblich todsicheren
Geldanlage-Tipps im Internet für
Cybertrading-Plattformen. Sogar tagesschau.de
soll darüber berichten. Die Wahrheit: Alles
Fake! Es ist Teil einer Masche, mit der
Kriminelle, häufig aus dem Ausland, hohe
Geldsummen ergaunern.
Karolina Wojtal,
Juristin und Co-Leiterin des Europäischen
Verbraucherzentrums (EVZ), warnt vor dreistem
Anlage-Betrug.

Achtung Betrug: Kriminelle locken mit
Prominenten als Lockvögel, um Verbraucher zur
Investition in Cybertrading-Plattformen zu
bringen. (Foto: stock.adobe.com/Summit Art
Creations)
Achtung Betrug: Kriminelle locken
mit Prominenten als Lockvögel, um Verbraucher
zur Investition in Cybertrading-Plattformen zu
bringen. (Foto: stock.adobe.com/Summit Art
Creations)
Ein exemplarischer Fall aus
der Praxis des EVZ
Über eine Meldung
gelangt Harald G. (Name geändert) zu einem echt
wirkenden Online-Artikel der Tagesschau: Dort
wird über einen Skandal von Peter Maffay
berichtet. Angeblich soll der Musiker in einer
Sendung verraten haben, wie er schnell Geld mit
einer Bitcoin-Software verdient. Nun soll er von
der Deutschen Bundesbank verklagt worden sein.
Ein Link im Artikel führt direkt zur besagten
Plattform. Von der seriösen Aufmachung der Seite
getäuscht, klickt Harald G. auf den Link und
meldet sich mit Namen, E-Mail und Handynummer
an.
Daraufhin meldet sich eine
Finanzbrokerin aus Österreich. Mit der
Überweisung von 250 Euro könne sein Depot auf
der Cybertrading-Plattform aktiviert werden. Nun
kann er den vermeintlich rasanten Anstieg seines
Kapitals verfolgen. Doch als Harald G. den
Gewinn ausgezahlt haben möchte, soll er auf
einmal Gebühren zahlen. Er widerruft seine
Anmeldung und fordert sein Geld zurück. Seitdem
wird er von den Brokern aus Österreich
telefonisch belästigt. An sein Geld kommt er
jedoch nicht.
Hallo Frau Wojtal, der
beschriebene Fall wurde natürlich anonymisiert.
Er ist jedoch so bei Ihnen gelandet. Gibt es für
den betroffenen Mann eine Aussicht, wieder an
sein verlorenes Geld zu kommen?
Leider
sind die Chancen, den Schaden ersetzt zu
bekommen, eher gering. Besonders bei
Überweisungen. Bei einer Zahlung mit Kreditkarte
ist ein Chargeback möglich, jedoch nicht
garantiert. Schnelles Handeln erhöht die
Erfolgschancen. Falls eine Versicherung (z. B.
eine Cyber-Versicherung) abgeschlossen wurde,
könnte diese unter Umständen einen Teil des
entstandenen Schadens übernehmen.
Das
klingt sehr ernüchternd. Welche
Handlungsmöglichkeiten haben Verbraucher, die
auf einen Betrug reingefallen sind?
Betroffene sollten sofort den Kontakt zu den
Brokern abbrechen. Dann sollten Sie sich an ihre
Bank oder Kreditkartenanbieter wenden, um eine
Rückbuchung der Überweisung oder der
Kreditkartenzahlung (Chargeback) zu versuchen.
Überweisungen lassen sich, wenn überhaupt, nur
in einem sehr engen Zeitfenster rückgängig
machen. Je nach Fall sollten Sie Bankkonto und
Karte ebenfalls sperren lassen. Und unbedingt
eine Strafanzeige bei der Polizei erstatten.
Solche kuriosen Meldungen, die mit dem
schnellen Geld winken, tauchen regelmäßig im
Internet auf. Wie realistisch sind die
Versprechungen?
Die Versprechungen, wie
‚schnell und ohne Aufwand‘ reich zu werden, sind
völlig unrealistisch. Sie sind gezielt darauf
ausgelegt, Menschen mit Erfolgsgeschichten zu
täuschen. Dabei haben die Promis, die diese
Methoden angeblich empfehlen, niemals diese
Aussagen getroffen. Das investierte Geld wird
nicht angelegt, sondern direkt von den Betrügern
einbehalten.
Wann sollte man stutzig
werden, wenn man auf einen solchen Artikel
stößt?
Stutzig sollten Sie werden, wenn
Prominente für ein Produkt oder eine Methode
werben, ohne dass dies auf deren offiziellen
Kanälen bestätigt wird. Auch wenn die
angeblichen Nachrichtenartikel von Tagesschau &
Co. authentisch wirken, sie sind ein Fake. Oft
behaupten die Täter auch, dass sie von
Institutionen wie der Deutschen Bundesbank oder
renommierten Medienhäusern unterstützt werden.
Oder die Anbieter behaupten, ‚exklusive
Handelsgeheimnisse‘ oder eine ‚spezielle
Software‘ zu haben. Das alles soll
Glaubwürdigkeit erzeugen.
Haben Sie Tipps
für Verbraucher, um die Betrüger zu enttarnen?
Betroffene sollten auf der Webseite des
vermeintlichen Cybertrading-Unternehmens
nachschauen: Hat die Website kein Impressum oder
keine Angabe zur zuständigen Aufsichtsbehörde
(z. B. BaFin), sollten Sie misstrauisch werden.
Sind die Geschäftsbedingungen nur auf Englisch,
obwohl der Anbieter als deutscher Broker
auftritt, ist das bereits ein Zeichen, dass
etwas nicht stimmt. Auch ein Warnsignal: Pop-Ups
oder Banner (z. B. ‚nur noch wenige Plätze
verfügbar‘), mit denen Druck ausgeübt wird.
Recherchieren Sie im Internet über unabhängige
Quellen nach den Aussagen, die die Promis
getätigt haben.
Was ist das Ziel der
Betrüger?
Die Betrüger wollen möglichst
hohe Summen erlangen. Sie bauen über Wochen oder
Monate Vertrauen zu den Betroffenen auf, zeigen
ihnen vermeintliche Gewinne an und drängen
wiederholt zu weiteren Zahlungen. Das angeblich
investierte Geld wird jedoch nie angelegt,
sondern fließt direkt in das kriminelle
Netzwerk.
Welcher Schaden entsteht bei
den betroffenen Verbraucherinnen und
Verbrauchern?
Der finanzielle Schaden ist
teils enorm. Betroffene verlieren ihr gesamtes
investiertes Kapital. In extremen Fällen kommen
sie sogar in existenzgefährdende Situationen,
etwa wenn sie Ersparnisse, Immobilien oder ganze
Erbschaften verspekulieren. Dazu kommt auch die
psychische Belastung: Viele verlieren das
Vertrauen in andere Menschen und schämen sich,
auf den Betrug reingefallen zu sein. In einigen
Fällen brechen sogar Beziehungen und Familien
auseinander.
Was sind Ihre Empfehlungen,
um gar nicht erst auf die Masche reinzufallen?
Angebote, die unrealistisch erscheinen oder
schnelle Gewinne versprechen, besser ignorieren
und keine unbekannten Links oder Banner
anklicken. Selbst wenn diese auf seriösen
Plattformen erscheinen. Werden Sie skeptisch,
wenn man Ihnen das Gefühl gibt, Teil einer
Gruppe ‚Auserwählter‘ zu sein, mit denen ein
Geheimnis geteilt wird. Suchen Sie in
Online-Foren nach Erfahrungen anderer Nutzer.
Auf keinen Fall sollten Verbraucher
Daten von sich (Name, E-Mail, Telefonnummer) auf
unbekannten Plattformen eingeben. Prüfen Sie das
Impressum und holen Sie Informationen über den
Anbieter über offizielle Quellen (z. B. BaFin).
Im Zweifel lieber noch einmal extern überprüfen
lassen, bevor das erste Geld fließt. Das EVZ
berät Betroffene kostenlos.
Kleve: Kunstausstellung „Vides“ von
Peter Schmidt
Fr., 31.01.2025 - 10:30 - Fr.,
11.04.2025 - 16:45 Uhr
Peter Schmidt ist gerne unterwegs. Zu
den besonderen Kunstausstellungen zum Beispiel
in der Dorfkirche in Persingen direkt hinter der
niederländischen Grenze. Und er öffnet der Kunst
mit Asche, Staub und Rost experimentelle Räume.

„Die Verwendung von Acrylfarben und Tusche in
Kombination mit unkonventionellen Materialien
wie Asche und Rost bietet eine einzigartige
Möglichkeit, Texturen und Effekte zu erzeugen,
die das Endergebnis lebendig und dynamisch
machen“, so der Künstler.
Am
31.01.2025 um 10:30 Uhr eröffnet er seine
Kunstausstellung „Vides“ im Café Samocca an der
Hagschen Str. 71 in Kleve. „Kleinformatige
Werke, die durch ihre leuchtenden Farben zum
Betrachten einladen“, kommen nun bei seiner
bereits dritten Ausstellung im Klever Kulturcafé
Samocca neu dazu. Das Thema „Kreis“ bleibt ein
fester Bestandteil beim künstlerischen Schaffen
von Peter Schmidt.
Die Bilder tragen
keine Namen, so erhält der Betrachter seinen
ganz eigenen Raum zur Wahrnehmung. Der Eintritt
zur Vernissage ist frei, die Bilder sind noch
bis zum 11. April zu sehen. Die Ausstellung ist
zu den Öffnungszeiten des Café Samocca zu sehen:
Di - Fr: 9.15 – 16.45 Uhr Sa: 9.15 – 13.30 Uhr
So & Mo: geschlossen.

NRW-Wirtschaft: EU-Länder sind die
wichtigsten Handelspartner für lebende Rinder
und Schweine sowie deren Fleisch
Anlässlich
des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche in
Deutschland liefert Information und
Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches
Landesamt Fakten zum Außenhandel mit lebenden
Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen und deren
Fleisch sowie zur landwirtschaftlichen Haltung
der Tiere in Nordrhein-Westfalen.
NRW-Außenhandel: Schweinefleisch wurde 2023 am
häufigsten nach Italien exportiert – Rindfleisch
nach Spanien Beim Außenhandel mit lebenden
Schweinen und Schweinefleisch hat besonders der
Export von Schweinefleisch eine hohe Bedeutung:
Fleisch von Schweinen wurde 2023 im Wert von
1,49 Milliarden Euro in andere Länder
ausgeführt. Häufigste Abnehmerländer waren
Italien (19,1 Prozent), Polen (11,6 Prozent) und
die Niederlande (11,2 Prozent). Lebende Schweine
exportierte NRW im Wert von ca. 90 Millionen
Euro.
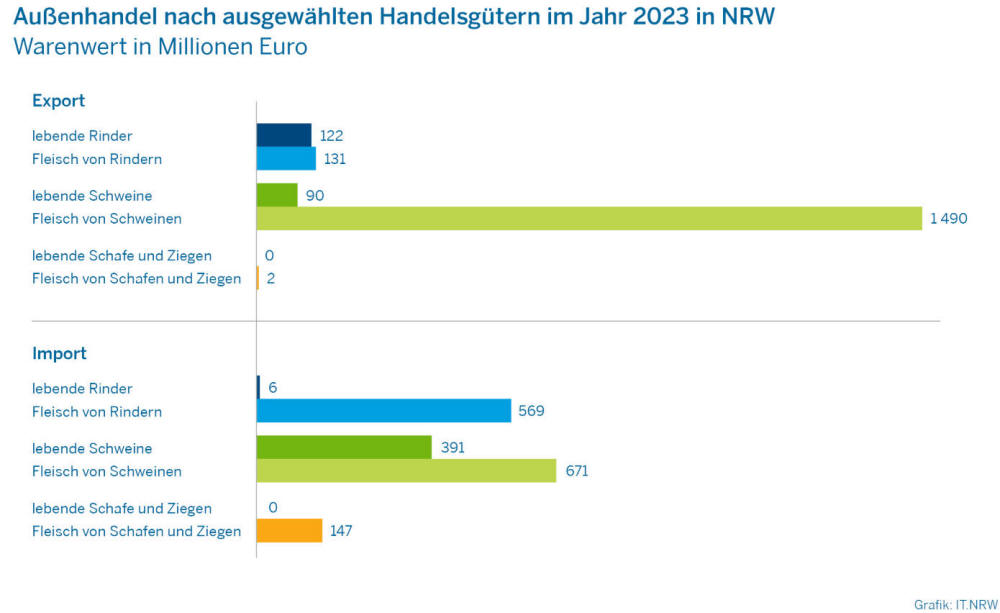
Diese wurden häufig nach Polen
(39,7 Prozent) und Ungarn (18,7 Prozent)
exportiert. Gemessen am Warenwert hat der Import
von lebenden Schweinen für NRW eine größere
Bedeutung als der Export; 2023 wurden lebende
Schweine im Wert von ca. 390 Millionen Euro nach
NRW eingeführt. Diese kamen häufig aus den
Niederlanden (57,1 Prozent), Dänemark
(26,3 Prozent) und Belgien (16,5 Prozent). Im
Jahr 2023 hat NRW lebende Rinder im Wert von ca.
121 Millionen Euro in andere Länder exportiert.
Hauptabnehmerland waren mit über
83 Prozent die Niederlande. Fleisch von Rindern
wurde insgesamt im Wert von ca. 131 Millionen
Euro exportiert. Spanien war mit einem Anteil
von 20,9 Prozent das wichtigste Abnehmerland für
Rindfleisch, gefolgt von Frankreich mit
18,7 Prozent. Lebende Schafe und Ziegen wurden
in NRW im Jahr 2023 nicht importiert und
exportiert.
Fleisch von Schafen und
Ziegen wurde auch mit Handelspartnern außerhalb
der EU verstärkt gehandelt. Gemessen am
Warenwert importierte die NRW-Wirtschaft
deutlich mehr Fleisch von Schafen und Ziegen
(ca. 146 Millionen Euro) als dieses exportiert
wurde (ca. 2,39 Millionen Euro). Bei den
Herkunftsländern für Schaf- und Ziegenfleisch
war Neuseeland mit einem Anteil von 30,2 Prozent
das häufigste Herkunftsland, gefolgt von Irland
(22,6 Prozent) und den Niederlanden
(19,0 Prozent).
Exporte in Nicht-EU-Staaten im
Dezember 2024: voraussichtlich -0,8 % zum
November
Exporte in Drittstaaten
(kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren),
Dezember 2024 58,8 Milliarden Euro -0,8 % zum
Vormonat +0,8 % zum Vorjahresmonat Exporte in
Drittstaaten (Originalwerte Warenausfuhren),
Dezember 2024 51,9 Milliarden Euro -3,4 % zum
Vorjahresmonat
Die deutschen Exporte in
die Staaten außerhalb der Europäischen Union
(Drittstaaten) sind im Dezember 2024 gegenüber
November 2024 kalender- und saisonbereinigt um
0,8 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter
mitteilt, wurden im Dezember 2024 kalender- und
saisonbereinigt Waren im Wert von 58,8
Milliarden Euro dorthin exportiert.
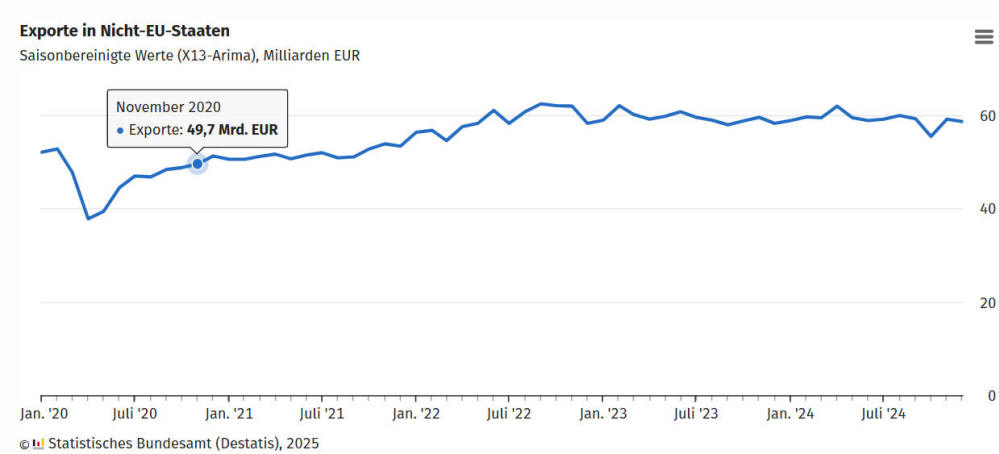
Nicht kalender- und saisonbereinigt wurden
im Dezember 2024 nach vorläufigen Ergebnissen
Waren im Wert von 51,9 Milliarden Euro in
Drittstaaten exportiert. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat Dezember 2023 sanken die Exporte
um 3,4 %. Wichtigster Handelspartner für die
deutschen Exporteure waren auch im Dezember 2024
die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden Waren im
Wert von 11,5 Milliarden Euro exportiert.
Damit stiegen die Exporte in die
Vereinigten Staaten gegenüber Dezember 2023 um
1,1 %. In die Volksrepublik China wurden Waren
im Wert von 6,1 Milliarden Euro exportiert, das
waren 16,1 % weniger als im Vorjahresmonat. Die
Exporte in das Vereinigte Königreich nahmen im
Vorjahresvergleich um 13,0 % auf
5,2 Milliarden Euro ab.
Exporte nach
Russland gegenüber dem Vorjahresmonat um 20,7 %
gesunken
Die deutschen Exporte in die
Russische Föderation sanken im Dezember 2024
gegenüber Dezember 2023 um 20,7 % auf
0,4 Milliarden Euro. Im Dezember 2024 lag
Russland damit auf Rang 24 der wichtigsten
Bestimmungsländer für deutsche Exporte außerhalb
der EU. Im Februar 2022, dem Monat vor dem
Angriff auf die Ukraine, hatte Russland noch
Rang 5 belegt.
Exporte (Originalwerte):
Wichtigste Handelspartner Dezember 2024

Donnerstag,
23. Januar 2025
Moers:
Briefwahlunterlagen liegen voraussichtlich ab 8.
Februar vor
Wegen der aktuell zahlreichen Anfragen von
Bürgerinnen und Bürgern teilt das Briefwahlbüro
der Stadt Moers mit, dass die
Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am
Sonntag, 23. Februar, noch nicht vorliegen.
Voraussichtlich ist dies ab Samstag, 8. Februar,
der Fall.
Die Beantragung ist aber schon
jetzt möglich - auf schriftlichem Weg
(Mail/Post), persönlich im Rathaus oder online.
Das Briefwahlbüro benötigt dazu Vornamen,
Nachnamen und die Wohnanschrift (gegebenenfalls
Urlaubsanschrift).
Der Versand der
Unterlagen erfolgt voraussichtlich am Montag,
10. Februar. Alle Personen, die ins
Wählerverzeichnis eingetragen sind, können per
Briefwahl wählen. Das Briefwahlbüro ist im
Rathaus Moers (Nordflügel, Raum 2.070, ‚Seelow‘,
Rathausplatz 1) zu finden.
Geöffnet ist
es montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr,
donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8
bis 13 Uhr. Zudem gibt es an zwei Samstagen
Sonderöffnungszeiten: Am 8. und 15. Februar
jeweils von 9 bis 12.30 Uhr. Fragen sind auch
per E-Mail an wahlen@moers.de oder
telefonisch unter 0 28 41 / 201-908 möglich.
Potenzial Wohnungsleerstand:
Bundesbauministerin Klara Geywitz stellt
Handlungsstrategie vor
Die Bundesministerin für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz,
hat im Rahmen des Kommunaldialogs „Wohnen in
ländlichen Räumen" heute in Berlin die
„Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung"
vorgestellt. Diese zielt darauf ab,
leerstehenden Wohnraum wieder nutzbar zu machen.
Sie wurde im vergangenen Jahr unter Einbeziehung
von Fachgesprächen und weiteren Bundesressorts
erarbeitet.
Dazu Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen:
„Knapp zwei Millionen Wohnungen und
Einfamilienhäuser in Deutschland stehen leer.
Leerstand macht etwas mit den Orten und mit den
Menschen, die dort leben. Umso dringender ist
es, auch über diese Lebensrealität zu reden.
So individuell wie die Gegebenheiten und
Lebenssituationen in den Kommunen sind, sind
auch die Anforderungen an die eigenen vier
Wände: Familien brauchen mehr Platz, Fachkräfte
suchen ein Zuhause in der Nähe ihres
Arbeitsplatzes, Auszubildende eine bezahlbare
Bleibe. Aber nur dort, wo sich die Menschen
wohlfühlen, sie eine Arbeit haben, die
Entwicklungschancen ihrer Kinder gut sind und
notwendige Infrastrukturangebote für alle
Altersgruppen erreichbar sind, werden sie gerne
wohnen.
Die Belebung von Leerständen
und Wiedernutzbarmachung von bestehenden
Gebäuden lässt nicht nur lebendige Orte
entstehen, sondern spart auch Kosten und trägt
zur Reduzierung des Flächenverbrauchs bei. Umso
wichtiger ist es, dafür valide und
regionalisierte Daten zu bekommen, um
zielgerichtet unterstützen zu können. Wir haben
dazu Gesetzesinitiativen und Forschung auf den
Weg gebracht, sie müssen langfristig
weitergeführt werden, um ihre Wirkung entfalten
zu können.
Die Handlungsstrategie zeigt,
dass Kommunen, Länder und Bund hier einander
schon gut unterstützen. Guter öffentlicher
Nahverkehr, Bildung und Arbeitsplätze sind
unerlässlich, um eine stabile Basis für das
Ankommen vor Ort zu schaffen. Fördermittel
müssen dafür über Jahre verlässlich
bereitstehen. Leerstandsmanagement braucht einen
langen Atem und viel lokales Engagement und
Herzblut. Die Kommunen brauchen die
Unterstützung und haben sie mehr als verdient."
Die im Sommer 2024 veröffentlichten
Zensusdaten, die den Stand 2022 abbilden,
zeigen, dass vor allem in strukturschwachen, und
hier insbesondere in ländlichen Regionen,
Leerstand besteht. Dieser stellt Kommunen und
Gemeinden vor große Herausforderungen. Durch
gezielte Förderung und Schaffung von Anreizen
für Unternehmen und Privatpersonen unterstützt
der Bund Kommunen und Gemeinden dabei,
leerstehende Dorf- und Stadtkerne wieder zu
attraktiven Wohn- und Arbeitsorten
umzugestalten.
In der
Handlungsstrategie werden verschiedene Maßnahmen
der Innenentwicklung, der Stärkung
gleichwertiger Lebensverhältnisse sowie des
Wissenstransfers verknüpft. So tragen bspw.
Programme wie die Städtebauförderung maßgeblich
dazu bei, die Attraktivität von Städten und
Gemeinden zu verbessern. Dies schafft auch für
Gebäudeeigentümer wichtige Rahmenbedingungen für
Investitionen in leerstehende oder ungenutzte
Gebäude.
Zukünftig sollten durch eine
gezielte Kombination von Städtebauförderung und
sozialer Wohnraumförderung im Rahmen der
Leerstandsaktivierung Synergien zwischen der
Beseitigung städtebaulicher Missstände und der
Versorgung der Zielgruppen der sozialen
Wohnraumförderung noch stärker genutzt werden.
Die im Rahmen der Strategie entwickelte
Webseite „Potenzial Leerstand"
(www.region-gestalten.bund.de/potenzial-leerstand),
stellt für verschiedene Nutzergruppen
anschauliche und vielfältige Informationen zu
rechtlichen und finanziellen Instrumenten, guten
Beispielen sowie Initiativen beim Abbau von
Wohnungsleerstand bereit.
Im Rahmen des
Kommunaldialogs „Wohnen in ländlichen Räumen"
diskutieren zudem Teilnehmende aus Ländern,
Kommunen und Verbänden, wie die Wohn- und
Lebenssituation in ländlichen Regionen weiter
verbessert werden kann. Neben den Maßnahmen der
„Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung"
wurden Themen der Städtebauförderung und der
Fachkräftegewinnung angesprochen.
Die
Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung finden
Sie hier.
Flurbereinigung
Wesel-Büderich - Schlussfeststellung
Aktenzeichen: 33 – 7 07 02
Schlussfeststellung
In der Flurbereinigung
Wesel-Büderich (Kreis Wesel, Teile der Städte
Wesel und Rheinberg) wird hiermit gemäß § 149
Flurbereinigungsgesetz -FlurbG- die
Schlussfeststellung erlassen und folgendes
festgestellt:
Die Ausführung des
Flurbereinigungsplanes - einschließlich seiner
Nachträge 1 bis 3 - ist bewirkt. Den Beteiligten
stehen keine Ansprüche mehr zu, die im
Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt
werden müssen. Die Aufgaben der
Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung
Wesel- Büderich sind abgeschlossen.
Gründe
Der Abschluss des
Flurbereinigungsverfahrens durch die
Schlussfeststellung ist zulässig und begründet.
Der Flurbereinigungsplan einschließlich seiner
Nachträge ist in allen Teilen ausgeführt.
Insbesondere ist das Eigentum an den neuen
Grundstücken auf die im Flurbereinigungsplan
benannten Beteiligten übergegangen.
Die
öffentlichen Bücher sind berichtigt.
Da somit
weder Ansprüche der Beteiligten noch sonstige
Angelegenheiten verblieben sind, die im
Flurbereinigungsverfahren hätten geregelt werden
müssen, ist es durch die Schlussfeststellung
abzuschließen.
Hinweise:
Da die
Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft für
abgeschlossen erklärt werden, erlischt sie mit
der Schlussfeststellung (§ 149 Abs. 4 FlurbG).
Damit erlöschen auch die Rechte und Pflichten
des Vorstandes.
Das
Flurbereinigungsverfahren endet (erst) mit der
Zustellung der unanfechtbar gewordenen
Schlussfeststellung an den Vorsitzenden der
Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung
Wesel-Büderich (§ 149 Abs. 3 FlurbG).
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die
Schlussfeststellung der Flurbereinigung
Wesel-Büderich kann innerhalb eines Monats
Widerspruch bei der Bezirksregierung Düsseldorf,
40474 Düsseldorf, erhoben werden.
Gegen die
Schlussfeststellung steht gemäß § 149 Abs. 1
Satz 3 FlurbG auch dem Vorstand der
Teilnehmergemeinschaft das Recht zum Widerspruch
zu.
Online-Voting und
Jurywertung: Siegerinnen und Sieger der
SportEsel-Awards 2024 stehen fest
Tickets für die 3. SportNacht Wesel präsentiert
von Rhenus werden knapp - Sportfunktionär
Friedhelm Julius Beucher nimmt Award
„Sonder-SportEsel der Stadt Wesel präsentiert
von Rhenus“ auf der Gala am 14. Februar
persönlich entgegen.

In weniger als vier Wochen findet die 3.
SportNacht Wesel statt, bei der sich über 500
Gäste aus Sport, Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft treffen, um Wesels beste
Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des
Jahres 2024 zu ehren. Knapp 400 Eintrittskarten
wurden bereits für die Gala mit rotem Teppich
und kurzweiligem Rahmenprogramm im beheizten
Zelt an der Rheinpromenade verkauft.
„Die Tickets für die SportNacht Wesel werden
langsam knapp, insbesondere in der Kategorie 1
inklusive Buffet sollte man sich mit dem Kauf
einer Karte beeilen, da diese auf 300 limitiert
sind. Ich gehe davon aus, dass wir zur
Veranstaltung hin wieder ausverkauft sein
werden“, erklärt Organisator Kai Meesters.
Tickets gibt es in der Stadtinfo am Großen Markt
und bei Teamsport Niederrhein in der
Mercatorstraße ab 20,- Euro.
Gespannt sind nicht nur die Gäste, wer die
SportEsel-Awards 2024 diesmal gewinnen wird.
Insbesondere die Sportlerinnen und Sportler der
Stadt Wesel dürften sich auf die Vergabe der
wunderschönen Wesel-Esel in den Farben Gold,
Silber und Bronze freuen. Satte 4.234 Stimmen
wurden im Rahmen der Online-Wahl auf der
Homepage der SportNacht Wesel abgegeben.
Gevotet werden konnte für die
SportEsel-Awards „Sportlerin des Jahres,
präsentiert von Fielmann, „Sportler des Jahres,
präsentiert von Volksbank RheinLippe“ und
„Mannschaft des Jahres, präsentiert von der
Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe“. Nach
dem Online-Voting hat sich eine mehrköpfige Jury
nun abschließend zu den Platzierungen beraten,
dessen Gewichtung zu 50% in die Gesamtbewertung
einfließt. Seit heute steht fest, wer die
jeweils fünf Erstplatzierten sind, gelüftet wird
das Geheimnis jedoch erst live auf der Bühne am
14. Februar.
Mit Fotos und
Videoclips auf einer großen LED-Wand ins
Programm eingebunden werden alle Nominierten.
Wer den SportEsel-Award „Ehrenamtler/in des
Jahres 2024, präsentiert von Stadtwerke Wesel“
erhalten wird, wird ebenfalls erst am Abend der
SportNacht gelüftet. Sportfunktionär Friedhelm
Julius Beucher nimmt „Sonder-SportEsel-Award der
Stadt Wesel präsentiert von Rhenus“ auf der Gala
persönlich entgegen.
Lediglich die
Vergabe eines SportEsel-Awards steht bereits
fest: Friedhelm Julius Beucher, Präsident des
Deutschen Behindertensportverbandes und des
Nationalen Paralympischen Komitees wird den
Sonder-SportEsel der Stadt Wesel, präsentiert
von Rhenus am 14. Februar auf der Bühne für sein
herausragendes Engagement im Behindertensport
entgegennehmen.
„Ich freue mich
sehr, von der Stadt Wesel mit diesem
Sonder-SportEsel ausgezeichnet zu werden. Wann
bekommt man schon mal einen Esel verliehen? Es
ehrt mich sehr, dass ich diesen
Sonder-Sportpreis als Wertschätzung für das
große Engagement vieler erhalte. Daher war es
mir auch ein persönliches Anliegen, bei der
SportNacht Wesel persönlich vor Ort zu sein, um
gemeinsam mit der lokalen Gemeinschaft und den
Verantwortlichen die Bedeutung von Inklusion und
Chancengleichheit im Sport in den Fokus zu
rücken. Ohne Wenn und Aber sage ich: Menschen
mit Behinderungen gehören in die Mitte der
Gesellschaft – sowohl im Sport als auch darüber
hinaus”, sagt Beucher, der seit Juni 2009
Präsident des Deutschen
Behindertensportverbandes (DBS) ist.
In dieser Position war er zugleich
Delegationsleiter des Team Deutschland
Paralympics bei den Paralympischen Spielen seit
2010, zuletzt bei den Paralympics in Paris
2024. Die Wurzeln seines langjährigen
Engagements rund um den Behindertensport liegen
bereits Anfang der 1990er Jahre. Als damaliger
Bundestagsabgeordneter besuchte der
Bundesverdienstkreuzträger fast alle
Paralympischen Spielen seit 1992.
An
der Spitze des 1951 gegründeten DBS setzt er
sich mit voller Leidenschaft für die Belange von
Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderungen
ein. 1990 wurde Friedhelm Julius Beucher in den
Bundestag gewählt, dem er zwölf Jahre lang
angehörte. Von 1998 bis 2002 war er Vorsitzender
des Sportausschusses im Deutschen Bundestag.
Kurzweilige Talkrunde Zusammen mit Bernd
Reuther, Mitglied im Sportausschuss des
Deutschen Bundetages und Wesels Dezernent für
Kultur und Sport, Rainer Benien wird Beucher in
einem Talk zum Thema „Inklusion und Special
Olympics“ sprechen, moderiert vom
Schwimmweltmeister und ZDF-Experten Christian
Keller, der durch den gesamten Abend führen
wird. Weitere Infos zur 3. SportNacht Wesel
unter: www.sportnacht-wesel.de
Vorbereitungen für die
Bundestagswahl in Dinslaken laufen auf
Hochtouren
Im Wahlbüro der Stadt Dinslaken werden derzeit
alle Weichen für die Bundestagswahl am 23.
Februar 2025 gestellt. Ab Ende Januar erhalten
alle Wahlberechtigten ihre
Wahlbenachrichtigungen. Diese informieren
darüber, in welchem Wahlraum gewählt werden kann
und enthalten auch Hinweise zur Beantragung
eines Wahlscheins für die Briefwahl.
Für
Wählerinnen und Wähler, die am Wahltag
verhindert sind, bietet die Stadt mehrere
Möglichkeiten zur Beantragung der
Briefwahlunterlagen. Am einfachsten geht dies
über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung
mithilfe eines Smartphones. Außerdem steht auf
der Rückseite der Benachrichtigung ein
Papierformular zur Verfügung, das
handschriftlich ausgefüllt werden kann.
Da sich die Wahlvorschläge auf den
Stimmzetteln bis Ende Januar noch ändern können,
erfolgt der Druck der Unterlagen erst Anfang
Februar. Der Versand der Briefwahlunterlagen ist
daher ab dem 7. Februar 2025 geplant. Das
Wahlbüro bittet um Geduld bis zu diesem
Zeitpunkt.
Wer bereits vor Erhalt der
Wahlbenachrichtigung einen Wahlschein beantragen
möchte, beispielsweise aufgrund einer geplanten
Reise, kann dies über das Onlineportal der Stadt
oder durch Abholung eines Papierformulars im
Rathaus tun. Weitere Informationen hierzu finden
sich schon jetzt auf der Homepage der Stadt.
Ab dem 7. Februar 2025 wird im Rathaus eine
Sofortwahlstelle eingerichtet, um eine
persönliche Stimmabgabe ohne Postweg zu
ermöglichen. Die Sofortwahlstelle ist auch
samstags geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten
werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Fragen
beantwortet auch das Wahlbüro – telefonisch
unter 02064 66 888 und per E-Mail an
wahlen@dinslaken.de
Beständige
Hilfsbereitschaft des Löschzugs Repelen
Die Jahreshauptversammlung des Löschzuges
Repelen der Feuerwehr Moers fand am Samstag, 11.
Januar, statt.
Die Jahreshauptversammlung
des Löschzuges Repelen der Feuerwehr Moers fand
am Samstag, 11. Januar, statt. Durch den Abend
führten die Löschzugführer Volker Scholz und
Nils Cameli, die gemeinsam mit den Kameradinnen
und Kameraden auf das vergangene Jahr
zurückblickten.

Löschzug Repelen (Foto: Löschzug
Repelen)
Zu Beginn der Versammlung
gedachten die Anwesenden in einer Schweigeminute
der verstorbenen Kameradinnen und Kameraden. Der
Leiter der Feuerwehr, Andre Gesthuysen, würdigte
die geleistete Arbeit der Mitglieder. Er lobte
die „starke Truppe“, auf die man sich jederzeit
verlassen könne, und betonte außerdem die
wichtige Rolle der Familien und Partner, die den
Feuerwehrleuten durch ihr Verständnis und ihre
Unterstützung erst ermöglichen, den Dienst für
die Gemeinschaft zu leisten. Auch die
Löschzugführer dankten allen Kameradinnen und
Kameraden sowie den Familien und
Unterstützerinnen und Unterstützern für ihre
Treue, ihren Einsatz und ihre beständige
Hilfsbereitschaft.
Großer
Zusammenhalt im Ortsteil Repelen
Ein weiteres
wichtiges Thema des Abends war der
außergewöhnliche Zusammenhalt im Ortsteil
Repelen: Ob mit Vereinen, Unternehmern oder den
Bürgerinnen und Bürgern – der Löschzug Repelen
ist hervorragend vernetzt und profitiert von
einem starken Miteinander. Dieses enge Netzwerk
trägt maßgeblich zur erfolgreichen Arbeit der
Feuerwehr bei und schafft eine solide Basis für
zahlreiche gemeinsame Aktivitäten.
Zudem nahm an dem Abend Andre Gesthuysen
gemeinsam mit der Löschzugführung mehrere
Beförderungen vor. Vom Feuerwehranwärter zum
Feuerwehrmann wurden Andre Möllmann und
Christian Ehlert ernannt. Die Kameraden Patrick
Richter, Robin Rösler und Edwin Hamm stiegen vom
Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann auf.
Oberfeuerwehrfrau Wiebke Scholz wurde zur
Unterbrandmeisterin befördert.
Josh
Mosebach wechselte vom Oberfeuerwehrmann zum
Unterbrandmeister, während Luca Neuhaus als
Hauptfeuerwehrmann zum Unterbrandmeister ernannt
wurde. Christian Bothe und Philip Renz bekleiden
nun den Dienstgrad des Brandmeisters.
Darüber hinaus erhielten weitere
Kameradinnen und Kameraden Teilnahmeurkunden für
erfolgreich abgeschlossene Lehrgänge, darunter
Truppmann, Atemschutzgeräteträger, Sprechfunker
und Motorkettensägenausbildung. Einen Ausblick
gab es bereits auf den Sommer 2026. Dann soll es
wieder einen Brandschutztag beim Löschzug
Repelen geben. Die Vorbereitungen laufen bereits
an.
Infos zu kultursensibler
Pflege im Stadtteilbüro Neu_Meerbeck
In Deutschland leben Menschen aus vielen
verschiedenen Kulturen, die unterschiedliche
Vorstellungen von Gesundheit, Krankheit und
Pflege haben. Der Interkulturelle Pflegedienst
Rose berät am Donnerstag, 30. Januar, von 15 bis
17 Uhr im Stadtteilbüro Neu_Meerbeck,
Bismarckstraße 43b, zu diesem Thema.
Denn es ist wichtig, dass Pflegebedürftige
in ihrer Kultur, Sprache und ihren individuellen
Bedürfnissen verstanden und respektiert werden.
Pflegekräfte, Angehörige und alle Interessierten
sind herzlich eingeladen, sich über die
Herausforderungen und Chancen einer Pflege zu
informieren, die kulturelle Unterschiede
beachtet und einbindet.
Die
Veranstaltung ist kostenlos. Rückfragen sind
telefonisch unter 0 28 41 / 201 530 sowie online
unter stadteilbuero.meerbeck@moers.de möglich.
vhs Moers – Kamp-Lintfort
verlost Karten für Lesung mit Vera Weidenbach
Die Autorin Vera Weidenbach gastiert am
Weltfrauentag in der Europaschule in
Kamp-Lintfort. (Foto: Weidenbach_Vera © Vic
Harster_001) Frauen in der Wissenschaft – sie
wurden in der Vergangenheit selten anerkannt und
häufig ignoriert. Welchen Anteil Frauen
tatsächlich an der Entwicklung und der
Gestaltung der modernen Welt haben, erklärt die
Autorin und Journalistin Vera Weidenbach in
ihrem Buch ‚Wie Frauen die Moderne Welt
erschufen – und warum wir sie nicht kennen‘.
Anlässlich des Weltfrauentages im März
lädt die vhs Moers – Kamp-Lintfort gemeinsam mit
der Gleichstellungsstelle Kamp-Lintfort zu einer
Lesung der Autorin ein. Einige Karten für diesen
Abend verlost die vhs am Dienstag, 28. Januar.
Unter der Telefonnummer 0 28 41/201 - 565 können
die ersten zehn Anruferinnen und Anrufer ab 9
Uhr bei Nennung des Stichworts ‚Mathilda-Effekt‘
jeweils zwei Karten gewinnen.
Die
Lesung findet dann am Freitag, 7. März, um 18
Uhr in der Aula der Europaschule,
Sudermannstraße 4, statt. Die Zuhörerinnen und
Zuhörer erfahren unter anderem, dass es Frauen
waren, die den ersten Trickfilm geschaffen
haben, die zum ersten Mal eine DNA beschrieben
und das erste Computerprogramm geschrieben
haben.
Karten sind auch für 10 Euro im
Vorverkauf telefonisch unter 0 28 41/201 - 565
sowie online unter www.vhs-moers.de zu
bestellen. Außerdem gibt es welche für 12 Euro
an der Abendkasse.

Öffentliche Bildungsausgaben 2023 um 4,3 %
(vorher: 4,4 %) gestiegen
184 Milliarden Euro für Bildung aus öffentlicher
Hand Pro-Kopf-Ausgaben bei 2 200 Euro Knapp die
Hälfte der Ausgaben entfiel auf die Schulen
Die Bildungsausgaben von Bund, Ländern und
Gemeinden sind im Jahr 2023 auf
gut 184 Milliarden Euro gestiegen. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, waren das nominal (nicht
preisbereinigt) 4,3 % oder 8 Milliarden Euro
mehr als im Jahr 2022. Umgerechnet auf die
Gesamtbevölkerung gaben die öffentlichen
Haushalte damit im Jahr 2023 insgesamt 2 200
Euro je Einwohnerin und Einwohner für Bildung
aus (2022: 2 100 Euro), bezogen auf die
Einwohnerinnen und Einwohner unter 30 Jahren
waren es 7 200 Euro (2022: 7 000 Euro).
Der Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben
am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag allerdings
2023 mit 4,5 % unter dem Niveau des Vorjahres
(2022: 4,6 %). Knapp die Hälfte der Ausgaben
floss in die Schulen Für die Schulen wurde 2023
mit 90 Milliarden Euro knapp die Hälfte (49 %)
der öffentlichen Bildungsausgaben verwendet. 44
Milliarden Euro beziehungsweise 24 % entfielen
auf die Kindertagesbetreuung und 36 Milliarden
Euro (20 %) auf die Hochschulen.
Die
restlichen 15 Milliarden Euro (8 %) wurden für
die Förderung von Bildungsteilnehmerinnen und
-teilnehmern (9 Milliarden Euro bzw. 5 %), für
Jugend- und Jugendverbandsarbeit (3 Milliarden
Euro beziehungsweise 2 %) und für das Sonstige
Bildungswesen (3 Milliarden Euro beziehungsweise
1 %) ausgegeben. Rückgang der Bildungsausgaben
auf Bundesebene Die Bildungsausgaben des Bundes
lagen im Jahr 2023 mit 12 Milliarden Euro um
0,9 Milliarden Euro oder 7 % unter dem
Vorjahreswert.
Dies ist insbesondere
auf niedrigere Zuweisungen an das Sondervermögen
für den Digitalpakt Schule im Berichtsjahr 2023
zurückzuführen. Durch unregelmäßige Zuführungen
an Sondervermögen kann es im Zeitverlauf zu
Ausgabenschwankungen kommen. Von den
Bundesmitteln wurden jeweils gut 5 Milliarden
Euro für Hochschulen (44 %) und für die
Förderung von Bildungsteilnehmerinnen und
Bildungsteilnehmern (45 %) verwendet.
Für das Sonstige Bildungswesen wurden
0,6 Milliarden Euro (5 %) ausgegeben, für die
Jugend- und Jugendverbandsarbeit 0,5 Milliarden
Euro (4 %) und für die Schulen 0,3 Milliarden
Euro (2 %). Für die Kindertagesbetreuung fielen
beim Bund keine nennenswerten Ausgaben an.
Länder und Gemeinden verzeichnen Mehrausgaben
Die Länder gaben insgesamt 126 Milliarden Euro
aus und stellten damit gut zwei Drittel (68 %)
der öffentlichen Bildungsausgaben im Jahr 2023.
Im Vergleich zu 2022 stiegen die
Ausgaben der Länder um 4 Milliarden Euro oder
3 %. Von den Landesmitteln wurden 70 Milliarden
Euro (55 %) für den Schulbereich, 31 Milliarden
Euro (25 %) für die Hochschulen und
21 Milliarden Euro (17 %) für die
Kindertagesbetreuung aufgewendet. Die restlichen
4 Milliarden Euro (3 %) entfielen auf die
Förderung von Bildungsteilnehmerinnen und
Bildungsteilnehmern, das Sonstige Bildungswesen
und die Jugend- und Jugendverbandsarbeit.
Auf Gemeindeebene lässt sich ein Anstieg
der Ausgaben um 4 Milliarden Euro (+11 %) auf
insgesamt 47 Milliarden Euro beobachten. Die
Gemeinden verwendeten mit 23 Milliarden Euro (48
%) knapp die Hälfte ihrer Gesamtausgaben im
Bildungsbereich für die Kindertagesbetreuung,
weitere 20 Milliarden Euro (42 %) wurden im
Schulbereich ausgegeben.
Jeweils 2
Milliarden Euro wurden für die Förderung von
Bildungsteilnehmerinnen und Bildungsteilnehmern
(5 %) und die Jugend- und Jugendverbandsarbeit
(4 %) aufgebracht. Auf den Bereich Sonstiges
Bildungswesen entfielen bei den Gemeinden kaum
Ausgaben (0,5 Milliarden Euro beziehungsweise 1
%), auf den Bereich Hochschulen gar keine.
12 % der allgemeinbildenden
Schulen sind Privatschulen
Die Zahl
der Privatschulen in Deutschland nimmt zu: Im
Schuljahr 2023/24 waren rund 3 800
allgemeinbildende Schulen hierzulande in
privater Trägerschaft. Das war knapp jede achte
allgemeinbildende Schule (12 %), wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des
Internationalen Tages der Bildung am 24. Januar
mitteilt. Zugleich gab es knapp 29 000
öffentliche allgemeinbildende Schulen.
Die Zahl der Privatschulen ist in den
vergangenen zehn Jahren um 8 % gestiegen: Im
Schuljahr 2013/2014 hatte es gut 3 500
Privatschulen gegeben. Im selben Zeitraum ging
die Zahl der öffentlichen Schulen um 4 % zurück
(2013/14: 30 300 Schulen).
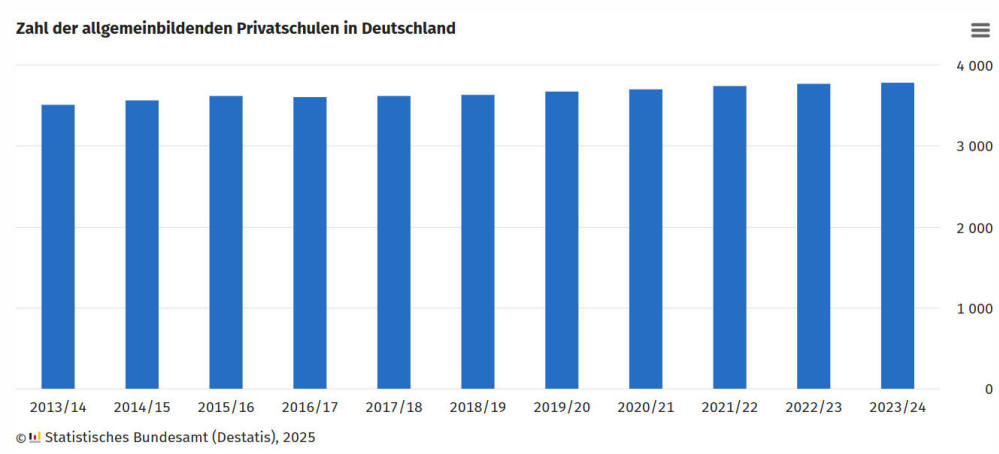
Der Anteil der Privatschülerinnen und
-schüler blieb im Zehn-Jahres-Vergleich jedoch
weitgehend konstant: Im Schuljahr 2023/24 ging
wie in den Jahren zuvor seit 2013/14 knapp ein
Zehntel (9 %) der Kinder und Jugendlichen,
welche allgemeinbildende Schulen besuchten, auf
Privatschulen. Insgesamt waren das 2023/24 rund
801 100 von insgesamt knapp
8,8 Millionen Schülerinnen und Schülern.
Im Schuljahr 2013/14 hatten 730 400 der
insgesamt 8,4 Millionen Schülerinnen und Schüler
eine Privatschule besucht. Diese Konstanz ist
unter anderem darauf zurückzuführen, dass die
Privatschulen durchschnittlich kleiner als die
öffentlichen sind und die Schließungen von
öffentlichen Schulen durch Vergrößerungen der
verbliebenen öffentlichen Einrichtungen
ausgeglichen wurden.
Eltern
bezahlten im Schnitt 2 032 Euro pro Jahr für
einen Privatschulplatz Für einen Platz an einer
Privatschule muss häufig Schulgeld gezahlt
werden. Für rund 595 000 Kinder und Jugendliche
wurde in der Lohn- und Einkommensteuer 2020
Schulgeld geltend gemacht. 2 032 Euro im Jahr
zahlten deren Eltern im Durchschnitt für einen
kostenpflichtigen Privatschulplatz.
Für knapp 7 % kostete der Platz mindestens
5 000 Euro im Jahr, knapp ein Viertel (23 %)
machte zwischen 2 000 und 5 000 Euro steuerlich
geltend, knapp die Hälfte (48 %) zwischen 500
und 2 000 Euro und für 22 % beliefen sich die
Gebühren auf weniger als 500 Euro im Jahr.
Deutliche Unterschiede zeigen sich auf
regionaler Ebene: Am höchsten war das
durchschnittlich steuerlich geltend gemachte
Schulgeld in Hessen mit 3 230 Euro je Kind, am
niedrigsten in Sachsen mit 1 239 Euro.
Zahl der Kita-Kinder mit
Betreuungszeit von mehr als 35 Wochenstunden von
2014 bis 2024 um 30 % gestiegen
• Zahl der Kinder mit Betreuungszeit von bis zu
25 Stunden pro Woche im selben Zeitraum um 8 %
zurückgegangen
• Pädagogisches Kita-Personal
binnen zehn Jahren um 46 % zugenommen, 67 %
arbeiten nicht in Vollzeit
•
Top-3-Erziehungsberufe: Zahl der
Absolvent/-innen auf neuem Höchststand
Lange Betreuungszeiten werden in den
Kindertageseinrichtungen hierzulande immer
häufiger. Die Zahl der Kinder mit einer
vertraglich vereinbarten Betreuungszeit von mehr
als 35 Stunden in der Woche hat von 2014 bis
2024 um 30 % zugenommen, wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt.
Knapp
zwei Drittel (64 %) dieser Kinder hatten zuletzt
eine festgelegte Betreuungszeit von mehr als 45
Wochenstunden. Ebenfalls gestiegen ist in den
vergangenen zehn Jahren die Zahl der Kinder mit
einer Betreuungszeit von 25 bis 35 Wochenstunden
(+25 %).
Einen Rückgang gab es
hingegen bei Kindern mit einer kürzeren
Betreuungszeit von bis zu 25 Stunden in der
Woche: Deren Zahl nahm von 2014 bis 2024 um 8 %
ab. Die durchschnittlich vereinbarte
Betreuungszeit stieg damit in den vergangenen
zehn Jahren von 35,3 auf 36,1 Stunden pro Woche.
Im selben Zeitraum ist die Zahl der betreuten
Kinder insgesamt um ein Fünftel (20 %) gestiegen
– von 3,29 Millionen auf 3,94 Millionen.
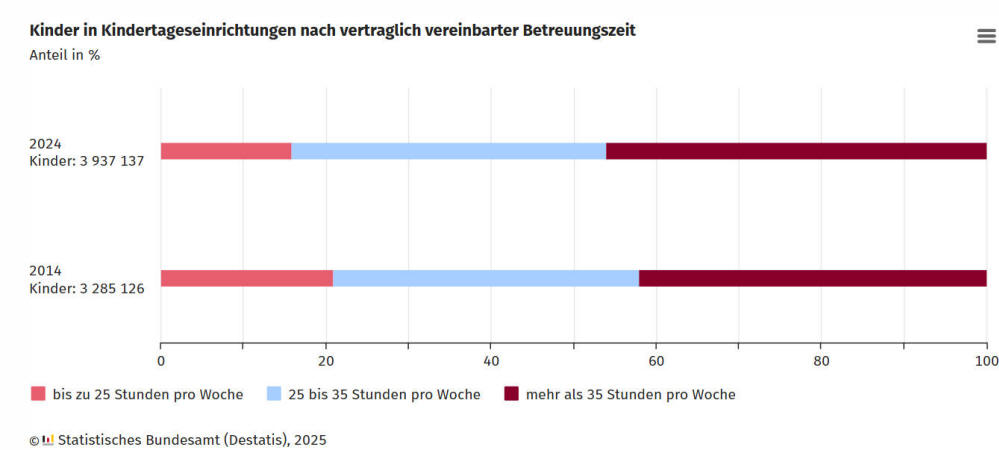
46 % mehr pädagogisches Personal als zehn
Jahre zuvor
Um lange Betreuungszeiten
gewährleisten zu können, wird ausreichend
Personal benötigt. Die Zahl der pädagogisch
tätigen Personen in Kindertageseinrichtungen ist
in den vergangenen zehn Jahren um 46 %
gestiegen. Rund 724 100 Betreuungskräfte
arbeiteten 2024 in Kindertageseinrichtungen, im
Jahr 2014 waren es noch gut 494 300 Personen.
67 % des pädagogischen Kita-Personals
arbeiten in Teilzeit
Obwohl die Zahl der
pädagogischen Betreuungskräfte binnen zehn
Jahren stark gestiegen ist, gilt die
Personalsituation in vielen Einrichtungen als
angespannt. Ein Grund für die personelle Notlage
vieler Kitas dürfte darin liegen, dass der
Anteil der Kita-Betreuungskräfte in Vollzeit
vergleichsweise gering ist: 67 % des
pädagogischen Kita-Personals im Jahr 2024
arbeiteten weniger als 38,5 Stunden pro Woche
(2014: 65 %).
Zur Einordnung: Nach
Ergebnissen des Mikrozensus für das Jahr 2023
arbeiteten 31 % aller abhängig Erwerbstätigen
nicht in Vollzeit. Für das Jahr 2024 liegen noch
keine Daten vor.
55 600 Menschen 2023 mit
Ausbildungsabschluss in Top-3-Erziehungsberufen
Für die pädagogische Arbeit in der
Kindertagesbetreuung qualifiziert unter anderem
eine schulische Ausbildung in einem der drei
häufigsten Erziehungsberufe. Im Jahr 2023
schlossen rund 55 600 Menschen eine solche
Ausbildung als Erzieher/in, Sozialassistent/in
oder sozialpädagogische/r Assistent/in
beziehungsweise als Kinderpfleger/in ab. Das war
ein neuer Höchststand, obwohl für
Schleswig-Holstein die entsprechende Zahl nicht
vorlag.
Knapp die Hälfte (44 %) der
Absolvierenden, die einen beruflichen Abschluss
an Berufsfachschulen, Fachschulen oder
Fachakademien erlangten, erwarb diesen in einem
der Top-3-Erziehungsberufe. Im Jahr 2013 hatten
bundesweit noch 44 100 Absolventinnen und
Absolventen eine Ausbildung in einem dieser
Erziehungsberufe abgeschlossen. Dabei bildet ein
Ausbildungsabschluss als Sozialassistent/in in
der Regel die Basis für eine Laufbahn in
Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens,
in einigen Bundesländern ist der Abschluss
Voraussetzung für die weiterführende Ausbildung
als Erzieher/in sowie als
Heilerziehungspfleger/in.
Erzieher/in
unter Top 10 der Berufe mit den meisten
Anerkennungsverfahren ausländischer Abschlüsse
Für die Kinderbetreuung wird auch auf
Fachkräfte aus dem Ausland gesetzt. 2 778
Verfahren zur Anerkennung eines ausländischen
Berufsabschlusses als Erzieher/in gab es im Jahr
2023. Davon wurden 1 743 positiv, 624 negativ
und 222 noch nicht beschieden. 186 Verfahren
wurden ohne Bescheid beendet. Besonders häufig
ging es um die Anerkennung von Abschlüssen aus
Spanien (324), der Ukraine (237) und der Türkei
(231).
Insgesamt zählt der Abschluss als
Erzieher/in zu den Top 10 in der Rangliste der
Berufe mit den meisten Anerkennungsverfahren
ausländischer Abschlüsse. Die Verfahren zur
Anerkennung eines ausländischen
Berufsabschlusses als Erzieher/in machten knapp
3 % aller Anerkennungsverfahren aus.
Mittwoch, 22.
Januar 2025
Kreis Wesel verlässt X
„Seit der Übernahme durch Elon Musk wird X
zunehmend als Plattform zur Destabilisierung
unserer freiheitlich, demokratischen
Grundordnung genutzt. Auch durch Eigentümer Elon
Musk selbst. Dies steht im Gegensatz zu den
Grundsätzen, die für die Kommunikation
öffentlicher Institutionen in Deutschland
maßgeblich sind. Zudem habe ich in meinen
Amtseid als Landrat geschworen unsere Verfassung
und Gesetze als Basis unserer Demokratie und
unseres Rechtsstaates mit allen mir zur
Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen“,
erklärt Landrat Ingo Brohl.
Der
Kreis Wesel hat daher am 20.01.2025 seinen
offiziellen Kanal auf der Plattform X (ehemals
Twitter) endgültig gelöscht. Bereits seit der
Übernahme der Plattform durch Elon Musk im
Oktober 2023 war der Kanal inaktiv, da die
ständigen Regeländerungen und die neue
Ausrichtung der Plattform mit den Werten und
Zielen des Kreises nicht mehr vereinbar waren.
Neben der bedenklichen inhaltlichen
Ausrichtung und dem Zurückfahren jeglicher
Kontrollmechanismen für Desinformation und Hetze
schwindet zudem die Reichweite der Plattform
weiter. Viele Nutzer, darunter auch wichtige
Partner und Medien, haben die Plattform bereits
verlassen.
Moers: 99 Karikaturen zeigen
humorvollen Blick auf aktuelle Herausforderungen
Mit der Ausstellung ‚Glänzende Aussichten‘ zeigt
die vhs Moers –Kamp-Lintfort in Kooperation mit
den ‚Omas for Future Moers‘ vom 1. bis zum 24.
Februar 99 Karikaturen zu den Themen Konsum,
Klimawandel und Gerechtigkeit.
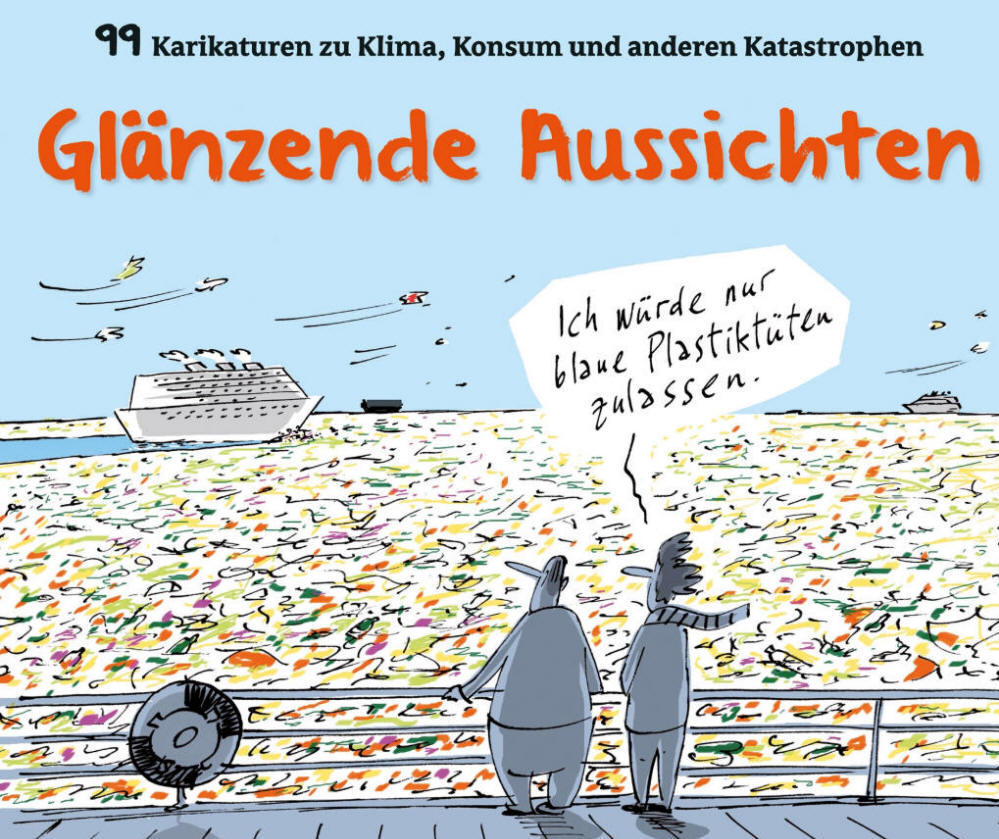
Die humorvolle Ausstellung ‚Glänzende
Aussichten‘ ist ab dem 1. Februar im
Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum zu sehen.
(Foto: Misereor)
Die Präsentation im
Foyer des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums,
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, regt auf besondere
Weise zum Nachdenken über menschliche Abgründe
und weltpolitische Zusammenhänge an. Die ‚Omas
for Future Moers‘ werden jeweils dienstags bis
freitags von 15 bis 17 Uhr und samstags von 11
bis 13 Uhr im Foyer sein, um mit interessierten
Besuchern und Besucherinnen ins Gespräch zu
kommen.
Gut strukturierte
Faktenblätter stellen die wesentlichen
Informationen zum Thema kurz und prägnant dar.
Somit eignet sich die Ausstellung auch für den
Besuch von Schulklassen. Damit interessierte
Schulklassen durch die Ausstellung begleitet
werden können, ist eine vorherige Anmeldung
telefonisch unter 0 28 41/201-565 oder online
unter www.vhs-moers.de erforderlich.
Moers: Gesamtplanung und
Kosten für den Innenstadtumbau im Ausschuss
Der Regionalverband Ruhr hat im Auftrag der
Stadt Moers eine neue Klimaanalyse erstellt.
Erstmals ist auch die Anpassung an den
Klimawandel berücksichtigt worden. Die
Ergebnisse werden im nächsten Ausschuss für
Stadtentwicklung, Planen und Umwelt am
Donnerstag, 23. Januar, vorgestellt.
Beschlossen werden sollen außerdem die
Gesamtplanung und die Kosten für den
Innenstadtumbau, die Gestaltungssatzung für die
Moerser Innenstadt und das Straßen- und
Wegekonzept für die Jahre 2025 bis 2029.
Ein weiteres Thema ist die Straßenplanung
für die Neukirchener Straße im Bereich
Rosendahl- bis Ehrenmalstraße. Die öffentliche
Sitzung beginnt um 16 Uhr im Ratssaal des
Rathauses Moers (Rathausplatz 1).
Moers: Tagung am 25. Januar:
Arbeit im Mittelalter. Zwischen Mühsal und
Berufung
Eine Tagung zum Thema
‚Arbeit im Mittelalter. Zwischen Mühsal und
Berufung‘ findet am Samstag 25. Januar, von 10
bis 17 Uhr im Alten Landratsamt statt.
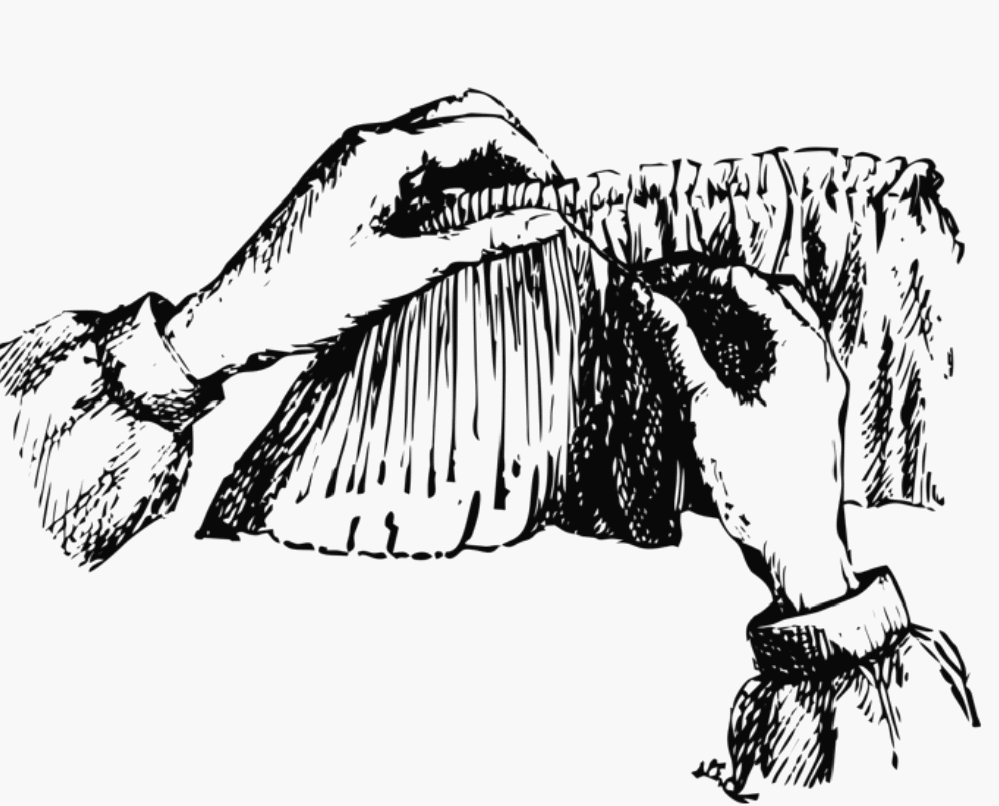
Grafik: Grafschafter Museum
Zwischen
Mühsal und Berufung‘ findet am Samstag 25.
Januar, von 10 bis 17 Uhr im Haus der
Demokratiegeschichte (Altes Landratsamt, Kastell
5) statt. Sie wird im Rahmen der Kooperation der
Stadt Moers mit dem Institut für
niederrheinische Kulturgeschichte und
Regionalentwicklung (InKuR) der Universität
Duisburg-Essen angeboten.
Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen. Unter
der Leitung von Prof. Dr. Gaby Herchert, Dr.
Judith Lange und Diana Finkele stellen Lehrende
und Studierende ihre Untersuchungen zu dem Thema
vor. Der Eintritt ist kostenlos.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Arbeit
war Schutz war Müßiggang Im Mittelalter sahen
die Menschen Arbeit nicht nur als eine Strafe
Gottes, sondern auch als Selbstdisziplinierung,
Schutz vor Müßiggang und Vorbeugung vor
Versuchungen aller Art an.
Nach
ihrer Vorstellung hat Gott jedem Menschen eine
Aufgabe innerhalb der Ordnung zugewiesen, die
sie oder er bestmöglich erfüllen soll. In der
Regel folgte der Sohn dem Vater nach und
übernahm dessen Arbeit. Familien waren zugleich
Produktionsgemeinschaften. Für den Adel gehörte
demonstrativer Müßiggang zur höfischen
Repräsentation.
Im Spätmittelalter
änderten sich die Lebensverhältnisse, die
gesellschaftliche Ordnung und die Einstellungen
zur Arbeit. Mit zunehmender Urbanisierung
differenzierten sich Gewerke und
Dienstleistungen aus und führten zu höherer
sozialer Mobilität und Neuorganisation von
Produktionsprozessen. Manche Diskussionen um
Arbeit und ihre Bedingungen aus der heutigen
Zeit waren aber auch schon damals aktuell.
Moers: „Gemeinsam anders –
Das HGB ermöglicht Teilhabe“
Unter dem Titel „Gemeinsam anders – Das HGB
ermöglicht Teilhabe“ sind alle Interessierten
herzlich eingeladen, eine besondere Lesung sowie
spannende Workshops und Einblicke in die Arbeit
mit Menschen mit Assistenzbedarf zu erleben.
• Lesung
mit Uli Hauser – berührende Geschichten einer
besonderen Reise
Ein Highlight der
Veranstaltung ist die Lesung von Stern-Autor Uli
Hauser aus seinem Buch „Gemeinsam, anders,
glücklich“. Hauser erzählt die bewegende
Geschichte einer außergewöhnlichen Reise mit
seinem Bruder Johannes, der Assistenzbedarf hat,
und zeigt, wie Begegnungen und Erlebnisse das
Leben eines jeden Menschen – ob mit oder ohne
Assistenzbedarf - bereichern können.
• Workshops
für Begegnungen und Mitmachaktionen
Im
Anschluss an die Lesung haben die Gäste die
Gelegenheit, an Workshops teilzunehmen, die von
den Studierenden der Fachschule für
Heilerziehungspflege und der Berufsfachschule
für Sozialassistenz vorbereitet wurden.
Die Workshops decken eine Vielzahl von Themen
ab, darunter Bewegung, Entspannung und gesunde
Snacks. Sie richten sich an Menschen mit und
ohne Assistenzbedarf und bieten Raum für
Austausch und gemeinsames Erleben.
• Einblick
in die Arbeit mit Assistenzbedarf
Die
Veranstaltung bietet nicht nur Unterhaltung und
Inspiration, sondern auch die Möglichkeit, mehr
über das Arbeitsfeld der Heilerziehungspflege zu
erfahren. Interessierte können einen Einblick in
die Ausbildung und den Berufsalltag erhalten.
Nicht zuletzt steht auch die
Behindertenhilfe und Psychiatrie aktuell vor der
Herausforderung des Fachkräfte- und
Personalmangels.
Veranstaltungsdatum 23.01.2025 - 13:00 Uhr -
16:00 Uhr. Veranstaltungsort Landwehrstraße 31,
47441 Moers. Veranstalter
Hermann-Gmeiner-Berufskolleg
Moers: Vinyltreff
Monatlicher Schallplattenbasar am Niederrhein im
Gewerbegebiet Moers-Hülsdonk für alle
diejenigen, die die guten alten Schallplatten zu
schätzten wissen. Das Vinylgestöber findet bei
freiem Eintritt für Besucher statt. Kostenfreie
Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Die Räumlichkeiten sind barrierefrei.
Veranstaltungsdatum 25.01.2025 - 10:00
Uhr - 15:00 Uhr. Veranstaltungsort MUSIC & MORE.
Adresse Am Schürmannshütt 26, 47441
Moers-Hülsdonk.
Moers: Damensitzung
Die 1. Große Grafschafter Karnevalsgesellschaft
"Fidelio" 1951 e.V. veranstaltet eine
Damensitzung im Kulturzentrum Rheinkamp.
Veranstaltungsdatum 25.01.2025 - 15:00
Uhr - 22:00 Uhr. Veranstaltungsort
Kopernikusstraße 9, 47445 Moers. Veranstalter
GGKG Fidelio Moers
Moers: Nachtwächterführung
Wer Moers aus ganz anderer Perspektive
kennenlernen möchte, begleite uns auf dieser
abendlichen Führung. Wandeln Sie auf den Spuren
der Nachtwächter der ehemals befestigten Stadt.
Lassen Sie nach Einbruch der Dunkelheit die
Geschichte von Moers wieder lebendig werden –
und lauschen Sie spannenden Erzählungen aus
früheren Zeiten.

Diese Führung begleitet Erika Ollefs.
Treffpunkt: Denkmal Friedrich I. Neumarkt
Weitere Infos zu den Stadtführungen Kosten:
8 Euro. Veranstaltungsdatum 25.01.2025 - 18:00
Uhr - 20:00 Uhr. Veranstaltungsort Denkmal am
Neumarkt, Neumarkt 47441 Moers.
Moers: Solo Konzert
Bart Maris solo im Jugendzentrum JuNo.
Veranstaltungsdatum 25.01.2025 - 19:00
Uhr - 21:00 Uhr. Veranstaltungsort Jugendzentrum
Nord (JuNo)
Moers: Meisterwerke aus
Romantik und Impressionismus von einem Meister
am Klavier
Am Sonntag, dem 26. Januar gibt es in Moers die
Gelegenheit, ein Klavier-Highlight der
Extraklasse zu erleben. Der amerikanische
Virtuose Menachem Har-Zahav wird um 18 Uhr im
Kammermusiksaal Martinstift (Filderstr. 126)
auftreten. Klassikliebhaber haben hier die
Gelegenheit, die Emotionalität und Finesse der
romantischen und impressionistischen
Klaviermusik hautnah zu erleben.

Ein virtuoser Künstler mit musikalischer
Leidenschaft und Sensibilität
Menachem
Har-Zahav hat sich in der Welt der klassischen
Musik einen Namen gemacht. Mit mehr als
eintausend öffentlichen Auftritten in den USA
und in Europa hat er bei Kritikern und Publikum
gleichermaßen große Anerkennung gefunden.
Sein emotionales und sensibles Klavierspiel und
sein technischer Glanz beeindrucken und
begeistern Musikliebhaber immer wieder.
Eine
abwechslungsreiche Auswahl aus Romantik und
Impressionismus
Auf dem Programm steht eine
abwechslungsreiche Auswahl von Werken bekannter
romantischer und impressionistischer Komponisten
wie Frédéric Chopin, Franz Liszt, Sergei
Rachmaninoff, Maurice Ravel und Claude Debussy.
Eintritt für Kinder und Jugendliche
nur 1 Euro – Begleitung halber Preis Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren zahlen zu
Menachem Har-Zahavs Konzerten einen stark
reduzierten Eintrittspreis von nur einem Euro.
Gleichzeitig erhalten bis zu zwei begleitende
Erwachsene pro Familie Karten zum halben
regulären Eintrittspreis.
Dahinter
steckt sein Wunsch, gerade der Jugend und
Familien einen Anreiz zu geben und zu
ermöglichen, klassische Konzerte zu besuchen. Er
selbst sagt dazu: „Ich finde es schade, dass so
viele Kinder und Jugendliche klassische Musik
als altmodisch und langweilig ansehen. Ich
möchte ihnen die Gelegenheit bieten, zu erleben,
dass Komponisten durch die musikalischen Epochen
hinweg spannende Musik geschrieben haben, die
auch heute noch mitreißt. Die Liebe zur
klassischen Musik darf nicht aussterben!“
Karten für dieses besondere
Klavier-Highlight gibt es für 22 Euro (ermäßigt
19 Euro für Schwerbehinderte ab GdB 50, 1 Euro
für unter 18-Jährige und 11 Euro für deren
Begleitung) im Ticketshop ,
telefonisch unter 0151 / 28 44 24 49 und an der
Abendkasse ab 17.30 Uhr.
Weitere
Informationen zu Menachem Har-Zahav.
Veranstaltungsdatum 26.01.2025 - 18:00
Uhr - 19:45 Uhr. Veranstaltungsort
Kammermusiksaal Martinstift, Filder Straße 126
47447 Moers

Erzeugerpreise Dezember 2024: +0,8 %
gegenüber Dezember 2023
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
(Inlandsabsatz), Dezember 2024 +0,8 % zum
Vorjahresmonat -0,1 % zum Vormonat -1,8 %
Jahresdurchschnitt 2024 gegenüber
Die
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im
Dezember 2024 um 0,8 % höher als im Dezember
2023. Im November 2024 hatte die
Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat
bei +0,1 % gelegen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, gingen die
Erzeugerpreise im Dezember 2024 gegenüber dem
Vormonat um 0,1 % zurück.
Im
Jahresdurchschnitt 2024 waren die gewerblichen
Erzeugerpreise 1,8 % niedriger als im
Jahresdurchschnitt 2023. Im Jahr 2023 hatte die
Veränderung gegenüber dem Vorjahr im
Jahresdurchschnitt noch bei +0,2 % gelegen.
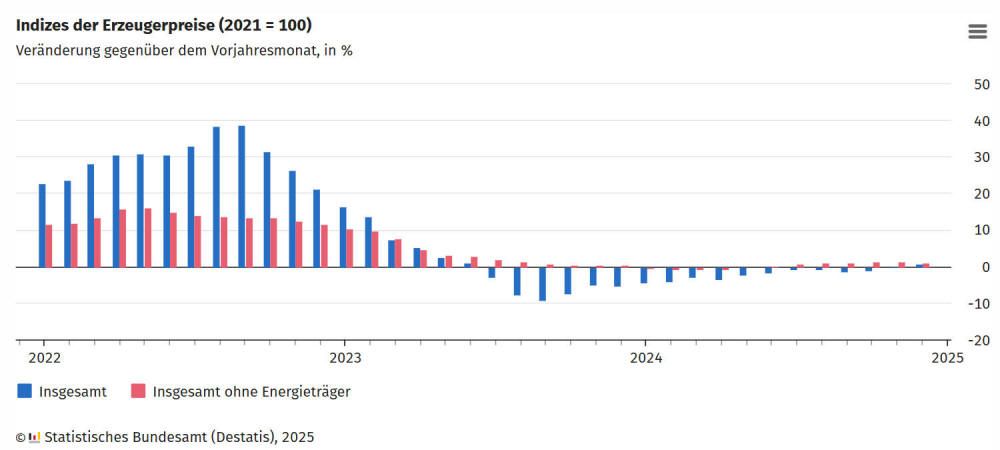
Hauptursächlich für den Anstieg der
Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat
waren im Dezember 2024 die Preissteigerungen bei
den Investitionsgütern. Auch Verbrauchsgüter,
Gebrauchsgüter und Vorleistungsgüter waren
teurer als im Vorjahresmonat, während Energie
billiger war. Ohne Berücksichtigung von Energie
stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum
Vorjahresmonat im Dezember 2024 um 1,2 % und
blieben gegenüber November 2024 unverändert.
Rückgang der Energiepreise gegenüber
Vorjahresmonat und dem Vormonat
Energie war
im Dezember 2024 um 0,2 % billiger als im
Vorjahresmonat. Gegenüber November 2024 fielen
die Energiepreise um 0,4 %. Den höchsten
Einfluss auf die Veränderungsrate gegenüber dem
Vorjahresmonat bei Energie hatten die
Preisrückgänge für Erdgas in der Verteilung. Die
Gaspreise fielen über alle Abnehmergruppen
betrachtet gegenüber Dezember 2023 um 5,6 %
(+0,2 % gegenüber November 2024).
Elektrischer Strom kostete im Dezember 2024 über
alle Abnehmergruppen hinweg 1,3 % weniger als im
Dezember 2023. Gegenüber dem Vormonat November
2024 sanken die Strompreise um 1,6 %.
Mineralölerzeugnisse waren im Dezember 2024 um
4,0 % billiger als im Dezember 2023. Gegenüber
November 2024 stiegen diese Preise um 0,3 %.
Leichtes Heizöl kostete 4,8 % weniger als ein
Jahr zuvor (+2,8 % gegenüber November 2024). Die
Preise für Kraftstoffe waren 3,9 % niedriger
(+0,8 % gegenüber November 2024).
Dagegen
kostete Fernwärme 17,2 % mehr als im Dezember
2023, die Preise blieben gegenüber November 2024
unverändert.
Preisanstiege bei
Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und
Gebrauchsgütern
Die Preise für
Investitionsgüter waren im Dezember 2024 um 1,8
% höher als im Vorjahresmonat (unverändert
gegenüber November 2024). Maschinen kosteten 2,0
% mehr als im Dezember 2023. Die Preise für
Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um 1,4 %
gegenüber Dezember 2023.
Verbrauchsgüter
waren im Dezember 2024 um 2,6 % teurer als im
Dezember 2023 (+0,2 % gegenüber November 2024).
Nahrungsmittel kosteten 3,1 % mehr als im
Dezember 2023. Deutlich teurer im Vergleich zum
Vorjahresmonat waren Butter mit +40,9 % (+2,1 %
gegenüber November 2024) und Süßwaren mit +24,4
% (+0,6 % gegenüber November 2024).
Rindfleisch kostete 15,9 % mehr als im Dezember
2023 (+1,7 % gegenüber November 2024). Billiger
als im Vorjahresmonat waren im Dezember 2024
dagegen insbesondere Zucker (-32,6 %),
Schweinefleisch (-7,0 %) und Getreidemehl (-6,3
%).
Gebrauchsgüter waren im Dezember 2024
um 1,0 % teurer als ein Jahr zuvor (+0,1 %
gegenüber November 2024).
Leichter
Preisanstieg bei Vorleistungsgütern gegenüber
Dezember 2023
Die Preise für
Vorleistungsgüter waren im Dezember 2024 um 0,1
% höher als ein Jahr zuvor. Gegenüber dem
Vormonat fielen sie um 0,1 %.
Preissteigerungen gegenüber Dezember 2023 gab es
unter anderem bei Natursteinen, Kies, Sand, Ton
und Kaolin (+4,2 %), Gipserzeugnissen für den
Bau (+3,8 %), Elektrischen Transformatoren (+2,6
%) sowie bei Kabeln und elektrischem
Installationsmaterial (+1,1 %).
Holz
sowie Holz- und Korkwaren kosteten 2,2 % mehr
als im Dezember 2023. Nadelschnittholz war 14,7
% teurer als im Dezember 2023. Dagegen war
Laubschnittholz 5,6 % günstiger als im
Vorjahresmonat. Die Preise für Spanplatten waren
gegenüber dem Vorjahresmonat 2,6 % niedriger.
Die Preise für Metalle sanken gegenüber dem
Vorjahresmonat um 0,3 %, gegenüber dem Vormonat
stiegen sie dagegen um 0,1 %. Roheisen, Stahl
und Ferrolegierungen war 7,6 % billiger als im
Dezember 2023. Die Preise für Betonstahl sanken
im Vorjahresvergleich um 1,5 %. Dagegen lagen
die Preise für Kupfer und Halbzeug daraus mit
+6,4 % deutlich über denen des Vorjahresmonats.
Chemische Grundstoffe verbilligten sich
insgesamt um 0,7 % gegenüber dem Vorjahresmonat.
Glas und Glaswaren waren 5,4 % günstiger als im
Vorjahresmonat, Futtermittel für Nutztiere waren
3,8 % günstiger.
Veränderungen im
Jahresdurchschnitt 2024 gegenüber 2023
Den
größten Einfluss auf den Rückgang der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im
Jahresdurchschnitt 2024 um 1,8 % gegenüber dem
Vorjahr hatte die Entwicklung der Energiepreise.
Im Durchschnitt sanken diese Preise gegenüber
dem Vorjahr um 6,2 %. Erdgas in der Verteilung
war im Jahresdurchschnitt 2024 um 13,3 %
billiger als 2023, elektrischer Strom 10,3 %.
Mineralölerzeugnisse kosteten im
Jahresdurchschnitt 4,1 % weniger als 2023.
Ohne Berücksichtigung der Energiepreise
erhöhten sich die Erzeugerpreise 2024 gegenüber
dem Vorjahr um 0,3 %.
Vorleistungsgüter
waren im Jahr 2024 durchschnittlich 1,2 %
billiger als 2023. Hier wirkte sich die
Preisentwicklung für Metalle mit -3,6 % am
stärksten aus. Besonders stark sanken die Preise
für Pellets und Briketts aus Sägenebenprodukten
(-29,0 %), für Flachglas (-24,8 %) und für
Düngemittel und Stickstoffverbindungen (-17,2
%).
Die Preise für Investitionsgüter
waren im Jahresdurchschnitt 2024 um 2,2 % höher
als 2023. Gebrauchsgüter verteuerten sich um 1,0
%.
Verbrauchsgüter waren im Jahr 2024
durchschnittlich 1,1 % teurer als 2023.
Nahrungsmittel kosteten 0,8 % mehr als 2023.
Besonders stark stiegen die Preise für Butter
(+26,6 %) und für verarbeitete Süßwaren (+20,1
%). Dagegen sanken die Preise für Getreidemehl
um 13,7 %, für Zucker um 4,3 %.

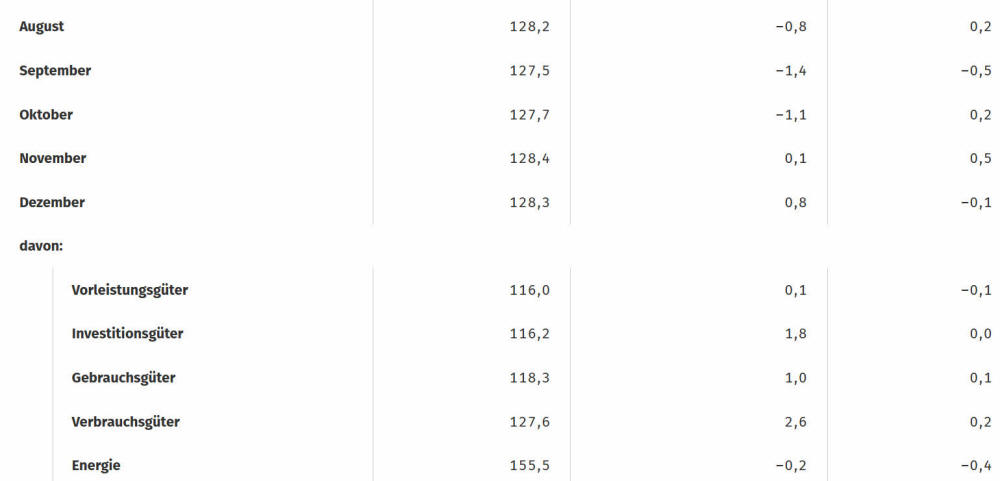
Dienstag, 21.
Januar 2025
Jährliches Treffen der
Bürgermeister der Euregio-Großstädte:
Nachhaltige Quartiersentwicklung im Fokus
Sich innerhalb der Euregio-Rhein-Waal
austauschen und erfolgreich zusammenarbeiten –
dieses Ziel stand erneut im Mittelpunkt, als
sich die Bürgermeister der sieben
Euregio-Großstädte Nijmegen, Apeldoorn, Arnhem,
Ede (alle Niederlande), Düsseldorf, Duisburg und
Moers am Freitag, 17. Januar, im Eurotec-Looop
in Moers trafen.
Im Fokus der
diesjährigen Gespräche stand ein neues Projekt
zur nachhaltigen Quartiersentwicklung. Die
Stadtoberhäupter erörterten, wie sie das
Gelingen einer klimaneutralen und resilienten
Gestaltung von Stadtteilen und Stadtquartieren
bestmöglich gemeinsam vorantreiben können. Vor
dem Hintergrund des Pariser
Klimaschutzabkommens, das das Ziel hat, die
Durchschnittstemperatur nicht stärker als 1,5
Grad steigen zu lassen, sollen kooperativ die
kreativen Ideen und Ansätze aller Partner auf
der Stadtquartiersebene betrachtet werden.
Das zu diesem Zweck ins Leben gerufene
Projekt „100.000 plus.zero“ stellt einen
weiteren wichtigen Baustein in der
erfolgreichen, grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit der Euregio-Großstädte dar.
Gemeinsam mit den sechs Partnern warb die Stadt
Ede als Leadpartner Fördermittel in Höhe von
rund 50.000 Euro aus dem INTERREG-Programm ein.
In der Folge werden Lösungsansätze
für eine nachhaltige Quartiersentwicklung
ausgelotet und erarbeitet, von denen die
beteiligten Großstädte profitieren – und die
auch kleineren Städten der Region als Vorbild
dienen können. Die besondere Bedeutung dieses
Projektes konnte beim Treffen von den
beteiligten Bürgermeistern als nicht hoch genug
hervorgehoben werden. So betont auch
Stadtdirektor Martin Murrack als Vertreter
Duisburgs, dass es für diese Mammutaufgabe keine
Musterlösungen oder Blaupausen gibt. Dennoch
biete der aktuelle Ansatz einen hohen
grenzüberschreitenden Mehrwert.
„Der
inspirierende Austausch mit den niederländischen
Partnern kann eine Bereicherung für unsere Stadt
sein. Wir brauchen Innovationen und
Quartiersentwicklungen, um in einer dicht
besiedelten Stadt wie Duisburg eine gesunde
Zukunft für die nachwachsenden Generationen zu
gestalten.“
Städte betreten bei der
immer dringender werdenden Klimafolgenanpassung
und der resilienten Stadtentwicklung oft
Neuland. Und mehr noch: Die Folgen des
Klimawandels stellen aktuell gerade auch für
Kommunen „per se“ eine Herausforderung in
höchstem Maße dar – sind sie doch in vielen
Bereichen die treibenden Kräfte bei zentralen
Transformationsaufgaben. Zu betrachten und zu
bearbeiten ist die gesamte thematische Klaviatur
von der Verkehrs-, Energie- und Bau- bis hin zur
Boden- und Agrarwende.

An der Jahrestagung nahmen folgende Amtsträger
teil. Im Bild von links nach rechts: Hubert
Bruls (Nijmegen), René Verhulst (Ede), Ahmed
Marcouch (Arnheim), Peter Messerschmidt
(Apeldoorn), Dr. Stephan Keller (Düsseldorf),
Stadtdirektor Martin Murrack (Duisburg),
Christoph Fleischhauer (Moers).
Das
100.000+Städtenetzwerk arbeitet auf Basis des
Memorandums of Understanding aus dem Jahr 2017
in zahlreichen Themen in der Euregio Rhein-Waal
zusammen.
Moers: Ausschuss für
Bürgeranträge berät über Verkehrsthemen
Verschiedene Verkehrsthemen beraten die
Mitglieder des Ausschusses für Bürgeranträge am
Dienstag, 21. Januar. Die Sitzung findet um 16
Uhr im Ratssaal des Rathauses (Rathausplatz 1)
statt.
Unter anderem geht es um
regensichere Wartestellenhäuschen, einen
geforderten Zaun im Bereich der Cölve-Brücke und
die Erweiterung der Bewohnerparkzone 7 auf die
gesamte Sedanstraße.
Moers: Zunächst keine
weiteren Fällungen im Schlosspark
Bis auf Weiteres werden keine Fällungen von
Bäumen mehr im Rahmen der Schlossparksanierung
durchgeführt. Das Gesamtkonzept ‚Denkmalgerechte
und zukunftsorientierte Sanierung des
Schlossparks‘ wird unter Beteiligung aller
Gruppierungen möglichst bis zur Sommerpause noch
einmal überarbeitet und dann politisch
beschlossen. Die bisherigen Beschlüsse werden
aufgehoben.
Diese Ergebnisse
brachte eine Sondersitzung des Stadtrats am
Donnerstag, 16. Januar. Auch etwa 14 bereits
geschädigte Bäume bleiben somit zunächst stehen.
Sie werden unter Einbeziehung externer
Sachverständiger – benannt durch die
Bürgerinitiative und den Grafschafter Museums-
und Geschichtsverein - erneut begutachtet.
Bis Ende Februar sollen dann noch
einzelne Fällungen vorgenommen werden. Eine
Bürgerinitiative hatte gegen die bereits
beschlossenen Pläne protestiert. Daraufhin hat
eine Fraktion die Sondersitzung beantragt. Die
Aufzeichnung der gesamten Sitzung steht noch bis
Donnerstag, 23. Januar, online zur Verfügung.
Zur Version ohne Untertitel.
Zur Version mit Untertiteln.
Kleve: Fällung von Bäumen am
Dorfanger in Reichswalde notwendig
Hohe Temperaturen und langanhaltende
Trockenperioden im Sommer setzen Bäumen in
Deutschland immer stärker zu. Aktuell machen
sich die Auswirkungen des Klimawandels wieder an
einem konkreten Beispiel in unserer Region
bemerkbar: Auf einer Waldfläche der Stadt Kleve
an der Straße Dorfanger im Ortsteil Reichswalde
müssen Buchen gefällt werden. Planmäßig soll die
Maßnahme bis Anfang Februar abgeschlossen sein.

Kettensäge-Aktion am Kermisdahl
Die Bäume
sind aufgrund der klimatischen Herausforderungen
der vergangenen Jahre nicht mehr vital und
können nicht länger erhalten werden. Auch aus
Gründen der Verkehrssicherung ist es notwendig,
das Gebiet in Reichswalde konsequent zu
durchforsten. Bei der Umsetzung der Maßnahme
wird die Stadt Kleve eng durch die zuständige
Försterin begleitet. Klimaresistente und
standortangepasste Nachpflanzungen an derselben
Stelle sind für Herbst 2025 geplant. Mit vier
verschiedenen Baumarten soll ein klimastabiler
Mischwald entstehen.
Neue E-Mail-Adresse für Klimaschutz,
Umwelt und Nachhaltigkeit in Kleve
Zum Jahresbeginn hat der Fachbereich
Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit der Stadt
Kleve eine zentrale E-Mail-Adresse für alle
Fragen zu den Themenbereichen Klima,
Grünflächen, Spielplätze, Parks und
Straßenbäume, Nachhaltigkeit, Mobilität sowie
Umweltschutz eingerichtet. Ziel ist es, die
Kommunikation zwischen der Stadtverwaltung und
den Bürgerinnen und Bürgern in
Umweltangelegenheiten direkter, einfacher und
effizienter zu gestalten.

Ein Eichenbaum von unten - Bild: Xalanx -
stock.adobe.com
Ab sofort können sich
Bürgerinnen und Bürger mit Ihren Fragen oder
Anregungen zu Themen wie Bäumen, Grünflächen,
Spielplätzen oder der Fahrrad-Infrastruktur
direkt unter der Mailadresse Umwelt@kleve.de an
die Stadt Kleve wenden. Auch Anliegen zur
kommunalen Wärmeplanung, zum
Klimaschutzfahrplan, zum Klimaanpassungskonzept
oder städtischen Förderprogrammen, wie der
Solar- oder Gründachförderung, können über diese
Adresse geklärt werden.
Für Themen wie
Artenschutz, Vertragsnaturschutz oder Fragen zu
Landschafts- und Naturschutzgebieten sowie
Alleen bleibt die Untere Naturschutzbehörde des
Kreises Kleve die richtige Ansprechpartnerin.
Die Stadt Kleve freut sich auf den direkten
Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern, um
gemeinsam an einer nachhaltigen und lebenswerten
Zukunft für unsere Stadt zu arbeiten.
Betrugsversuche
nehmen zu: Vorsicht beim Scannen von QR-Codes im
Ausland
Seit der Corona-Pandemie
sind QR-Codes aus dem Verbraucheralltag nicht
mehr wegzudenken. Das haben auch Kriminelle
erkannt, die mit gefälschten QR-Codes und
Webseiten versuchen, schnelles Geld zu machen.
Aufpassen müssen insbesondere Autofahrerinnen
und Autofahrer. Denn der Betrug (auch Quishing
genannt) findet meist an Ladesäulen für
Elektroautos oder an Parkautomaten statt.

© Touchr / Adobe Stock
Quishing: So gehen
die Täter vor
In einem ersten Schritt
erstellen die Kriminellen eine Internetseite,
die einer offiziellen Seite zum Beispiel einer
Stadt oder eines Ladesäulenbetreibers ähnelt.
Im zweiten Schritt präparieren die Betrüger
einen QR-Code, der auf die gefälschte Seite
verlinkt. Den ausgedruckten QR-Code bringen sie
dann an öffentlichen Parkuhren, Ladesäulen für
Elektroautos etc. an oder überkleben die echten
QR-Codes. Verbraucherinnen und Verbraucher, die
nun den QR-Code scannen und ihre persönlichen
Daten eingeben, um z.B. eine Rechnung zu
begleichen, zahlen das Geld direkt an die
Betrüger bzw. geben ihre Daten direkt an diese
weiter.
Wo kann man dem CR-Code-Betrug
begegnen?
Quishing ist vor allem im
öffentlichen Raum anzutreffen. Dort, wo QR-Codes
bereits vorhanden sind, um einen Vorgang zu
erleichtern, damit Verbraucher zum Beispiel eine
Gebühr einfach bezahlen können. Also an
Parkuhren, E-Ladesäulen, an Bahnhöfen,
Bushaltestellen, Fahrradverleihstationen oder
über gefälschte Strafzettel an der
Windschutzscheibe.
Die Betrugsversuche wurden
bereits europaweit gemeldet - Urlauber können
ihnen also in jedem Land begegnen.
Wie
kann man sich vor dem QR-Code-Betrug schützen?
Seien Sie bei öffentlichen QR-Codes skeptisch:
QR-Codes auf Flyern, Plakaten oder anderen
öffentlichen Orten können leicht manipuliert
oder ausgetauscht werden. Scannen Sie diese nur,
wenn Sie der Quelle vertrauen.
Prüfen Sie
Alternativen: Verwenden Sie, wenn möglich, die
direkte Eingabe der URL anstelle eines QR-Codes.
Prüfen Sie Links genau: Viele QR-Scanner-Apps
zeigen die URL vor dem Öffnen an. Kontrollieren
Sie diese sorgfältig und achten Sie auf
verdächtige Domains oder Rechtschreibfehler.
Im Zweifel nicht interagieren: Schließen Sie
die Website, wenn Sie unsicher sind, und geben
Sie keine persönlichen Daten oder
Bankinformationen ein.
Handeln Sie bei
Betrug: Sollte es zu einer verdächtigen
Transaktion gekommen sein, sperren Sie die
Kreditkarte umgehend, beantragen Sie bei Ihrer
Bank ein Chargeback und informieren Sie Polizei
sowie den Betreiber.
Hier finden Sie
ausführliche Informationen zum Thema Quishing
und wie Sie sich davor schützen können.
Stadt Kleve präsentiert
Merchandise-Kollektion: Stadtsilhouette trifft
auf lokale "Warming Stripes"
In
einer neuen Merchandise-Kollektion vereint die
Stadt Kleve Klimabewusstsein mit Heimatliebe. Ab
sofort sind unter anderem Tassen, Stofftaschen
und Kühlschrankmagnete bei der Wirtschaft,
Tourismus und Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM)
erhältlich. Ihre Gestaltung verbindet markante
Bestandteile der Klever Stadtsilhouette mit
einer lokal angepassten Version der "Warming
Stripes" – basierend auf den Temperaturdaten der
Stadt Kleve.

Die Verantwortlichen präsentieren die neuen
Artikel mit Klever Warming Stripes
Präsentieren die neuen Merchandise-Artikel
(v.l.): Christoph Bors, Merle Gemke, Martina
Gellert, Kristina Janßen.
Die
"Warming Stripes" sind eine visuelle Darstellung
der globalen Temperaturentwicklung und wurden
vom Klimaforscher Ed Hawkins entwickelt. Für die
neue Kollektion wurden die Streifen speziell an
die Temperaturdaten der Stadt Kleve angepasst,
um die lokalen Auswirkungen des Klimawandels
sichtbar zu machen. In Kombination mit der von
Maren Rombold gestalteten Stadtsilhouette
entsteht ein ausdrucksstarkes Design mit
Bedeutung.
„Mit diesen Produkten möchten
wir auf die Bedeutung des Klimaschutzes und der
Klimaanpassung hinweisen und zugleich die
Identität unserer Stadt betonen“, erklärt
Christoph Bors, Klimaschutzmanager der Stadt
Kleve. „Durch die Darstellung der Warming
Stripes mit Kleves Temperaturanstieg machen wir
deutlich, dass der Klimawandel nicht nur ein
globales, sondern auch ein lokales Thema ist,
das uns alle betrifft.“
Die Kollektion
ist ab sofort an der Touristinfo der WTM im
Klever Rathaus erhältlich. Während die
umweltfreundlichen Stofftaschen eine nachhaltige
Alternative zu Plastiktüten bieten, erfüllen die
Tassen und Magnete gleichermaßen praktische als
auch dekorative Zwecke. Mit dieser Kollektion
möchte die Stadt Kleve ein Zeichen für
nachhaltiges Handeln setzen und lädt Bürgerinnen
und Bürger ein, sich mit der Klimaproblematik
auf lokaler Ebene auseinanderzusetzen.
Tierisches Yoga im Museum
Kurhaus Kleve
Im Rahmen des
Begleitprogramms der großen Sonderausstellung
„Ewald Mataré: KOSMOS“ findet am Donnerstag, dem
23. Januar 2025 von 18 bis ca. 19 Uhr ein
„Tierisches Yoga“ im Museum Kurhaus Kleve statt.

Beim Angebot „Tierisches Yoga“ im Januar 2025
handelt es sich um ein Kooperationsprojekt
zwischen Tiergarten und Museum Kurhaus Kleve,
das von der VHS Kleve angeregt wurde und
organisiert wird. Die Ansprechperson der VHS
Kleve bei Fragen und Unklarheiten ist Aija
Samina-Edelhoff, Tel. 02821/84-718, E-Mail
vhs@kleve.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 10
Euro pro Person, es werden maximal 15 Personen
angenommen. Eine Anmeldung ist ->hier über die
Website der VHS Kleve möglich.
Winterlesung mit Hubert Wanders im
Museum Kurhaus Kleve
Auch im Jahr
2025 wird das beliebte Format der Winterlesungen
im MKK fortgesetzt. Dabei stellen Protagonisten
des kulturellen Klever Lebens in eigener Auswahl
Texte der Weltliteratur vor und bringen sie auf
je individuelle Weise zu Gehör. Diesmal geht es
um nichts existenzielleres als sogenannte
„Wendepunkte“, entscheidende Momente und
Weichenstellungen im persönlichen und
gesellschaftlichen Bereich, nach denen nichts
mehr so ist wie vorher.
Die zweite Lesung
mit Hubert Wanders findet am Donnerstag, den 23.
Januar 2025, um 19.30 Uhr statt und widmet sich
Lea Ypis Frei. Erwachsenwerden am Ende der
Geschichte(2021)

Tirana 20. Februar 1991: Die Statue von Enver
Hoxha wird vom Sockel gestürzt, in Albanien
endet das Zeitalter des stalinistisch geprägten
Kommunismus, in dem Geheimpolizei und Partei das
Leben bestimmten. Aber schon bald löst sich die
Hoffnung auf eine bessere Zukunft auf: Die
Wirtschaft ist ruiniert, die Arbeitslosigkeit
groß, das Land droht im Chaos zu versinken,
ungeheuer große Massen von Albanern auf dem
maroden Schiff Vlora wollen im August des Jahres
im Hafen von Bari nach Italien einreisen.
Diese Geschehnisse beschreibt Lea Ypi
(geboren 1979) aus der Sicht einer
Erwachsenwerdenden. Sie erzählt von ihrer
geborgenen Kindheit und Schulzeit in Albanien,
gibt Einblicke in den Alltag der kommunistischen
Zeit und lässt den Leser teilhaben an den
Gefühlen einer Elfjährigen beim Sturz des alten
Regimes in 1991. An diesem Wendepunkt erfährt
sie auch Fakten aus der Vergangenheit ihrer eng
mit der Geschichte Albaniens verbundenen
Familie, die ihr bis dahin verschwiegen wurden.
In diese autobiografische Erzählung
verwebt die Autorin ihre philosophischen
Gedanken über unterschiedliche Formen der
Freiheit. Lea Ypi hat in Italien Philosophie und
Literatur studiert, u.a. in Paris und Frankfurt
geforscht. Sie lehrt seit 2016 als Professorin
für Politische Theorie an der London School of
Economics und besetzte 2024 den
Benjamin-Lehrstuhl des Centre for Social
Critique an der Humboldt-Universität Berlin.
Hubert Wanders stellt dieses Buch von Lea
Ypi vor, dass Die Zeit als ein „leuchtendes
Memoir über ein vergessenes Stück Europa“
beschrieb, und ergänzt dies durch
Albanien-Bilder aus verschiedenen Zeiten.
Die
Lesungen finden jeweils am Donnerstag um 19.30
Uhr in der Lounge des Museum Kurhaus Kleve
statt, der Eintritt beträgt 5 EUR (reduziert und
für Mitglieder des Freundeskreises 3 EUR).
Workshops „Die liegende Kuh
plastisch formen“ im Museum Kurhaus Kleve
Am Samstag, dem 25. Januar 2025 finden zwei
Workshops mit Stefanie Dennstedt statt, bei
denen es sowohl um die Kühe von Ewald Mataré als
auch um Skulpturen aus Pappmaché geht. Für
Mataré war nicht nur wichtig wie eine
Tierskulptur aussieht, sondern auch dass sie
sich gut anfühlt.
In der WunderKammer werden mit den eigenen
Händen verschiedene Materialien und Formen
ausprobiert. Zum Schluss formt jedes Kind seine
eigene Kuh aus Pappmaché.
Workshop 1
Der erste Workshop findet von 11 bis 12 Uhr
statt und richtet sich an 3- bis 5-Jährige in
Begleitung. Die Kosten hierfür betragen 8,- €
pro Person.
Workshop 2
Der zweite
Workshop findet direkt im Anschluss von 12.30
bis 14 Uhr statt und richtet sich an 6- bis
8-Jährige ohne Begleitung. Die Kosten hierfür
betragen 11,- € pro Person.
Anmeldungen
sind zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag
von 11 bis 17 Uhr) am Empfang des Museum Kurhaus
Kleve [Tel. +49-(0)2821 / 750 10, E-Mail
empfang@mkk.art] möglich.
Kopfkino-Vorlesen am 25. Januar
2025 in der Klever Stadtbücherei
Am
Samstag, 25. Januar 2025 findet ab 10:30 das erste
„Kopfkino“ des Jahres 2025 in der Stadtbücherei
Kleve, Wasserstraße 30-32, statt. Die Vorlesepaten
Hans-Peter Bause und Jeroen Blok lesen Geschichten
von Janosch.

Gemäß dem Motto „Wenn man einen Freund hat, braucht
man sich vor nichts auf der Welt fürchten“ bekommen
Kinder die schönsten Geschichten vom kleinen Tiger
und vom kleinen Bären zu hören. Der kleine Tiger
und der kleine Bär sind dicke Freunde, die jede
Menge Abenteuer erleben.
Und sie fürchten
sich vor nichts, weil sie zusammen wunderbar stark
sind. Bei „Oh, wie schön ist Panama“, „Riesenparty
für den Tiger“ und „Ich mach Dich gesund, sagt der
Bär“ darf jedes Kind sein Kopfkino einschalten.
Der Eintritt zum Kopfkino ist
selbstverständlich frei, eine Anmeldung nicht
erforderlich
Not-Eingriff in der Zentralen Notaufnahme des
St. Josef Krankenhauses Moers
„Kleines Wunder“: Ärzt:innen des
Krankenhauses Bethanien und des St. Josef
Krankenhauses operieren Patienten mit gedeckt
geplatztem Bauchaortenaneurysma erfolgreich
Dass ein 56-jähriger Patient mit einem
gedeckt rupturierten Bauchaortenaneurysma
überlebt hat, hat er dem beherzten Eingreifen
und der guten Zusammenarbeit von Ärzt:innen des
Krankenhauses Bethanien Moers und des St. Josef
Krankenhauses Moers zu verdanken.
Ende November 2024 stellte sich der Patient mit
stärksten Schmerzen und dem Verdacht auf eine
Nierenkolik in der Zentralen Notaufnahme (ZNA)
des St. Josef Krankenhauses vor. Bei einer
umgehend erfolgten Ultraschalluntersuchung wurde
eine große Aussackung an der Bauchschlagader mit
einem umgebenden Bluterguss festgestellt.
Bei diesem sogenanntem gedeckt rupturierten
Bauchaortenaneurysma handelt es sich um eine
geplatzte Aussackung an der Bauchschlagader, bei
der die Ausbreitung des Blutes durch Knochen
oder umliegendes Gewebe gebremst wird und die
umgehend behandelt werden muss. Dies sollte im
Krankenhaus Bethanien Moers passieren, das den
Patienten zur Operation des Aneurysmas in der
Klinik für Gefäßchirurgie & Phlebologie unter
Chefarzt Prof. Dr. Bruno Geier übernehmen
sollte. Noch vor dem Transport des 56-jährigen
Patienten verschlechterte sich sein Zustand
jedoch akut, sodass eine Verlegung nicht mehr
möglich war.
Im Schockraum des
St. Josef Krankenhauses wurde der Patient in
Narkose versetzt und der Chefarzt der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie des St. Josef
Krankenhauses, Dr. Marc Renter, nahm noch in der
ZNA eine Bauchöffnung vor und legte eine Klemme
an die Bauchaorta an, um die Blutung zu stoppen,
die durch das rupturierte Aneurysma entstanden
war. Dem Team aus Anästhesie, Chirurgie und
Zentraler Notaufnahme des St. Josef
Krankenhauses gelang es so, den Patienten zu
stabilisieren.
Parallel wurde Prof.
Dr. Geier im Krankenhaus Bethanien als
Spezialist für Gefäßchirurgie erneut
kontaktiert, mit der Bitte, den Patienten direkt
im St. Josef Krankenhaus zu operieren: „Ich habe
schnell die entsprechenden Gefäßprothesen
organisiert und dann wurde ich auch schon
abgeholt. Mit dem Notarzteinsatzfahrzeug der
Feuerwehr Moers und Blaulicht ging es rüber ins
Nachbarkrankenhaus.“
Prof. Geier
erläutert weiter: „Im St. Josef Krankenhaus
angekommen, waren sehr viele Menschen in der
ZNA, um dem Patienten zu helfen und ihn zu
versorgen. Dr. Renter hatte bereits eine Klemme
an die Bauchaorta gesetzt, um die Blutung zu
stoppen. Mithilfe einer weiteren provisorischen
Klemme, die wir gemeinsam setzten, konnte der
Patient so weit stabilisiert werden, dass er in
den OP gebracht werden konnte.“
Im
Operationssaal wurde der 56-Jährige von Prof.
Dr. Geier, Dr. Renter und zwei Oberärztinnen der
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des
St. Josef Krankenhauses erfolgreich operiert.
Während des rund zweieinhalbstündigen Eingriffs
wurde dem Patienten eine Y-förmige Prothese an
der Bauchaorta eingesetzt und dieser
anschließend auf die Intensivstation des St.
Josef Krankenhauses verbracht.
„Es ist
erstaunlich, dass der Patient nach allem, was er
mitgemacht hat und nach der Gabe von vielen
Blutprodukten so stabil ist“, erklärt Prof.
Geier. „Es ist schon ein kleines Wunder, dass er
all das gut überstanden hat. Durch das beherzte
und mutige Eingreifen von Dr. Renter und seinem
Team und dem Anruf bei uns, konnten wir das
gemeinsam meistern – und der Patient überleben.“
Aortenaneurysma – Definition, Symptome,
Ursachen
Ein erhöhtes Risiko für die
sackförmige Erweiterung in der Hauptschlagader
haben Männer ab 65 Jahren. „Wenn ein Aneurysma
platzt und ,frei‘ bluten kann, ohne von Gewebe
gehalten bzw. gedeckt zu werden, verblutet man
innerhalb weniger Minuten. Oft merken die
Patientinnen und Patienten nicht, dass sie eine
solche Aussackung haben. Manche Betroffene
klagen über Rückenschmerzen, ansonsten ist ein
Aortenaneurysma symptomlos. Es sind oftmals
Zufallsfunde, bei denen dann, je nach Größe und
Lage, schnelles Handeln gefordert ist“, klärt
der erfahrene Chefarzt Prof. Geier auf.
„40 bis 50 % der Patientinnen und Patienten
versterben an einem rupturierten
Bauchaortenaneurysma.“ Die Ursachen hierfür
kennt man nicht genau. Eine Schwäche der Gefäße
oder eine erblich bedingte Neigung zu einem
Aortenaneurysma spielen ebenso eine Rolle, wie
hoher Blutdruck, Rauchen oder Krankheiten, wie
COPD, da sie das Risiko für Aortenaneurysmen
fördern können.
Ultraschalluntersuchung der Bauchaorta
Seit
2018 übernehmen die Krankenkassen einmalig ein
Screening der Bauchaorta für Männer ab 65
Jahren. Hierbei misst der bzw. die Ärzt:in
mittels Ultraschall die Aorta an der Stelle mit
dem größten Durchmesser unterhalb der Stelle, an
der die Nierengefäße abzweigen. So kann
festgestellt werden, ob eventuelle Aussackungen
vorliegen und Handlungsbedarf besteht.
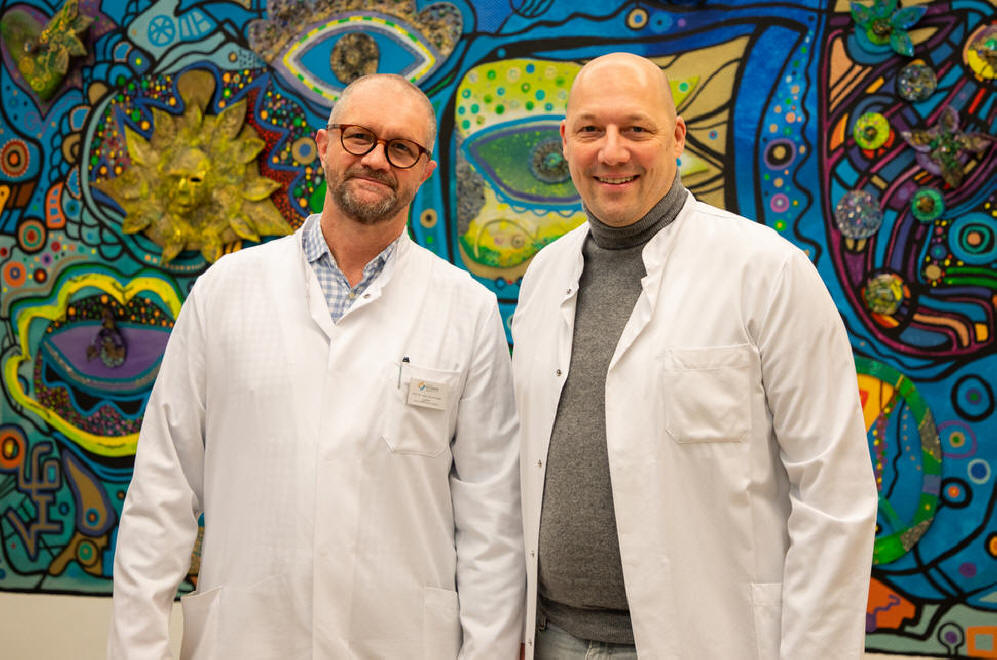
Prof. Dr. Bruno Geier, Chefarzt der Klinik für
Gefäßchirurgie & Phlebologie des Krankenhauses
Bethanien Moers, und Dr. Marc Renter, Chefarzt
der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
des St. Josef Krankenhauses, operierten einen
Patienten mit gedeckt geplatztem
Bauchaortenaneurysma erfolgreich.

Fünf Jahre Brexit:
Entwicklungen im Außenhandel und bei den
Einbürgerungen
Vor fünf Jahren, am
31. Januar 2020, verließ das Vereinigte
Königreich mit Inkrafttreten des
Austrittsabkommens die Europäische Union. Wie
Information und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt mitteilt, waren im Jahr
2023 sowohl das Handelsvolumen als auch die Zahl
der Einbürgerungen in NRW niedriger als im Jahr
2019 vor dem Brexit.

C IT.NRW
Rückgang von über zehn
Prozent bei den NRW-Exporten
Die
nordrhein-westfälische Wirtschaft exportierte
2023 Waren im Wert von 9,5 Milliarden Euro in
das Vereinigte Königreich. Das waren
10,3 Prozent weniger als 2019, dem Jahr vor dem
Brexit (damals ca. 10,6 Milliarden Euro). Im
Zeitraum dazwischen, welcher von Ukraine-Krieg
und Coronakrise geprägt war, hatte es jedoch
unterschiedliche Entwicklungen gegeben: So war
der Exportwert bis 2021 zunächst auf
8,4 Milliarden Euro gesunken, ehe dieser 2022
auf 9,7 Milliarden Euro anstieg.
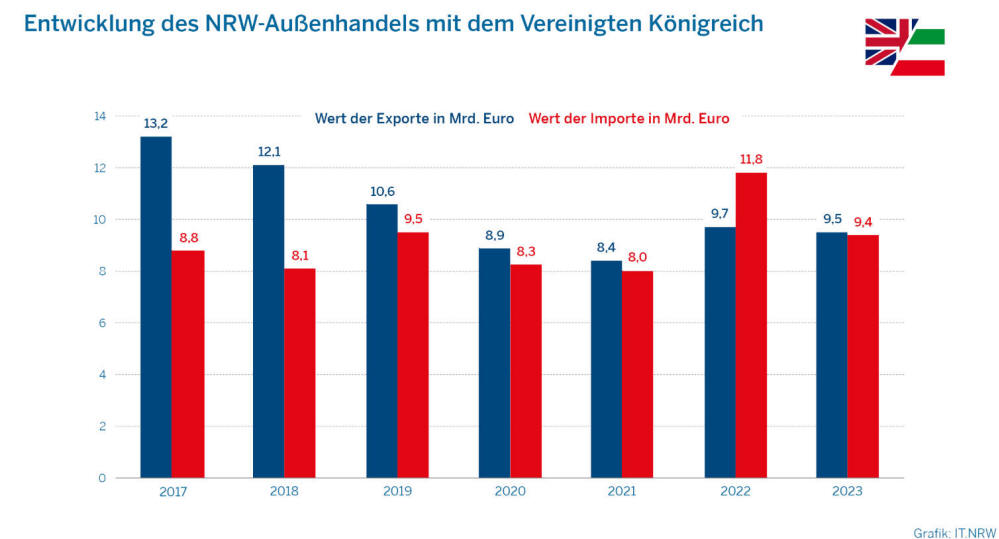
Der Importwert lag 2023 mit 9,4 Milliarden
Euro um ca. 1,3 Prozent niedriger als 2019
(damals: 9,5 Milliarden Euro). In der Zeit
dazwischen war der Wert der Importe auf
8,0 Milliarden Euro im Jahr 2021 gesunken, 2022
hatte es einen Anstieg auf 11,8 Milliarden Euro
gegeben. Während vor dem Brexit die Exportsumme
die Summe der Importe überstiegen hatte, hatten
sich beide Werte im Jahr 2023 nahezu
angeglichen.
Vereinigtes Königreich
2023 neuntstärkstes Abnehmerland der
NRW-Wirtschaft
Das Vereinigte Königreich war
2023 – nach Ländern wie den Niederlanden,
Frankreich, den USA und Italien – das
neuntstärkste Abnehmerland
nordrhein-westfälischer Exporte. 2019, dem Jahr
vor dem Brexit, hatte das Vereinigte Königreich
noch den siebten Rang belegt. Die höchsten
Exportwerte im Jahr 2023 hatten die Warengruppen
Lastkraftwagen unter 5 Tonnen (ca. 478 Millionen
Euro) und Bänder für Getränkedosenkörper aus
Aluminium (ca. 426 Millionen Euro).
2019 hatten PKWs mit Ottomotor (720 Millionen
Euro) und Arzneiwaren (524 Millionen Euro) vorne
gelegen. Das Vereinigte Königreich war 2019 das
achtwichtigste Herkunftsland für NRW-Importe,
2023 belegte es den zehnten Rang. Bei den
Importwerten standen 2023 Erdöl (ca.
1,9 Milliarden Euro) und Arzneiwaren (ca.
980 Millionen Euro) an der Spitze, ebenso wie
2019 (Erdöl damals: 1,3 Milliarden Euro;
Arzneiwaren damals: ca. 800 Millionen Euro).
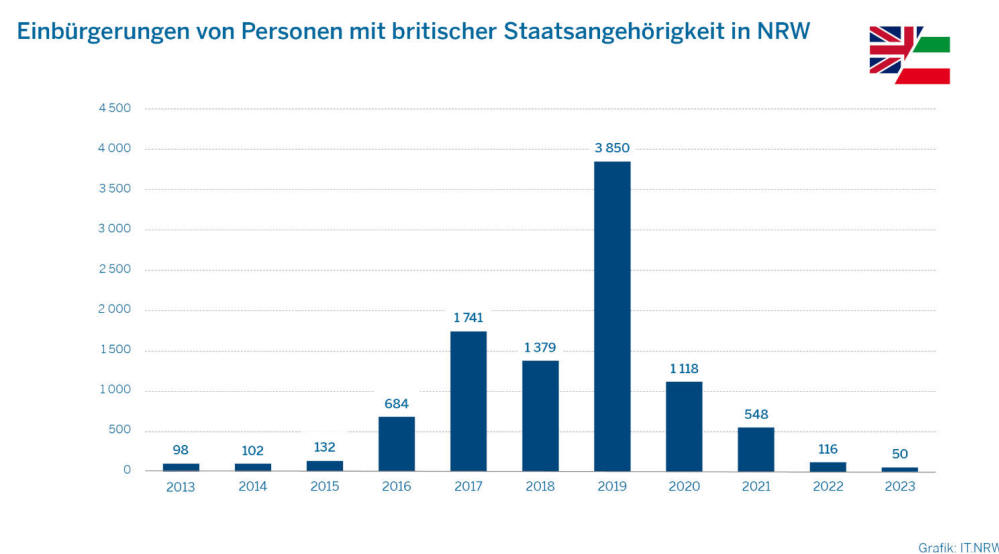
Zahl der Einbürgerungen von Personen mit
britischer Staatangehörigkeit in NRW seit
EU-Austritt gesunken
Seit dem EU-Austritt
des Vereinigten Königreichs im Jahr 2020 ist die
Zahl der Einbürgerungen von Personen mit
britischer Staatsangehörigkeit gesunken: Von
2020 bis 2023 wurden insgesamt 1 832 Britinnen
und Briten in NRW eingebürgert. Die bisher
höchste Zahl wurde im Jahr 2019 mit 3 850
Einbürgerungen erreicht.
Exporte nach Japan von Januar bis November 2024
um 7,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum
gestiegen
• Waren im Wert von 20,1
Milliarden Euro nach Japan exportiert
•
Pharmazeutische Erzeugnisse wichtigste
Exportgüter • Importe aus Japan gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 12,2 % gesunken
Von Januar bis November 2024
wurden Waren im Wert von 20,1 Milliarden Euro
aus Deutschland nach Japan exportiert. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
nahmen die Exporte damit um 7,5 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum zu.
Insgesamt führte
Deutschland in den ersten elf Monaten des Jahres
2024 Waren im Wert von 1 441,4 Milliarden Euro
(-1,3 % gegenüber Januar bis November 2023) aus.
Mit einem Anteil von 1,4 % an den Gesamtexporten
lag Japan exportseitig auf Rang 18 der
wichtigsten Handelspartner Deutschlands.
Baugenehmigungen für Wohnungen im November
2024: -13,0 % zum Vorjahresmonat
Baugenehmigungen von Januar bis
November 2024 zum Vorjahreszeitraum: -18,9 %
Baugenehmigungen in Neubauten von Januar bis
November 2024 zum Vorjahreszeitraum:
-22,1 %
bei Einfamilienhäusern -12,7 % bei
Zweifamilienhäusern -22,4 % bei Mehrfamilienhäusern
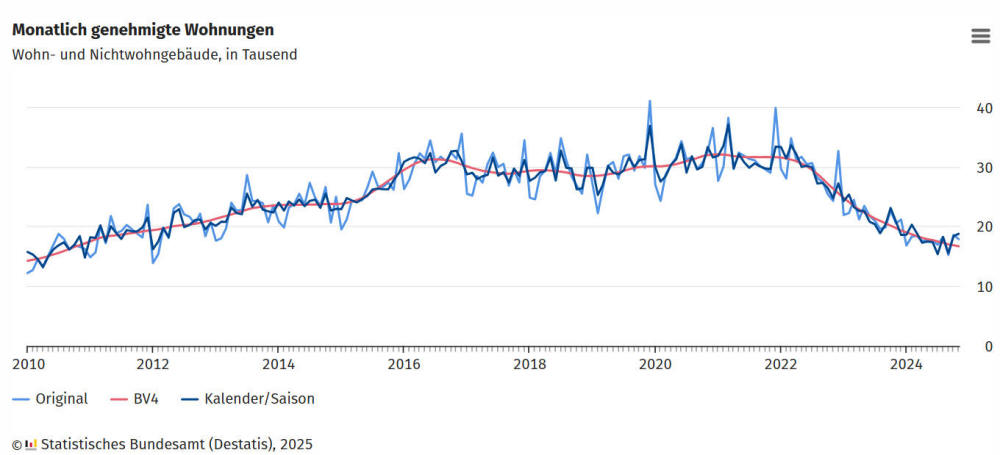
Im November 2024 wurde in Deutschland der Bau
von 17 900 Wohnungen genehmigt. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren
das 13,0 % oder 2 700 Baugenehmigungen weniger als
im November 2023. Im Zeitraum von Januar bis
November 2024 wurden 193 700 Wohnungen genehmigt.
Das waren 18,9 % oder 45 200 weniger als im
Vorjahreszeitraum. In diesen Ergebnissen sind
sowohl Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen
Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für neue
Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.
In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden
im November 2024 insgesamt 14 200 Wohnungen
genehmigt. Das waren 16,8 % oder 2 900 Wohnungen
weniger als im Vorjahresmonat. Von Januar bis
November 2024 wurden 158 000 Neubauwohnungen
genehmigt und damit 21,8 % oder 44 100 weniger als
im Vorjahreszeitraum.
Dabei ging die
Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um
22,1 % (-9 900) auf 34 800 zurück. Bei den
Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter
Wohnungen um 12,7 % (-1 700) auf 11 700. Auch bei
der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, den
Mehrfamilienhäusern, verringerte sich die Zahl der
genehmigten Wohnungen deutlich um 22,4 % (-29 300)
auf 101 200 Wohnungen.
Montag, 20. Januar 2025
Kleve:
Anmeldung zu den weiterführenden Schulen 2025/26
Die weiterführenden Schulen im Klever
Stadtgebiet nehmen in der Zeit vom 22.02.2025
bis 26.02.2025 die Anmeldungen von Schülerinnen
und Schülern der vierten Grundschulklassen
entgegen, die ab Beginn des Schuljahres
2025/2026 eine weiterführende Schule besuchen
werden.

Bild: maroke - stock.adobe.com
Anmeldungen sind nur nach vorherigen
Terminvereinbarungen möglich. Nähere
Informationen darüber sind auf den Homepages der
Schulen hinterlegt.
Die
Erziehungsberechtigten werden gebeten, zur
Anmeldung die Geburtsurkunde des Kindes oder das
Familienstammbuch, das Halbjahreszeugnis
2024/2025 mit der Grundschulempfehlung und den
von der Grundschule ausgehändigten Anmeldeschein
vorzulegen.
Der Schulträger ist laut
Rechtsverordnung des Landes NRW verpflichtet,
für einen Ausgleich der Schulen seines Bereichs
untereinander zu sorgen. Daher ist grundsätzlich
mit der Anmeldung keine Aufnahmepflicht
verbunden. Nach Abschluss der Anmeldephase wird
im Einvernehmen mit dem Schulträger endgültig
über den Anmeldewunsch entschieden.
Anmeldetermine der einzelnen Schulen
Gesamtschule am Forstgarten, Eichenallee 1,
47533 Kleve, Tel. 02821/713960
www.gaf.kleve.de
Samstag, 22.02.2025,
10.00 – 14.00 Uhr
Montag, 24.02.2025, 14.00 –
17.00 Uhr
Dienstag, 25.02.2025, 14.00 – 17.00
Uhr
Mittwoch, 26.02.2025, 14.00 – 17.00 Uhr
Joseph Beuys Gesamtschule, Hagsche Poort 29,
47533 Kleve, Tel. 02821/75040 oder
02821/9977690. www.jbg.kleve.de
Samstag,
22.02.2025, 10.00 – 13.00 Uhr
Montag,
24.02.2025, 16.00 – 19.00 Uhr
Dienstag,
25.02.2025, 16.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch,
26.02.2025, 16.00 – 19.00 Uhr
Karl
Kisters Realschule, Lindenstraße 3a, 47533
Kleve, Tel. 02821/78123,
www.kkrs-kleve.de
Montag, 24.02.2025, 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag, 25.02.2025, 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch, 26.02.2025, 14.00 – 18.00 Uhr
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Römerstraße 9,
47533 Kleve, Tel. 02821/72950
www.stein.kleve.de
Montag, 24.02.2025,
14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag, 25.02.2025, 14.00
– 18.00 Uhr
Mittwoch, 26.02.2025, 14.00 –
18.00 Uhr
Konrad-Adenauer-Gymnasium,
Köstersweg 41, 47533 Kleve, Tel. 02821/976010
www.adenauer-gymnasium.de
Samstag,
22.02.2025, 10.00 – 14.00 Uhr
Montag,
24.02.2025, 08.00 – 17.00 Uhr
Dienstag,
25.02.2025, 08.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch, 26.02
Azubis begeistern Schüler für Ausbildung - 43
Ausbildungsbotschafter von IHK geehrt
Ausbildungsbotschafter besuchen Schulen in der
Region und informieren über die berufliche
Ausbildung. So erfahren Schüler aus erster Hand,
wie der Alltag eines Azubis in einem Unternehmen
wirklich aussieht. Am 16. Januar wurden 43
Ausbildungsbotschafter für ihren Einsatz von der
Niederrheinischen IHK geehrt. Insgesamt bekamen
110 Azubis eine Urkunde.
Berufsorientierung auf Augenhöhe: Dafür gehen
Auszubildende aus Duisburg sowie den Kreisen
Kleve und Wesel persönlich in die Schulen. Als
IHK-Ausbildungsbotschafter berichten sie den
Schülern von ihren Erfahrungen und geben
praktische Einblicke in ihre Berufe. Sie
beantworten Fragen zur Karriere und bringen
ihnen die Berufswelt näher.
Bevor es losgeht,
werden die Azubis von der IHK in Kommunikation
und Präsentation geschult. 2024 wurden 175 neue
Ausbildungsbotschafter ausgebildet, die
insgesamt über 3000 Schüler in der Region
erreicht haben. Die Initiative trägt maßgeblich
dazu bei, junge Menschen für eine Ausbildung zu
begeistern.

Matthias Wulfert, Geschäftsführer Aus- und
Weiterbildung, dankte den Azubis für Ihr
Engagement.
„Unsere
Ausbildungsbotschafter können den Jugendlichen
die Vielfalt und die Chancen einer Ausbildung
authentisch vermitteln. So leisten sie einen
wichtigen Beitrag zur Berufsorientierung“, sagt
Matthias Wulfert, Geschäftsführer für Aus- und
Weiterbildung bei der Niederrheinischen IHK.
„Durch ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen
machen sie die berufliche Zukunft für die
Schüler greifbar und realistisch.“
Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) fördert das landesweite Projekt
„Ausbildungsbotschafter und
Ausbildungsbotschafterinnen NRW – Unterwegs für
Kein Abschluss ohne Anschluss“. Die Koordination
vor Ort übernehmen die Handwerks- sowie
Industrie- und Handelskammern.
Interessierte Unternehmen und Schulen können
sich bei IHK-Projektkoordinatorin Meike
Komatowsky melden unter 0203 2821-495 oder über
komatowsky@niederrhein.ihk.de.

Die Niederrheinische IHK ehrte 43 erfolgreiche
Ausbildungsbotschafter. Fotos: Niederrheinische
IHK/Bettina Engel-Albustin
Moers
in Zahlen Stand 31. Dezuember 2024 -
Einwohnerzahl im letzten Jahr leicht rückläufig
Die Moerser Bevölkerung wird anhand
verschiedener Merkmale wie Alter, Geschlecht,
Familienstand und Religionszugehörigkeit
untersucht. Datengrundlage bildet das
Melderegister der Stadt Moers.
In den Monaten Januar bis Mai sank die
Einwohnerzahl kontinuierlich um insgesamt 393
Personen. Von Juni bis Dezember stieg die
Einwohnerzahl um 302 Personen, so dass am
Jahresende noch ein Minus von 91 Personen
bleibt. Insgesamt hatten damit 106.150 Personen
in Moers ihren alleinigen Wohnsitz oder ihren
Hauptwohnsitz. Am 31.12.2023 waren es noch
106.241, die höchste Personenzahl seit langer
Zeit – genau genommen seit 2007.
Damals stieg die Einwohnerzahl in den Jahren
2000 bis 2004 auf 107.082 Personen an (vgl. Abb.
1). Danach gab es bis 2014 eine lange Phase der
Rezession. In den meisten Jahren gab es zwar
einen leicht positiven Wanderungssaldo, der aber
den negativen natürlichen Saldo nicht aufwiegen
konnte. Das bedeutet, jedes Jahr versterben mehr
Menschen, als geboren werden. Insgesamt verlor
Moers von 2005 bis 2014 jährlich rund 380
Personen. Im Jahr 2015 erfuhr Moers einen
Bevölkerungszuwachs von 1.463 Personen aufgrund
des Syrienkriegs.
Das Durchschnittsalter
stieg von 45,3 Jahren im Vorjahr auf 45,4 Jahre
leicht an. Den niedrigsten Wert wies mit 41,5
Jahren Meerbeck auf, Schwafheim mit 50,0 Jahren
den höchsten. Gegenüber dem Vorjahr ist das
Durchschnittsalter in Utfort um 0,5 Jahre und in
Asberg um 0,3 Jahre gestiegen, in
Rheinkamp-Mitte und in Hülsdonk um 0,2 Jahre
gesunken.
Geschlecht
In Moers
überwogen die Frauen mit 51,3 %, die Männer
lagen bei 48,7 % (vgl. Tab. 3). Die neuen
Geschlechtskategorien „divers“ und „ohne Angabe“
werden aus Datenschutzgründen einer größeren
Gruppe, in diesem Fall den Frauen, zugeschlagen.
Bei den 0- bis 5-Jährigen lag der Frauenanteil
noch bei 48,5 %, erst in der Altersgruppe von 45
bis 64 Jahren überwogen die Frauen.
Aufgrund ihrer etwas höheren Lebenserwartung lag
ihr Antei bei den Älteren ab 75 Jahren bei 58,9
%. Die höchsten Frauenanteile gab es in den
Sozialatlasbezirken mit älteren Einwohnern
(MoersMitte, Schwafheim und Hülsdonk).
Familienstand Die meisten Moerser:innen waren
verheiratet (44,7 %), 37,5 % waren ledig, 7,8 %
geschieden, 7,4 % verwitwet und von 2,5 % der
Einwohner war der Familienstand unbekannt.
Zwischen den Ortsteilen ergaben sich
durchaus Abweichungen. So gab es im „jungen“
Meerbeck mehr Ledige und weniger Verheiratete.
Im „älteren“ Schwafheim gab es dagegen mehr
Verheiratete und Verwitwete und weniger Ledige.
In der ebenfalls „älteren“ Stadtmitte waren nur
36,8 % der Einwohner verheiratet, dafür gab es
hier viele Singles (Ledige, Geschiedene und
Verwitwete) und unbekannte Familienstände (vgl.
Tab. 3). Abb. 2: Die Altersstrukturen in den 12
Sozialatlasbezirken in Moers am 31.12.2024
Religionszugehörigkeit
Religionszugehörigkeit Noch 47,4 % aller
Moerser:innen gehörten am 31.12.2024 einer
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an
(vgl. Tab. 4). Die andere Hälfte (52,6 %) war
konfessionslos oder gehörte einer
Religionsgemeinschaft ohne
öffentlich-rechtlichen Status an. Gegenüber dem
Vorjahr hat die evangelische Kirche 3,4 % ihrer
Mitglieder verloren und lag bei 23,8 %.
Die katholische Kirche verlor 3,1 % und lag
fast gleichauf bei 23,0 %. Die höchsten Anteile
evangelischer Christen gab es in Hülsdonk (28,6
%), Schwafheim (28,2 %) und Kapellen (27,8 %),
die höchsten Anteile der Katholiken lagen in
Rheinkamp-Mitte (26,5 %) und Utfort (26,3 %).
Die Hotspots der Konfessionslosen bzw.
Angehörigen einer Religionsgemeinschaft ohne
öffentlich-rechtlichen Status lagen in Meerbeck
(61,8 %) und Vinn (59,2 %), gefolgt von
Moers-Mitte (56,0 %) und Repelen (55,8 %).
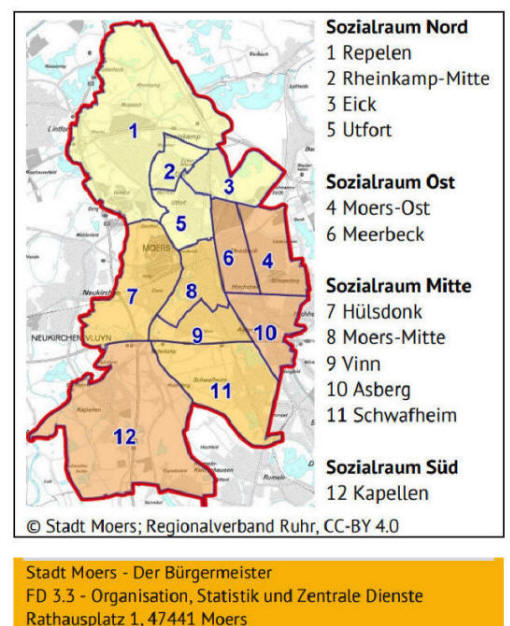
2016 sank die Einwohnerzahl bereits wieder
um 482 Personen und blieb dann von 2017 bis 2021
relativ konstant. Als Folge des Kriegs in der
Ukraine stieg im Jahr 2022 die Einwohnerzahl
erneut stark an um 1.538 Personen. In 2023
folgte ein weiterer Anstieg um 349 Personen. Im
nun abgelaufenen Jahr 2024 kam es zu einem
leichten Rückgang von 91 Personen, dies sind
-0,1 %.
Anhand dieses
gesamtstädtischen Wertes von -0,1 % kann die
Entwicklung in den 12 Sozialatlasbezirken
verglichen werden. So gab es im vergangenen Jahr
in Utfort (-1,0 %) und Moers-Ost (-1,1 %) sowie
Rheinkamp-Mitte (+2,6 %) deutlich höhere Zu- und
Abnahmen der Einwohnerzahl (vgl. Tab. 2). Zum
Beispiel hat Rheinkamp-Mitte von 2000 bis 2020
kontinuierlich Einwohner verloren, gewinnt
seitdem aber wieder hinzu, insbesondere im
vergangenen Jahr.
Neben
den 106.150 Personen mit alleinigem Wohnsitz
oder Hauptwohnsitz in Moers gab es am 31.12.2024
weitere 2.369 Personen, die in Moers mit einem
Nebenwohnsitz gemeldet waren (2,2 %). Insgesamt
lag die wohnberechtigte Bevölkerung damit bei
108.519 Personen. Im Folgenden wird die
Bevölkerung mit alleinigem Wohnsitz bzw.
Hauptwohnsitz betrachtet.
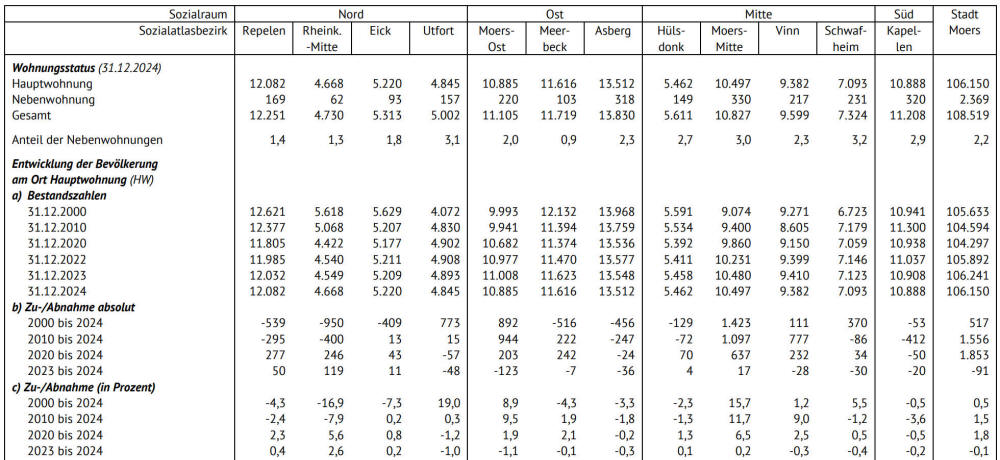
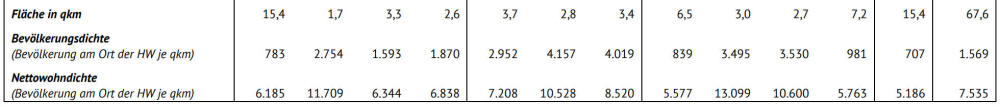
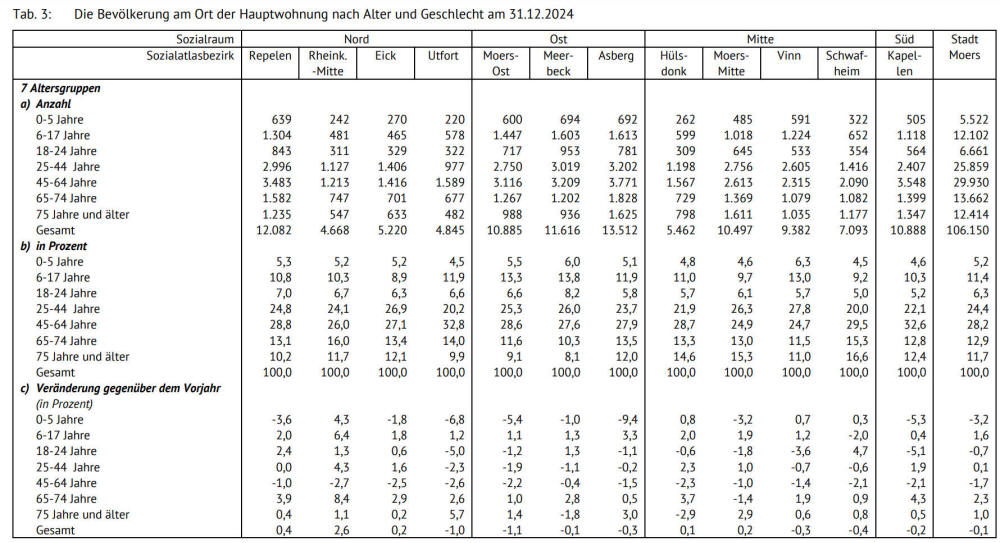
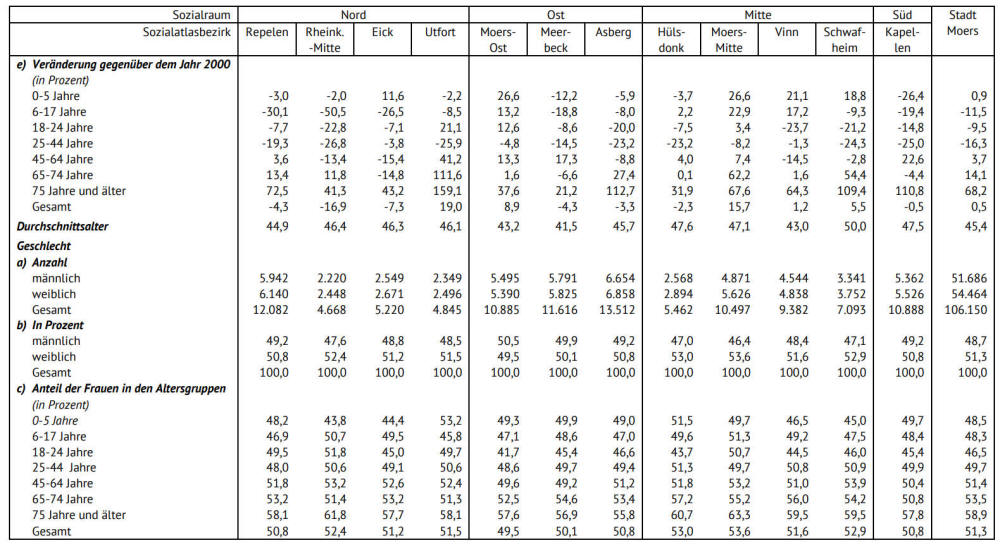
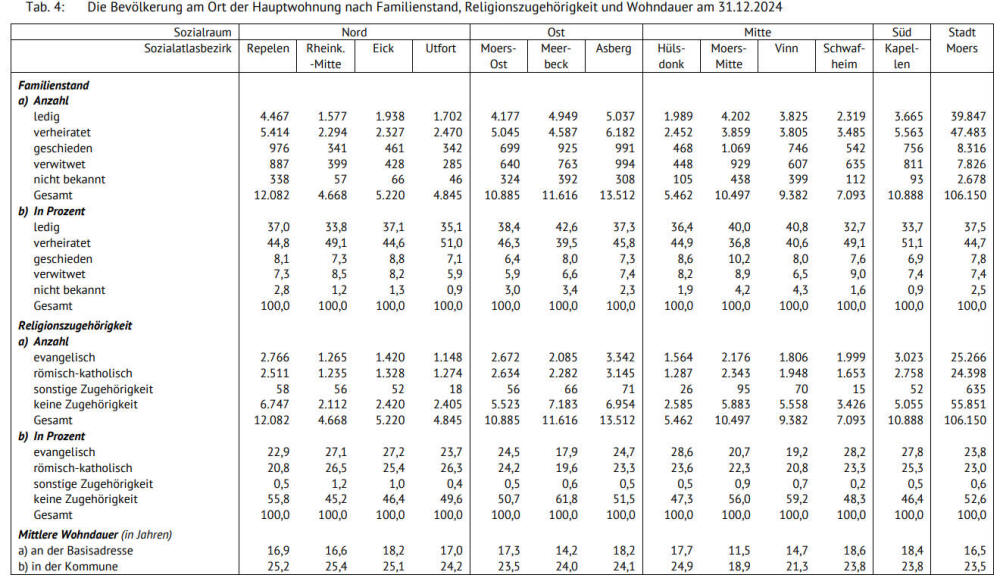
Multifunktionales Grün: Zehn
Wanderbäume für die Klever Innenstadt
Mobiles Grün für die Klever Innenstadt: kürzlich
hat die Stadt Kleve insgesamt zehn sogenannte
„Wanderbäume“ im Innenstadtbereich aufgestellt.
Es handelt sich um junge Bäume, die in leicht
transportablen Holzkübeln wachsen und hierdurch
flexibel an verschiedenen Standorten platziert
werden können. Sie sollen als eine flexible und
nachhaltige Ergänzung zu herkömmlichen
Stadtbäumen dienen und dazu beitragen, die
Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöhen.

Einer der neuen Wanderbäume auf der Herzogbrücke
Gerade dort, wo die Dauerhafte Anpflanzung
von Bäumen eine Herausforderung ist –
beispielsweise aufgrund von unterirdischen
Leitungen oder aus Platzgründen – bieten die
mobilen Bäume eine praktische Alternative für
mehr Grün. Aber auch als temporäre Barrieren
oder Absperrungen eignen sich die Wanderbäume.
Sie können etwa Straßenflächen abgrenzen oder
als optisch ansprechende Sperrelemente bei
Stadtfesten eingesetzt werden.
Bestückt
wurden die Kübel mit Gehölzen, die ausgewachsen
eine Höhe von bis zu drei Metern erreichen
werden. Als Ergänzung dienen bodendeckende
Stauden. Jeder der zehn Kübel ist mit einem
integrierten Wassertank ausgestattet, der die
Intervalle zum Gießen verlängert und somit den
Pflegeaufwand reduziert. Darüber hinaus sind die
Kübel mit Sitzflächen versehen, die zum
Verweilen einladen. Teilweise wurden auch
Fahrradbügel installiert.
Als erster
Standort für die Wanderbäume wurden die Ecke
Wasserstraße/Große Straße, die Herzogbrücke, der
Koekkoekplatz und die Ecke Hagsche Straße/
Hagsche Port ausgewählt.

Die Anschaffung der Wanderbäume wurde mit 70 %
der Kosten durch das Ministerium für Heimat,
Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes
Nordrhein-Westfalen über die Landesinitiative
Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen
gefördert.
Stadtführungen in Dinslaken erfreuen
sich großer Beliebtheit
Da die
Stadtführungen in Dinslaken sehr beliebt sind,
wird das Programm immer weiter ausgebaut und der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Einen
Überblick über ein ganzes Jahr Dinslakener
Stadtführungen gibt es in dem neuen
Stadtführungsflyer der Tourismusförderung der
Stadt Dinslaken. Das 32 Seiten umfassende Medium
stellt das umfangreiche Angebot ausführlich und
übersichtlich dar.
An zahlreichen
Terminen können verschiedenste Themenführungen
für Kinder und Erwachsene gebucht werden. Neben
historischen Stadtführungen durch Dinslakens
Innen- und Altstadt oder durch die Stadtteile
finden sich auch spezielle Angebote für Kinder
und Jugendliche.
Die beliebten
Kräuterführungen und Planwagenfahrten werden
ergänzt durch erlebnisorientierte Rundgänge mit
dem Nachtwächter Heinrich Denkhaus oder der Hexe
Ulanth Dammartz. Spannende Einblicke in das
Leben und Arbeiten ehemaliger Bergleute geben
Führungen über das ehemalige Zechengelände in
Lohberg.
Der neue Stadtführungsflyer ist
ab sofort in der Stadtinformation am Rittertor
erhältlich. Ebenso liegt er in Kürze im
Bürgerbüro, in der Stadtbibliothek, im Rathaus
und Museum Voswinckelshof sowie im Ledigenheim
und Stadtteilbüro Lohberg aus und darf gerne zum
Schmökern mit nach Hause genommen werden.
Zudem steht er auf der Homepage der Stadt
Dinslaken unter
https://www.dinslaken.de/wirtschaft-freizeit/tourismus/stadtfuehrungen#
als Download zur Verfügung.
Besonderer
Dank gilt den mitwirkenden Gästeführerinnen und
Gästeführern sowie den beteiligten
Institutionen, ohne deren Einsatz und
Unterstützung die zahlreichen Stadtführungen
nicht umzusetzen wären.
Bei Fragen zu den
Stadtführungen in Dinslaken steht das Team der
Stadtinformation am Rittertor gerne unter Tel.
02064 – 66 222 oder per E-Mail
stadtinformation@dinslaken.de zur Verfügung.
Dinslaken: Acoustic Lounge
am 23. Januar im Dachstudio
Am
Donnerstag, den 23. Januar findet um 19 Uhr die
nächste Acoustic Lounge im Dachstudio mit drei
Musiker*innen statt:
Luna
Luna ist
eine 22 Jahre alte Musikerin aus Bocholt, die
bereits im Alter von 13 Jahren ihren ersten
öffentlichen Auftritt hatte. 2018 hat sich aus
einem Musik-Projekt heraus ihre Band "Music
Madness" gegründet, die regelmäßig live in NRW
auftritt. Luna, die sich bei ihren
Solo-Auftritten selbst auf der Gitarre
begleitet, begeistert mit ihrer Pop-/Soul-Stimme
und präsentiert Akustik-Cover sowie
Eigenkompositionen.
Marcel Janßen
Der
Emmericher Vollblut-Musiker, Produzent,
Songwriter und Musikschul-Dozent Marcel Janßen
tritt hauptsächlich als Lead-Sänger seiner Bands
"Felkmett" und "Dörmakar" in Erscheinung, mit
denen er regelmäßig in NRW und in den
Niederlanden auftritt. Bei Solo-Auftritten
tauscht er seine E-Gitarre gegen eine akustische
Western-Gitarre ein, um eine abwechslungsreiche
Auswahl an Cover-Songs aus den Genres Pop, Rock
und Pop-Punk auf seine eigene Art und Weise zu
präsentieren. Seine Spontanität und gute Laune
machen jeden Auftritt zu einem spaßigen
Erlebnis.
Canne
Sängerin Anne und
Pianistin Can kommen aus Duisburg und machen
bereits jahrelang gemeinsam Musik. Seit 2024
treten die beiden im Duo als "Canne" auf und
bieten großartig-arrangierte Piano-Cover von
Drake, Whitney Houston, Michael Jackson oder
Bruno Mars mit Gänsehaut-Faktor.
Durch den
Abend führt wie immer Cesare Acoustic. Der
Eintritt ist frei. Um Hutspenden für die
Künstler wird gebeten.
Dachstudio der
Stadtbibliothek, Friedrich-Ebert-Str. 84, 46535
Dinslaken. Einlass: 18.30 Uhr
Dinslaken: Funny Money – Farce von Ray
Cooney in der Kathrin-Türks-Halle
Ehefrau Jean Perkins erkennt ihren
Henry nicht wieder. Ausgerechnet an seinem
Geburtstag kommt er zu spät nach Hause, und
getrunken hat er auch. Sein Geburtstagsessen ist
ihm völlig egal, er will nur weg, weit weg und
das so schnell wie möglich. Zwei Flüge nach
Barcelona – ohne Rückflug. Was ist los mit Henry
Perkins?
In der U-Bahn hat er seinen
Aktenkoffer, mit dem eines Fremden verwechselt
und ist plötzlich reich… Ray Cooney, der
Schöpfer herrlich absurder englischer Komödien,
hat mit „FUNNY MONEY“ ein Meisterwerk dieses
Genres geschaffen.
Zu sehen gibt es
die Aufführung am 28. Januar ab 20 Uhr in der
Dinslakener Kathrin-Türks-Halle. Eintrittskarten
sind im Vorverkauf ab 20 Euro in der
Stadtinformation am Rittertor* und an der
Abendkasse ab 24 Euro zu erhalten. Außerdem gibt
es sie online unter
www.stadt-dinslaken.reservix.de (hier fallen
zusätzliche Gebühren an). *geöffnet Dienstag bis
Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie Dienstag bis
Freitag von 14 bis 17 Uhr
Seniorenkarneval: Vorverkauf
startet am 27. Januar
Bauchredner
Peter Kerscher ist mit seiner Kuh Dolly am 16.
Februar beim Sparkassen-Seniorenkarneval im
Kulturzentrum Rheinkamp zu Gast.
Was
haben Bauchredner Peter Kerscher und seine Kuh
Dolly mit dem ‚Handwerker Peters‘ und der
niederländischen Spaß-Kapelle ‚Mootworm‘
gemeinsam? Sie alle treten beim diesjährigen
Sparkassen-Seniorenkarneval am Sonntag, 16.
Februar, von 15 bis 18 Uhr im Kulturzentrum
Rheinkamp, Kopernikusstraße 11, auf.

Peter Kerscher mit einer Handpuppe
Zusammen mit der Sparkasse am Niederrhein lädt
die Stadt Moers (Fachbereich Soziales) wieder zu
einem bunten Programm für Seniorinnen und
Senioren ein, das die Karnevalsgesellschaft
Elfenrat Moers-Eick e.V. zusammengestellt hat.
Mit dabei sind auch wieder deren Tanzgarden ‚Die
Schnuckis‘, ‚Die Elfengarde‘ und ‚Die
Expressives‘.
Die musikalische
Begleitung übernimmt das ‚Duo California‘. Und
natürlich kommt das Prinzenpaar Pascal I. und
Elsa I. vom Kulturausschuss Grafschafter
Karneval zu Besuch. Die Moderation des
Nachmittags übernimmt Klaus Likar. Einlass ist
ab 14.30 Uhr. Karten sind ab Montag, 27. Januar,
bei der Stadtinformation, Kirchstraße 27a/b,
erhältlich.
Im Eintrittspreis von 12
Euro (Moers-Pass-Inhaber: 6 Euro) sind die Hin-
und Rückfahrt mit dem Bus, die Aufbewahrung der
Garderobe sowie Kaffee und Kuchen enthalten.
Karten sind ab dem 27. Januar in der Stadt-
und Touristinformation von Moers Marketing
(Kirchstraße 27 a/b) erhältlich. Öffnungszeiten:
montags bis freitags von 10 bis 13.30 Uhr,
dienstags bis donnerstags auch von 14 bis 17.30
Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Taxifahrten
für Menschen mit Behinderung (nur mit
Berechtigungsausweis) können unter folgenden
Rufnummern gebucht werden:
0 28 41/ 5 55
55
0 28 41/ 7 33 33
0 28 41/ 9 31 99 17
0 28 41/ 1 69 44 30
0 28 41/ 9 99 29 99.

Über acht von zehn Tarifbeschäftigten
erhielten bis Ende 2024 eine
Inflationsausgleichsprämie
• Im
Durchschnitt lag die Inflationsausgleichsprämie bei
2 680 Euro
• Die niedrigsten Prämien wurden im
Baugewerbe gezahlt, im Gastgewerbe erhielten
anteilig die wenigsten Tarifbeschäftigten diese
Sonderzahlung
Mehr als acht von zehn
Tarifbeschäftigten (86,3 %) in Deutschland haben im
Zeitraum Oktober 2022 bis Dezember 2024 eine
Inflationsausgleichsprämie erhalten. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen
der Statistik der Tarifverdienste mitteilt, lag der
durchschnittliche Auszahlbetrag pro Person bei 2
680 Euro. Bei der Inflationsausgleichsprämie
handelte es sich um eine steuerfreie Sonderzahlung
von bis zu 3 000 Euro, die je nach
Tarifvereinbarung als Gesamtbetrag oder gestaffelt
in Teilbeträgen an die Beschäftigten ausgezahlt
werden konnte. Die Steuerfreiheit dieser
Sonderzahlung war eine Maßnahme des dritten
Entlastungspakets der Bundesregierung zur Milderung
der Folgen der Energiekrise.
Deutliche
Unterschiede zwischen den Branchen Sowohl in der
durchschnittlichen Höhe der
Inflationsausgleichsprämie als auch im Anteil der
Tarifbeschäftigten, die eine solche Prämie
erhielten, gab es zwischen den einzelnen Branchen
deutliche Unterschiede: Die niedrigsten Prämien
wurden im Baugewerbe mit durchschnittlich
1 103 Euro sowie im Handel mit durchschnittlich
1 419 Euro gezahlt, die höchsten in den
Wirtschaftsabschnitten Öffentliche Verwaltung,
Verteidigung, Sozialversicherung sowie Erziehung
und Unterricht mit jeweils 3 000 Euro.
Ebenfalls überdurchschnittlich hohe
Inflationsausgleichsprämien waren in den Bereichen
Kunst, Unterhaltung und Erholung (2 976 Euro) sowie
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung
(2 942 Euro) vereinbart worden. Alle
Tarifbeschäftigten im Wirtschaftsabschnitt
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung,
Sozialversicherung verfügten über einen tariflichen
Anspruch auf eine Inflationsausgleichsprämie.
Auch viele Tarifbeschäftigte in den
Wirtschaftsabschnitten Erziehung und Unterricht
(99,3 %), Bergbau und Gewinnung von Steinen und
Erden (98,3 %) und Verarbeitendes Gewerbe (97,7 %)
hatten einen Anspruch darauf. Im Gastgewerbe
(11,6 %) und im Bereich der Erbringung sonstiger
wirtschaftlicher Dienstleistungen (12,2 %)
profitierten anteilig die wenigsten
Tarifbeschäftigten von einer
Inflationsausgleichsprämie.
Durchschnittliche tarifliche
Inflationsausgleichprämie und Anteil der
Berechtigten nach Wirtschaftsbereichen
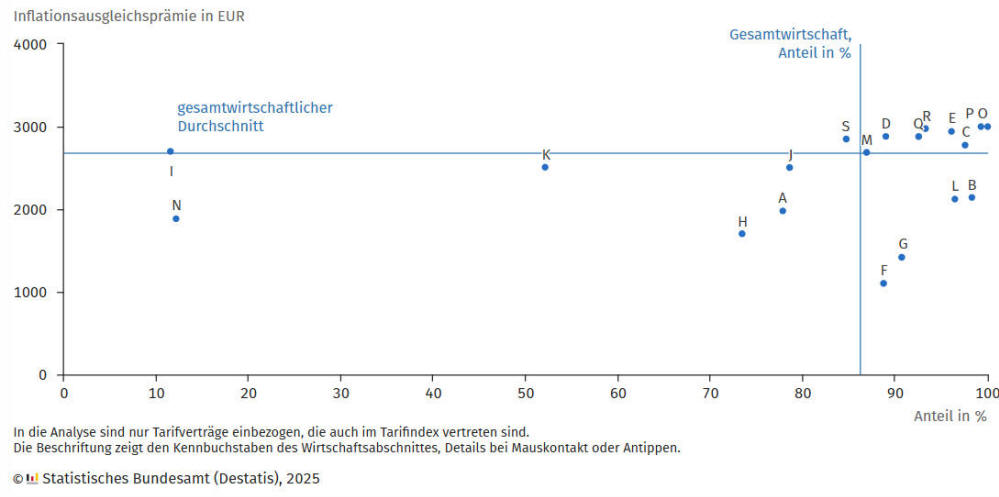
2,6 % weniger
Schwangerschaftsabbrüche im 3. Quartal 2024 als
im Vorjahresquartal
Im 3. Quartal 2024 wurden in
Deutschland rund 26 000 Schwangerschaftsabbrüche
gemeldet. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, waren das 2,6 % weniger als
im 3. Quartal 2023. Die Ursachen für die
Entwicklung sind anhand der Daten nicht
bewertbar. Insbesondere liegen keine
Erkenntnisse über die persönlichen
Entscheidungsgründe für einen
Schwangerschaftsabbruch nach der
Beratungsregelung vor.
68 % der Frauen,
die im 3. Quartal 2024 einen
Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen,
waren zwischen 18 und 34 Jahre alt, 20 %
zwischen 35 und 39 Jahre. 9 % der Frauen waren
40 Jahre und älter, 3 % waren jünger als 18
Jahre. 42 % der Frauen hatten vor dem
Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur Welt
gebracht.
96 % der gemeldeten
Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der
Beratungsregelung vorgenommen. Eine Indikation
aus medizinischen Gründen oder aufgrund von
Sexualdelikten war in den übrigen 4 % der Fälle
die Begründung für den Abbruch.
Die
meisten Schwangerschaftsabbrüche (45 %) wurden
mit der Absaugmethode durchgeführt, bei 42 %
wurde das Mittel Mifegyne® verwendet. Die
Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant,
darunter 85 % in Arztpraxen beziehungsweise
OP-Zentren und 13 % ambulant in Krankenhäusern.
|