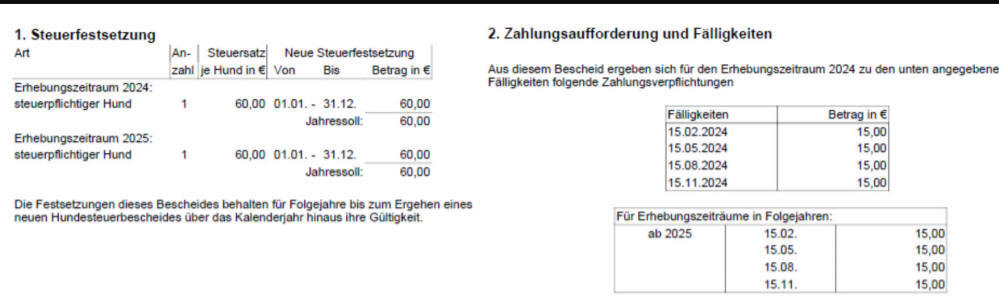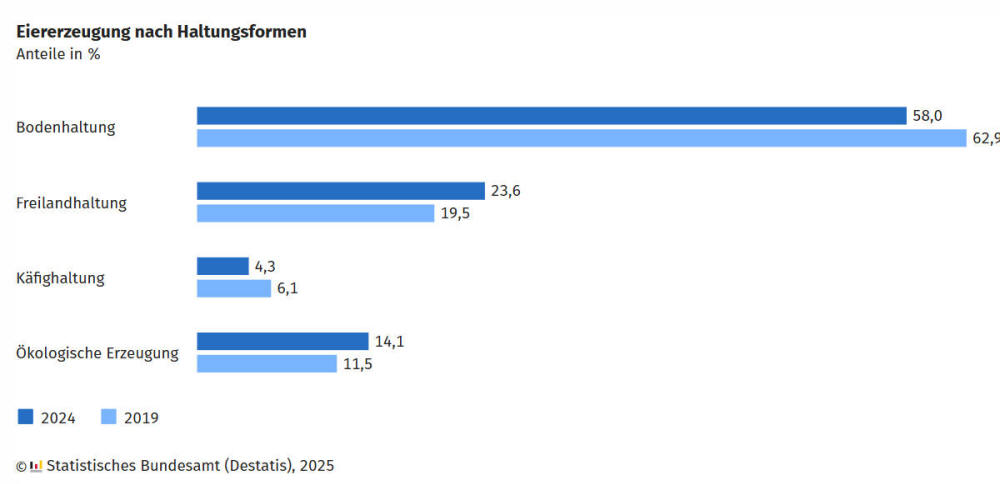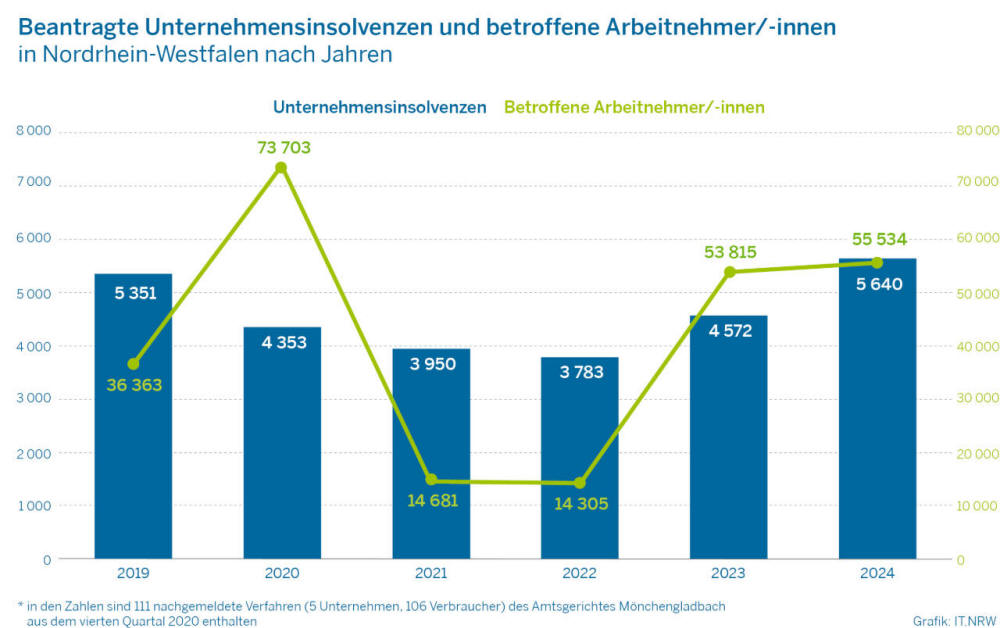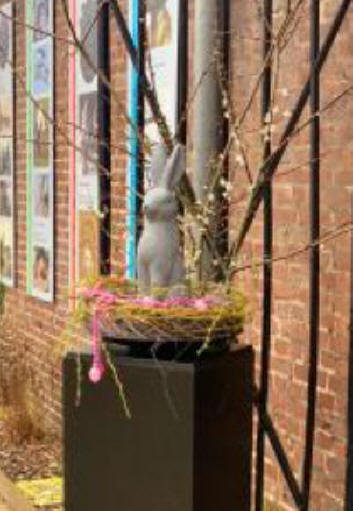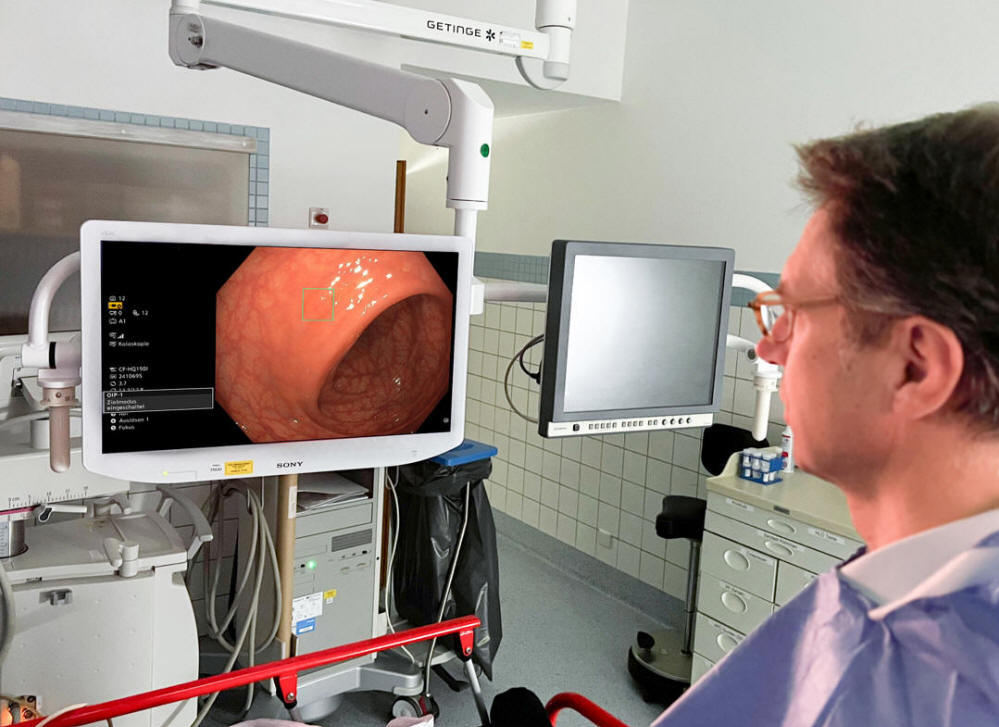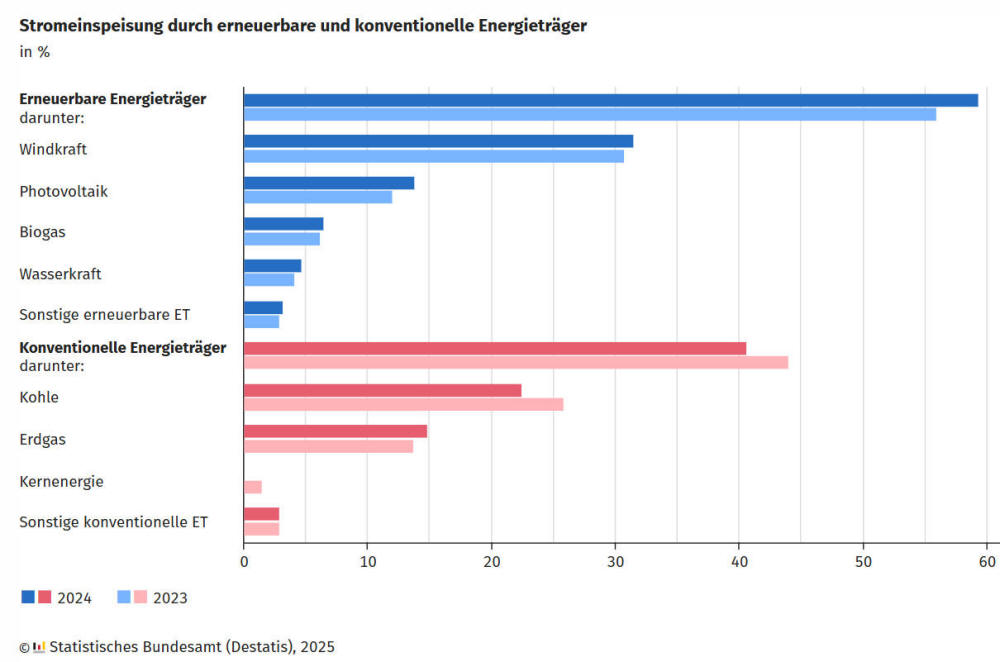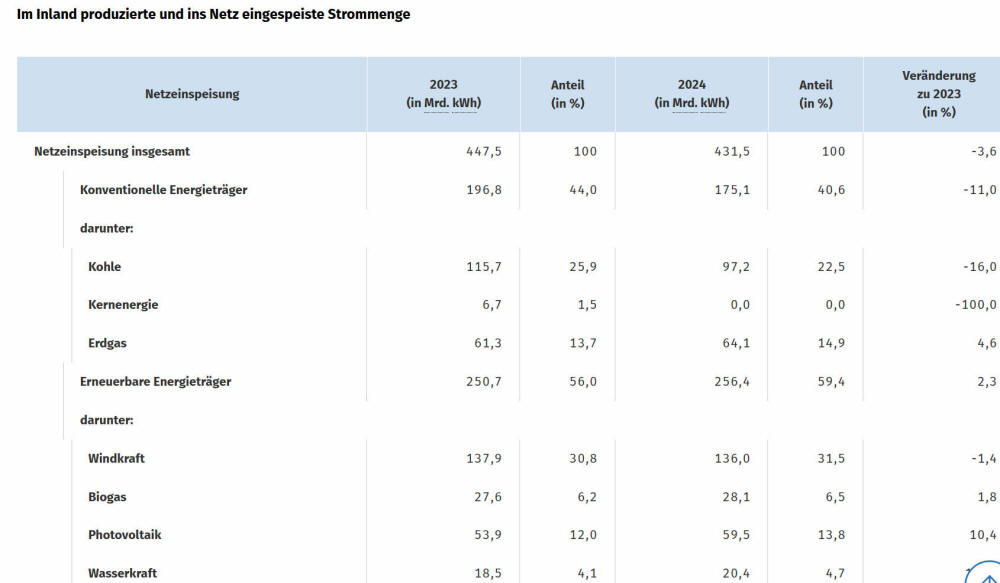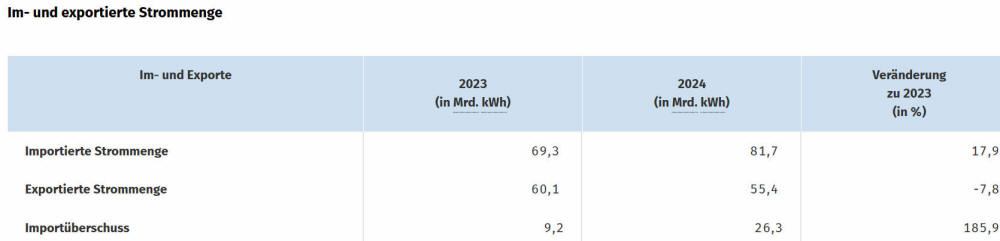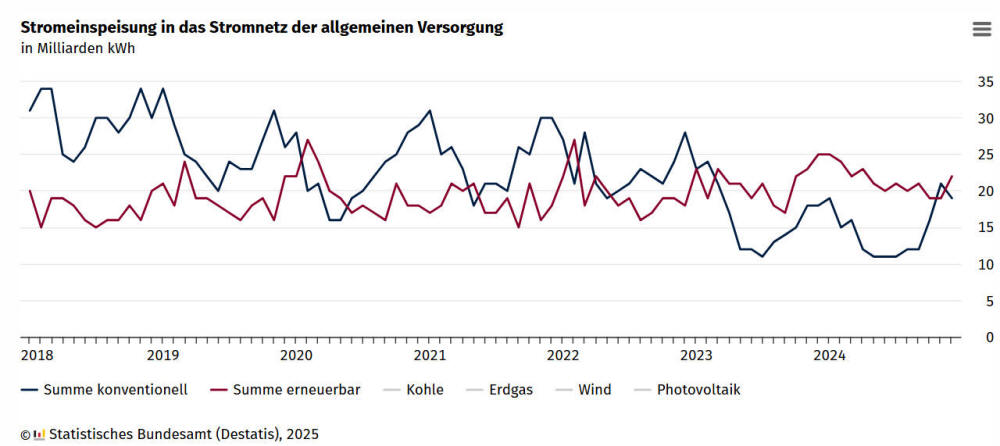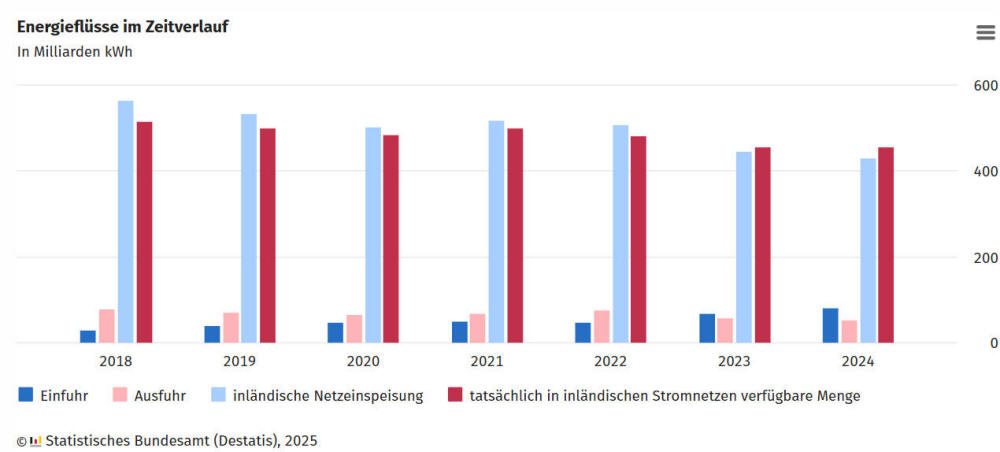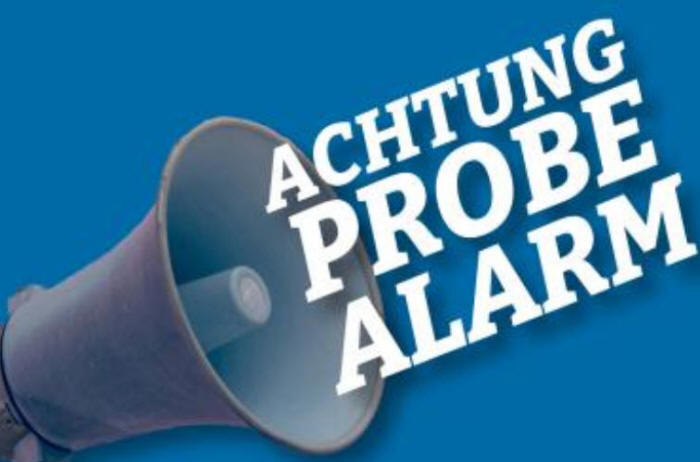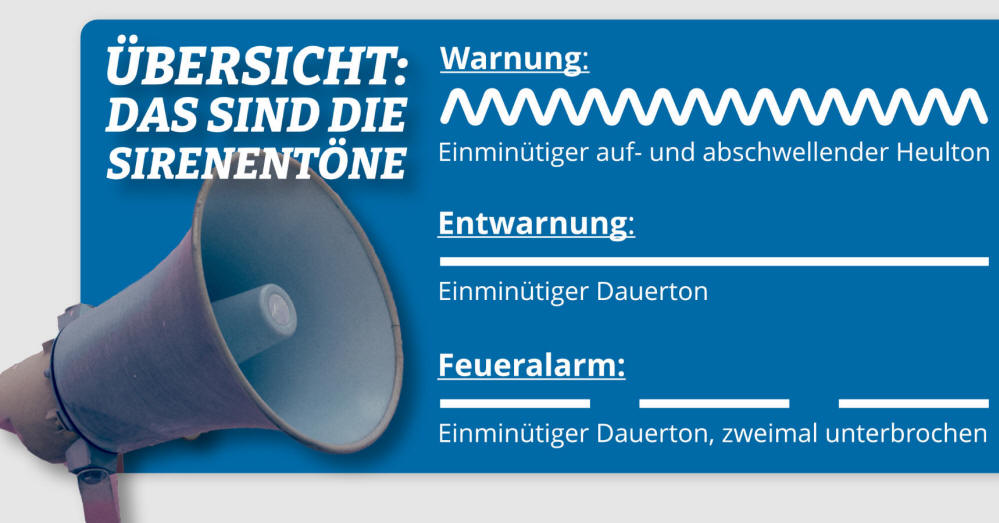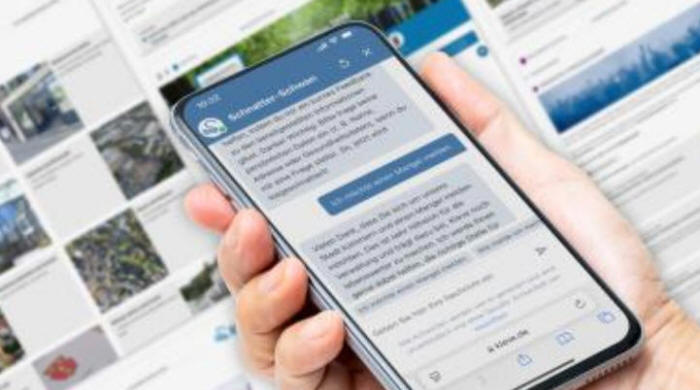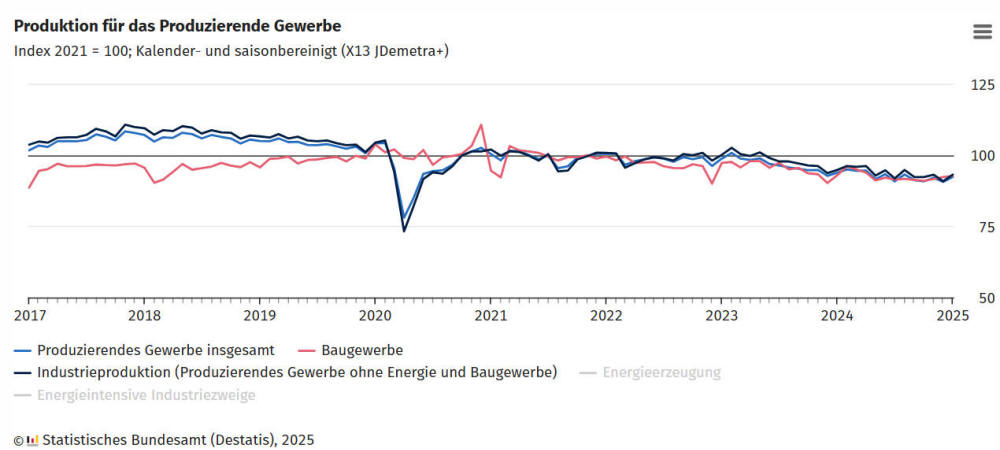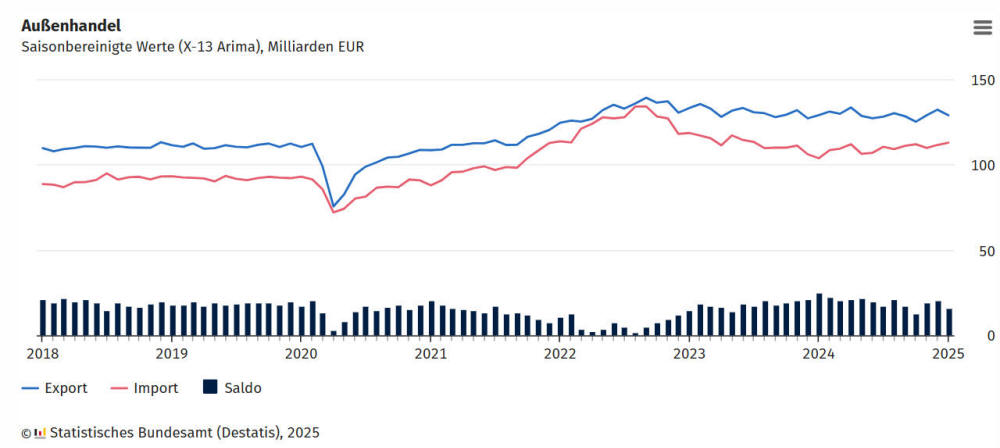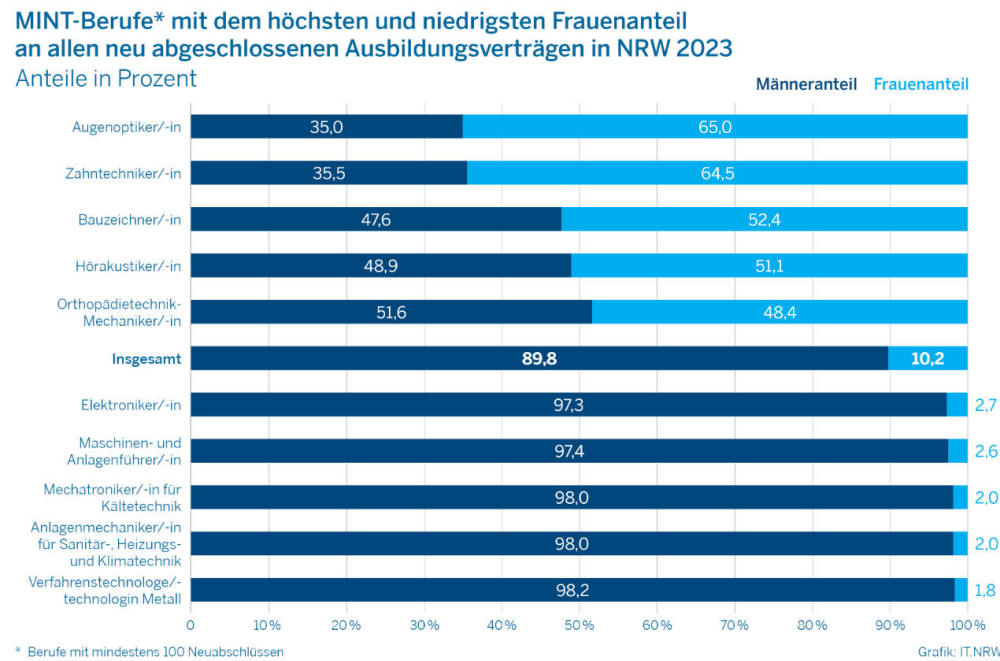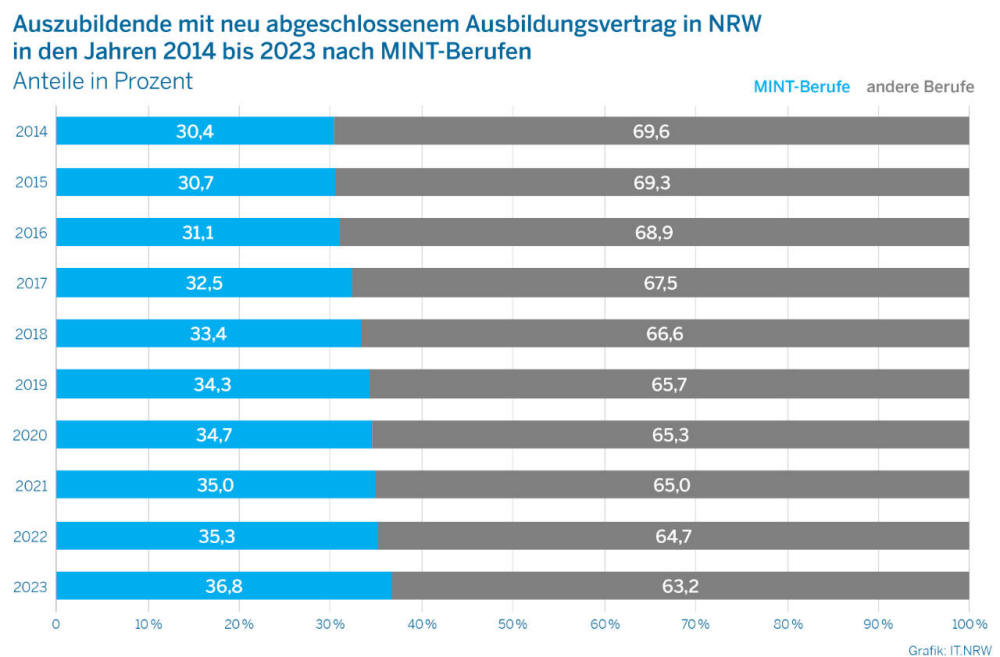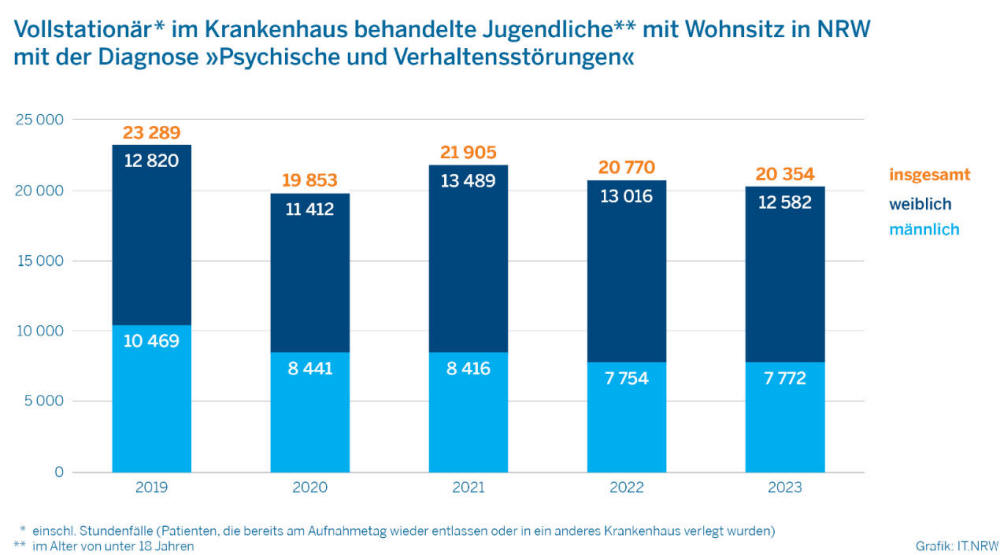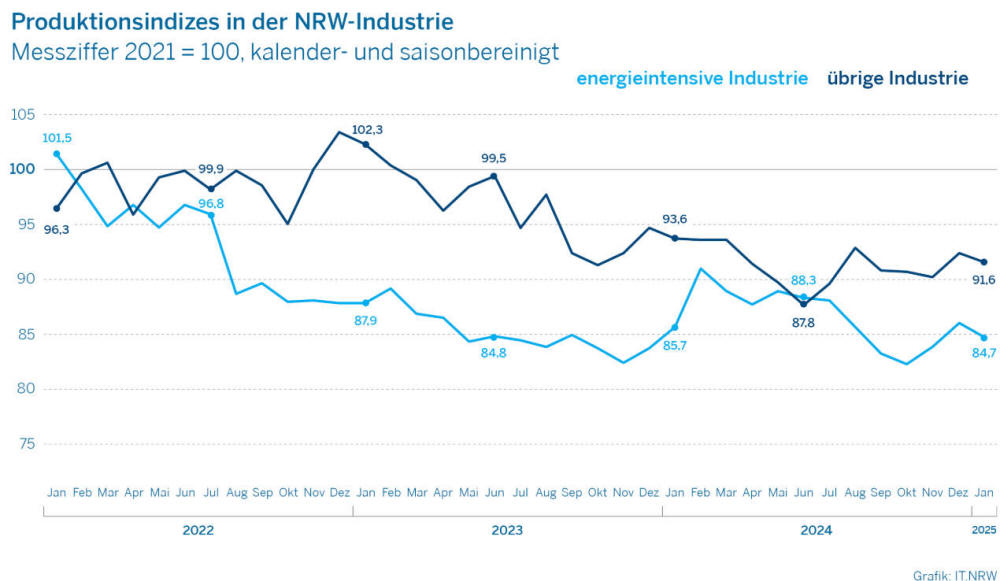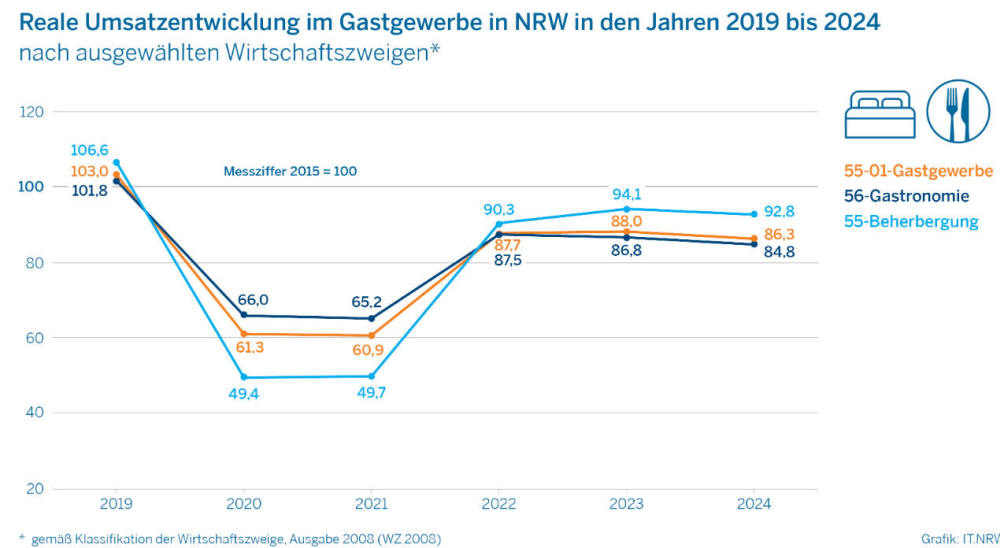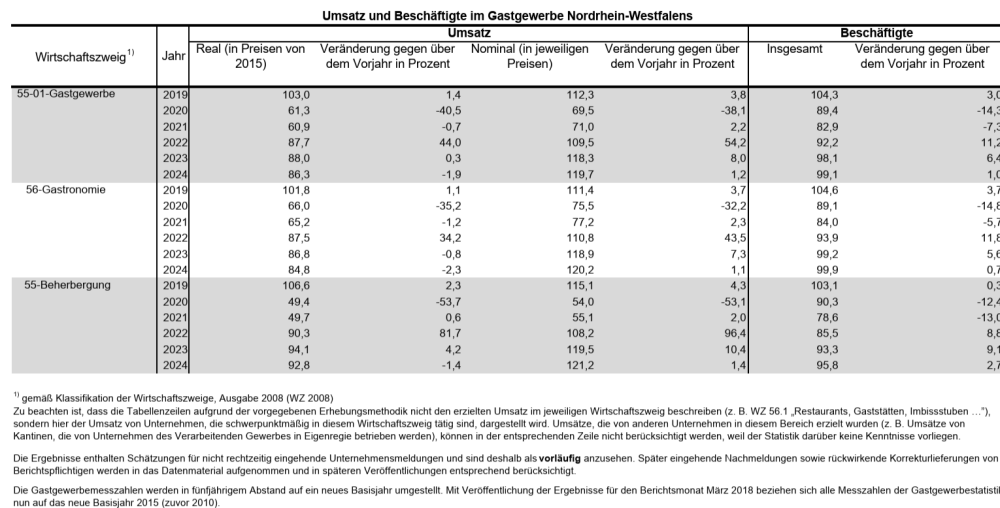|
Samstag, 15., Sonntag, 16. März 2025 -
15. März Tag der Druckkunst und
Weltverbrauchertag
50 Jahre
Städtepartnerschaft mit Agen – Ein Fest der
deutsch-französischen Freundschaft in Dinslaken
Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrags
zwischen Agen und Dinslaken. Auf dem Bild ist
der französische Bürgermeister Dr. Pierre
Esquirol und Karl-Heinz Klingen. Foto:
Stadtarchiv Dinslaken

Bürgermeisterin Eislöffel begrüßt am Wochenende
22. und 23. März 2025 unsere Freundinnen und
Freunde aus Dinslakens Partnerstadt Agen: eine
offizielle Delegation unserer französischen
Partnerstadt, angeführt von Bürgermeister Jean
Dionis du Séjour, sowie Mitglieder des Comité de
Jumelage Agen-Dinslaken (ehrenamtlicher Verein
zur Unterstützung der Partnerschaft). Gemeinsam
feiern Agen und Dinslaken das 50-jährige
Jubiläum der Städtepartnerschaft.
Diese Partnerschaft ist mehr als eine formale
Verbindung zwischen zwei Städten – sie ist ein
Symbol für die Kraft der Versöhnung und den Wert
des Miteinanders. Seit 1975 verbindet Dinslaken
und Agen eine tiefe Freundschaft, die über
Generationen hinweg gewachsen und heute ein
fester Bestandteil des kulturellen und
gesellschaftlichen Lebens beider Städte ist. Die
Feierlichkeiten stehen ganz im Zeichen der
deutsch-französischen Freundschaft, die aus
einer tragischen Vergangenheit und Krieg
hervorgegangen ist und die einstige Feindschaft
zwischen Frankreich und Deutschland überwunden
hat.
Die Dinslakener Bürgermeisterin
Michaela Eislöffel betont: "Die entstandenen
vertrauensvollen und freundschaftlichen
Beziehungen konnten sich zwischen Menschen
beider Städte entwickeln, weil Menschen beider
Städte aufeinander zugegangen sind. Auf der
Grundlage des Respekts und der Vergebung hat
sich eine wunderbare lebendige Freundschaft
entwickelt. Diese Freundschaft ist ein
wertvoller Schatz für alle Menschen in
Dinslaken, der beweist, das tiefe Wunden einer
Generation im Miteinander heilen können. Gute
Beziehungen entstehen im gegenseitigen Austausch
und im Verständnis füreinander.
Ich bin
sehr glücklich darüber, dass viele Menschen in
unserer Stadt unsere Partnerschaft und
Freundschaft lebendig halten. So organisieren
die Mitglieder unseres
Städtepartnerschaftsvereins Reisen in unsere
Partnerstadt und leben die Freundschaft durch
Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse. Ich danke
allen, die dazu beigetragen haben diese
Begegnungen aktiv zu gestalten, dadurch bleibt
die Freundschaft lebendig, bereichert unser
Leben und bildet ein wichtiges Fundament. Sie
erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Brücken
zu bauen und gemeinsam für Menschlichkeit,
Frieden und unsere Demokratie einzustehen.“
Das Jubiläumswochenende bietet eine
Vielzahl von Veranstaltungen, die die lebendige
Gegenwart dieser Partnerschaft zeigen. Am
Samstag wird die Delegation aus Agen das St.
Benedikt Haus der Caritas in Lohberg besuchen –
ein beeindruckendes CO₂-neutrales Altenheim, das
für Nachhaltigkeit und Innovation steht. Danach
folgt eine Fahrt auf den Förderturm in Lohberg.
Hier tauchen unsere Gäste ein in die
industrielle Geschichte Dinslakens und genießen
den Blick von oben.
Am Nachmittag
wird es besonders symbolisch: Im Garten des
Museums Voswinckelshof werden um 17:30 Uhr fünf
Pflaumenbäume gepflanzt, ein Geschenk der Stadt
Agen. Die Pflaumenbäume sollen an unsere
Partnerstadt Agen erinnern, die für den
Pflaumenanbau sehr bekannt ist. Die Bäume sollen
als Zeichen unserer Freundschaft allen Menschen
in Dinslaken zugänglich sein und Freude
bereiten. Sie stehen für das Wachstum und die
Beständigkeit der Freundschaft zwischen unseren
beiden Städten.
Bürgermeisterin
Eislöffel: "Seien Sie bei der Baumpflanzung
dabei und bereiten Sie unseren Gästen aus Agen
ein unvergessliches Erlebnis. Ich würde mich
freuen, wenn viele Dinslakenerinnen und
Dinslakener sich zu diesem besonderen Ereignis
auf der Museumswiese am nächsten Samstag
einfinden würden."
Am Sonntag, den 23.
März liegen für uns Freud und Leid nah
beieinander. Wir gedenken der Toten der
Bombardierung Dinslakens und gleichzeitig ist
das der Tag der Unterzeichnung der
Städtepartnerschaftsurkunde. Beide Anlässe
spiegeln sich im Programm des Jubiläums wider.
Am Sonntag startet das Programm um 9:45 Uhr
mit einem ökumenischen Gottesdienst in der
evangelischen Stadtkirche, bei dem die Werte von
Frieden und Versöhnung im Mittelpunkt stehen
werden. Anschließend findet um 11:00 Uhr eine
Gedenkveranstaltung am Parkfriedhof statt.
Anlässlich des 80. Jahrestags der Zerstörung
Dinslakens am 23. März 1945 werden
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und
Bürgermeister Jean Dionis du Séjour über das
Leid in beiden Ländern und Städten reden.
Schülerinnen und Schüler der Ernst-Barlach
Gesamtschule tragen Zeitzeugenberichte aus
Dinslaken vor.
In diesem Jahr sollen
Kränze an den Gräbern von vier französischen
Bombenopfern, die als Zwangsarbeiter in
Dinslaken waren, sowie an den Gräbern vom
ehemaligen Bürgermeister Karl-Heinz Klingen und
dem Gründer des Partnerschaftsvereins
Klaus-Dieter Graf niedergelegt werden
Die Städtepartnerschaft zwischen Agen und
Dinslaken lebt nicht nur von offiziellen
Besuchen – sie wird getragen von den Menschen
beider Städte. Das ehrenamtliche Engagement des
Städtepartnerschaftsvereins Dinslaken und des
Comité de Jumelage Agen-Dinslaken spielt dabei
seit mittlerweile zehn Jahren eine zentrale
Rolle. Doch schon mit Beginn der
Städtepartnerschaft entstand ein reger Austausch
von verschiedenen Vereinen und Schulen.
Schülerbesuche ermöglichen es jungen Menschen,
andere Kulturen kennenzulernen, Vorurteile
abzubauen und persönliche Verbindungen zu
knüpfen. „Die Jugend ist unsere Zukunft“, sagt
Bürgermeisterin Eislöffel. „Es liegt an uns
allen, diese Freundschaft
generationenübergreifend zu leben und
weiterzugeben.“
Am Sonntagnachmittag wird
im Rathaus ein Festakt abgehalten, mit dem die
langjährige Partnerschaft gewürdigt wird. Den
feierlichen Abschluss des Besuchs bildet ein
festliches Konzert in der Kathrin-Türks-Halle,
das der Städtepartnerschaftsverein organisiert
hat: Die festival:philharmonie westfalen sowie
der festival Chor musik:landschaft westfalen
präsentieren Beethovens 9. Symphonie – ein
musikalisches Meisterwerk, das mit seiner Ode
„An die Freude“ wie kein anderes Stück für den
europäischen Gedanken steht.
Die
Feierlichkeiten sind nicht nur ein Rückblick auf
fünf Jahrzehnte erfolgreicher Zusammenarbeit
zwischen Dinslaken und Agen, sondern auch eine
Einladung an die Menschen beider Städte, Teil
dieser besonderen Verbindung zu sein. „Unsere
Städtepartnerschaft zeigt uns die Stärke des
Miteinanders“, so Eislöffel abschließend. Mit
Blick auf die Zukunft fügt sie hinzu: „Möge
unsere Freundschaft weiterhin wachsen – als
Symbol für Frieden, Verständigung und
Zusammenarbeit Landesgrenzen hinweg für ein
geeintes Europa.“
Mehr Transparenz
– Kostenfallen abbauen!
Anlässlich des Weltverbrauchertags am 15. März
veröffentlicht das JFF – Institut für
Medienpädagogik eine Studie zum Umgang von 12-
bis 14-Jährigen mit Monetarisierungsmodellen in
Online-Games. Sehr geehrter Herr Jeschke, Die
Ergebnisse der Studie zeigen, dass
unterschwellige Kaufanreize, intransparente
Kostenstrukturen und manipulative Gamedesigns
Heranwachsende in ihren Konsumentscheidungen
erheblich beeinflussen können.
Vielfältige Kaufanreize versetzen junge
Gamer*innen unter Handlungsdruck Zahlreiche
Online-Spiele und Plattformen wie Roblox, Clash
Royale oder EA Sports FC, die besonders bei
Jugendlichen beliebt sind, bieten ihren
Nutzer*innen die Möglichkeit, mit Echtgeld
sogenannte In-Game-Währungen, Items und
Spielvorteile zu kaufen. Diese Extras können das
Spielerlebnis intensiver gestalten und den
Spielfortschritt beschleunigen. Zwei Drittel der
Studienteilnehmer*innen im Projekt ACT ON! haben
bereits Geld in Online-Games ausgegeben.
Nicht wenige betonen, ihr in der Regel
begrenztes Budget mit Bedacht auszugeben und
gamesbezogene Käufe abzuwägen. Zwischen
„Vorteilsangeboten“, Belohnungssystemen und
glücksspielähnlichen Elementen fällt es Kindern
und Jugendlichen jedoch nicht immer leicht ihre
Konsumimpulse zu regulieren.
Intransparente Wechselkurse und
Mikrotransaktionen erschweren zudem die
Kontrolle über die Ausgaben. Einige
Teilnehmer*innen berichten von ihren
ausgabenbezogenen Kontrollverlusten, die
teilweise erhebliche Ausmaße erreichen. Die
Studie verdeutlicht Handlungsbedarfe auf
verschiedenen Ebenen: Frühzeitige
Sensibilisierung: Heranwachsende sollten
möglichst frühzeitig zu einem kritischen
Konsumverhalten befähigt und in der Entwicklung
affektiver Kompetenzen gefördert werden.
Eltern unterstützen: zur Entwicklung
medienerzieherischer Kompetenzen benötigen
Eltern niederschwellige Informationen und
unaufwändige Sicherungsangebote. Verantwortung
der Games-Industrie: Spieleanbieter sind in die
Pflicht zu nehmen, Kostenstrukturen transparent
abzubilden und maximale Schutzfunktionen zu
implementieren.
Regulierung
manipulativer Kaufmechanismen: Dark Patterns,
Pay-to-win-Strukturen und
Skin-Trading-Plattformen müssen kritisch geprüft
und für Minderjährige strenger reguliert werden.
Fazit: Schutz und Befähigung junger
Verbraucher*innen notwendig Die Ergebnisse aus
ACT ON! zeigen, dass viele Kinder und
Jugendliche ihre Ausgaben in Online-Games
durchaus reflektieren, jedoch durch gezielte
Kaufanreize und soziale Dynamiken unter starken
Druck geraten.
Um sie zu souveränen und
handlungssicheren Konsument*innen zu machen,
sind medienpädagogische Unterstützungsangebote
erforderlich, die ihre kritisch-reflexiven und
affektiven Kompetenzen im digitalen Raum gezielt
stärken. Zudem sind Games-Anbieter gefordert
faire und transparente Kostenstrukturen zu
gestalten, die sich noch stärker an
jugendmedienschutzrechtlichen Prinzipien
orientieren.
Beteiligungsverfahren zur 1.
Regionalplanänderung zum Ausbau der Windenergie
abgeschlossen - 270 Stellungnahmen in der
Abwägung
Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat vom 20.
Januar bis 3. März 2025 ein sechswöchiges
Beteiligungsverfahren zur 1.
Regionalplanänderung im Hinblick auf den Ausbau
der Windenergie gestartet.
Sowohl
öffentliche Stellen wie Kommunen, Fachbehörden
oder Kammern, als auch Bürgerinnen und Bürger,
private Initiativen und Verbände hatten in
dieser Zeit Gelegenheit, zu den Planinhalten
Stellung zu nehmen. Insgesamt sind etwa 270
Stellungnahmen eingegangen. Die exakte Anzahl
kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau
benannt werden, da einige Stellungnahmen in
mehrfacher Ausführung sowohl postalisch als auch
digital eingegangen sind.
Alle
eingegangenen Stellungnahmen werden nun von der
Regionalplanungsbehörde ausgewertet und
sämtliche entscheidungsrelevante Belange müssen
abgewogen werden. Ausschlaggebend ist, dass es
sich bei den vorgebrachten Anregungen um
substanzielle, planerisch handhabbare Belange
handelt. Mangelnde Akzeptanz allein ist dabei
kein abwägungserheblicher Belang.
Sofern auf Grundlage der Einwendungen Änderungen
an der Flächenkulisse vorgenommen werden
sollten, müssen diese immer auch fachlich
begründet werden. Sollten im Rahmen des
Beteiligungsverfahrens Hinweise eingegangen
sein, die eine Änderung des Planentwurfs
erfordern (durch Herausnahme, Neuabgrenzung oder
Hinzunahme von Windenergiebereichen), ist eine
weiteres Beteiligungsverfahren notwendig.
Insofern entscheidet der nun laufende
Prozess auch darüber, ob die
RVR-Verbandsversammlung den das Verfahren
abschließenden Feststellungsbeschluss wie
angestrebt noch in diesem Jahr fassen kann. Nach
dem Beschluss muss die Planänderung bei der
Landesplanungsbehörde zur Rechtsprüfung
angezeigt werden.
Mit der
Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt
des Landes NRW wird die 1. Änderung des
Regionalplans Ruhr dann rechtskräftig. Die
RVR-Verbandsversammlung hatte am 13. Dezember
2024 den sogenannten Aufstellungsbeschluss für
die 1. Regionalplanänderung gefasst und das
Änderungsverfahren damit förmlich eingeleitet.
idr
Robert Koch-Institut:
Akute Respiratorische Erkrankungen – aktuelle
Saison
Die ARE-Aktivität geht nach mehreren Wochen auf
hohem Niveau inzwischen deutlich zurück,
weiterhin dominiert die Zirkulation der
Influenzaviren das ARE-Geschehen. In der 10. KW
wurden überwiegend Influenza B-Viren im
ambulanten Bereich nachgewiesen.
Bei
schwer verlaufenden Erkrankungen unter älteren
Patientinnen und Patienten wurden weiterhin am
häufigsten Influenza A(H1N1)pdm09-Viren
nachgewiesen. Personen können das Risiko einer
Influenzainfektion durch die bekannten
Verhaltensweisen reduzieren (unabhängig vom
Impfstatus): www.rki.de/are-faq-schutz.
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen
Wochenbericht. Weiterlesen
Krankenhäuser für
Befragung zur Influenza-Impfung gesucht
(OKaPII-Studie)
Das Robert Koch-Institut
führt jährlich eine Online-Befragung von
Krankenhaus-Personal zur Influenza-Impfung
(OKaPII) durch und erfasst die Impfquote sowie
die Gründe der Impfentscheidung zur
Grippeschutzimpfung. Eine Anmeldung zur
Studienteilnahme erfolgt über das Krankenhaus,
das sich über eine kurze Online-Abfrage zu
Krankenhausmerkmalen für die Studie registriert
und für seine Mitarbeitenden einen Link zum
Online-Fragebogen erhält.
Anmeldeschluss
für die Krankenhäuser ist der 4. April 2025. Im
Anschluss an die Datenerhebung erhalten die
Krankenhäuser einen einrichtungsbezogenen
Ergebnisbericht, der dabei unterstützt, die
hauseigenen Impfaktivitäten vorzubereiten.
vhs-Moers –
Kamp-Lintfort: Workshops zum Tag der Druckkunst
Zum Tag der Druckkunst am Samstag, 15. März,
bietet die vhs Moers – Kamp-Lintfort gemeinsam
mit der Bibliothek Moers und dem Kulturbüro von
12 bis 16 Uhr verschiedene Workshops an.
Diese finden von 12 bis 16 Uhr im
Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum an der
Wilhelm-Schroeder-Straße 10 statt. Interessierte
können an diesem Nachmittag verschiedene
Techniken vom Buchdruck bis zum Materialdruck
ausprobieren.
Die Veranstaltung ist
kostenlos. Eine Anmeldung für die
Workshop-Angebote ist telefonisch unter 0 28 41
/ 201 – 565 und online unter www.vhs-moers.de möglich.
Hundebesitzer: Hundesteuer in Kleve war
zum 15. Februar 2025 fällig
In der kommenden Woche beginnt die Stadt Kleve
mit dem Mahnlauf für die Hundesteuer. Zahlreiche
Hundehalterinnen und Hundehalter haben die
Zahlung bislang versäumt – vermutlich, weil die
Steuerbescheide seit dem vergangenen Jahr als
Dauerbescheide gelten und nicht mehr jährlich
neu verschickt werden. Der erste
Fälligkeitstermin für das Jahr 2025 war bereits
am 15. Februar.
Die Stadt Kleve ruft nun
alle zahlungspflichtigen Hundebesitzerinnen und
Hundebesitzer dazu auf, ihre Zahlung kurzfristig
zu prüfen und nachzuholen, um eine Mahnung zu
vermeiden. Zum Ende der kommenden Woche werden
die Mahnungen versendet. Wer die Zahlung also
kurzfristig anstößt, kann noch mit einem
rechtzeitigen Eingang bei der Stadt Kleve
rechnen.
Bereits Anfang 2024 hat die
Stadt Kleve die Erhebung der Hundesteuer auf
sogenannte Dauerbescheide umgestellt. Diese
werden nicht jährlich neu verschickt, wie es
bislang der Fall war. Stattdessen gelten die
Beträge und Fälligkeiten des Vorjahres auch für
das aktuelle Jahr. Darauf weisen die Bescheide
aus 2024 einerseits deutlich hin, andererseits
hat die Stadt Kleve Mitte Dezember 2024 per
Pressemitteilung und auf www.kleve.de nochmals
darauf aufmerksam gemacht. Wer seinen Bescheid
aus 2024 nicht mehr besitzt oder Fragen zur
Hundesteuer hat, kann sich an die folgende
E-Mail-Adresse wenden:
steuern@kleve.de.
Hundesteuerbescheid 2024 Beispiel
So sieht
ein beispielhafter Dauerbescheid zur Hundesteuer
in Kleve aus. Zum Vergrößern anklicken.
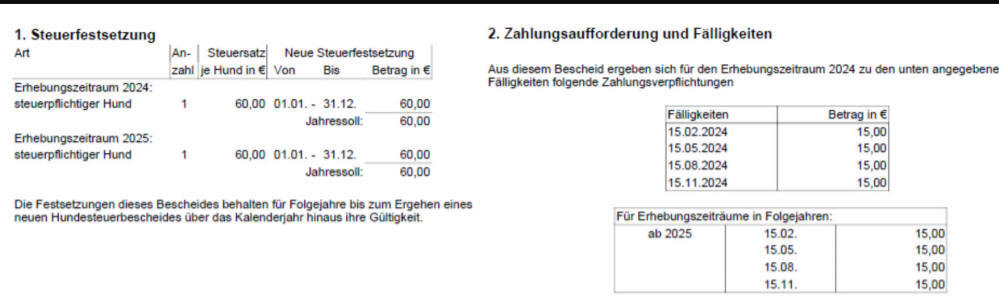
Folgendermaßen hat die Stadt Kleve am 12.
Dezember 2024 über die Umstellung informiert:
Wer einen Hund hält, zahlt dafür in den
meisten Kommunen Deutschlands eine Hundesteuer.
Auch in Kleve wird eine Hundesteuer erhoben,
deren Höhe sich vor allem nach der Anzahl der
gehaltenen Hunde bemisst. Ein Hund kostet
jährlich 60 Euro, zwei Hunde kosten 90 Euro je
Hund, drei und mehr Hunde kosten 108 Euro je
Hund.
Hundehalterinnen und Hundehalter
haben in der Vergangenheit jeweils zum
Jahreswechsel einen Hundesteuerbescheid von der
Stadt Kleve erhalten, der die Höhe sowie die
Fälligkeit der zu zahlenden Hundesteuer
ausweist. Mit Beginn des Jahres 2024 wurde die
Erhebung der Hundesteuer in Kleve allerdings auf
sogenannte Dauerbescheide umgestellt.
Solange sich keine Änderungen in den
Verhältnissen der Hundehaltung ergeben –
insbesondere also im Vergleich zum Vorjahr weder
zusätzliche Hunde noch weniger Hunde gehalten
werden – gilt ein solcher Dauerbescheid für die
Folgejahre fort. Es bleibt dann bei denselben
Fälligkeiten zur Zahlung der Hundesteuer und bei
derselben Steuerhöhe, bis ein Änderungsbescheid
durch die Stadt Kleve ergeht. Bleiben alle
Verhältnisse gleich, entfällt also die
alljährliche Post zum Jahreswechsel.
Hundehalterinnen und Hundehalter wurden hierauf
bereits im Anfang 2024 ergangenen Dauerbescheid
hingewiesen. Die seinerzeit versandten Bescheide
weisen die Steuerhöhe und die Fälligkeiten ab
dem Jahr 2025 explizit aus.
Grundsätzlich
gilt, dass Klever Bürgerinnen und Bürger einen
Hund innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme in
den Haushalt bei der Stadt Kleve anmelden
müssen. An- und Abmeldungen können schnell und
unkompliziert komplett digital über
www.kleve.de/serviceportal erledigt werden. Wer
keinen Zahlungstermin verpassen möchte, kann der
Stadt Kleve dort ebenfalls volldigital ein
Lastschriftmandat erteilen.
Kinder und Jugendliche komponieren für das moers
festival Moers
Das moers festival
bietet Nachwuchs-Komponistinnen und Komponisten
eine Bühne: Das Projekt "… plötzlich still im
Unimoersum!?" bringt Kinder und Jugendliche ab
neun Jahren mit erfahrenen Musikerinnen und
Musikern zusammen, unter deren Anleitung sie die
Kraft von "Stille" in der Musik erforschen und
mit unterschiedlichen Ausdrucksformen
experimentieren.
Das entstehende
Musikstück präsentieren die Kinder dann beim
moers festival (6. bis 9. Juni) auf der Bühne.
Wer mitmachen möchte, sendet seine oder ihre
Gedanken zur Stille in Form von Musik, Tanz,
Text, Performance, Schauspiel oder einer ganz
eigenen Art von Kunst an Leticia Carrera
(l.i.carrera@outlook.de) oder Polina Titova
(polina.titova@moers-festival.de) oder per
WhatsApp an 0160/1533920. Bewerbungsschluss ist
der 31. März 2025. idr - Infos unter
https://www.moers-festival.de/
Kleve: Stefan Schöler am
Samocca-Hauspiano
Sa., 15.03.2025 -
10:00 - 12:00 Uhr
Einmal im Monat zur besten
Frühstückszeit lädt das Café Samocca zum
Live-Piano. Der Klever Pianist Stefan Schöler
ist am Samstag, 15.03.2025 von 10 bis 12 Uhr, im
Kaffeehaus an der Hagschen Str. 71 in Kleve zu
Gast.

Der studierte Musiker spielt seine eigenen
Kompositionen und Jazz-Improvisationen. Der
Eintritt zum Hauspiano ist frei, eine
Reservierung zum Frühstück kann unter der
Telefonnummer 02821 7113931 vorgenommen werden.
Dinslaken: Picobello Frühjahrsputz
geht bald los – bis 19. März anmelden
Bis zum 19. März 2025 können sich alle
Interessierten noch schnell für die beliebte
Müllsammelaktion Picobello anmelden. 48 Gruppen
haben sich bisher mit rund 1.700 Menschen für
die diesjährige Aktion gemeldet. Es gibt noch
freie Kapazitäten! Vom 22. bis 29. März 2025
findet die Aktion statt.
Dinslakener*innen, Kindergärten, Schulen,
Vereine, Verbände, Nachbarschaften, Unternehmen
und sonstige Organisationen und Gemeinschaften
sind herzlich dazu eingeladen mitzumachen. „Ich
freue mich über jede helfende Hand, die sich für
unsere Natur und Umwelt stark macht.
Generationsübergreifend setzen sich bei dieser
Aktion Menschen dafür ein, unsere Stadt
gemeinsam sauberer und lebenswerter zu machen“,
so Bürgermeisterin Michaela Eislöffel. Melden
Sie sich jetzt noch schnell über die Homepage
der Stadt Dinslaken www.dinslaken.de (Stichwort
„picobello“) an.
Der konkrete
Sammeltag im Aktionszeitraum und der Sammelort
sind frei wählbar, sofern es sich um öffentliche
Flächen der Stadt handelt oder die Genehmigung
des Grundstückseigentümers beziehungsweise der
Grundstückseigentümerin vorliegt. Die benötigten
Sammelsäcke werden von der Stadt Dinslaken
gestellt, Arbeitshandschuhe, Greifzangen und
Warnwesten auch, aber nur soweit verfügbar.
Diese Materialien müssen
kurzfristig zurückgegeben werden, um für andere
wieder zur Verfügung zu stehen. Es wird
empfohlen, festes Schuhwerk, Handschuhe und eine
Warnweste beim Picobello-Einsatz zu tragen.
Problemabfälle dürfen nicht gesammelt werden.
Beim Auffinden von Altölkanistern,
Autobatterien, ätzenden und umweltgefährlichen
Stoffen sollte der Fundort dem DIN-Service
gemeldet werden. Auch bei scharfkantigen,
spitzen oder schweren Gegenständen ist Vorsicht
geboten.
Kleve: Konzert mit
dem Celloquartett ausverkauft
Alle
lieben Cello – so ist das Konzert des
2CitiesCelloquartett am Sonntag, 16. März, in
der Kleinen Kirche schon jetzt ausverkauft! Es
gibt auch keine Karten mehr an der Abendkasse.

Das 2Cities Celloquartett
Kleiner
Trost: einer der Cellisten kommt schon bald
erneut zum Konzert nach Kleve! Cellist Michael
Wehrmeyer gastiert am Sonntag, 27. April, 18 Uhr
im Museum Kurhaus, zusammen mit der Harfenistin
Johanna Dorothea Görißen.
Die beiden
sind ebenfalls junge Stipendiaten des Deutschen
Musikwettbewerbs in der Konzertauswahl des
Deutschen Musikrates und bilden das duo51Saiten.
Auf ihrem Konzertprogramm stehen u.a. Werke von
Gabriel Fauré, Franz Schubert, Lili Boulanger,
Isang Yun und Claude Debussy.
Wie das
Celloquartett legt auch das Duo aus Cello und
Harfe einen Programmschwerpunkt auf Musik aus
Frankreich. Zusammen spielen die beiden sogar
auf noch mehr Saiten als die vier Celli.
Konzertkarten (12 €/ Schüler + Studenten 5 €)
gibt es auch schon für dieses Konzert auf
www.kleve.reservix.de, an allen
Reservix-VVK-Stellen (Buchhandlung Hintzen,
Niederrhein Nachrichten, Klever Rathaus-Info),
Einlass: 17.30 Uhr.
Kleve:
Seminar: Denk dich glücklich - Optimismus
lernen!
Mi., 19.03.2025 - 19:00 -
Mi., 19.03.2025 - 21:30 Uhr
Unsere Gedanken
bestimmen, wie wir die Welt um uns herum
wahrnehmen. Zwar können wir die Realität nicht
ändern, aber unsere Sichtweise darauf.
Nachhaltig die Gedanken optimistischer zu
verändern und somit glücklicher zu werden, ist
möglich! In diesem Kolkgespräch stellen wir
leicht in den Alltag zu integrierende, effektive
(und wissenschaftlich belegte) Übungen vor, die
Ihnen helfen, Ihre Stimmung positiver zu
beeinflussen.

Die Eintrittskarten sind hier erhältlich:
https://www.wasserburg-rindern.de/veranstaltungen/info/25-306
Neues Amtsblatt
Am
14. März 2025 ist ein neues Amtsblatt der Stadt
Dinslaken erschienen. Es enthält eine
öffentliche Bekanntgabe der Fernwärmeversorgung
Niederrhein GmbH. Die Amtsblätter der Stadt
Dinslaken können auf der städtischen Homepage
nachgelesen werden: www.dinslaken.de.
Die Stadt Moers hat ein Amtsblatt
veröffentlicht.
Alle
veröffentlichten Amtsblätter finden Sie unter https://www.moers.de/rathaus-politik/amtsblaetter
Amtsblatt Nr. 05 vom 13.03.2025 (358.19 KB)

Eierproduktion 2024 um 4,2 % gestiegen
• Hennenhaltung und Eierproduktion im Freiland
und in ökologischer Haltung nehmen weiter zu,
Bodenhaltung aber nach wie vor dominierende
Haltungsform
• Bis Ende 2025 auslaufende
Kleingruppen- und Käfighaltung geht weiter
zurück
• Insgesamt 13,7 Milliarden Eier und
damit 302 Eier je Legehenne im Jahr 2024
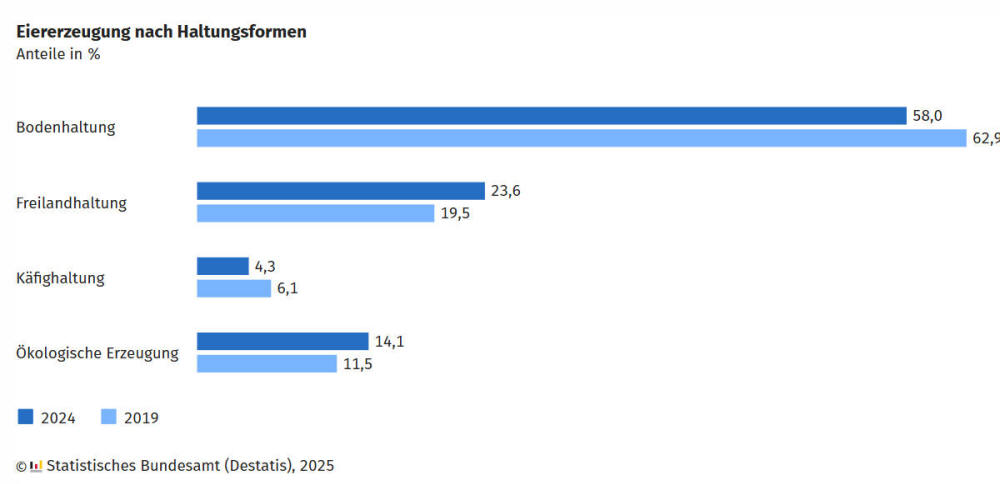
Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 13,7
Milliarden Eier in Betrieben von Unternehmen mit
mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen
produziert. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, stieg die Eierproduktion
damit gegenüber dem Vorjahr um 4,2 % oder 550
Millionen Eier. Die Bodenhaltung war mit 58,0 %
der erzeugten Eier nach wie vor die dominierende
Haltungsform, wenngleich der Anteil im
Vorjahresvergleich erneut sank (2023: 58,8 %).
Im Fünfjahresvergleich zum Jahr 2019
wird der rückläufige Trend der Bodenhaltung noch
deutlicher: Damals stammten noch 62,9 % der in
Deutschland produzierten Eier aus Bodenhaltung.
Demgegenüber stieg der Anteil der Eier aus
Freilandhaltung im Jahr 2024 weiter auf 23,6 %
(2023: 23,0 %; 2019: 19,5 %). Der Anteil der
Eier aus ökologischer Erzeugung lag bei 14,1 %
und stieg damit ebenfalls gegenüber dem Vorjahr
(2023: 13,4 %; 2019: 11,5 %).
Der
verbleibende Anteil von 4,3 % der Eierproduktion
entfiel auf die Haltung in Kleingruppen und
ausgestalteten Käfigen (2023: 4,9 %; 2019: 6,1
%). Insgesamt wurden in den erfassten Betrieben
im Jahresdurchschnitt 45,3 Millionen Legehennen
gehalten. Damit legt eine Henne im Jahr 2024
durchschnittlich 302 Eier.
Champignonernte 2024 um 2,7 % gesunken
• Fast 98 % der im Jahr 2024 geernteten
Speisepilze waren Champignons
• Knapp 12 %
der gesamten Erntemenge von Speisepilzen
ökologisch
produziert
• Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen bedeutendste Speisepilz-Anbauländer
Im Jahr 2024 wurden in
Deutschland 75 700 Tonnen Champignons
geerntet. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, waren das 2,7 %
weniger als im Vorjahr, aber 5,7 % mehr als im
zehnjährigen Durchschnitt von 2014 bis 2023.
Die gesamte Erntemenge an Speisepilzen in
Betrieben mit mindestens 0,1 Hektar
Produktionsfläche belief sich 2024 auf 77 700
Tonnen.
Der überwiegende Anteil der
Speisepilzerzeugung entfiel mit einem Anteil von
97,5 % auf Champignons. Die übrige Erntemenge
setzte sich aus Austernseitlingen, Shiitake
und sonstigen Spezialpilzkulturen zusammen. 11,7
% der Speisepilze (9 100 Tonnen) wurden in
Betrieben mit vollständig ökologischer
Erzeugung produziert.
Erntefläche von
Champignons um 4,7 % gesunken
Die
Erntefläche für die Erzeugung von Champignons
sank im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %
auf 341 Hektar. Sie lag damit aber immer noch
6,6 % über dem zehnjährigen Durchschnitt der
Jahre 2014 bis 2023. Die gesamte Erntefläche für
Speisepilze belief sich auf 355 Hektar, wovon
13,8 % vollständig ökologisch bewirtschaftet
wurden.
Im Jahr 2014 hatte die
gesamte Erntefläche noch 261 Hektar betragen,
mit einem vollständig ökologischen Anteil von
13,9 %. Größte Speisepilz-Ernteflächen in
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Die beiden
bedeutendsten Bundesländer für die
Speisepilzproduktion waren 2024 wie in den
Vorjahren Niedersachsen mit einer Erntefläche
von 194 Hektar und Nordrhein-Westfalen mit einer
Erntefläche von 77 Hektar.
Fünf Jahre Corona: 2024 übertrifft Zahl der
Unternehmensinsolvenzen in NRW erstmals das
Vorkrisenniveau
Im Jahr 2024 haben
die nordrhein-westfälischen Amtsgerichte 5 640
Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren
23,4 Prozent mehr Unternehmensinsolvenzen als
ein Jahr zuvor (Jahr 2023: 4 572 Verfahren). Wie
das StatistischesLandesamt anlässlich des
Beginns der Corona-Pandemie vor fünf Jahren
mitteilt, lag die Zahl der gemeldeten
Unternehmensinsolvenzen erstmals wieder über dem
Vorkrisenniveau (2019: 5 351 Verfahren), nachdem
sie in den Jahren bis 2022 zurückgegangen war.
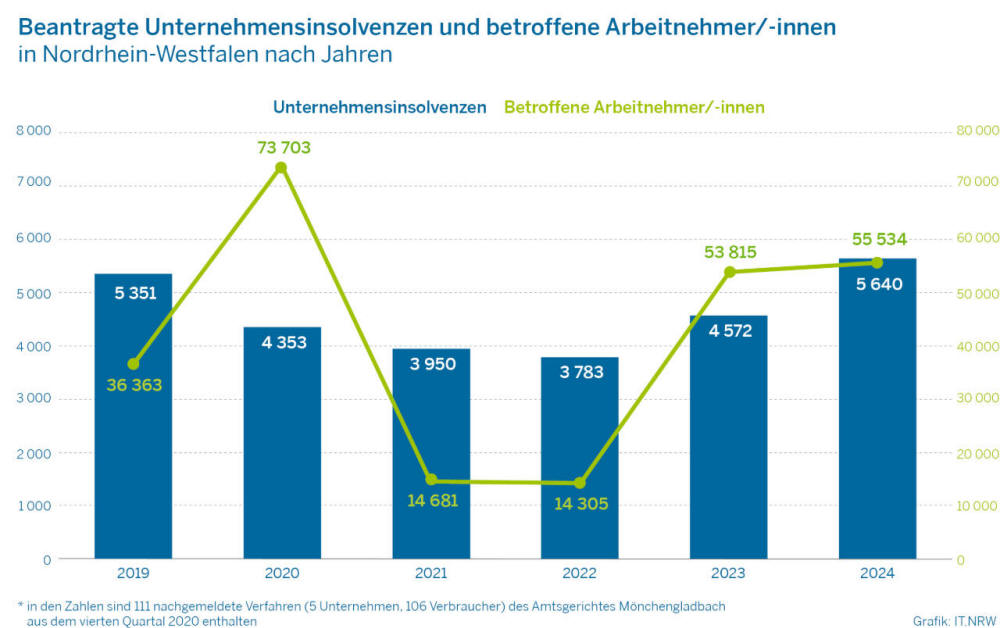
Zum Zeitpunkt der Übermittlung der Daten
waren 55 534 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
von einer Unternehmensinsolvenz betroffen, das
waren 3,2 Prozent mehr als im Jahr 2023 (damals:
53 815 Beschäftigte). Im Vergleich zu den Zahlen
vor der Corona-Krise (2019: 36 363 Beschäftigte)
waren 52,7 Prozent mehr Beschäftigte von
Unternehmensinsolvenzen betroffen.
Allerdings waren zwischenzeitlich im ersten
Pandemiejahr 2020 sogar rund 74 000
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einer
Unternehmensinsolvenz betroffen. Damit lag die
Zahl 2024 um 24,7 Prozent niedriger als zu
Beginn der Corona-Pandemie 2020. Die
voraussichtlichen Forderungen waren mehr als
viermal so hoch wie im Jahr 2019 Die Höhe der
voraussichtlichen Forderungen der
Unternehmensinsolvenzen beliefen sich im Jahr
2024 auf 13,6 Milliarden Euro und lagen damit um
58,2 Prozent höher als im entsprechenden
Vorjahreszeitraum (Jahr 2023: 8,6 Milliarden
Euro).
Die voraussichtlichen
Forderungen waren mehr als viermal so hoch wie
im Jahr 2019 (damals: 3,2 Milliarden Euro). Zahl
der Verbraucherinsolvenzen um 9,4 Prozent höher
als 2019 Die Zahl der gemeldeten Verfahren von
beantragten Verbraucherinsolvenzen (dazu zählen
Arbeitnehmende, Personen in Rente oder
Erwerbslose) stieg gegenüber dem Jahr 2023
(damals: 17 186 Verfahren) um 0,6 Prozent auf
17 285 Verfahren. Im Vergleich zu 2019 lag die
Zahl der Verbraucherinsolvenzen um 9,4 Prozent
höher (damals: 15 797).
Die
voraussichtlichen Forderungen waren mit
0,79 Milliarden Euro nahezu auf dem
Vorjahresniveau (2023: 0,81 Milliarden Euro);
2019 lagen sie bei 0,73 Milliarden Euro. Neben
den Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen gab
es im Jahr 2024 noch 5 409 weitere gemeldete
Insolvenzverfahren von übrigen Schuldnerinnen
und Schuldnern.
Insgesamt haben die
Amtsgerichte im Jahr 2024 damit 28 334
beantragte Insolvenzverfahren gemeldet, das
entspricht einem Plus von 6,0 Prozent gegenüber
dem Vorjahr (2023: 26 737 Verfahren) und einem
Anstieg von 12,4 Prozent gegenüber 2019 (damals:
25 198 Verfahren).
Freitag, 14. März
2025
Freie Plätze in Moerser Kitas
Rund 100 freie Plätze melden die
(städtischen und nichtstädtischen)
Kindertageseinrichtungen in Moers für Kinder
über 3 Jahren (Ü3). Auch unterschiedliche
Stundenkontingente sind noch verfügbar. Im
U3-Bereich gibt es nur noch vereinzelte
Kita-Plätze. Hier sind die Tagespflegepersonen
aber eine gute Alternative.
Die
Betreuung in den kleinen Gruppen ist meist
familiärer und kann für die jüngeren Kinder aus
pädagogischer Sicht oft die sinnvollere
Alternative zur Kita sein. Die Fachberatung des
städtischen Fachdienstes Jugend berät hier
gerne. Mit dem Besuch einer Kindertagespflege
geht übrigens der Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz ab dem 3. Lebensjahr nicht
verloren.
Kontakt für freie
Kita-Plätze: Telefon 0 28 41 / 201-353 (Iris
Alexandra Arndt/Torben Paulsen). Kontakt für
freie Plätze in der Kindertagespflege: Telefon 0
28 41 / 201-824 (Sandra Koth) oder 0 28 41 /
201-825 (Melanie Wirth).
Asiatische Hornisse auch in Moers: Gefahr für
die heimische Insektenwelt
Schon
seit Jahren ist ein starker Rückgang der
heimischen Insekten zu beobachten. Nun breitet
sich ein Feind der heimischen Arten auch in
Moers aus: die asiatische Hornisse (Vespa
velutina).

Die asiatische Hornisse erkennt man an der
nahezu schwarzen Brust, leuchtend gelben Füßen
und dem dunklen Hinterleib mit gelben Streifen.
(Foto: Thomas Beissel)
Die Untere
Naturschutzbehörde Kreis Wesel ruft daher die
Bürgerinnen und Bürger auf, Sichtungen dieser
Hornissenart zu melden. Sie zeichnet sich durch
eine nahezu schwarze Brust, auffallend leuchtend
gelbe Füße und einen dunklen Hinterleib aus, der
mit gelben Streifen überzogen ist.
Die
Arbeiterinnen erreichen eine Größe von 1,5 bis
2,5 cm, die Königin bis zu 3 cm. Während
asiatische Hornissen eine ernsthafte Bedrohung
für Bienen und andere Insekten darstellen,
müssen sich Menschen nicht besonders vor ihr
fürchten, außer sie sind Allergiker/innen. Ihr
Stich ist vergleichbar mit dem einer heimischen
Wespe oder Hornisse.
Beseitigung der
Nester durch Fachleute
In freier Wildbahn
sind die Tiere in der Regel friedlich.
Erschütterungen in der Nähe von Nestern hingegen
versetzen die Hornissen in einen Alarmzustand.
Daher sollte die Beseitigung Fachleuten
überlassen werden. Sie orten die Hornissennester
oft mithilfe der Dochtglas-Methode. Die dafür
aufgestellten Locktöpfe sollten unbedingt stehen
gelassen werden.
Wer eine asiatische
Hornisse oder ihr Nest entdeckt, soll nach
Möglichkeit ein Foto mit Angabe des Fundorts und
einer Beschreibung des Nistortes an die Untere
Naturschutzbehörde schicken:
info.unb@kreis-wesel.de. Örtliche Imker helfen
gerne bei der Identifizierung.
Wordpress-Kurs in der vhs Moers -
Kamp-Lintfort
Wer seine persönliche
oder unternehmerische Internetpräsenz auf- oder
ausbauen möchte, ist bei der vhs Moers -
Kamp-Lintfort richtig: Am Freitag, 21. März, ab
18 Uhr, und Samstag, 22. März, ab 9 Uhr, findet
in den Räumen an der Wilhelm-Schroeder-Straße 10
der Kurs ‚Die eigene Webseite mit WordPress‘
statt.
Das praxisorientierte Seminar
vermittelt den Einstieg zum Erstellen einer
eigenen Website. Programmierkenntnisse sind
nicht erforderlich, aber PC-Grundkenntnisse
sollten vorhanden sein. Eine vorherige Anmeldung
für den Kurs ist erforderlich und telefonisch
unter 0 28 41/201 – 565 sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.
Wesel:
Frühlingsmarkt am 15./16. März 2025 im
Deichdorfmuseum
Frische Ideen für
den Frühling ... dafür ist der
Frühlings-Kunsthandwerkermarkt im
Deichdorfmuseum Bislich weit über die Grenzen
des Dorfes am Niederrhein bekannt. Unmittelbar
vor dem Museum, zwischen den
Ausstellungsbereichen, auf dem großzügigen
Museums-Innenhof und in den charmanten
Ausstellungsscheunen beziehen hierzu viele
Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker der
Region ihre liebevoll dekorierten Stände.
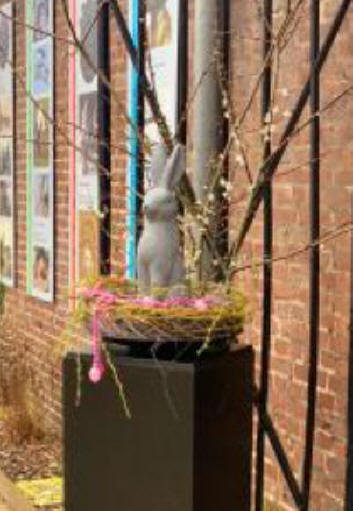
Samstag 15.03.2025 und Sonntag 16.03.2025
(jeweils ab 11.00 Uhr) geht es los. Bis 18.00
Uhr wird an beiden Tagen jede Menge geboten:
Inspirationen für den Start in die warme
Jahreszeit, Ideen für Kind und Kegel, leckere
Snacks in urigem Ambiente ... nicht umsonst
erfreut sich der Markt daher auch überregional
so großer Beliebtheit! Der Eintritt kostet für
Erwachsene 2 Euro pro Person (Kinder bis 14
Jahren haben freien Zutritt).
Die
Eintrittsgelder kommen dabei vollumfänglich dem
weitestgehend ehrenamtlich betriebenen
Deichdorfmuseum zu Gute. Für Kinder gibt es
Kreativecken und zwischen 11.30 und 16.30
plastisches Gestalten im Leseraum des
Obergeschosses. Wer gerne mal sehen möchte, wie
früher auf den Höfen gebacken wurde, kommt an
den Vormittagen auf seine Kosten.
Bei den Ständen neu vorgestellt werden diesmal
unter anderem zarte Malereien auf besonderem
Untergrund, dekorative Überraschungen und bunte
genähte Hasen, die einfach zum Kuscheln
einladen. Dazu gibt es auch wieder kreativen
Schmuck, Spannendes aus Holz und Stein,
österliches und vieles mehr. Wer eher nicht
durch die Reihen bummeln möchte, kann sich
unsere Vogelwelt-Präsentation ansehen, den
riesigen Wels aus der Rhein-Deich-Scheune
bestaunen oder mehr erfahren zum Thema Deichbau
und Deichschutz in den letzten Jahrhunderten.
Da der Markt drinnen wie draußen
stattfindet, ist er für jedes Wetter geeignet.
Genügend Parkflächen sind per Beschilderung
ausgewiesen. Und wer dann einfach genug vom
bunten Trubel hat, kann durch das Dorf zum Deich
schlendern, bei der Kirche den Störchen zusehen,
am Samstag die Schmiedemannschaft bis ca. 16.00
Uhr in Aktion erleben oder einfach nur den
Ausblick über den Rhein genießen.
Bislich ist nicht umsonst für viele Wandernde
und Radfahrer wie das Deichdorfmuseum selbst ein
lohnenden Ziel für Touren. Bei dieser
Gelegenheit schon mal ein SAVE THE DATE:
(Palm-)Sonntag 13.04.2025 Eröffnung der
Sonderausstellung 2025 Auch in diesem Jahr
verbindet sich mit dem Fährenstart der beliebten
Bislicher Rad- und Personenfähre zwischen
Bislich und Xanten-Beek die Eröffnung der großen
Jahres-Sonderausstellung im Museum. Sie steht in
diesem Jahr ganz im Zeichen von 80 Jahre
Kriegsende am Niederrhein.
80 Jahre
Kriegsende bedeutet hier auch 80 Jahre Frieden
und die Befreiung vom Regime der
Nationalsozialisten, welches unfassbares Leid
über Millionen von Menschen in ganz Europa
brachte, Das direkt am Rheindeich gelegene Dorf
Bislich fand sich damals - im März 1945 -
relativ unerwartet mitten in einer der
Offensiven Alliierter Truppenverbände in der
Region wieder.
"Dakotas über dem
Dorf - Bislich im März 1945" lautet der Titel
der Ausstellung, die die Vorgeschichte, die
Geschehnisse und die Stimmungen dieses
besonderen Momentes der Bislicher Geschichte
unter anderem aus den Perspektiven der
Zeitzeugen vorstellt. Es wird eine Ausstellung
mit englischsprachigen Zusammenfassungen der
Texte sein.
Schottische Truppenverbände
waren es, die Bislich am 24. März frühmorgens
eroberten und auch in Bislich bauten englische
Ingenieure 1945 eine sogenannte Bailey-Bridge,
von der Teile vor und im Museum für diesen
besonderen Teil der Geschichte stehen. Für das
Publikum öffnet die Ausstellung um 14.00 Uhr.
Die Veranstaltung zur Eröffnung startet um 11
Uhr.
Innenstadtumgestaltung:
Stadt Kleve lädt zur Bürgerbeteiligung ein!
Bis zur Landesgartenschau 2029 soll die Klever
Innenstadt aufgewertet werden und dauerhaft mit
mehr Aufenthaltsqualität punkten. Ein
spezialisiertes Büro für Wettbewerbsmanagement
bereitet hierfür derzeit gemeinsam mit der
Klever Stadtverwaltung einen Planungswettbewerb
vor. Im Rahmen des Wettbewerbs sollen kreative
und innovative Ideen präsentiert und per
Juryentscheid ein Büro für
Landschaftsarchitektur gefunden und beauftragt
werden, welches die Planungen für den
Innenstadtbereich übernimmt.
Hier geht es
direkt zur Online-Umfrage für erste Ideen zur
Umgestaltung der Klever Fußgängerzone:
https://beteiligung.nrw.de/portal/kleve/beteiligung/themen/1012821
Klever Fußgängerzone
Im Vorfeld des
Wettbewerbs ruft die Stadt Kleve nun alle
Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich aktiv an
der Umgestaltung der Klever Innenstadt zu
beteiligen. Bis zum 23. März 2025 haben
Interessierte die Möglichkeit, über eine
Online-Beteiligung ihre Ideen und Anregungen
einzubringen. Es besteht sowohl die Möglichkeit,
eigene Vorschläge für die Umgestaltung der
Innenstadt zu machen als auch Aspekte
mitzuteilen, auf die besonders geachtet werden
soll. Den Link zur Umfrage finden Interessierte
auf der Übersichtsseite
www.kleve.de/laga29.
In diesem
ersten Schritt der Bürgerbeteiligung geht es
zunächst darum, Anregungen für die grundlegende
Planungsaufgabe des Wettbewerbs zu sammeln. Auf
dieser Basis werden die Planungsbüros
anschließend ihre Entwürfe entwickeln. Im
Verlauf des Wettbewerbs werden weitere
Bürgerbeteiligungen folgen und die Detailtiefe
der Planung steigen.
Kleverinnen und
Klever werden also auch weiterhin die
Gelegenheit haben, Einfluss auf die Planungen
zur Landesgartenschau in unserer Stadt zu
nehmen. Bei der aktuellen Beteiligung geht es
außerdem rein um die Innenstadtflächen. Die
eigentlichen Ausstellungsflächen für die
Landesgartenschau entlang des Kermisdahls und
des Spoykanals werden in einem gesonderten
Verfahren behandelt, in das Bürgerinnen und
Bürger ebenfalls einbezogen werden.
Zudem
lädt die Stadt Kleve am Donnerstag, 20. März
2025 um 19.00 Uhr zu einer Präsenzveranstaltung
im Gebäude 2A der Hochschule Rhein-Waal,
van-den-Bergh-Straße 2, Seminarraum 127 ein.
Hier werden nicht nur weitere Ideen gesammelt,
sondern es wird auch das Verfahren des
anstehenden Planungswettbewerbs vorgestellt und
erläutert. Anschließend besteht die Möglichkeit,
in den direkten Austausch zu gehen.
Die
Stadt Kleve möchte die Bürgerinnen und Bürger
aktiv in den Gestaltungsprozess einbinden, um
eine Grundlage für die weitere Planung zu
schaffen, mit der sich die Kleverinnen und
Klever identifizieren können. „Nutzen Sie die
Chance, Ihre Ideen einzubringen – ob online oder
vor Ort. Die Ergebnisse der Beteiligung werden
Teil der anstehenden Planungsaufgabe werden“,
betont Bürgermeister Wolfgang Gebing, „Die Stadt
Kleve freut sich auf eine rege Beteiligung!“
Von
Steuertipps bis Absicherung gegen
Elementarschäden
Verband Wohneigentum e.V.
bietet kostenlose Online-Infotage an
Die richtige Absicherung gegen
Elementarschäden, Steuertipps für Wohneigentümer
und rechtliche Fragen bei Vermietung/Teilen von
Immobilien – das sind die Themen der nächsten
Online-Informationswoche des gemeinnützigen
Verbands Wohneigentum. Vom 17. bis zum 19. März
2025 informiert der Eigentümerverband jeweils ab
18 Uhr.
Information und Anmeldung:
https://www.verband-wohneigentum.de/bv/on245432
Die Termine:
Montag, 17. März, 18 Uhr
Steuerliche Fragen rund um das Wohneigentum
Ein praxisnaher Überblick, wie die eigene
steuerliche Situation optimiert werden kann.
Erläutert werden Abzugsfähigkeiten im
Zusammenhang mit privatem Eigentum sowie
steuerliche Besonderheiten bei Einkünften aus
Vermietung/Verpachtung. Wir klären, welche
Kosten Sie steuerlich geltend machen können.
Dienstag, 18. März, 18 Uhr
Vermietung und
geteilter Besitz – rechtliche Fragen (in
Kooperation mit der Grünen Liga e. V.)
Der
Vortrag befasst sich mit alternativen
Nutzungsmöglichkeiten für die eigene Immobilie
und klärt damit verbundene rechtliche Fragen. Es
geht um Einliegerwohnungen, die
genossenschaftliche Weiterentwicklung des
Eigenheims und unterschiedliche Rechtsformen für
kleine Wohnprojekte.
Mittwoch, 19. März,
18 Uhr
Elementarschäden - wie kann ich mein
Eigentum schützen?
Starkregen und Unwetter
machen vielen Hausbesitzer*innen Angst. Wie kann
das Wohneigentum vor drohenden Elementarschäden
geschützt werden? Ein Überblick über bauliche,
rechtliche und versicherungstechnische Aspekte.
50 Jahre Kreis Wesel: Förderschulen
übergeben selbstgetöpferte Schalen für
Bonsai-Kopfweiden
Im Rahmen des
Jubiläumsjahres zum 50jährigen Bestehen hat der
Kreis Wesel ein außergewöhnliches Geschenk für
besondere Anlässe in Auftrag gegeben: Die
Kopfweide – der Wappenbaum des Kreises Wesel und
nicht wegzudenkendes Element der
niederrheinischen Kulturlandschaft – als Bonsai.
Schülerinnen und Schüler der
kreiseigenen Förderschulen
Hilda-Heinemann-Schule (Moers), Bönninghardt
Schule Alpen und der Schule am Ring (Wesel)
haben im Rahmen ihres Kunst-Unterrichts 200
individuelle Schalen für diese Bonsais
getöpfert. Am Dienstag, 11. März 2025, wurden
sie Landrat Ingo Brohl übergeben.
Landrat Ingo Brohl: „Unser Jubiläumsjahr soll
die ganze Bandbreite und Vielfalt unseres
Niederrheinkreises und unserer Aufgaben als
Kreis widerspiegeln. Daher ist es großartig,
dass die Schülerinnen und Schüler unserer
kreiseigenen Förderschulen mit ihrem kreativen
Talent einen farbenfrohen und nachhaltigen
Beitrag zu unserem Jubiläumsjahr leisten. Sie
machen die ehedem schon besonderen Bonsai
Kopfweiden mit ihren selbstgetöpferten Schalen
zu einem sehr besonderen, sehr individuellem
Geschenk.“
Landrat Ingo Brohl dankte bei
der Übergabe den beteiligten Lehrerinnen und
Lehrern sowie den Schülerinnen und Schülern für
ihr Engagement. In die Schalen werden nun die
Bonsai Kopfweiden in einer Gärtnerei
eingepflanzt und sukzessive ab Sommer als
bleibendes und nachhaltiges Geschenk zum
Jubiläumsjahr eingesetzt.

Schülerinnen und Schüler übergeben die selbst
getöpferten Bonsai-Schalen an Landrat Ingo Brohl
Urban Gardening: Gemeinsam für grünere
Städte. Welche Vorteile hat das Gärtnern in der
Stadt?
Gärtnern in der Stadt ist beliebt: Bereits seit
über 20 Jahren zeigt sich in Deutschland ein
gestiegenes gesellschaftliches Interesse an der
Begrünung urbaner Räume. Viele Stadtbewohner
entdecken den neuen Lebensstil für sich und
möchten sich künftig selbst mit Obst und Gemüse
versorgen oder ihr Umfeld mit Pflanzen
aufwerten.
Gartenbauexperte Dr. Lutz Popp
vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und
Landespflege e. V. (BLGL) informiert über die
unterschiedlichen Formen und die Vorteile von
Urban Gardening sowie über Möglichkeiten zur
Beteiligung.

Stehen keine Bodenflächen zur Verfügung, etwa
weil sie versiegelt oder mit Schadstoffen
belastet sind, nutzen Initiativen gerne diverse
Gefäße zum Gärtnern. Quelle: BLGL
Bis vor
wenigen Jahrzehnten gehörte der Anbau von
Nutzpflanzen zum Alltag dazu. Auch in den
Städten bepflanzten die Menschen verfügbare
Flächen, um sich selbst mit Obst und Gemüse
versorgen zu können. Mit der Zeit kam der
Nutzgarten jedoch aus der Mode, bis er zu Beginn
des 21. Jahrhunderts eine Renaissance erlebte.
Besonders große Aufmerksamkeit erregt das
Gärtnern in der Stadt.
„Ob
gemeinschaftlich genutzter Kräutergarten,
bepflanzte Hausfassaden und -dächer oder
Balkonbegrünung – der Begriff Urban Gardening
schließt alle möglichen Formen des
Stadtgärtnerns mit ein“, informiert
Gartenbauexperte Dr. Lutz Popp vom Bayerischen
Landesverband für Gartenbau und Landespflege e.
V. Stehen keine Bodenflächen zur Verfügung, etwa
weil sie
versiegelt oder mit Schadstoffen belastet sind, nutzen
Initiativen gerne diverse Gefäße zum Gärtnern.
Infrage kommen beispielsweise ausgebaute
Maschinenteile, Lebensmittelverpackungen,
Foliensäcke, Kisten und Paletten.
Welche
Vorteile hat das Gärtnern in der Stadt?
Urban-Gardening-Projekte werten Städte auf
vielfache Weise auf: Pflanzen verbessern die
Luft, indem sie Kohlendioxid binden und
wertvollen Sauerstoff freisetzen. Darüber hinaus
haben sie einen kühlenden Effekt, weshalb
urbanes Gärtnern in Zeiten des Klimawandels eine
immer größere Rolle spielt.
Bürger
können Obst und Gemüse vor Ort ernten und ihre
Ausgaben für hochwertige Lebensmittel
reduzieren. Gleichzeitig entfallen Transportwege
für Lebensmittel, was den Energieverbrauch und
den CO₂-Ausstoß im Bereich Ernährung reduziert.
Durch die Verwertung von anfallendem
Grüngut-Kompost an Ort und Stelle lassen sich
enge Kreisläufe schaffen. Einwohner erhalten
Informationen über den Anbau von Pflanzen und
Probleme, die dabei auftreten können.
Auf diese Weise wächst das Verständnis für
Landwirte und Gärtner. Viele Projekte vermitteln
der Stadtbevölkerung Wissen über gesunde
Ernährung sowie frische und gesunde
Lebensmittel. „Brach- und Freiflächen in der
Stadt finden eine sinnvolle Nutzung – selbst,
wenn die Begrünung nur vorübergehend ist. Neben
der optischen Aufwertung der Flächen und der
Möglichkeit zur Selbstversorgung schaffen
Stadtgärten auch einen Ort der Begegnung“,
ergänzt Dr. Popp.
„Bottom up“: Private
Initiativen von Bürgern
Den Anstoß für
Urban-Gardening-Projekte gaben in der
Vergangenheit oft spontane
Guerilla-Gardening-Aktionen, bei denen
Aktivisten etwa mithilfe von Samenbomben öde
Straßenränder oder Baumscheiben in
Wildblumenbeete und Rabatten verwandelten, deren
Pflege die Anwohner anschließend häufig
übernahmen.
„Was Bürger unbedingt
wissen sollten: Eine solche Aufwertung
vernachlässigter Flächen in der Umgebung ist
eigentlich verboten“, betont der
Gartenbauexperte. Der Grundstückseigentümer kann
von den Aktivisten fordern, dass sie die
Pflanzen beseitigen, da es sich um eine
Sachbeschädigung handelt. Wenn Bürger bei
solchen Guerilla-Aktionen umsichtig vorgehen,
stoßen sie bei den Eigentümern – meist sind das
die Kommunen – jedoch eher auf positive
Resonanz. Wichtig ist beispielsweise, dass
Stadtgärtner nur heimische Pflanzen verwenden,
dass sie ausschließlich brachliegende Flächen
nutzen und dass die Pflanzen den Verkehr nicht
behindern.
Engagierte Bürger, die ihre
städtischen Begrünungsprojekte längerfristig
planen, wählen eine Rechtsform – meist einen
Verein. „Um auf der sicheren Seite zu sein,
empfiehlt es sich, Absprachen mit der
Stadtverwaltung zu treffen“, rät Dr. Popp.
Teilweise geben auch Privatpersonen und Firmen
geeignete Flächen für Urban-Gardening-Projekte
frei.
„Top down“: Kommunale Angebote zum
Mitgärtnern
Mittlerweile initiieren sogar
viele Kommunen selbst Angebote zum Mitgärtnern
für die Bevölkerung, indem sie geeignete Flächen
zur Verfügung stellen und aktiv dafür werben –
Urban Gardening funktioniert dann nach dem
Prinzip „top down“. Solche kommunalen Angebote
haben auch wirtschaftliche Vorteile: Wenn Bürger
beispielsweise Blühstreifen entlang der Gehwege
und Straßen vor ihrem Haus pflegen, entlasten
sie damit den Bauhof und helfen den Kommunen
beim Sparen.
Was sollten Interessierte
beachten?
Auch wenn die Motivation zu Beginn
hoch ist und viele Interessierte so schnell wie
möglich loslegen möchten, geht es nicht ohne
Vorbereitung. Denn um langfristig Freude am
neuen Hobby zu haben, sind gartenbauliche
Grundkenntnisse unverzichtbar.
„Nur so
können sich engagierte 'Stadtgärtner' dauerhaft
über kräftig wachsende Pflanzen, prächtige
Blüten und üppige Ernten freuen. Fachliche
Unterstützung erhalten Interessierte
beispielsweise bei den Gartenbauvereinen vor
Ort“, informiert Dr. Popp vom BLGL. Der
Tatendrang motivierter Bürger, ergänzt durch das
Wissen erfahrener Vereinsmitglieder, ist die
beste Voraussetzung für die Durchführung
ambitionierter Urban-Gardening-Projekte.
„Bei jeder 28. Koloskopie wird
ein Darmkrebs verhindert.“
Bethanien Moers
nutzt „Künstliche Intelligenz“ bei
Darmspiegelungen
Der März ist Darmkrebsmonat. Grund genug für das
Krankenhaus Bethanien Moers auf die Wichtigkeit
einer regelmäßigen Darmkrebsvorsorge
hinzuweisen. „Bei jeder 28. Koloskopie wird ein
Darmkrebs verhindert“, so Prof. Dr. Ralf Kubitz,
Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie &
Onkologie des Krankenhauses Bethanien Moers.
Seit Beginn des Jahres führt das Moerser
Krankenhaus als eines der ersten Krankenhäuser
in der Region Koloskopien (Darmspiegelungen)
unter Zuhilfenahme von Künstlicher Intelligenz
(KI) durch. „Wir können so noch schneller,
präziser und mit einer noch höheren
Zuverlässigkeit arbeiten“, erklärt der erfahrene
Gastroenterologe.
Wie wichtig das
ist, belegen die aktuell verfügbaren Zahlen des
RKIs. Darmkrebs ist bei Männern die
dritthäufigste (11,7 %) und bei Frauen die
zweithäufigste Krebsart (10,5 %). Jährlich
erkranken allein in Deutschland etwa 55.000
Menschen neu an Darmkrebs. Rund 24.000 sterben
pro Jahr an den Folgen der Erkrankung. Dabei
zählt Darmkrebs zu den am besten erforschten
Krebsarten.
90 % der
Darmkrebserkrankungen entwickeln sich aus
zunächst gutartigen Darmpolypen (Adenom), die
Entartung zum Krebs (Karzinom) dauert rund zehn
Jahre. Bei keiner anderen Krebsart bietet die
Früherkennung derart große Chancen, die
Krebsentwicklung zu verhindern, wie bei
Darmkrebs. Eine Darmkrebsvorsorge wird ab dem
50. Lebensjahr empfohlen. Frauen sollten eine
Koloskopie ab dem 55. und Männer ab dem 50.
Lebensjahr durchführen lassen, die Kosten werden
von der Krankenkasse übernommen.
Einsatz neuer Technologie
„Bei der Koloskopie
wird die KI, die im Grunde nichts anderes als
ein Prozessor ist, der an unser System
angeschlossen wird, beim Absuchen der
Schleimhaut eingeschaltet. Auf dem
Bildschirm werden dann die Stellen, die
potenzielle Polypen sein könnten, angezeigt,
indem sie mit grünen Quadraten umrandet werden.
Wenn sich nach eingehender Untersuchung
herausstellt, dass es sich hierbei tatsächlich
um Polypen handelt, werden diese direkt
abgetragen“, beschreibt Prof. Dr. Kubitz die
Vorgehensweise.
Wann können Patient:innen
zur Koloskopie ins Krankenhaus Bethanien kommen?
Zum einen ist das bei sogenannten
Indikations-Koloskopien der Fall. Hier liegen
etwa konkrete Symptome, wie Blutbeimengungen im
Stuhl, Verstopfungen oder Durchfallerkrankungen
vor, die auf einen Darmkrebs hinweisen könnten.
„Des Weiteren sind Patientinnen und
Patienten bei uns richtig, wenn ein
niedergelassener Kollege bzw. eine
niedergelassene Kollegin zuvor einen Polypen
gefunden hat, der nicht ambulant entfernt werden
konnte“, klärt Prof. Dr. Kubitz auf. „Da für
Patientinnen und Patienten mit einer privaten
Krankenversicherung etwas andere Regeln gelten,
dürfen wir dieser Patientengruppe Koloskopien
ebenfalls im Rahmen einer Darmkrebsvorsorge
anbieten.“
Hohe Qualität seit Jahren
„Zur Qualitätssicherung wird von Kostenträgern
verlangt, dass bei mindestens 25 % der
Koloskopien Polypen gefunden werden müssen. Wir
hatten schon immer eine sehr hohe sogenannte
Detektionsrate, sie liegt bei uns bei über 40 %.
Damit sind wir weit über dem geforderten Maß.“
Ein weiteres Qualitätsmerkmal sei die
prozentuale Anzahl der „vollständigen
Koloskopien“ pro Jahr.
„Man muss im
Rahmen von Zertifizierungen, zum Beispiel bei
der Zertifizierung unseres Darmzentrums, eine
bestimmte Menge erfüllen. Bei uns liegt diese
seit Jahren konstant bei 99 %“, betont der
Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie &
Onkologie, der mit seinem Team und weiteren
Kooperationspartner:innen 2021 den Felix Burda
Award in der Kategorie „Engagement des Jahres“
erhielt.
Der Felix Burda Award wird
an innovative, nachhaltige und beispielgebende
Engagements auf dem Gebiet der Darmkrebsvorsorge
verliehen. Mit der Darmkrebskampagne „Darmgesund
in Moers“ konnte das Krankenhaus Bethanien Moers
in Kooperation mit dem St. Josef Krankenhaus aus
Moers und der Facharztpraxis Purrmann (heute
gastromed-niederrhein Ihr Gesundheitszentrum –
Praxis für Innere Medizin/Gastroenterologie Dr.
Du Le Quach), der Selbsthilfegruppe ILCO und der
Krebsgesellschaft NRW im Jahr 2019 mehr als
1.100 Menschen zusätzlich dazu bewegen, sich bei
einer Darmspiegelung untersuchen zu lassen.
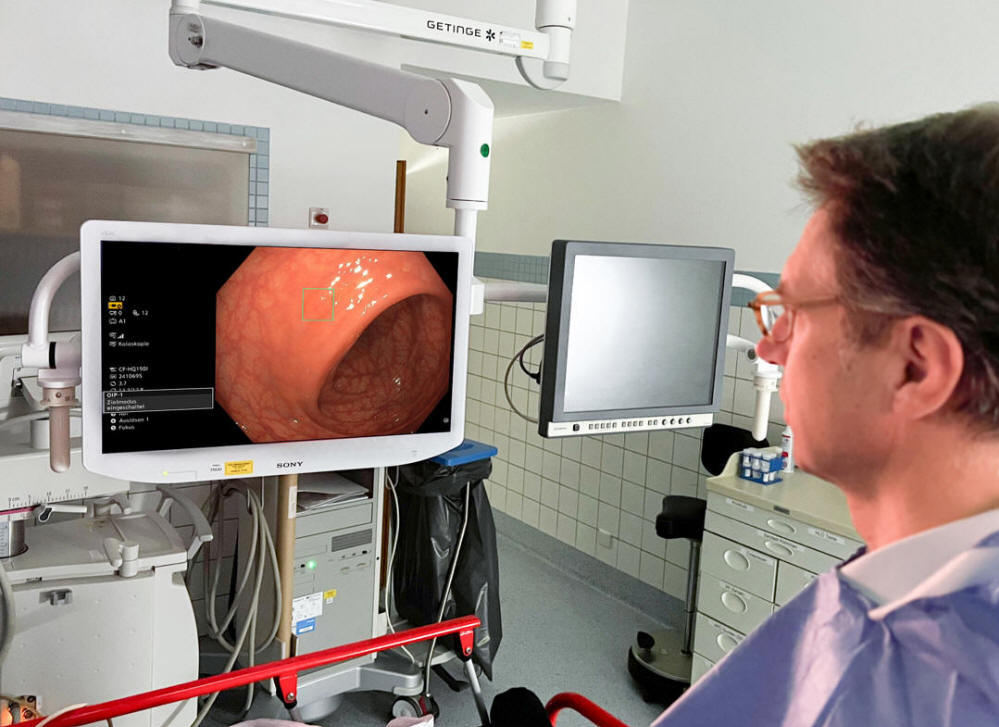
Die im Krankenhaus Bethanien Moers bei
Koloskopien eingesetzte KI erkennt potenzielle
Polypen und markiert sie mit grünen Quadraten.

Stromerzeugung 2024: 59,4 % aus erneuerbaren
Energieträgern
• Insgesamt 3,6 % weniger Strom ins Netz
eingespeist als im Vorjahr
• Stromerzeugung
aus Photovoltaik steigt um 10,4 % auf neuen
Höchstwert
• Kohle nach Windkraft weiterhin
zweitwichtigster Energieträger,
Einspeisung
von Kohlestrom sinkt aber um 16,0 % im Vergleich
zum Vorjahr
• 17,9 % mehr Strom nach
Deutschland importiert als im Vorjahr,
Importüberschuss fast verdreifacht
Im
Jahr 2024 wurden in Deutschland 431,5 Milliarden
Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Netz
eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen
mitteilt, waren das 3,6 % weniger Strom als im
Jahr 2023. Gründe für den Rückgang waren
insbesondere ein geringerer Strombedarf infolge
des Produktionsrückgangs im Produzierenden
Gewerbe sowie der vermehrte Import von Strom aus
dem Ausland.
Mit einem Anteil von 59,4 %
stammte der im Jahr 2024 inländisch erzeugte und
ins Netz eingespeiste Strom mehrheitlich aus
erneuerbaren Energiequellen. Insgesamt stieg die
Stromerzeugung aus diesen Quellen gegenüber dem
Vorjahr um 2,3 % auf 256,4 Milliarden
Kilowattstunden und erreichte damit einen neuen
Höchstwert. 2023 hatte der Anteil des Stroms aus
erneuerbaren Quellen noch bei 56,0 % gelegen.
Demgegenüber sank die Stromerzeugung aus
konventionellen Energieträgern 2024 im
Vorjahresvergleich um 11,0 % auf 175,1
Milliarden Kilowattstunden und einen Anteil von
40,6 % des inländisch erzeugten Stroms.
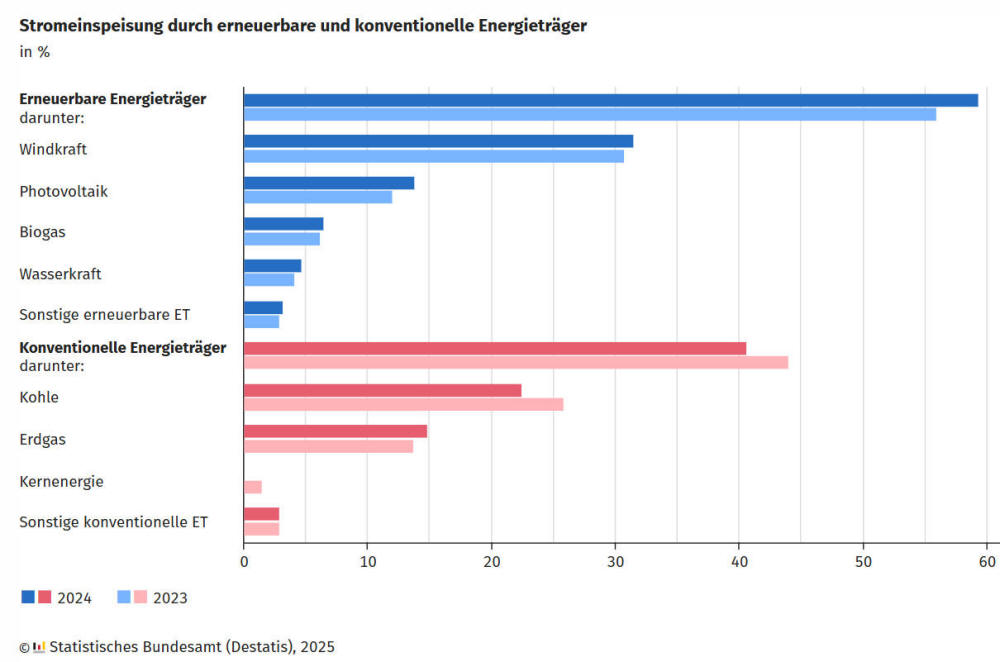
Erneuerbare Energien: Einspeisung aus
Photovoltaik steigt auf neues Rekordhoch
Die erzeugte Menge von Strom aus Windkraft sank
2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 1,4 %
auf 136,0 Milliarden Kilowattstunden. Trotzdem
stieg der Anteil der Windkraft an der
Stromerzeugung von 30,8 % im Jahr 2023 auf
31,5 % im Jahr 2024. Damit blieb die Windkraft
die wichtigste Energiequelle in der inländischen
Stromerzeugung.
Die
Stromeinspeisung aus Photovoltaik stieg 2024
gegenüber dem Vorjahr deutlich um 10,4 % auf
59,5 Milliarden Kilowattstunden. Dies entsprach
13,8 % der gesamten inländischen Stromproduktion
und war der höchste Anteil an Strom aus
Photovoltaik für ein Gesamtjahr seit Beginn der
Erhebung im Jahr 2018.
Auch die
Stromeinspeisung aus Wasserkraft stieg 2024
deutlich um 10,3 % auf 20,4 Milliarden
Kilowattstunden und kam damit auf einen Anteil
von 4,7 % der gesamten Stromerzeugung.
Konventionelle Energieträger: Deutlich weniger
Strom aus Kohle, deutlich mehr aus Erdgas Die
Bedeutung der Kohle für die inländische
Stromerzeugung nahm 2024 weiter ab: Mit 97,2
Milliarden Kilowattstunden wurden 16,0 % weniger
Strom aus Kohle ins Netz eingespeist als im
Vorjahr.
Der Anteil des Kohlestroms
an der gesamten inländischen Stromproduktion des
Jahres 2024 sank auf 22,5 % und erreichte damit
einen neuen Tiefststand für ein Gesamtjahr. 2023
hatte der Anteil noch bei 25,9 % gelegen.
Demgegenüber stieg die Stromeinspeisung aus
Erdgas 2024 gegenüber dem Vorjahr um 4,6 % auf
64,1 Milliarden Kilowattstunden und einen Anteil
von 14,9 % der gesamten Stromproduktion.
Damit war der Anteil von Erdgas an der
Stromproduktion 2024 so hoch wie in keinem
anderen Jahr seit Beginn der Erhebung im Jahr
2018. 2022 war der Anteil von Erdgas an der
Stromerzeugung infolge des russischen Angriffs
auf die Ukraine und der angespannten Situation
auf dem Gasmarkt auf 11,5 % gefallen. 2023 war
der Anteil von Strom aus Erdgas dann bereits auf
13,7 % gestiegen.
Nach der Abschaltung
der letzten deutschen Kernkraftwerke am
15. April 2023 gab es im Jahr 2024 keine
Stromeinspeisung aus inländisch erzeugter
Kernenergie mehr. Bereits 2023 hatte Strom aus
Kernkraft nur noch 1,5 % des eingespeisten
Stroms ausgemacht.
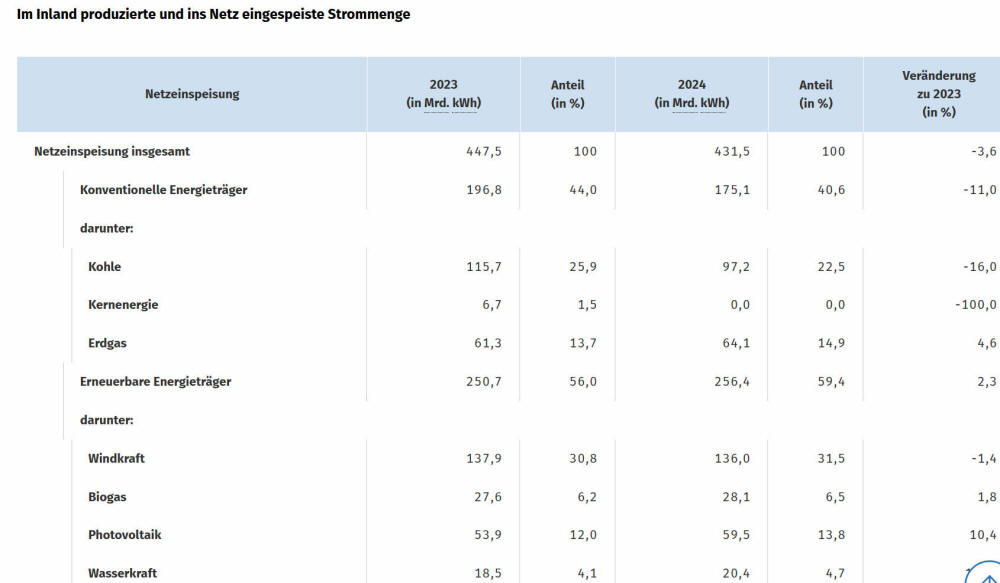
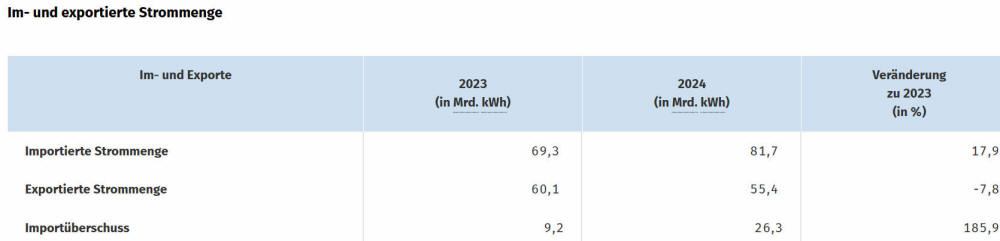
Importüberschuss 2024 im Vergleich zum
Vorjahr beinahe verdreifacht
Die nach
Deutschland importierte Strommenge stieg im Jahr
2024 im Vergleich zu 2023 um 17,9 % auf 81,7
Milliarden Kilowattstunden (2023: 69,3
Milliarden Kilowattstunden). Demgegenüber
verringerte sich die aus Deutschland exportierte
Strommenge um 7,8 % auf 55,4 Milliarden
Kilowattstunden.
Damit hat
Deutschland im zweiten Jahr in Folge mehr Strom
importiert als exportiert. Der Importüberschuss
verdreifachte sich dabei nahezu von
9,2 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2023 auf
26,3 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2024.
Energiemix im Zeitverlauf: Fast ein Viertel mehr
Strom aus erneuerbaren Quellen seit 2018.
Im langfristigen Trend ist ein deutlicher
Wandel in der inländischen Stromerzeugung
erkennbar: Während bis 2022 konventionelle
Energieträger dominierten, wurde seit 2023 mehr
Strom durch erneuerbare Energien erzeugt. Im
Jahr 2024 wurde fast in allen Monaten mehr Strom
aus erneuerbaren als aus konventionellen
Energieträgern eingespeist.
Im Jahr
2018, dem ersten Jahr der Erhebung, waren mit
207,5 Milliarden Kilowattstunden noch fast ein
Viertel weniger Strom aus erneuerbaren Energien
erzeugt und ins Netz eingespeist worden als
2024. Parallel dazu nahm die Stromerzeugung aus
konventionellen Energiequellen zwischen 2018 und
2024 deutlich ab.
Während 2018 noch
355,8 Milliarden Kilowattstunden aus fossilen
Quellen eingespeist worden waren, halbierte sich
dieser Wert auf 175,1 Milliarden Kilowattstunden
im Jahr 2024.
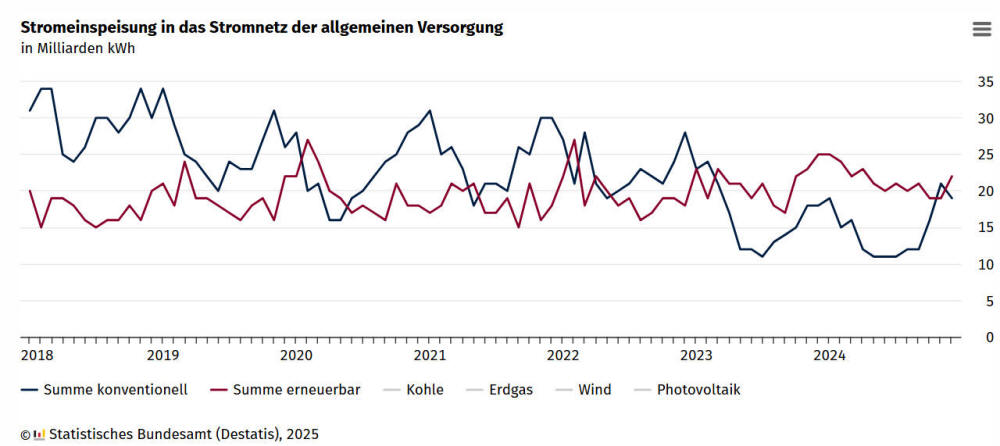
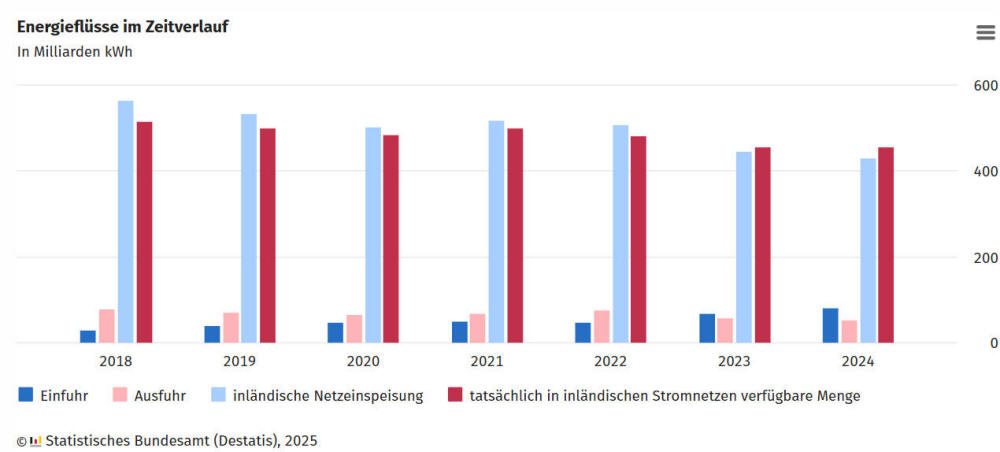
Energieflüsse im Zeitverlauf:
Stromproduktion im Inland gesunken, Importe
gestiegen Seit 2018 ist ein deutlicher Rückgang
der inländischen Stromeinspeisung zu
verzeichnen. Während die Netzeinspeisung 2018
noch bei 566,8 Milliarden Kilowattstunden
gelegen hatte, sank sie bis 2024 um 23,9 % auf
431,5 Milliarden Kilowattstunden.
Bis 2022 bestand ein Exportüberschuss, da die
ins Netz eingespeiste Strommenge die Menge des
im Inland verbrauchten Stroms überstieg. Diese
Entwicklung kehrte sich jedoch im Jahr 2023 um,
seitdem übertrifft der Import von Strom den
Export. Die Summe aus der inländischen
Stromeinspeisung und der Stromimporte abzüglich
der Stromexporte ergibt die tatsächlich in den
inländischen Stromnetzen verfügbare Strommenge.
Diese sank von 518,0 Milliarden Kilowattstunden
im Jahr 2018 auf 457,8 Milliarden
Kilowattstunden im Jahr 2024, das entspricht
einem Rückgang von 11,6 %.
Donnerstag, 13. März
2025
Kleve: Landesweiter Warntag am
Donnerstag, 13. März 2025
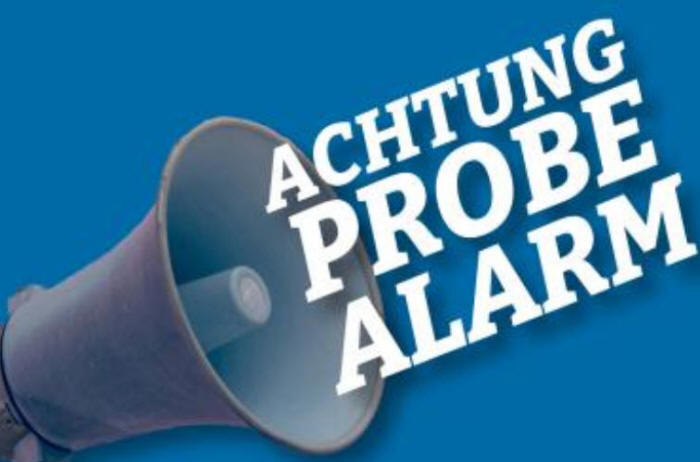
Die Kreis-Leitstelle Kleve aktiviert die Sirenen
im Kreis Kleve. Das Land NRW löst die Warn-App
NINA und den Handy-Alarm „Cell Broadcast“ aus.
Kreis Kleve – Der „landesweite Warntag“
findet in diesem Jahr am Donnerstag, 13. März
2025, statt. Dabei lösen um 11 Uhr die
zuständigen Leitstellen in ganz
Nordrhein-Westfalen – also auch im Kreis Kleve –
die vorhandenen digitalen Sirenen aus.
Der Probealarm setzt sich aus der folgenden
Kombination von Sirenentönen zusammen:
„Entwarnung – Warnung – Entwarnung“.
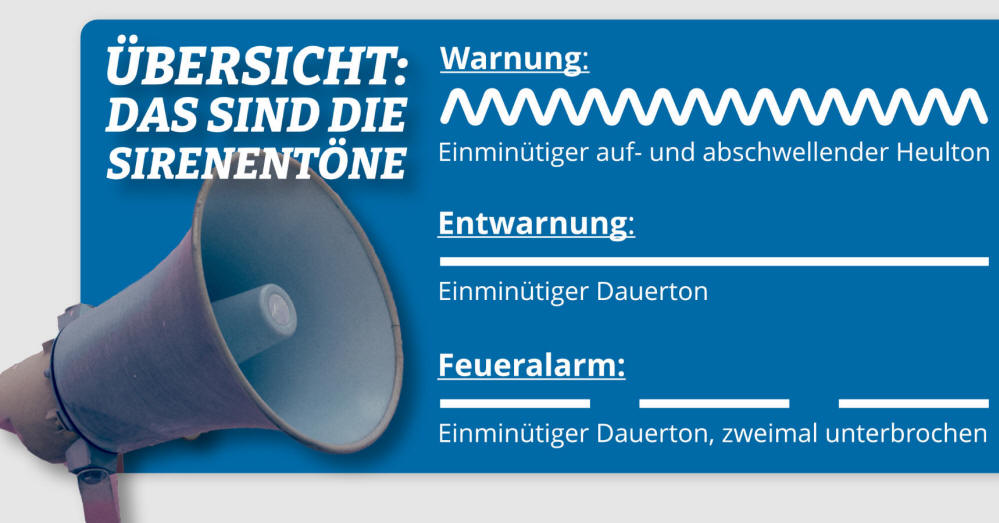
Die Entwarnung erfolgt dabei durch einen
einminütigen Dauerton und die Warnung durch
einen einminütigen Heulton, der auf- und
abschwillt. Zum Abschluss ist erneut ein
einminütiger Entwarnungs-Dauerton zu hören. Die
Signale werden in einem Abstand von fünf Minuten
ausgelöst. Ziel des Warntages ist es, die
Infrastruktur zu testen und zugleich das Thema
Warnung wiederholt in den Fokus der öffentlichen
Wahrnehmung zu rücken.
Übersicht der
Sirenentöne. Grafik: Stadt Kleve. Zum Vergrößern
auf die Grafik klicken.
In allen 16
Kommunen im Kreis Kleve sind Sirenen
installiert. Die akustische Wahrnehmbarkeit der
digitalen Sirenen kann durch die Windrichtung
beeinflusst werden. Unter Umständen sind die
Signaltöne daher nicht in allen Ortsteilen zu
hören.
Für eine umfassende Warnung der
Bevölkerung werden mehrere Warnmittel zeitgleich
eingesetzt. Auch diese werden am Warntag
getestet. Ebenfalls um 11 Uhr wird seitens des
Landes Nordrhein-Westfalen die „Warn-App NINA“
ausgelöst. NINA warnt deutschlandweit oder
standortbezogen vor Gefahren wie Hochwasser,
Gefahrstoffausbreitung, Großbrand oder vor
anderen so genannten Großeinsatzlagen. Die
NINA-App steht kostenlos in den bekannten
App-Stores zum Download zur Verfügung.
Den „Warnmix“ ergänzen darüber hinaus Warnungen
über „Cell Broadcast“. Dies ist ein
Mobilfunkdienst, mit dem Nachrichten – auch ohne
Installation einer App – unmittelbar auf das
Handy oder Smartphone geschickt werden. Bevor
die Warnmeldungen empfangen werden können, ist
es unter Umständen notwendig, zuerst die
entsprechenden Einstellungen des eigenen Handys
zu aktualisieren.
Auf der Internetseite
des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
www.bbk.bund.de sind unter dem Stichwort „Cell
Broadcast“ Anleitungen für verschiedene
Handymodelle verfügbar. Dort befinden sich auch
weitere Informationen rund um das Thema „Cell
Broadcast“.
Im Lokalradio Antenne
Niederrhein wird in den Nachrichten um 11 Uhr
auf den Warntag hingewiesen. Zudem wird der
Sender das laufende Programm unterbrechen, um
das Live-Einsprechen aktueller Gefahrenwarnungen
zu testen.
Auf den Internetseiten des
Kreises Kleve, www.kreis-kleve.de, gibt es unter
den Suchbegriffen „Sirenenton“ oder „NINA“
weitere Informationen.
150
Wohnungen auf Areal einer alten Gärtnerei in
Weeze
Die Unternehmensgruppe Conx
will auf dem 1,6 ha großen Areal der Gärtnerei
Jentjens an der Gocher Straße 83 in Weeze 110
Wohnungen zwischen 60 und 120 m² Größe bauen.
Gedacht ist an ein Mix aus teilweise geförderten
Miet- und Eigentumswohnungen. Das Konzept sieht
drei Baufelder mit maximal
zweieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhäusern vor,
die durch einen Hofcharakter Gemeinschaft und
Nachbarschaft fördern sollen.
Der
Entwurf stammt vom Architekturbüro JKL aus
Osnabrück. Das Bebauungsplanverfahren für das
"Graf´sche Höfe" genannte Projekt läuft bereits.
Der Abbruch der Gärtnerei ist für Herbst 2025
vorgesehen, der Baubeginn soll Mitte 2026
erfolgen. Aufgrund zweier geplanter
Industrieansiedelungen erwartet Weeze in den
kommenden Jahren einen deutlichen
Bevölkerungszuwachs. TD
Moers:
Suche nach dem mittelalterlichen Neutor am
Pumpeneck
Enni verbindet archäologische
Arbeiten in der Neustraße mit der Reparatur
eines Kanalbruchs
Ende April
startet in Moers die Sanierung der Altstadt. In
der Fußgängerzone wird die ENNI Stadt & Service
Niederrhein (Enni) hierzu bereits in der
kommenden Woche archäologische Vorarbeiten
begleiten. Da die Archäologen in der Neustraße
in Höhe der Hausnummern 31 a und 34 Reste der
mittelalterlichen Toranlage des Neutors
vermuten, beginnen hier ab Montag, 17. März,
archäologisch begleitete Suchschachtungen.
Sollten sich keine größeren Funde
ergeben, werden die Arbeiten binnen weniger Tage
abgeschlossen sein. Enni verbindet diese
Baumaßnahmen gleichzeitig mit der Reparatur
eines Kanalbruchs im nur wenige Meter entfernten
Bereich der Neustraße 21. Da hier die
grundsätzliche Kanalsanierung noch mindestens
ein Jahr dauern wird und hier bereits die
Oberfläche der Straße vor dem
Kinderbekleidungsgeschäft Mundomio abgesackt
ist, werden die Monteure ab dem kommenden Montag
das in rund zwei Metern Tiefe liegende defekte
Kanalstück mit einem Saugbagger freilegen und
anschließend reparieren.
Nur der
direkte Baustellenbereich wird hierbei
abgesperrt. Fußgänger können ihn jederzeit
passieren und Kunden die Geschäfte erreichen.
Auch der Lieferverkehr wird während der
Bauarbeiten möglich sein. Läuft alles nach Plan,
wird Enni die Arbeiten in der Neustraße noch in
der kommenden Woche abschließen. Auch bei
umfangreicheren archäologischen Maßnahmen
sichert Enni zu, den ersten Trödelmarkt des
Jahres am 23. März nicht zu behindern.
„Dieses beliebte Frühjahrsevent kann in jedem
Fall uneingeschränkt stattfinden“, verspricht
der Enni-Projektleiter Knut Wiesten hierfür
Vorkehrungen zu treffen. Fragen beantwortet Enni
unter der Rufnummer 104-600.
Wesel: Neue Parkscheinautomaten auf dem
Parkdeck Martini
Ab Dienstag, 11.
März 2025, wird das Bezahlsystem auf dem
Parkdeck Martini umgestellt. Bisher wurde das
Parkdeck mit Parkscheinen bewirtschaftet, die
man an der Einfahrtsschranke zog, am
Kassenautomaten bezahlte und damit die
Ausfahrtsschranke öffnete. Da es dabei jedoch
immer wieder zu technischen Problemen kam, wird
nun auf dem Parkdeck ein neuer Parkscheinautomat
aufgestellt.

Das Prinzip des neuen Automaten gleicht den
Geräten in der Innenstadt: Nutzer*innen können
mit Bargeld einen Parkschein lösen und diesen
gut sichtbar in ihr Fahrzeug legen. Auch die
Nutzung einer App ist möglich. Schranken gibt es
nicht mehr. Die Einhaltung der Zahlungspflicht
wird von Politessen kontrolliert.
Auch preislich ändert sich etwas: Der Preis für
das Tagesticket wird auf drei Euro angehoben. Im
Gegensatz zu anderen bewirtschafteten
öffentlichen Parkplätzen gilt das Ticket aber
den ganzen Tag. Das Mitnehmen des Tickets auf
andere Parkplätze funktioniert daher nicht. Für
die Besucher*innen des Städtischen Bühnenhauses
ändert sich nichts: Sie können weiterhin
kostenlos parken.
Wesel:
Wartungsarbeiten beim Rechenzentrum - Einige
Online-Dienste zeitweise nicht verfügbar
Am kommenden Sonntag, 16. März 2025, stehen
einige Online-Dienste des Kreises Wesel
zeitweise nicht zur Verfügung. Das Kommunale
Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) führt
routinemäßige Wartungsarbeiten an seinen Servern
durch. Ab Montag, 17. März 2025, stehen alle
Online-Services wie gewohnt zur Verfügung.
Heimat Lohberg: kurzzeitig wegen
Elektroarbeiten geschlossen
Das
Stadtteilbüro „Heimat Lohberg“ ist wegen
kurzfristiger Elektroarbeiten derzeit
geschlossen. Voraussichtlich wird es kommende
Woche (Woche ab dem 17. März 2025) wieder zu den
gewohnten Zeiten öffnen.
Die regulären
wöchentlichen Öffnungszeiten sind: Montag:
14-18 Uhr Mittwoch: 9-12 Uhr Donnerstag: 9-16
Uhr Freitag: 9-12 und 13-16 Uhr. Das
Stadtteilbüro ist auch per E-Mail an heimat.lohberg@dinslaken.de erreichbar.
Moers: Osterfeuer bis 11.
April anzeigen
Ab sofort ist die
Anzeige von Osterfeuern beim Fachdienst Ordnung
der Stadt Moers möglich. Bis spätestens 11.
April muss das Onlineformular übermittelt
werden. Erlaubt sind nur Osterfeuer, die der
Brauchtumspflege dienen. Dazu zählen
ausschließlich Veranstaltungen von eingetragenen
Vereinen, Organisationen und
Glaubensgemeinschaften.
Der
Fachdienst Ordnung führt vor Ort
stichprobenartig Kontrollen durch. Verstöße
können mit einer Geldbuße geahndet werden.
Tierschutz beachten Die Stadt Moers bittet
darum, besonders den Tierschutz zu
berücksichtigen. Vor dem Anzünden muss das Holz
umgeschichtet werden, um Vögel, Igel, Mäuse und
Kaninchen zu vertreiben. Den Verbrennungsplatz
müssen außerdem volljährige Aufsichtspersonen
bis zum vollständigen Erlöschen von Feuer und
Glut beaufsichtigen.
Erlaubt ist nur
unbehandeltes, naturbelassenes Holz (Baum- und
Strauchschnitt). Zudem ist ein Abstand von
mindestens 100 Metern zu Wohngebäuden sowie
Wald- und Naturschutzgebieten einzuhalten. Das
Onlineformular ist hier abrufbar.
Dort sind auch weitere Informationen zum Thema
zu finden. Fragen beantworten auch gerne die
Mitarbeitenden des Fachdienstes Ordnung unter
Telefon 0 28 41 / 201-985.
Chatbot der Stadt Kleve: Künstliche Intelligenz
hilft beim digitalen Behördengang
Internetseiten von Behörden bieten die
verschiedensten Informationen zu vielen
Bereichen des täglichen Lebens. Mitunter
erschwert die hohe Informationsdichte jedoch das
schnelle Auffinden von benötigten Auskünften.
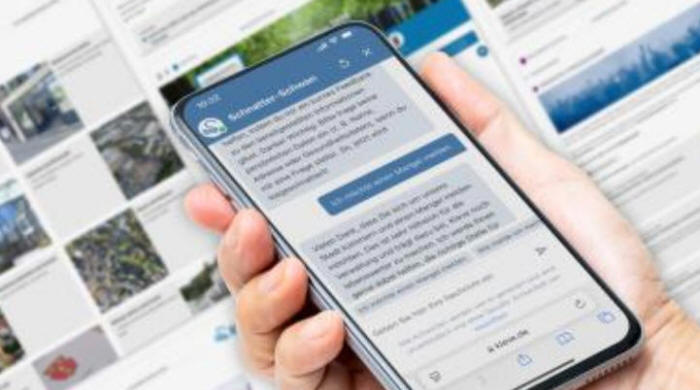
Egal ob am PC oder am Smartphone: Ab sofort
hilft der neue Chatbot beim Navigieren der
städtischen Website und beim Auffinden von
Informationen.
Auf der Internetseite
der Stadt Kleve hilft hierbei künftig die
künstliche Intelligenz. Ab sofort steht allen
Besucherinnen und Besuchern der Internetseite
der Stadt Kleve, www.kleve.de, ein persönlicher
digitaler Assistent zur Seite. Dem neuen Chatbot
der Stadt Kleve können beliebige Fragen rund um
die Dienstleistungen der Stadt Kleve gestellt
werden. Mithilfe von künstlicher Intelligenz
stellt das Programm daraufhin zügig die
Informationen der städtischen Internetseite
zusammen und gibt sie gebündelt aus.
Neben den reinen Informationen erhalten
Bürgerinnen und Bürger auch einen Link auf deren
Quelle. Das Programm ist auf jeder Unterseite
der städtischen Website in der unteren rechten
Bildschirmecke eingebunden. Das neue System
erleichtert gleichzeitig den niederschwelligen
Zugang zu den Dienstleistungen der Stadt Kleve
in Fremdsprachen.
Fragen können in
über 50 Sprachen an den Chatbot herangetragen
werden, die Antworten werden jeweils automatisch
an die Sprache der Anfrage angepasst. Auf diese
Weise kann eine Vielzahl von Fragen rund um die
Stadt Kleve und die Dienstleistungen der
Stadtverwaltung bequem und datenschutzkonform
beantwortet werden. Im Hintergrund werden
lediglich anonymisierte Informationen über die
Anfragethemen gespeichert. Es werden keine
echten Chatverläufe gesichert und auch keine
personenbezogenen Daten erhoben.
Im
Vorfeld jeder Anfrage weist das Programm darauf
hin, auch selbst keine personenbezogenen Daten
einzutragen. Für die Umsetzung des Chatbots
arbeitet die Stadt Kleve mit einer darauf
spezialisierten Firma aus Bremerhaven zusammen.
Aktuell befindet sich der Chatbot noch in der
Anlernphase. Nicht jede Antwort wird daher auf
Anhieb perfekt sein und alle gewünschten
Informationen liefern, mitunter können sich noch
kleinere Fehler einschleichen.
Mit
jeder bearbeiteten Anfrage lernt die künstliche
Intelligenz im Hintergrund jedoch dazu und
optimiert sich eigenständig. Zudem steht die
Stadt Kleve weiterhin in Kontakt zur
Herstellerfirma, um den digitalen Assistenten
stetig weiterzuentwickeln. Insbesondere in der
aktuellen Phase freut sich die Stadt Kleve daher
über Feedback zu den Antworten des Programms.
Jede Antwort kann dafür direkt im
Chatbot bewertet werden. Durch die Einführung
des Chatbots werden die übrigen Kanäle zur
Kontaktaufnahme mit der Stadt Kleve ergänzt.
Bürgerinnen und Bürger können sich
selbstverständlich nach wie vor auch
telefonisch, per E-Mail oder persönlich bei der
Stadtverwaltung Kleve melden.
Moers: Pianistinnen präsentieren am Sonntag
Ravel und Brahms
Ein
traumwandlerisches Zusammenspiel können die
Gäste eines Konzerts am Sonntag, 16. März, um 18
Uhr im Kammermusiksaal des Martinstifts (Filder
Straße 126) erleben.

Mona und Rica Bard (v.r.) präsentieren am
Sonntag, 16. März, um 18 Uhr im Kammermusiksaal
Ravels Rapsodie Espagnole und Brahms‘ Walzer.
(Foto: Uwe Arens)
Die Schwestern und
Pianistinnen Mona und Rica Bard präsentieren
unter anderem Ravels Rapsodie Espagnole und
Brahms‘ Walzer. Es ist eine Veranstaltung im
Rahmen der Städtischen Konzertreihe. Bereits um
17.15 Uhr findet eine Konzerteinführung statt.
Bis 18 Jahre ist der Eintritt frei
(Die Musikschule bittet um Reservierung).
Erwachsene zahlen im Vorverkauf 17 Euro. Die
Karten sind in der Stadt- und Touristinformation
von Moers Marketing, Kirchstraße 27 a/b, Telefon
0 28 41 / 88 22 60 (zuzüglich 8 Prozent
Vorverkaufsgebühren) bis einschließlich Samstag
und bei der Musikschule, Filder Straße 126,
Telefon 0 28 41 / 13 33 bis Freitag erhältlich.
Restkarten gibt es an der Abendkasse.
vhs Moers – Kamp-Lintfort:
Positionen der Naturethik für das 21.
Jahrhundert
Einen Philosophiekurs
über die Positionen der Naturethik für das 21.
Jahrhundert bietet die vhs Moers – Kamp-Lintfort
ab Dienstag, 18. März, an. Unter dem Motto
‚Macht euch die Erde untertan?‘ wird anhand
verschiedener Texte die Verantwortung gegenüber
Menschen, Tieren und Pflanzen diskutiert.
Der Kurs findet insgesamt sechsmal
jeweils dienstags ab 19 Uhr in der vhs Moers an
der Wilhelm-Schroeder-Straße 10 statt.
Anmeldungen sind telefonisch unter 0 28 41/201 –
565 sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.
Branchenanalyse:
Backwarenbranche kämpft mit Herausforderungen,
Fachkräftemangel und hoher Arbeitsbelastung,
zuletzt positiver Trend bei Azubis
Die Backwarenbranche in Deutschland steckt im
Strukturwandel. Der trifft in besonderer Weise
das Bäckereihandwerk. Während dieses seit Jahren
schrumpft, expandiert die Brotindustrie.
Insgesamt hat die traditionsreiche Branche mit
Herausforderungen zu kämpfen, aber es gibt auch
positive Anzeichen. Das zeigen erste Ergebnisse
des neuen „Bäckerei-Monitors“. Dabei handelt es
sich um eine umfassende Branchenanalyse und
Beschäftigtenbefragung, die die
Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit der
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)
fördert.* Vorgestellt werden die Befunde heute
auf einer Pressekonferenz der NGG in Berlin
(Link zu weiteren Materialien und Zitaten zur PK
unten).
Während der Gesamtumsatz der
Backwarenbranche mit ihren 282000 Beschäftigten
infolge einer zunehmenden Dominanz von
Großfilialisten und Brotindustrie auf 21,8
Milliarden Euro im Jahr 2023 gestiegen ist, hat
die Zahl der Betriebe des Bäckereihandwerks
allein in den letzten zehn Jahren um 30 Prozent
abgenommen. Seit 2014 sind 20000 Arbeitsplätze
verlorengegangen.
Gleichzeitig stieg der
Anteil an Teilzeitkräften unter den
sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in der
Branche von 30 auf 39 Prozent. Seit 2022
stabilisiert sich der Markt: Die Zahl der
Beschäftigten hat – parallel zur sich erholenden
Geschäftsentwicklung vieler Betriebe – bis 2024
insgesamt um 2000 Beschäftigte zugenommen.
Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen
Jobs ist seit 2022 jedoch weiter rückläufig
(-6500), das Wachstum ist allein auf eine
Zunahme von Minijobs zurückzuführen (+8500).
Diese Entwicklung sehen sowohl Christina
Schildmann, Leiterin der Forschungsförderung der
Hans-Böckler-Stiftung, als auch Studienautor Dr.
Stefan Stracke und die Gewerkschaft kritisch,
weil sie eine Verschiebung hin zu weniger
stabilen und tendenziell schlechter
abgesicherten Arbeitsverhältnissen zeigt.
Lichtblicke nach Abwärtstrend im
Bäckerhandwerk
Doch es gibt aktuell auch
Lichtblicke für den Handwerksberuf. Mehr junge
Menschen wollen wieder in Bäckereien arbeiten:
Bei den Bäcker*innen-Azubis gab es 2024 ein Plus
von 11,4 Prozent, bei den Fachverkäufer*innen im
Bäckerhandwerk sogar von 22,5 Prozent. In den
Jahren zuvor war die Zahl der Auszubildenden in
der Branche hingegen stetig rückläufig.
Beschäftigte beklagen hohe Arbeitsintensität
Laut Beschäftigtenbefragung werden
Arbeitsintensität und körperliche Anforderungen
insgesamt als hoch eingeschätzt. 86 Prozent der
Befragten erleben oft bzw. sehr häufig Zeitdruck
und Stress. Ebenfalls 86 Prozent berichten, dass
oft oder sehr häufig Personal fehle. „Sehr hohe
Belastungen, die u.a. auf den Personalmangel und
auf Zeitdruck und Stress zurückzuführen sind,
erleben vor allem Verkäufer*innen in Filialen“,
berichtet Studienleiter Stracke von wmp consult.
„Hier sind die Arbeitgeber gefragt,
Maßnahmen zu ergreifen, um dem Fachkräftemangel
entgegenzusteuern. Wir beobachten, dass einige
Betriebe schon dabei sind, sich zu modernisieren
und auf Bedürfnisse ihrer Arbeitnehmenden
eingehen. Aber gerade in diesem Bereich muss
künftig noch viel mehr getan werden.“
Personal- und Fachkräftemangel: Zuwanderung als
Chance
Nach Auskunft von Interviewten bleibt
der Personal- und Fachkräftemangel eine der
größten Herausforderungen in der Branche. Um
Personal zu finden, haben einige Betriebe des
Bäckerhandwerks ihren Suchradius bei der
Rekrutierung von Auszubildenden nach Südostasien
und Nordafrika ausgeweitet.
Während sich
die Zahl der Auszubildenden im Backgewerbe
allein in den letzten zehn Jahren fast halbiert
hat (2024: 8500 Auszubildende), steigt sie bei
Auszubildenden mit ausländischer Herkunft. Rund
ein Viertel der Auszubildenden hat einen
Migrationshintergrund, vor zehn Jahren waren es
weniger als 9 Prozent.
Verlagerung von
Nacht- auf Tagarbeit
„Eine potenzielle
Maßnahme, um die Arbeitsbedingungen und
Attraktivität gerade des Bäckereihandwerks
nachhaltig zu verbessern, wäre die Verlagerung
von Prozessen von der Nacht- in die
Tagproduktion“, so Stracke. Einige Betriebe
hätten dies schon erfolgreich umgesetzt. Helfen
könne dabei zum Beispiel Schockfrostung und
Gärunterbrechung sowie Veränderungen der
Teigführung.
„Dadurch können die Teige
schon tagsüber vorbereitet und geknetet werden,
nachts wird dann nur noch gebacken“, erläutert
Stracke. Eine wesentliche Voraussetzung im
Bereich klassischer Handwerksbäckereien sei der
Einsatz moderner Kältetechnik. Laut Interviewten
sei eine solche Verlagerung von Prozessen in der
Breite eher noch selten zu beobachten. Auch hier
gebe es jedoch eine Reihe von positiven
Beispielen.
Zur Bewältigung des Personal-
und Fachkräftemangels seien darüber hinaus
umfassendere Strategien erforderlich, die die
Attraktivität von Arbeitgebern und Berufsbildern
stärken, betont Christina Schildmann. Als
wesentliche Bausteine dafür hebt Branchenexperte
Stefan Stracke bessere Bedingungen u.a. in Bezug
auf Entgelt, Planbarkeit der Arbeitszeiten,
Überstundenausgleich, flexible
Work-Life-Balance-Angebote,
lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle,
Gesundheitsvorsorge, Entwicklungs- und
Karriereperspektiven, Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten und die
Arbeitsatmosphäre hervor.
Zentrale
Ergebnisse des Backwaren-Monitors 2025,
gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung in
Kooperation mit der NGG
Beschäftigte:
Rund 282000 Menschen arbeiten 2024 in der
Backwarenbranche, darunter 81000
Minijober*innen. Die Zahl der Betriebe im
klassischen Bäckerhandwerk ist in den
vergangenen zehn Jahren um 30 Prozent gesunken.
Fachkräftemangel: Seit 2014 sind 20000
Arbeitsplätze verlorengegangen. Gleichzeitig
steigt der Anteil an Teilzeitkräften auf knapp
40 Prozent. Erfreulich ist die Entwicklung bei
den Auszubildenden zu Fachverkäufer*innen im
Bäckerhandwerk. Dort gab es 2024 einen Zuwachs
von 22,5 Prozent.
Strukturwandel: Die
Dominanz der Großfilialisten und Brotindustrie
wächst. Die Anzahl der traditionellen
Bäckerhandwerksbetriebe sinkt seit Jahren,
während große Unternehmen expandieren.
Löhne & Arbeitsbedingungen: In
Handwerksbäckereien und Filialbäckereien ist die
Bezahlung oft niedrig. In der Brotindustrie
hingegen sind die Löhne höher, aber die dortige
Schichtarbeit belastet die Beschäftigten.
Arbeitsbelastung: Beschäftigte beklagen eine
hohe Arbeitsintensität, im Wesentlichen
verursacht durch Personalmangel. In
Filialbäckereien ist die psychische Belastung
besonders hoch. In der Industrie klagen die
Beschäftigten über die hohe Intensität im
Schichtbetrieb.
Azubi-Situation: Die Zahl
der Auszubildenden hat sich in den letzten zehn
Jahren fast halbiert. Laut Befragung wissen 73
Prozent nicht, ob sie nach ihrer Ausbildung
übernommen werden. 58 Prozent halten die
Vergütung für zu niedrig. Doch 2024 dreht sich
der Trend: Bei den Bäcker*innen-Azubis gab es
ein Plus von 11,4 Prozent. Rund 25 Prozent der
Auszubildenden kommen aus dem Ausland bzw. haben
einen ausländischen Pass.

21 % der 16- bis 74-Jährigen kaufen
Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel
online
Immer mehr Menschen in
Deutschland kaufen Medikamente oder
Nahrungsergänzungsmittel über das Internet. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
gaben 21 % der Bevölkerung im Alter von 16 bis
74 Jahren im Jahr 2024 an, Arzneimittel oder
Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel
Vitaminpräparate online gekauft zu haben. Der
Anteil ist in den vergangenen Jahren gestiegen:
2021 hatte er noch bei 16 % gelegen.

Anteil bei Frauen und in mittlerer
Altersgruppe am höchsten Mehr Frauen als Männer
nutzen das Internet für den Kauf von Arznei-
oder Nahrungsergänzungsmitteln: Während knapp
ein Viertel (24 %) der 16- bis 74-jährigen
Frauen im Jahr 2024 angab,
entsprechende Online-Käufe in den letzten drei
Monaten vor der Befragung getätigt zu haben, lag
der Anteil bei den Männern derselben
Altersgruppe bei 17 %. Auch unter Menschen
mittleren Alters ist der Anteil derjenigen, die
Arznei- oder Nahrungsergänzungsmittel online
kaufen, besonders hoch.
23 % der 25-
bis 64-Jährigen gaben an, solche Produkte über
das Internet zu bestellen. Deutlich geringer
fiel der Anteil in den jüngeren und älteren
Altersgruppen aus: Während 17 % der 65- bis
74-Jährigen Arznei- oder
Nahrungsergänzungsmittel im Internet kauften,
waren es bei den 16- bis 24-Jährigen lediglich
12 %. Insgesamt gaben im Jahr 2024 gut 83 % der
Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren in
Deutschland an, schon einmal etwas im
Internet gekauft oder bestellt zu haben.
10 % mehr ausländische
Studienanfängerinnen und -anfänger im
Studienjahr 2024
• Insgesamt 491
400 Studienanfängerinnen und -anfänger und damit
2,0 % mehr als im Studienjahr 2023
• Zahl
deutscher Erstimmatrikulierter sinkt im
Vorjahresvergleich um 1,1 %
•
Gesamtstudierendenzahl im Wintersemester
2024/2025 mit 2 868 600 Studierenden fast
unverändert zum Vorjahr
Im Studienjahr
2024 (Sommersemester 2024 und Wintersemester
2024/2025) haben sich 491 400
Studienanfängerinnen und Studienanfänger
erstmals für ein Studium an einer Hochschule in
Deutschland eingeschrieben. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen
Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 9 400
beziehungsweise 2,0 % mehr als im Studienjahr
2023.
Dabei wurde der Anstieg
alleine von den ausländischen
Erstimmatrikulierten getragen. Deren Zahl stieg
gegenüber dem Vorjahr um 13 100 oder 10 % auf
145 100, während die Zahl der deutschen
Studienanfängerinnen und -anfänger (346 300) um
1,1 % zurückging.
Ausländeranteil an
Erstimmatrikulierten seit 2014 von 22 % auf 30 %
gestiegen Nach den vorläufigen Ergebnissen ergab
sich im Studienjahr 2024 ein Ausländeranteil an
den Erstimmatrikulierten von rund 30 %. Zehn
Jahre zuvor im Studienjahr 2014 hatte er noch
bei 22 % gelegen.
Im selben Zeitraum
stieg die Zahl der ausländischen
Studienanfängerinnen und -anfänger um 33 %,
während sich die Zahl der deutschen
Erstimmatrikulierten – vor allem demografisch
bedingt – um 13 % verringerte. Die Gesamtzahl
der Studienanfängerinnen und -anfänger sank
damit im Zehnjahresvergleich von 2014 (504 900)
bis 2024 um 2,7 %.
Jüngster Anstieg
der Erstsemesterzahl verteilt sich ungleichmäßig
auf Fächergruppen Der Gesamtanstieg der
Studienanfängerzahl um 2,0 % zwischen 2023 und
2024 vollzog sich in den Fächergruppen
uneinheitlich. So fielen die Anstiege in den
MINT-Fächergruppen Ingenieurwissenschaften
(+3,6 % auf 133 600) und Mathematik,
Naturwissenschaften (+2,9 % auf 52 300) sowie in
der Fächergruppe
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (+3,0 %
auf 28 900) überdurchschnittlich aus.
In den MINT-Fächergruppen waren zugleich die
stärksten Anstiege ausländischer
Erstimmatrikulierter zu beobachten (Mathematik,
Naturwissenschaften: +14 % auf 14 900;
Ingenieurwissenschaften: +12 % auf 54 800).
Demgegenüber verzeichneten die Fächergruppen
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
(+0,6 % auf 193 800) sowie Geisteswissenschaften
(+0,4 % auf 49 700) unterdurchschnittliche
Anstiege bei der Studienanfängerzahl. I
n
der Fächergruppe Kunst, Kunstwissenschaft ging
die Erstsemesterzahl im Vorjahresvergleich sogar
um 1,2 % auf 15 500 zurück. Gesamtzahl
ausländischer Studierender im Wintersemester
2024/2025 um 5 % gestiegen
Die
Gesamtzahl der Studierenden blieb im
Wintersemester 2024/2025 mit 2 868 600 gegenüber
dem Wintersemester 2023/2024 (2 868 300) nahezu
konstant. Allerdings veränderte sich die
Aufteilung in deutsche und ausländische
Personen: Während die Zahl der deutschen
Studierenden von 2 398 800 im Wintersemester
2023/2024 um 1,0 % auf 2 376 000 im laufenden
Wintersemester 2024/2025 zurückging, erhöhte
sich die Zahl der ausländischen Studierenden um
5 % von 469 500 auf 492 600.
Weitere Ergebnisse zu Studierenden an deutschen
Hochschulen sind auf der Themenseite "Hochschulen"
im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes
verfügbar. Einen Gesamtüberblick über die
Bildungssituation in Deutschland von der Schule
über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet
die Themenseite "Bildungsindikatoren".
Mittwoch, 12.
März 2025
Großer Streik-Tag in Moers:
Kitas geschlossen, Einschränkungen im
Bürgerservice
Großer Streiktag
morgen (Mittwoch, 12. März) auch in Moers: Unter
anderem fällt die freie Sprechzeit im
Bürgerservice (8-10 Uhr) aus. Vereinbarte
Termine bleiben, aber es kann zu längeren
Wartezeiten kommen.
Die städtischen
Kitas Diergardtstraße, Walter-Karentz-Straße und
Barbarastraße bleiben geschlossen. Nur
Notgruppen gibt es in den Einrichtungen Am
Pandyck, Orchideenstraße,
Konrad-Adenauer-Straße, Lockertstraße,
Wilhelm-Müller-Straße und Pusenhof.
Eltern sind bereits durch die Kita-Leitungen
informiert worden. Auch in anderen Bereichen
kann es eventuell zu Einschränkungen kommen.
Dinslaken: Einschränkungen
durch Warnstreik am 11. und 12. März möglich
Die Dinslakener Stadtverwaltung weist auf einen
bevorstehenden Warnstreik hin, der am Dienstag,
11. März, und Mittwoch, 12. März 2025,
stattfinden wird. Aufgerufen dazu hat die
Gewerkschaft ver.di.
Dieser Warnstreik führt auch
zu Einschränkungen bei verschiedenen städtischen
Dienstleistungen. In den meisten städtischen
Kitas werden Notgruppen eingerichtet. Die Eltern
werden wie beim letzten Mal von ihrer jeweiligen
Kita informiert.
Auch die Müllabfuhr
und die Straßenreinigung könnten betroffen sein.
Ebenfalls könnten andere städtische
Dienstleistungen beeinträchtigt sein, jedoch
sind die genauen Auswirkungen noch nicht
bekannt.
Die Stadtverwaltung bittet um
Verständnis für die streikbedingten
Einschränkungen und dankt allen Mitarbeitenden,
die im Vorfeld ihre Streikbeteiligung
angekündigt hatten, obwohl diese Ankündigung
nicht gesetzlich verpflichtend ist. Die
Mitarbeitenden streiken für gute
Arbeitsbedingungen und auskömmliche Vergütung im
öffentlichen Dienst.
Forum
für Verkehrs- und Brückenmanagement bietet
wichtige Plattform
Verbesserung der
Infrastruktur: Bezirksregierung Düsseldorf lädt
Verwaltung und Wirtschaft zum intensiven
Austausch ein
Im Hinblick auf den
hohen Modernisierungsbedarf an der Infrastruktur
des Regierungsbezirks hat die Bezirksregierung
Düsseldorf eine Plattform für die Vertreter von
Verwaltung und Wirtschaft geschaffen, um dieses
zentrale Thema für den Regierungsbezirk
Düsseldorf in den Blick zu nehmen. Als
Bündelungsbehörde bringt die Bezirksregierung
die unterschiedlichen Akteure zusammen, um
Impulse für ein zuständigkeitsübergreifendes und
effizientes Baustellen- und Risikomanagement zu
geben.

Regierungspräsident Thomas Schürmann begrüßte
die Teilnehmer:innen - Foto Bez.Regierung
Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung
im November 2023 und dem ersten Follow-Up Termin
im Juni 2024 sowie den darauffolgenden
Arbeitsgruppensitzungen trafen sich die
Fachleute am 10. März 2025 zum 3. Forum im
Plenarsaal der Bezirksregierung in Düsseldorf.
In Vorträgen skizzierte die DB-InfraGO
einige der im Jahr 2025 geplanten Maßnahmen. Der
Landesbetrieb Straßenbau NRW referierte zur
Joseph-Kardinal-Frings-Brücke, ein Vertreter vom
Arbeitskreis Kommunaler Ingenieurbau NRW zum
Kommunalen Brückenmanagement und den
Herausforderungen für die Kommunen. Neben dem
Fachkräftemangel sind dies beispielsweise die
Komplexität von Vergabeverfahren oder auch
begrenzte finanzielle Mittel innerhalb der
Kommunen.
Forum und Arbeitsgruppen zeigen
erste Erfolge: Positiv wird bewertet, dass der
Informationsaustausch zwischen den Akteuren aus
Verwaltung, Wirtschaft und Industrie
intensiviert und die Vernetzung durch die
gemeinsame Arbeit in den regionalen
Arbeitsgruppen gefördert wird. So konnten
innerhalb der Arbeitsgruppen Maßnahmen
identifiziert werden, die zu einer Kollision
durch Schienensperrungen und gleichzeitige
Sperrung von bedeutenden Verkehrswegen geführt
hätten. Durch eine Anpassung der Planung wurde
dies umgangen.
Und: TIC Kommunal, die
digitale landesweite
Baustellenkoordinationsplattform von
Straßen.NRW, wird durch die kommunalen
Baulastträger mittlerweile intensiver genutzt.
Regierungspräsident Thomas Schürmann ist von
dem Netzwerk überzeugt: „Alle profitieren von
dem intensiven und direkten Austausch, der eine
funktionierende Infrastruktur und die
Minimierung der Belastungen auf dem Weg dorthin
zum Ziel hat. Nur mit der frühzeitigen
Information aller Beteiligten und der
Koordination untereinander kann der enorme
Sanierungsbedarf möglichst störungsfrei
bewältigt werden.“
Drei
Sachverständige öffentlich bestellt und
vereidigt
Am 5. Februar 2025 hat der
Präsident der Niederrheinischen IHK, Werner
Schaurte-Küppers, drei neue Sachverständige
öffentlich bestellt und vereidigt. Alexander
Auerswald zum Sachverständigen für
Straßenverkehrsunfälle, Martin Gossens zum
Sachverständigen für Kraftfahrzeugschäden und
-bewertung und Pierre Linneweber zum
Sachverständigen für Trinkwasserhygiene.
Alle drei haben erfolgreich den Nachweis der
besonderen Sachkunde, der persönlichen Eignung
und der weiteren Voraussetzungen nach der
Sachverständigenordnung erbracht.
Mit dem
Eid verpflichten sich die Sachverständigen vor
dem IHK-Präsidenten, die von der Vollversammlung
beschlossene Sachverständigenordnung einzuhalten
und ihre Sachverständigenleistungen unabhängig,
weisungsfrei, unparteiisch, gewissenhaft und
persönlich zu erbringen.
Die
Niederrheinische IHK bestellt und vereidigt
Sachverständige auf allen Gebieten der
gewerblichen Wirtschaft: vom Bauwesen über den
Umweltbereich bis hin zur Unternehmensbewertung.

v.l.: Dr. Frank Rieger (Geschäftsbereichsleiter
Recht und Steuern), Martin Gossens, Alexander
Auerswald, Pierre Linneweber und Werner
Schaurte-Küppers (IHK-Präsident). Foto:
Niederrheinische IHK/Hendrik Grzebatzki
Dinslaken: Erweiterung Klaraschule
kann gebaut werden
Dinslakens
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel konnte jetzt
eine positive Nachricht des Kreises Wesel
entgegennehmen: Der Kreis erteilte seine
Zustimmung zur vorzeitigen Mittelfreigabe für
die Umsetzung der Baumaßnahme Klaraschule.
Bürgermeisterin Eislöffel zeigte sich
erfreut: „Durch die Freigabe der Mittel können
die Pläne für einen Anbau in Modulbauweise an
der Gemeinschaftsgrundschule nun umgesetzt
werden. Damit decken wir den Raumbedarf an der
Klaraschule zum Schuljahresbeginn 2025/26. Für
Eltern, Schüler*innen und Lehrkräfte ist das ein
wichtiges Signal.
Die politischen
Vertreterinnen und Vertreter im Rat haben sich
letztlich für gute Lern- und Lehrbedingungen in
unserer Stadt entschieden. Ebenfalls danke ich
dem Kreis Wesel für die rasche Bearbeitung
unseres Antrags. Rahmenbedingungen für gute
Bildung zu schaffen, sollte immer unser
gemeinsames Ziel sein, weil wir hier in unsere
Zukunft investieren und Bildungsbiografien
positiv beeinflussen können.“
Für
den geplanten Anbau sind Investitionskosten von
maximal 1,85 Millionen Euro angesetzt. Für diese
wichtige Investition hat der Kreis Wesel nun
grünes Licht gegeben. Die Stadt Dinslaken ist
aufgrund ihrer schwierigen Haushaltssituation
darauf angewiesen, dass der Kreis Wesel als
Aufsichtsbehörde den notwendigen Maßnahmen
zustimmt.
An der Klaraschule ist
zunächst ein eingeschossiges Gebäude in
Modulbauweise durch das städtische
Bauunternehmen ProZent GmbH zu errichten. Es
enthält zwei Klassen, ein bis zwei
Differenzierungsräume und eine neue WC-Einheit.
Das Bauwerk hat denselben Standard wie das
übrige Schulgebäude und könnte bei zusätzlichem
Raumbedarf in Zukunft aufgestockt werden.
Die Modulbauweise bietet flexible
Nachnutzungen, so dass diese auch abgebaut und
an einem anderen Standort wieder aufgebaut
werden kann. Diese modulare Konstruktion bietet
den Vorteil, dass auch während des laufenden
Schulbetriebes sowohl der Bau als auch eine
spätere Erweiterung möglich sind.
Zufrieden zeigt sich Bürgermeisterin Eislöffel
mit dem Ergebnis und der konstruktiven
Zusammenarbeit mit der ProZent: „Die
Mitarbeitenden der ProZent und der
Stadtverwaltung haben in enger Zusammenarbeit
eine kostenreduzierte Variante zusätzlicher
Klassenräume unter hohem Zeitdruck geplant und
nicht nur den Grundstein für gute Bildung
gelegt, sondern auch eine moderne und
nachhaltige Lösung präsentiert, die nun
unverzüglich umgesetzt wird.“
Die
Stadtverwaltung schätzt die dauerhafte,
räumliche Lösung für die GGS Klaraschule als
notwendig ein, weil nach aktuellen Berechnungen
der Bedarf an Schulplätzen im nördlichen
Stadtgebiet auch in den kommenden Jahren nicht
sinken wird.
Moers: Stadt
sucht zwei neue Schiedspersonen
Sie
versuchen zu schlichten, bevor es zur
Gerichtsverhandlung kommt: Schiedspersonen. Die
Stadt Moers sucht zwei neue für die Bezirke 1 –
Kohlenhuck, Bornheim, Repelen, Genend – und 2 –
Rheinkamp-Mitte, Eick, Utfort. Bis Sonntag, 13.
April, können sich Interessierte bewerben.
Die Schiedspersonen sollten ihren Wohnsitz
in dem entsprechenden Bezirk haben und zwischen
25 und 75 Jahre alt sein. Freude und Geschick an
der Verhandlungsführung sowie Bereitschaft zum
Zuhören sind Voraussetzungen zur Ausübung dieses
Ehrenamtes. Die benötigten Kenntnisse werden in
Schulungen vermittelt. Bewerbungen von Menschen
mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich
erwünscht.
Vielfältige Arbeitsgebiete
Die Schiedsfrauen und Schiedsmänner führen
Schlichtungsverfahren in bürgerlich-rechtlichen
Streitigkeiten (zum Beispiel Einhaltung der
Grundstücksgrenzen, Lärmbelästigungen oder
Bepflanzungen), Nachbarrecht und verschiedenen
Privatklagedelikten durch.
Dazu zählen unter anderem
Beleidigungen, üble Nachrede, Hausfriedensbruch,
leichte und fahrlässige Körperverletzungen,
Verletzung des Briefgeheimnisses, Bedrohung und
Sachbeschädigungen – auch im Vollrausch – sowie
Strafrecht. Die Verhandlungen werden in den
Privaträumen der Schiedsleute geführt. Dafür
erhalten sie eine Aufwands- und
Amtsraumentschädigung.
Die Bewerber
sollen einen PC besitzen, Kenntnisse in
Textverarbeitung haben und bereit sein, sich in
umfangreiche Formularsätze einzuarbeiten und
diese im Zusammenhang mit den Schiedsverfahren
zu benutzen.
Die Schiedsperson wird für fünf
Jahre vom Rat der Stadt Moers gewählt und vom
Amtsgericht bestätigt. Die Amtszeit beginnt mit
der Vereidigung durch die
Amtsgerichtsdirektorin.
Aufwandsentschädigung und Ehrenamtskarte
Die
Schiedsfrauen und Schiedsmänner erhalten eine
monatliche Aufwandsentschädigung von 60 Euro,
die quartalsmäßig ausgezahlt wird, und eine
Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro. Diese
Einmalzahlung kann zum Beispiel für die
Beschaffung eines PCs genutzt werden.
Des Weiteren können die Schiedsfrauen und
Schiedsmänner der Stadt Moers aufgrund ihres
ehrenamtlichen Engagements ein Jahr nach dem
Beginn ihrer Tätigkeit die Ehrenamtskarte des
Landes Nordrhein-Westfalen beantragen. Bei rund
35 Einrichtungen des Landes und des
Landschaftsverbands erhalten die Inhaberinnen
und Inhaber Vergünstigungen, z. B. bei Theatern
und Museen oder zum Beispiel auf
Einzeleintrittskarten im Archäologischen Park
Xanten (50 Prozent Rabatt).
Infobox: Wer
Interesse an der Ausübung des Amtes hat, kann
sich schriftlich unter Angabe von Name,
Anschrift, Geburtsdatum und Beruf bei der Stadt
Moers, Fachdienst Ordnung, 47439 Moers,
bewerben. Die Unterlagen müssen ein Lichtbild,
einen tabellarischem Lebenslauf und einen
Tätigkeitsnachweis enthalten. Weitere
Informationen finden unter dem Stichwort
‚Schiedspersonen‘ und auf der Homepage der
BDS-Bezirksvereinigung Krefeld-Moers:
www.bds-krefeld.de.
Landesweiter Warntag am Donnerstag, 13. März
2025
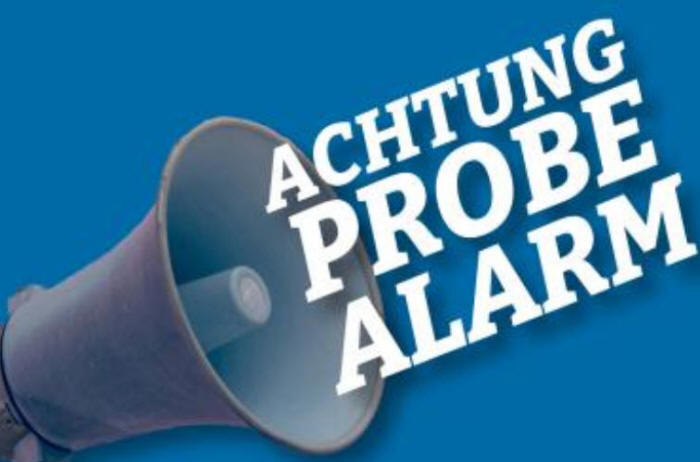
Die Kreis-Leitstelle Kleve aktiviert die Sirenen
im Kreis Kleve. Das Land NRW löst die Warn-App
NINA und den Handy-Alarm „Cell Broadcast“ aus.
Kreis Kleve – Der „landesweite Warntag“
findet in diesem Jahr am Donnerstag, 13. März
2025, statt. Dabei lösen um 11 Uhr die
zuständigen Leitstellen in ganz
Nordrhein-Westfalen – also auch im Kreis Kleve –
die vorhandenen digitalen Sirenen aus.
Der Probealarm setzt sich aus der folgenden
Kombination von Sirenentönen zusammen:
„Entwarnung – Warnung – Entwarnung“.
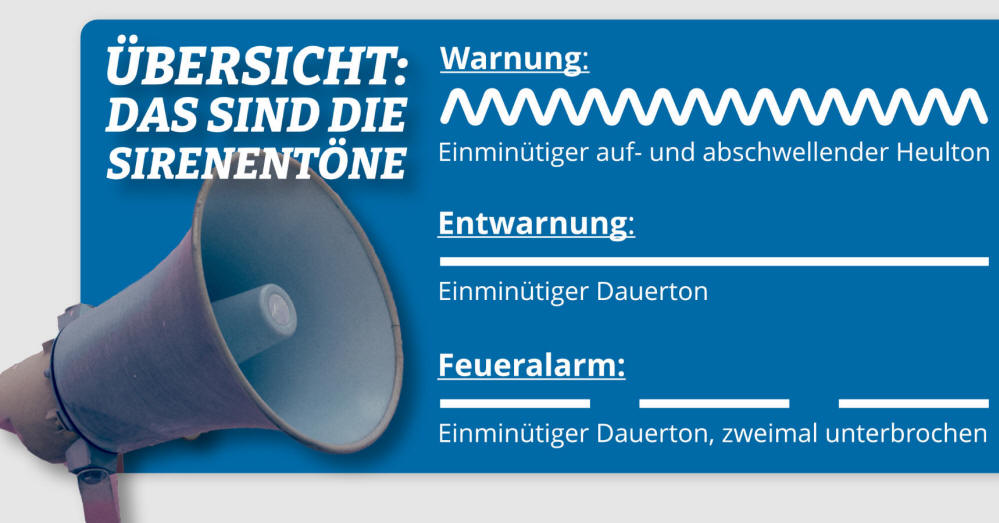
Die Entwarnung erfolgt dabei durch einen
einminütigen Dauerton und die Warnung durch
einen einminütigen Heulton, der auf- und
abschwillt. Zum Abschluss ist erneut ein
einminütiger Entwarnungs-Dauerton zu hören. Die
Signale werden in einem Abstand von fünf Minuten
ausgelöst. Ziel des Warntages ist es, die
Infrastruktur zu testen und zugleich das Thema
Warnung wiederholt in den Fokus der öffentlichen
Wahrnehmung zu rücken.
Übersicht der
Sirenentöne. Grafik: Stadt Kleve. Zum Vergrößern
auf die Grafik klicken.
In allen 16
Kommunen im Kreis Kleve sind Sirenen
installiert. Die akustische Wahrnehmbarkeit der
digitalen Sirenen kann durch die Windrichtung
beeinflusst werden. Unter Umständen sind die
Signaltöne daher nicht in allen Ortsteilen zu
hören.
Für eine umfassende Warnung der
Bevölkerung werden mehrere Warnmittel zeitgleich
eingesetzt. Auch diese werden am Warntag
getestet. Ebenfalls um 11 Uhr wird seitens des
Landes Nordrhein-Westfalen die „Warn-App NINA“
ausgelöst. NINA warnt deutschlandweit oder
standortbezogen vor Gefahren wie Hochwasser,
Gefahrstoffausbreitung, Großbrand oder vor
anderen so genannten Großeinsatzlagen. Die
NINA-App steht kostenlos in den bekannten
App-Stores zum Download zur Verfügung.
Den „Warnmix“ ergänzen darüber hinaus Warnungen
über „Cell Broadcast“. Dies ist ein
Mobilfunkdienst, mit dem Nachrichten – auch ohne
Installation einer App – unmittelbar auf das
Handy oder Smartphone geschickt werden. Bevor
die Warnmeldungen empfangen werden können, ist
es unter Umständen notwendig, zuerst die
entsprechenden Einstellungen des eigenen Handys
zu aktualisieren.
Auf der Internetseite
des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
www.bbk.bund.de sind unter dem Stichwort „Cell
Broadcast“ Anleitungen für verschiedene
Handymodelle verfügbar. Dort befinden sich auch
weitere Informationen rund um das Thema „Cell
Broadcast“.
Im Lokalradio Antenne
Niederrhein wird in den Nachrichten um 11 Uhr
auf den Warntag hingewiesen. Zudem wird der
Sender das laufende Programm unterbrechen, um
das Live-Einsprechen aktueller Gefahrenwarnungen
zu testen.
Auf den Internetseiten des
Kreises Kleve, www.kreis-kleve.de, gibt es unter
den Suchbegriffen „Sirenenton“ oder „NINA“
weitere Informationen.
Rotbachbrücke auf der Kirchstraße in
Dinslaken-Hiesfeld für Fahrzeuge über 3,5 t
gesperrt
Die Rotbachbrücke
(Kirchstraße, Kreisstraße 8) in
Dinslaken-Hiesfeld ist seit Mittwoch, 5. März
2025, für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen
tatsächliches Gewicht gesperrt. Als Ergebnis
einer turnusmäßig durchgeführten
Brückenhauptprüfung wurde eine anlassbezogene
Nachrechnung des Bauwerks veranlasst.
Die Nachrechnung kommt zu dem Ergebnis, dass
eine Sperrung des Bauwerks für Fahrzeuge mit
einem tatsächlichen Gewicht über 3,5 Tonnen
unumgänglich ist. Von der Sperrung ist auch die
Buslinie 17 betroffen.
Die Fahrtroute
der Linie 17 wird durch die NIAG entsprechend
angepasst. Die NIAG wird hierüber entsprechend
informieren. Mittelfristig wird ein Neubau der
Brücke erforderlich. Eine Umleitung für
Fahrzeuge über 3,5 Tonnen tatsächliches Gewicht
ist über die Ziegelstraße, Oberhausener Straße
(L4) und die Bergerstraße (L462) ausgeschildert.
Moers: Baustelle
Römerstraße: Einbahnstraßen sollen Verkehrsfluss
besser steuern
Aufgrund der
Baustelle in der Römerstraße ist es in den
letzten Tagen zu teils gefährlichen
Verkehrsverstößen in zwei Nebenstraßen gekommen,
die zur Umfahrung genutzt werden. Um dies zu
verhindern und den Verkehrsfluss besser steuern
zu können, werden die Straßen An der Beeke (in
Richtung Blücherstraße) und Schöllingstraße (in
Richtung Germendonks Kamp) während der Bauzeit
zu Einbahnstraßen.
Die Stadt hat
damit auf Hinweise von Anwohnerinnen und
Anwohnern reagiert. Die Maßnahmen sind mit der
Polizei abgesprochen. In der Römerstraße und
einigen Nebenstraßen saniert die ENNI Stadt &
Service Niederrhein weite Teile der
Infrastruktur. Die Römerstraße bleibt
voraussichtlich bis Sommer 2025 zwischen der
Blücherstraße und dem Germendonks Kamp gesperrt.
Eine Umleitung über Kirschenallee,
Mosel-, Jahn- und Bismarckstraße bzw.
stadteinwärts über Bismarck- und Donaustraße
sowie Kirschenallee ist ausgeschildert.
Nächstes Reparatur-Café in St. Ida
am 19. März
Im Monat März öffnet
das Reparatur-Café in St. Ida/Rheinkamp, Eicker
Grund 102, am Mittwoch, 19., wieder seine
Pforten. Von 16 bis 18.30 Uhr stehen
ehrenamtlich Helfende bei der Wiederherstellung
defekter Dinge aus den Bereichen Elektro,
Holzarbeiten und Fahrräder zur Seite.
Neben den Reparaturen von PC, Laptop,
Tablet, Handy und Smartphone können sich die
Besitzerinnen und Besitzer auch im Umgang mit
ihren Geräten beraten oder sich bei der
Installation von Programmen oder Apps helfen
lassen. Das Reparatur-Café ist eine Kooperation
des Quartierzentrums AWO-Caritas mit der
katholischen Kirchengemeinde St. Martinus und
KoKoBe Moers. Weitere Infos gibt es telefonisch
unter 0 28 41/8 87 86 06 sowie online unter tanja.reckers@caritas-moers-xanten.de.
Moers: Hoffnung und
Zärtlichkeit: Konzert mit Lesung zu Hüsch am
Freitag
Hoffnung und Zärtlichkeit:
Zu einem Konzert mit Lesung zu Hanns Dieter
Hüsch laden das Schlosstheater Moers und das
Grafschafter Museum am Freitag, 14. März, um 19
Uhr ein. Unter anderem Leonardo Lukanow, Ludwig
Michael und Marissa Möller gestalten den Abend
zu Hanns Dieter Hüsch am Freitag, 14. März, um
19 Uhr mit.

(Foto: Jakob Studnar)
Die Veranstaltung
findet im Haus der Demokratiegeschichte im Alten
Landratsamt (Kastell 5) statt. Den Abend
gestalten textlich und musikalisch Leonardo
Lukanow, Ludwig Michael, Marissa Möller und
Achim Tang (Bass). Der Universalkünstler Hanns
Dieter Hüsch hat mit seiner einzigartigen
literarischen Sezierkunst, seiner unglaublichen
Liebe und Nachsicht zu den Untersuchungsobjekten
das niederrheinische ‚Gemüt‘ mit beinahe
volkskundlicher Präzision beschrieben und
festgehalten.
Sein poetischer,
verspielter, skeptischer und philosophischer
Blick ging weit über die Region hinaus und gebar
so eigenartige Figuren wie den
existenzphilosophischen Hagenbuch, der mit
bürokratischer Akribie versucht, die Ordnung der
Welt zu verstehen. Und Themen wie
Rechtsradikalismus, der Kalte Krieg und die
zunehmende politische Ideologisierung bewegten
ihn schon damals.
Die Gäste können
nun neu hinhören, denn: „Nur wenn wir in uns
alle sehn – Besiegen wir das Phänomen“. Die
Veranstaltung findet statt im Rahmen des
Jubiläumsjahres HÜSCH100 zum 100. Geburtstag des
Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch. Tickets zum
Preis von 21,50 Euro (ermäßigt 8 Euro) können
telefonisch im Schlosstheater Moers unter 0 28
41 / 8 83 41 10 reserviert werden.
Online-Vortragsreihe: RVR und
Verbraucherzentrale NRW informieren wieder
kostenlos über Solarenergie
Der
Regionalverband Ruhr (RVR) und die
Verbraucherzentrale NRW legen ihre
Online-Vortragsreihe zu Solarenergie in diesem
Jahr wieder auf. Jeweils Donnerstag werden in
Zoom-Vorträgen wichtige Themen erklärt und
Fragen beantwortet. Los geht's am 26. März mit
Informationen zu "Sonnenstrom vom Dach –
Photovoltaik Dachanlagen". "Photovoltaik-Anlagen
mieten oder kaufen?" - um diese Entscheidung
dreht sich die Veranstaltung am 2. April, bevor
am 9. April der Fokus auf "Sonnenstrom vom
Balkon – Steckersolargeräte" liegt.
"Photovoltaik auf Mehrfamilienhäusern" lautet
das Thema des Online-Vortrags am 16. April. Alle
Angebote sind kostenlos. Die Vortragsreihe ist
ein Angebot der Solarmetropole Ruhr, die der RVR
und das Handwerk Region Ruhr initiiert haben.
Sie richtet sich sowohl an
Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer als auch
an Bewohnerinnen und Bewohner von
Mehrfamilienhäusern.
Vorkenntnisse
sind nicht notwendig und Fragen ausdrücklich
erwünscht. Eine vorherige Online-Anmeldung unter
https://solarmetropole.ruhr/veranstaltungen
ist erforderlich. In den letzten drei Jahren
nutzten fast 3.500 Bürgerinnen und Bürger die
kostenlosen und neutralen Vortragsangebote der
Solarmetropole Ruhr. idr
Kleve: Earth Hour 2025: Licht aus. Stimme an.
Gemeinsam für einen lebendigen Planeten
Auch in diesem Jahr folgt die
Stadtverwaltung Kleve dem Aufruf des WWF
Deutschland und beteiligt sich an der Earth Hour
2025. Mit der Earth Hour rufen Menschen, Städte
und Unternehmen weltweit zu mehr Engagement für
den Klimaschutz auf.

Kirchturmspitze im Dunkeln neben bewölktem Mond
Dazu schalten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in über 180 Ländern am Samstag, 22.
März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht
aus, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu
setzen. Bekannte Bauwerke werden dann wieder
symbolisch in Dunkelheit gehüllt, darunter
Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor in Berlin,
die Chinesische Mauer von Peking bis Xinjiang,
der Big Ben in London, der Eiffelturm in Paris
oder der Darling Harbour in Sydney.
Mittlerweile wird die Stunde der Erde zum 19.
Mal auf allen Kontinenten gefeiert. In den
vergangenen Jahren haben sich tausende Städte in
192 Ländern beteiligt. Allein in Deutschland
haben 2024 insgesamt 560 Städte und Gemeinden
teilgenommen. In Kleve beteiligen sich mehrere
Institutionen an der Earth Hour.
Dazu gehören die Stadt Kleve, die Wirtschaft,
Tourismus & Marketing der Stadt Kleve GmbH, die
Umweltbetriebe der Stadt Kleve, die Hochschule
Rhein-Waal, die Sparkasse Rhein-Maas sowie die
Volksbank Kleverland eG, der Klevische Verein
mit der Schwanenburg, die Stifts- und
Propsteikirche St. Mariä Himmelfahrt sowie die
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, die allesamt
für eine Stunde die Beleuchtung ihrer Gebäude
ausschalten.
Kleves Bürgermeister
Wolfgang Gebing: „Die Earth Hour ist ein starkes
Signal, um für unsere Erde und unsere
Lebensgrundlagen einzustehen und gemeinsam eine
nachhaltige und zukunftsfähige Politik und
Wirtschaft einzufordern. Gemeinsam können wir
den Wandel schaffen.“ Alle Infos zur Earth Hour
gibt es unter
www.wwf.de/earth-hour.
Am Dienstag, den 25. März 2025, tagt der Rat der
Stadt Dinslaken.
Die Sitzung
beginnt um 17:30 Uhr in der
Kathrin-Türks-Halle. Tagesordnungen
sowie Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen
sind grundsätzlich auch online im
Ratsinformationssystem einsehbar.

Produktion im Januar 2025: +2,0 % zum
Vormonat
Produktion im
Produzierenden Gewerbe
Januar 2025 (real,
vorläufig):
+2,0 % zum Vormonat (saison- und
kalenderbereinigt)
-1,6 % zum Vorjahresmonat
(kalenderbereinigt)
Dezember 2024 (real,
revidiert):
-1,5 % zum Vormonat (saison- und
kalenderbereinigt)
-2,2 % zum Vorjahresmonat
(kalenderbereinigt)
Die reale
(preisbereinigte) Produktion im Produzierenden
Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar
2025 gegenüber Dezember 2024 saison- und
kalenderbereinigt um 2,0 % gestiegen. Im weniger
volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion
von November 2024 bis Januar 2025 auf dem Niveau
der drei vorangegangenen Monate (0,0 %).
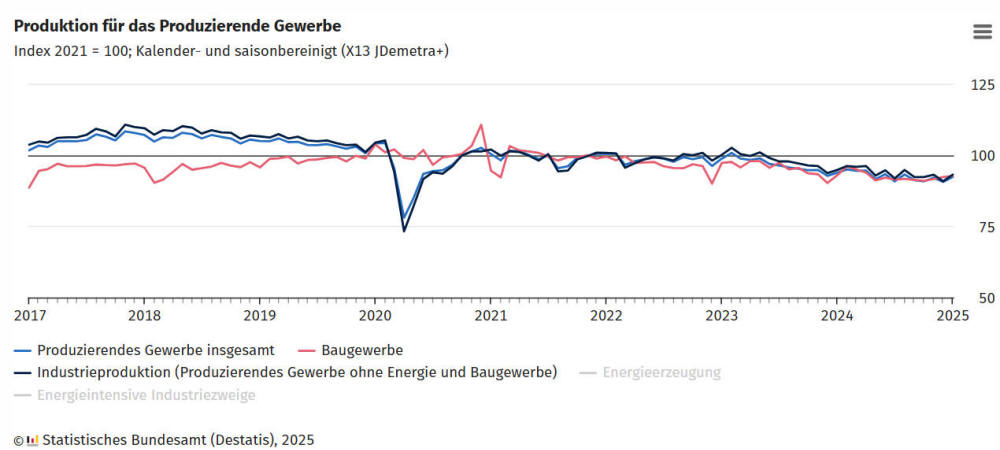
Im Dezember 2024 sank die Produktion
gegenüber November 2024 nach Revision der
vorläufigen Ergebnisse um 1,5 % (vorläufiger
Wert: -2,4 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat
Januar 2024 war die Produktion im Januar 2025
kalenderbereinigt 1,6 % niedriger.
Deutlicher Produktionszuwachs in der
Automobilindustrie
Die positive Entwicklung
der Produktion im Januar 2025 ist insbesondere
auf den Anstieg in der Automobilindustrie
(saison- und kalenderbereinigt +6,4 % zum
Vormonat) zurückzuführen. Auch die
Produktionszuwächse in der
Nahrungsmittelindustrie (+7,5 %) und in der
Maschinenwartung und -montage (+15,6 %)
beeinflussten das Gesamtergebnis positiv.
Negativ wirkte sich hingegen der Rückgang im
Bereich Herstellung von Metallerzeugnissen (-7,7
%) aus.
Die Industrieproduktion
(Produzierendes Gewerbe ohne Energie und
Baugewerbe) nahm im Januar 2025 gegenüber
Dezember 2024 saison- und kalenderbereinigt um
2,6 % zu. Dabei stieg die Produktion von
Vorleistungsgütern um 3,3 %. Die Produktion von
Investitionsgütern sowie die Produktion von
Konsumgütern stiegen jeweils um 2,4 %. Außerhalb
der Industrie sank die Energieerzeugung um 0,5 %
im Januar 2025 im Vergleich zum Vormonat. Die
Bauproduktion stieg hingegen um 0,4 %.
Im
Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2024 fiel
die Industrieproduktion im Januar 2025
kalenderbereinigt um 1,7 %.
Produktion in
energieintensiven Industriezweigen gestiegen
In den energieintensiven Industriezweigen ist
die Produktion im Januar 2025 gegenüber Dezember
2024 saison- und kalenderbereinigt um 3,4 %
gestiegen. Im Dreimonatsvergleich war die
Produktion in den energieintensiven
Industriezweigen von November 2024 bis Januar
2025 auf dem Niveau der drei vorangegangenen
Monate (0,0 %). Verglichen mit dem
Vorjahresmonat Januar 2024 war die
energieintensive Produktion im Januar 2025
kalenderbereinigt um 2,1 % höher.
Exporte im Januar 2025: -2,5 % zum
Dezember 2024
Exporte (kalender- und
saisonbereinigte Warenausfuhren), Januar 2025
129,2 Milliarden Euro
-2,5 % zum Vormonat
-0,1 % zum Vorjahresmonat
Importe (kalender-
und saisonbereinigte Wareneinfuhren), Januar
2025
113,1 Milliarden Euro
+1,2 % zum
Vormonat
+8,7 % zum Vorjahresmonat
Außenhandelsbilanz (kalender- und
saisonbereinigt), Januar 2025
+16,0
Milliarden Euro
Im Januar 2025 sind die
deutschen Exporte gegenüber Dezember 2024
kalender- und saisonbereinigt um 2,5 % gesunken
und die Importe um 1,2 %
gestiegen. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) anhand
vorläufiger
Ergebnisse weiter mitteilt,
sanken die Exporte im Vergleich zum
Vorjahresmonat
Januar 2024 um 0,1 % und die
Importe stiegen um 8,7 %.
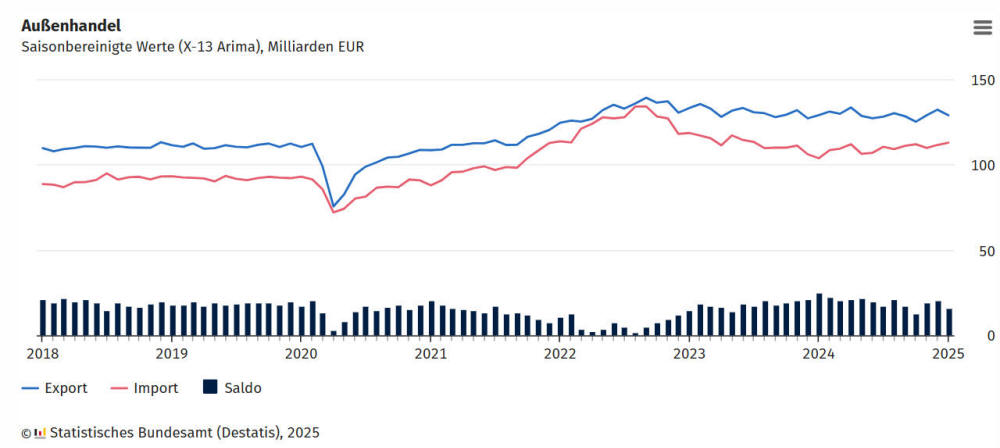
Außenhandel mit EU-Staaten
In
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU)
wurden im Januar 2025 kalender- und
saisonbereinigt Waren im Wert von 69,8
Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren
im Wert von 57,0 Milliarden Euro von dort
importiert. Gegenüber Dezember 2024 sanken die
kalender- und saisonbereinigten Exporte in die
EU-Staaten um 4,2 % und die Importe aus diesen
Staaten um 1,1 %. In die Staaten der Eurozone
wurden Waren im Wert von 48,4 Milliarden Euro
(-5,0 %) exportiert und es wurden Waren im Wert
von 37,7 Milliarden Euro (-0,2 %) aus diesen
Staaten importiert. In die EU-Staaten, die nicht
der Eurozone angehören, wurden Waren im Wert von
21,4 Milliarden Euro (-2,3 %) exportiert und es
wurden Waren im Wert von 19,3 Milliarden Euro
(-2,7 %) von dort importiert.
Außenhandel mit Nicht-EU-Staaten
In die
Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden
im Januar 2025 kalender- und saisonbereinigt
Waren im Wert von 59,4 Milliarden Euro
exportiert und es wurden Waren im Wert von 56,1
Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert.
Gegenüber Dezember 2024 nahmen die Exporte in
die Drittstaaten um 0,4 % ab, während die
Importe von dort um 3,7 % stiegen.
Die
meisten deutschen Exporte gingen im Januar 2025
in die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden
kalender- und saisonbereinigt 4,2 % weniger
Waren exportiert als im Dezember 2024. Damit
nahmen die Exporte in die Vereinigten Staaten
auf einen Wert von 13,0 Milliarden Euro ab. Die
Exporte in die Volksrepublik China sanken um 0,9
% auf 6,7 Milliarden Euro. Die Exporte in das
Vereinigte Königreich wuchsen um 1,7 % auf 6,8
Milliarden Euro.
Die meisten Importe
kamen im Januar 2025 aus der Volksrepublik
China. Von dort wurden kalender- und
saisonbereinigt Waren im Wert von 12,9
Milliarden Euro eingeführt. Das waren 2,8 %
weniger als im Vormonat. Die Importe aus den
Vereinigten Staaten stiegen um 6,5 % auf 8,0
Milliarden Euro. Die Importe aus dem Vereinigten
Königreich nahmen im gleichen Zeitraum um 18,8 %
auf 3,6 Milliarden Euro zu.
Die Exporte
in die Russische Föderation stiegen im Januar
2025 gegenüber Dezember 2024 kalender- und
saisonbereinigt um 7,2 % auf 0,6 Milliarden
Euro, gegenüber Januar 2024 nahmen sie um 9,3 %
ab. Die Importe aus Russland sanken im Januar
2025 gegenüber Dezember 2024 um 15,7 % auf 0,1
Milliarden Euro, gegenüber Januar 2024 nahmen
sie um 37,7 % ab.
Dienstag, 11.
März 2025
Moers: Stromunterbrechung
nach Softwareproblem
In Teilen von
Moers und Neukirchen-Vluyn kam es am
Montagmorgen zu einem kurzzeitigen Stromausfall.
Kleine Ursache, große Wirkung: Bei einem
routinemäßigen Softwareupdate für die
automatisierte Steuerungsanlage des Stromnetzes
der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein (Enni) ist
es am Montagmorgen in Teilen von Moers und
Neukirchen-Vluyn zu einer kurzzeitigen
Stromunterbrechung gekommen.
Wie
Jörn Rademacher als zuständiger Leiter des
Stromnetzbetriebs der Enni mitteilte, hätten
hierdurch um Punkt 9 Uhr insgesamt 26 der 130 im
Netzgebiet verteilten sogenannten
Leistungsschalter in den fünf Umspannanlagen
ausgelöst.
Folge: Auf den hierüber
gesteuerten Versorgungsstrecken waren rund
15.000 Haushalts- und Gewerbekunden für einige
Minuten spannungslos. Der zuständige
Elektrotechniker nahm daraufhin das neue
Softwareprogramm wieder vom Netz und schaltete
die Bereiche wieder manuell zu.
Während alle Kunden um 9:14 Uhr wieder versorgt
waren, läuft für Rademachers Team aktuell die
Störungssuche. „Ein solcher fehlerhafter
Schaltvorgang ist bislang noch nicht
aufgetreten“, sagt der Elektroingenieur. „Wir
werden die Software jetzt sehr gründlich mit dem
Hersteller testen, bevor wir sie erneut
einsetzen. Für die kurzzeitige
Stromunterbrechung entschuldigen wir uns bei den
betroffenen Kunden.“
Wesel:
11. März – Nationaler Gedenktag für die Opfer
terroristischer Gewalt – Stadt hängt Flaggen auf
halbmast
Die Bilder des Krieges entsetzen viele Menschen.
Jede Form der Gewalt ist abscheulich. Leider hat
es in den vergangenen Jahren auch terroristische
Gewaltakte gegeben, bei denen Menschen ums Leben
gekommen sind, so unter anderem bei einem
gewerkschaftlichen Demonstrationszug in München.
Ein Mann steuerte ein Auto gezielt in eine
Menschen-Ansammlung. Dabei kamen eine Mutter und
ihr zweijähriges Kind ums Leben.

Die Bundesregierung hat am 16. Februar 2022
beschlossen, jährlich am 11. März den
„Nationalen Gedenktag für die Opfer
terroristischer Gewalt“ zu begehen. Vor diesem
Hintergrund wird am 11. März 2025 die
Trauerbeflaggung in Wesel angeordnet. Unter
anderem werden Flaggen am Rathaus auf halbmast
gehisst.
Die Stadt Wesel begrüßt
ausdrücklich diesen Beschluss. Zudem hisst die
Stadt Wesel seit drei Jahren die Friedensflagge
mit der berühmten „Friedenstaube“ von Pablo
Picasso. So setzt die Stadt Wesel ein Zeichen
für den Frieden, die Freiheit und eine tolerante
Gesellschaft.
Starkes
Signal für ein sauberes Moers
Rund 1.000
Freiwillige beteiligen sich am Abfallsammeltag
Die Verpackung des Schokoriegels, die
Getränkeflasche oder die Zigarettenkippe: Es
sind die achtlos weggeworfenen Abfälle, die sich
in den Hecken, an den Bürgersteigen oder an den
Wegrändern in Parks sammeln. Mit dem
Abfallsammeltag sensibilisiert die ENNI Stadt &
Service Nieder-rhein (Enni) einmal pro Jahr für
das Problem und lädt alle Moerserinnen und
Moerser dazu ein, ein starkes Signal für mehr
Stadtsauberkeit zu setzen. So fand am zweiten
Samstag im März die 19. Auflage des Aktionstags
im Rahmen der Initiative „Sauberes Moers“ statt.

„Wir haben erneut rund 1.000 Helferinnen und
Helfer für den Abfallsammeltag gewinnen können“,
freut sich Claudia Jaeckel, die die Aktion bei
der Enni seit Jahren organisiert, über den
erneut großen Zuspruch. „Be-sonders schön ist,
dass sich auch viele Familien mit Kindern
angemeldet haben.“ Denn was bei dem
Abfallsammeltag so alles in den Mülltüten
landet, wäre zum größten Teil vermeidbar –
sofern von klein auf die Einstellung vermittelt
wird, auf Sauberkeit zu achten.
Neben
Einzelpersonen, Familien und Nachbarschaften gab
es auch in diesem Jahr wieder rund zehn Schulen
und Kitas, regionale Unternehmen und weitere
Gemeinschaften, die sich in der Woche vor und
nach dem Abfallsammeltag an der Aktion
beteiligen.
Beispielsweise sammelten die
Angler-Interessengemeinschaft „Rheinpreußen“
Rheinkamp-Meerbeck e.V. (AIG) mit den Freien
Schwimmern Rheinkamp rund um den Waldsee am
Baerler Busch, der Lions Club in
Moers-Schwafheim am Bergsee, der Förderverein
Streichelzoo rund um den Streichelzoo, der TV
Kapellen rund um die Sportanlage Lauersforter
Straße sowie die Omas und Opas for Future im
Ortskern Kapellen. Sie alle erhielten von der
Enni ausrei-chend Handschuhe und Müllsäcke sowie
die Zusage, dass Enni-Mitarbeiter den
gesammelten Müll an vorab vereinbarten
Ablageorten abholen.

Am Enni-Sportpark Rheinkamp beteiligten sich
unter anderem die stellver-tretende Moerser
Bürgermeisterin Claudia van Dyck, Enni-Vorstand
Lutz Hormes, sowie weitere Vertreter aus der
kommunalen Politik an der Akti-on. Für
Kopfschütteln sorgten hier beispielsweise
unzählige Zigaretten-kippen, obwohl große
Aschenbecher in erreichbarer Nähe liegen. Noch
größer ist das Kopfschütteln bei Sperrgut wie
Gartenstühlen, dem Deckel einer Auflagenbox oder
auch Autoreifen, Möbeln oder Bauschutt, die an
anderen Stellen in Moers auftauchten. „Das ist
alles andere als ein Kava-liersdelikt“, ärgert
sich Claudia Jaeckel. „Es ist eine
Ordnungswidrigkeit, die Bußgelder nach sich
zieht, sofern wir die Verursacher ermitteln
können.“
Gerade in Gebieten wie dem
Baerler Busch kommt es immer wieder zu Funden
von Sperrgut. Das nur schlecht einzusehende
Gebiete lädt offen-sichtlich dazu ein, in Nacht
und Nebel den Müll dort abzuladen.
Unverständlich, wie Claudia Jaeckel betont:
„Sperrmüll wie Möbel kann man kostenfrei zuhause
abholen lassen. Man muss nur einen Termin
vereinbaren. Und das meiste an sonstigem Müll
kann man ebenfalls kostenfrei am
Kreislaufwirtschaftshof abgeben“, sagt Jaeckel.
„Wenn es ohnehin bereits ins Auto verladen
wurde, wäre der Weg dorthin weitaus besser als
der in die freie Natur.“
Insgesamt kamen
beim 19. Abfallsammeltag wieder rund fünf Tonnen
an Unrat zusammen. So ist das Resümee der
diesjährigen Aktion positiv. „Die hohe Zahl an
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigt uns immer
wieder, dass vielen die Stadtsaubereit am Herzen
liegt“, so Claudia Jaeckel. Und was man nie
vergessen dürfe: „Die meisten Moerserinnen und
Moerser verhalten sich richtig.“
Moerser Frühling: Es gibt noch freie
Standplätze auf der Kindertrödelmeile
Beim Stadtfest „Moerser Frühling“ dürfen auf der
Kindertrödelmeile ausschließlich Kindersachen
angeboten werden.

(Foto: Bettina Engel-Albustin/Moers Marketing)
Das Stadtfest „Moerser Frühling“ mit
verkaufsoffenem Sonntag lädt am 06. April wieder
zum frühlingshaften Stöbern, Einkaufen, Genießen
und geselligen Beisammensein in die Moerser
Innenstadt ein. Auch in diesem Jahr gibt es auf
der Homberger Straße von 13-18 Uhr eine quirlige
Kindertrödelmeile, auf der Klein und Groß nach
Herzenslust stöbern können.
Die zu
kurze Matschhose, das zu klein gewordene Fahrrad
oder die unbeliebten Spielsachen finden an
diesem Sonntag ein neues Zuhause und füllen
zusätzlich die Sparschweinchen auf. Wer noch
einen Standplatz auf der Kindertrödelmeile haben
möchte, hat aktuell noch die Chance dazu: Unter www.moers-marketing.de/moerser-fruehling-moerser-herbst/ können
sich Interessierte durch Ausfüllen des
Bewerbungsformulars einen der kostenlosen
Trödelplätze während des Stadtfestes sichern.
Alternativ kann man sich per Mail
unter Angabe des Vor- und Zunamens, einer
Telefonnummer sowie einer E-Mail-Adresse an event@moers-marketing.de wenden. Wichtig
ist: Es dürfen ausschließlich Kindersachen
angeboten werden!
Stadtteilbüro Neu_Meerbeck: Polizei berät am 18.
März
Beratungen und Tipps zu
unterschiedlichsten Themen bietet
Polizeihauptkommissar Jochen Schaten am
Dienstag, 18. März, im Stadtteilbüro
Neu-Meerbeck an. Von 15 bis 16 Uhr ist er an der
Bismarckstraße 43b zu Gast. Interessierte
Bürgerinnen und Bürger aus Meerbeck und
Hochstraß sind herzlich eingeladen.
Rückfragen und weitere Informationen sind
telefonisch unter 0 28 41/201 – 530 und online
unter stadtteilbuero.meerbeck@moers.de möglich.
Mit Top-Leistungen in der Ausbildung
ab ins Studium IHK und Uni informieren über
neues Programm
Abitur in der
Tasche – und jetzt? Viele Jugendliche wissen
nach der Schule nicht, ob eine Ausbildung oder
ein Studium das richtige für sie ist. Mit dem
Bildungsprogramm „UNI on TOP“ können sie im
Bereich BWL die Vorteile beider Wege
kombinieren. Am 19. März informiert die
Niederrheinische IHK gemeinsam mit der
Universität Duisburg-Essen und sechs
Berufskollegs über das Projekt.
Klingt
zunächst nach dualem Studium, ist es aber nicht:
„UNI on TOP“ richtet sich an Azubis mit
exzellenten Leistungen. Das Studium beginnt
erst, wenn sie in ihrer Ausbildung Fuß gefasst
haben. Dann haben sie die Möglichkeit, neben der
regulären Ausbildung Vorlesungen an der
Hochschule zu besuchen. Flexibel und ohne
Risiko. Und sie können sich Leistungen aus der
Berufsschule für die Uni anrechnen lassen.
„Das Programm eröffnet jungen Menschen neue
Karrierechancen. Sie sind praktisch und
akademisch top ausgebildet. Eine Kombination,
die auf dem Arbeitsmarkt gerne gesehen ist“,
sagt Matthias Wulfert, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen IHK.
Wanja von der Goltz, Studiendekan der Mercator
School of Management der Universität
Duisburg-Essen, ergänzt: „Ausbildung und Studium
müssen keine Gegensätze sein. Sie können perfekt
miteinander kombiniert werden. Mit ‚UNI on TOP‘
bieten wir eine flexible Lösung, die der Praxis
gerecht wird.“
Praxisnah studieren
– flexibel und zukunftsorientiert Mit „UNI ON
TOP“ gewinnen junge Talente doppelt: Sie sammeln
wertvolle Berufserfahrung und studieren
gleichzeitig an einer renommierten Universität.
Im Optimalfall sind so zwei Abschlüsse innerhalb
von vier Jahren möglich.
Am 19.
März erfahren interessierte Azubis sowie
Ausbildungsbetriebe in der Universität
Duisburg-Essen (Campus Duisburg), wie sie eine
kaufmännische Ausbildung mit einem Studium der
Betriebswirtschaftslehre verbinden können.
Für Informationen zur Anmeldung können sich
Interessenten an Lars Waldöfner (waldoefner@niederrhein.ihk.de)
wenden.
Moers: Saxophon zum
Ausprobieren am 22. März
Interessierte können am Samstag,
22. März, von 11 bis 13 Uhr in der Moerser
Musikschule (Filder Straße 126) unter
professioneller Anleitung dem Saxophon erste
Töne entlocken. Die Dozentin Mari Ángeles del
Valle möchte gerne die Begeisterung für ihr
Instrument weitergeben.
Sie selbst hat
im Alter von acht Jahren begonnen und ist
mittlerweile nicht nur an der Moerser
Musikschule, sondern auch an der Musikhochschule
Köln tätig.

Darüber
hinaus ist sie im In- und Ausland als
herausragende Interpretin gefragt. Interessierte
können sich telefonisch in der Moerser
Musikschule unter 0 28 41 / 13 33 anmelden oder
spontan vorbeikommen. Treffpunkt ist im Haus
Rheinland, Raum 02, auf dem Gelände der
Musikschule.
Stadtwerke Dinslaken Energy Run in der heißen
Vorbereitungs-Phase
Bürgermeisterin
Michaela Eislöffel gab mit Vertretern der
organisierenden Vereine und der Unterstützer
eine Pressekonferenz zum Laufevent beim
Hauptsponsor Stadtwerke Dinslaken. Einen Monat
vor dem Stadtwerke Dinslaken Energy Run steigt
die Vorfreude bei den ausrichtenden Vereinen SuS
09 und Marathon Dinslaken, bei der Stadt
Dinslaken und bei den Unterstützern, allen voran
dem Hauptsponsor Stadtwerke Dinslaken.
Die Vertreter aller Beteiligten, darunter
der Vorsitzende von SuS 09 Arndt Jarosch und
Markus Kuhlmann, ebenfalls SuS 09, die
Vorsitzende von Marathon Dinslaken Petra Pelzer
sowie Britta Bethe, Abteilungsleiterin Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit, Vertriebssteuerung
beim Hauptsponsor Stadtwerke Dinslaken,
informierten in einer Pressekonferenz im Alten
Gaswerk der Stadtwerke im Beisein von
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel über den
Stand der Vorbereitungen für das Laufevent am
Sonntag, 6. April, sowie über die Entwicklung
der Teilnehmerzahlen.
„Die
Vorbereitungen für den Energy Run 2025 laufen
derzeit auf Hochtouren. Gemeinsam mit Marathon
Dinslaken haben wir erneut eine Topveranstaltung
geplant, welche die besten Bedingungen für alle
LäuferInnen und Läufer bieten wird. Ein
absolutes Highlight hier bei uns am Niederrhein,
welches auch anspruchsvolle Läufer
zufriedenstellen wird,“ so der erste Vorsitzende
des SuS 09 Arndt Jarosch.
„Der SuS
09 setzt dabei erneut eine erhebliche Anzahl an
ehrenamtlichen Helfenden ein, um allen
Anwesenden einen unvergleichlichen Tag zu
bescheren, so dass unisono gesagt werden kann:
Dinslaken und der Energy Run sind eine Reise
wert.“
Der Stadtwerke Dinslaken Energy
Run in Zahlen
Aktuell
(Stand 6. März, 12 Uhr), haben sich 1.777
Läuferinnen und Läufer für den Stadtwerke
Dinslaken Energy Run angemeldet. Damit ist noch
nicht die Zahl von 2.170 Teilnehmenden vom
letzten Jahr erreicht, aber die Anmeldefrist
geht auch erst jetzt in die heiße Phase. Die
Organisatoren sind zuversichtlich, dass der
Stadtwerke Dinslaken Energy Run 2025 mit ähnlich
hoher Beteiligung wie 2024 abschließen wird.
Anmeldungen sind noch bis einschließlich 23.
März online über www.taf-timing.de/dinslaken2025 möglich.
„Unser Energy Run ist auch in 2025 ein
Sporthighlight in Dinslaken, vor allem die
kleinen Läuferinnen und Läufer sind in großer
Anzahl am Start“, so Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel.
Die Firmen Gold Michels und
Sport Birkner verlosen in diesem Jahr erstmalig
unter allen Läufer*innen des Haupt- und des
Volkslaufes, die das Ziel erreichen, jeweils
eine von drei Garmin fenix 8 Smart Watches oder
ein von zwei hochwertigen Laufschuh-Paaren nach
Wahl – unabhängig von der Platzierung. Allein
die erfolgreiche Teilnahme zählt.
Die Sponsoren Marc Hellmich, Toni Bienemann,
Bernhard Riedel sowie Vanessa Kupke von Life Fit
drückten durch ihre Anwesenheit bei der
Pressekonferenz ihre Verbundenheit zum
Stadtwerke Dinslaken Energy Run aus. Marc
Kriesten von den Top-Apotheken war leider
verhindert, sprach aber allen Beteiligten
ausdrücklich seine volle Unterstützung aus.
„Nun sind es noch vier Wochen bis zum
Energy Run, der immer noch die erfolgreichste
Einzellaufveranstaltung in der Region ist und
ohne die Unterstützung der vielen Sponsoren,
insbesondere der Stadtwerke Dinslaken und der
Stadt Dinslaken nicht zu stemmen wäre“, so die
Vorsitzende von Marathon Dinslaken Petra
Pelzer.
„Meinen besonderen Dank
möchte ich in diesem Jahr an alle Helfer von
Marathon Dinslaken und SUS 09 richten. Danke,
dass ihr so hinter dieser Laufveranstaltung
steht! Die Endphase hat begonnen und damit eine
spannende Zeit, auf die ich mich sehr freue.“
Ein Dank, dem sich auch Bürgermeisterin
Michaela Eislöffel anschließt: „„Ich danke den
Ehrenamtlichen und den Sponsoren für ihren
unermüdlichen Einsatz für den Sport. Allen
Teilnehmenden von nah und fern wünsche ich
Erfolg und drücke fest die Daumen.“
Das Ordnungsamt und der DIN-Service
sind ebenfalls involviert. Sie sorgen schon Tage
im Voraus und bei der sonntäglichen
Veranstaltung selbst für die Absperrung der
Strecke rund durch die Dinslakener Altstadt.
Stadtwerke Dinslaken loben
erneut Schulpreise aus
Kinder und
Jugendliche zu mehr Fitness und Teamgeist
animieren: Dafür loben die Stadtwerke Dinslaken
spezielle Schulpreise von je 100 Euro für die
jeweils teilnehmerstärksten Klassen der Stufen 2
bis 8 aus. Bislang haben sich 529 (Stand 05.03.)
Schülerinnen und Schüler angemeldet, im Vorjahr
waren es insgesamt 674.
Da die
Anmeldefrist erst am 23. März endet, kann die
Teilnahmezahl von 2024 noch erreicht werden. Die
Schulpreise für den Stadtwerke Dinslaken Energy
Run sind wie die Auszeichnungen für Grundschulen
beim Stadtradeln oder auch die Ausrichtung des
Stadtwerke Dinslaken Energy Splash im DINamare
ein Anreiz, Kinder und Jugendliche zu
sportlicher Betätigung zu animieren. Mehr Infos
zu den Läufen:
stadtwerke-dinslaken.de/sd/energy-run
Moers: Französische Klänge bei der
diesjährigen Benefizmatinee am 30. März
Wer am Sonntag, 30. März, bei der Benefizmatinee
des Inner Wheel Club (IWC) im Kammermusiksaal
der Musikschule ab 11.30 Uhr (Einlass ab 11 Uhr)
gerne dabei sein möchte, sollte sich zügig eine
der restlichen Karten besorgen.

Freuen sich gemeinsam auf die 8. Benefizmatinee
des Inner Wheel Clubs Moers und der Musikschule
am 30. März: Musikschulleiter Georg Kresimon,
Marlies Stark (IWC), Saxophonistin Mari Ángeles
del Valle, Evelyn Cillis (IWC), Pianistin Bonju
Lee, Ulla Schaller (IWC) und die
stellvertretende Musikschulleiterin Ulrike
Schweinfurth. (Foto: Pressestelle)
„Die
Matinee ist stark gefragt und hat inzwischen ihr
Stammpublikum, so dass es nicht mehr allzu viele
Karten gibt“, freut sich die stellvertretende
Leiterin der Musikschule, Ulrike Schweinfurth.
Das musikalische Programm besteht in diesem Jahr
überwiegend aus französischer Musik, unter
anderem von Frédéric Chopin, Eugéne Bozza und
François Borne. Es ist mittlerweile die 8.
Benefizmatinee und seit sieben Jahren laden die
Moerser Musikschule und der Inner Wheel Club
Moers gemeinsam dazu ein.
Hochkarätige Musikerinnen
Im ersten
Programmteil präsentieren sich die Saxophonistin
Mari Ángeles del Valle und die Pianistin Bonju
Lee von der Musikschule. Del Valle hat ein
Hochschulstudium am Conservatorio Superior de
Música Manuel Castillo in Sevilla abgeschlossen
und ist seit zwei Jahren neben ihrer
Musikschultätigkeit Dozentin an der Hochschule
für Musik und Tanz in Köln.
Die
Pianistin Lee hat an der Musikhochschule in
Detmold und der Hochschule für Musik Saar
studiert. Sie konnte bereits im letzten Jahr das
Matineepublikum gemeinsam mit ihrem Mann in
Moers begeistern.
Beide Musikerinnen
verzichten auf ihre Gage, die dem Förderkreis
der Moerser Musikschule zugutekommt. Den zweiten
Matinee-Teil bestreiten Schülerinnen und Schüler
aus der Begabtenförderung.
Besonderes Buffet vom Inner Wheel Club
Ebenso besonders wie die musikalischen Klänge
wird auch das Buffet an diesem Tag sein. Die
Damen vom Inner Wheel Club bieten wieder
passendes Fingerfood an – nun mit einer
französischen Note. „Wir möchte unser
Buffet-Angebot diesmal noch erweitern“, kündigen
die Clubmitglieder Evelyn Cillis und Ulla
Schaller an. Und Marlies Stark ergänzt: „Wir
sind jedes Jahr mit Freude dabei und arbeiten
für das Ehrenamt aus sozialem Engagement
heraus.“ Und auch Musikschulleiter Georg
Kresimon ist für die Unterstützung dankbar.
„Der Einsatz des IWC ist für uns immens
wichtig, denn neben dem finanziellen Aspekt
zeigt er auch, wieviel Wertschätzung unsere
Arbeit erfährt.“ Die wenigen Restkarten sind zum
Preis von 29 Euro bei der Moerser Musikschule,
Filder Straße 126, erhältlich (Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Mittwoch von 13 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 13
Uhr).
Der Niederrhein auf
der ITB: Digitalisierung und Natur-Erlebnisse
Die Megatrends Digitalisierung und
Nachhaltigkeit haben den Auftritt der
Niederrhein Tourismus GmbH (NT) auf der ITB
Berlin bestimmt. Am Stand von Tourismus NRW
konnte sich die Region Anfang März dem
interessierten Fachpublikum auf der
Internationalen Tourismus-Börse präsentieren.
Dabei ging es unter anderem um die
Digitalisierung des Verleihsystems
NiederrheinRad: Die rund 300 Räder sind nun mit
modernen Schlössern ausgestattet, um per App
nicht nur gebucht, sondern auch sofort genutzt
werden zu können. „Außerdem haben wir uns mit
den Anbietern der WELCMpass-App getroffen, um
weitere Details zur digitalen
Niederrhein-Gästecard zu besprechen“, berichtet
NT-Geschäftsführerin Martina Baumgärtner, die
gemeinsam mit Prokuristen Nina Jörgens in Berlin
war.
Die neue Gästecard soll ab
August dieses Jahres erhältlich sein und den
Nutzern viele Vergünstigungen bringen, etwa beim
Besuch von Freizeiteinrichtungen. Der lokale und
regionale Einzelhandel soll sich ebenfalls
einbringen und so profitieren können. „Auf der
ITB wurde einmal mehr deutlich, dass in der
Digitalisierung die Zukunft liegt. Daher werden
wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit allen
Partnern weiterverfolgen“, so Baumgärtner.
Deutlich spürbar war die Nachfrage nach
nachhaltigen Outdoor-Angeboten. Gerade im
Bereich „Rad und Wandern in der Natur“, den zwei
großen touristischen Schwerpunkten am
Niederrhein, ist das Interesse groß. „Auch in
diesem Kontext können wir – als Unteraussteller
bei Tourismus NRW – diese wichtige Messe als
Erfolg verbuchen“, sagt Nina Jörgens.
Konkret gab es unter anderem Termine mit den
Paketreiseveranstaltern Scherzer aus Bayern und
Service-Reisen aus Hessen. Zur verstärkten
Vermarktung der Region wurden ebenfalls
Gespräche geführt, etwa mit Fach- und
Publikumsmedien mit großen Reichweiten.

Der Niederrhein Tourismus (NT) präsentierte sich
am NRW-Stand auf der ITB. v.l.: Nina Jörgens
(NT), Silke Krebs, Staatssekretärin im
NRW-Ministerium für Wirtschaft, Industrie,
Klimaschutz und Energie, Martina Baumgärtner
(NT), Alexandra Fuchs (Neuss Marketing) und Dr.
Heike Döll-König (Tourismus NRW). Foto:
Tourismus NRW e.V. / Bildschön

NRW-Azubis: Fast 37 Prozent aller neuen
Ausbildungsverträge wurden 2023 in MINT-Berufe
abgeschlossen
Ein immer größerer
Anteil der neuen Auszubildenden wählt einen
MINT-Beruf. Wie das Statistische Landesamt
mitteilt, wurden 36,8 Prozent aller neuen
Ausbildungsverträge 2023 in einem Beruf in den
Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik abgeschlossen.
Vor zehn Jahren hatte der Anteil der
MINT-Azubis an allen neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen noch bei 30,4 Prozent
gelegen. Auch die Anzahl der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge stieg in diesem Bereich von
35 103 im Jahr 2014 auf 39 033 im Jahr 2023
(+11,2 Prozent). Im Vergleich dazu ist die
Gesamtzahl neuer Ausbildungsverträge im selben
Zeitraum von 115 419 auf 106 095 zurückgegangen
(−8,1 Prozent).
Rund zehn Prozent
der MINT-Azubis waren weiblich
Von den über
39 000 neuen Ausbildungsverträgen in
MINT-Berufen im Jahr 2023 wurden 10,2 Prozent
von Frauen abgeschlossen (3 975 Neuabschlüsse)
und 89,8 Prozent von Männern (35 061
Neuabschlüsse). Zum Vergleich: Bei den
Neuabschlüssen im dualen System insgesamt lag
der Frauenanteil 2023 bei 34,8 Prozent.
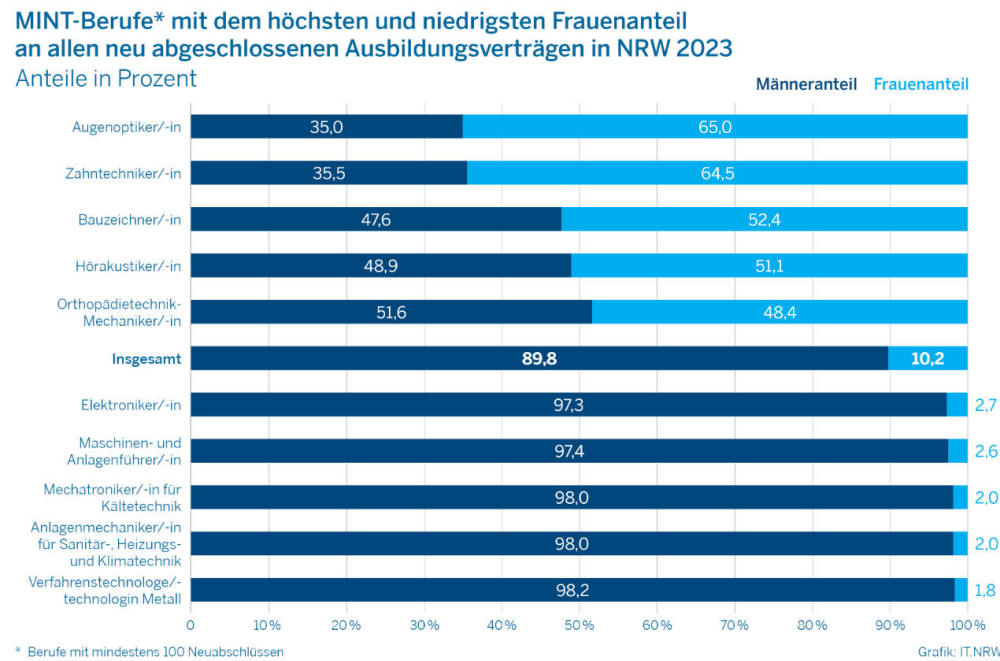
Höchster Frauenanteil im
Ausbildungsberuf Augenoptiker/-in
Mit einem
Frauenanteil von 65,0 Prozent war der Beruf
Augenoptiker/-in im Jahr 2023 der MINT-Beruf mit
den anteilig meisten weiblichen Auszubildenen an
allen Neuabschlüssen, gefolgt von den Berufen
Zahntechniker/-in (64,5 Prozent) und
Bauzeichner/-in (52,4 Prozent). Männer waren am
stärksten in den MINT-Berufen
Verfahrenstechnologe/-technologin Metall
(98,2 Prozent), Anlagenmechaniker/-in für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie
Mechatroniker/-in für Kältetechnik (jeweils
98,0 Prozent) vertreten.
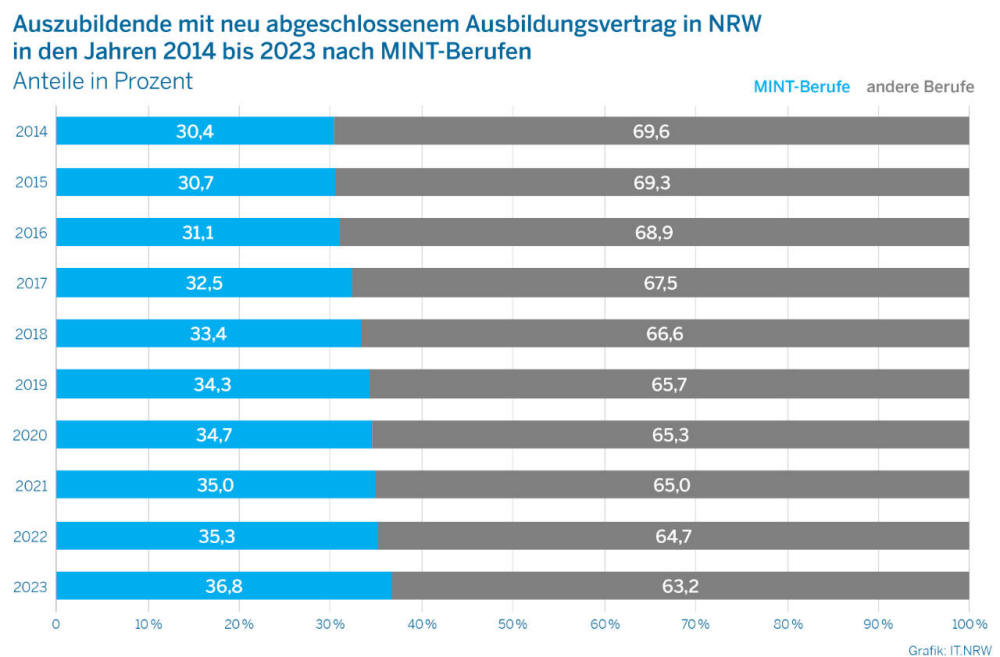
NRW: 12,6 Prozent weniger
Krankenhausbehandlungen von Kindern und
Jugendlichen aufgrund psychischer Erkrankungen
als vor Beginn der Corona-Pandemie
Im Jahr 2023 wurden 20 354 Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren aus
Nordrhein-Westfalen aufgrund von psychischen und
Verhaltensstörungen in Krankenhäusern behandelt.
Wie das Statistische Landesamt mitteilt, lag die
Zahl dieser Behandlungsfälle damit um
12,6 Prozent niedriger als 2019. 61,8 Prozent
der behandelten Kinder und Jugendlichen waren
Mädchen.
Nachdem die Behandlungen
wegen psychischer Erkrankungen 2020, im ersten
Jahr der Corona-Pandemie, um 14,8 Prozent
gegenüber dem Vorjahr gesunken waren, stiegen
sie 2021 um 10,3 Prozent an. In den Jahren 2022
und 2023 fiel die Fallzahl wieder um 5,2 Prozent
bzw. 2,0 Prozent. Der Anstieg der
Krankenhausbehandlungen aufgrund psychischer
Erkrankungen im Jahr 2021 bestand ausschließlich
aus Behandlungsfällen von weiblichen Kindern und
Jugendlichen: Sie waren gegenüber 2020 um
18,2 Prozent angestiegen, während die männlichen
Behandlungsfälle mit −0,3 Prozent nahezu
unverändert blieben.
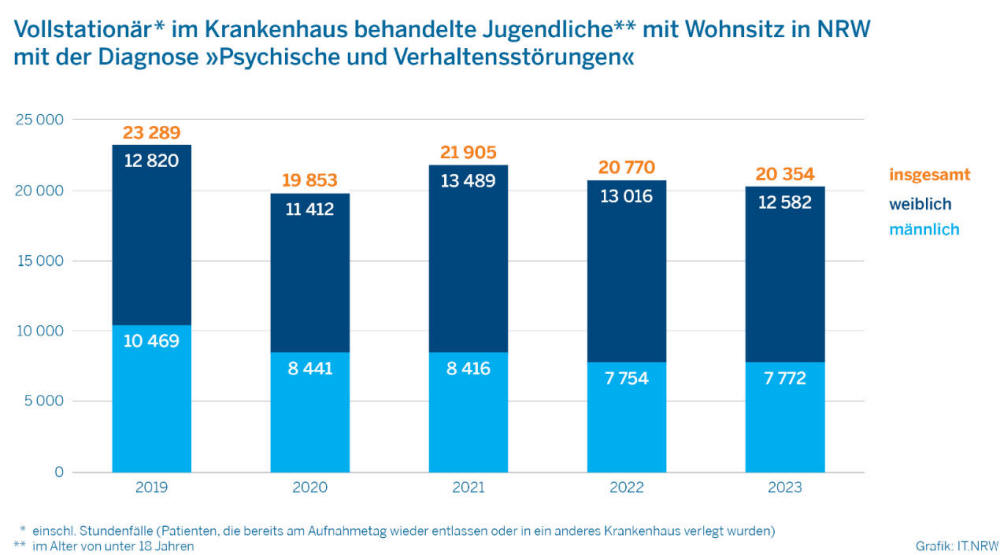
Häufigste Diagnose war die depressive
Episode – stärkerer Anstieg als bei psychischen
Behandlungsfällen insgesamt Im Jahr 2023 wurden
24,5 Prozent mehr Kinder und Jugendliche
aufgrund einer depressiven Episode im
Krankenhaus behandelt als im Jahr 2019. Damit
stieg die Fallzahl depressiver Episoden in
diesem Zeitraum stärker als die Behandlungsfälle
aufgrund psychischer Erkrankungen insgesamt
(+12,6 Prozent).
Mit 5 556 Fällen im
Jahr 2023 war die depressive Episode wie in den
Jahren zuvor die am häufigsten gestellte
Einzeldiagnose unter den im Krankenhaus
behandelten psychischen Erkrankungen von Kindern
und Jugendlichen. Mit diesem Krankheitsbild
wurden überwiegend Mädchen behandelt
(80,6 Prozent). Knapp ein Fünftel der aufgrund
depressiver Episoden behandelten Patientinnen
und Patienten (19,0 Prozent) war noch keine
14 Jahre alt.
Anstieg bei
Essstörungen – Rückgang bei Behandlungen
aufgrund von Alkohol und Störung des
Sozialverhaltens
Die Zahl der
Krankenhausbehandlungen von Kindern und
Jugendlichen mit Essstörungen ist mit 1 305
Fällen im Jahr 2023 gegenüber dem Vor-Coronajahr
2019 um 54,6 Prozent gestiegen. Damit fiel die
Fallzahlsteigerung dieser Erkrankung stärker aus
als bei den psychischen Behandlungsfällen von
Kindern und Jugendlichen insgesamt. Nach einem
Anstieg um 59,4 Prozent von 2020 auf 2021 sanken
die Behandlungsfälle danach wieder um insgesamt
9,1 Prozent.
Die Zahl der
Behandlungsfälle aufgrund von Psychischen und
Verhaltensstörungen durch Alkohol hat sich in
2023 mehr als halbiert gegenüber 2019
(−57,0 Prozent). Krankenhausbehandlungen mit der
Hauptdiagnose „Kombinierte Störung des
Sozialverhaltens und der Emotionen” gingen in
diesem Zeitraum um 43,4 Prozent zurück.
Höchste Fallzahl psychischer
Krankenhausbehandlungen je 100 000 Kinder und
Jugendliche im Kreis Paderborn
Regional
betrachtet gab es die höchsten Anteile der
Behandlungsfälle aufgrund von psychischen und
Verhaltensstörungen bei unter 18-Jährigen an der
gleichaltrigen Bevölkerung 2023 für Patientinnen
und Patienten aus dem Kreis Paderborn mit 1 040
Fällen je 100 000 Minderjährigen.
Es folgen
die Kreise Recklinghausen (1 012) und Unna
(1 006). Die niedrigsten Fallzahlen wurden für
den Kreis Minden-Lübbecke (417), Gütersloh (419)
und den Kreis Düren (428) ermittelt. Im
Landesdurchschnitt lag die Zahl bei 651
Behandlungsfällen je 100 000 Kinder und
Jugendliche.
Montag, 10. März 2025
|
|
Brut- und
Setzzeit: Leinenpflicht bitte einhalten
Im März hat die sogenannte Brut- und
Setzzeit begonnen. Die Stadt Moers bittet
Hundehalterinnen und –halter deshalb, besonders
gut auf die Leinenpflicht zu achten. Sie gilt
für die Innenstadt und verschiedene Grünflächen
im Stadtgebiet, wie z. B. den Schloss- und
Freizeitpark oder den Jungbornpark.
Im Außenbereich und auf Waldwegen ist es Hunden
erlaubt, frei im Einflussbereich der Halterin
oder des Halters zu laufen. Aber auch dort
dürfen sie keine anderen Tiere stören oder
jagen. Das Bundesnaturschutzgesetz regelt
außerdem einheitlich, dass in der Zeit vom 1.
März bis zum 30. September Bäume, Hecken,
lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze nicht
abgeschnitten oder beseitigt werden dürfen.
Niederrhein: Platz unter den Top
10: Februar 2025 war warm und sehr trocken -
Monatliche hydrologische Auswertung von
Emschergenossenschaft und Lippeverband
Auf
einen sehr nassen Januar folgte ein sehr
trockener Februar: In beiden Verbandsgebieten –
sowohl im Einzugsbereich der
Emschergenossenschaft als auch des
Lippeverbandes – erreicht der Februar 2025 Platz
6 unter den 10 trockensten Februarmonaten seit
1931. Das ist das Ergebnis der monatlichen
hydrologischen Auswertung der beiden regionalen
Wasserwirtschaftsverbände.
Im
Emscher-Gebiet fielen im Gebietsmittel nur 12,1
mm Niederschlag (1 mm = 1 Liter pro
Quadratmeter). Das 130-jährige Mittel für den
Februar liegt bei 56 mm. 17 der 28 Tage im
Februar waren komplett niederschlagsfrei. Die
Monatssummen im Genossenschaftsgebiet liegen
alle unter 20 mm.
Minimal waren es nur
9,7 mm an der Messstation in Dortmund-Kruckel,
maximal waren es 19,4 mm an der Station am
Pumpwerk Duisburg-Hülsermanngraben. Die maximale
Tagesmenge an Niederschlag fiel im
Emscher-Gebiet an der Station Pumpwerk
Herten-Resser Bach: Am 27. Februar 2025 regnete
es dort 6,8 mm innerhalb eines Tages.
Das Gebietsmittel im Gebiet des Lippeverbandes
liegt für den Februar 2025 bei 14,5 mm. Das
130-jährige Mittel für den Februar liegt dort
bei 53 mm. Im Verbandsgebiet waren 14 der 28
Tage niederschlagsfrei. Dort knacken die
maximalen Monatssummen jedoch die 20 mm knapp.
Minimal fielen im Lippe-Gebiet lediglich 7,3 mm
an der Station Kläranlage Soest.
Maximal waren es 23,0 mm
Niederschlag in einem Monat an der Station
Hünxe-Schacht Lohberg. Den maximalen
Tagesniederschlag im Lippeverbands-Gebiet
registrierte die Station Hünxe-Flugplatz am 26.
Februar 2025: An diesem Tag fielen dort 8,5 mm.
Das Monatsmittel der Lufttemperatur lag im
Februar 2025 mit 4,2 Grad (gemessen in Bochum)
über dem langjährigen Mittel, das bei 3,4 Grad
liegt.
Emschergenossenschaft und
Lippeverband
Emschergenossenschaft und
Lippeverband (EGLV) sind öffentlich-rechtliche
Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee
des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip
leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten
Emschergenossenschaft sind unter anderem die
Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung
und -reinigung sowie der Hochwasserschutz.
Der 1926 gegründete Lippeverband
bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe
im nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem
den Lippe-Zufluss Seseke naturnah um. Gemeinsam
haben Emschergenossenschaft und Lippeverband
rund 1.800 Beschäftigte und sind Deutschlands
größter Abwasserentsorger und Betreiber von
Kläranlagen und Pumpwerken (rund 782 Kilometer
Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle,
546 Pumpwerke und 59 Kläranlagen).
www.eglv.de
Stadt Wesel veröffentlicht neuen
Mietspiegel
Die Stadt Wesel hat
einen neuen Mietspiegel herausgegeben. Der
Mietspiegel informiert über die ortsübliche
Vergleichsmiete in Wesel. Mit Hilfe des
Mietspiegels kann ermittelt werden, wie hoch die
ortsübliche Miete für eine Wohnung mit
bestimmten Merkmalen ist. Zur Ermittlung der
Vergleichsmiete wurde eine repräsentative
Befragung durchgeführt. Dabei wurden unter
anderem die Größe, das Baujahr, verschiedene
Ausstattungsmerkmale und energetische Aspekte
sowie der Mietpreis der Wohnungen erhoben. Wer
den Mietspiegel einsehen möchte, kann diesen auf
der Homepage der Stadt Wesel unter www.wesel.de/mietspiegel kostenlos
herunterladen. Links
Mietspiegel
50 Jahre Kreis Wesel:
Wassersymposium
Am Donnerstag, 6.
März 2025, fand im Rahmen des Jubiläumsjahres
zum 50-jährigen Bestehen des Kreises Wesel von 9
bis 16.15 Uhr das Wassersymposium im Weseler
Kreishaus statt. Die Veranstaltung richtete sich
an wasserwirtschaftliche Organisationen und
Akteure aus der Region. Rund 170 Besuchende
waren der Einladung von Landrat Ingo Brohl
gefolgt.
„Auch hier im Kreis Wesel
wissen wir um die Bedeutung des Wassers – sei es
als Trinkwasser, für die Landwirtschaft, als
Lebensraum für Flora und Fauna oder für den
Hochwasserschutz,“ so Landrat Ingo Brohl in
seiner Begrüßungsrede. „Keiner kann die
Herausforderungen des Wassermanagements allein
bewältigen. Nur gemeinsam – Politik, Verwaltung,
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft –
können wir tragfähige Lösungen entwickeln.
Deshalb wünsche ich mir von diesem Symposium
einen offenen und konstruktiven Austausch.
Lassen Sie uns gemeinsam ein tieferes
Verständnis für Wasser entwickeln und Ideen für
eine nachhaltige Zukunft sammeln.“
Weihbischof Rolf Lohmann aus Xanten, in der
Deutschen Bischofskonferenz für Umweltfragen
zuständig, sagte in seinem Grußwort: „Wir müssen
neu lernen, in einem guten Verhältnis zu unserer
Umwelt zu leben. Die Folgen des
menschengemachten Klimawandels konnten lange
ignoriert werden. Nun aber spüren wir sie umso
drastischer.
Dabei geht es nicht nur um die
Natur als Selbstzweck. Denn wir profitieren ja
von den Leistungen, die ein fein austariertes
Ökosystem uns bietet. Gerät es unter Druck, wird
unser Leben mühsam – und auch teuer.
Mittlerweile kosten uns die Folgen des
Klimawandels und der Umweltverschmutzung jedes
Jahr Milliarden.
Aber ich möchte keine
Trübsal blasen. Es gibt vielversprechende
Ansätze: von der Renaturierung von Flüssen über
effektivere Methoden der Wassernutzung bis hin
zu innovativen Konzepten der Wasserspeicherung
wie den Schwammstädten. Und ich bin sehr
gespannt auf die heutigen Diskussionen.“

v.l. Henning Deters, Steffi Hain, Elke Reichert,
Prof. Dr. Ulrich Paetzel, Volker Kraska, Landrat
Ingo Brohl, Dr. Bernd Lüttgens
Die
von Radiomoderatorin Steffi Hain (Radio K.W.)
moderierte Veranstaltung startete mit einem
Interview von Vorstandsmitglied Helmut Czichy
und Dr. Christian Steenpaß, dem technischen
Leiter des Fachdienstes Umwelt bei der
Kreisverwaltung. Zum Thema „Kreis Wesel – eine
besondere Wasserregion“ erläuterten die beiden
Experten die Grundidee des Symposiums.
So soll das Wassersymposium dazu dienen, den
Menschen im Kreis Wesel die Bedeutung des
Wassers in ihrer Region auf unterhaltsame Weise
zu verdeutlichen. Dr. Christian Steenpaß: „Der
Niederrhein und damit auch der Kreis Wesel ist
seit jeher durch Wasser in all seinen Facetten
charakteristisch geprägt. Als
wasserwirtschaftlich besonders wichtige Region
in Nordrhein-Westfalen sind wir in der
glücklichen und nicht selbstverständlichen
Situation über Wasserreserven zu verfügen, die
auch mit Blick in die Zukunft eine sichere
Wasserversorgung möglich machen.
Gleichzeitig bringt der Niederrhein mit seinen
Kendeln und Donken sowie Landgräben und
Bruchgebieten landschaftliche Rahmenbedingungen
mit sich, deren wir uns gewahr sein und in die
wir uns als Menschen in unserem Handeln einfügen
müssen."
Helmut Czichy
ergänzte: "Ein besonders langes Stück des
Rheines verläuft durch unseren Kreis und prägt
ihn als Lebens- und Transportader. Dabei
außergewöhnlich sind die Geländesenkungen durch
den Kohle- und Salzbergbau, die mit die höchsten
Binnendeiche in Europa erforderlich gemacht
haben. In der Konsequenz besteht zugleich die
Aufgabe, enorme Mengen von hochwertigem
Grundwasser als Sümpfungswasser abzupumpen.
Ebenfalls prägend und relevant ist die große
Zahl und Fläche an Kiesbaggerseen. Insgesamt
braucht es hier ein gut abgestimmtes
Zusammenwirken der vielen verschiedenen
Institutionen und Akteure." Im Anschluss
erörterte Meteorologe und Radiomoderator Donald
Bäcker die Frage „Klimawandel – geht uns das
Wasser aus?“.
Bäcker ging auf die
Ursachen und Auswirkungen des menschengemachten
Klimawandels und dessen Einfluss auf
Heißwetter-Perioden und Dürren in Deutschland
ein. Nach einer gemeinsamen Mittagspause stand
das Thema „Wasser – Grundlage des gesunden
Lebens“ im Mittelpunkt des Auftritts von
Mediziner und Fernsehmoderator Dr. med.
Heinz-Wilhelm Esser, besser bekannt als Doc
Esser.

Doc Esser
Er erläuterte die
Notwendigkeit von regelmäßigem Trinken für die
Gesundheit des Menschen, denn zu wenig Wasser
mache krank. Selbst die menschlichen kognitiven
Fähigkeiten seien stark vom eigenen
Wasserhaushalt abhängig. Daher sei sauberes
Trinkwasser „sauwichtig“ für uns Menschen. In
der abschließenden Podiumsdiskussion behandelte
Landrat Ingo Brohl gemeinsam mit
Wasserwirtschaftsexperten aus der Region die
„Herausforderungen von heute und morgen“.
Elke Reichert,
Präsidentin des Landesamts für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz in NRW, Prof. Dr. Ulrich
Paetzel, Vorstandsvorsitzender
Emschergenossenschaft und Lippeverband, Volker
Kraska, Vorstand der
linksrheinischen Entwässerungsgenossenschaft
Lineg, Henning Deters, Vorstandsvorsitzender der
Gelsenwasser AG und Dr. Bernd Lüttgens
(Hauptgeschäftsführer des Rheinischen
Landwirtschaftsverbands) sprachen unter anderem
über den natürlichen Abfluss von
Oberflächengewässern, Starkregen- und
Dürreprävention, Renaturierung von Gewässern,
den Hochwasserschutz sowie die Sicherung der
Wasserversorgung und der Wasserqualität.
Dinslaken:
Machen Sie mit! Gemeinsam anpacken beim
Picobello Frühjahrsputz
Pünktlich
mit den ersten Sonnenstrahlen und den ersten
Blumen geht es in Dinslaken raus an die frische
Luft: Für den diesjährigen „Picobello“
Frühjahrsputz sucht die Stadt noch viele große
und kleine Helfer. Vom 22. bis 29. März 2025
findet die beliebte Müllsammelaktion statt, an
der sich in den vergangenen Jahren viele
Dinslakenerinnen und Dinslakener mit großem
Engagement beteiligt haben.

„Ich freue mich über jede helfende Hand, die
sich für unsere Natur und Umwelt stark macht.
Generationsübergreifend setzen sich bei dieser
Aktion Menschen dafür ein, unsere Stadt
gemeinsam sauberer und lebenswerter zu machen“,
so Bürgermeisterin Michaela Eislöffel. Sie lädt
alle Dinslakener*innen, Kindergärten, Schulen,
Vereine, Verbände, Nachbarschaften, Unternehmen
und sonstigen Organisationen und Gemeinschaften
herzlich dazu ein mitzumachen.
Bis zum
19. März 2025 können sich alle Interessierten
über die Homepage der Stadt Dinslaken
www.dinslaken.de (Stichwort „picobello“)
anmelden.
(https://www.dinslaken.de/stadt-buergerservice/dienstleistungen/picobello-muellsammelaktion).
Der konkrete Sammeltag im Aktionszeitraum und
der Sammelort sind frei wählbar, sofern es sich
um öffentliche Flächen der Stadt handelt oder
die Genehmigung des Grundstückseigentümers
beziehungsweise der Grundstückseigentümerin
vorliegt.
Die benötigten Sammelsäcke
werden von der Stadt Dinslaken gestellt,
Arbeitshandschuhe, Greifzangen und Warnwesten
auch, aber nur soweit verfügbar. Diese
Materialien müssen kurzfristig zurückgegeben
werden, um für andere wieder zur Verfügung zu
stehen.
Es wird empfohlen, festes
Schuhwerk, Handschuhe und eine Warnweste beim
Picobello-Einsatz zu tragen. Problemabfälle
dürfen nicht gesammelt werden. Beim Auffinden
von Altölkanistern, Autobatterien, ätzenden und
umweltgefährlichen Stoffen sollte der Fundort
dem DIN-Service gemeldet werden. Auch bei
scharfkantigen, spitzen oder schweren
Gegenständen ist Vorsicht geboten.
Rosenmontagszug 2025 in Kleve: Vielen
Dank für eine friedliche Party!
Gute
Laune, beste Stimmung und viel gegenseitige
Rücksichtnahme: Trotz vieler Unsicherheiten im
Vorfeld des Klever Rosenmontagszuges 2025 sowie
gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit
wurde in Kleve friedlich miteinander gefeiert.

Direkt im Anschluss an den Umzug am Montag traf
sich das Koordinierungsgremium des Umzuges zur
Abschlussbesprechung und Rückschau auf das
Einsatzgeschehen. Alle beteiligten Einsatz- und
Organisationskräfte – Klever
Rosenmontagskomitee, Polizei Kleve, Freiwillige
Feuerwehr Kleve, Umweltbetriebe der Stadt Kleve,
beteiligte Sanitätsdienste sowie die Stadt Kleve
– haben einhellig von einem friedlichen und
störungsfreien Umzug bei bester Feierlaune
berichtet. Insgesamt war das Einsatzaufkommen in
Kleve unauffällig und gering.
Im Namen
aller beteiligter Einsatz- und
Organisationskräfte möchten wir uns herzlich bei
allen Besucherinnen und Besuchern sowie allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das
hervorragende Miteinander bedanken! Teilweise
kamen Besucherinnen und Besucher von sich aus
auf die Einsatzkräfte zu und haben sich für den
Einsatz bedankt, von vielen teilnehmenden Wagen
bedankten sich die Feiernden per
Lautsprecherdurchsage. Auch im Rahmen
notwendiger Sicherheitskontrollen zeigten sich
die Beteiligten vielfach einsichtig. Die Menge
von herumliegenden Glasbehältnissen ist erneut
gesunken.
Alle beteiligten Organisationen
sind glücklich darüber, dass der
Rosenmontagsumzug in Kleve hierdurch auch in
diesem Jahr wieder ein großartiges Ereignis
geworden ist. Viel berechtigtes Lob wurde in den
letzten Tagen bereits an die USK für die
Durchführung der zusätzlichen Straßensperren
sowie an das KRK für die reibungslose
Organisation der Veranstaltung gerichtet. Trotz
zusätzlicher Auflagen für die Zugwagen konnte
der Umzug im Vergleich zum vergangenen Jahr
sogar mit vier zusätzlichen Zugnummern starten.
Heimat-Preis der Stadt Kleve
2025 – jetzt Vorschläge einreichen!
Im November 2024 konnte der Heimat-Preis der
Stadt Kleve erneut an 3 Preisträger ausgereicht
werden. Über den ersten Preis freute sich die
Jugendfeuerwehr der Stadt Kleve, mit dem 2.
Preis wurde der Kellener Heimat- und
Kulturverein Cellina e.V. ausgezeichnet, den 3.
Preis konnte der Mosaik – Familienkundliche
Vereinigung für das Kleverland e.V. mit nach
Hause nehmen.

Heimat-Preis mit Skyline Kleve
Auch im
Jahr 2025 wird der Heimat-Preis der Stadt Kleve
wieder ausgelobt. Er wird in Form eines
Preisgeldes in Höhe von insgesamt 7.000 Euro
verliehen. Der Betrag wird aus Mitteln des
Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes NRW in Höhe von 5.000
EUR und dem Anteil der Stadt Kleve mit 2.000 EUR
ausgelobt. Das Preisgeld staffelt sich je nach
Anzahl der Preisträger.
Mit dem
Heimat-Preis wird herausragendes Engagement in
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Neben der
Wertschätzung für die geleistete Arbeit,
verbindet sich damit auch die Chance für die
eigene Heimat zu begeistern. Der Preis ist neben
Lob und Anerkennung zugleich auch Ansporn für
andere: neue Interessierte werden ermutigt, sich
für die Heimat zu engagieren, denn Heimat
braucht immer weitere und neue Unterstützerinnen
und Unterstützer. Nach dem Grundsatz „Wir
fördern, was Menschen verbindet“ fördert das
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen im
Zuge der neuen Förderperiode 2023-2027 diesen
Preis.
Vorschlagsberechtigt für die
Verleihung des Heimat-Preises sind alle
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kleve,
sowie Vereine und Institutionen mit Sitz in
Kleve.
Darüber hinaus steht den im Rat
der Stadt Kleve vertretenen Fraktionen ein
Vorschlagsrecht zu.
Über die Zuerkennung
des Heimat-Preises entscheidet der Rat auf
Grundlage des Vorschlages eines unabhängigen
Preisgerichts.
Bei der Auswahl der
Preisträger legt das Preisgericht die folgenden
Kriterien zugrunde: Verdienste um die Heimat
Erhalt, Pflege und Förderung von Bräuchen, sowie
das Engagement für die Kultur und Tradition. Es
muss mindestens ein Preiskriterium erfüllt
werden.
Vorschläge für die Verleihung
des Heimat-Preises können bis spätestens
30.06.2025 eingereicht werden. Der Vordruck
sowie die Richtlinien zum Förderprogramm stehen
auf der Internetseite der Stadt Kleve unter
www.kleve.de/heimat-preis zum Download bereit.
Zumba im Sportpark Rheinpreußen
‚Zumbaverliebt‘ mit Sabine Groß-Marquardt: Es
gibt drei Termine für ein offenes Workout im
Sportpark Rheinpreußen mit der erfahrenen
Zumba-Instruktorin. Bewegung, Musik und jede
Menge Spaß gibt es an den Samstagen, 15. März,
12. April (jeweils 10.30 Uhr) und 10. Mai (14.30
und 16 Uhr).
Die Teilnehmenden
erwartet eine energiegeladene Zumba-Party, bei
der Fitness und Freude im Vordergrund stehen.
Das Motto: ‚Sport, ohne es zu merken!‘ Alle sind
herzlich willkommen - egal, ob Anfänger oder
Fortgeschrittene. Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
Bei Regen muss das Event leider
ausfallen. Weitere Informationen gibt es
telefonisch beim Stadtteilbüro Neu_Meerbeck
unter 0 28 41 / 201-530 sowie per E-Mail an stadtteilbuero.meerbeck@moers.de.
vhs Moers – Kamp-Lintfort: Entspannung
durch Klangschlagen
Moers: Welche
Wirkungen Klangschalen auf Körper und Geist
haben können, erfahren die Teilnehmenden eines
Kurses der vhs Moers – Kamp-Lintfort am Samstag,
15. März. Der Workshop ‚Entspannung mit
Klangschalen‘ beginnt um 10 Uhr in der vhs an
der Wilhelm-Schroeder-Straße 10.
Erklärt werden die verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten von Klangschalen, deren
Herkunft und die Herstellung. Zum Abschluss gibt
es eine entspannende Klangmeditation.
Mitzubringen sind bequeme Kleidung, dicke
Socken, eine Decke, ein Kissen und Wasser.
Anmeldungen für den Workshop sind telefonisch
unter 0 28 41/201- 565 sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.
Wesel: Ab 17. März wird
die Kurt-Kräcker-Straße in den Abendstunden voll
gesperrt
Im Rahmen der aktuell
laufenden Bauphase muss
die Kurt-Kräcker-Straße auf Höhe der
Eisenbahnbrücke von Montag, 17. März, bis
einschließlich Freitag, 28.
März, jeweils zwischen 18 bis 6 Uhr für alle
Verkehrsteilnehmenden voll gesperrt werden.
Grund für die Sperrung ist der Aufbau eines
Traggerüstes. Hinweise auf Umleitungen werden
vor Ort installiert.
Die
Eisenbahnüberführung Kurt-Kräcker-Straße wird im
Zuge des Ausbaus komplett erneuert. Wir setzen
alles daran, die von den Bauarbeiten ausgehenden
Störungen so gering wie möglich zu halten.
Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und
Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich
ausschließen. Wir bitten hierfür um Verständnis.
Quelle: Deutsche Bahn
Biokreis Erzeugerring NRW & Niedersachsen –
Videokonferenz-Sprechstunde Jetzt
starten: Umstellen auf Ökolandbau Auch wenn sich
der Biomarkt langsam wieder stabilisiert – es
bleibt spannend für Landwirte, die ihren Betrieb
auf ökologische Landwirtschaft umstellen wollen.
Doch motivierte Betriebe sollten einen Umstieg
gerade jetzt erwägen.
Über
Perspektiven, Förderung und Rahmenbedingungen
reden, die ersten Fragen stellen – dazu bietet
der Biokreis Erzeugerring NRW & Niedersachsen ab
jetzt monatlich Video-Sprechstunden an. Chancen
nutzen mit der Öko-Umstellung – darum geht es.
Der nächste Termin in diesem Jahr: Termin:
Mittwoch, 12. März, ab 19.30 Uhr Die
Zugangsdaten werden nach der Anmeldung
zugesandt. Anmeldungen bitte an
nrw@biokreis.de
vhs Kleve: Interaktive
Lesung: Wonneseufzer. Reiseerzählungen aus den
Alpen
Do., 13.03.2025 - 18:30 -
Do., 13.03.2025 - 20:00 Uhr
Was geschieht,
wenn Alpenautorin Gabriele Reiß den Finger über
die Atlaskarte wandern lässt? Dann bleibt er
irgendwo stehen und sie zoomt den Ort heran. Und
dann reist sie dorthin und erlebt Dinge, zu Fuß
oder mit dem 3-Gang-Fahrrad, die erstaunlich und
bewegend sind: Berglandschaften,
Menschengeschichten und Menschenwerke – verteilt
über den gesamten Alpenraum.

So ungewöhnlich die Reiseplanung, so
ungewöhnlich der Lese- u. Bildvortrag zu ihrem
neuen Buch ‚Wonneseufzer‘: Die Teilnehmenden
wählen selbst aus, welche Bilder sie sehen,
welche Texte sie hören möchten. Sie entscheiden,
wohin die Reise gehen soll: zur südsteirischen
Weinstraße, nach Berchtesgaden ins Steinerne
Meer, in die Apfelblütentäler Südtirols, in die
Einsamkeit einer Zillertaler Schafhütte oder ins
Wallis zu den Schwarznasenschafen …
Beispiele der 22 zur Auswahl stehenden Orte, wo
Alpenliebhabende Inspiration und Anlässe für
Seufzer der Wonne finden. Anmeldung:
https://www.vhs-kleve.de/kurssuche/kurs/Wonneseufzer-Reiseerzaehlungen-aus-den-Alpen/B132001
Moers:
Industriekultur bei Wanderung zum Geleucht
entdecken
Hoch über Moers thront
auf der Halde Rheinpreußen das größte
Montankunstwerk weltweit: das Geleucht von Otto
Piene. Bei einer Wanderung am Freitag, 14. März,
um 18.30 Uhr erfahren die Teilnehmenden
Wissenswertes über die Hintergründe und zur
Industriegeschichte der Region. Treffpunkt ist
am Clubhaus der Freien Schwimmer, Römerstraße
790.
Das begehbare Kunstobjekt steht
für die industrielle Vergangenheit des
Ruhrgebiets und des Niederrheins. Die
überdimensionale Grubenlampe ist auf der Halde
Rheinpreußen in genau 103,60 Meter Höhe zu
finden. Für die rund zweistündige und 3,5
Kilometer lange Tour sind eine gute Kondition
und festes Schuhwerk nötig.
Verbindliche
Anmeldungen zu der Führung sind in der Stadt-
und Touristinformation von Moers Marketing
möglich: Kirchstraße 27a/b, Telefon 0 28 41 / 88
22 6-0. Die Teilnahme kostet pro Person 8 Euro.
Vortrag vhs
Kleve: Currywurst trifft Frikandel -
Arbeitssuche im Nachbarland
Di.,
18.03.2025 - 18:30 - Di., 18.03.2025 - 20:00 Uhr
Wollen Sie wissen, wie das Arbeiten im
Nachbarland schmeckt? Erfahren Sie, welche
Chancen der Arbeitsmarkt im Nachbarland bietet,
wie Sie diese entdecken können und welche
Unterschiede es gibt! Die Veranstaltung findet
in Zusammenarbeit mit dem EURES Team Rhein Waal
statt.

Anmeldung:
https://www.vhs-kleve.de/kurssuche/kurs/Currywurst-trifft-Frikandel-Arbeitssuche-im-Nachbarland/B620003

NRW-Industrie: Produktion im Januar
2025 um 1,1 Prozent gesunken
Die
Produktion der NRW-Industrie ist im Januar 2025
nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und
saisonbereinigt um 1,1 Prozent gegenüber
Dezember 2024 gesunken. Wie das
StatistischesLandesamt mitteilt, sank die
Produktion in den energieintensiven
Wirtschaftszeigen um 1,5 Prozent.
Die Produktion in der restlichen Industrie war
gegenüber dem entsprechenden Vormonat um
0,9 Prozent niedriger. Verglichen mit dem
Vorjahresmonat sank die Produktion um
1,9 Prozent (−1,2 Prozent in der
energieintensiven und −2,2 Prozent in der
übrigen Industrie).
Unterschiedliche
Entwicklungen in den energieintensiven Branchen
Im Vergleich zu Dezember 2024 waren in NRW
für die energieintensiven Branchen im Januar
2025 unterschiedliche Entwicklungen zu
beobachten: Innerhalb der energieintensiven
Branchen wurde für die Kokerei und
Mineralölverarbeitung ein Produktionsanstieg von
6,3 Prozent (+7,0 Prozent ggü. dem
Vorjahresmonat) ermittelt. In der chemischen
Industrie stieg die Produktion um 2,4 Prozent
(+6,2 Prozent ggü. dem Vorjahresmonat).
Die Metallerzeugung- und Bearbeitung
konstatierte dagegen einen Produktionsrückgang
von 8,6 Prozent (−11,4 Prozent ggü. dem
Vorjahresmonat). Unterschiedliche Entwicklungen
auch in den übrigen Branchen In den Branchen der
übrigen Industrie waren ebenfalls
unterschiedliche Entwicklungen zu erkennen: Die
Produktionsleistung bei der Herstellung von
Kraftwagen und Kraftwagenteilen stieg um
22,9 Prozent (+4,2 Prozent ggü. dem
Vorjahresmonat).
Im Bereich
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln
wurde ein Produktionsplus von 6,0 Prozent
verzeichnet (+3,9 Prozent ggü. dem
Vorjahresmonat). Im Bereich Herstellung von
elektrischer Ausrüstung ging die Produktion
dagegen um 9,3 Prozent zurück (−11,3 Prozent
ggü. dem Vorjahresmonat).
Der
Maschinenbau vermeldete einen
Produktionsrückgang von 4,7 Prozent
(−7,8 Prozent ggü. dem Vorjahresmonat).
Rückläufige Werte im Vergleich zu Februar 2022
sowohl in der energieintensiven als auch in der
übrigen Industrie Im Vergleich zu Februar 2022,
zu Beginn des Krieges in der Ukraine, sank die
Produktion im Januar 2025 insgesamt um
10,1 Prozent (−13,7 Prozent in der
energieintensiven Industrie; −8,1 Prozent in der
übrigen Industrie).
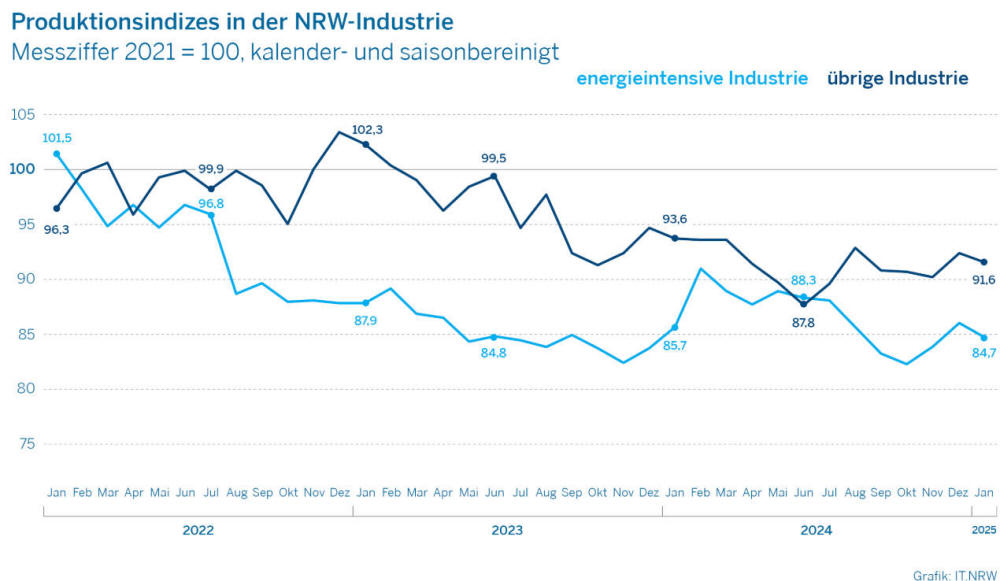
Fünf Jahre Corona: Umsatz und
Beschäftigung im NRW-Gastgewerbe auch 2024 noch
unter Vor-Corona-Niveau
Das
Gastgewerbe in NRW hat 2024 weniger Umsatz
gemacht als im Vor-Corona-Jahr 2019. Wie
Information und Technik Nordrhein-Westfalen
anlässlich des Beginns der Coronapandemie als
Statistisches Landesamt mitteilt, ist im Jahr
2024 der reale Umsatz im Gastgewerbe – also
unter Berücksichtigung der Preisentwicklung – um
16,2 Prozent geringer, als im Vor-Corona-Jahr
2019. Nominal legte der Umsatzindex im Vergleich
zu 2019 um 6,6 Prozent zu.
Die
Beschäftigung liegt auch fünf Jahre nach
Pandemiebeginn noch fünf Prozent unter dem
Vor-Corona-Niveau. Realer Umsatz im Gastgewerbe
sinkt 2024 um 1,9 Prozent Im Jahr 2021 erreichte
der reale Umsatzindex des Gastgewerbes seinen
Tiefpunkt (60,9). Nach der Lockerung der
Covid-Beschränkungen erholte sich der Index in
den folgenden Jahren (2022: 87,7; 2023: 88,0),
erreichte jedoch nicht das Niveau von 2019.
Im Jahr 2024 sank der Umsatz im
Vergleich zum Vorjahr erstmalig wieder
(−1,9 Prozent). Nominal konnte der Index bereits
2023 (118,3) den Vor-Corona-Wert (112,3)
überschreiten. Dieser Trend setzte sich auch im
Jahr 2024 fort und der Index stieg im Vergleich
zum Vorjahr um 1,2 Prozent. Die Beschäftigung
liegt seit dem Covid-Tiefpunkt in 2021 (82,9)
weiterhin unter dem Vor-Corona-Niveau.
Allerdings legte der Index seit 2022 stetig zu
und erreichte 2024 einen Wert von 99,1.
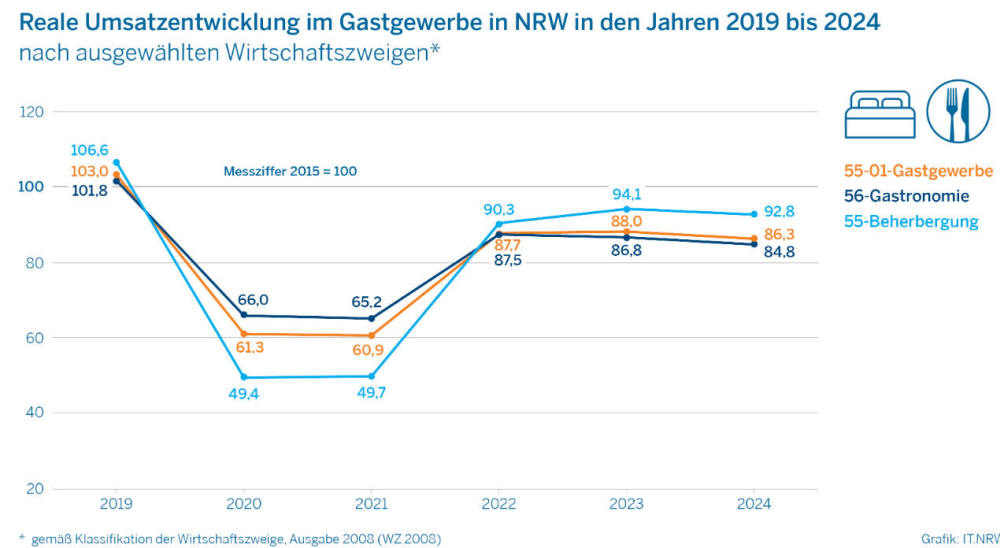
Realer Umsatz bei Beherbergungen erholt sich
schneller als in der Gastronomie
Im
Beherbergungsgewerbe lag der reale Umsatz 2024
unter dem Niveau von 2019 (−12,9 Prozent).
Nominal verzeichnete der Index ein Plus von
5,3 Prozent. In der Gastronomie sank der reale
Umsatz verglichen mit 2019 um 16,7 Prozent;
nominal stieg der Umsatz um 7,9 Prozent.
Der Beschäftigungsindex des
Beherbergungsgewerbes verlor verglichen mit dem
Vor-Covid-Niveau um 7,1 Prozent. In der
Gastronomie fällt dieser Rückgang mit
4,5 Prozent etwas schwächer aus. Der reale
Umsatz in der Gastronomie war in 2023
(−0,8 Prozent) und 2024 (−2,3 Prozent) im
Vergleich zum Vorjahr rückläufig.
Im
Beherbergungsgewerbe konnte 2023 im Vergleich
zum Vorjahr noch ein Plus von 4,2 Prozent
erwirtschaftet werden; in 2024 ging der reale
Umsatz um 1,4 Prozent zurück. Allgemein deutet
die Entwicklung der realen Umsatzindizes darauf
hin, dass sich das Beherbergungsgewerbe (92,8)
tendenziell besser erholt als die Gastronomie
(84,4).
Ende Februar 2020 wurden die
ersten COVID-19-Fälle in Nordrhein-Westfalen
festgestellt. Am 11. März 2020 folgte die
Ausrufung der Pandemie durch die
Weltgesundheitsorganisation (WHO).
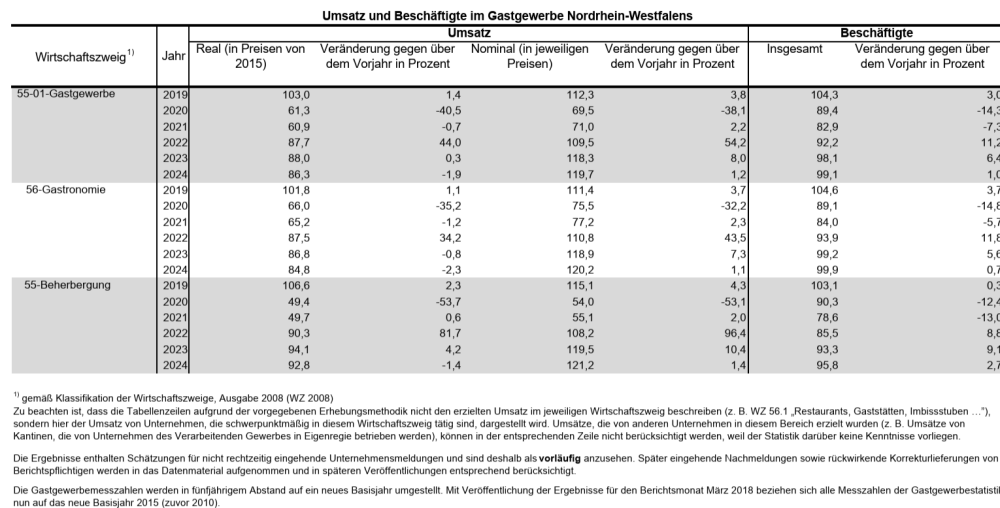
|