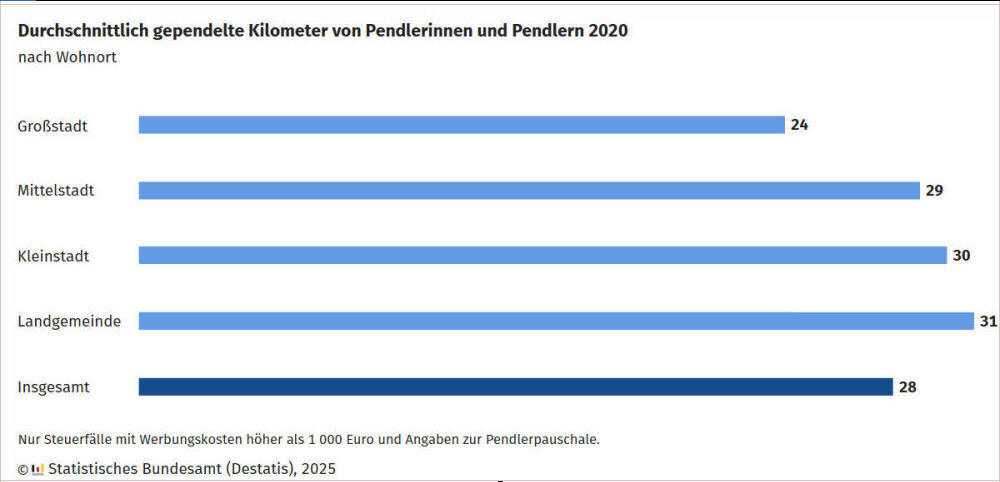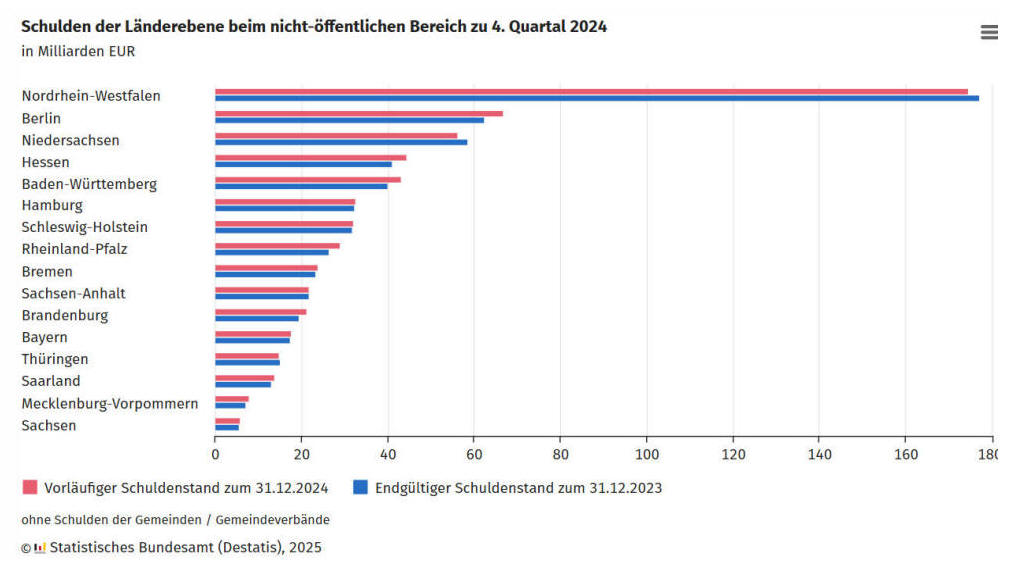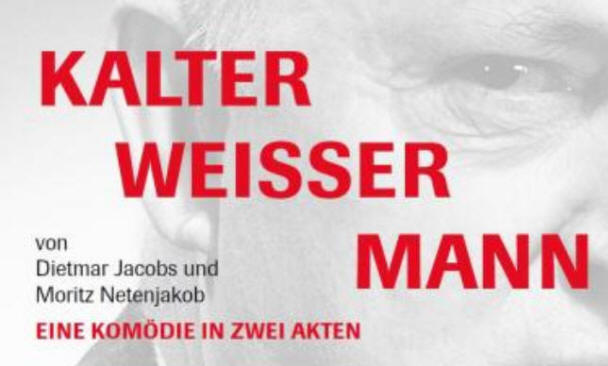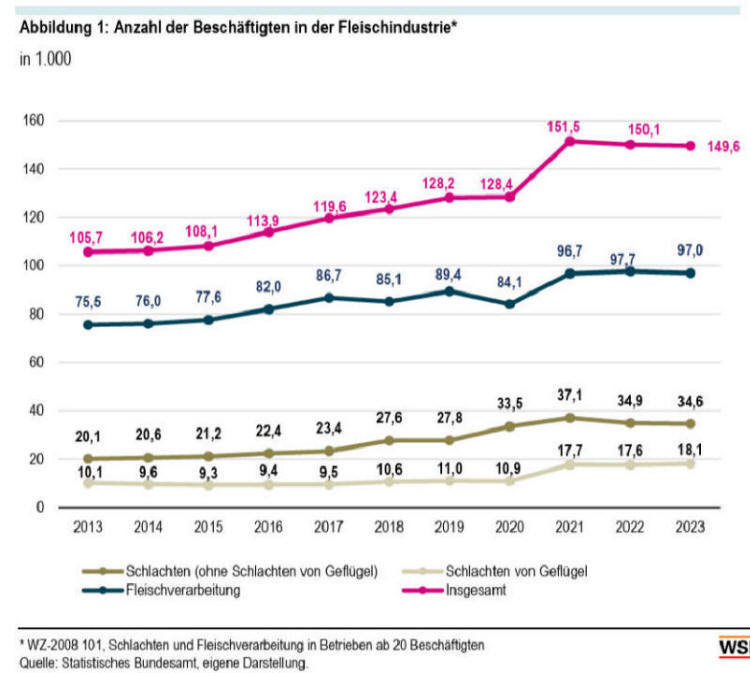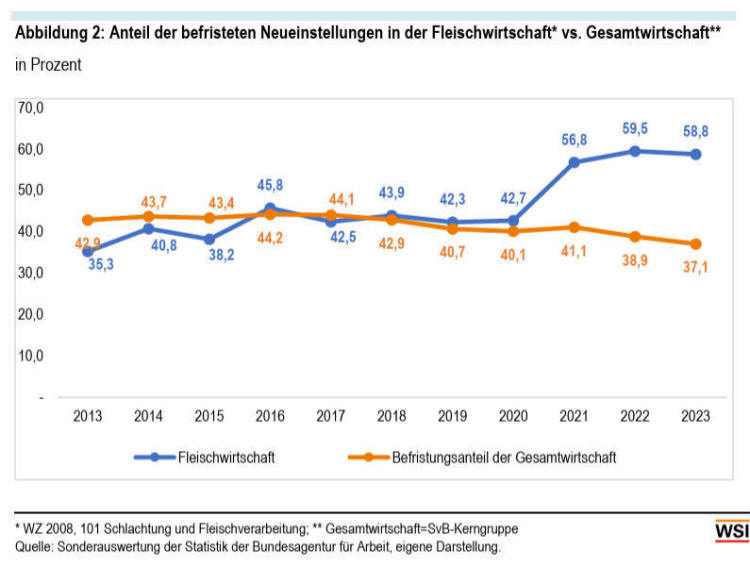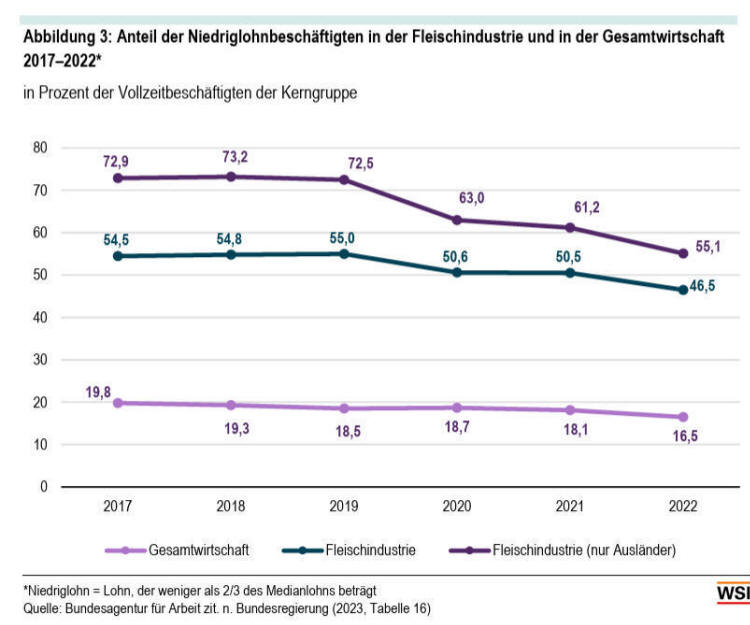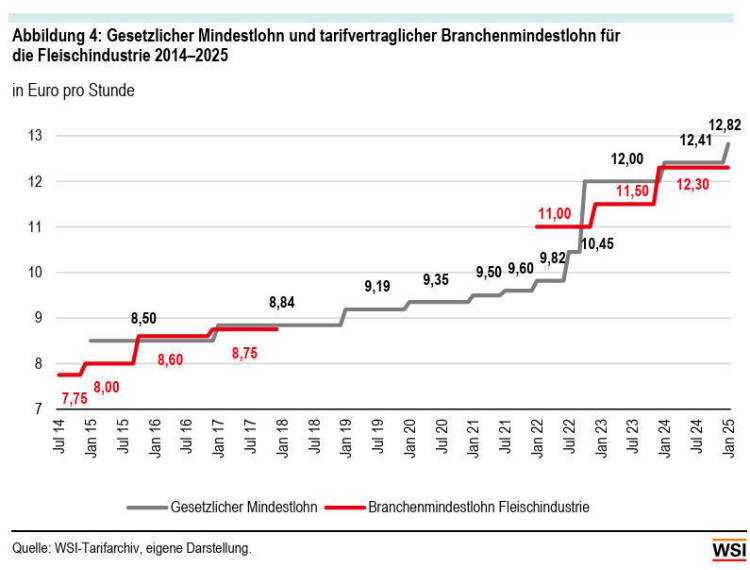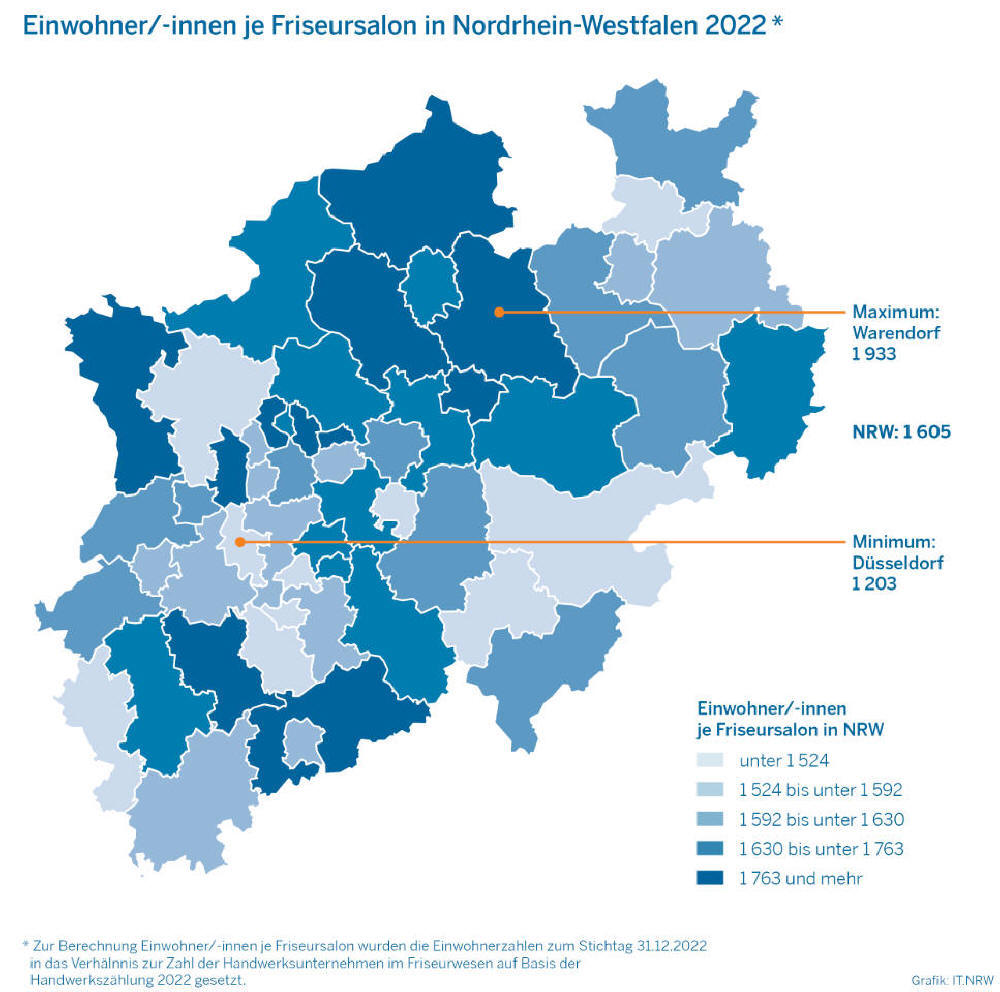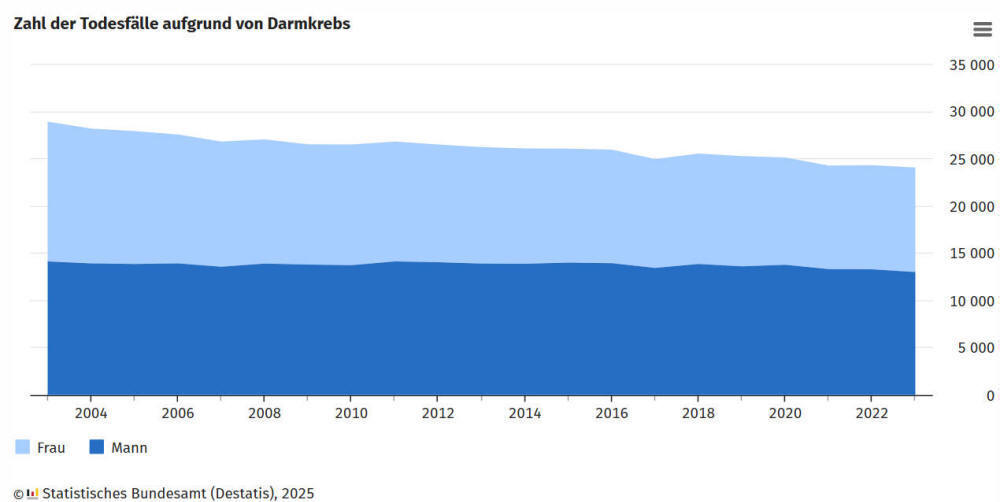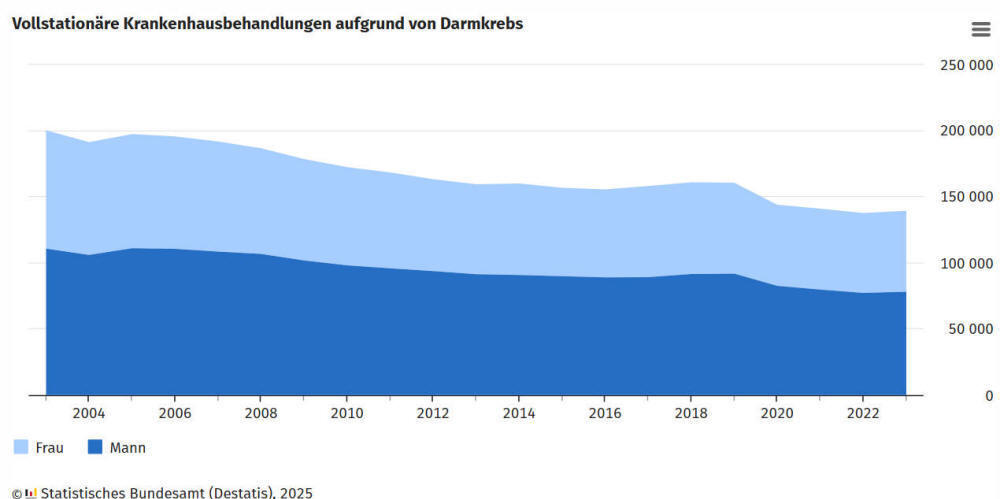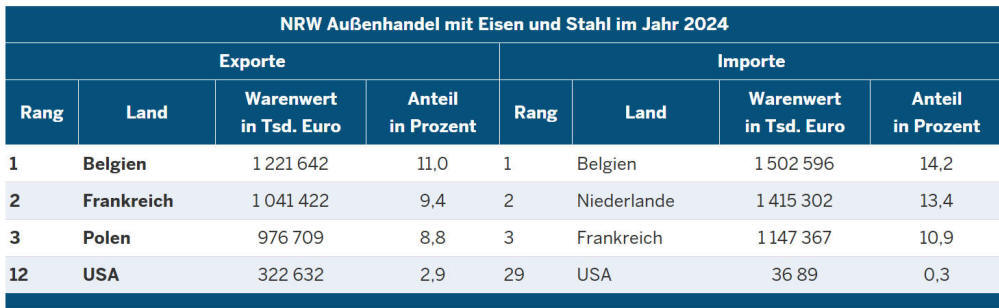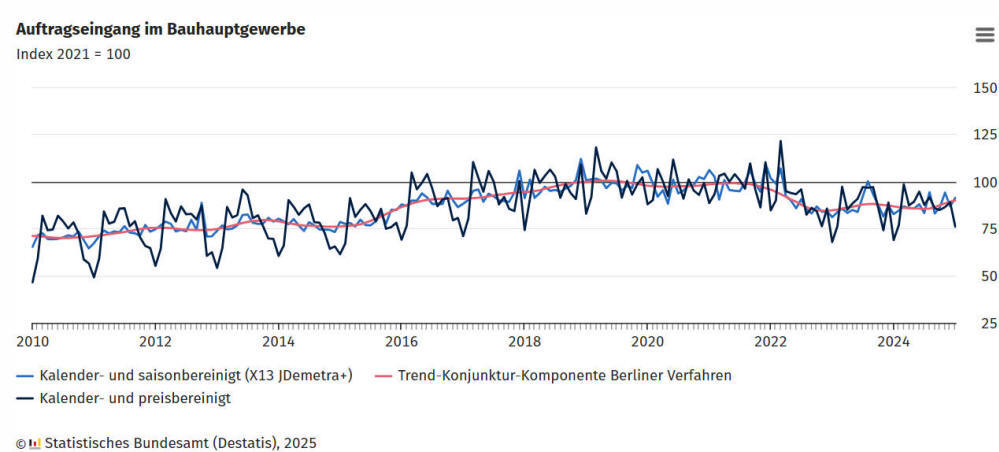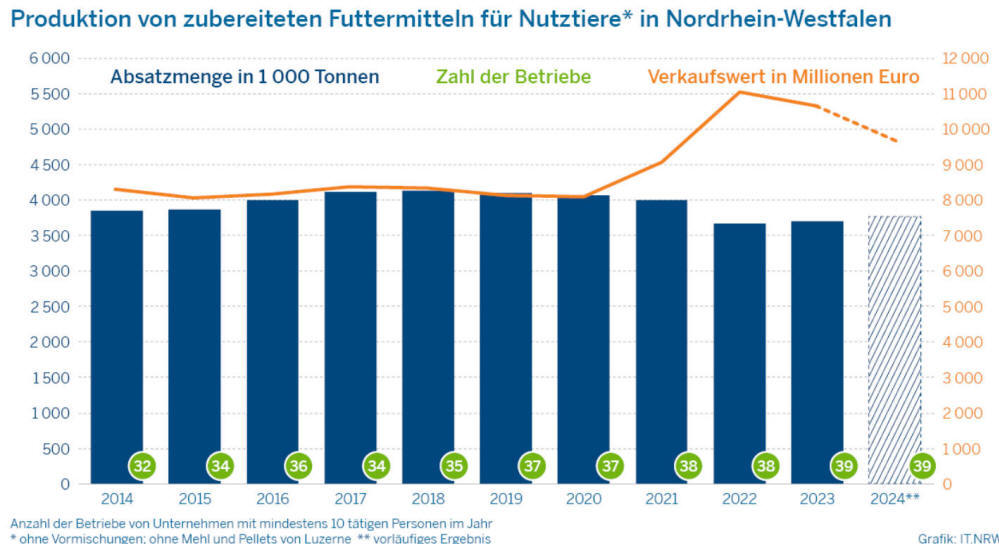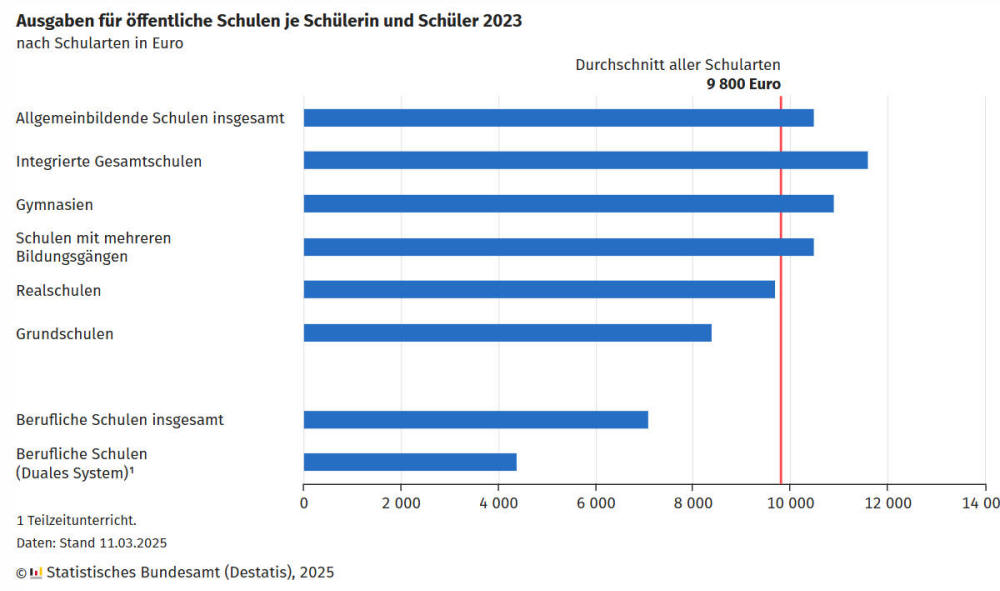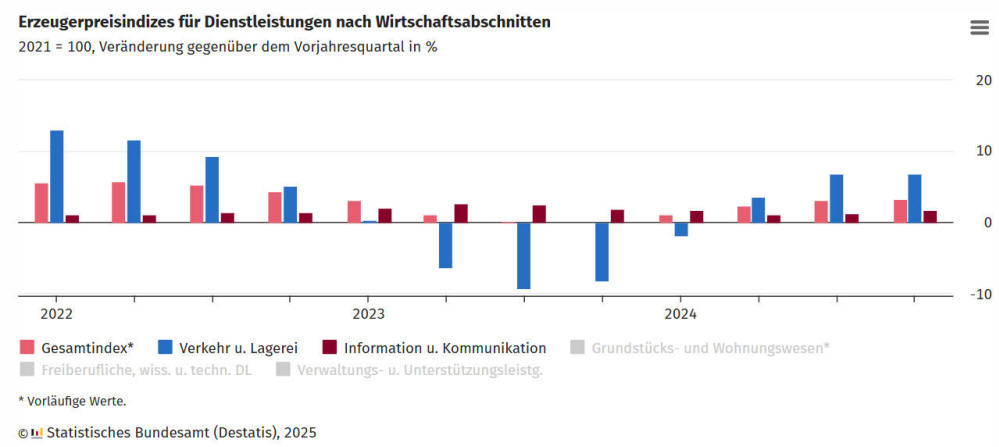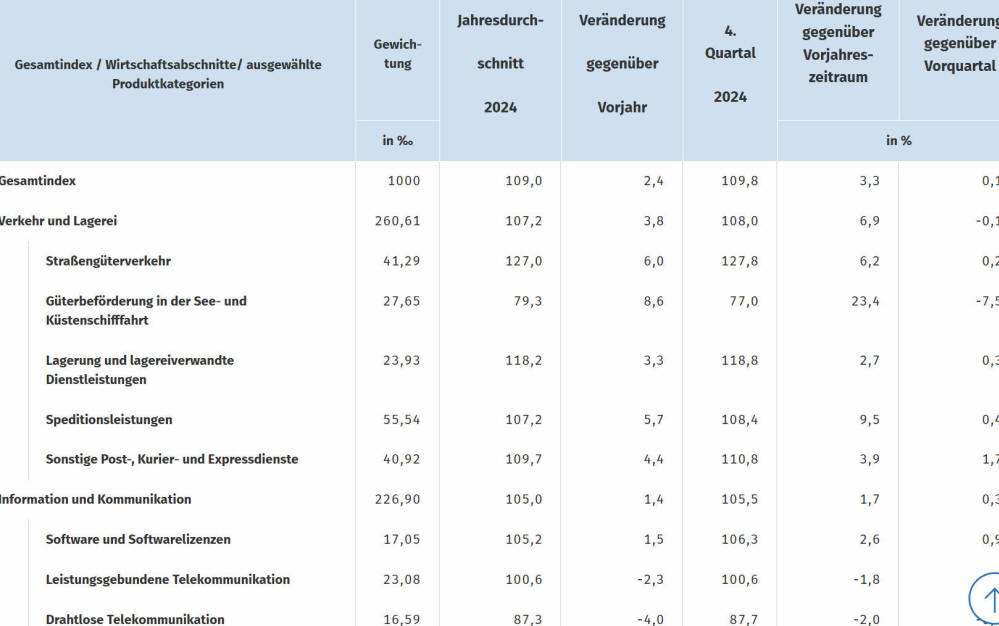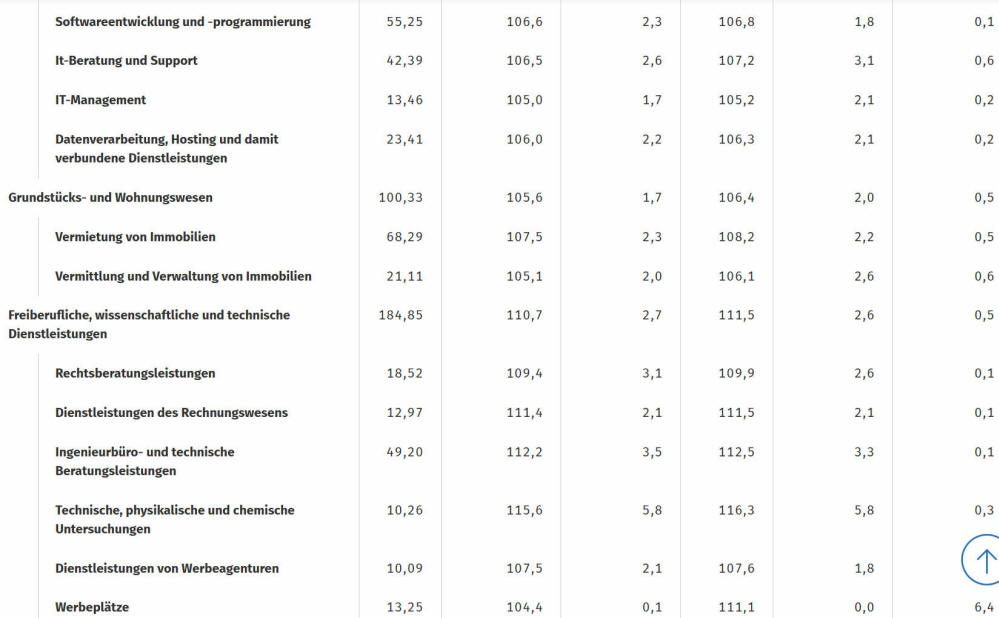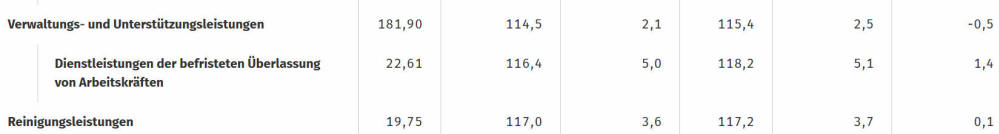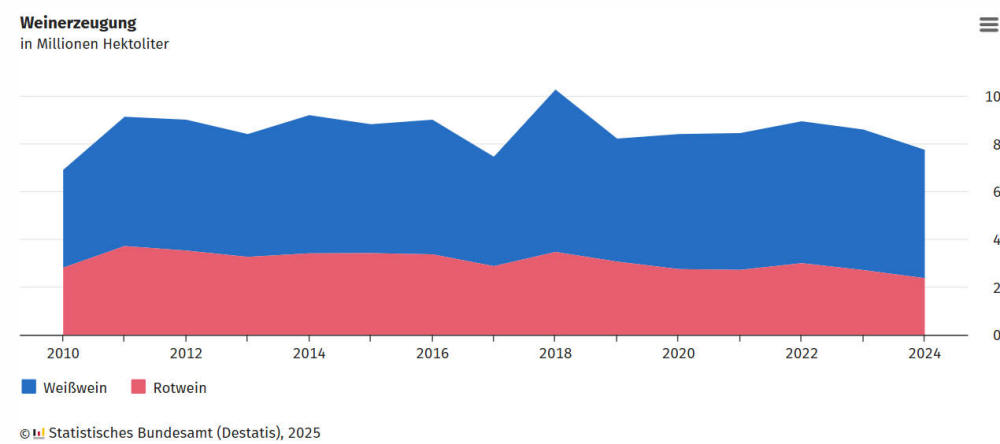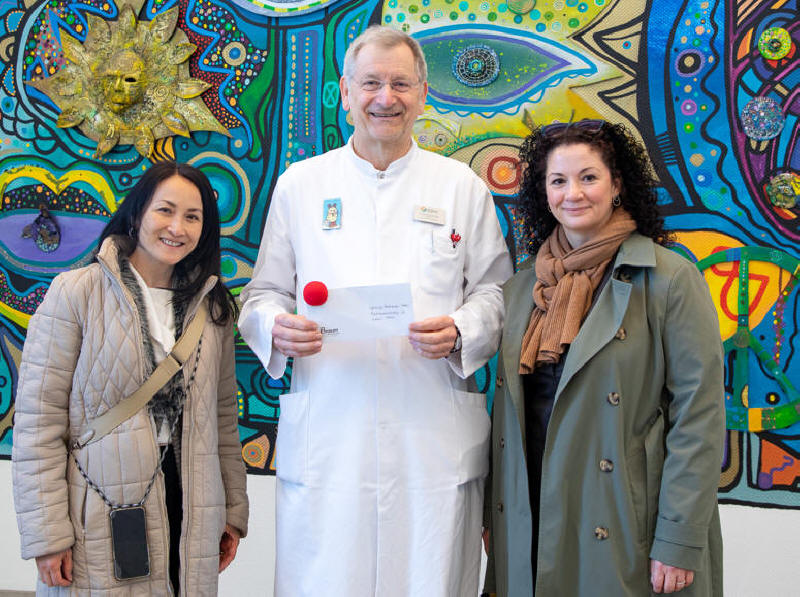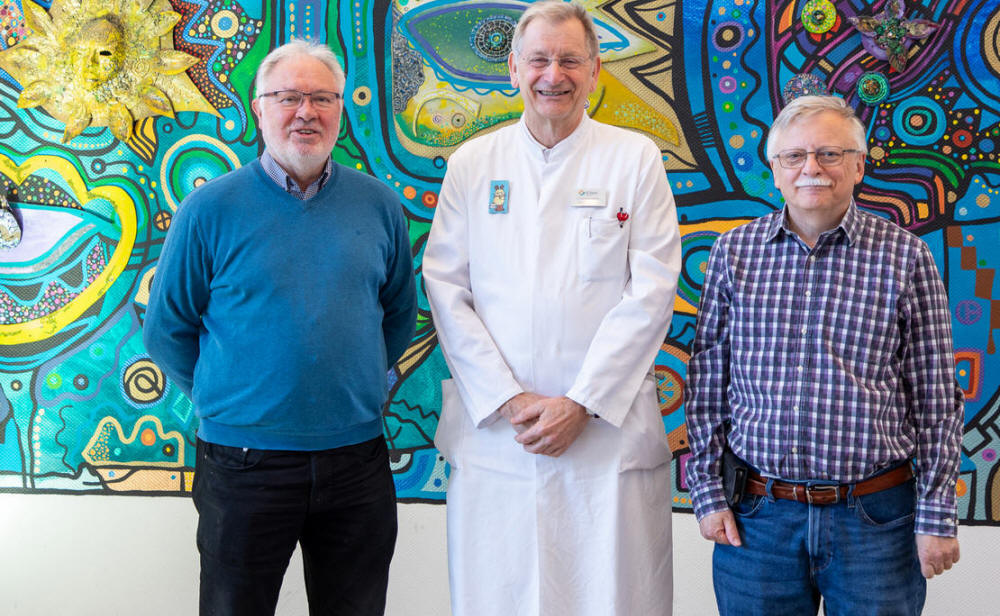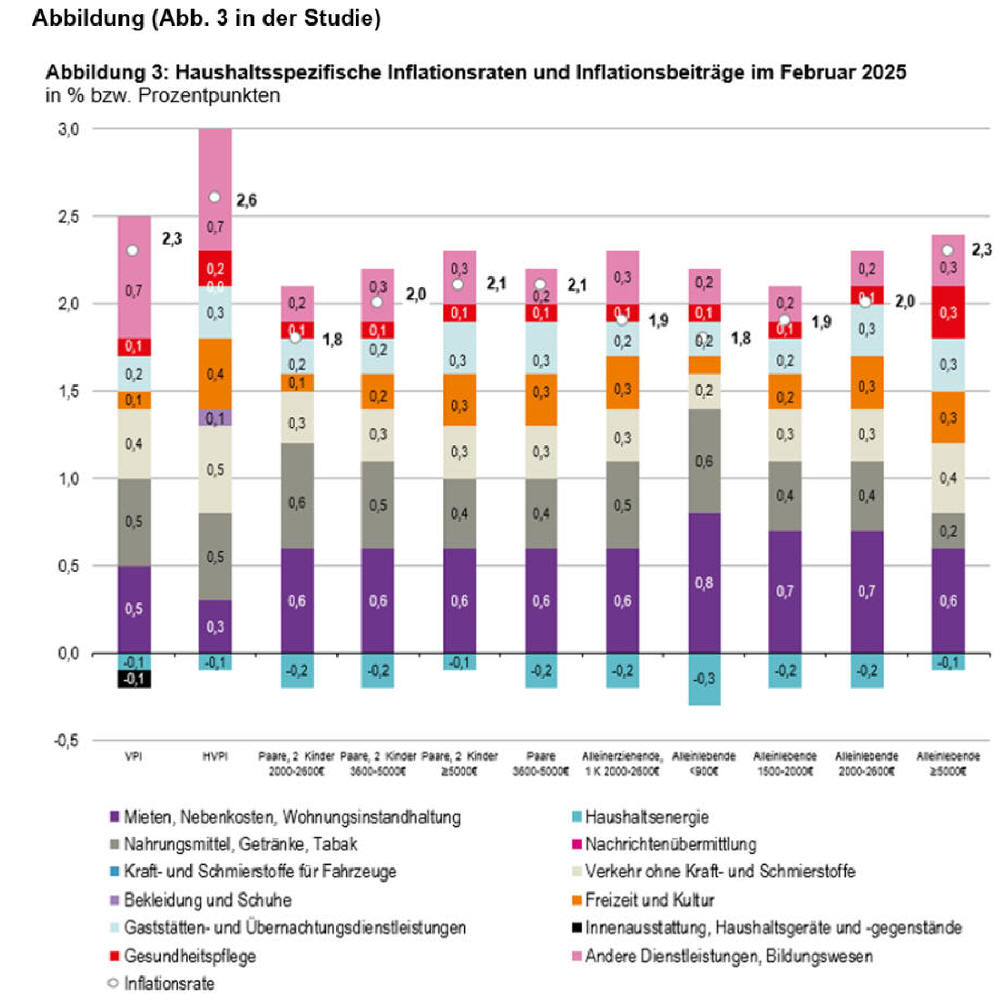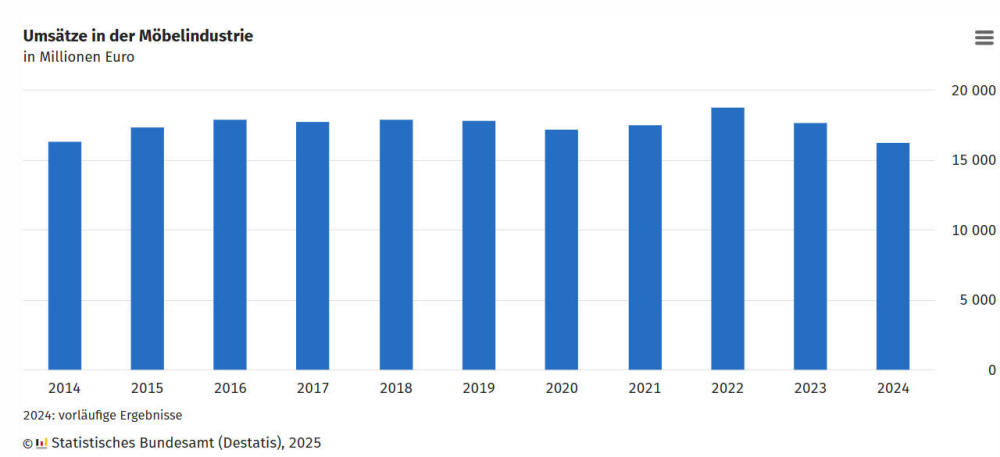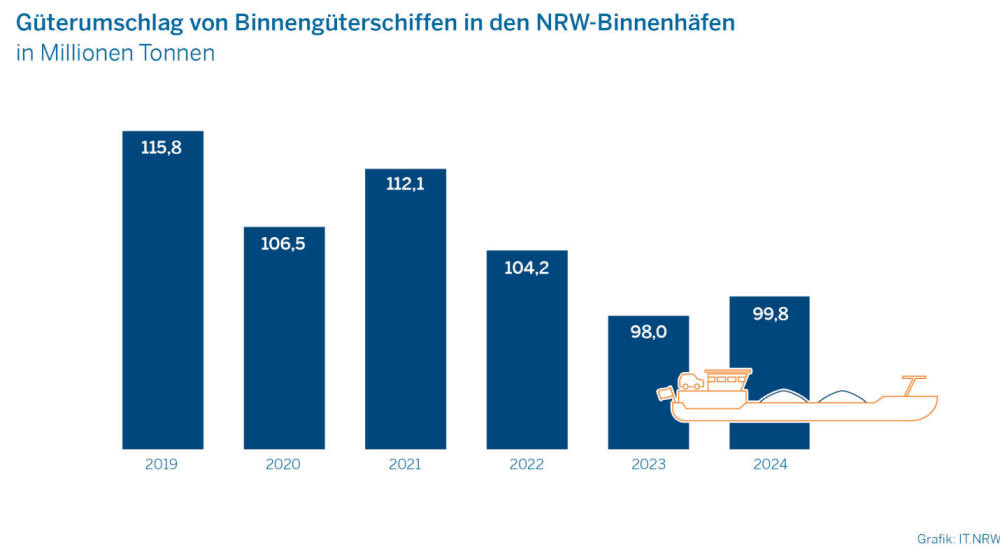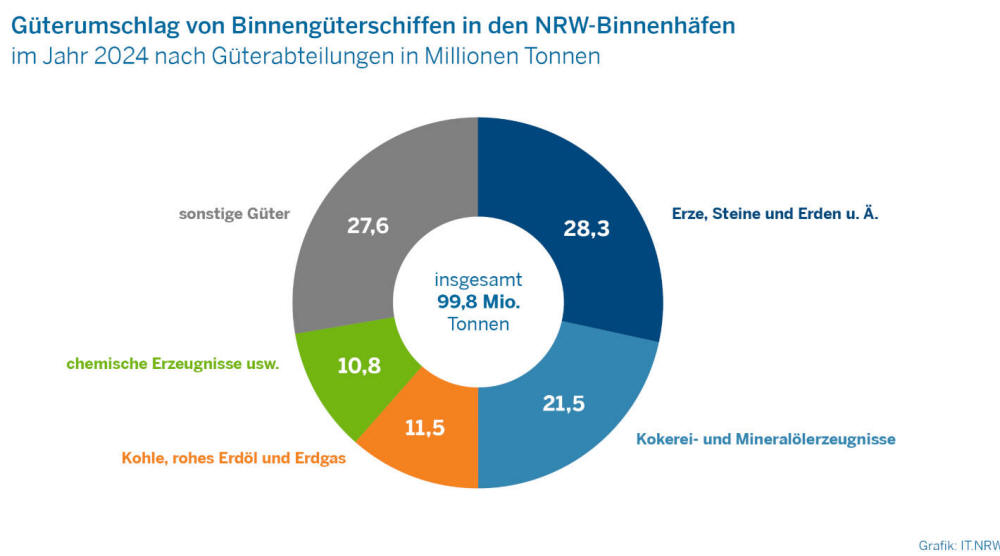|
 Umstellung
Winter- auf Sommerzeit: 30.03.2025
Uhr-Umstellung von 2 Uhr auf 3 Uhr. Umstellung
Winter- auf Sommerzeit: 30.03.2025
Uhr-Umstellung von 2 Uhr auf 3 Uhr.
Samstag, 29., Sonntag, 30. März 2025
Neue Schnellbuslinie SB 46 verbindet Nijmegen,
Goch, den Airport Weeze und Kevelaer | Start am
6. April 2025
Ab dem 6. April 2025 startet die neue
Schnellbuslinie SB 46, die eine direkte
Verbindung zwischen Nijmegen, Kranenburg, Goch,
dem Airport Weeze und Kevelaer bietet. Die Linie
wird von der BVR Busverkehr Rheinland GmbH,
einer 10-prozentigen Tochter der DB Regio Bus
NRW, betrieben.
Fahrplan und Taktung
Der SB 46 verkehrt im Zweistundentakt und bietet
eine schnelle Verbindung zwischen den Städten
und dem Flughafen: Ab Nijmegen Hauptbahnhof über
Kranenburg, Goch, Airport Weeze und weiter nach
Kevelaer Bahnhof:
Erste Abfahrt: 02:40
Uhr
Letzte Abfahrt: 22:40 Uhr
Fahrzeit bis Airport Weeze: ca. 65 Minuten
Ab Airport Weeze nach Nijmegen:
• Erste
Abfahrt: 04:36 Uhr • Letzte Abfahrt: 00:36 Uhr
Tarife und Ticketkauf
Auf der Linie
SB 46 gilt der VRR-Tarif und somit auch das
Deutschlandticket. Tickets sind erhältlich über
die App “DB NRWay“ oder unter
www.dbregiobus-nrw.de/tickets-tarife/nrway.
Weeze Airport – Nijmegen: ab 11,88 € (Stand
April 2025)
Den vollständigen Fahrplan
finden Sie hier:
Download Fahrplan SB 46 (PDF)
„Mit der neuen Schnellbuslinie SB 46
wird die Erreichbarkeit des Airport Weeze weiter
verbessert und Reisenden und Pendlern eine
Verbindung im öffentlichen Personennahverkehr
zwischen den Städten Nimwegen und Kevelaer
geboten“, sagt Tom Kurzweg, Sprecher des Airport
Weeze und ergänzt: „Wir freuen uns natürlich
besonders, dass nun auch unsere Gäste aus den
Niederlanden eine Möglichkeit haben, den Airport
Weeze mit dem Bus ab Nimwegen direkt, preswert
und komfortabel zu erreichen.“
„Mit der
neuen Schnellbuslinie SB 46 leisten wir einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung der
grenzüberschreitenden Mobilität und stärken die
Anbindung zwischen Nordrhein-Westfalen und den
Niederlanden. Wir sind stolz darauf, einen
weiteren Schritt in Richtung für das
Verkehrsnetz über Landesgrenzen hinweg gegangen
zu sein und werden auch in Zukunft weiterhin eng
mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um den
öffentlichen Nahverkehr in der Region noch
weiter zu optimieren.“, sagt
Niederlassungsleiterin der BVR Busverkehr
Rheinland GmbH Manja Schmidt.
Anmeldezahlen an den weiterführenden
Schulen in Kleve
Ende Februar 2025 fanden die
Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen in
Kleve für das Schuljahr 2025/26 statt.
Potenziell hätten bis zu 639 Schülerinnen und
Schüler (SuS) an einer der fünf weiterführenden
Schulen im Klever Stadtgebiet angemeldet werden
können. Neben den Grundschulkindern aus Kleve
sind darunter 117 Kinder, die Grundschulen der
Gemeinde Bedburg-Hau besuchen sowie 106
Grundschülerinnen und Grundschüler aus der
Gemeinde Kranenburg. Insgesamt haben die
weiterführenden Schulen in Kleve zum
bevorstehenden Schuljahr eine Kapazität von 622
SuS.
Die aktuellen Anmeldezahlen stellen
sich nach Abschluss des Verfahrens wie folgt
dar:
Schule Zügigkeit Kapazität Anmeldungen
Konrad Adenauer Gymnasium 4 124 111
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 3 93 107
Gesamtschule am Forstgarten 6 162 165
Joseph
Beuys Gesamtschule 5 135 74
Karl Kisters
Realschule 4 108 130
Insgesamt haben
sich somit 587 SuS an einer weiterführenden
Schule im Klever Stadtgebiet angemeldet. Neben
SuS aus Kranenburg und Bedburg-Hau stammen
einzelne Anmeldungen davon auch von Kindern aus
Emmerich und Goch. Mit Stand vom 24. März 2025
ist der Stadt Kleve bekannt, dass sich insgesamt
60 Schülerinnen und Schüler aus Kleve,
Bedburg-Hau und Kranenburg an Schulen außerhalb
des Klever Stadtgebietes angemeldet haben. 21
Anmeldungen von SuS stehen noch aus.
Die
Schulleitung der Gesamtschule am Forstgarten hat
trotz eines leichten Anmeldeüberhangs alle
angemeldeten Kinder aufgenommen. Die Leitung der
Karl Kisters Realschule hat hingegen 15 SuS
ablehnen müssen, sodass dort 115 Kinder
aufgenommen wurden. Das
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium konnte 93 SuS
aufnehmen und musste 14 SuS ablehnen.
Innenstadtentwicklung: Was gehört zu
Kleve, was darf sich verändern?
Ergebnisse
der Bürgerbeteiligung
Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung
können am Ende der folgenden Seite unter
"Downloads" heruntergeladen werden:
https://www.kleve.de/stadt-kleve/freizeit-und-kultur/landesgartenschau-2029/aktuelles-zur-landesgartenschau

Die Stadt Kleve bedankt sich herzlich bei allen
Bürgerinnen und Bürgern, die sich aktiv an der
Bürgerbeteiligung für die zukünftige Gestaltung
der Innenstadt beteiligt haben. Dank der
Beiträge aus der Online-Umfrage und der
Veranstaltung vor Ort konnten viele Ideen und
Anregungen gesammelt werden, die nun in den
Planungswettbewerb für die Klever Innenstadt
einfließen werden. Renommierte Planungsbüros
werden über den Sommer Entwürfe für die
Umgestaltung der Klever Innenstadt fertigen,
über die anschließend eine Jury entscheidet.
Rund 50 Interessierte fanden am vergangenen
Donnerstag den Weg zur Präsenzveranstaltung in
den Räumlichkeiten der Hochschule-Rhein-Waal.
Nach einer kurzen Vorstellung der aktuellen
Sachstände wurden in Kleingruppen Ideen und
Anregungen zur Innenstadt gesammelt. Diese
wurden anschließend im Plenum diskutiert und
ergänzt.
Zentrale Themen waren die Begrünung,
Beleuchtung, Spielangebote für Kinder und
Sitzgelegenheiten zum Verweilen. Zusätzlich zur
Präsenzveranstaltungen haben insgesamt 138
Personen den Online-Fragebogen ausgefüllt und
der Stadt Kleve auf diese Weise ihre
Vorstellungen für die Klever Innenstadt der
Zukunft mitgeteilt. Auch für diese vielen
Meinungen möchte sich die Stadt Kleve herzlich
bedanken.
Die Stadt Kleve verfolgt im
Rahmen der Landesgartenschau das Ziel, die
Fußgängerzone aufzuwerten und ihre Attraktivität
zu steigern, um langfristig die Kundenfrequenz
zu erhöhen. Dabei spielt die Gestaltung des
öffentlichen Raums eine zentrale Rolle.
„Die Klever Innenstadt soll ein Ort sein, mit
dem sich die Kleverinnen und Klever
identifizieren können, an dem aber auch
Besucherinnen und Besucher unserer Stadt gerne
verweilen. Es geht nicht nur um Veränderungen,
sondern auch darum, das Einzigartige von Kleve
zu bewahren und neu in Szene zu setzen. Der
anstehende Planungswettbewerb ist dabei ein
gutes Instrument, um sich Expertise von außen zu
holen und neue Blickwinkel zu bekommen“, betont
Bürgermeister Wolfgang Gebing.
Der
Planungswettbewerb soll in Kürze starten und die
Ergebnisse der Bürgerbeteiligung werden in die
Entwürfe einfließen. Die Juryentscheidung über
den besten Entwurf ist für Mitte September 2025
geplant.
Allen Interessierten stehen die
Ergebnisse der Bürgerbeteiligung auf
www.kleve.de/laga29 unter dem Punkt „Aktuelles
zur Landesgartenschau“ ab sofort öffentlich zur
Verfügung. Dort sind sowohl die Eingaben aus der
Vor-Ort-Veranstaltung als auch die Ideen aus der
Online-Umfrage aufgeführt.
Beliebter Moerser KunstFrühling erstmalig in
Räumen der Sparkasse
Die Beteiligten freuen sich auf den
Moerser KunstFrühling am 5. und 6. April, der
erstmals in den Räumen der Sparkasse am
Niederrhein am Ostring in Moers stattfindet.

Gruppenfoto Moerser Künstlerinnen und Künstlern
zu Hüschs 100. Geburtstag. (Foto: Sparkasse am
Niederrhein)
Kultur erleben und den
Frühling begrüßen: Erstmals findet der Moerser
KunstFrühling am Samstag, 5. und Sonntag, 6.
April, in den Räumen der Sparkasse am
Niederrhein (Ostring 4-7) statt. „Wir freuen uns
sehr, diesmal auch der Gastgeber dieses schönen
Events zu sein“, sagt
Vorstandsvorstandsvorsitzender Giovanni
Malaponti. Die Sparkasse hat bereits in den
Vorjahren den KunstFrühling finanziell
gefördert.
Parallel zum Moerser Frühling
der Moers Marketing GmbH in der Innenstadt
präsentiert das Kulturbüro an beiden Tagen von
11 bis 17 Uhr wieder einen abwechslungsreichen
Kunst- und Kreativmarkt. „Über 50 Moerser
Künstlerinnen und Künstler sind dabei, die ihre
Arbeiten zum Verkauf anbieten: Grafiken,
Fotografien, Ölbilder, Aquarelle und Acrylbilder
sind hier ebenso zu finden wie Schmuck,
österliche Deko oder Gestricktes“, erläutert Eva
Marxen, Leiterin des Kulturbüros.
KunstFrühling feiert Hüschs 100. Geburtstag
Neben Kaffee und Kuchen aus der bewährten
Herstellung von Caffe Classico warten eine ganze
Reihe von Besonderheiten auf die Besucherinnen
und Besucher: Die anlässlich einer öffentlichen
Ausschreibung entstandenen 18 Motive zum Thema
‚Hüsch100‘ werden im Rahmen einer kleinen Schau
innerhalb des Kunstmarktes gezeigt.
„Auch beim KunstFrühling wollten wir natürlich
den Blick auf den 100. Geburtstag von Hanns
Dieter Hüsch werfen“, so Diana Finkele, Leiterin
des Eigenbetriebs Bildung und des Grafschafter
Museums. Einige dieser Arbeiten – Malereien,
Zeichnungen, Fotografien, Collagen – können auch
in Form eines zehnteiligen Postkarten-Sets
gekauft werden.
Siebdruck, Manga und
Lieblingstiere
Am ‚Serviceschalter für
tierische Illustrationswünsche‘ zeichnet
Kinderbuchillustratorin Katja Jäger gegen eine
kleine Spende live Lieblingstiere von
Besucherinnen und Besuchern des Moerser
KunstFrühlings. Auch selber kreativ werden
können große und kleine Gäste in diesem Jahr an
verschiedenen Stationen: zum Beispiel am Stand
‚Siebdruck to go‘ von Dietlinde Fricke.
‚Be creative‘ – so die Einladung von Diana
Kirsten-Szlaski und Jen Satora am Kreativ-Tisch
gleich neben der Kinderspielzone der Sparkasse
in der Kundenhalle. Diana Kirsten-Szlaski leitet
die Herstellung von ‚Mein erstes Künstlerbuch‘,
gestaltet mit (selbstgeschnitzten) Stempeln, an.
Bei Jen Satora kommen alle auf ihre Kosten, die
Fans von Comics und japanischen Mangas sind und
eigene Figuren zeichnen möchten.
Alle
Angebote sowie der Eintritt zum KunstFrühling
sind kostenfrei.
Eine Anmeldung ist nicht
nötig. Die Künstlerstände befinden sich in der
Kundenhalle sowie im Casino der
Sparkassen-Hauptstelle.
vhs Moers
– Kamp-Lintfort: Fahrradtouren für Menschen 60+
Rund 25 Kilometer lange Radtouren durch
Wiesen und Wälder, durch Dörfer und Felder plant
und unternimmt eine Gruppe der vhs Moers –
Kamp-Lintfort für mobile Seniorinnen und
Senioren. Am Montag, 7. April, treffen sich
Interessierte zum ersten Mal um 16 Uhr zu einer
Vorbesprechung in der vhs Moers,
Wilhelm-Schroeder-Straße 10.
Dabei geht
es um organisatorische Dinge, um die Routen und
die genauen Termine. Insgesamt sind drei Touren
vorgesehen. Eine vorherige Anmeldung ist
notwendig. Das ist telefonisch unter 0 28 41/201
– 565 und online unter www.vhs-moers.de möglich.
Neues Amtsblatt
Die Stadt Moers hat ein Amtsblatt
veröffentlicht. Alle veröffentlichten
Amtsblätter finden Sie unter https://www.moers.de/rathaus-politik/amtsblaetter
Amtsblatt Nr. 06 vom 27.03.2025 (562.96 KB)
Kleve: Führung "Der Forstgarten im
Frühjahr" am 6. April
Schon im 18. Jahrhundert wurde der
Klever Forstgarten nach Art eines Botanischen
Gartens angelegt und hat mit seinen
geschwungenen Wegen und fremdländischen Gehölzen
bis heute nicht an Anziehungskraft verloren.

Blüte im Obstbaumarboretum © Foto: Hans Heinz
Hübers
Bei der Führung „Der Forstgarten
im Frühjahr“ am Sonntag, den 06. April 2025 um
14.30 Uhr wird der Gartenführer Hans Heinz
Hübers, der selbst viele Jahre für die Pflege
der Gartenanlagen verantwortlich war, die
Geschichte vom „Lustgarten“ bis zum Bürgerpark
beschreiben. Dabei geht es sowohl um die Zeiten
unter Buggenhagen und Weyhe, die Kurzeit als Bad
Cleve, die Nachkriegszeit sowie um die
Rekonstruktion unter Gustav und Rose Wörner bis
zum neuen Parkpflegewerk von Elke Lorenz.
Außerdem wird das Obstbaumarboretum
besichtigt, das vor wenigen Jahren angelegt
wurde, viele alte Obstsorten sowie eine
Wetterstation der Hochschule Rhein-Waal
beherbergt und ein wichtiges Biotop darstellt.
Die Führung beginnt um 14.30 Uhr am Museum
Kurhaus Kleve (Tiergartenstraße 41) und kostet 8
€ pro Person.
Eine Anmeldung ist online
unter www.kleve-tourismus.de
oder bei der Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve
GmbH (Tel.: 02821/84806) erforderlich. Für
Gruppen besteht außerdem die Möglichkeit, die
Führung zum Preis von 75 € zum Wunschtermin zu
buchen.
Moers: Frühjahrskonzert des
Kammerorchesters mit Wiener Klassik am 6. April
Zum Frühjahrskonzert lädt das
Niederrheinische Kammerorchester Moers (NKM) am
Sonntag, 6. April, um 18 Uhr, in das
Kulturzentrum Rheinkamp (Kopernikusstraße 11)
ein.

(Foto: Privat)
Die Veranstaltung findet
im Rahmen der Städtischen Konzertreihe statt.
Das diesjährige Frühjahrskonzert des NKM taucht
tief in die Seele der Wiener Klassik ein und
stellt zwei herausragende Sinfonien aus der
Feder von Joseph Haydn einander gegenüber: zum
einen die ‚La Passione‘ betitelte Sinfonie Nr.
49 in f-Moll, deren eröffnendes Adagio in seiner
Intensität zu den schönsten Einfällen des
Komponisten gehört.
Zudem ist die
energetisch hochgeladene Sinfonie Nr. 44 in
e-Moll genannte ‚Trauersinfonie‘ zu erleben, die
in ihrem Gehalt und ihrer wilden Zugespitztheit
weit entfernt ist von jeglicher verzopften
Gefälligkeit. Zwischen diesen beiden Sinfonien
erklingt das Joseph Haydn zugeschriebene
Hornkonzert Nr. 2 D-Dur, das mit seinem
unbeschwert fröhlichen Charakter in starkem
Gegensatz zu den beiden Sinfonien steht.
Solist ist Kristiaan Slootmakers,
stellvertretender Solohornist der
Niederrheinischen Sinfoniker. Als Dirigent
konnte das NKM Philip van Buren gewinnen, der
bereits in früheren Jahren musikalischer Leiter
des Orchesters war. Bis 18 Jahre ist der
Eintritt frei (Die Musikschule bittet um
Reservierung).
Erwachsene zahlen im
Vorverkauf 17 Euro in der Stadt- und
Touristinformation von Moers Marketing,
Kirchstraße 27 a/b, Telefon 0 28 41 / 88 22 60
(zuzüglich 8 Prozent Vorverkaufsgebühren) und
bei der Musikschule, Filder Straße 126, Telefon
0 28 41 / 13 33. Eventuelle Restkarten sind an
der Abendkasse erhältlich.

13,8 Millionen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nutzten 2020
die Pendlerpauschale - Gut die Hälfte der
Pendler/-innen mit Jahresbruttolohn von 20 000
bis unter 50 000 Euro
Im Zuge der
Koalitionsverhandlungen wird auch eine Erhöhung
der Pendlerpauschale diskutiert. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis der
Daten aus den Steuererklärungen mitteilt,
nutzten im Jahr 2020 rund 13,8 Millionen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die
Entfernungspauschale, auch Pendlerpauschale
genannt.
Auf ihrem Weg zur Arbeit legten
sie durchschnittlich 28 Kilometer zurück.
Hierbei wurden nur Fälle erfasst, bei denen die
Werbungskosten über dem
Arbeitnehmer-Pauschbetrag von damals 1 000 Euro
lagen. Diejenigen, die unterhalb dieses Betrags
blieben, gaben ihre gependelten Kilometer häufig
nicht in ihrer Steuererklärung an
beziehungsweise reichten gar keine
Steuererklärung ein. 84 % der Pendlerinnen und
Pendler (11,6 Millionen) nutzten zumindest für
einen Teil der Strecke das eigene Auto.
Großteil der Pendler/-innen mit Jahresbruttolohn
zwischen 20 000 und 100 000 Euro Ein Großteil
der Pendlerinnen und Pendler hatte ein mittleres
Einkommen: Mehr als die Hälfte (54 %) von ihnen
erhielt einen jährlichen Bruttolohn von 20 000
bis unter 50 000 Euro, bei weiteren 30 % lag er
zwischen 50 000 und 100 000 Euro im Jahr. Unter
20 000 Euro verdienten 11 % aller Pendlerinnen
und Pendler, mindestens 100 000 Euro 5 %.
Insgesamt machten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die die Pendlerpauschale nutzten,
43 % aller veranlagten Steuerfälle mit Einkommen
aus nichtselbständiger Arbeit aus. Der Anteil
war bei Pendlerinnen und Pendler mit einem
jährlichen Bruttolohn von 50 000 bis unter
100 000 Euro am höchsten (62 %). Bei einem
Bruttolohn von mindestens 100 000 im Jahr lag er
bei 56 %, bei 20 000 bis unter 50 000 Euro
brutto jährlich bei 49 %.
Unter den
veranlagten Steuerfällen mit einem
Jahresbruttolohn von unter 20 000 Euro machten
17 % von der Pendlerpauschale Gebrauch.
Personen außerhalb von Großstädten pendelten im
Schnitt weiter Die Längen der Pendelstrecken
unterscheiden sich je nach Wohnort. Lebten
Pendlerinnen oder Pendler in einer Großstadt mit
mindestens 100 000 Einwohnerinnen und
Einwohnern, legten sie durchschnittlich rund 24
Kilometer zur Arbeit zurück.
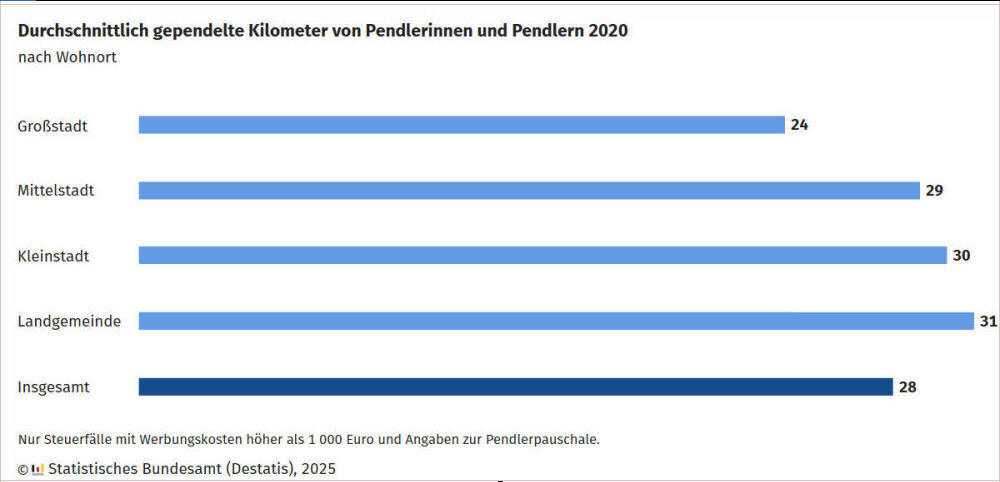
In
Mittelstädten mit 20 000 bis unter 100 000
Einwohnerinnen und Einwohnern waren es mit 29
Kilometern bereits 5 Kilometer mehr. In
Kleinstädten mit 5 000 bis unter 20 000
Einwohnerinnen und Einwohnern sowie in
Landgemeinden betrug der durchschnittliche
Arbeitsweg 30 beziehungsweise 31 Kilometer. Je
ländlicher eine Person wohnte, desto häufiger
fuhr sie zudem mit dem Auto. In Großstädten
gaben 68 % der Pendlerinnen und Pendler an,
zumindest für einen Teil der Strecke das Auto zu
nutzen. In Mittel- und Kleinstädten betrug der
Anteil 87 % beziehungsweise 91 %, in
Landgemeinden 93 %.
Öffentliche Schulden im 4. Quartal
2024 um 2,6 % höher als Ende 2023
Öffentlicher Schuldenstand steigt um 63,9
Milliarden Euro
Der Öffentliche
Gesamthaushalt war beim nicht-öffentlichen
Bereich zum Jahresende 2024 mit 2 509,0
Milliarden Euro verschuldet. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach
vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg die
öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem
Jahresende 2023 um 2,6 % oder 63,9 Milliarden
Euro.
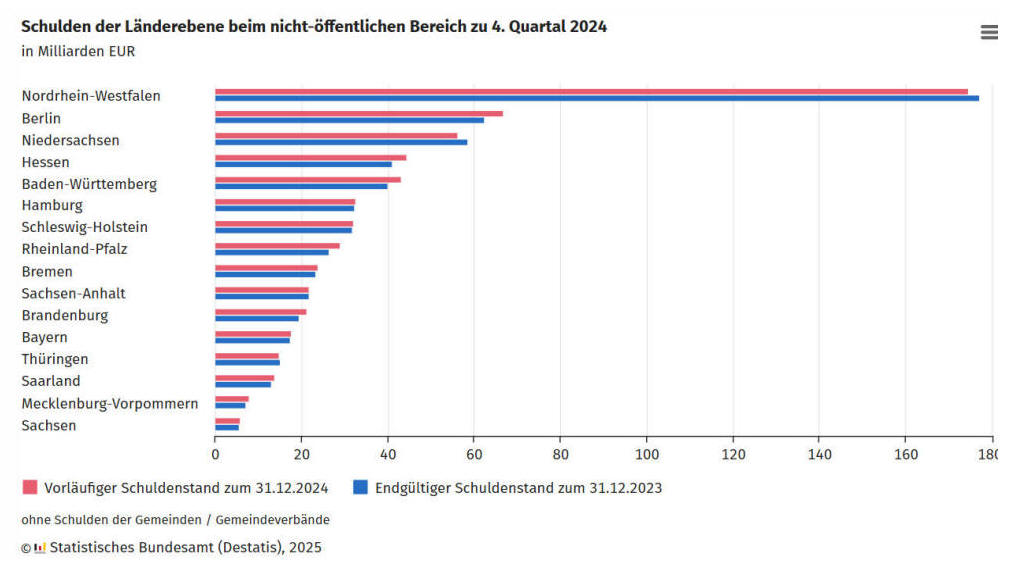
Gegenüber dem 3. Quartal 2024
stieg die Verschuldung um 0,8 % oder 20,5
Milliarden Euro. Zum Öffentlichen Gesamthaushalt
zählen die Haushalte von Bund, Ländern,
Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der
Sozialversicherung einschließlich aller
Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich
gehören Kreditinstitute sowie der sonstige
inländische und ausländische Bereich, zum
Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.
Schulden des Bundes steigen um 2,1 %
Die Schulden des Bundes waren zum
Ende des 4. Quartals 2024 um 2,1 %
beziehungsweise 36,5 Milliarden Euro höher als
Ende 2023. Ursächlich hierfür war insbesondere
der Anstieg der Verschuldung des "Sondervermögen
Bundeswehr" um 295,6 % oder 17,2 Milliarden Euro
auf nunmehr 23,0 Milliarden Euro. Die
Verschuldung des Sondervermögens
"Wirtschaftsstabilisierungsfonds Corona"
hingegen sank binnen Jahresfrist um 40,2 % oder
14,9 Milliarden Euro auf 22,1 Milliarden Euro.
Gegenüber dem 3. Quartal 2024 stieg die
Verschuldung des Bundes um 0,8 % oder
13,6 Milliarden Euro.
Schulden der
Länder erhöhen sich ebenfalls um 2,1 % D
ie
Länder waren zum Ende des 4. Quartals 2024 mit
606,9 Milliarden Euro verschuldet, das waren
2,1 % oder 12,7 Milliarden Euro mehr als zum
Jahresende 2023.
Gegenüber dem
3. Quartal 2024 stieg die Verschuldung der
Länder um 0,1 % oder 796 Millionen Euro. Am
stärksten stiegen die Schulden gegenüber dem
Jahresende 2023 prozentual in
Mecklenburg-Vorpommern (+10,9 %),
Rheinland-Pfalz (+9,7 %), Brandenburg (+8,9 %)
und Hessen (+8,3 %). In Mecklenburg-Vorpommern
wurden auslaufende Kredite beim öffentlichen
Bereich am Kapitalmarkt (nicht-öffentlicher
Bereich) teilweise refinanziert.
Der
Schuldenanstieg in Rheinland-Pfalz ist im
Wesentlichen dadurch begründet, dass im Rahmen
des Programms "Partnerschaft zur Entschuldung
der Kommunen in Rheinland-Pfalz" (PEK-RP) zum
31. Dezember 2024 insgesamt 2,8 Milliarden Euro
an kommunalen Kassenkrediten vom Land übernommen
wurden. Dadurch sank im Gegenzug die
Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände
in Rheinland-Pfalz.
Schuldenrückgänge
gegenüber dem Jahresende 2023 wurden lediglich
für Niedersachsen (-4,1 %), Thüringen (-1,8 %),
Nordrhein-Westfalen (-1,5 %) sowie
Sachsen-Anhalt (-0,8 %) ermittelt. Schulden der
Gemeinden und Gemeindeverbände wachsen um 9,5 %
Auch bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden
nahm die Verschuldung zum Ende des 4. Quartals
2024 gegenüber dem Jahresende 2023 zu.
Sie stieg um 9,5 % oder 14,7 Milliarden Euro auf
169,4 Milliarden Euro. Gegenüber dem 3. Quartal
2024 erhöhten sich die kommunalen Schulden um
3,7 % oder 6,1 Milliarden Euro. Den höchsten
prozentualen Schuldenanstieg gegenüber dem
Jahresende 2023 wiesen dabei die Gemeinden und
Gemeindeverbände in Mecklenburg-Vorpommern
(+17,7 %) auf, gefolgt von Sachsen (+17,3 %),
Niedersachsen (+15,0 %), Bayern (+14,0 %) und
Nordrhein-Westfalen (+12,8 %).
Einen
Rückgang der Verschuldung gab es lediglich in
Rheinland-Pfalz (-21,3 %) wegen des
Entschuldungsprogramms PEK-RP sowie in Thüringen
(-4,0 %) und im Saarland (-0,3 %). Die
Verschuldung der Sozialversicherung sank im
4. Quartal 2024 gegenüber dem Jahresende 2023 um
1,4 Millionen Euro (-3,5 %) auf
39,5 Millionen Euro.
Zeitumstellung

Uhr 1 Stunde vorstellen
|

Im
Oktober Uhr 1 Stunde zurückstellen
|
Im März
Uhr um eine Stunde auf die Sommerzeit vorstellen
- im Oktober um eine Stunde zurückstellen
Während des Zweiten
Weltkriegs wurde die Sommerzeit wieder
eingeführt. Unmittelbar nach dem Krieg wurde die
jährliche Umstellung auf Sommerzeit von den
westlichen Besatzungsmächten bestimmt. 1947
wurden die Uhren zwischen dem 11. Mai und 29.
Juni im Rahmen der so genannten Hochsommerzeit
zwei Stunden vorgestellt. Diese endete mit Ende
des Jahres 1949. Ursprünglich galt die MESZ in
Deutschland für die Zeit zwischen dem letzten
Sonntag im März und dem letzten Sonntag im
September. Von 1950 bis 1979 gab es in
Deutschland keine Sommerzeit.
Die
erneute Einführung der Sommerzeit wurde in der
„alten“ Bundesrepublik 1978 beschlossen, trat
jedoch erst 1980 in Kraft.
Zum einen
wollte man sich bei der Zeitumstellung den
westlichen Nachbarländern anpassen, die bereits
1977 als Nachwirkung der Ölkrise von 1973 aus
energiepolitischen Gründen die Sommerzeit
eingeführt hatten. Zum anderen musste man sich
mit der DDR über die Einführung der Sommerzeit
einigen, damit Deutschland und insbesondere
Berlin nicht zusätzlich noch zeitlich geteilt
war.
Die Bundesrepublik und die DDR
führten die Sommerzeit zugleich ein, das diente
der Harmonisierung. In der DDR regelte die
Verordnung über die Einführung der Sommerzeit
vom 31. Januar 1980 die Umstellung.
Von
1981 bis 1995 begann in Deutschland die
Sommerzeit am letzten Sonntag im März um 2.00
Uhr MEZ und endete am letzten Sonntag im
September um 3.00 Uhr MESZ. Durch die
Vereinheitlichung der unterschiedlichen
Sommerzeitregelungen in der Europäischen Union
wurde die Sommerzeit 1996 in Deutschland um
einen Monat verlängert und gilt seitdem vom
letzten Sonntag im März um 2.00 Uhr MEZ bis zum
letzten Sonntag im Oktober um 3.00 Uhr MESZ.
(Richtlinie 2000/84/EG des Europäischen
Parlamentes).
Die Zeit
Man kann die Zeit am Lauf der Gestirne oder mit
Atomuhren präzise messen. Uns allen steht am Tag
gleich viel davon zur Verfügung, nämlich 24
Stunden. Die Zeit ist somit etwas Objektives.
Dennoch hat Zeit auch eine subjektive Dimension.
Möchten Sie nicht auch in schönen Momenten die
Zeit anhalten? Scheint sie nicht in anderen
Fällen zu kriechen oder dann wieder rasend
schnell zu vergehen, fragte einmal Johann
Hahlen, Präsident des Statistischen Bundesamtes.
Drei Stunden täglich
wenden Personen ab 10 Jahren im Durchschnitt für
Bildung und Erwerbstätigkeit auf. Eine halbe
Stunde mehr Zeit ( 3 Stunden) wird mit
unbezahlter Arbeit für Haushalt und Familie und
mit Ehrenämtern verbracht. Ein gutes Drittel
seiner Zeit verschläft der Durchschnittsmensch
und rund 2 stunden braucht er für persönliche
Dinge wie Anziehen, Körperpflege und Essen. Gut
25 % des Tages - das sind sechs Stunden - nehmen
Freizeitaktivitäten wie Fernsehen, Sport, Hobby
und Spiele sowie das soziale Leben in Anspruch.
Frauen leisten mehr
unbezahlte Arbeit und wenden mehr Zeit für
soziale Kontakte. Dagegen stehen bei den Männern
Erwerbstätigkeit sowie Spiele und die
Mediennutzung stärker im Vordergrund. Im
Vergleich zum Anfang der 90er Jahre wird in
Deutschland weniger gearbeitet, sowohl bezahlt
als auch unbezahlt. Dafür steht mehr Freizeit
und mehr Zeit für persönliche Dinge wie das
Essen zur Verfügung.
In anderen Ländern mit vergleichbaren Erhebungen
beansprucht insbesondere die Erwerbstätigkeit -
hier ohne den Weg zur Arbeit - mehr Zeit als die
durchschnittlich 2 Stunden pro Tag bei Männern
und 1 œ Stunden bei Frauen in Deutschland. In
Ländern wie Finnland und Großbritannien, in
denen deutlich mehr Personen erwerbstätig sind,
wird insgesamt bis zu einer halben Stunde pro
Tag mehr gegen Bezahlung gearbeitet. Dafür ist
hier die unbezahlte Arbeit eine Viertelstunde
geringer als in Deutschland oder Belgien.
Personen, die
vollzeiterwerbstätig sind, arbeiten über die
Woche von Montag bis Sonntag verteilt
durchschnittlich knapp fünf Stunden pro Tag.
Wenn sie zu Hause sind, wartet weitere Arbeit
auf sie: Das Essen vorbereiten, die Kinder ins
Bett bringen und andere unbezahlte Arbeiten
nehmen etwas mehr als 2 œ Stunden in Anspruch.
Das ist eine Stunde weniger unbezahlte Arbeit
als im Durchschnitt der gesamten erwachsenen
Bevölkerung.
Zur Entspannung
lesen, fernsehen, ab und zu zum Sport und seinen
Hobbys nachgehen - das macht insgesamt 3 Stunden
aus. Knapp zwei Stunden werden für das soziale
Leben aufgebracht. Für Schlafen, Essen und
Körperpflege bleiben dann noch 10 Stunden.
Rentner machen
durchschnittlich 4 Stunden Hausarbeit über den
ganzen Tag verteilt und von vielen Pausen
unterbrochen. Zwischendurch lesen sie, sehen
fern oder gehen spazieren - alles in allem knapp
fünf Stunden täglich.
Da Rentner oft
allein leben, ist die tägliche Stunde an
Gesprächen, Telefonaten und Besuchen von
Verwandten oder Bekannten für sie sehr wichtig.
Nahezu ebensoviel Zeit nehmen der Besuch von
Veranstaltungen und die Ruhepausen während des
Tages in Anspruch. Für Schlafen, Körperpflege
und Essen nehmen sie sich mit gut 11 Stunden
mehr Zeit als in jüngeren Jahren. Vieles dauert
im Alter einfach älter.
Die bezahlten
Arbeitsstunden, die die Bevölkerung in
Deutschland einbringt, fließen in jedem Quartal
in die Größe des Bruttoinlandsprodukts ein. Das
Bruttoinlandsprodukt ist der am häufigsten
gebrauchte Maßstab für die wirtschaftlichen
Leistungen einer Volkswirtschaft.
Doch
gearbeitet wird nicht nur gegen Bezahlung.
Unbezahlte Arbeit wird in beträchtlichem Umfang
in den privaten Haushalten von und für die
Familie erbracht. Diese unbezahlten Tätigkeiten
umfassen mehr Stunden als die bezahlte Arbeit.
In Zahlen bedeutet das, daß über die ganze Woche
verteilt alle Personen ab 10 Jahren
durchschnittlich gut 25 Stunden unbezahlt,
bezahlt dagegen etwa 17 Stunden arbeiten.
Die Bewertung der
unbezahlten Arbeit in Euro ist ein schwieriges
Unterfangen. Eine sinnvolle Bewertung besteht
darin, den Stundenlohn einer Hauswirtschafterin
heranzuziehen. Diese Personen erledigen und
organisieren alle Arbeiten im Haushalt.
Da mit der unbezahlten Arbeit keine soziale
Absicherung verbunden ist, also keine oder nur
geringe Ansprüche an die Renten-, Arbeitslosen-
oder Krankenversicherung entstehen, erscheint
aus dieser Perspektive eine Bewertung mit dem
Nettolohn angemessen. Dieser betrug 1992 knapp 6
Euro, in 2001 gut 7 Euro je Stunde. Obwohl das
Jahresvolumen in Stunden zurückgegangen ist, ist
der Wert der unbezahlten Arbeit im Haushalt
damit von 603 Milliarden Euro in 1992 auf 684
Milliarden Euro in 2001 angestiegen.
Nicht alles, was im
Haushalt produziert wird, beruht allein auf
unbezahlter Arbeit. So werden für ein
Mittagessen Zutaten eingekauft und dauerhafte
Gebrauchsgüter wie Kühlschrank oder Herd
genutzt. Auch muss die Küche entsprechend groß
und ausgestattet sein, was Kosten für die
Kücheneinrichtung mit sich bringt.
Der
Gesamtwert der unbezahlten Produktion im
Haushalt, der alle diese Komponenten einbezieht,
war 2001 mit 1121 Milliarden Euro um 22 % höher
als im Jahre 1992. Der Wert der Produktion im
Haushalt, der bei Unternehmen am ehesten mit dem
Umsatz vergleichbar wäre, ist somit deutlich
stärker angestiegen als der Wert der unbezahlten
Arbeit mit 13 % und etwas stärker als der
Verbraucherpreisindex, der in diesem Zeitraum um
gut 18 % zulegt.
In 2001 entfielen 61 %
des Wertes der Produktion auf unbezahlte Arbeit
und 27 % auf Käufe von Gütern, die mit der
Haushaltsproduktion verbraucht werden. Die
Abschreibungen auf die im Haushalt genutzten
dauerhaften Gebrauchsgüter hatten nur einen
Anteil von 3 %.
Insbesondere die Haus- und Gartenarbeit sowie
die Pflege und Betreuung von Kindern und anderen
Haushaltsmitgliedern werden nach wie vor
überwiegend von Frauen durchgeführt.
Während sich bei der Haus- und Gartenarbeit das
Verhältnis des Zeitaufwands von Frauen und
Männern im früheren Bundesgebiet von 2,7 auf 2,3
und in den neuen Bundesländern von gut 2,2 auf
knapp 1,9 verbesserte, ergibt sich bei der
Pflege und Betreuung von Kindern bzw. anderen
Haushaltsmitgliedern zumindest im früheren
Bundesgebiet ein anderes Bild.
Hier hat
sich die Arbeitsteilung sogar noch weiter zu
Ungunsten der Frauen verschoben. Je nach Alter,
der Einbindung ins Berufsleben und der
Familienstruktur arbeiten die Frauen zwischen
einer Dreiviertelstunde und 4 Stunden mehr im
Haushalt.
In den Paarhaushalten sind
Männer nach wie vor für Reparaturen und
handwerkliche Aktivitäten zuständig. Daneben
beteiligen sie sich insbesondere an Einkauf und
Haushaltsplanung. In Paarhaushalten mit Kindern,
in denen nur der Partner erwerbstätig ist,
beteiligen sich Männer zu 34 % an den Einkäufen.
Sind beide erwerbstätig, werden 39 % der
Einkäufe von Männern erledigt (jeweils eine
halbe Stunde). Bei Rentnerehepaaren investieren
die Männer sogar mehr Zeit in den Einkauf und
die Haushaltsplanung als die Frauen.
Das Leben der Frauen in
den neuen Bundesländern war Anfang der 90er
Jahre ganz wesentlich von der Erwerbstätigkeit
bestimmt. Die Erwerbszeiten von erwerbstätigen
Frauen, die in Paarhaushalten mit Kindern leben,
haben zwar seitdem abgenommen. Trotzdem wenden
diese Frauen in 2001 / 2002 von Montag bis
Freitag mit durchschnittlich 6 ΠStunden
deutlich höhere Zeiten für Erwerbstätigkeit und
Bildung auf als im früheren Bundesgebiet mit
knapp 4 Stunden.
In den neuen
Bundesländern ist der Anteil der
vollzeiterwerbstätigen Mütter immer noch höher
und teilzeiterwerbstätige Mütter arbeiten länger
als im früheren Bundesgebiet.
Die tatsächlich
praktizierte Arbeitsteilung besagt nichts
darüber, ob die Menschen nach ihrer eigenen
Einschätzung über genügend, zu wenig oder zu
viel Zeit für eigene Lebensbereich verfügen.
Generell gilt: Sowohl bei Paaren mit Kindern als
auch bei Paaren ohne Kind betrachtet die
Mehrheit ihren Zeitaufwand für Beruf und
Qualifikation bzw. für die Hausarbeit als gerade
richtig.
Etwa
zwei Fünftel der Bevölkerung finden neben
Erwerbstätigkeit und familiären Aufgaben Zeit
für bürgerschaftliches Engagement. Das
Engagement in einer Elternvertretung kann ebenso
dazu zählen wie die Initiative im Mütterzentrum
oder die Übungsleitung im Sportverein. Im
breiten Feld bürgerschaftlichen Engagements
bildet das Ehrenamt im engeren Sinne ein
wichtiges Element. Immerhin 18 % der Erwachsenen
nehmen sich Zeit für ein Ehrenamt.
In
welchem zeitlichen Umfang einer solchen Aufgabe
nachgegangen wird, ist nicht zuletzt vom
familiären Rahmen und der Einbindung in das
Erwerbsleben bestimmt. Wird der Durchschnitt
über alle Erwachsene herangezogen, scheint der
wöchentliche Zeitaufwand von 52 Minuten eher
gering. Wenn aber tatsächlich ein Ehrenamt
ausgeübt wird, so nimmt diese Aufgabe mit gut 4
Ÿ Stunden pro Woche bei der ausübenden Person
einen erheblichen Teil der freien Zeit ein. Am
stärksten ist das Engagement bei den
Alleinlebenden.
In welcher Weise sich Männer und Frauen die
Kinderbetreuung teilen, hängt nicht nur von
Traditionen und persönlichen Neigungen, sondern
auch stark von der Erwerbstätigkeit des Partners
ab. Erwerbstätige Frauen mit Kindern unter 6
Jahren wenden für die Betreuung ihres
Nachwuchses mit 2 ΠStunden doppelt so
viel Zeit auf wie erwerbstätige Männer, nicht
erwerbstätige Frauen mit 3 Œ Stunden sogar etwa
das Dreifache.
Mit steigendem Alter der
Kinder reduziert sich die Betreuungszeit
spürbar. Bei Paaren, deren jüngstes Kind
zwischen 6 und 18 Jahren alt ist, macht sie
weniger als ein Drittel der Zeit aus, die Eltern
mit Kindern unter 6 Jahren aufwenden. Dabei
verändert sich die Verteilung der zeitlichen
Belastung auf Mütter und Väter kaum.
Viele Haushalte erhalten
Hilfe von Verwandten, Nachbarn oder Freunden,
sei es bei Haushaltstätigkeiten oder der
Betreuung der Kinder, beim Bauen oder
Reparieren. Nicht immer handelt es sich um
praktische Hilfestellungen. Manchmal kann ein
Gespräch mit Freunden ein ebenso wichtiger
Beistand sein. 56 % aller Alleinerziehenden- und
46 % aller Paarhaushalte mit minderjährigen
Kindern sind im Alltag auf Unterstützung
angewiesen.
Das
Lernen gehört zu den wichtigsten Aktivitäten
überhaupt. Vieles lernen wir von unseren Eltern,
anderes in Schule oder Hochschule, am
Arbeitsplatz, auf Kursveranstaltungen, durch
Beobachten und Ausprobieren oder auch durch
Selbststudium.
Bildung und Lernen wird
jedoch gemeinhin mit Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in Verbindung gebracht.
Allerdings machen die sich immer schneller
wandelnden Anforderungen in Beruf und
Gesellschaft ein kontinuierliches Lernen durch
verstärkte Weiterbildung erforderlich.
Doch wie viel Zeit nimmt eigentlich das Lernen
in verschiedenen Lebensabschnitten in Anspruch?
Für den Besuch von Schule und Hochschule, die
berufliche Fortbildung während und außerhalb der
Arbeitszeit und die allgemeine Weiterbildung
bringen Personen im Alter ab 10 Jahren
durchschnittlich eine knappe Dreiviertelstunde
pro Tag auf. Frauen geringfügiger als Männer.
Die Jugendlichen lernen deutlich
länger. So wenden die 10- bis 18jährigen
einschließlich Hausaufgaben und Selbststudium
durchschnittlich etwa 3 œ Stunden täglich für
das Lernen auf. Während bei den 18- bis
25jährigen noch 1 œ auf Lernaktivitäten
entfallen, ist es in der Gruppe der 25- bis
45jährigen lediglich noch eine gute
Viertelstunde. Personen über 45 Jahren sind
durchschnittlich nur wenige Minuten täglich mit
Bildung und Lernen beschäftigt. Mädchen und
junge Frauen bis zum Alter von 25 Jahren
beteiligen sich insgesamt etwas mehr an
Lernaktivitäten als Männer, ältere Frauen etwas
weniger oder gleich lang.
In unserer
schnelllebigen Zeit werden berufliche und
allgemeine Weiterbildung immer wichtiger.
Dennoch finden bei allen Personen ab 10 Jahren
gut 85 % aller Bildungs- und Lernaktivitäten im
Rahmen von Schule bzw. Hochschule statt.
Berufliche Weiterbildungsaktivitäten innerhalb
und außerhalb der Arbeitszeit haben mit knapp 4
% bzw. gut 3 % zusammen ein ähnliches Gewicht
wie die allgemeine Weiterbildung (7,5 %).
Welche Bedeutung hat
der formale Bildungsabschluss für die
Beteiligung an beruflicher und allgemeiner
Weiterbildung? Bei Personen, die bereits über
einen Abschluss einer Wissenschaftlichen
Hochschule (insbesondere Hochschule) verfügen,
steht mit gut 86 % das selbst organisierte
Lernen, etwa durch selbst organisierte Gruppen
oder das Selbstlernen mit Büchern, dem Computer
o. ä., eindeutig im Vordergrund. Unter jenen,
die eine berufliche Lehre absolvieren, beträgt
dieser Anteil gut zwei Drittel.
Den Feierabend als freie
Zeit nach der Erwerbsarbeit gibt es sicherlich
nicht so uneingeschränkt. Zwar endet für viele
die Erwerbsarbeit schon ab 16 Uhr. Das bedeutet
aber nicht, dass danach nicht mehr gearbeitet
wird. Gerade in der Zeit 16 bis 20 Uhr wird eine
ganze Menge für den Haushalt getan.
Trifft die Vorstellung zu, dass nicht
erwerbstätige Menschen - jung oder alt - freie
Zeit im Übermaß haben?
An einem durchschnittlichen Wochentag haben
Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren
tatsächlich viel Zeit für Mediennutzung, ihr
soziales Leben, Hobbys und Sport. Von Montag bis
Freitag beanspruchen diese Aktivitäten
durchschnittlich 6 Stunden am Tag: 5 Stunden bei
Mädchen und 6 bei Jungen. Schule und
Hausaufgaben nehmen bei den Jungen und Mädchen
durchschnittlich gute 5 Stunden ein. Bei den
unbezahlten Arbeiten im Haushalt helfen Mädchen
mit gut 1 Stunden bereits mehr mit als Jungen
mit etwa einer Stunde.
Mit steigendem Alter
nimmt der Anteil derer zu, die erwerbstätig
sind. So befinden sich von den Jugendlichen bzw.
Erwachsenen zwischen 15 und 20 Jahren viele in
einer beruflichen Ausbildung. Dies spiegelt sich
an den Wochentagen in 1 Stunden Erwerbsarbeit
bei den jungen Frauen und gut 2 Stunden bei den
jungen Männern wider.
Freitag, 28. März
2025
Moers: Pflegefamilien gesucht -
Infoabend über die bereichernde Aufgabe
Einige Kinder können nicht in ihren
Familien leben, da ihre Eltern sie aus
unterschiedlichen Gründen nicht ausreichend
versorgen, fördern und erziehen können.

Pflegefamilien bieten für Kinder, die nicht bei
ihren Eltern aufwachsen können, einen
verlässlichen Lebensort. (Foto: Bubble 1971)
Pflegefamilien sind dann ein
verlässlicher Lebensort. Der Pflegekinderdienst
der Stadt Moers sucht herzliche, geduldige,
positiv eingestellte und flexible Menschen, die
diese Kinder aufnehmen und so ihren Alltag
bereichern möchten. Ausführliche Informationen
über die spannende Aufgabe erhalten
Interessierte am Dienstag, 8. April, ab 18.30
Uhr, in den Räumen des Pflegekinderdienstes in
Utfort, Rathausallee 141. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
Beratung,
Begleitung, Schulung
Der Pflegekinderdienst
betreut etwa 120 Kinder in Dauer- und
Bereitschaftspflegefamilien und bietet u. a.
eine fachliche Beratung und Begleitung durch
persönliche Ansprechpartner sowie Schulungen,
Fortbildungen, Pflegegeld und Zusatzleistungen.
Es bestehen zudem verschiedene Angebote, sich
mit anderen Pflegeeltern auszutauschen.
Beim Infoabend gibt das Team des
Pflegekinderdienstes einen Einblick in die
Voraussetzungen, die eine Pflegefamilie
mitbringen sollte, und stellt die Bedürfnisse
der Kinder dar, die nicht in ihren leiblichen
Familien aufwachsen können. Selbstverständlich
ist das Team für alle Fragen zum Thema offen.
Bund stellt 300 Millionen Euro für das
Förderprogramm „Klimafreundlicher Neubau“ (KFN)
bereit
Klara Geywitz, Bundesministerin für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen erklärt:
„Es freut mich, dass unser Programm
‚Klimafreundlicher Neubau‘ weiterhin so gut am
Markt angenommen wird. Wir konnten damit seit
dem Start des Programms Anfang 2023 knapp
100.000 neue Wohnungen fördern, die dringend
gebraucht werden. Der Bedarf an zinsverbilligten
Krediten bleibt hoch. Wichtig ist, dass die
Förderung verlässlich und stabil weiterläuft.
Dafür hat die Bundesregierung heute gesorgt."
Seit Förderstart am 1. März 2023 bis zum
31. Dezember 2023 wurden Förderzusagen in Höhe
von rund 7,6 Milliarden Euro erteilt. Es wurden
47.734 Wohneinheiten gefördert und
Gesamtinvestitionen von über 17 Milliarden Euro
angestoßen.
Im vergangenen Jahr wurden
für das Programm KFN Förderzusagen in Höhe von
rund 6,9 Milliarden Euro erteilt. Insgesamt
wurden so Investitionen von 18,4 Milliarden Euro
angestoßen. Es wurden 47.247 Wohneinheiten
gefördert.
Ausschuss verabschiedete
Fachbereichsleiterin Susanne Hein
Seit dem 1. März 2018 war Suanne Hein
Leiterin des städtischen Fachbereichs Interner
Service und damit auch Personalchefin. Ende des
März geht sie in den Ruhestand.

Foto: Pressestelle
Der Ausschuss für
Personal und Digitalisierung verabschiedete Hein
in der Sitzung am Mittwoch, 26. März. Diese
Aufgabe übernahmen der stellvertretende
Vorsitzende Lukas Klaffki und Personaldezernent
Claus Arndt.
Susanne Hein war seit 1986
in verschiedenen Führungspositionen bei der
Stadt Moers tätig - zuerst als Leiterin der
Gleichstellungsstelle, als behördliche
Datenschutzbeauftragte, als Leiterin des
Prozessteams Verwaltungsreform, in der
Stabsfunktion Zentrale Steuerungsunterstützung
und als Leiterin des ‚Büro des Bürgermeisters‘.
Reparatur: Ab dem 31. März vorübergehend
kein Fahrdienst auf dem Waldfriedhof in
Dinslaken
Der Fahrdienst für gehbehinderte
Menschen am Waldfriedhof in Oberlohberg kann ab
dem 31. März 2025 vorübergehend nicht angeboten
werden: Das Elektrofahrzeug ist dann für
voraussichtlich eine Woche in der Werkstatt. Bis
dahin bittet die Stadt die
Friedhofsbesucher*innen um Verständnis.
Dinslakens Bürgermeisterin Eislöffel
lädt zu Fahrradfrühling mit verkaufsoffenem
Sonntag ein
Am Sonntag, 6. April 2025, rollen die
Räder wieder durch Dinslaken: Der 7. Dinslakener
Fahrradfrühling lädt alle Interessierten ein,
die neuesten Trends rund ums Fahrrad zu
entdecken. Von modernen E-Bikes bis hin zu
spannenden Aktionen für Kinder bietet die
Veranstaltung zahlreiche Highlights in der
Innenstadt.

Foto, von links nach rechts: Chiara Hübbers und
Andreas Schroer (Wirtschaftsförderung Stadt
Dinslaken), Andreas Eickhoff (Stadtmarketing
Dinslaken e.V.). Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel, Tobias Agthe (Center-Manager Neutor
Galerie), Emilie Heitmann (Neutor Galerie),
Joachim Vogel (Zweirad Vogel)
"Der
Fahrradfrühling ist eine gute Gelegenheit, die
Vielfalt und Möglichkeiten des Radfahrens zu
entdecken und dabei aktiv etwas für Gesundheit
und Umwelt zu tun. Ich lade alle herzlich ein,
mit uns den Energy Run, den Fahrradfrühling und
den verkaufsoffenen Sonntag zu erleben", so
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.
Auf
dem Neutorplatz stehen die aktuellen Fahrrad-
und E-Bike-Trends im Mittelpunkt. Besuchende
können sich über innovative Modelle informieren
und beraten lassen. Zweirad Vogel ist als
Hauptsponsor wieder mit einem breiten Angebot
vertreten.
Während auf dem Altmarkt ein
abwechslungsreiches Kinderprogramm geboten wird,
präsentiert das Gesundheitszentrum Lang in der
Neustraße 20 Verschiedenes rund um das Thema
Mobilität. Die Clown Brothers sorgen mit ihrer
unterhaltsamen Show für fröhliche Momente und
bringen Groß und Klein zum Lachen.
Der
Stadtwerke Dinslaken Energy Run startet bereits
am Morgen und läuft bis etwa 14 Uhr parallel zum
Fahrradfrühling. Die Stadt lädt dazu ein, die
Teilnehmenden des Laufs zunächst anzufeuern und
anschließend durch die Innenstadt zu schlendern.
Weitere Informationen zur Anmeldung sind
unter https://www.stadtwerke-dinslaken.de/privatkunden/service/uebersicht/stadtwerke-dinslaken-energy-run.html verfügbar.
Während der Läufe ist die Altstadt
eingeschränkt mit dem Auto befahrbar. Nutzen Sie
unter anderem die Tiefgarage am Rathaus (über
die Friedrich-Ebert-Straße) oder die
Parkmöglichkeiten auf der anderen Seite der
Friedrich-Ebert-Straße (z.B. Rutenwall, am
Neutor oder Neutor Galerie). Auch rund um den
Bahnhof und im Bereich der Trabrennbahn gibt es
mögliche Parkplätze.
Zusätzlich
empfohlen wird, wenn möglich, die Anreise zu
Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV. Gemeinsam mit
dem Fahrradfrühling sorgt das sportliche
Wochenende für jede Menge Bewegung und ein
aktives Stadtleben. Zum verkaufsoffenen Sonntag
öffnen die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler
von 13:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen.
Besucher*innen können die Gelegenheit nutzen,
durch die Geschäfte zu bummeln und sich auf die
neue Saison einzustimmen. In Verbindung mit den
zahlreichen Aktionen rund um das Fahrrad
verspricht der Fahrradfrühling ein
abwechslungsreiches Erlebnis für die ganze
Familie. Auch die Stadtinformation am Rittertor
hat für Besuchende geöffnet.
Der
Fahrradfrühling ist eine
Kooperationsveranstaltung der Stadt Dinslaken
mit Zweirad Vogel außerdem unterstützt die
Neutor Galerie, der Stadtmarketing Dinslaken
e.V., das Gesundheitszentrum Lang, Klar
Elektrotechnik und weiteren Partnerinnen und
Partnern.
Moers: Ausschuss berät über Baumaßnahmen
an Schulen
Aktuelle Berichte zu städtischen
Baumaßnahmen erhalten die Mitglieder des
Ausschusses für Bauen, Wirtschaft und
Liegenschaften am Montag, 31. März, um 16 Uhr.
Die Sitzung findet im Ratssaal des Rathauses,
Rathausplatz 1, statt.
Unter anderem
geht es um den Neubau und Sanierungen in den
Bereichen Sport, Schulen, Kitas, Kultur und
Feuerwehr. Zudem beraten die Mitglieder die
Baumaßnahmen an der Anne-Frank-Gesamtschule und
am Gymnasium in den Filder Benden.
Tanz in den Mai in & an der
Gerichtskantine Kleve
Mi., 30.04.2025 - 19:00 - Do.,
01.05.2025 - 02:00
KLE Event und CG Gastro
organisieren in der Gerichtskantine das Event
für Kleve zum Tanz in den Mai. Am 30. April 2025
wird in der Gerichtskantine Kleve ein
unvergesslicher Abend voller Musik, Tanz und
Genuss veranstaltet. Das Highlight des Abends:
Schlagerstar Normen Langen, der mit seinen Hits
das Publikum begeistern wird.

Doch damit nicht genug - für den perfekten Mix
aus Party-Sounds und mitreißenden Beats sorgen
DJ Carlos und das Team von Magic Sound, die
gemeinsam die Tanzfläche zum Beben bringen.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt:
Verschiedene Grillstationen bieten eine Auswahl
von vegetarischen Gerichten und saftigem
Grillfleisch. Frisch Gezapftes und viele Drinks
stehen in unserer Cocktailbar für Euch bereit.
Und wer clever feiert, nutzt die Happy Hour von
20 bis 21 Uhr!
Tickets gibt es bei
unserem Ticketpartner: Klever Festzelt unter
https://www.kleverfestzelt.de/
Bethanien Moers: Neuer Chefarzt der Klinik
für Allgemein- & Viszeralchirurgie nimmt ab dem
01. April seine Arbeit auf
Ab dem 01. April 2025 wird Prof. Dr.
Dirk Bausch (Foto) die Geschicke der Klinik für
Allgemein- & Viszeralchirurgie am Krankenhaus
Bethanien Moers leiten. Er folgt auf Dr.
Hans-Reiner Zachert, der sich nach 16 Jahren als
Chefarzt der Klinik und Leiter des Darmzentrums
in den Ruhestand verabschiedet.

Der erfahrene Chirurg Prof. Dr. Bausch kommt vom
Marienhospital Herne nach Moers, wo er bislang
als Chefarzt der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie tätig war. Für seinen Start
hat er sich einiges vorgenommen: „Ich habe im
Rahmen des Bewerbungsverfahrens einen sehr
positiven Eindruck von der Stiftung Bethanien
gewinnen können und freue mich deshalb schon
sehr auf den Beginn meiner Tätigkeit in Moers.
Mir ist es wichtig, die bestehende hohe
Qualität der Klinik für Allgemein- &
Viszeralchirurgie, die Dr. Zachert und sein Team
aufgebaut und über die Jahre erfolgreich
ausgebaut haben, weiter voranzutreiben. Ich
möchte bestehende und funktionierende Strukturen
erhalten, aber auch weiterentwickeln.
Ein mittelfristiges Ziel – neben der Etablierung
der minimal-invasiven Leber- und
Pankreaschirurgie am Standort – ist die
Einrichtung von Spezialsprechstunden.“ Diese
sollten nach Krankheitsbildern und den
entsprechenden Ansprechpartner:innen
aufgefächert sein, damit unter anderem
niedergelassene Ärzt:innen direkt wüssten, wer
welche Krankheitsbilder behandle. „Ich habe
hiermit in der Vergangenheit bereits sehr gute
Erfahrungen gemacht“, so Prof. Dr. Bausch.
Langfristig möchte er das
Viszeralonkologische Zentrum des Krankenhauses
Bethanien zu „dem“ Viszeralonkologischen Zentrum
der Region machen und „der“ Ansprechpartner für
die Bereiche Onkologische Chirurgie und
Endokrine Chirurgie werden. Patient:innen
erwartet indes ein Chefarzt, der sie und ihre
umfassende Versorgung in den Mittelpunkt stellt.
„Ich bin für meine Patientinnen und
Patienten da. Die meisten Operationen, auch bei
komplexen onkologischen Fällen, werde ich nach
Möglichkeit minimal-invasiv durchführen.
Betroffene erholen sich hierdurch
nachgewiesenermaßen schneller und besser.“
Mitarbeiter:innen des Krankenhauses
Bethanien können sich hingegen auf einen
Teamplayer freuen, der sich für ihre Förderung
und Weiterentwicklung einsetzen möchte – und der
viel Wert auf eine gute interdisziplinäre
Zusammenarbeit legt.
„Eine kollegiale
und freundschaftliche Art der Zusammenarbeit ist
für mich der Schlüssel, um Spitzenmedizin
anbieten zu können. Die Behandlung ist heute
immer ein Teamspiel – und bei diesem möchte ich
mich gut integrieren. Hierzu zähle ich auch die
niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Ihnen
stehe ich jederzeit als Ansprechpartner zur
Verfügung. Ich strebe einen engen Kontakt an,
weil man die Patientinnen und Patienten nicht
alleine versorgen kann“, erklärt der neue
Chefarzt.
Dr. Ralf Engels, Vorstand der
Stiftung Bethanien, betont: „Ich freue mich,
dass wir Herrn Prof. Dr. Bausch für unsere
Stiftung gewinnen konnten – und unseren
Patientinnen und Patienten so einen erfahrenen
Spezialisten für ihre bestmögliche Versorgung
zur Seite stellen können.“
Theater in Kleve: Kalter Weißer Mann
Fr., 04.04.2025 - 20:00 - Fr., 04.04.2025 -
22:00
Der Tod ist nie schön. Aber es könnte
schlimmer kommen, als mit 94 Jahren friedlich
einzuschlafen: Zum Beispiel eine Trauerfeier,
die völlig aus dem Ruder gerät.
Gernot
Steinfels, Patriarch einer Firma des alten
deutschen Mittelstands, ist verstorben, und sein
designierter Nachfolger (60) richtet für das
Unternehmen die Beisetzung aus. Doch sein Text
auf der Schleife sorgt für heftige Irritation:
„In tiefer Trauer. Deine Mitarbeiter“. Schnell
hat der neue „alte weiße Mann“ an der Spitze
nicht nur seine Marketing-Leiterin, den
Social-Media-Chef und seine Sekretärin gegen
sich, sondern auch die sehr selbstbewusste
Praktikantin.
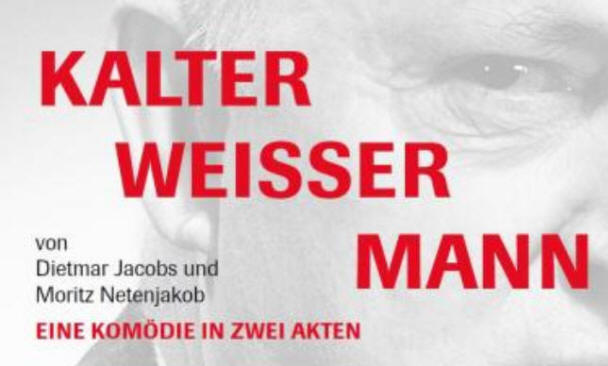
Vor dem Theaterpublikum als versammelter
Trauergemeinde zerfleischt sich in diesem
hochpointierten Stück schließlich die
Führungsetage der Firma immer mehr. Und nicht
einmal der verzweifelte Pfarrer kann die Wogen
glätten.
Die wendungsreiche Komödie von
Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob (u.a.
EXTRAWURST) zeichnet mit scharfem Blick und
lustvoller Hingabe die Abgründe, Fallstricke und
rhetorischen Kniffe der aktuellen Diskussion
über soziale Umgangsnormen, ihre
menschlich-allzumenschlichen Ursachen, weckt
aber auch die Sehnsucht nach einem aufmerksamen
und respektvollen Umgang miteinander.
Die
Tickets sind bei der Buchhandlung Hintzen sowie
über das XOX-Kartentelefon (Tel.: 02821-78755)
oder per E-Mail an xox-theater@web.de
erhältlich.
„Ahoi!“ – Saunafans gehen auf große
Kreuzfahrt in Neukirchen-Vluyn
Auch im April gibt es im Freizeitbad
Neukirchen-Vluyn einen besonderen Saunatreff
Aufgrund der Ostertage gibt es im April nur eine
Ausgabe des beliebten Saunatreffs im Freizeitbad
Neukirchen-Vluyn.
Die ENNI Sport & Bäder
Niederrhein (Enni) lädt alle Saunafans dazu am
Samstag, 5. April, in das Freizeitbad ein, das
dann zwischen 18 Uhr und 24 Uhr ein besonderes
Programm bietet. Die Nutzung der Sauna und des
Hallenbades ist dann ausschließlich textilfrei
möglich. „
Ahoi! Alle Leinen los“
lautet das Motto des Abends, der die Besucher
auf eine große Kreuzfahrt entführt. Dabei gibt
es Aufgüsse mit Aromen aus aller Welt. An der
Nordseeküste erwartet die Leichtmatrosen ein
Duft aus Sanddorn, einen Hauch aus Westindien
versprüht Lemongras, von den alten Wikingern
erfahren die Saunafans die Heilkunde des Terva
und abschließend rundet eine steife Brise mit
Sole das Kreuzfahrtprogramm ab.
Weitere
Informationen – auch zu den Eintrittspreisen –
gibt es unter
www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de
vhs Moers – Kamp-Lintfort:
Philosophischer Vortrag ‚Was ist das Böse?‘
Eine philosophische Betrachtung der
Frage ‚Was ist das Böse?‘ gibt es bei einem
Vortrag der vhs Moers – Kamp-Lintfort am
Donnerstag, 10. April. Ab 19 Uhr geht es in der
vhs Moers, an der Wilhelm-Schroeder-Straße 10,
um Überlegungen rund ums ‚Böse‘ - von der
Frühaufklärung bis in die Gegenwart, von
Voltaire bis Hannah Arendt.
Erörtert
werden Fragen wie ‚Ist das Böse ein wesentlicher
Bestandteil der menschlichen Natur?‘, ‚Ist das
Böse tiefgründig oder banal?‘ und ‚Ist das Böse
überhaupt verstehbar?‘
Im Anschluss an
den Vortrag soll das Thema kontrovers diskutiert
werden. Eine vorherige Anmeldung ist
erforderlich und telefonisch unter 0 28 41/201 –
565 sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.
Frühlingsgefühle für zuhause:
SCHÖNER WOHNEN Naturell Kreidefarbe bringt
frische Natürlichkeit in die eigenen vier Wände
Für Wände und Holzmöbel: 20 pudermatte,
von der Natur inspirierte Farbtöne, schaffen ein
harmonisches und natürliches Ambiente
Frischekick für den Lieblingsraum – die SCHÖNER
WOHNEN Naturell Kreidefarbe „Frühlingserwachen“
versprüht die Energie des Frühlings.

Foto SCHÖNER WOHNEN-Kollektion
Im
Frühjahr erwacht die Natur zu neuem Leben –
damit wächst auch zuhause die Lust auf frische
und natürliche Farbtöne. Mit SCHÖNER WOHNEN
Naturell Kreidefarbe in den Nuancen
„Frühlingserwachen“, „Blütenzauber“,
„Kirschblütenmeer“ oder „Eukalyptuswald“ lässt
sich der Frühling ganz einfach in die eigenen
vier Wände holen. So erinnern sanfte Grün-,
Rosa- und Gelbtöne an blühende Kirschbäume,
zartes Blattgrün und warme Sonnenstrahlen. Im
Handumdrehen sorgen die pastelligen Wandfarben
für eine Wohlfühlatmosphäre und ein
Gute-Laune-Gefühl – und zwar das ganze Jahr
über.
Mehr Wohlbefinden für zuhause
Die Serie SCHÖNER WOHNEN Naturell
Kreidefarbe besteht aus 20 hochdeckenden
Wandfarben, deren Nuancen von der Natur
inspiriert sind. Namen wie „Rosenduft“ oder
„Waldgeflüster“ vermitteln bereits eine
Vorstellung davon, welche Atmosphäre sie im Raum
erschaffen können. Besonders elegant wirken die
Farben von SCHÖNER WOHNEN Naturell Kreidefarbe
in Kombination mit Naturmaterialien wie
unbehandeltem Holz, Korbaccessoires oder
Sisalteppichen. So entsteht eine stilvolle
Balance, die Wohnräume zeitlos und behaglich
wirken lässt.
DIY-Tipp: Naturell
Kreidefarbe bietet vielseitige
Gestaltungsmöglichkeiten. So verschönern die
Farben nicht nur Wände, sondern auch Holzmöbel –
sei es Ton-in-Ton oder mit verschiedenen
Farbtönen, die sich harmonisch aufeinander
abstimmen lassen. Wichtig: Für eine zuverlässige
Versiegelung der Oberflächen nach dem Streichen
den transparenten SCHÖNER WOHNEN Naturell
Möbelschutz verwenden.
Wellness für die
Wände
Die SCHÖNER WOHNEN Naturell
Kreidefarbe trägt nicht nur zu einem
harmonischen Wohngefühl bei, sondern steht auch
für einen bewussten, nachhaltigen Lebensstil.
Natürliche Inhaltsstoffe wie Kreide,
Porzellanerde und Farbpigmente sorgen für ein
pudermattes Finish, eine hohe Farbtonstabilität
und eine besondere Farbtiefe.
Die vegane
Rezeptur kommt ohne Lösemittel, Weichmacher und
Konservierungsmittel aus und ist somit auch für
Allergikerinnen und Allergiker geeignet. Das
Bindemittel besteht aus nachwachsenden
Rohstoffen (nach dem Massenbilanzverfahren),
wodurch wertvolle Ressourcen geschont werden.
Diese Eigenschaften machen die SCHÖNER WOHNEN
Naturell Kreidefarbe zu einer umweltfreundlichen
Wahl für moderne Wohnkonzepte.
Noch mehr
Möglichkeiten: Neue praktische 1-Liter-Größe
Ob für kleinere Streichprojekte oder
Ausbesserungen an Möbeln und Wänden – mit der
neuen 1-Liter-Größe lässt sich die SCHÖNER
WOHNEN Naturell Kreidefarbe noch vielfältiger
und flexibler einsetzen. Sie eignet sich etwa
ideal, um individuelle Akzente zu setzen – sei
es beim Upcycling kleiner Möbelstücke oder beim
Verschönern dekorativer Elemente wie
Bilderrahmen und Regalböden. Die kompakte Größe
ermöglicht zudem ein nachhaltigeres Arbeiten.
Denn weniger Farbe bedeutet weniger Überschuss.
So lassen sich Wohn(t)räume kreativ und
ressourcenschonend gestalten.
Neue WSI-Studie: Die Fleischindustrie nach
dem Arbeitsschutzkontrollgesetz: Verbot von
Werkverträgen hat sich bewährt, doch Löhne
weiter meist niedrig
Das mit der Verabschiedung des
Arbeitsschutzkontrollgesetzes Anfang 2021 in
Kraft getretene Verbot von Werkverträgen in den
Kernbereichen der Fleischindustrie hat sich
grundsätzlich bewährt. In der Regel wurden fast
alle ehemals bei Subunternehmen angestellten
Werkvertragsbeschäftigten von den
Fleischunternehmen übernommen. Zugleich wurden
die Arbeits- und Lebensbedingungen der
vorwiegend osteuropäischen Arbeitsmigrant*innen
deutlich verbessert.
Dies konnte nicht
zuletzt dadurch erreicht werden, dass
undurchsichtige Subunternehmerketten aufgelöst
und klare Verantwortlichkeiten für die
Beschäftigten bei den Fleischunternehmen
hergestellt wurden. Dies sind die Kernergebnisse
einer neuen Studie des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung.*
Für die Studie
wurden insgesamt 14 Betriebe aus verschiedenen
Bereichen der Fleischindustrie untersucht und
insgesamt 85 Expert*innen-Interviews mit
Betriebsräten, Management, Gewerkschaften,
Beratungsstellen und Kontrollbehörden geführt.
„Das Arbeitsschutzkontrollgesetz hat die
Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie
deutlich verbessert und die schlimmsten
Ausbeutungsformen beseitigt“, so die Autor*innen
der Studie Dr. Şerife Erol und Prof. Dr.
Thorsten Schulten vom WSI. „Trotz äußerst harter
Arbeitsanforderungen gehen Löhne und
Arbeitsbedingungen vieler Beschäftigter in der
Fleischindustrie jedoch kaum über die
gesetzlichen Mindeststandards hinaus. Für eine
nachhaltige Verbesserung wäre vor allem die
Wiederherstellung branchenweiter
Tarifvertragsstrukturen notwendig“, lautet das
Fazit der Studienautor*innen.
„Ein Verbot
von Werkverträgen ist offensichtlich ein
wirksamer Schritt, um in vielen Branchen mit
hartnäckig prekären Arbeitsbedingungen
Verbesserungen anzustoßen. Dieses Ergebnis weist
über die Fleischindustrie hinaus“, sagt Prof.
Dr. Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche
Direktorin des WSI. „Doch es ist eben nur ein
erster Schritt, nicht die Lösung aller
Probleme.“
Das Verbot von Werkverträgen
Die deutsche Fleischindustrie verfolgte
lange Zeit ein Geschäftsmodell, das auf billige
Massenproduktion setzt, die vor allem auf der
Ausnutzung osteuropäischer Arbeitsmigrant*innen
mit extrem schlechten Arbeitsbedingungen
beruhte. Abgesichert wurde dies durch ein
undurchsichtiges System von Subunternehmen. Im
Ergebnis waren bis zu 50 und mehr Prozent der
Beschäftigten in den Schlachthöfen und
Fleischfabriken so genannte
Werkvertragsarbeitnehmer*innen, die nicht bei
den eigentlichen Fleischunternehmen beschäftigt
waren.
Mit den massenhaften
Corona-Ausbrüchen rückte im Frühjahr 2020 die
Fleischindustrie einmal mehr ins öffentliche
Interesse. Offensichtliche Missstände machten
deutlich, wie nötig eine Neuregulierung der
Branche war. „Nachdem zuvor mehrere Versuche
einer freiwilligen Einschränkung von
Werkverträgen gescheitert waren, war ein
weitreichender gesetzlicher Eingriff notwendig,
um die Fleischbranche tatsächlich zu einem
Abrücken von diesem Beschäftigungsmodell zu
bringen“, sagt die wissenschaftliche
Mitarbeiterin des WSI und Koautorin der Studie
Erol.
Im Ergebnis wurden nahezu alle
ehemaligen Werkvertragsbeschäftigten von den
Fleischunternehmen übernommen. Die Anzahl der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in
der Fleischindustrie stieg nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes in nur einem Jahr um
18 Prozent, von 128.400 im Jahr 2020 auf 151.500
Beschäftigte im Jahr 2021.
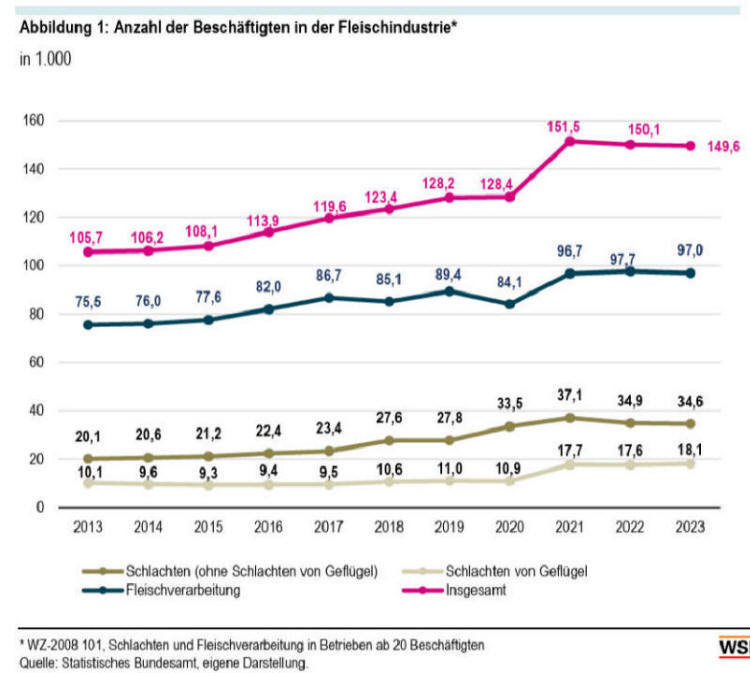
Allerdings haben viele der neueingestellten
Beschäftigten in der Fleischindustrie nur einen
befristeten Arbeitsvertrag. Mit Inkrafttreten
des Arbeitsschutzkontrollgesetzes ist der Anteil
befristeter Neueinstellungen von 42,7 Prozent im
Jahr 2020 auf 56,8 Prozent ein Jahr später
angestiegen und verharrt seither auf einem
vergleichbar hohen Niveau .
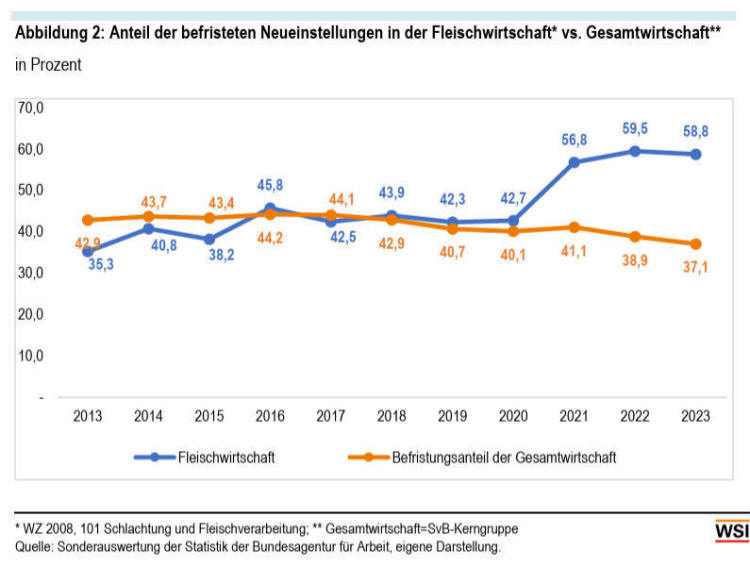
Verbesserung der Arbeitsbedingungen
Mit der Übernahme der ehemaligen
Werkvertragsbeschäftigten ging auch die
Verantwortung für deren Arbeitsbedingungen auf
die Fleischunternehmen über. Zuvor wurde immer
wieder von Verstößen gegen
Arbeitsrechtsbestimmungen wie Mindestlohngesetz
oder Arbeitszeitgesetz berichtet, die jedoch
aufgrund undurchsichtiger
Personalverantwortlichkeiten in der Regel nicht
geahndet wurden. Nun ist das Management der
Fleischbetriebe für die Einhaltung der
gesetzlichen Arbeitsstandards verantwortlich.
Durch größere Belegschaften in den
Fleischbetrieben sind auch die
Betriebsratsgremien deutlich angewachsen und
haben oft mehr freigestellte
Betriebsratsmitglieder. Damit verfügen sie über
deutlich mehr Ressourcen, um die
Arbeitsbedingungen zu überwachen. Mit dem
Werkvertragsverbot wurde insgesamt mehr
Transparenz in der Branche geschaffen, was die
Kontrolle der Rechtsdurchsetzung erheblich
erleichtert hat.
Mit dem
Arbeitsschutzkontrollgesetz wurden zusätzliche
eine Reihe bedeutsamer Maßnahmen zur
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen
von Beschäftigten in der Fleischindustrie
eingeführt. Hierzu gehören eine verpflichtende
elektronische Arbeitszeiterfassung, eine
deutliche Erhöhung der Kontrolldichte durch die
Behörden sowie Maßnahmen zur Verbesserung der
Wohnverhältnisse von Arbeitsmigrant*innen.
Vor allem die elektronische
Arbeitszeiterfassung hat wesentlich dazu
beigetragen, dass überlange Arbeitszeiten und
ein Umgehen des Mindestlohns durch unbezahlte
Mehrarbeit deutlich eingeschränkt wurden, so die
Studie.
Die Kontrolldichte in den
Fleischfabriken hat deutlich zugenommen. Wurden
2019 insgesamt 340 Kontrollen durch die
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) in der
Fleischindustrie durchgeführt, so waren es im
Corona-Jahr 2020 bereits 519 und im Jahr 2021
nach Verabschiedung des
Arbeitsschutzkontrollgesetzes sogar 683
Kontrollen. Hinzu kommen zahlreiche Kontrollen
auf Ebene der Bundesländer durch
Arbeitsschutzbehörden und Gewerbeaufsichtsämter.
Allerdings gingen die Kontrollen nach
dem Höchststand im Jahr 2021wieder um 15 Prozent
zurück. Wie die Studie zeigt, bleiben wirksame
Kontrollen und abschreckende Sanktionen eine
entscheidende Voraussetzung für eine nachhaltige
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der
Fleischindustrie.
Die Wohnverhältnisse
osteuropäischer Arbeitsmigrant*innen haben sich
in vielen Fällen deutlich verbessert.
Insbesondere große Fleischkonzerne sind
zunehmend dazu übergegangen, eigene Wohnungen
zur Verfügung zu stellen, deren Standard oft von
Betriebsräten kontrolliert wird. Auch die früher
üblichen extrem überteuerten Mieten für
Werkswohnungen gehören mittlerweile weitgehend
der Vergangenheit an.
Niedriglohnbranche
mit geringer Tarifbindung
Trotz dieser
Verbesserungen gehört die Fleischindustrie nach
wie vor zu den ausgeprägten Niedriglohnbranchen,
zeigen Erol und Schulten. Nach Angaben der
Bundesagentur für Arbeit erhielten im Jahr 2022
etwas weniger als die Hälfte (46, 5 Prozent)
aller Vollzeitbeschäftigten in der
Fleischindustrie nur einen Niedriglohn, d.h.
einen Lohn, der unterhalb von zwei Dritteln des
mittleren Lohns in Deutschland liegt (s.a.
Abbildung 3 ).
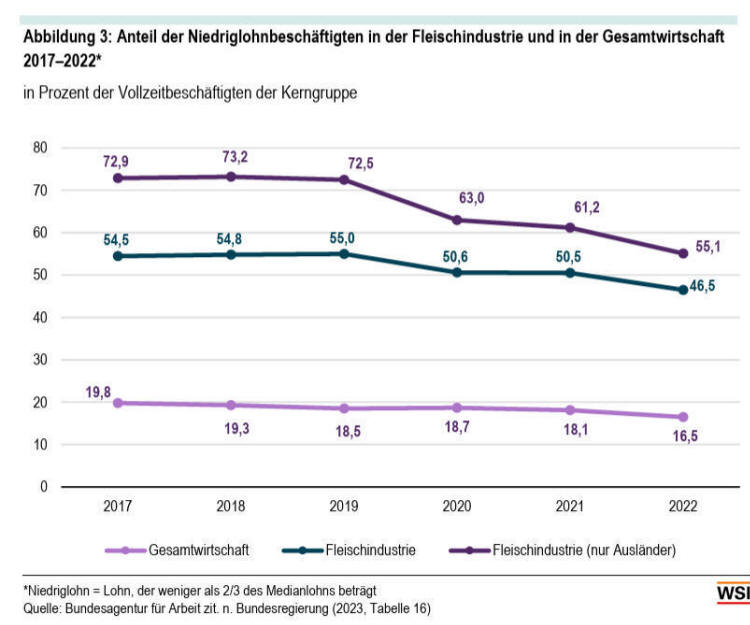
Bei den ausländischen Vollzeitbeschäftigten
waren es sogar 55,1 Prozent. Gegenüber den
Vorjahren ist der Anteil der
Niedriglohnbeschäftigten zwar deutlich
zurückgegangen. Er bleibt jedoch auf einem im
Vergleich zu anderen Branchen extrem hohen
Niveau.
Der hohe Niedriglohnanteil in der
Fleischindustrie liegt nicht zuletzt auch an der
sehr niedrigen Tarifbindung in der Branche.
Nachdem die ehemals flächendeckend verbreiteten
Branchentarifverträge seit den 1990er Jahren
sukzessive von der Arbeitgeberseite aufgekündigt
wurde, existiert heute nur noch eine sehr
fragmentierte Tariflandschaft mit etwa 50
Haustarifverträgen.
Der überwiegende Anteil
der Fleischunternehmen befindet sich hingegen in
einem tariflosen Zustand. In diesen Unternehmen
bekommen die an- und ungelernten Arbeitskräfte
aus Osteuropa oft nicht viel mehr als den
gesetzlichen Mindestlohn.
Nach Einführung
des gesetzlichen Mindestlohns hat es zeitweilig
auch einen tarifvertraglichen
Branchenmindestlohn gegeben, der jedoch zumeist
unterhalb des gesetzlichen Niveaus lag. Nach
Inkrafttreten des Arbeitsschutzkontrollgesetztes
ist der tarifvertragliche Branchenmindestlohn
wieder erneuert worden. Er wurde jedoch relativ
bald von der Entwicklung des gesetzlichen
Mindestlohns wieder eingeholt und war damit de
facto unwirksam (s.a. Abbildung 4).
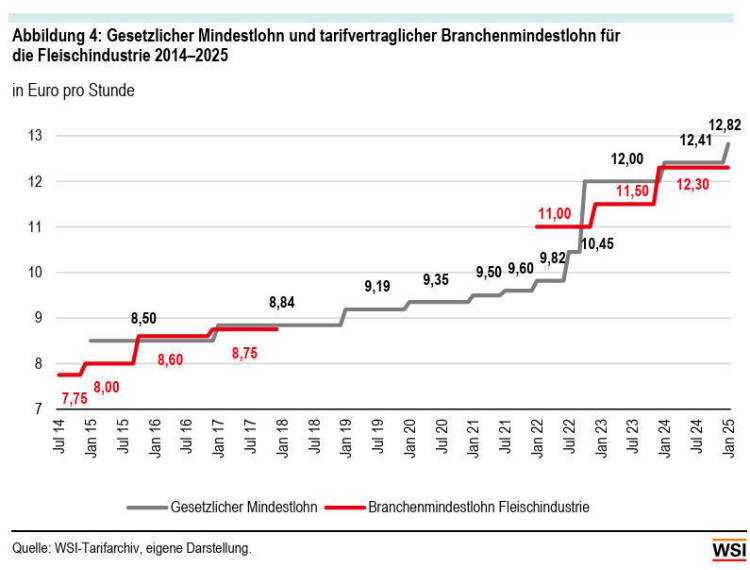
Ob die aktuell begonnenen Verhandlungen über
einen neuen Branchenmindestlohn zu einem
Ergebnis führen werden, ist derzeit ungewiss.
Zeitweilig waren die Arbeitgeber der
Fleischindustrie bereit, über Eckpunkte für
einen neuen branchenweiten Manteltarifvertrag zu
verhandeln. Mittlerweile sind die Verhandlungen
jedoch ergebnislos abgebrochen wurden. „Nachdem
die Fleischindustrie wieder aus dem öffentlichen
Fokus herausgerückt ist, haben die Unternehmen
offensichtlich auch ihr Interesse an
branchenweiten Tarifvertragsstrukturen verloren.
Dabei wären flächendeckende Tarifverträge in
der Fleischindustrie das zentrale Instrument, um
gute Arbeitsbedingungen oberhalb gesetzlicher
Mindeststandrads durchzusetzen“, sagt der Leiter
des WSI-Tarifarchivs und Ko-Autor der Studie
Schulten.

NRW-Friseurwesen:
Preise für Leistungen gestiegen – Zahl der
Azubis gesunken
Friseurleistungen für Herren sind im Jahr 2024
um 5,5 Prozent teurer gewesen als 2023 (gemessen
an der Veränderung der
Jahresdurchschnittswerte). Wie Information und
Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches
Landesamt anlässlich der TOP HAIR Messe in
Düsseldorf mitteilt, haben sich die Preise für
Friseurleistungen für Damen im selben Zeitraum
um 4,1 Prozent erhöht.
Salondichte
regional unterschiedlich
Insgesamt gab es im
Jahr 2022 in NRW 11 304 Handwerksunternehmen im
Friseurwesen. Bezogen auf die Bevölkerungszahl
kamen damit rein rechnerisch auf einen
Friseursalon 1 605 Einwohner/-innen. Regional
variierte dieses Verhältnis: In Düsseldorf kam
auf 1 203 Einwohner/-innen ein Friseursalon, im
Kreis Warendorf waren es 1 933 Köpfe pro Salon.
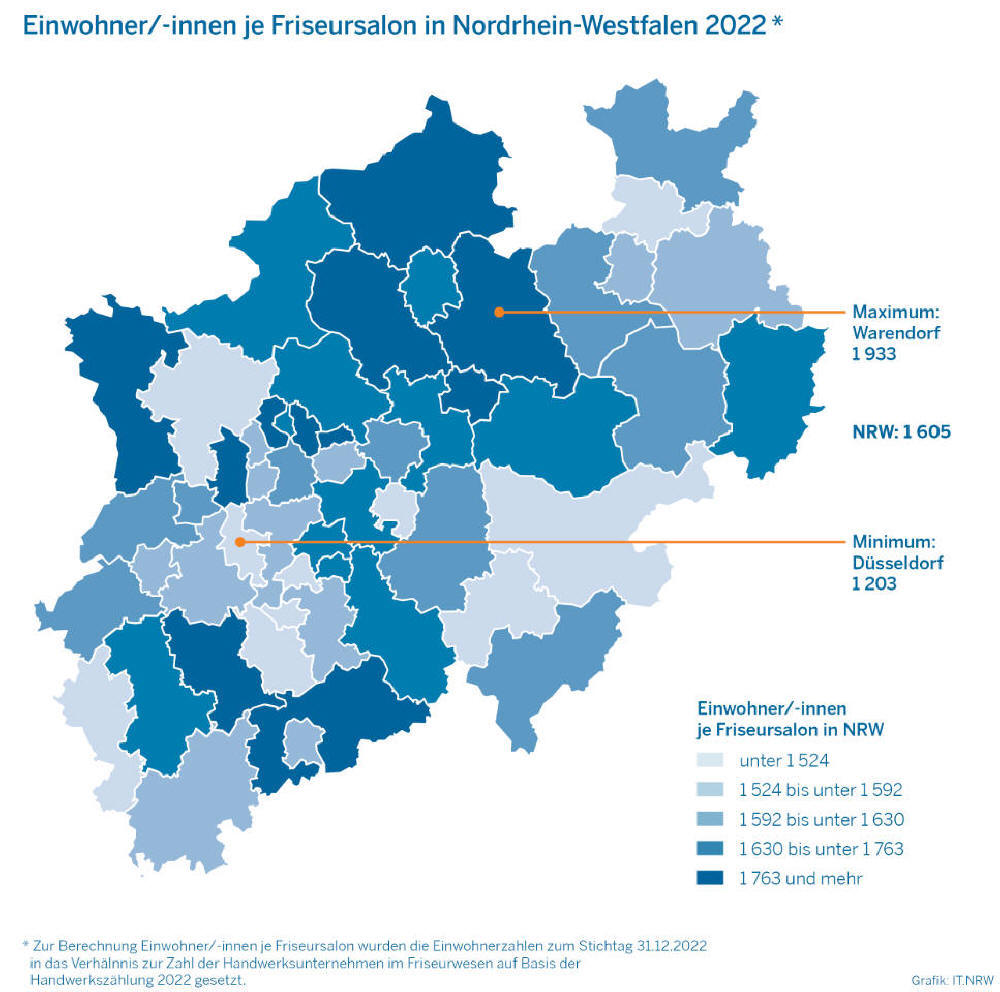
Mehr als ein Drittel der Friseur-Azubis ist
männlich – Anteil hat sich innerhalb der letzten
zehn Jahre fast verdreifacht Im Jahr 2023
machten in NRW 3 159 Personen eine Ausbildung im
Friseurhandwerk. Von ihnen waren 63,3 Prozent
weiblich und 36,7 Prozent männlich. Das
Geschlechterverhältnis hat sich damit im
Zehnjahresvergleich angeglichen: Im Jahr 2014
waren noch 12,6 Prozent der Friseur-Azubis
männlich gewesen.
Insgesamt befanden
sich vor 10 Jahren 5 319 Personen in einer
Ausbildung im Friseurhandwerk. Damit sank die
Zahl der Friseur-Azubis seit 2014 um
40,6 Prozent. IT.NRW erhebt und veröffentlicht
als Statistisches Landesamt zuverlässige und
objektive Daten für das Bundesland
Nordrhein-Westfalen für mehr als 300 Statistiken
auf gesetzlicher Grundlage.
Dies ist
dank der zuverlässigen Meldungen der Befragten
möglich, die damit einen wichtigen Beitrag für
unsere Gesellschaft leisten. Aussagekräftige
statistische Daten dienen als Grundlage für
politische, wirtschaftliche und soziale
Entscheidungen. Sie stehen auch der Wissenschaft
und allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.
(IT.NRW)
Darmkrebs: Zahl der
Todesfälle binnen 20 Jahren um 17 % gesunken
• Rückgang vor allem bei Frauen
• Auch Zahl der Krankenhausbehandlungen deutlich
zurückgegangen (-30 %)
• Entwicklung gegen
den Trend: Zahl der Krebstoten und
Krebsbehandlungen insgesamt gestiegen
In
Deutschland sterben immer weniger Menschen an
Darmkrebs. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, ist die Zahl der Todesfälle
aufgrund von Darmkrebs binnen 20 Jahren um 17 %
zurückgegangen: Von 28 900 Todesfällen im Jahr
2003 auf rund 24 100 Todesfälle im Jahr 2023. Im
selben Zeitraum nahm die Zahl der Krebstoten
insgesamt um 10 % zu: von 209 300 auf 230 300
Menschen.
Die Bevölkerung ist im
selben Zeitraum um 2 % gewachsen: auf 83,5
Millionen Menschen zum Jahresende 2023.
Allerdings ist Darmkrebs damit nach wie vor die
zweithäufigste krebsbedingte Todesursache nach
Lungen- und Bronchialkrebs. Ein Grund für den
Rückgang könnte neben einer verbesserten
Therapie auch das nach und nach ausgebaute
Früherkennungsprogramm in Deutschland sein.
Aktuell wird ab April 2025 das
Anspruchsalter für die Vorsorge-Darmspiegelung
bei Frauen von 55 auf 50 Jahre gesenkt und damit
die Darmkrebsvorsoge für Männer und Frauen
angeglichen.
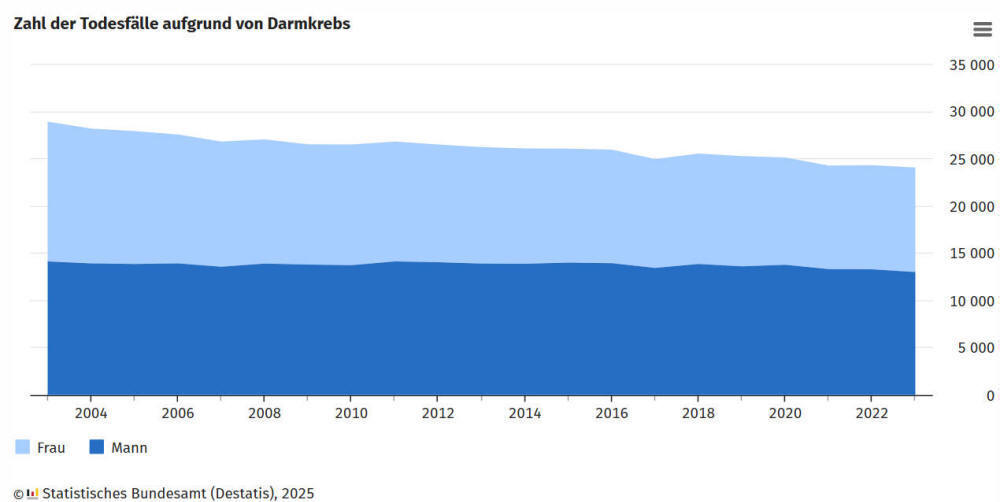
Zahl der Todesfälle aufgrund von Magenkrebs
und Gebärmutterhalskrebs ebenfalls gesunken
Einen größeren prozentualen Rückgang als bei den
Todesfällen aufgrund von Darmkrebs gab es unter
den weitverbreiteten Krebsarten lediglich beim
Magenkrebs und beim Gebärmutterhalskrebs. An
Magenkrebs starben im Jahr 2023 gut ein Drittel
(-34 %) weniger Menschen als 20 Jahre zuvor.
Auch bei Gebärmutterhalskrebs (-20 %) gab es
binnen 20 Jahren deutlich weniger Todesfälle.
Bei anderen Krebsarten wie Hautkrebs
(+61 %), Bauchspeicheldrüsenkrebs (+53 %), oder
Prostatakrebs (+32 %) nahm die Zahl der
Todesfälle im selben Zeitraum dagegen zu. Seit
2006 sterben anteilig mehr Männer an Darmkrebs
Einen deutlichen Rückgang bei den
darmkrebsbedingten Todesfällen gab es bei den
Frauen: Im Jahr 2023 starben mit 11 100 Frauen
rund 25 % weniger an Darmkrebs als noch 20 Jahre
zuvor, bei Männern waren es mit
13 000 Todesfällen rund 8 % weniger. Damit waren
54 % der im Jahr 2023 an Darmkrebs Verstorbenen
Männer, 46 % Frauen. Seit dem Jahr 2006 sterben
anteilig mehr Männer als Frauen an Darmkrebs.
Wie bei den meisten
Krebserkrankungen sind vor allem ältere Menschen
betroffen: So waren 71 % der 2023 an Darmkrebs
Verstorbenen 70 Jahre und älter. Vor 20 Jahren
lag deren Anteil bei 67 %. Im Jahr 2023 waren
18 % in der Altersgruppe von 60 bis 69 Jahren,
8 % waren im Alter von 50 bis 59 Jahre und 3 %
waren jünger als 50 Jahre. Zahl der
Klinikbehandlungen wegen Darmkrebs binnen
20 Jahren um 30 % gesunken.
In den
vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Menschen,
die aufgrund einer Darmkrebserkrankung im
Krankenhaus behandelt werden mussten, deutlich
zurückgegangen. Im Jahr 2023 wurden rund
139 200 Menschen wegen Darmkrebs stationär
behandelt. Das waren 30 % weniger Fälle als im
Jahr 2003. Damals kamen 200 100 Menschen mit
einer solchen Diagnose in ein Krankenhaus. T
rotz des Rückgangs im langfristigen
Vergleich war Darmkrebs im Jahr 2023 mit einem
Anteil von 10 % die zweithäufigste Krebsdiagnose
nach Lungen- und Bronchialkrebs (12 %). Männer
sind durchweg in den letzten 20 Jahren von der
Diagnose Darmkrebs häufiger betroffen als
Frauen: Auf sie entfielen 2023 rund 56 % der
stationären Behandlungen wegen Darmkrebs, aber
nur 48 % aller Krankenhausbehandlungen
insgesamt.
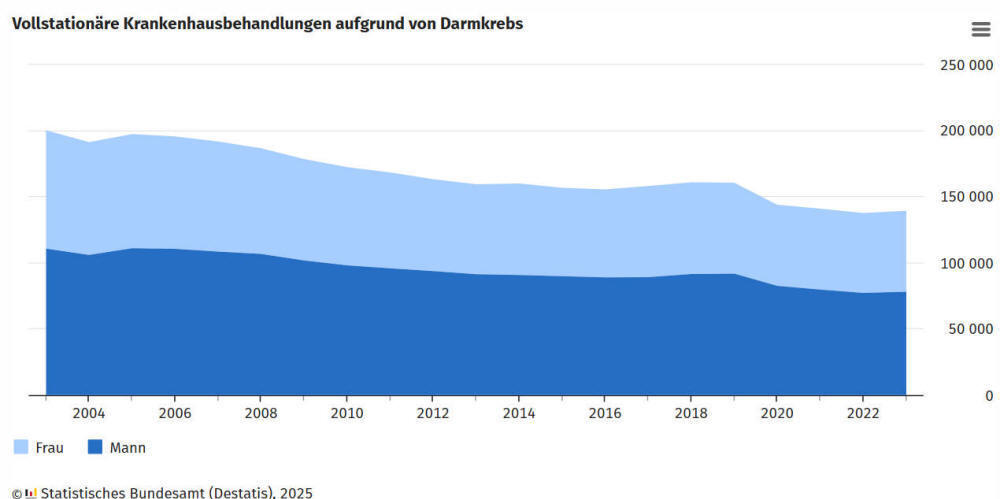
Mehr Behandlungen wegen
Darmkrebs in der Altersgruppe der 20- bis
29-Jährigen
Bei durchweg allen Altersgruppen
ab 30 Jahren sind die darmkrebsbedingten
Krankenhausbehandlungen im langfristigen
Vergleich rückläufig. Dagegen stiegen die
darmkrebsbedingten Krankenhausbehandlungen bei
den 20- bis 29-Jährigen an, wenn auch mit
niedrigen Fallzahlen: In dieser Altersgruppe gab
es 2023 rund 520 Patientinnen und Patienten;
20 Jahre zuvor waren es 360.
Einen
Leistungsanspruch auf Darmkrebsvorsorge hat man
in Deutschland ab 50 Jahren. Jünger als 50 Jahre
waren im Jahr 2023 rund 9 100 Menschen, die
aufgrund einer Darmkrebserkrankung im
Krankenhaus behandelt wurden. Das waren 7 %
aller Fälle. Darmkrebs tritt im Alter häufiger
auf: Mehr als die Hälfte (51 %) der im Jahr 2023
aufgrund einer Darmkrebserkrankung behandelten
Patientinnen und Patienten war 70 Jahre und
älter.
Donnerstag, 27.
März 2025
Moers: Lebhafter Austausch
beim Fachtag des Netzwerkes Kinderschutz
Innerhalb von nur einem Tag war auch
dieser Fachtag des Netzwerkes Kinderschutz
ausgebucht. Die Fachkräfte haben sich am
Mittwoch, 19. März, über das Thema ‚Datenschutz
im Kinderschutz – ein Widerspruch? Vertrauen
schützt!‘ informiert.
Dabei konnte
Senay Demir, Koordinatorin des Netzwerkes bei
der Stadt Moers, mit Prof. Dr. Christof
Radewagen (Hochschule Osnabrück und Autor des
Leitfadens ‚Vertrauensschutz im Kinderschutz‘)
einen hochkarätigen Referenten gewinnen, der im
Anschluss für Gespräche zur Verfügung stand. In
seinem Vortrag zeigte er auf, dass sich
Datenschutz und Kinderschutz ergänzen können,
wenn die richtigen Maßnahmen ergriffen werden,
um das Vertrauen der Betroffenen zu gewinnen und
zu bewahren.
Professor Radewagen
stellte seine praxisorientierte
‚Kindeswohlmatrix‘ vor – ein Instrument, das
Fachkräften helfen soll, die richtigen
Handlungsentscheidungen zu treffen. Der Fachtag
bot den Teilnehmenden praxisorientierte
Anregungen und Lösungen, wie sie den Spagat
zwischen Datenschutz und effektiven
Schutzmaßnahmen für Kinder im Alltag meistern
können.
Was die Veranstaltung besonders
lebendig machte, war der interdisziplinäre
Austausch zwischen den Teilnehmenden aus
verschiedenen Bereichen – u. a. Sozialarbeit,
Psychologie, Recht, Pädagogik.
Spaß, Spiel und gute Laune nach dem
Frühjahrsputz in Neu_Meerbeck
Erst
die Arbeit, dann das Vergnügen: Zum mittlerweile
schon traditionellen Frühjahrsputz lädt das
Stadtteilbüro Neu_Meerbeck am Samstag, 5. April,
von 11 bis 14 Uhr ein. Anschließend wird wieder
gefeiert.
‚Viele Hände - schnelles Ende‘:
Das Team des Stadtteilbüros hofft auf rege
Teilnahme. (Foto: Stadtteilbüro)

Zunächst sollen aber Straßen, Plätze und
Grünanlagen in Meerbeck und Hochstraß vom Müll
befreit werden. Nach dem Motto ‚Viele Hände -
schnelles Ende‘ hofft das Team des
Stadtteilbüros, dass viele Menschen tatkräftig
mit anpacken. Außerdem sind die Bewohnerinnen
und Bewohner eingeladen, Vorgärten oder Gehwege
zu säubern und verschönern. ENNI unterstützt die
Aktion und stellt Müllsäcke zur Verfügung.
Zusammen mit Greifzangen werden sie am
Samstag um 11 Uhr vor dem Stadtteilbüro,
Bismarckstraße 43b, ausgegeben. Nach-Feier mit
Spielmobil und Waffeln Das kleine Fest mit Spaß,
Spiel und guter Laune findet im Anschluss von 14
bis 17 Uhr auf dem Spielplatz Ecke
Römerstraße/Kirschenallee statt.
Das
Spielmobil des städtischen Kinder- und
Jugendbüros mit vielen Spielen, spannenden
Mitmach- und Kreativ-Aktionen wird betreut von
der Jugend der DITIB Moschee. Eine süße Leckerei
gibt es in Form von frischgebackenen und mit
viel Liebe zubereiteten Waffeln des
Fördervereins der St. Marien Schule.
Der
Erlös ist für einen guten Zweck. Den
Bewohnerinnen und Bewohnern bietet das
Stadtteilbüro zudem eine gute Gelegenheit, sich
über aktuelle Projekte, laufende Initiativen und
andere Themen im Stadtteil zu informieren.
Rückfragen und weitere Informationen unter
Telefon 0 28 41 / 201-530 oder per Mail: stadtteilbuero.meerbeck@moers.de.
Wärme im Wandel – Die
Wärmeplanung der Stadt Wesel
Die
Stadt Wesel lädt zu einer kostenfreien
Bürgerinformation zur Kommunalen Wärmeplanung
ein. Am Mittwoch, 2. April 2025, können
Bürger*innen Wesels die Gelegenheit nutzen, sich
über die Inhalte und Ziele der Wärmeplanung zu
informieren. Worin besteht eigentlich der
Unterschied zwischen einer zentralen oder
dezentralen Wärmeversorgung? Was ist ein
Wasserstoffnetz?
Das von der Stadt
beauftragte Unternehmen Gertec GmbH
Ingenieurgesellschaft steht für Rückfragen zur
Verfügung. Die Stadtwerke Wesel werden anhand
von zwei Projekten aufzeigen, wie eine CO2-freie
Wärmeversorgung in der Zukunft aussehen könnte.
Unter anderem gibt es die Überlegung, die
Abwärme aus der Kläranlage zu nutzen.
Abgerundet wird die Veranstaltung durch den
Vortrag des Energieberaters Klaus Overhoff. Er
beantwortet Fragen zum Gebäudeenergiegesetz
(GEG) in Bezug auf die kommunale Wärmeplanung
und erläutert, welche Fördermittel für
Eigentümer*innen momentan zur Verfügung stehen.
Die Stadt Wesel lädt alle Bürger*innen
dazu ein, den Weg der Klimaneutralen
Energieversorgung aktiv mitzugestalten und sich
rechtzeitig über bevorstehende Veränderungen in
der Wärmeversorgung zu informieren. Die
kostenlose Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr im
Ratssaal des Rathauses, Klever-Tor-Platz 1 in
Wesel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wesel startet wieder in eine
neue Flusskreuzfahrt-Saison
Auch in
diesem Jahr heißt die Hansestadt für die Saison
2025 wieder zahlreiche Flusskreuzfahrtschiffe
willkommen. Bereits am 18. März legte die
Viking River Cruises bei bestem Ausflugswetter
erstmalig an der Weseler Rheinpromenade an. Bis
Mitte November folgen 30 weitere Termine. Ebenso
wieder zu Gast sein werden an 15 Terminen erneut
die Flusskreuzfahrtgäste der A-ROSA.

Von Ende April bis Ende Oktober läuft hier
die regelmäßige Tour der A-ROSA ALEA zwischen
Köln und dem Ijsselmeer mit dem Stopp in Wesel
am vorletzten Reisetag. Die A-ROSA-Schiffe haben
bei voller Belegung ca. 200 Passagiere aus dem
deutschsprachigen Raum an Bord. Die
VIKING-Schiffe beherbergen rund 190 Gäste,
hauptsächlich aus den USA, Kanada sowie
Großbritannien.
Die Flusskreuzfahrtgäste
nehmen auf Wunsch an unterschiedlichen
Landprogrammen teil und haben zudem ausreichend
Freizeit zum individuellen Aufenthalt in der
Weseler Innenstadt.
Wesel:
Der Schweizer Anbieter Viking River Cruises legt
erneut in Wesel an.
Zwischen März
und November sind mehr als 30 Stopps mit je rund
190 Passagieren geplant. Viele Passagiere nutzen
die Gelegenheit, den Niederrhein bei einem
Ausflug kennenzulernen. Darunter sind
erfahrungsgemäß viele US-amerikanische Gäste.
Sie interessieren sich für die Geschichte des
Niederrheins und genießen das entspannte Treiben
in den Orten am Fluss.
Für die
Passagiere wird ein Ausflug nach Xanten mit
einem Besuch des LVR-Archäologischen Parks
angeboten. Alternativ haben die Gäste die
Gelegenheit, Wesel auf eigene Faust zu erkunden.
Linda Kremers von 2-LAND-Reisen berichtet: „Wenn
alle geplanten Terminen durchgeführt werden,
werden bis zu 6.000 ausländische Gäste den
Niederrhein erkunden. Wir freuen uns, in unserer
Funktion als Vermittler zwischen Viking Cruises,
Wesel Marketing GmbH, LVR Archäologischer Park
und dem Busunternehmen Tekath unseren Beitrag
leisten zu dürfen.“
Die Schiffe
machen im Rahmen ihrer Niederlande-Belgien-Route
Halt in Wesel – der einzigen Station in
Deutschland auf dieser Tour. Ein großes
Flusskreuzfahrtschiff ist die ganze Saison auf
der Route unterwegs. Ein weiteres Schiff legt
zusätzlich im Frühjahr an. BU: Ein Zeichen für
den Frühling: Das erste Flusskreuzfahrtschiff
legt in Wesel an.
Klever
Spielplatz an der Stadthalle: So steht es um den
Baufortschritt
Bereits seit einigen
Jahren befindet sich das Klever
Stadthallenumfeld in einem Umgestaltungsprozess,
der das Areal umfangreich aufgewertet hat. Wo
vor wenigen Jahren noch Autos auf der Straße
Bleichen fuhren, ist inzwischen ein großzügiger
Vorplatz für die Stadthalle sowie ein ufernaher
Fußweg am Spoykanal entstanden, der zum
Flanieren einlädt.

Baustelle Spielplatz Stadthalle
Während
die Arbeiten nördlich der Stadthalle
abgeschlossen sind, rollen die Bagger südlich
der Veranstaltungsstätte nach wie vor: Auf den
lange ungenutzten Flächen zwischen Stadtbücherei
und Spoykanal entsteht aktuell ein ansprechender
Kinderspielplatz in bester Innenstadtlage.
Dieser wird neben umfangreichen
Klettermöglichkeiten und anderen Spiel- und
Sinnesgeräten, die zu großen Teilen inklusiv
nutzbar sind, auch einen großen Matsch- und
Wasserspielbereich bieten.

Ergänzt werden die Geräte durch eine
naturnahe Gestaltung ihres Umfeldes.
Natursteinquader und Baumstämme bieten
Sitzgelegenheiten und alte, wie neue Bäume
sollen in den warmen Sommermonaten kühlenden
Schatten spenden. Modellierte Hügel laden zum
Toben ein. Zur Wasserstraße grenzt die
Spielflächen künftig eine Hecke ab. Alle Kinder
können sich an der Stelle also auf ein absolutes
Highlight freuen.

Wer aktuell an der Baustelle
entlangspaziert, kann bereits viele Geräte des
Spielplatzes erkennen. Fertigstellung und
Eröffnung des Spielplatzes werden allerdings
leider noch einige Wochen auf sich warten
lassen. Viele Unwägbarkeiten hatten das
Voranschreiten der Bauarbeiten in den
vergangenen Monaten verzögert: ungewöhnlich
nasse Bodenverhältnisse, archäologische Funde im
Boden und nicht zuletzt auch das frostige
Winterwetter.
Es fehlen nun noch
einige Einbauten, letzte Bodenarbeiten und auch
klimaangepasste Bepflanzungen, bevor die ersten
Kinder den Spielplatz entdecken können.
Baubedingt muss die Baustelle aktuell für etwa
drei Wochen pausieren. Danach können die letzten
Arbeiten durchgeführt werden, sodass der
Spielplatz voraussichtlich im Mai freigegeben
und eröffnet werden kann. Die Stadt Kleve und
alle Beteiligten freuen sich darauf, wenn der
Spielpatz pünktlich zum Sommer endlich von
spielenden Kindern bevölkert wird.
Hintergrund: Integriertes Handlungskonzept
Der Spielplatz an der Stadthalle ist Teil des
Integrierten Handlungskonzeptes. Das Integrierte
Handlungskonzept bildet den Rahmen für die
Entwicklung der Innenstadt bis Ende 2027.
„Integriert“ bedeutet, dass alle Themenfelder
und Funktionen einer Innenstadt berücksichtigt
werden: Wohnen, Einzelhandel, Gastronomie,
Kultur und öffentlicher Raum. Viele
unterschiedliche Gruppen und Akteure werden
dabei miteinbezogen.
Für Kleve wurde
2013 ein Integriertes Handlungskonzept
erarbeitet. In diesem Konzept sind drei
Themenfelder als Schwerpunkte festgelegt:
Öffentlicher Raum, Baukultur und Kommunikation.
Gefördert wird das Integrierte Handlungskonzept
über die Städtebauförderung von Bund und Land,
vom Bundesministerium für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen, sowie vom
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Dinslaken: Mit dem Steiger
auf den Spuren der Bergleute
Der
ehemalige Obersteiger Silvo Magerl nimmt
Interessierte am Sonntag, 13. April 2025, von 15
bis 17 Uhr mit auf eine einzigartige Reise:
Dabei geht es um das Bergwerk, das ihn fast sein
gesamtes Arbeitsleben lang geprägt hat. In
lebendigen Schilderungen lässt er die harte,
aber faszinierende Welt wiederaufleben.
Mit packenden Geschichten aus dem Leben der
Bergleute und persönlichen Erlebnissen aus
seiner Zeit im Bergbau entführt er die
Teilnehmenden in eine Zeit, in der der Bergbau
mehr als nur ein Beruf war – er war
Lebensmittelpunkt und Lebensart. Die Ende 2005
stillgelegte Zeche Lohberg war für viele
Bergleute nicht nur eine Arbeitsstätte, sondern
ein zentraler Bestandteil ihres Lebens.
Bei der Führung erzählt der erfahrene
Bergingenieur von den prägenden Momenten seiner
Karriere: von der historischen Entwicklung des
Bergwerks, vom schmutzigen Alltag mit schwarzen
Augenrändern, von der Plüngelstube, der Kaue und
der Grubenwehr. Er berichtet von der Einfahrt in
die Grube und dem schweißtreibenden Malochen in
der Dunkelheit – und immer wieder vom
unerschütterlichen Zusammenhalt der Kumpel, denn
unter Tage gab es keine Fremden, nur Kumpel.
Der Treffpunkt zur Führung ist am
Ledigenheim in Lohberg, Stollenstraße 1. Die
Teilnahmegebühr beträgt 7,50 Euro pro Person und
ist direkt vor Ort beim Gästeführer zu
entrichten. Eine vorherige Anmeldung ist
erforderlich und wird vom Team der
Stadtinformation am Rittertor telefonisch unter
02064 – 66 222 oder per E-Mail an
stadtinformation@dinslaken.de entgegengenommen.
Kurt-Kräcker-Straße in Wesel
wird für den motorisierten Verkehr gesperrt
Im Rahmen der aktuell laufenden
Bauphase muss die Kurt-Kräcker-Straße auf Höhe
der Eisenbahnüberführung von Dienstag, 25. März
(06:00 Uhr), bis voraussichtlich Montag, 21.
April (23:30 Uhr), für den motorisierten Verkehr
gesperrt werden. Die Eisenbahnüberführung (EÜ)
Kurt-Kräcker-Straße wird im Zuge des Ausbaus der
Bahnstrecke zwischen Emmerich und Oberhausen
komplett erneuert.
Für die Arbeiten
ist die Errichtung eines Traggerüstes im Bereich
der EÜ Kurt-Kräcker-Straße notwendig. Dadurch
ist die Durchfahrbarkeit auf eine Höhe von 3,80
Meter begrenzt. In den letzten Tagen ist
aufgefallen, dass trotz entsprechender
Hinweisschilder Lkw-Fahrzeuge die maximal
zulässige Durchfahrtshöhe missachten. Da ein
Anprall mit dem Traggerüst lebensgefährlich ist,
soll kurzfristig ein Anprallbalken als Schutz
installiert werden.
Dieser soll an der
Kreuzung Dinslakener Landstraße -
Kurt-Kräcker-Stracke errichtet werden. Hinweise
auf Umleitungen werden vor Ort installiert. Wir
setzen alles daran, die von den Bauarbeiten
ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu
halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen
und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich
ausschließen.
vhs Moers – Kamp-Lintfort:
‚Alte Wege zum Frieden – neu entdeckt‘
Ziel 16 der Nachhaltigkeitsziele der UN:
Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
(Quelle: United Nations) Gedanken über
Möglichkeiten und Wege zum Frieden stehen im
Mittelpunkt einer Veranstaltung der vhs Moers –
Kamp-Lintfort am Donnerstag, 3. April, ab 19
Uhr. ‚Alte Wege zum Frieden – neu entdeckt‘
greift unter anderem die Philosophie der Antike
zu Menschlichkeit und friedvollem Miteinander
auf.
Der Abend widmet sich den
Denkern vom Altertum bis in die Neuzeit und
greift deren Strategien gegen Krieg und Gewalt
auf. Am Ende der Veranstaltung steht in der vhs
Moers, Wilhelm-Schroeder-Straße 10, die Frage
‚Was können wir von der Vergangenheit für unsere
Gegenwart lernen?‘.
Der Abend findet in
Kooperation mit der ‚Friedensinitiative
Niederrhein‘ und im Rahmen des diesjährigen
vhs-Themenschwerpunkts zu den 17
Nachhaltigkeitszielen der UN statt. Der Abend
ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich
und telefonisch unter 0 28 41/201 - 565 sowie
online unter www.vhs-moers.de möglich.
Fachkräftemangel großes
Hindernis für mehr Patente und mehr Innovationen
Deutschlands Innovationskraft zeigt
sich in einem leichten Anstieg der
Patentanmeldungen um 0,4 Prozent im Jahr 2024,
womit es nach den USA weltweit den zweiten Platz
belegt. Besonders bemerkenswert ist der Zuwachs
von 6,6 Prozent im Bereich digitaler
Schlüsseltechnologien, während die USA und China
hier Rückgänge verzeichnen.
VDI-Direktor
Adrian Willig betont: „Unsere Ingenieurinnen und
Ingenieure treiben den Fortschritt maßgeblich
voran. Jetzt ist es an der Zeit die richtigen
Weichenstellungen für die Zukunft zu treffen.
Wir brauchen mehr technische Fachkräfte und
damit mehr Ingenieurskapazitäten. Dafür muss die
neue Bundesregierung die Voraussetzungen
schaffen, denn nur mit einem Innovationsschub
können wir die technologische Spitzenposition
wiedererlangen.“

Deutschlands Innovationskraft zeigt sich in
einem leichten Anstieg der Patentanmeldungen.
Symbolbild: Ground Picture/Shutterstock
25.000 Patente haben deutsche Forscherinnen und
Forscher angemeldet, teilte das Europäische
Patentamt zu seinem Index 2024 mit. Zum
Vergleich: Die USA haben circa 48.000 Patente in
Europa angemeldet. Adrian Willig ordnet ein:
„Die Zahlen sind erfreulich und zeigen, wie
innovationsfreudig Deutschland immer noch ist.
Aber dennoch können wir uns auf den Zahlen nicht
ausruhen, um in Zukunft weiter wettbewerbsfähig
zu bleiben, denn die Gewitterwolken hängen über
dem Innovationsstandort Deutschland.“
„Wir sind die Jahre zuvor ins Hintertreffen
geraten. Eine Aufholjagd gegenüber USA, China
und Japan kann nicht schnell genug beginnen.
Dafür braucht es von der neuen Bundesregierung
Investitionen in zentrale Transformationsfelder.
Nur so können wir Deutschland und den Standort
Europa resilienter und wettbewerbsfähiger
machen. Innovationen dürfen nicht länger durch
überbordende Bürokratie ausgebremst werden“, so
Willig. Der VDI hat für die 21.
Legislaturperiode Handlungsempfehlungen
herausgegeben, die sich unter anderem auf
zentrale Transformationsfelder wie Künstliche
Intelligenz, Energiesysteme und Circular Economy
konzentrieren.
„Dafür braucht es
qualifizierte Fachkräfte im Ingenieurwesen, denn
sie erfinden wegweisende Technologien für
unseren Alltag – für unsere Zukunft.“ Der
wachsende Fachkräftemangel ist eine der größten
Bedrohungen für den Wirtschaftsstandort
Deutschland. Bis 2035 werden laut Erhebungen bis
zu 340.000 Mint-Akademiker und -Akademikerinnen
in Rente gehen.
Aus Sicht des VDI sollte
technische Bildung gestärkt werden – von der
schulischen Ausbildung bis zur Förderung
lebenslangen Lernens. Dazu sollte ein
Technikunterricht in allen Schulformen und über
alle Schulstufen hin verbindlich, durchgängig
und mit bundesweit einheitlichen
Bildungsstandards in allen Bundesländern
eingeführt werden. Zudem braucht es gezielte
Anreize zur Fachkräftezuwanderung und eine
bessere Integration ausländischer Fachkräfte in
den Arbeitsmarkt.
VDI als Gestalter
der Zukunft
Mit unserer Community und unseren rund
130.000 Mitgliedern setzen wir, der VDI e.V.,
Impulse für die Zukunft und bilden ein
einzigartiges multidisziplinäres Netzwerk, das
richtungweisende Entwicklungen mitgestaltet und
prägt. Als bedeutender deutscher technischer
Regelsetzer bündeln wir Kompetenzen, um die Welt
von morgen zu gestalten und leisten einen
wichtigen Beitrag, um Fortschritt und Wohlstand
zu sichern.
Mit Deutschlands größter
Community für Ingenieurinnen und Ingenieure,
unseren Mitgliedern und unseren umfangreichen
Angeboten, schaffen wir das Zuhause aller
technisch inspirierten Menschen. Dabei sind wir
bundesweit, auf regionaler und lokaler Ebene in
Landesverbänden und Bezirksvereinen aktiv. Das
Fundament unserer täglichen Arbeit bilden unsere
rund 10.000 ehrenamtlichen Expertinnen und
Experten, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen
einbringen.
Zu den Handlungsempfehlungen

NRW-Wirtschaft exportierte 2024 Eisen und
Stahl im Wert von rund 11 Milliarden Euro
Im Jahr 2024 hat die
nordrhein-westfälische Wirtschaft 9,7 Milliarden
Tonnen Eisen und Stahl im Wert von
11,1 Milliarden Euro exportiert. Wie Information
und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt mitteilt, waren gemessen
am Warenwert Belgien (1,2 Milliarden Euro),
Frankreich (1,0 Milliarden Euro) und Polen
(0,9 Milliarden Euro) die Hauptzielländer dieser
Exporte.
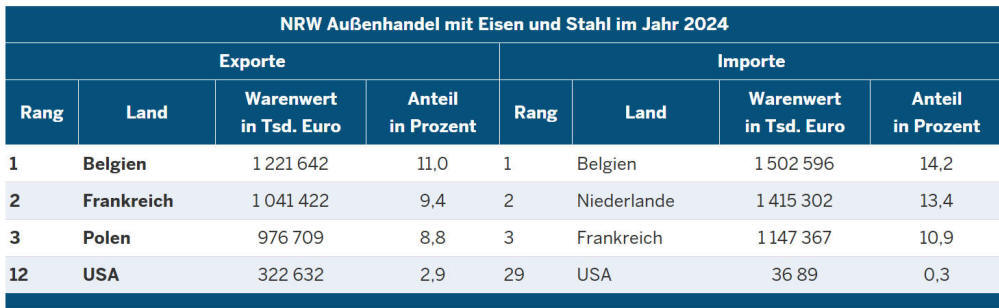
Die USA belegten im Ranking der zwölf
wichtigsten Exportländer mit einem
Außenhandelsumsatz im Wert von rund
323 Millionen Euro Rang zwölf. Die zwei größten
Seehäfen Europas befinden sich in Antwerpen
(Belgien) und Rotterdam (Niederlande). Diese
sind zentral für den Güterumschlag im
internationalen Handel.
Bei den Importen von
Eisen und Stahl nach NRW liegen die USA auf Rang
29.
Die nordrhein-westfälische Wirtschaft
importierte 8,6 Milliarden Tonnen Eisen und
Stahl im Wert von 10,6 Milliarden Euro im Jahr
2024. Belgien war mit einem Warenwert von
1,5 Milliarden Euro an den Eisen- und
Stahlimporten nach NRW das bedeutendste
Lieferland. Auf den Plätzen zwei und drei
folgten mit 1,4 Milliarden Euro Warenwert die
Niederlande und Frankreich mit 1,1 Milliarden
Euro. Die USA nahmen mit rund 37 Millionen Euro
Rang 29 ein.
Auftragseingang im
Bauhauptgewerbe im Januar 2025: +5,2 % zum
Vormonat
+5,2 % zum Vormonat (real, saison- und
kalenderbereinigt) +10,3 %
zum
Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)
+12,1 % zum Vorjahresmonat (nominal) Umsatz im
Bauhauptgewerbe, Januar 2025 +10,8 % zum
Vorjahresmonat (real)
+13,1 % zum
Vorjahresmonat (nominal)
Der reale
(preisbereinigte) Auftragseingang im
Bauhauptgewerbe ist nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar
2025 gegenüber Dezember 2024 kalender- und
saisonbereinigt um 5,2 % gestiegen. Dabei nahm
der Auftragseingang im Hochbau um 1,7 % und im
Tiefbau um 8,4 % zu.
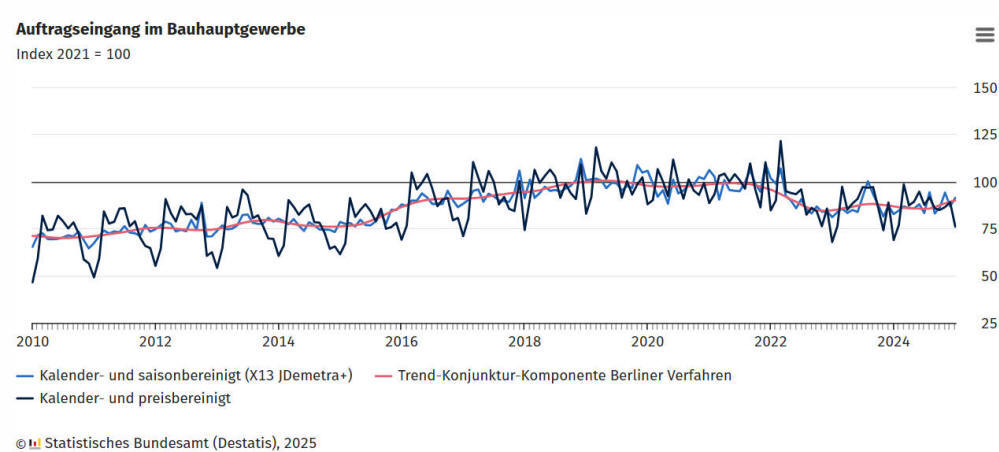
Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2024
stieg der reale, kalenderbereinigte
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe um 10,3 %.
Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um
8,6 % und im Tiefbau um 12,1 % zu. Der nominale
(nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag
12,1 % über dem Vorjahresniveau.
Umsatz
real 10,8 % höher als im Vorjahresmonat
Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe lag im
Januar 2025 um 10,8 % über dem Vorjahresmonat.
Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum
um 13,1 % auf 5,7 Milliarden Euro. Die Zahl der
im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im
Januar 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um
0,8 % zu.
NRW-Industrie:
2024 ist der Absatzwert der
Futtermittelproduktion für Nutztiere um über
acht Prozent gesunken
Im Jahr 2024 sind nach vorläufigen
Ergebnissen 3,8 Millionen Tonnen zubereitete
Futtermittel für Nutztiere ohne Vormischungen,
Mehl und Pellets von Luzernen im Wert von
974,6 Millionen Euro hergestellt worden. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, stieg die
Absatzmenge damit gegenüber 2023 um
67 700 Tonnen (+1,8 Prozent), während der
Absatzwert nominal um 87,1 Millionen Euro bzw.
8,2 Prozent sank.
In 39 der 9 747
produzierenden Betrieben des Verarbeitenden
Gewerbes wurden 2024 Futtermittel für Nutztiere
hergestellt. Im Jahr 2014 umfasste der
Berichtskreis 32 Betriebe. Gegenüber dem Jahr
2014 sank die Absatzmenge um 81 300 Tonnen
(−2,1 Prozent) während der Absatzwert um
137,7 Millionen Euro bzw. 16,5 Prozent stieg.
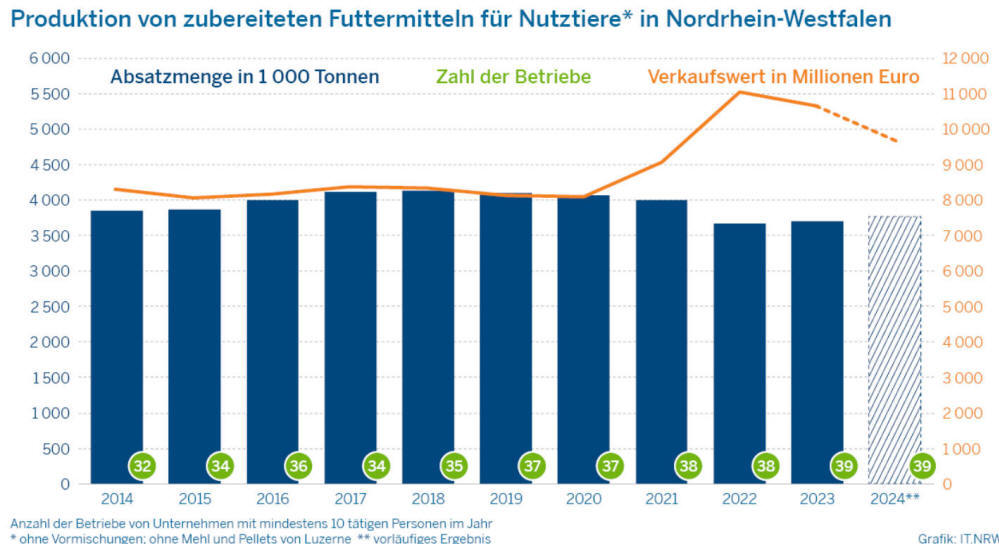
Die Regierungsbezirke Düsseldorf und Münster
hatten den größten Anteil an der NRW Produktion
83,4 Prozent der Absatzmenge und 79,8 Prozent
des Absatzwerts wurden 2024 in Betrieben der
Regierungsbezirke Düsseldorf und Münster
erzielt. So wurden 44,1 Prozent der Absatzmenge
und 40,5 Prozent des Absatzwertes der in NRW
produzierten Futtermittel im Regierungsbezirk
Münster erzielt.
Im Regierungsbezirk
Düsseldorf waren es 39,3 Prozent der Absatzmenge
und 39,4 Prozent des Absatzwerts. Weitere
Futtermittel für Nutztiere In einem der o. g.
Betriebe sowie vier weiteren Betrieben sind
zusätzlich Futtermittel für Nutztiere in Form
von Vormischungen, sowie Mehl und Pellets von
Luzernen im Wert von 40,7 Millionen Euro
(−19,4 Prozent; gegenüber 2023) hergestellt
worden.
Mittwoch, 26.
März 2025
Erfolglose
Verfassungsbeschwerde gegen Solidaritätszuschlag
Mit heute (26. März 2025) verkündetem
Urteil hat der Zweite Senat des
Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe eine
Verfassungsbeschwerde gegen das
Solidaritätszuschlaggesetz 1995 (SolZG 1995) in
der Fassung des Gesetzes zur Rückführung des
Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019
zurückgewiesen.
Der zum 1. Januar
1995 eingeführte Solidaritätszuschlag stellt
eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Art. 106
Abs. 1 Nr. 6 Grundgesetz (GG) dar. Der Senat
führt in seinem Urteil aus, dass eine solche
Ergänzungsabgabe einen aufgabenbezogenen
finanziellen Mehrbedarf des Bundes voraussetzt,
der durch den Gesetzgeber allerdings nur in
seinen Grundzügen zu umreißen ist.
Im
Fall des Solidaritätszuschlags ist dies der
wiedervereinigungsbedingte finanzielle
Mehrbedarf des Bundes. Weiter führt der Senat
aus, dass ein evidenter Wegfall des Mehrbedarfs
eine Verpflichtung des Gesetzgebers begründet,
die Abgabe aufzuheben oder ihre Voraussetzungen
anzupassen. Insoweit trifft den
Bundesgesetzgeber – bei einer länger andauernden
Erhebung einer Ergänzungsabgabe – eine
Beobachtungsobliegenheit.
Ein
offensichtlicher Wegfall des auf den Beitritt
der damals neuen Länder zurückzuführenden
Mehrbedarfs des Bundes kann auch heute (noch)
nicht festgestellt werden. Eine Verpflichtung
des Gesetzgebers zur Aufhebung des
Solidaritätszuschlags ab dem
Veranlagungszeitraum 2020 bestand und besteht
folglich nicht.
Die
Verfassungsbeschwerde, mit der sich die
Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer gegen
die unveränderte Fortführung der
Solidaritätszuschlagspflicht und gegen den nur
teilweisen Abbau des Solidaritätszuschlags
wenden, blieb daher erfolglos. Richterin
Wallrabenstein hat sich der Senatsmehrheit im
Ergebnis angeschlossen, jedoch hinsichtlich der
Begründung ein Sondervotum verfasst.
DMB-Vorstand Tenbieg zum Soli-Urteil: „Jetzt
sind andere Entlastungen für den Mittelstand
gefragt“
Marc S. Tenbieg, geschäftsführender
Vorstand des Deutschen Mittelstands-Bundes
(DMB), kommentiert das heutige Urteil des
Bundesverfassungsgerichts, das den
Solidaritätszuschlag als verfassungskonform
bestätigt hat.
„Wir respektieren die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts,
bedauern jedoch, dass der Solidaritätszuschlag
für viele kleine und mittlere Unternehmen
weiterhin eine erhebliche finanzielle Belastung
bleibt und an sich nicht mehr viel mit dem
‚Aufbau Ost‘ zu tun hat“, so Tenbieg.
„Rund sieben Milliarden Euro zahlen
mittelständische Betriebe jährlich – Geld, das
in wirtschaftlich angespannten Zeiten dringend
für Investitionen, Innovationen und Schaffung
von Arbeitsplätzen benötigt wird.“ Tenbieg
fordert daher von der Politik nennenswerte
finanzielle Entlastungen für KMU: „Die dringend
notwendige Steuer- und Abgabenentlastung muss
nun auf anderem Wege erfolgen.
Wir
erwarten von der kommenden Bundesregierung
wirksame Maßnahmen zur Stärkung des Mittelstands
– etwa durch steuerliche Erleichterungen auf ein
international wettbewerbsfähiges Niveau von 25
Prozent, Abbau der zeit- und kostenintensiven
Bürokratie sowie praxisnahe und gut
ausgestattete Förderprogramme. Nur so können KMU
auch künftig ihre zentrale Rolle als
Innovations- und Beschäftigungstreiber
erfüllen.“
IHK fordert
Steuerreform nach Soli-Entscheidung Unternehmen
müssen endlich entlastet werden
Der Solidaritätszuschlag (Soli)
entspricht der Verfassung. Das hat das
Bundesverfassungsgericht heute entschieden. Ein
schwerer Schlag für die Unternehmen, findet die
Niederrheinische IHK.
Eine steuerliche
Entlastung ist überfällig, betont IHK-Präsident
Werner Schaurte-Küppers: „Die Entscheidung des
Gerichts, dass der Soli bleibt, ist zu
respektieren. Unsere Wirtschaft braucht aber
eine echte Steuerreform, um international
wettbewerbsfähig zu sein. Wir müssen mehr
unternehmerische Freiheit zulassen. Wir sagen:
Sofort entlasten.
Ziel muss sein, den
Soli abzuschaffen und die Unternehmenssteuern
auf maximal 25 Prozent zu senken. Auch die
Stromsteuer muss auf das europäische Mindestmaß
– für alle Branchen. Unternehmen bauen gerade
massiv Stellen ab oder gehen ins Ausland. Das
sollte Warnung genug sein. Neben den Steuern
bleibt die Bürokratie das Hauptproblem. Es ist
falsch, wenn die öffentliche Verwaltung stärker
wächst als die Wirtschaft. Das gilt übrigens
auch für die Anzahl der Ministerien in Berlin.
Es wäre ein starkes Signal, das Kabinett von 16
auf 12 Minister zu reduzieren.“
Campingplatz "Hohes Ufer" in
Schermbeck: Öffnung zum Saisonstart
Der Campingplatz „Hohes Ufer“ in Schermbeck kann
zum Start der Camping-Saison wieder geöffnet
werden. Die Nutzungsuntersagung, die der Kreis
Wesel Anfang 2022 erteilt hatte, wird zum
31.03.2025 aufgehoben und der Platz kann wieder
betrieben werden.
Auf dem Campingplatz
hat sich viel getan: Die Betreiber haben die
Fahrwege verbreitert, die sehr wichtigen
Brandschutzstreifen von mindestens zehn Meter
Breite neu angelegt und für eine gesicherte und
ausreichende Löschwasserversorgung gesorgt.
Während der Zeit der Schließung wurden
zahlreiche Pachtverträge beendet und die
Bebauung von diesen Parzellen entfernt.
Für die Betreiber und die Bauaufsichtsbehörde
Kreis Wesel ist die Arbeit aber noch nicht
beendet. Zum Hintergrund: Anfang 2022 musste die
untere Bauaufsicht des Kreises Wesel den Platz
am Wesel-Datteln-Kanal schließen. Vorausgegangen
war eine Begehung des Platzes durch die Gemeinde
Schermbeck und den Kreis Wesel, bei der
schwerwiegende Brandschutzmängel festgestellt
wurden.
Die vorgefundenen Mängel ließen
damals erkennen, dass sich ein Brand über den
Platz ungehindert, schnell und in alle
Richtungen vollständig ausgedehnt hätte.
Löscharbeiten wären nicht möglich gewesen, da
kein Löschwasser zur Verfügung stand. Außerdem
wäre im Brandfall eine Rettung von Menschen und
Tieren mit Fahrzeugen der Feuerwehr oder
Rettungsdienste nur eingeschränkt möglich
gewesen.
Die sofortige Untersagung der
Weiternutzung war die einzige Möglichkeit, um
die konkrete Gefahr für Leib und Leben der
Pächterinnen und Pächter abzuwenden. Die
Betreiber müssen nun einen Bauantrag erarbeiten
lassen, um die neue Aufteilung mit Fahrwegen,
Brandschutzstreifen und Parzellen genehmigen zu
lassen.
Mit dieser Genehmigung kann der
Platz dann zunächst als reiner Campingplatz
betrieben werden, der Bau von Mobilheimen oder
dauerhaft abgestellte Wohnwagen sind dann
weiterhin verboten. Perspektivisch soll der
Platz zu einem sogenannten Wochenendplatz
weiterentwickelt werden. Dafür muss ein
Bebauungsplan aufgestellt und von der
Gemeindevertretung Schermbeck beschlossen
werden.
Der Kreis Wesel ist weiterhin
auf dem Platz tätig, um die
Brandschutzvorschriften vollständig
durchzusetzen und so die letzten Gefahrenquellen
zu beseitigen. Auch, wenn die grundsätzliche
Aufteilung des Platzes und die Versorgung mit
Löschwasser mittlerweile den gesetzlichen
Anforderungen entsprechen, gibt es immer noch
Parzellen, auf denen noch Gebäude von Pächtern
vorhanden sind und nicht alle Größen- und
Abstandsregeln eingehalten sind.
Für
wenige Parzellen muss eine individuelle
Nutzungsuntersagung weiterhin ausgesprochen
bleiben, da die vorhandenen Gebäude zu dicht
aneinander stehen und die Grenzabstände
untereinander nicht einhalten.
Moers: Biomasse-Heizkraftwerk -
Technologiepark Eurotec
Seit 2009 betreibt Enni gemeinsam mit
den Stadtwerken Dinslaken im Moerser
Technologiepark Eurotec ein
Biomasse-Heizkraftwerk. Die hochmoderne
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage der
Tochtergesellschaft Biokraft produziert neben
Strom auch Wärme. Das sorgt für hohe
Wirkungsgrade und beste Ökobilanzen.
Interessierte Niederrheiner und
Niederrheinerinnen erfahren hier auf dem
historischen Gelände der ehemaligen Zeche
Rheinpreußen, wie die Biokraft aus Frischholz
Strom für jährlich 5.000 Haushalte und Wärme für
3.200 Häuser produziert. Bei einem Rundgang
informieren Experten bzw. Expertinnen über das
Funktionsprinzip der Anlage und diskutieren mit
Teilnehmenden über die Energieerzeugung aus
nachwachsenden Rohstoffen.
Eine
Anmeldung ist erforderlich. Es gibt eine
Mindestteilnehmerzahl. Kurs-Nr.: F10434A Gebühr:
unentgeltlich #ENNI-Ökotouren# In Kooperation
mit der Enni Mit Enni können Niederrheiner und
Niederrheinerinnen jetzt im Frühjahr erneut
hinter die Kulissen ökologisch besonders
wertvoller Projekte blicken und dabei mit
Experten diskutieren.
Neben
regenerativen Kraftwerken stellt Enni dabei
erneut auch ihren vertikalen Garten am Moerser
Firmensitz als ein besonderes Öko-Projekt der
Region vor. Event details Veranstaltungsdatum
26.03.2025 - 17:00 Uhr - 19:00 Uhr
Veranstaltungsort Eurotec-Ring 15 47445 Moers
Veranstaltungsort Technologiepark Eurotec
Moers: Lern-Treff
Viele Menschen mit Lese- und
Schreibproblemen verbergen ihre Schwierigkeiten.
Sie befürchten bloßgestellt zu werden oder ihren
Arbeitsplatz zu verlieren. Für sie heißt das,
nicht aufzufallen und die Ausbildung,
Freundschaften oder sogar ihre Partnerschaft zu
riskieren.
Funktionaler Analphabetismus
ist in unserer Gesellschaft immer noch ein
Tabuthema. Deshalb bieten wir Hilfe an. Ohne
Anmeldung. Ohne Termin. Jede und jeder
Erwachsene mit Schwierigkeiten beim Lesen und
Schreiben ist eingeladen jeden Mittwoch,
zwischen 11 und 13 Uhr in das Café Sonnenblick
in der Moselstr. 55 in Meerbeck zu kommen.
Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück
Kuchen hilft unsere Grundbildungsexpertin bei
allen Schriftsprachproblemen (z. B. Anträge,
Bewerbungen, Rechnungen usw.), hat ein offenes
Ohr für die Probleme und findet, sofern vom
Ratsuchenden gewünscht, auch einen passenden
Lese- und Schreibkurs. Kursleitung: Hülya Reske
unentgeltlich Veranstaltungsdatum
26.03.2025 - 11:00 Uhr - 13:00 Uhr
Veranstaltungsort Moselstraße 55 47443 Moers
Veranstaltungsort Café Sonnenblick
Moers: Feuerwehrausschuss tagt am 28. März
Die Satzung für die Durchführung der
Brandverhütungsschau ist Thema des
Feuerwehrausschusses am Freitag, 28. März. Die
Sitzung findet um 16 Uhr im Ratssaal des
Rathauses, Rathausplatz 1, statt.
Hintergrund der Satzungsänderung ist, dass unter
anderem die Personalkosten gestiegen sind,
sodass die Gebühren neu kalkuliert werden
müssen. Weitere Themen sind zudem der Bericht zu
Baumaßnahmen an Feuerwehrgebäuden, die
Einstellung von Nachwuchskräften und die
Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der
Freiwilligen Feuerwehr.
Solar
lohnt sich: Kostenlose Online-Vortragsreihe in
Dinslaken zur Solarenergie
Die Solarmetropole Ruhr informiert
gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW.
Solarenergie ist ein wichtiger Bestandteil der
deutschen Stromversorgung und gewinnt zunehmend
an Bedeutung. Diese Vortragsreihe bietet
fundierte Informationen, um den Einstieg in die
Solarenergie sicher gestalten zu können.
In der kostenlosen Online-Vortragsreihe
erfahren Bürger*innen alles rund um
Photovoltaik-Anlagen, von der Planung bis zur
Nutzung. Die Vorträge richten sich an
Hausbesitzer*innen und Bewohner*innen von
Mehrfamilienhäusern. Vorkenntnisse sind nicht
notwendig und Fragen aus dem Teilnehmendenkreis
sind ausdrücklich erwünscht.
Termine der
Vortragsreihe:
26.03.: Sonnenstrom vom Dach
– Photovoltaik-Dachanlagen
02.04.:
Photovoltaik-Anlagen mieten oder kaufen?
09.04.: Sonnenstrom vom Balkon –
Steckersolargeräte
16.04.: Photovoltaik auf
Mehrfamilienhäusern
Die Teilnahme ist
kostenlos, eine Anmeldung unter www.solarmetropole.ruhr ist
erforderlich. Dort sind auch weitere
Informationen zu den einzelnen Vorträgen zu
finden und mit Hilfe des regionalen
Solardachkatasters kann jetzt schon geprüft
werden, ob ein Gebäude für Solarenergie geeignet
ist. Die Stadt Dinslaken ist Teil der
Solarmetropole Ruhr und des Energiesparhauses
Ruhr des Regionalverbands Ruhr (RVR).
Moers: Ziele des Fernsehens
Ein
Streifzug durch 75 Jahre deutsche
Fernsehgeschichte
1950 begann mit der Ausstrahlung des
ersten Testbildes eine neue Ära der
Medienentwicklung in der gerade gegründeten BRD.
Ziel des neuen „Fernsehens“ sollte es sein,
„Brücken von Mensch zu Mensch, von Völkern zu
Völkern“ zu schlagen und so einen Beitrag zu
leisten „zur ewigen Hoffnung der Menschheit:
Friede auf Erden“.
Der Vortrag schildert
mit oft zum Schmunzeln anregenden Ausschnitten,
auf welchen Wegen das neue Medium in der
folgenden Zeit versuchte, diesen Ansprüchen
gerecht zu werden und zum „Lagerfeuer“ wurde, um
das sich alle Generationen versammelten.
Er wirft einen Blick auf die Veränderungen,
die die Zulassung von Privatsendern mit sich
brachten und wagt eine Prognose, ob das
klassische Fernsehen angesichts der wachsenden
Popularität des Streamings noch eine Chance hat
oder das Lagerfeuer endgültig erloschen ist.
Referent: Jürgen Plewka Kurs-Nr.: F10105
Gebühr: 7 Euro Event details Veranstaltungsdatum
27.03.2025 - 19:00 Uhr - 21:00 Uhr.
Veranstaltungsort Altes Landratsamt
vhs Moers - Kamp-Lintfort:
Klangschalen-Workshop
Der Workshop richtet sich an Anwender
und Anwenderinnen und Interessierte. Christiane
Claren stellt eine große Zahl an Schalen und
Klöppeln vor und erklärt die unterschiedliche
Handhabung. Sie ist Mitarbeiterin einer
Fairtrade-Firma und bringt entsprechend nur fair
gehandelte Produkte mit.
Was es damit
auf sich hat, erklärt die theoretische
Einführung. Nach einem kurzen Film erfahren Sie
alles über die Herstellung, die Herkunft und
über die Geschichte der Klangschalen. Im
Anschluss können Sie dann die Ruhe stiftende
Wirkung auf Körper und Seele selber
ausprobieren. Sie lernen alles über die
Handhabung und über die unterschiedlichen
Einsatzmöglichkeiten.
Referentin:
Christiane Claren Kurs-Nr.: F30039 Gebühr:
unentgeltlich. Veranstaltungsdatum 28.03.2025 -
16:00 Uhr - 18:15 Uhr. Veranstaltungsort
Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort Adresse
Wilhelm-Schroeder-Straße 10 47441 Moers
Moers: Improviser in Residence 2025
invites: Jaune Toujours band
Jaune Toujours lädt Sie ein, sie auf
ihrer musikalischen Reise zu begleiten, auf der
Genres überschritten und Regeln neu geschrieben
werden. *VERTIGO* ist mehr als ein Album: Es ist
ein Statement, eine Einladung, die Welt anders
zu sehen, mit der gleichen Offenheit, die die
Band seit den 1990er Jahren auszeichnet.
Veranstaltungsdatum 27.03.2025 - 19:00 Uhr.
Veranstaltungsort Weygoldstraße 10,47441 Moers.
Veranstaltungsort Die Röhre, Veranstalter
Festivalbüro des moers festivals
Moers: Schiffbruch erlitten?
Sind Sie jemals gescheitert? Haben Sie
schon einmal eine Niederlage erlitten? Versagen
erlebt? Ablehnung erfahren? Eine Sache vergeigt,
in den Sand gesetzt? Wenn Sie auf eine dieser
Fragen mit „ja“ antworten können, dann ist
dieser Abend richtig für Sie! Es gibt eine Menge
Literatur über den Erfolg, aber kaum etwas über
das Scheitern.
Obwohl so viele von uns
Scheitern erleben, gerade in der heutigen Zeit,
die von Macht, Erfolg und Konkurrenzdenken
geprägt ist. Wie aber kann ich nach einer
Niederlage wieder Hoffnung schöpfen? Wie
bewältige ich mein Scheitern?
Welchen
Nutzen kann ich vielleicht aus dieser
Lebensphase ziehen, und vor allem: Wie kann ein
Neuanfang beginnen, und wie kann mir der
christliche Glaube dabei eine Hilfestellung
sein? Downloads
Schiffbruch erlitten - Referent: Stefan Hohage
Veranstaltungsdatum 27.03.2025 - 19:00
Uhr - 20:00 Uhr Veranstaltungsort
Karl-Hoffmeister-Straße 16 ,47441 Moers.
Moers: Historischer Stadtrundgang am
Sonntag
Die ‚Grafschafterin Anna‘ und ‚Frau
Therese Sempel‘ begeben sich auf den Weg zu
einer besonderen historischen Stadtführung am
Sonntag, 30. März, 10.30 Uhr.
Start ist vor dem Haupteingang des Moerser
Schlosses, Kastell 9. Unterwegs erzählen die
historischen Figuren von der Entstehung der
Stadt, Begebenheiten aus der römischen,
oranischen und preußischen Regentschaft sowie
vom Stadtbrand und dem Leben der Bürgerschaft
und Edelleute.
Die Gästeführerinnen
Anne-Rose Fusenig oder Renate Brings-Otremba
begleiten den Rundgang in historischer
Gewandung. Verbindliche Anmeldungen zu der
Führung nimmt die Stadt- und Touristinformation
von Moers Marketing entgegen: Kirchstraße 27a/b,
Telefon 0 28 41 / 88 22 60. Kosten pro Person: 8
Euro.
Moers: Enni liest Zähler bei 4.700 Kunden im
April in Scherpenberg und Hochstraß ab
Das Ableseteam der ENNI Energie &
Umwelt Niederrhein (Enni) ist im Zuge des
sogenannten rollierenden Ableseverfahrens im
April in den Moerser Stadtteilen Scherpenberg
und Hochstraß unterwegs. „Dieses Mal erfassen
wir dort bei etwa 4.700 Haushaltskunden rund
7.400 Strom-, Gas- und Wasserzählerstände.
Dabei unterstützt uns die
Dienstleistungsgesellschaft ASL Services“,
informiert Lisa Bruns als zuständige
Mitarbeiterin der Enni. Sind vereinzelte Zähler
nicht für die Ableser der ASL zugänglich,
hinterlassen sie eine Informationskarte im
Briefkasten. „Die Bewohner finden darauf die
Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, an die sie
die Zählerstände selbst mitteilen können“, so
Bruns.
Wichtiger Hinweis: Die Ablesung
erfolgt jährlich. Als wiederkehrendes Ereignis
informiert die Enni die Kunden nicht gesondert
darüber. Dennoch hofft Lisa Bruns auf deren
Unterstützung: „Wichtig für uns ist, dass die
Zähler frei zugänglich sind. Nur so ist ein
schneller und reibungsloser Ablauf
gewährleistet.“
Übrigens: Damit keine
schwarzen Schafe in die Häuser gelangen, haben
alle durch Enni beauftragten Ableser einen
Dienstausweis. Bruns: „Den sollten sich Kunden
zeigen lassen, damit keine ungebetenen Gäste ins
Haus gelangen.“ Im Zweifel sollten sich Kunden
bei der Enni unter der kostenlosen
Service-Rufnummer 0800 222 1040 informieren.
vhs Kleve: Tastschreiben
Entdecken Sie die Kunst des
Tastschreibens in unserem Seminar! Innerhalb
kurzer Zeit erlernen Sie die Griffwege der
PC-Tastatur nach der 10-Finger-Methode. Dieser
ganzheitliche Ansatz eignet sich besonders für
Interessierte ab 12 Jahren ohne Vorerfahrungen.
Mit Assoziations- und
Visualisierungstechniken fördern wir Ihren
Lernerfolg. Während des Kurses konzentrieren wir
uns auf die Grundlagen, zu Hause üben Sie die
Schreibsicherheit und -geschwindigkeit.
Ferienkurs von Mo. - Do., 14. - 17.04.2025, 9:30
- 12:30 Uhr. Mehr Infos unter 02821-84722 oder
vhs@kleve.de
Neues Bürokratiemonster
für Menschen mit Haus? Verband Wohneigentum
besorgt über geplante Norm zur
Verkehrssicherungsprüfung
Der gemeinnützige Verband Wohneigentum
zeigt sich besorgt über die geplante neue
DIN-Norm [DIN 94681] des Deutschen Instituts für
Normung zur „Verkehrssicherheitsüberprüfung für
Wohngebäude“.
Der 40-seitige Entwurf,
der regelmäßige Sicherheitsprüfungen an
Wohngebäuden durch Fachbetriebe vorsieht, könnte
zu erheblichen Zusatzkosten für Eigentümer von
Haus oder Wohnung führen. Statt bürokratische
Hürden abzubauen, droht die Norm zusätzliche
Auflagen und Kosten mit sich zu bringen.
Expert*innen schätzen, dass die Kosten für eine
solche Überprüfung durchaus in den vierstelligen
Bereich steigen könnten.
„Die
Belastung der Wohneigentümer durch zusätzliche
Prüfpflichten ist aus unserer Sicht nicht
gerechtfertigt“, erklärt Peter Wegner, Präsident
des Verbands Wohneigentum. „Viele Hausbesitzer
sind bereits durch steigende Energiekosten und
Instandhaltungsaufgaben stark belastet. Die
Einführung zusätzlicher, kostenintensiver
Prüfpflichten würde die ohnehin schwierige
finanzielle Situation vieler Eigentümerinnen und
Eigentümer weiter verschärfen.“
Auch
freiwillige Norm hat negative Auswirkungen In
einer
Pressemitteilung vom 20. März betont das
Deutsche Institut für Normung, dass die
neue Norm freiwillig und eine gesetzliche
Verpflichtung „bei dieser Norm nicht vorgesehen“
sei. Doch auch eine freiwillige Norm hat
negative Auswirkungen, beispielsweise auf
Gebäudeversicherungen, und treibt die Kosten in
die Höhe, betont der Verband Wohneigentum.
„Die Gefahr besteht, dass Gebäudeversicherer
es zukünftig zur Auflage machen, eine solche
jährliche Verkehrssicherungsprüfung
durchzuführen oder die Versicherungsprämien
erhöhen, wenn man diese nicht vorweisen kann“,
erklärt Verband-Wohneigentum-Präsident Peter
Wegner. So würde eine indirekte Pflicht zur
Umsetzung entstehen, die auch deswegen Kosten
hochtreibt, da die jährliche Prüfung nach
DIN-Norm [DIN 94681] von Fachbetrieben
durchgeführt werden muss.
Gründliche
Überprüfung der Norm auf Praxistauglichkeit!
Der Verband Wohneigentum fordert eine gründliche
Überprüfung der Norm mit Blick auf ihre
Praxistauglichkeit. „Eigentum verpflichtet. Wer
ein Haus oder eine Wohnung mit Grundstück
besitzt, muss auch heute schon im Rahmen der
Verkehrssicherungspflicht dafür sorgen, dass
dort niemand zu Schaden kommt. Wohneigentum darf
nicht durch übermäßige Regulierung unattraktiv
gemacht werden. Wir appellieren an die
Verantwortlichen, pragmatische Lösungen zu
schaffen“, so Wegner weiter.
Der
Norm-Entwurf befindet sich noch bis zum 7. April
2025 in der öffentlichen Diskussion. Der Verband
Wohneigentum wird seine fachliche Perspektive
dazu einbringen und fordert eine stärkere
Berücksichtigung der Interessen von
Wohneigentümern im Normungsprozess.
vhs Moers – Kamp-Lintfort:
Möglichkeiten des Ehrenamts
Den Bürgerbus fahren, beim moers
festival helfen oder im Reparatur-Café
unterstützen – Möglichkeiten, sich ehrenamtlich
zu engagieren, gibt es viele. Wer sich für ein
Ehrenamt interessiert, dem bietet die vhs Moers
– Kamp-Lintfort am Donnerstag, 3. April, die
Veranstaltung ‚Freiwillig – Verschiedene
Ehrenamtsmöglichkeiten stellen sich vor‘ an.
Ab 19 Uhr gibt es in den Räumen der vhs
Moers an der Wilhelm-Schroeder-Straße 10
Einblicke in verschiedene Organisationen, bei
denen man sich aktiv einbringen kann. Die
Veranstaltung ist kostenlos. Eine rechtzeitige
Anmeldung telefonisch unter 0 28 41/201 - 565
oder online unter www.vhs-moers.de ist
erforderlich.
Stadt Moers
lädt zum Jubiläums-Hackday am 4. und 5. April
ein
Sein zehnjähriges Jubiläum feiert der
Hackday Moers in diesem Jahr. Die beliebte
Veranstaltungsreihe findet am Freitag, 4. und
Samstag, 5. April, im Rathaus (Rathausplatz 1)
statt. „Wir hoffen, dass zum Jubiläum besonders
viele interessierte Menschen unserer Einladung
folgen“, erklärt Stephan Bernoth, Leiter der
Stabstelle Digitalisierung der Stadt Moers.

Ursprünglich ist der Hackday mit dem
Fokus auf OpenData gestartet. Das sind offene
Daten, die von allen Nutzerinnen und Nutzern
kostenlos verwendet werden dürfen, um sie einer
breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu
stellen.
„Im Laufe der Jahre öffnete
sich die überregionale Veranstaltung im Laufe
der Jahre mehr und mehr weiteren Themen wie
OpenGovernment, E-Partizipation, Civic
Technology (technische Konzepte, die das
Engagement der Bürgerschaft fördern), Künstliche
Intelligenz (KI)oder
Verwaltungsdigitalisierung“, beschreibt
Beigeordneter Claus Arndt die inhaltliche
Ausprägung.
Die Veranstaltung
richtet sich traditionell nicht nur an digitale
Expertinnen und Experten, sondern an alle
Interessierten, die mit Technikunterstützung
sinnvolle gesellschaftliche Änderungen erreichen
möchten. „Ein wichtiger Punkt bei den Hackdays
waren und sind immer das digitale ehrenamtliche
Engagement und die Zusammenarbeit der
Stadtverwaltung mit Freiwilligen“, so Arndt
weiter.
Verwaltungsdigitalisierung
am Freitag
Der Hackday startet offiziell am
Freitag, 4. April, um 9.30 Uhr im Ratssaal. Der
Tag steht besonders unter dem Thema der
Verwaltungsdigitalisierung. Beispielsweise
stellt Dr. Annika Busse LLMoin – ein
KI-Assistent für die Hamburger Stadtverwaltung -
vor. Mitarbeitende nutzen das Tool für
verschiedene Zwecke. Prof. Dr. Jörn von Lucke
von der Zeppelin Universität Friedrichshafen
erläutert danach die Auswirkungen von
generativen KI-Technologien auf die
Verwaltungsarbeit.
Generativ
bezeichnet in dem Zusammenhang, dass KI die
Texte, Bilder, Videos oder andere Datenformen
erzeugt. Bei der Diskussion mit Marc Groß, vom
Vorstand der ‚Kommunalen Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt)‘ geht es darum, ob
und wie innovative Technologien bürokratische
Prozesse verschlanken, Prozesse automatisieren
und die Verwaltung in einen agilen Partner für
die Gesellschaft verwandeln können.
In
einem weiteren Vortrag geht Prof. Dr. Jörn von
Lucke darauf ein, wie KI Bauvorhaben, Baustellen
und das Gebäudemanagement mit allen Prozessen
tiefgreifend verändern kann. Viele Angebote für
Kinder und Jugendliche Samstag findet eher das
‚klassische‘ Angebote des Hackdays für den
privaten und ehrenamtlichen Bereich statt.
Beispielsweise bringt Harald Schwarz
Interessierten die Anwendung Open Street Map
(OSM) näher. Diese riesige Geodatenbank wird von
tausenden von Freiwilligen mit Informationen
befüllt und steht danach allen Menschen zur
freien Verfügung. Um Beteiligungen von
Bürgerinnen und Bürgern geht es bei der
Veranstaltung mit Chris Demmer (Smart City
Koordinator der Stadt Mönchengladbach).
Beim Datencafé am Nachmittag erläutert
der Student und Software-Entwickler Lennart
Fischer die potenziellen Anwendungs- und
Nutzungsmöglichkeiten von Offenen Daten. Beide
Hackday-Tage haben auch wieder zahlreich
Workshops für junge Menschen im Angebot.
Beispielsweise können Kinder und Jugendliche in
zwei Veranstaltungen durch das Spiel Minecraft
auf kreative und spielerische Weise das
Programmieren lernen.
Bei Tactile
Interfaces programmieren und basteln die
Teilnehmenden elektronische Textilien, die zum
Beispiel eine Hose in eine Trommel verwandeln
oder einen Pullover zum Singen bringen.
Alle Informationen über den diesjährigen Hackday
gibt es unter der Stichwort 'Hackday
2025'. Für die Teilnahmen an Vorträgen und
Workshops bittet das Team des Hackdays um
verbindliche Anmeldungen.

Preise für Wohnimmobilien im 4. Quartal
2024: +1,9 % zum Vorjahresquartal
+0,3 % zum Vorquartal
Die Preise für Wohnimmobilien
(Häuserpreisindex) in Deutschland sind im 4.
Quartal 2024 gegenüber dem 4. Quartal 2023 um
durchschnittlich 1,9 % gestiegen. Gegenüber dem
Vorquartal stiegen sie um 0,3 %.
Immobilienpreise im Vergleich zum
Vorjahresquartal nur in dünn besiedelten
ländlichen Kreisen gesunken In den
meisten Gegenden Deutschlands sind die
Immobilienpreise im 4. Quartal 2024 im Vergleich
zum 4. Quartal 2023 gestiegen. Nur in dünn
besiedelten ländlichen Kreisen waren die Preise
gegenüber dem Vorjahresquartal rückläufig. Dort
kosteten Wohnungen im Durchschnitt 1,2 %, Ein-
und Zweifamilienhäuser 0,9 % weniger.
In den sieben größten Städten Deutschlands
(Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am
Main, Stuttgart und Düsseldorf) musste für
Wohnungen 1,6 % mehr gezahlt werden als im
4. Quartal 2023, Häuser kosteten 1,1 % mehr. Im
Vergleich zum Vorquartal waren die Preise für
Wohnungen dagegen leicht rückläufig (-0,3 %).
Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich in
diesen Städten um 3,9 % gegenüber dem
Vorquartal.
In den kreisfreien
Großstädten ohne Metropolen stiegen die Preise
für Wohnungen um 2,5 % gegenüber dem
Vorjahresquartal, für Ein-und Zweifamilienhäuser
erhöhten sie sich um 2,2 %. Im Vergleich zum
Vorquartal kosteten Wohnungen sowie Ein-und
Zweifamilienhäuser jeweils 0,2 % mehr.
Kommende Revision der Ergebnisse ab 2022
Im Zuge der Umsetzung einer neuen
Liefervereinbarung zum Berichtsjahr 2022 wurden
einige Fälle mit unbekanntem Baujahr fehlerhaft
dem Neubau zugeordnet. Daher werden die
Ergebnisse derzeit rückwirkend bis zum 1.
Quartal 2022 korrigiert. Nach aktuellen
Berechnungen werden sich die Korrekturen nur
geringfügig auf den Häuserpreisindex insgesamt
auswirken.
Im Bereich Neubau und bei den
Ergebnissen nach siedlungsstrukturellen
Kreistypen ist dagegen mit stärkeren
Veränderungen als im Häuserpreisindex insgesamt
zu rechnen. Alle in dieser Pressemitteilung
genannten Veränderungsraten für das 4. Quartal
2024 zum Vorquartal und Vorjahresquartal wurden
bereits korrigiert.
Da sich die
Indexwerte ab dem 1. Quartal 2022 durch die
vorzunehmenden Korrekturen ändern können, wurden
die entsprechenden Werte im Internetangebot als
vorläufig gekennzeichnet. Die
Jahresveränderungsraten werden mit den
korrigierten Ergebnissen veröffentlicht. Die
ausstehenden Korrekturen werden schnellstmöglich
vorgenommen und das Datenangebot aktualisiert.
Elterngeld 2024: Elterngeld Plus gewinnt
weiter an Bedeutung
• 1,24 Millionen Frauen und 432 000
Männer bezogen 2024 Elterngeld; Väteranteil mit
25,8 % leicht rückläufig
• Anteil der
Beziehenden von Elterngeld Plus mit 36,7 % auf
neuem Höchstwert
• Durchschnittliche Dauer
des geplanten Elterngeldbezugs 2024 bei Frauen
mit 14,8 Monaten weiterhin deutlich länger als
bei Männern mit 3,8 Monaten
Rund 1,67
Millionen Frauen und Männer in Deutschland haben
im Jahr 2024 Elterngeld erhalten. Das waren rund
95 000 oder 5,4 % weniger als im Jahr 2023. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, ging die Zahl der Männer mit
Elterngeldbezug im Vorjahresvergleich um 31 000
oder 6,6 % auf 432 000 zurück, die Zahl der
leistungsbeziehenden Frauen um 65 000 oder 5,0 %
auf 1,24 Millionen.
Damit sank die Zahl
der Elterngeldbeziehenden im dritten Jahr in
Folge und lag 10,6 % niedriger als 2021. Zum
Vergleich: Im selben Zeitraum ging die Zahl der
Geburten nach vorläufigen Angaben um etwa 15 %
zurück.
613 000 Bezieherinnen und
Bezieher von Elterngeld planten im Jahr 2024 die
Inanspruchnahme von Elterngeld Plus, und zwar
42,3 % der berechtigten Mütter und 20,6 % der
Väter. Insgesamt betrug der Anteil der
Empfängerinnen und Empfänger von Elterngeld, die
bei ihrem Elterngeldbezug zumindest anteilig
auch Elterngeld Plus einplanten, 36,7 % (2023:
34,8 %). Seit seiner Einführung wird das
Elterngeld Plus somit immer stärker nachgefragt.
Zum Vergleich: 2016, im ersten Jahr
nach seiner Einführung, entschieden sich 20,1 %
der Mütter und 8,2 % der Väter für Elterngeld
Plus. Das Elterngeld Plus fällt monatlich
niedriger aus als das sogenannte
Basiselterngeld, wird dafür aber länger gezahlt,
sodass es insgesamt den gleichen Gesamtbetrag
ergibt. Arbeiten beide Elternteile parallel in
Teilzeit, können mit dem Partnerschaftsbonus bis
zu vier zusätzliche Monate Elterngeld Plus in
Anspruch genommen werden.
Von dieser
Möglichkeit machten allerdings nur 8,6 % der
Beziehenden von Elterngeld Plus Gebrauch.
Väteranteil in Sachsen am höchsten, im Saarland
am niedrigsten Der Väteranteil ging im Jahr 2024
leicht zurück auf 25,8 % (2023: 26,2 %). Dies
ist der erste nennenswerte Rückgang. Seit 2015
ist der Väteranteil kontinuierlich angestiegen,
damals hatte er noch bei 20,9 % gelegen.
Der Väteranteil gibt den Anteil der
männlichen Bezieher an allen
Elterngeldbeziehenden an. Er würde also genau
50 % betragen, wenn bei allen Kindern sowohl der
Vater als auch die Mutter gleichermaßen
Elterngeld beziehen würde.
Spitzenreiter
im Bundesländervergleich mit einem Väteranteil
von 29,5 % im Jahr 2024 war – wie im Vorjahr –
Sachsen, gefolgt von Baden-Württemberg (28,1 %)
und Bayern (27,8 %). Am niedrigsten lag der
Väteranteil 2024 – ebenfalls wie im Vorjahr – im
Saarland (20,6 %).
Nach wie vor
erhebliche Unterschiede zwischen Frauen und
Männern bei der geplanten Bezugsdauer
Die
durchschnittliche Dauer des geplanten
Elterngeldbezugs lag bei den Frauen im Jahr 2024
unverändert bei 14,8 Monaten. Die von Männern
angestrebte Bezugsdauer war mit durchschnittlich
3,8 Monaten dagegen deutlich kürzer und im
Vergleich der vergangenen Jahre praktisch
konstant (2023: 3,7 Monate; 2022: 3,6 Monate).
9 800 Euro je Schülerin und Schüler
an öffentlichen Schulen im Jahr 2023
Ausgaben
je Schülerin und Schüler gegenüber 2022 um gut 3
% gestiegen
Die öffentlichen Haushalte haben im
Jahr 2023 durchschnittlich 9 800 Euro für die
Ausbildung einer Schülerin beziehungsweise eines
Schülers an einer öffentlichen Schule
ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter
mitteilt, waren das nominal (nicht
preisbereinigt) rund 300 Euro beziehungsweise 3
% mehr als im Jahr 2022.
Gut drei
Viertel der Gesamtausgaben (7 400 Euro
beziehungsweise 76 %) entfielen dabei auf die
Personalkosten. Die restlichen Mittel wurden für
den laufenden Sachaufwand (1 400 Euro
beziehungsweise 14 %) und Investitionen (1 000
Euro beziehungsweise 10 %) bereitgestellt.
Pro-Kopf-Ausgaben variieren zwischen den
Schularten teils deutlich
An
allgemeinbildenden Schulen wurden im Jahr 2023
durchschnittlich 10 500 Euro je Schülerin und
Schüler und somit 300 Euro (+3 %) mehr als im
Vorjahr aufgewendet. Zwischen den Schularten
zeigen sich teils deutliche Unterschiede in der
Ausgabenhöhe.
So beliefen sich die
Pro-Kopf-Ausgaben an Grundschulen auf
8 400 Euro, während es an Integrierten
Gesamtschulen rund 11 600 Euro waren. An
Gymnasien wurden durchschnittlich 10 900 Euro je
Schülerin und Schüler ausgegeben. Die Ausgaben
an beruflichen Schulen lagen im Vergleich
deutlich niedriger.
Im Jahr 2023 wurden
hier insgesamt 7 100 Euro je Schülerin und
Schüler aufgewendet. Dies entspricht einer
Steigerung um 300 Euro (+5 %) gegenüber dem
Vorjahr. Erklärbar sind die niedrigeren Ausgaben
an den beruflichen Schulen insbesondere mit
überwiegendem Teilzeitunterricht an den
Berufsschulen innerhalb des dualen
Ausbildungssystems.
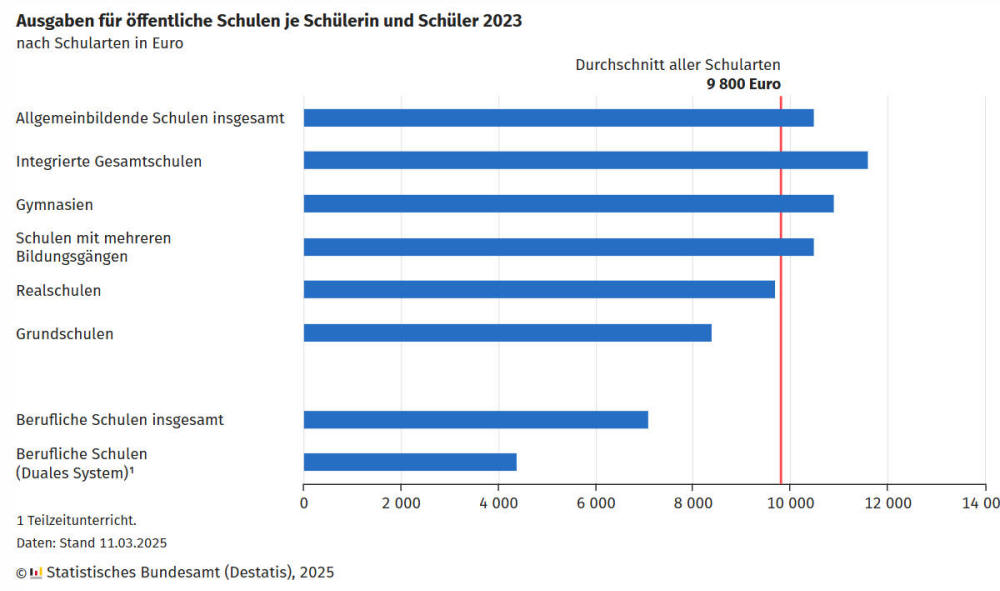
Hoher Anstieg der Ausgaben je Schülerin und
Schüler in Bayern Mit Ausnahme des Saarlands, wo
aufgrund auslaufender Sonderprogramme ein
Rückgang von 140 Euro (-1 %) zu verzeichnen war,
stiegen die Ausgaben je Schülerin und Schüler im
Jahr 2023 in allen Bundesländern. Am stärksten
nahmen die Ausgaben in Bayern (+700 Euro
beziehungsweise +6 %) und in Schleswig-Holstein
(+500 Euro beziehungsweise +5 %) zu.
Die
höchsten Ausgaben verzeichneten Berlin mit
13 400 Euro, Hamburg mit 12 300 Euro und Bayern
mit 11 300 Euro. In Nordrhein-Westfalen lagen
die Ausgaben mit 8 900 Euro je Schülerin und
Schüler am niedrigsten. Bei einem
Ausgabenvergleich zwischen den Bundesländern ist
zu beachten, dass sich nicht nur die
Schulstruktur und das Unterrichtsangebot in den
einzelnen Ländern unterscheiden, sondern auch
Unterschiede hinsichtlich
Schüler-Lehrer-Relationen, Besoldungsstruktur,
Gebäudemanagement oder der zeitlichen Verteilung
von Investitionsprogrammen vorliegen.
4 % mehr junge Menschen beginnen
2024 einen Bildungsgang im Anschluss an die
Sekundarstufe I oder ein Studium
• Zahl der neuen Schülerinnen und
Schüler in Sekundarstufe II um 14 % gestiegen,
vor allem durch Wiedereinführung des
neunjährigen Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen
und Schleswig-Holstein
• 3,3 % mehr junge
Menschen beginnen ein Programm im
Übergangsbereich zum Erwerb beruflicher
Grundkenntnisse oder zum Nachholen eines
Schulabschlusses
• Zahl der Ausländerinnen
und Ausländer steigt in allen vier Sektoren der
integrierten Ausbildungsberichterstattung
Im Jahr 2024 haben in Deutschland gut 1,9
Millionen Personen ein Studium aufgenommen, eine
Berufsausbildung angefangen, ein Programm im
Übergangsbereich zwischen Schule und
Berufsbildung begonnen oder den Weg zum Erwerb
einer Hochschulzugangsberechtigung
eingeschlagen.
Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen
Ergebnissen der integrierten
Ausbildungsberichterstattung mitteilt, waren das
4 % oder 72 600 Personen mehr als im Jahr 2023.
Der Zuwachs ist unter anderem auf
Bildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit
ausländischer Staatsangehörigkeit
zurückzuführen, deren Zahl um 12 %
beziehungsweise 42 900 Personen gegenüber 2023
zunahm.
Steigende Anfängerzahlen in den
Sektoren Studium, Erwerb der
Hochschulzugangsberechtigung und im
Übergangsbereich
Von den insgesamt 1,9
Millionen Personen haben 691 200 eine
Berufsausbildung angetreten (-0,3 % gegenüber
2023). 495 800 Personen haben ein
Hochschulstudium begonnen, das waren 1,9 % mehr
als im Vorjahr. 467 300 Schülerinnen und Schüler
haben den Weg zum Abitur beziehungsweise zum
Erwerb einer Hochschulzugangsberechtigung
eingeschlagen – entweder in gymnasialen
Oberstufen oder an beruflichen Schulen. Ihre
Zahl ist um 14 % gegenüber dem Vorjahr
gestiegen, was zum Großteil auf die
Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums in
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein
zurückzuführen ist.
Durch den
Wechsel vom G8- zum G9-Modell verweilten im
vergangenen Schuljahr 2023/24 mehr Schülerinnen
und Schüler in der Sekundarstufe I. Somit
mündeten sie nicht im Vorjahr, sondern in diesem
Jahr in die Sekundarstufe II ein. Deshalb kommt
es nun in diesen beiden Ländern zu starken
Zunahmen in diesem Sektor gegenüber dem Vorjahr.
Rund 259 400 junge Menschen nahmen im Jahr 2024
ein Bildungsprogramm im Übergangsbereich
zwischen Schule und Berufsausbildung auf.
Die Anfängerzahl nahm damit gegenüber 2023
um 3,3 % oder 8 200 Personen zu und stieg
bereits im dritten Jahr in Folge. Ziel der
Programme des Übergangsbereichs ist der Erwerb
beruflicher Grundkenntnisse, das Erlernen der
deutschen Sprache oder das Nachholen eines
Schulabschlusses.
Zahl der Ausländerinnen
und Ausländer steigt in allen vier Sektoren der
integrierten Ausbildungsberichterstattung
Der Zuwachs von Anfängerinnen und Anfängern
eines Bildungsprogramms mit ausländischer
Staatsangehörigkeit zeigt sich in allen vier
Sektoren der integrierten
Ausbildungsberichterstattung: So stieg die Zahl
der Ausländerinnen und Ausländer, die eine
Berufsausbildung begannen, 2024 gegenüber dem
Vorjahr um 12 % auf 114 100. Bei den
Studienanfängerinnen und -anfängern betrug der
Zuwachs 10 % (145 400 Personen).
In den
Programmen zum Erwerb der
Hochschulzugangsberechtigung gab es 46 500
ausländische Anfängerinnen und Anfänger und
damit 16 % mehr als 2023. Auch hier ist die
Zunahme zum Teil auf die stark gestiegenen
Schülerzahlen in Nordrhein-Westfalen aufgrund
der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums
zurückzuführen.
Im Übergangsbereich stieg
die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer, die
2024 ein Bildungsprogramm zum Erwerb beruflicher
Grundkenntnisse, zum Erlernen der deutschen
Sprache oder zum Nachholen eines
Schulabschlusses anfingen, gegenüber 2023 um 11
% oder 11 300 Personen auf insgesamt 109 600.
Der erneute Zuwachs der ausländischen
Bildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer dürfte
wie bereits in den Vorjahren vorrangig auf nach
Deutschland zugewanderte Jugendliche und junge
Erwachsene zurückzuführen sein, die sukzessive
in die verschiedenen Sektoren des deutschen
Bildungssystems einmünden.
Dienstag, 25.
März 2025
Moers: Vorträge zur politischen
Partizipation und zu anonymen Bestattungen
Das Projekt ‚Macht.mit!‘ des Ev. Bildungswerkes
FRIEDA des Kirchenkreises Moers ist Thema im
Sozialausschuss am Dienstag, 25. März. Im
Modellprojekt werden Kursformate entwickelt, die
zur Förderung der politischen Partizipation im
Quartier beitragen. In einem Vortrag stellt
Pfarrerin Anke Prumbraum die Frage, ob anonyme
Bestattungen ein Zeichen der Vereinsamung der
Gesellschaft sind.
Außerdem geht es in
der Sitzung um die aktuelle Situation bei der
Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.
Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Ratssaal des
Rathauses Moers (Rathausplatz 1). Zur selben
Zeit tagt dort einen Tag später (Mittwoch, 26.
März) der Ausschuss für Personal und
Digitalisierung. Unter anderem berichtet die
städtische Fachkraft für Arbeitssicherheit über
seine Aufgaben und Arbeitsinhalte.
Europäisches Verbraucherzentrum
Deutschland: Kostenlose Veranstaltung am
Dienstag, 1. April 2025, von 15 bis 16 Uhr
Ihre Fahrgastrechte bei Fernbus-Reisen
Busreisen sind nachhaltig, preisgünstig und
bequem. Kein voller Bahnhof, keine
Parkplatzsuche und kein Warten am
Flughafen-Check-In. Eigentlich eine stressfreie
Reisemöglichkeit, gäbe es nicht immer mal wieder
Probleme wie Busverspätungen, Ausfälle oder
verpasste Anschlüsse. Und leider ist auch das
Gepäck nicht immer sicher.
Die
Expertinnen des Europäischen Verbraucherzentrums
Deutschland erklären Ihnen Ihre Rechte und
Pflichten, damit Sie wissen, wie Sie sich im
Ernstfall korrekt verhalten und Ihre Reise, zum
Beispiel in ein anderes EU-Land, zu einem
entspannten Erlebnis wird.
Wann und Wo? Dienstag, 1.
April 2025 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Dies ist
eine hybride Veranstaltung, das heißt, Sie
können online oder vor Ort an der Fragerunde
teilnehmen. Vor Ort: Stadtbibliothek Gütersloh
Digitaler Werkraum, 2. Obergeschoss
Blessenstätte 1 33330 Gütersloh Anmeldung bitte
an:
stadtbibliothek-guetersloh@gt-net.de oder
telefonisch: 05241 211 80 74
Online: Für die
Videokonferenz wird die Software „Zoom“
verwendet. Sie können über folgenden Link an der
Veranstaltung teilnehmen:
https://us02web.zoom.us/j/86089106695?pwd=TDM3NlE4Rm1MeFFQempRcTVicjNnQT09
Meeting-ID: 860 8910 6695 Kenncode: 335486 Den
Link zur Videokonferenz finden Sie auch auf der
Internetseite des Europäischen
Verbraucherzentrums Deutschland
(www.evz.de),
unter der Rubrik "Veranstaltungen".
Moers: Vorträge zur
politischen Partizipation und zu anonymen
Bestattungen
Das Projekt
‚Macht.mit!‘ des Ev. Bildungswerkes FRIEDA des
Kirchenkreises Moers ist Thema im
Sozialausschuss am Dienstag, 25. März. Im
Modellprojekt werden Kursformate entwickelt, die
zur Förderung der politischen Partizipation im
Quartier beitragen. In einem Vortrag stellt
Pfarrerin Anke Prumbraum die Frage, ob anonyme
Bestattungen ein Zeichen der Vereinsamung der
Gesellschaft sind.
Außerdem geht es
in der Sitzung um die aktuelle Situation bei der
Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.
Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Ratssaal des
Rathauses Moers (Rathausplatz 1). Zur selben
Zeit tagt dort einen Tag später (Mittwoch, 26.
März) der Ausschuss für Personal und
Digitalisierung. Unter anderem berichtet die
städtische Fachkraft für Arbeitssicherheit über
seine Aufgaben und Arbeitsinhalte.
Moers: Sandra da Vina
Auf unserem Planeten wurden
bereits viele Materialien verbaut, aber Plüsch
war nicht so oft dabei. Schade. Aber Sandra
nimmt die Herausforderung an und macht diese
Welt mit ihrem neuen abendfüllenden
Bühnenprogramm etwas flauschiger. Sandra Da Vina
steht seit über zehn Jahren auf der Bühne. Nicht
ununterbrochen, aber regelmäßig.

An diesem Abend kann man ihr für hundert Minuten
dabei zuschauen und erlebt einen wilden Mix aus
Stand Up Comedy, Lyrik und Literatur. Oder wie
die SZ es einmal über sie sagte: „Ebenso lustig
wie berührend“. Diese Show ist der Versuch, der
unnachgiebigen Härte dieser Welt mit etwas
Fröhlichkeit zu begegnen.
Ein Abend für
die großen Lacher und die kleinen
melancholischen Momente. Eben hundert Prozent
Plüsch. Tickets sind unter www.bollwerk107.de erhältlich!
Veranstaltungsdatum 26.03.2025 - 20:00
Uhr - 22:30 Uhr. Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107, 47441 Moers.
Wesel:
Spezialchemieunternehmen Altana steigert seinen
Umsatz
Der in Wesel beheimatete
Spezialchemiekonzern Altana wächst weiter: Das
global führende Unternehmen konnte seinen Umsatz
2024 nochmals um 16 Prozent auf 3.169 Millionen
Euro (Vorjahr: 2.742 Millionen Euro) steigern.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 27
Prozent auf 490 Millionen Euro (Vorjahr: 385
Millionen Euro), vor allem aufgrund der
deutlichen Absatzsteigerung. Eine Steigerung
verbuchte der Konzern auch bei den Ausgaben für
Forschung und Entwicklung: Er investierte 213
Millionen Euro (acht Prozent mehr als im
Vorjahr).
Mit sieben Prozent des
Umsatzes liegt Alatana bei den Investitionen
deutlich über dem Branchenschnitt. Gleichzeitig
investierte das Unternehmen mit 180 Millionen
Euro 30 Prozent mehr in seine Standorte, die
Digitalisierung und Nachhaltigkeit als im
Vorjahr. Unter anderem starteten die
Detailplanungen für einen hochmodernen neuen
Innovations-, Labor- und Seminarkomplex für 25
Millionen Euro am Heimatstandort Wesel. idr
Kamp-Lintfort, vhs- Gesundheitsforum: Was tun bei
Herzkreislaufstillstand?
Wie sollte
die Erstversorgung bei lebensbedrohlichen
Situationen wie einer Bewusstlosigkeit oder
einem Herz-Kreislauf-Atemstillstand aussehen?
Ein Vortrag im Rahmen des vhs-Gesundheitsforums
am Donnerstag, 3. April, vermittelt ab 17 Uhr
die Grundlagen der Herz-Lungen-Wiederbelebung.
Im Anschluss haben die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, die
Wiederbelebung am Übungsmodell zu trainieren. Der kostenlose Vortrag findet in der Aula der
Europaschule in Kamp-Lintfort, Sudermannstraße
4, statt. Er ist eine Kooperation mit dem St.
Bernhard Hospital in Kamp-Lintfort. Eine
vorherige Anmeldung ist telefonisch unter 0 28
41/201 – 565 sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.
vhs Moers – Kamp-Lintfort: Workshop der vhs zur ODI-App
ODI ist ein innovatives
ÖPNV-Mobilitätsangebot der wir4-Städtepartner
Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn und
Rheinberg. Als Ergänzung zum ÖPNV bietet es
Personen in Moers und Umgebung eine Alternative,
wenn man außerhalb des Fahrplans unterwegs oder
der Zielort mit öffentlichen Verkehrsmitteln
nicht erreichbar ist.
Wie die
ODI-App genau funktioniert, darüber klärt der
Workshop ‚Mit der ODI-App (nachts) unterwegs‘
der vhs Moers – Kamp-Lintfort am Dienstag, 1.
April, ab 15 Uhr auf. ODI fährt nur nach
vorheriger Anforderung und nur, wenn es keine
vergleichbare ÖPNV-Möglichkeit gibt. Somit ist
es eine gute Alternative zum Taxi.
Der
Workshop ist kostenlos und findet in der vhs
Moers, Wilhelm-Schroeder-Straße 10, statt. Bitte
das Smartphone mitbringen. Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich und telefonisch unter
0 28 41/201 – 565 und online unter www.vhs-moers.de möglich.
Krankenhaus Bethanien Moers
nutzt Patientenportal ab dem 01. April 2025
Weiterer Schritt in Richtung
„Krankenhaus der Zukunft“ mit digitaler
Patientenkommunikation
„Digital, aber nicht
weniger persönlich“ heißt es ab dem 01. April
2025 in der Klinik für Allgemein- &
Viszeralchirurgie des Krankenhauses Bethanien
Moers, wenn es um die Kommunikation mit
Patient:innen geht. Die Klinik macht den Anfang
in einem großangelegten Digitalisierungsprozess
des Krankenhauses, der unter anderem den Einsatz
eines digitalen Patientenportals vorsieht. Das
von der Firma POLAVIS bereitgestellte Portal
bietet den Patient:innen auf der einen Seite und
den Verantwortlichen auf Seiten der Klinik
erhebliche Vorteile.
„Konkret
bedeutet der offizielle Start des
Patientenportals in unserer Klinik für
Allgemein- & Viszeralchirurgie ab dem 01. April,
dass zum einen Termine online gemacht werden
können. Außerdem kann ein Dokumentenaustausch,
beispielsweise von Laborbefunden oder
Arztbriefen, schon vor der Vorstellung bzw.
Aufnahme im Krankenhaus erfolgen“, erklärt
Michael Ziller, Digitalisierungsbeauftragter der
Stiftung Bethanien Moers.
Darüber hinaus könne die
direkte Kommunikation, etwa dann, wenn sich
Termine verschieben würden oder abgesagt werden
müssten von einer der beiden Seiten, direkt über
Smart Devices erfolgen. Hierzu zählen zum
Beispiel Smartphones, Laptops, Tablets oder PCs.
Zum Patientenportal gelangen die
Patient:innen über einen Button mit der
Beschriftung „Termin buchen“, direkt auf der
Website der Klinik für Allgemein- &
Viszeralchirurgie unter
https://www.bethanien-moers.de/krankenhaus/leistungen-bereiche/kliniken-sektionen-institute/allgemein-viszeralchirurgie/ueberblick
oder über den folgenden QR-Code:

Ein Bild, das Muster, Quadrat, Pixel, nähen
enthält. KI-generierte Inhalte können fehlerhaft
sein.
„Da die zunehmende Digitalisierung
der Krankenhäuser viele neue Perspektiven
zulässt, wären für uns zukünftig auch Anamnesen
quasi ,vom Sofa aus‘ denkbar oder ein
Online-Check-in für den Aufenthalt im
Krankenhaus“, wirft Michael Ziller einen Blick
in die Zukunft.
Wichtig sei es dem
Krankenhaus Bethanien jedoch zu betonen, dass
die Online-Kommunikation optional erfolge. Eine
Terminvereinbarung, Absprache oder Ähnliches per
Telefon sei nach wie vor für die Patient:innen
möglich.
Dr. Ralf Engels, Vorstand der
Stiftung und Krankenhausdirektor, unterstreicht:
„Ich freue mich sehr, dass wir einen weiteren
wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einem immer
digitaleren Krankenhaus erfolgreich anschieben
konnten – und nun in die Praxis umsetzen können.
Das erleichtert nicht nur unsere Abläufe,
sondern vor allem auch den Alltag unserer
Patientinnen und Patienten.“
Kleve: Pianist Fabian Müller spielt
mit Beethoven
Der fantastische
Pianist Fabian Müller kommt nach der
krankheitsbedingten Absage in der vergangenen
Spielzeit endlich wieder nach Kleve! Am
Dienstag, 1. April, 20 Uhr in der Klever
Stadthalle läutet er mit Beethovens
Klaviersonate „Pastorale“ musikalisch den
Frühling ein. Mit drei weiteren
Beethoven-Sonaten bringt Müller einen Ausschnitt
seines kompletten Beethoven-Zyklus‘ im Berliner
Pierre-Boulez-Saal mit in die Klever
Konzertreihe.

Fabian Müller. (c) Bild: Christian Palm
Längst gilt Fabian Müller als einer der
bemerkenswertesten Pianisten seiner Generation.
Der fünffache Preisträger des
ARD-Musikwettbewerbs hat eine beachtliche
Karriere zurückgelegt, konzertiert auf den
Podien der Welt, dirigiert, komponiert – und
findet zwischen zahlreichen Auftritten und
Projekten noch eben Zeit für ein Gastpiel am
Niederrhein. Auf eigenen Wunsch kommt Müller mit
„Beethoven pur“, einem Programm aus vier ganz
unterschiedlichen Klaviersonaten, das er wenig
später auf Einladung von Daniel Barenboim in
Berlin spielen wird.
Aufgewachsen in der
Beethoven-Stadt Bonn hat sich Müller schon immer
intensiv mit der Musik Beethovens umfangreich
auseinander gesetzt. Die 32 Klaviersonaten
Beethovens schaffen es seiner Meinung nach wie
keine andere Musik, den Menschen in alle seinen
Gefühlen, Ansichten und Wesenarten einzufangen.
Der Pianist ist sicher, „dass das Klavier als
Instrument nicht diese Bedeutung hätte, wenn
diese 32 Sonaten nicht komponiert worden wären.“
Sein Beethoven-Konzert sei eine
„Entdeckungsreise der pianistischen
Möglichkeiten. Jede Sonate ist unterschiedlich,
jeder Moment neu und aufregend, wie eine Familie
mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, das
finde ich unglaublich“ schwärmt Müller von
diesen Meisterwerken der Tastenkunst.
Die
„Pastorale“-Sonate Nr. 15 op. 28, von Beethoven
beim Spazierengehen komponiert, bringt die ganze
Liebe für die Natur zum Ausdruck. Nach ihr
folgen die Sonaten Nr. 3 op. 2/3, Nr. 24 op. 78
und Nr. 30 op. 109. Mit der Kombination von
früher und später Sonate will er im Konzert
einen dramaturgischen Bogen spannen.
Um
etwas Persönliches und Kreatives beizutragen,
stellt der auch komponierene Pianist jeder
Sonate eine eigenen Bagatelle voran: „Das ist
für mich ein Abenteuerspielplatz, bei dem ich
viel ausprobieren kann. Das Frische, Unbekannte
überträgt sich auf die Sonate. Die hört man dann
wie zum ersten Mal!“ Um 19 Uhr gibt Verena
Krauledat die Konzerteinführung "Das dritte Ohr"
im Gespräch mit Fabian Müller.
Konzertkarten (18€/16€/Schüler, Studenten 5 €)
gibt es im VVK unter www.kleve.reservix.de, an
allen Reservix-VVK-Stellen (Buchhandlung
Hintzen, Niederrhein Nachrichten) und an der
Klever Rathaus-Info. Einlass: kurz vor 19 Uhr.
Dinslaken: Nacht der Bibliotheken: Am
4.4. lädt die Stadtbibliothek zum Entdecken ein
Zum ersten Mal findet am 4.
April bundesweit die „Nacht der Bibliotheken“
statt. Unter dem Motto „Wissen. Teilen.
Entdecken.“ öffnen Bibliotheken in ganz
Deutschland ihre Türen und laden Besucher*innen
ein, die vielfältigen Facetten der
Bibliothekswelt zu entdecken.
Auch die
Stadtbibliothek Dinslaken beteiligt sich mit
einem bunten Programm für alle Altersgruppen:
von 17 bis 22 Uhr bietet sie ein kreatives und
unterhaltsames Angebot.
In der
Kinderbibliothek wird den kleinen Gästen
vorgelesen, gemeinsam musiziert und es besteht
die Möglichkeit, eine eigene Murmelbahn zu bauen
oder kleine Roboter zu entdecken. Im ersten
Obergeschoss lädt die Gaming-Ecke zu einem
Mario-Kart-Turnier ein. Kreative Highlights
setzt die Künstlerin Natalia Aghahowa, die
Interessierte einlädt, kleine Kunstwerke aus
Gips zu gestalten.
Für musikalische
Unterhaltung sorgt die Band FUD’iES, die mit
bekannten Rockhits für Stimmung sorgt. Parallel
dazu präsentieren Oliver und Anna Scholz,
bekannt als „Brettspiel Teddy“, eine bunte
Auswahl an Gesellschaftsspielen und laden dazu
ein, in die vielfältige Welt der Brettspiele
einzutauchen.
Der Eintritt zu allen
Angeboten ist kostenlos, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Die Veranstaltung beginnt um
17 Uhr und endet um 22 Uhr. Die Kinderbibliothek
schließt bereits um 20 Uhr.
Das
vollständige Programm der Stadtbibliothek
Dinslaken zur „Nacht der Bibliotheken“ finden
Sie auf der Internetseite der Stadtbibliothek.
Der Abend wird vom Freundeskreis Stadtbibliothek
und Stadtarchiv Dinslaken e.V. finanziell
unterstützt.
Stadtbücherei
Wesel lädt zur "Nacht der Bibliotheken" ein
Am Freitag, den 4. April 2025, lädt die
Stadtbücherei Wesel zur „Nacht der Bibliotheken“
ein. Mit einem vielfältigen Programm können Jung
und Alt die Bücherei neu entdecken.

dbv, Mark Bollhorst
Den Auftakt macht
um 17:30 Uhr die Präsentation des Hörspiels „Das
Geheimnis der alten Villa“. Die Krachmacher-AG
und die Bücherbande-AG des
Konrad-Duden-Gymnasiums Wesel haben die
Geschichte selbst produziert. Zuhörende ab acht
Jahren können in das spannende Abenteuer
eintauchen.
Um 18 Uhr startet das
Chaos-Spiel. Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren
können in Gruppen durch die Bücherei laufen, um
nummerierte Karten mit Scherz- und Wissensfragen
rund um die Bücherei zu finden und zu
beantworten. Wer eine Frage falsch beantwortet,
muss ein Feld zurückgehen, während die
schnellste Gruppe gewinnt. Ein Spaß für alle,
die sich bewegen und rätseln möchten. Um
Anmeldung für das Chaos-Spiel an
stadtbuecherei@wesel.de wird gebeten.
Um 20 Uhr kommt das Kneipenquiz in die
Bücherei. 36 knifflige Fragen rund um Bücher,
Autor*innen und Co. warten auf gesellige
Literaturliebende. Das Quiz wird in
Zusammenarbeit mit Hilmar Schulz (Fragemann &
Söhne – die Kneipenquizzer) organisiert. Für das
Literatur-Quiz ist eine Anmeldung erforderlich,
bei der Name und Größe des Teams an
stadtbuecherei@wesel.de mitgeteilt werden.
Alle Veranstaltungen sind kostenfrei zu
besuchen.
Unter dem Motto „Wissen.
Teilen. Entdecken.“ werden Bibliotheken in ganz
Deutschland am 4. April 2025 erstmals bundesweit
um die Wette strahlen.

Erzeugerpreise für Dienstleistungen im Jahr
2024 um 2,4 % gestiegen
Die
Erzeugerpreise für Dienstleistungen in
Deutschland sind im Jahresdurchschnitt 2024 um
2,4 % gegenüber dem Jahr 2023 gestiegen. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise für
Dienstleistungen im 4. Quartal 2024 gegenüber
dem 4. Quartal 2023 um 3,3 %. Gegenüber dem 3.
Quartal 2024 gab es eine leichte Erhöhung um 0,1
%.
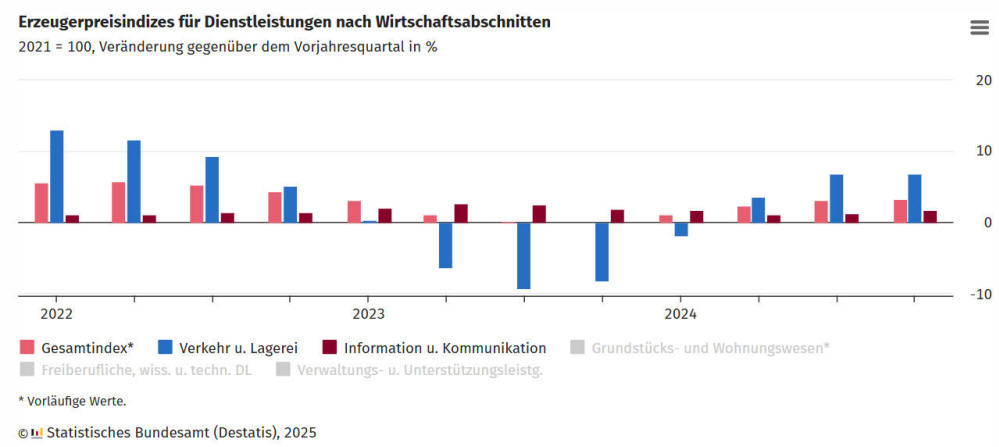
Wirtschaftsabschnitt freiberufliche,
wissenschaftliche und technische
Dienstleistungen: +2,7 % zum Vorjahr
Im
Wirtschaftsabschnitt freiberufliche,
wissenschaftliche und technische
Dienstleistungen gab es mit +2,7 % gegenüber
2023 einen moderaten Preisanstieg. Damit war der
Anstieg weniger stark als in den Vorjahren (2023
zu 2022: +4,1 %; 2022 zu 2021: +3,6 %). Den
stärksten Anstieg gab es im Wirtschaftszweig der
technischen, physikalischen und chemischen
Untersuchungen mit +5,8 % (2023 zu 2022: +5,0
%).
Neben Preiserhöhungen für technische
Überwachungsleistungen an Straßenfahrzeugen
bereits zu Beginn des Jahres 2024 waren auch
hier gestiegene Kosten für Personal und Material
hauptverantwortlich. Ebenfalls
überdurchschnittlich stiegen die Preise für
Ingenieurbüro- und technische
Beratungsleistungen mit +3,5 % (2023 zu 2022:
+4,4 %) sowie für Rechtsberatungsleistungen mit
+3,1 % (2023 zu 2022: +3,5 %).
Sowohl in
Ingenieurbüros als auch in Kanzleien wurden
wegen allgemein gestiegener Kosten und
insbesondere durch höhere Löhne und Gehälter
Preisanpassungen vollzogen, die jedoch weniger
stark ausfielen als im Vorjahr.
Wirtschaftsabschnitt Verwaltungs- und
Unterstützungsleistungen: +2,1 % zum Vorjahr
Auch im Wirtschaftsabschnitt Verwaltungs- und
Unterstützungsleistungen gab es gegenüber 2023
einen moderaten Preisanstieg von +2,1 % (2023 zu
2022: +5,6 %). Mit +5,0 % stiegen die Preise für
die befristete Überlassung von Arbeitskräften am
stärksten (2023 zu 2022: +6,5 %).
Neben
dem allgemeinen Arbeitskräftemangel waren
tarifbedingte Lohnsteigerungen in der Branche
maßgeblich für den Preisanstieg verantwortlich.
Letzteres war auch bei den Reinigungsleistungen
die Hauptursache für den Preisanstieg um +3,6 %
gegenüber dem Vorjahr, jedoch auf niedrigerem
Niveau als im Vergleich von 2023 zu 2022 mit
+7,8 %.
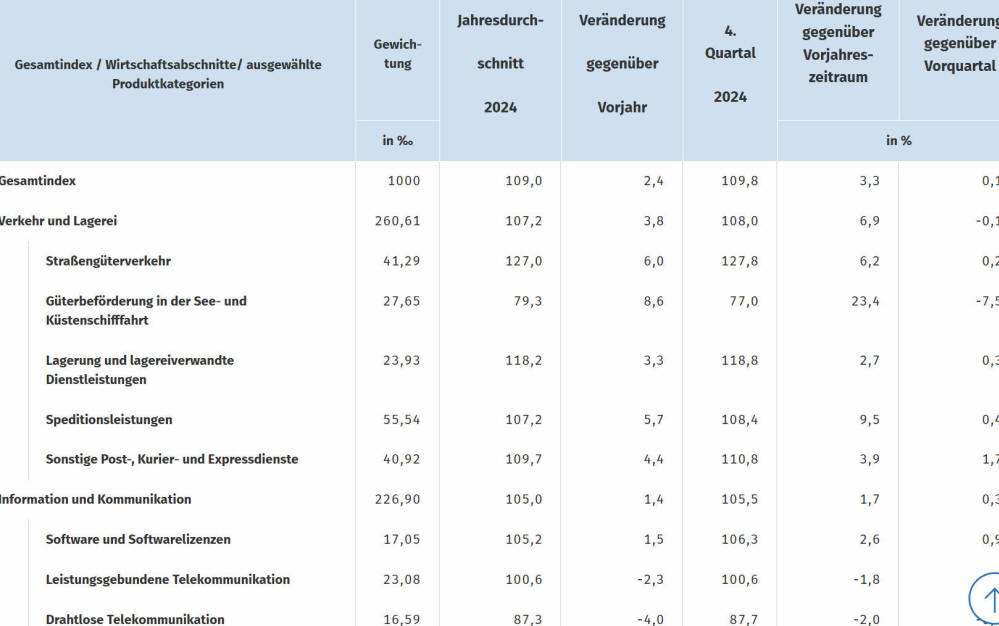
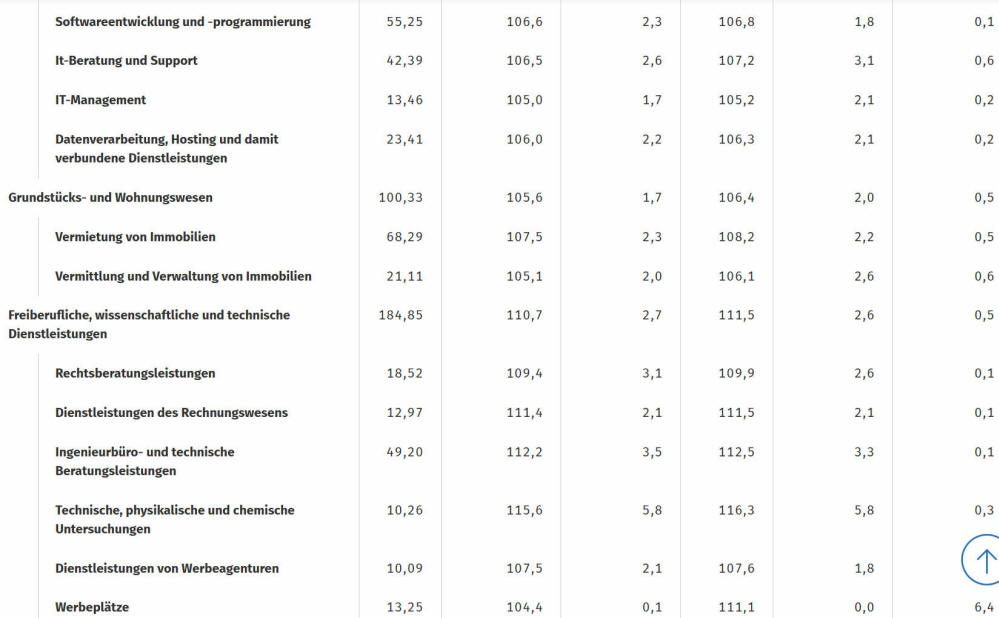
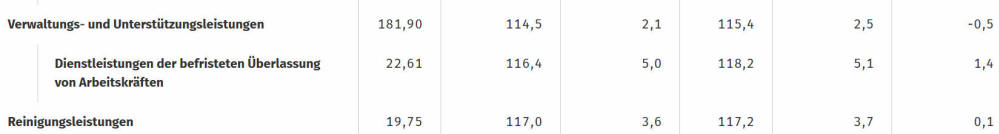
Weinerzeugung 2024: Rückgang um 9,8 %
auf 7,75 Millionen Hektoliter
•
Drittniedrigste Weinerzeugungsmenge in den
letzten 15 Jahren
• Deutlich weniger
Prädikatswein erzeugt: Anteil sinkt von 23,7 %
auf 16,1 %
• Mehr als die Hälfte des
erzeugten Weins aus Rheinhessen und der Pfalz
Im Jahr 2024 haben die Winzerinnen und
Winzer in Deutschland 7,75 Millionen Hektoliter
Wein und Most erzeugt. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag die Wein- und
Mosterzeugung damit 841 800 Hektoliter oder 9,8
% unter dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zum
Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2023 wurden 1,06
Millionen Hektoliter oder 12,0 % weniger Wein
und Most produziert. Dies war die
drittniedrigste Weinerzeugungsmenge in den
letzten 15 Jahren (2010: 6,91 Millionen
Hektoliter, 2017: 7,46 Millionen Hektoliter).
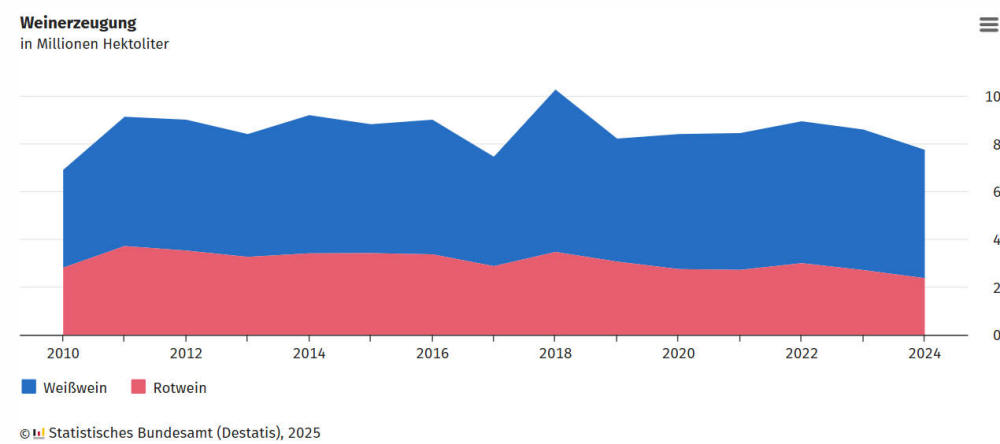
Das Weinjahr 2024 war gekennzeichnet durch
ein niederschlagsreiches Frühjahr, was regional
das Auftreten von Pilzkrankheiten wie
insbesondere dem Falschen Mehltau (Peronospora)
begünstigt hat. Zudem haben
Extremwetterereignisse wie Spätfröste, Hagel,
Stürme oder Starkregen vielerorts der Weinernte
geschadet.
Gut zwei Drittel (69,4 %) der
im Jahr 2024 erzeugten Weine waren Weißweine,
knapp ein Drittel (30,6 %) Rotweine
(einschließlich Roséwein und Rotling).
Umgerechnet in 0,75-Liter-Flaschen ergibt die
Wein- und Mosterzeugung des Jahres 2024 rund 1
Milliarde Flaschen.
Weniger
Prädikatswein als im Vorjahr erzeugt
An der
gesamten Wein- und Mosterzeugung 2024 betrug der
Anteil von Prädikatswein 16,1 % (1,25 Millionen
Hektoliter). Dieser Anteil war deutlich
niedriger als 2023, als 23,7 % des erzeugten
Weins zu Prädikatswein verarbeitet werden
konnten. 2024 wurden außerdem 6,0 Millionen
Hektoliter Qualitätswein (77,6 %), 344 600
Hektoliter Wein mit geschützter geographischer
Angabe (Landwein) (4,4 %), 11 400 Hektoliter
Rebsortenwein ohne geschützte
Ursprungsbezeichnung und ohne geschützte
geographische Angabe (0,1 %) und 132 600
Hektoliter Wein ohne geschützte
Ursprungsbezeichnung und ohne geschützte
geographische Angabe (1,7 %) produziert.
Größte Weinanbaugebiete Rheinhessen und
Pfalz erzeugten über die Hälfte der Weinmenge
In den beiden größten Weinanbaugebieten
Rheinhessen (2,44 Millionen Hektoliter) und
Pfalz (1,78 Millionen Hektoliter) wurden
zusammen über die Hälfte (54,5 %) des gesamten
deutschen Weins und Mosts erzeugt. Auf Platz
drei folgte das Weinanbaugebiet Mosel mit 1,14
Millionen Hektolitern (14,7 %), dessen Ergebnis
maßgeblich durch dort ansässige große
Handelskellereien geprägt ist. Diese nehmen auch
Trauben von anderen Weinanbaugebieten in
größeren Mengen auf, um sie zu Wein zu
verarbeiten. Auf dem vierten Platz lag das
Weinanbaugebiet Baden mit 954 600 Hektolitern
(12,3 %).
Sinkende Weinerzeugung in
allen Weinanbaugebieten mit Ausnahme von
Rheinhessen und Pfalz
In den beiden
Anbaugebieten Rheinhessen und Pfalz war die
Entwicklung der Weinerzeugung gegenüber dem
Vorjahr nahezu unverändert: Die erzeugten Mengen
lagen jeweils um 0,4 % über dem Vorjahr. Dagegen
nahm die Erzeugung in allen übrigen
Anbaugebieten gegenüber dem Vorjahr ab.
Besonders stark war der Rückgang der
Weinerzeugung gegenüber 2023 in Baden und
Württemberg, in Franken und an der Mosel. In
Baden sank die Weinerzeugung um 25,1 % auf 954
600 Hektoliter und in Württemberg um 18,5 % auf
667 600 Hektoliter. In Franken nahm die erzeugte
Weinmenge um 26,5 % auf 302 200 Hektoliter ab
und an der Mosel um 7,9 % auf 1,14 Millionen
Hektoliter ab.
Prozentual besonders
stark nahm die Weinerzeugung gegenüber 2023 in
einigen flächenmäßig kleinen Anbaugebieten ab.
So sank die Weinerzeugung in Sachsen um 68,9 %
auf 9 000 Hektoliter, in Saale-Unstrut um 63,8 %
auf 17 600 Hektoliter und an der Ahr um 54,5 %
auf 22 400 Hektoliter. Die drei genannten
Anbaugebiete weisen jeweils eine
Ertragsrebfläche von weniger als 1 000 Hektar
auf.
Montag, 24. März 2025
Mehr Energie für das Erdgas: Enni
wird in ihrem Netzgebiet 2027 auf H-Gas
umstellen
Die Erdgasversorgung in
Deutschland steht vor einer wichtigen
Umstel-lung: Bis 2030 wird das bisher im Norden
und Westen des Landes ge-nutzte L-Gas
(low-calorific) durch H-Gas (high-calorific)
ersetzt. „Da das L-Gas in Zukunft nicht mehr
unbegrenzt zur Verfügung steht, müssen auch wir
in unserem Moerser und Neukirchen-Vluyner
Netzgebiet aktiv werden und auf die neue
Gasqualität umstellen“, blickt Ingo Blank als
Projektleiter der ENNI Energie & Umwelt
Niederrhein (Enni) schon jetzt auf die in zwei
Jahren anstehende Veränderung.
„Zu
dieser Maßnahme sind wir als Netzbetreiber nach
dem Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet. Das
ist unabhängig vom tatsächlichen
Erdgaslieferanten.“ Da diese große Aktion bei
rund 20.000 Erdgaskunden im Enni-Gebiet einen
gro-ßen Vorlauf benötigt, erhalten die Kunden in
Kürze bereits erste Informa-tionen. Nach einer
folgenden Erhebung der Zustandsdaten der
Gasheizungen in einem Jahr wird die eigentliche
Umstellung der Gasqualität dann aber erst 2027
und 2028 erfolgen.

Aktuell stammt das Erdgas im Netzgebiet der
Enni aus den Niederlanden. Doch die stellt die
Förderung ihres L-Gases in naher Zukunft
kom-plett ein. Genau wie in vielen anderen
Region Deutschlands ist deswe-gen auch am
Niederrhein der schrittweise Ausstieg aus dem
L-Gas not-wendig. Dabei unterscheiden sich L-
und H-Gas in ihrer chemischen Zusammensetzung
und hieraus folgend ihrem Energiegehalt.
Gasgeräte und Gasanlagen in Haushalten,
Betrieben und der Industrie können meist einfach
auf die neue Gasqualität umgestellt werden.
Eine solch flächendeckende Aktion will
aber rechtzeitig geplant sein. So werden die
beauftragten Monteure der Enni die Gaskunden
bereits über ein Jahr vor der eigentlichen
Umstellung besuchen, um dabei zunächst nach und
nach alle Gasgeräte ihres Netzgebiets zu
erfassen und nach Kriterien wie Gerätetyp und
Hersteller zu kategorisieren. Erst in einem
zweiten, bis zu anderthalb Jahren späteren
Schritt werden sie die Gasgeräte technisch auf
H-Gas anpassen.
„Dies ist dann meist
durch den Austausch der Gasdüsen möglich, den
wir für Kunden übernehmen“, so Blank. „Wir
bereiten frühzeitig alles vor, um den sicheren
und effizienten Weiterbetrieb der Gasgeräte zu
gewährleisten.“ Aufgrund der Größe des
Netzgebietes hat Enni es für die Aktion in drei
Teilnetzgebiete aufgeteilt. In weiten Teilen von
Moers startet die Umstellung im April 2027 und
in Neukirchen-Vluyn sowie in den nördlichen
Moerser Regionen, Repelen, Genend und
Kohlenhuck, folgt sie dann im Juni. Erst im Juni
2028 sind mit Kapellen, Holderberg,
Achterathsheide und Vennikel die südlichen
Moerser Stadtteile an der Reihe.
Für
Kunden ist die Erdgasumstellung kostenfrei.
Falls eine Wartung, eine Reparatur oder ein
Geräteaustausch ansteht, müssen die
Geräteei-gentümer die Kosten naturgemäß selber
tragen. Ende März wird Enni jeden Haushalt und
Betrieb bereits über die anstehenden Termine und
den Ablauf der Erdgasumstellung informieren.
Wer sich schon jetzt informieren möchte,
kann dies im Internet unter:
www.enni-erdgasumstellung.de tun. Ab April geben
Berater auch unter 02841 104650 telefonisch
Auskunft.
Stellvertretende
NATO-Generalsekretärin begrüßt erneuerte
europäische Verteidigungsanstrengungen im
Europäischen Parlament
Die
stellvertretende NATO-Generalsekretärin Radmila
Shekerinska sprach vor dem Sicherheits- und
Verteidigungsausschuss des Europäischen
Parlaments.

Sie lobte die Europäer für ihre verstärkten
Investitionen in die Verteidigung, um für mehr
Sicherheit zu sorgen, würdigte die
Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und
beantwortete Fragen von Abgeordneten des
Europäischen Parlaments.
Die Stellvertretende Generalsekretärin
betonte die Bedeutung einer weiteren Stärkung
der NATO-EU-Zusammenarbeit. Sie unterstrich,
dass die NATO und die EU natürliche und
unverzichtbare Partner seien und dass die EU
ihren einzigartigen wirtschaftlichen Einfluss
nutzen könne, um die Rüstungsproduktion,
Innovation und militärische Mobilität im
Einklang mit den militärischen Plänen,
Fähigkeiten und Standards der NATO zu fördern.
In diesem Zusammenhang wies sie auch
darauf hin, dass Nicht-EU-Verbündete so weit wie
möglich in die Verteidigungsinitiativen der EU
einbezogen werden müssten. Shekerinska begrüßte
den ReArm Europe-Plan sowie die europäische
Unterstützung für die Ukraine.
In einem
Sicherheitskontext, in dem Europa mit
Instabilität und Bedrohungen aus vielen
Richtungen konfrontiert ist, betonte der
stellvertretende Generalsekretär, dass „die
Sicherheit unserer Bevölkerung unsere heiligste
Pflicht ist“.
Sondervermögen
richtig einsetzen: Investitionen in Straßen nur
mit Mehrwert für die Sicherheit
„Wir
freuen uns, dass der Weg für das Sondervermögen
für Infrastrukturinvestitionen nun frei ist. Die
Arbeit fängt jetzt erst an“, kommentiert der
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Verkehrssicherheitsrates (DVR) Stefan Grieger
die Zustimmung des Bundesrates zur Änderung des
Grundgesetzes.
Bei dem nun zu
diskutierenden Ausführungsgesetz zum
Sondervermögen sei nicht nur zu klären, was
finanziert wird, sondern auch, wie die Mittel
effizient genutzt werden. „Die Wunschlisten sind
lang. Bei dem enormen Investitionsrückstand und
der Laufzeit von zwölf Jahren kann sich das hohe
Volumen schnell relativieren. Es kommt daher
darauf an, mit jedem eingesetzten Euro möglichst
viel Hebelwirkung zu erreichen“, erläutert
Grieger.
Mittel für Straßenbau nur mit
Mehrwert für die Sicherheit
Der DVR weist
darauf hin, dass Bund, Länder und Kommunen sich
das Ziel gesetzt haben, die Zahl der im
Straßenverkehr Getöteten im Zeitraum von 2021
bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren. „Jede
staatliche Investition in Straßen muss darauf
abgeklopft werden, ob wir damit diesem Ziel
näherkommen“, sagt Grieger.
„Die
Fortschritte bei der Sicherheit reichen nicht
aus. Die Zahl der Getöteten verharrt auf einem
Plateau.“ Die amtliche Unfallstatistik
verzeichnete 2.562 Getötete für das Jahr 2021.
Im Jahr 2024 sind nach vorläufigen Angaben des
Statistischen Bundesamtes 2.780 Menschen im
Straßenverkehr ums Leben gekommen.
„Eine
sicher ausgestaltete Verkehrsinfrastruktur spart
der Volkswirtschaft Geld. Durch die Senkung der
volkswirtschaftlichen Folgekosten von
Verkehrsunfällen von jährlich rund 37 Milliarden
Euro, kann ein zusätzlicher wirtschaftlicher
Impuls aus ohnehin eingesetzten Mitteln
generiert werden“, erklärt Grieger.
Bedeutung der Umsetzungsfragen
Von der
Landstraße bis zur Innenstadt – für jede
Straßensituation lägen Konzepte und Regelwerke
für mehr Sicherheit vor. Es komme nun darauf an,
diese bei Investitionsmaßnahmen umzusetzen. Der
DVR sieht dabei zwei Handlungsebenen: effiziente
Prozesse und qualifiziertes Personal.
„Es
wird beim Infrastrukturvermögen darauf ankommen,
ob es uns gelingt, den Mangel an Fachkräften
insbesondere in den Verwaltungen zu beheben.
Auch für die Verkehrssicherheit liegt der
Schlüssel in entsprechenden Fortbildungen der
Planerinnen und Planer. Der DVR wird hier auch
weiterhin unterstützen“, sagt Grieger.
Auf der Verfahrensebene sei das Sicherheitsaudit
in der Planung von Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen
sowie das Bestandsaudit für das vorhandene
Straßennetz das Mittel Nummer eins zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit der Infrastruktur.
Der DVR sieht den Bund dabei nicht nur bei
den Bundesstraßen in der Verantwortung. „Auch
Gelder, die für den Straßenbau an Länder und
Kommunen fließen, sollten an den Nachweis
gekoppelt werden, dass sie nach dem aktuellen
Stand der Verkehrssicherheit eingesetzt werden“,
fordert Grieger.
Kompromisse beim
Verkehrsrecht nicht erneut aufschnüren
Wie
verkehrssicher es auf unseren Straßen zukünftig
zugeht, berät der Bundesrat auch unter einem
weiteren Tagesordnungspunkt: Aus den Ländern
wurden über 40 Anträge zur Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zur
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) eingebracht.
„Jetzt darf der Kompromiss zur Novelle des
Straßenverkehrsrechts aus dem letzten Jahr nicht
wieder aufgeweicht werden. Es ist wichtig, dass
die Verwaltungsvorschrift schnell kommt, damit
die Kommunen endlich in die Umsetzung gehen
können. Die Länder sollten sich nicht im
Klein-Klein verlieren“, mahnt Grieger.
Dass die Beschaffenheit des Straßenraums nicht
allein die Sicherheit des Verkehrs bestimme,
zeige der Disput zwischen Bund und Ländern um
das Parken auf Gehwegen. „Wir werden hier
gemeinsam mit unseren Mitgliedern auch bei der
praktischen Umsetzung noch eng dranbleiben“,
kündigte Grieger an. „Ob beim Ausbau von Straßen
oder der Kontrolle der Regeln: Alle
Verkehrsteilnahmearten sind gleichrangig –
dieser Grundsatz muss endlich in der Praxis
ankommen.“
Moers: Schulweg in
Schwafheim soll sicherer werden
Mehr Sicherheit für Schülerinnen und Schüler der
Waldschule in Schwafheim: Der Ausschuss für
Stadtentwicklung, Planen und Umwelt hat die
Schulwegplanung der Stadt am Donnerstag, 20.
März, einstimmig beschlossen. Unter anderem soll
es Zebrastreifen, Elternhaltestellen,
Halteverbote und kleine Straßenumbaumaßnahmen
geben. Schule, die befragten Eltern und die
Polizei hatten die Planung bereits positiv
bewertet.
Ebenfalls einstimmig war
der Beschluss über die Anlage eines Parkplatzes
auf der Fläche des abgerissenen Parkhauses
Kautzstraße. Enni baut hier 61 Stellplätze, die
jeweils 2,65 Meter breit sind. Die Kosten
liegen bei etwa 215.000 Euro. Die jährlichen
Einnahmen sind mit 152.500 Euro kalkuliert.
Mittelfristig soll auf der Kautzstraße wieder
ein Parkhaus gebaut werden.
Auf
einem Teil der Fläche des Freibads Solimare
errichtet Enni bis Mitte 2026 ein
kostenpflichtiges Grillareal. Bis dahin ist das
(kostenlose) Grillen nur im ausgeschilderten
Bereich Bettenkamper Meer im Freizeitpark
möglich. Eine entsprechende Satzungsänderung
haben die Ausschussmitglieder befürwortet. Dies
gilt auch für die Sanierung der Neukirchener
Straße (zwischen Drinhaus- und
Dorsterfeldstraße) und Ehrenmalstraße.
Moerser Baumpflanz-Offensive: Knapp 200
neue Bäume im ersten Quartal 2025
Allein in Vennikel, Utfort und Scherpenberg
hat Enni im Auftrag der Stadt 64 neue
Straßenbäume pflanzen lassen. Insgesamt sind es
im ersten Quartal 112. Hinzu kommen 85 Bäume in
Grünanlagen. In Kapellen, Hochstraß (Foto: pst),
Meerbeck und Schwafheim stehen die meisten. Der
Fachdienst Freiraum- und Umweltplanung setzt bei
den Baumarten auf Artenvielfalt und
Klimaverträglichkeit.

Der Rat der Stadt Moers hatte im Jahr 2022
entschieden, pro Jahr 250 neue Straßenbäume und
200 neue Bäume in Grünanlagen zu pflanzen. Die
Gesamtkosten liegen bei knapp 670.000 Euro pro
Jahr.
Sommerferienprogramm 2025
der Stadt Kleve
Auch in diesem Jahr
besuchten Bürgermeister Wolfgang Gebing und
Stadtkämmerer Klaus Keysers mit reichlich
Stieleis im Gepäck die Ferienfreizeit auf dem
Robi.
Hüttenbauen, Kochen, Feuermachen: Im
vergangenen Sommer besuchten Bürgermeister
Wolfgang Gebing und Kämmerer Klaus Keysers die
Inklusivmaßnahme Robi-Plus.

Auch in den diesjährigen Sommerferien bietet die
Stadt Kleve wieder ein buntes Ferienprogramm an.
Für die abwechslungsreichen Aktivitäten sind im
Vorfeld jeweils Anmeldungen erforderlich, die
über Online-Buchungsportale oder per E-Mail
abgewickelt werden. Alle Einzelheiten zu den
Inhalten sowie die Details und Links zur
Anmeldung gibt es unter:
www.kleve.de/sommerferien.
Bei der
alljährlichen Ferienfreizeit auf dem
Fingerhutshof in Kalkar-Wissel erwartet die
Kinder ein kreatives und spannendes Angebot auf
einem vielseitigen Gelände. Neben einer großen
Spielwiese steht den Kindern ein Spielplatz mit
vielen Geräten inklusive einer Wasserspielanlage
zur Verfügung.
Das Betreuungsteam freut
sich darauf, den Kindern ein abwechslungsreiches
Programm mit spannenden Workshops und Angeboten
bieten zu können. Die Tagesfreizeiten richten
sich an Klever Kinder im Alter von 6-12 Jahren
und finden in den letzten drei Wochen der
Sommerferien statt. Die Anmeldung zur Freizeit
ist ab dem 31. März 2025 möglich und erfolgt
ausschließlich online.
Auch der
städtische Abenteuerspielplatz Robinson bietet
abenteuerlustigen Kindern im Alter von 7-14
Jahren die Möglichkeit, in den ersten vier
Wochen der Sommerferien zu Matschen, zu Toben
und zu Klettern. Die Anmeldung für die einzelnen
Wochen ist ebenfalls ausschließlich online
möglich und wird ab dem 19. Mai 2025
freigeschaltet.
Im Anschluss daran
startet die „Robi-Plus-Maßnahme“. Die Maßnahme
richtet sich an Kinder mit besonderem
Unterstützungsbedarf und wird in den letzten
beiden Ferienwochen durchgeführt. Im Rahmen der
Maßnahme werden die 6 bis 14-jährigen Kinder
besonders intensiv pädagogisch begleitet. Die
„Robi-Plus-Kinder“ erwartet eine spannende
Abenteuerfreizeit. Gemeinsames Kochen, Basteln,
Werkeln, Hüttenbau und Lagerfeuer stehen auf dem
Programm.
Zudem bieten verschiedene
Einrichtungen und Vereine während der
Sommerferien vielseitige Ferien- und Sportkurse
an. Auch hierzu sind auf der städtischen
Internetseite alle Informationen hinterlegt.
Mode+Sport-Center Braun aus
Moers spendet zum 23. Mal an die Kinderklinik
Bethanien
Spende in Höhe von
2.000 Euro für die Klinikclowns Seit mehr als
zwei Jahrzehnten spendet das Mode+Sport-Center
Braun aus Moers die Erlöse aus seinem
Einpackservice zur Weihnachtszeit an die
Klinikclowns der Klinik für Kinder- &
Jugendmedizin des Krankenhauses Bethanien Moers.
Zuletzt erzielte dieser Einpackservice, zu dem
die Kund:innen des Modehauses eine beliebige
Summe beisteuern konnten, 2.000 Euro.
Bei der Übergabe des Schecks durch Tanja
Fischer und Xuan Becker aus dem Marketingteam
des Mode+Sport-Centers Braun an Dr. Michael
Wallot, Chefarzt der Klinik für Kinder- &
Jugendmedizin, erklären diese: „Kinder liegen
uns am Herzen. Sie in guten Händen und gut
betreut zu wissen, vor allem dann, wenn sie im
Krankenhaus liegen, ist beruhigend. Dass wir mit
unserer Spende nicht nur etwas Gutes tun,
sondern genau dazu beitragen können, freut uns
in besonderem Maße.“
Auch Dr.
Michael Wallot ist dankbar für das großzügige
Engagement. Es sei eine schöne Tradition, die in
dieser Form seit Jahren bestehe. Die
Klinikclowns seien ein unschätzbares Pfund für
die Kinder.
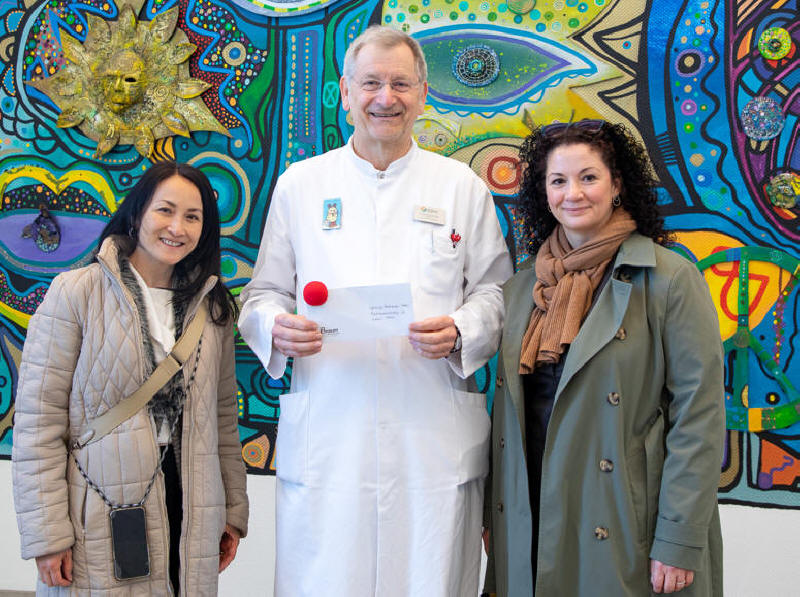
Xuan Becker (links) und Tanja Fischer (rechts)
vom Mode+Sport-Center Braun übergaben eine
Spende in Höhe von 2.000 Euro an den Chefarzt
der Klinik für Kinder- & Jugendmedizin Dr.
Michael Wallot.
Bethanien: Spende in Höhe von
400 Euro für die Kinderklinik
Reparatur-Café Eick spendet zum zweiten Mal für
die Klinikclowns
Vor Kurzem
übergaben Werner Windbergs und Norbert Bothe vom
Reparatur-Café Eick aus Moers eine Spende in
Höhe von 400 Euro an den Chefarzt der Klinik für
Kinder- & Jugendmedizin des Krankenhauses
Bethanien Moers Dr. Michael Wallot, der diese
dankend entgegennahm.
Das
Reparatur-Café Eick lädt Menschen ein, ihre
defekten Gegenstände mitzubringen und mit Hilfe
von ehrenamtlichen Expert:innen kostenlos zu
reparieren. Als Dank für die erhaltene Hilfe
kann ein individueller Betrag in einen
„Sparfrosch“ geworfen werden. Durch die
Einnahmen werden laufende Kosten und Materialien
für die Reparaturen finanziert. Das übrige Geld
kommt verschiedenen Einrichtungen im Kreis Moers
zugute – unter anderem den Klinikclowns der
Klinik für Kinder- & Jugendmedizin des
Krankenhauses Bethanien Moers.
„Es
ist uns ein Anliegen, etwas Gutes zu tun“, so
Norbert Bothe. „Wir freuen uns immer, dass uns
so viele Menschen besuchen, sich helfen lassen
und dann auch etwas spenden“, ergänzt Werner
Windbergs. Jeden dritten Mittwoch im Monat von
16 bis 18.30 Uhr findet das Reparatur-Café im
Pfarrheim St. Ida statt. In gemütlicher
Atmosphäre wird gemeinsam gewerkelt und bei
Kaffee und Kuchen Wissen ausgetauscht.
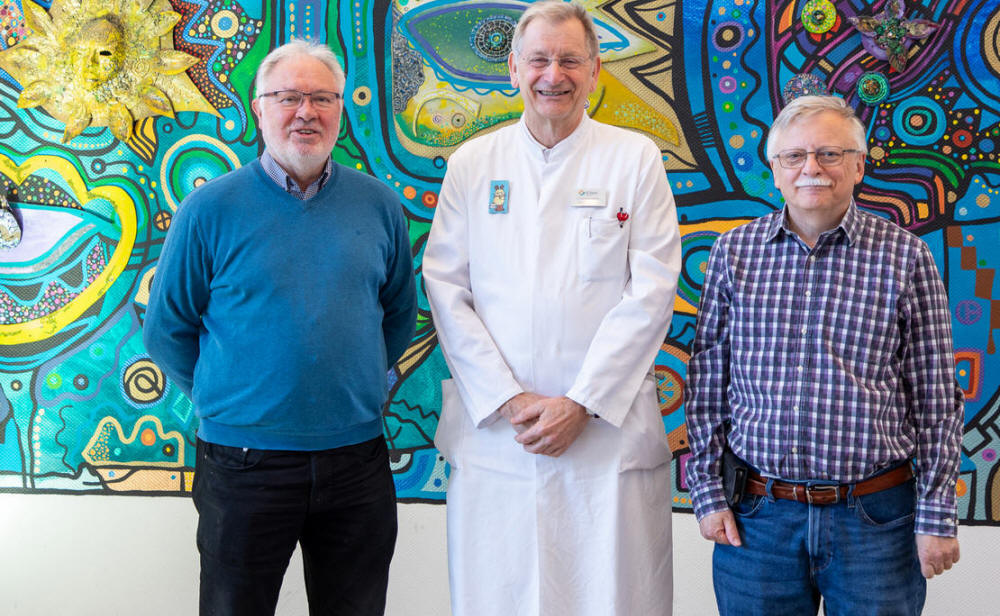
Norbert Bothe (rechts) und Werner Windbergs
(links) vom Reparatur-Café Eick übergaben
Chefarzt Dr. Michael Wallot eine Spende in Höhe
von 400 Euro für die Klinikclowns.
Kleve: Clone of Narzissen und
Tulpen in großen Schalen
Sa.,
29.03.2025 - 10:00 - Sa., 29.03.2025 - 15:00 Uhr
Der Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen
bietet an den genannten Tagen, wie in den
voraufgegangenen Jahren, wieder große Schalen
mit Narzissen, Tulpen und anderen
Frühlingsblumen zum Erwerb an, die mehrere
Wochen blühen. Blumen-Liebhaber und Freunde des
Frühlings sollten sich dies nicht entgehen
lassen

Die Veranstaltung findet im Starthof 1 (Zufahrt
über Papenfeldweg, Silvias-Handarbeitsstube) in
47533 Kleve-Donsbrüggen statt.
EU-Fluggastrechte: Das ECC-Net warnt vor
massiven Verschlechterungen für Reisende
Seit über 20 Jahren schützt die
EU-Fluggastrechte-Verordnung Passagiere bei
Annullierungen, Verspätungen und
Nichtbeförderung. Immer wieder gab es
Bestrebungen, die Verordnung zu reformieren –
doch bisher scheiterten diese Versuche. Nun ist
erneut eine umfassende Überarbeitung geplant,
die jedoch erhebliche Nachteile für Reisende mit
sich bringen könnte.

© Prostock-studio / Adobe Stock
Das
Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren
(ECC-Net) kritisiert insbesondere die
vorgeschlagenen neuen Entschädigungsregelungen
bei Verspätungen. „Die geplante Anhebung der
Schwellenwerte würde dazu führen, dass bis zu 85
% der betroffenen Passagiere keinen Anspruch auf
Entschädigung mehr hätten", warnt Karolina
Wojtal, Co-Leiterin des Europäischen
Verbraucherzentrums (EVZ) Deutschland. Dabei
gehören nicht gezahlte Ausgleichszahlungen der
Airlines zu den am häufigsten bearbeiteten
Verbraucherbeschwerden im ECC-Net.
Kritik
an neuen Entschädigungsregelungen
Bisher
haben Fluggäste bei Verspätungen ab drei
Stunden, für die die Fluggesellschaft
verantwortlich ist, Anspruch auf eine pauschale
Entschädigung:
250 Euro für Flüge bis 1.500
km,
400 Euro für Flüge bis 3.500 km,
600
Euro für Langstreckenflüge über 3.500 km.
Mehr zu den EU-Fluggastrechten.
Der
aktuelle Reformvorschlag der EU-Kommission sieht
hingegen folgende Änderungen vor:
250 Euro
erst ab 5 Stunden Verspätung (bis 3.500 km),
400 Euro erst ab 9 Stunden Verspätung (über
3.500 km innerhalb der EU),
400 Euro erst ab
9 Stunden Verspätung (über 6.000 km bei Flügen
außerhalb der EU),
600 Euro erst ab 12
Stunden Verspätung (über 6.000 km).
„Diese Anpassung ist ein gravierender
Rückschritt. Denn die meisten Verspätungen im
Luftverkehr liegen zwischen zwei und vier
Stunden. Verbraucher würden einen Großteil ihrer
Ansprüche verlieren. Und Airlines könnten dazu
verleitet werden, Flüge gezielt zu verspäten,
anstatt sie zu annullieren, um Entschädigungen
zu umgehen", so Karolina Wojtal.
EuGH-Urteile finden nicht ausreichend
Berücksichtigung
„Hinzu kommt, dass der
Regelungsentwurf die in den vergangenen 20
Jahren ergangene Rechtsprechung des EuGH zu den
Fluggastrechten und die darin entwickelten
Rechte der Verbraucher nicht ausreichend
berücksichtigt. Die EuGH-Rechtsprechung hat in
den letzten Jahren maßgeblich zur Stärkung der
Fluggastrechte beigetragen“, fügt Wojtal hinzu.
Insbesondere spricht sich das ECC-Net dafür
aus, sowohl eine Positiv- als auch eine
Negativliste der außergewöhnlichen Umstände
(also was als außergewöhnlicher Umstand
anzusehen ist und was nicht) aufzunehmen, die
die bisherige Entscheidungspraxis des
Europäischen Gerichtshofes berücksichtigt. Diese
dürfen jedoch nicht abschließend sein, um
zukünftigen Entwicklungen und Urteilen Rechnung
tragen zu können.
ECC-Net legt klare
Forderungen für starke Fluggastrechte vor
Das
ECC-Net fordert die EU-Kommission und die
Mitgliedstaaten auf, eine Reform im Sinne der
Verbraucher umzusetzen. Konkret fordert das
Netzwerk:
- Beibehaltung der bisherigen
Entschädigungsregelungen für Verspätungen, um
finanzielle Anreize für pünktliche
Flugdurchführungen zu erhalten.
-
Stärkere Regulierung von
Online-Ticketplattformen, um Verbraucher vor
Intransparenz und verzögerten Erstattungen zu
schützen. Insbesondere das Hin und Her zwischen
Vermittlern und Fluggesellschaften bei
Entschädigungen müsse beendet werden. Fluggäste
sollten die Möglichkeit haben, ihre Ansprüche
direkt bei der Airline geltend zu machen.
- Verbot von „No-Show“-Klauseln, die dazu
führen, dass ein Rück- oder Weiterflug verfällt,
wenn der Hinflug nicht angetreten wurde.
-
Verpflichtung zur schnellstmöglichen Umbuchung
auf alternative Verbindungen, auch mit anderen
Airlines.
- Bessere Insolvenzabsicherung für
Airlines, damit Fluggäste im Falle von
Zahlungsunfähigkeit nicht leer ausgehen.
-
Klare Regelungen beim Gepäck: Einheitliche und
transparente - Entschädigungsrichtlinien für
Gepäckverluste und -schäden.
- Klare
Definitionen für Handgepäck und Aufgabegepäck,
um versteckte Gebühren und unklare Regelungen zu
vermeiden.
- Verpflichtende Teilnahme der
Airlines an Schlichtungsverfahren zur
außergerichtlichen Beilegung von Streitfällen.
- Bessere Durchsetzung der Fluggastrechte durch
nationale Behörden, um sicherzustellen, dass
Airlines ihre Pflichten nicht umgehen.
Weitere Details und eine umfassende Analyse
finden sich im Positionspapier des ECC-Net
(PDF-Download).
IMK
Inflationsmonitors: Inflation für 6 von 9
Haushaltstypen bei oder unter 2 Prozent – noch
zu früh für Pause bei Zinssenkungen
Die Inflationsrate in Deutschland lag im Februar
2025 bei 2,3 Prozent und damit auf dem gleichen
Niveau wie im Januar. Das ist bereits nahe beim
Inflationsziel der Europäischen Zentralbank
(EZB) von zwei Prozent, zudem sank die Kernrate,
also die Inflation ohne die besonders
schwankungsanfälligen Güter Energie,
Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak, gegenüber
Januar von 2,8 auf 2,6 Prozent.
Schaut man auf die Inflationsraten verschiedener
Haushaltstypen, die sich nach Einkommen und
Personenzahl unterscheiden, hatten sechs von
neun untersuchten Haushaltstypen im Februar
Inflationsraten leicht unter oder genau bei 2,0
Prozent, zeigt der neue Inflationsmonitor des
Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung.
Insgesamt reichte
die Bandbreite der haushaltsspezifischen
Inflationsraten von 1,8 bis 2,3 Prozent. Zum
Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Inflationswelle
im Herbst 2022 waren es 3,1 Prozentpunkte
Differenz. Während Haushalte mit niedrigen
Einkommen während des akuten Teuerungsschubs der
Jahre 2022 und 2023 eine deutlich höhere
Inflation schultern mussten als Haushalte mit
mehr Einkommen, war ihre Inflationsrate im
Februar 2025 wie in den Vormonaten
unterdurchschnittlich: Der Warenkorb von Paaren
mit Kindern sowie der von Alleinlebenden mit
jeweils niedrigen Einkommen verteuerte sich um
je 1,8 Prozent.
Allerdings waren beide
Werte um 0,1 Prozentpunkte höher als im Januar.
Das liegt daran, dass der wieder stärkere
Preisanstieg bei Nahrungsmitteln sich bei diesen
Haushalten stärker auswirkt als bei Haushalten
mit höheren Einkommen, weil diese Güter des
Grundbedarfs in ihren schmalen Budgets ein
relativ hohes Gewicht haben.
Im
Jahresverlauf 2025 dürfte sich die
Inflationsrate sowohl in Deutschland als auch im
Euroraum weiter normalisieren und bei
gesamtwirtschaftlich zwei Prozent einpendeln, so
die Prognose des IMK. Gleichzeitig schwächelt
die Wirtschaft weiterhin. Die von Union und SPD
geplanten umfangreichen zusätzlichen
Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung
werden der Wirtschaftsentwicklung nach Erwartung
des IMK zwar wichtige Impulse geben, richtig
wirksam werden sie allerdings erst ab dem
kommenden Jahr.
Daher hält Dr. Silke
Tober, IMK-Expertin für Geldpolitik und Autorin
des Inflationsmonitors, weitere
Leitzinssenkungen durch die EZB für
erforderlich, zumal die kürzlich erfolgte
Zinssenkung auf 2,5 Prozent durch eine
zeitgleich stattfindende quantitative Straffung
der Geldpolitik in ihrer Wirkung abgeschwächt
wird. „Für eine Pause bei den Zinssenkungen wäre
es daher zu früh“, betont Tober. „Es ist an der
Zeit, dass Geld- und Fiskalpolitik gemeinsam ein
günstiges Umfeld für private Investitionen
schaffen, damit die Herausforderungen der
kommenden Jahre bewältigt werden und die
Realeinkommen steigen können.“
Mehr erfahren ›
Das IMK berechnet
seit Anfang 2022 monatlich spezifische
Teuerungsraten für neun repräsentative
Haushaltstypen, die sich nach Zahl und Alter der
Mitglieder sowie nach dem Einkommen
unterscheiden (mehr zu den Typen und zur Methode
unten). In einer Datenbank liefert der
Inflationsmonitor zudem ein erweitertes
Datenangebot: Online lassen sich Trends der
Inflation für alle sowie für ausgewählte
einzelne Haushalte im Zeitverlauf in
interaktiven Grafiken abrufen (Link unten).
•
Inflation hat sich zwar abgeschwächt –
Preisniveau ist aber weiterhin deutlich erhöht
Die längerfristige Betrachtung illustriert, dass
Haushalte mit niedrigem bis mittlerem Einkommen
von der starken Teuerung nach dem russischen
Überfall auf die Ukraine besonders stark
betroffen waren, weil Güter des Grundbedarfs wie
Nahrungsmittel und Energie in ihren Warenkörben
eine größere Rolle spielen als bei Haushalten
mit hohen Einkommen. Diese wirkten lange als die
stärksten Preistreiber, zeigt ein
längerfristiger Vergleich, den Tober in ihrem
neuen Bericht ebenfalls anstellt: Insgesamt
lagen die Verbraucherpreise im Februar 2025 um
20,7 Prozent höher als fünf Jahre zuvor.
•
Damit
war die Teuerung fast doppelt so stark wie mit
der EZB-Zielinflation von kumuliert 10,4 Prozent
in diesem Zeitraum vereinbar. Nahrungsmittel und
alkoholfreie Getränke verteuerten sich sogar um
34,4 Prozent, Energie war trotz der
Preisrückgänge in letzter Zeit um 38,8 Prozent
teurer als im Februar 2020. Auf dem Höhepunkt
der Inflationswelle im Oktober 2022 betrug die
Teuerungsrate für Familien mit niedrigen
Einkommen 11 Prozent, die für ärmere
Alleinlebende 10,5 Prozent.
Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen hatten
damals mit 7,9 Prozent die mit Abstand
niedrigste Inflationsrate. Erschwerend kommt
hinzu, dass Haushalte mit niedrigeren Einkommen
wenig finanzielle Polster besitzen und sich die
Güter des Grundbedarfs, die sie vor allem
nachfragen, kaum ersetzen oder einsparen lassen.
Im Februar 2025 verteuerten sich die
spezifischen Warenkörbe von Haushalten mit
niedrigen bis mittleren Einkommen hingegen etwas
weniger stark als der Durchschnitt, weil zuletzt
vor allem die Preise für Dienstleistungen
anzogen, die mit steigendem Einkommen stärker
nachgefragt werden. Allerdings wurde der Abstand
infolge wieder stärker anziehender
Nahrungsmittelpreise noch einmal geringfügig
kleiner.
So folgten im Vergleich der
neun Haushaltstypen auf die Familien und
Alleinlebenden mit niedrigen Einkommen (je 1,8
Prozent Inflation) die Inflationsraten von
Alleinlebenden und Alleinerziehenden mit jeweils
mittleren Einkommen (je 1,9 Prozent) sowie die
von Paarfamilien mit Kindern und mittleren
Einkommen (2,0 Prozent).
Um
ebenfalls 2,0 Prozent verteuerte sich der
Warenkorb von Alleinlebenden mit höheren
Einkommen. Am oberen Rand des Vergleichs, aber
nicht weit entfernt, lagen Alleinlebende mit
sehr hohen Einkommen (2,3 Prozent) und Familien
mit hohen Einkommen (2,1 Prozent), bei denen
sich beispielsweise höhere Preise für
Gastronomie und Hotelübernachtungen stärker
auswirken. Auch die Warenkörbe von Paaren ohne
Kinder mit mittleren Einkommen verteuerten sich
um 2,1 Prozent.
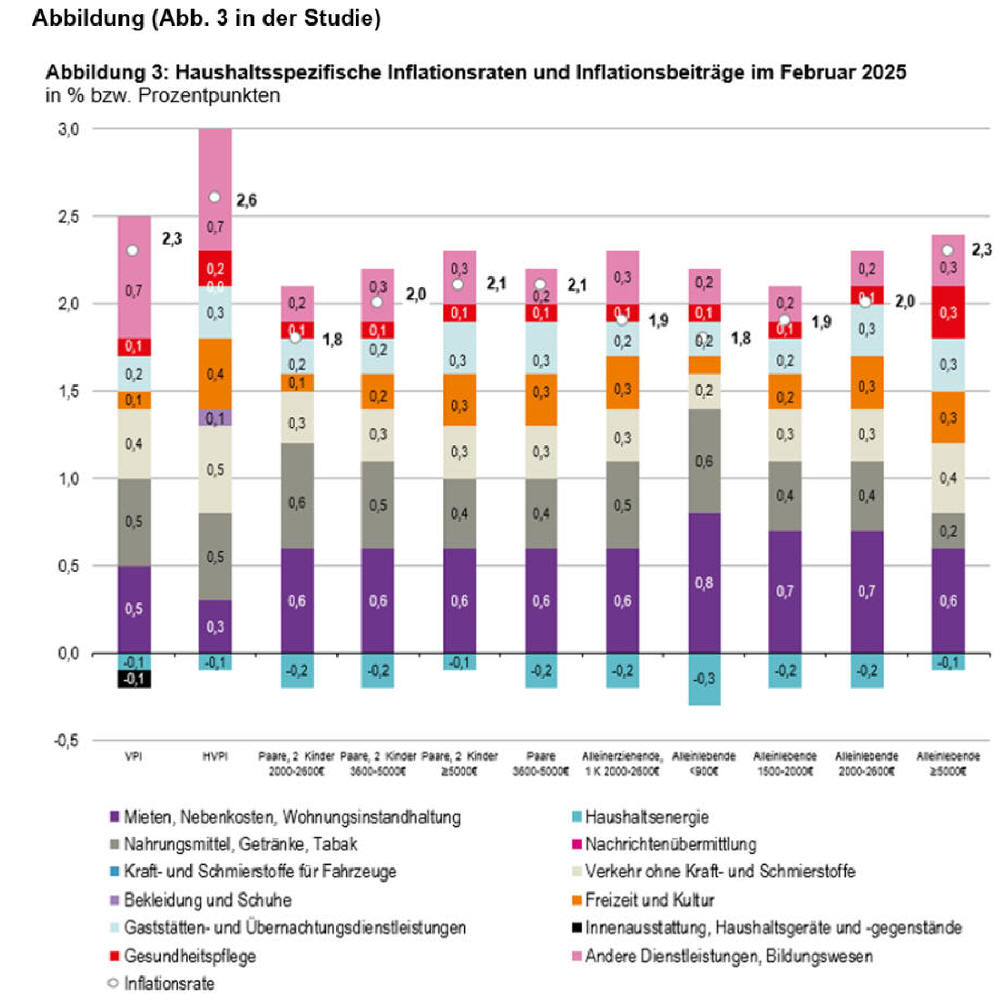

Möbelindustrie verzeichnet 2024
Umsatzrückgang von 7,8 %
• Zahl der Beschäftigten auf niedrigstem Stand
der letzten zehn Jahre
• Einzelhandel mit
Möbeln 2024 real um 5,5 % zurückgegangen
•
Wohnmöbel haben sich für Verbraucherinnen und
Verbraucher zuletzt
leicht verbilligt
Die Möbelindustrie hat im Jahr 2024 nach
vorläufigen Ergebnissen rund 16,3 Milliarden
Euro Umsatz erwirtschaftet – das sind 7,8 %
weniger als im Jahr 2023. Damals verbuchte die
Branche nominal 17,7 Milliarden Euro Umsatz, wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt. Dies stellt den stärksten
Umsatzrückgang gegenüber dem jeweiligen Vorjahr
in den letzten zehn Jahren dar.
Das
Umsatzminus zog sich durch alle
Produktionsbereiche: Bei der Herstellung von
Küchenmöbeln ging der Umsatz im Jahr 2024
gegenüber dem Vorjahr um 6,5 % zurück, bei der
Herstellung von Matratzen um 5,5 %, die
Herstellung von Büro- und Ladenmöbeln
verzeichneten mit 5,3 % und den sonstigen Möbeln
mit 10,9 % ebenfalls einen Rückgang. Die
Möbelbranche erzielt ein Großteil der Umsätze im
Inland: Der Inlandsumsatz machte mit rund 10,9
Milliarden Euro im Jahr 2024 zwei Drittel (66,8
%) des Gesamtumsatzes aus.
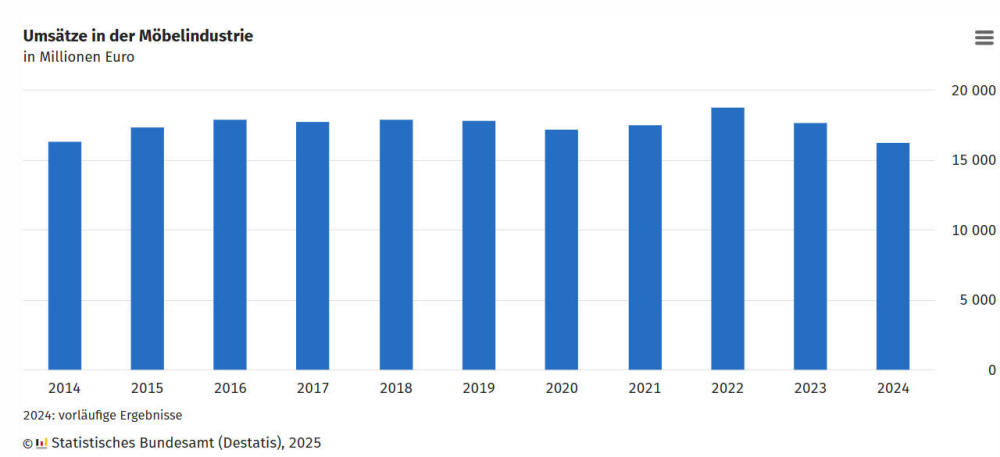
Zahl der Beschäftigten um 5,4 % gegenüber
Vorjahr gesunken
Zum Ende des Jahres 2024
waren in der Möbelindustrie nach vorläufigen
Ergebnissen rund 70 000 Menschen beschäftigt.
Das waren 5,4 % weniger als zum Jahresende 2023.
Es war zugleich der niedrigste Stand innerhalb
der vergangenen zehn Jahre. Zum Vergleich: Zum
Jahresende 2014 waren noch 83 500 Menschen in
der Möbelindustrie beschäftigt.
Möbelproduktion in den ersten drei Quartalen
2024 um 7,1 % zurückgegangen
Mit dem Umsatzminus ging auch ein Rückgang der
Produktion einher. Die Möbelhersteller in
Deutschland haben in den ersten drei Quartalen
des Jahres 2024 Möbel im Wert von 13,0
Milliarden Euro produziert. Das war ein Rückgang
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,1 %.
In den ersten drei Quartalen 2023 waren
Möbel im Wert von 13,9 Milliarden Euro
hergestellt worden. Bereits im gesamten Jahr
2023 war die Möbelproduktion gegenüber dem
Vorjahr wertmäßig zurückgegangen: Um 3,5 % auf
18,4 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 wurden
hierzulande noch Möbel im Wert von 19,1
Milliarden Euro produziert.
Einzelhandel mit Möbeln 2024 real um 5,5 %
zurückgegangen
Beim Einzelhandel mit Möbeln
ist die Kaufzurückhaltung spürbar. Zwar startete
der Einzelhandel mit Möbeln und
Einrichtungsgegenständen nach einem deutlichen
Umsatzrückgang im Jahr 2024 mit einem leichten
Plus ins neue Jahr: Der reale Umsatz nahm im
Januar 2025 kalender- und saisonbereinigt um 0,8
% gegenüber dem Vormonat zu.
Gegenüber
dem Januar 2024 gab es einen Anstieg um 0,6 %.
Im Jahr 2024 war jedoch der reale Umsatz mit
einem Minus von 5,5 % gegenüber 2023 deutlich
zurückgegangen. Bereits 2023 hatte es mit -10,8
% gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen
Rückgang der Umsätze im Einzelhandel mit Möbeln
gegeben.
Wohnmöbel haben sich für
Verbraucherinnen und Verbraucher binnen
Jahresfrist leicht verbilligt
Verbraucherinnen und Verbraucher mussten für
Wohnmöbel im Februar 2025 weniger ausgeben als
ein Jahr zuvor: Diese verbilligten sich
gegenüber Februar 2024 um 0,7 %. Darunter gingen
besonders die Preise für Matratzen (-6,9 %),
Wohn- oder Esszimmertische (-4,9 %) sowie für
Badezimmermöbel (-3,5 %) zurück. Dagegen
verteuerten sich unter anderem Kleiderschränke
(+1,1 %) sowie Küchenzeilen oder Einbauküchen
(+0,8 %) binnen Jahresfrist. Zum Vergleich: Die
Verbraucherpreise insgesamt nahmen im selben
Zeitraum um 2,3 % zu.
Im Jahr 2024 haben
sich die Preise für Wohnmöbel gegenüber dem
Vorjahr mit +0,1 % kaum verändert, während die
Verbraucherpreise insgesamt um 2,2 % zunahmen.
Dabei verbilligten sich beispielsweise
Kleiderschränke (-2,7 %) gegenüber dem Jahr
2023. Andere Möbelstücke wie Stühle oder
Eckbänke (+1,8 %) sowie Küchenzeilen oder
Einbauküchen (+0,9 %) verteuerten sich.
NRW-Binnenschifffahrt: Güterumschlag
nimmt 2024 wieder zu
In den
nordrhein-westfälischen Binnenhäfen sind im Jahr
2024 insgesamt 99,8 Millionen Tonnen Güter
umgeschlagen worden. Wie das Statistische
Landesamt mitteilt, lag der Güterumschlag der
Binnenschiffe damit um 1,8 Prozent über dem
Ergebnis des Jahres 2023. Damit verzeichnet die
Binnenschifffahrt in NRW seit 2021 erstmals
wieder eine Zunahme beim Güterumschlag.
Güterumschlag und Anzahl der Schiffe im
Dezember 2024 am niedrigsten
Im
Jahresverlaufs 2024 gab es den höchsten
Güterumschlag im Juli mit 8,8 Millionen Tonnen;
die meisten Schiffe (5 916) haben im August
Güter in den NRW-Häfen verladen. Im Dezember war
sowohl der Güterumschlag (7,8 Millionen Tonnen)
als auch die Anzahl der Schiffe (5 123) am
geringsten.
Am häufigsten wurden in NRW
Erze, Steine und Erden umgeschlagen Der Großteil
der umgeschlagenen Güter stammten im Jahr 2024
aus folgenden vier Güterabteilungen:
28,3 Millionen Tonnen waren Erze, Steine und
Erden (−1,9 Prozent), 21,5 Millionen Tonnen
Kokerei- und Mineralölerzeugnisse
(+10,4 Prozent), 11,5 Millionen Tonnen Kohle,
rohes Erdöl und Erdgas (−11,5 Prozent) und
10,8 Millionen Tonnen chemische Erzeugnisse
(+6,7 Prozent).
Es wurden
28,2 Millionen Tonnen Gefahrgut, z. B. Flüssige
Mineralölerzeugnisse transportiert; das waren
8,1 Prozent mehr als 2023. Dabei handelte es
sich um gut ein Viertel (28,3 Prozent) der
insgesamt beförderten Tonnage. Drei Viertel der
beförderten Güter wurden in Rheinhäfen
umgeschlagen Die bedeutendste Binnenwasserstraße
in NRW ist der Rhein.
Über drei Viertel
(76,0 Prozent) der von Januar bis Dezember 2024
beförderten Güter wurden in den Häfen an dieser
Wasserstraße umgeschlagen. Auf den Plätzen zwei
und drei rangierten das Westdeutsche Kanalgebiet
(22,2 Prozent) und der Mittellandkanal
(1,6 Prozent). Das Schlusslicht bildete das
Wesergebiet mit einem Anteil von 0,2 Prozent.
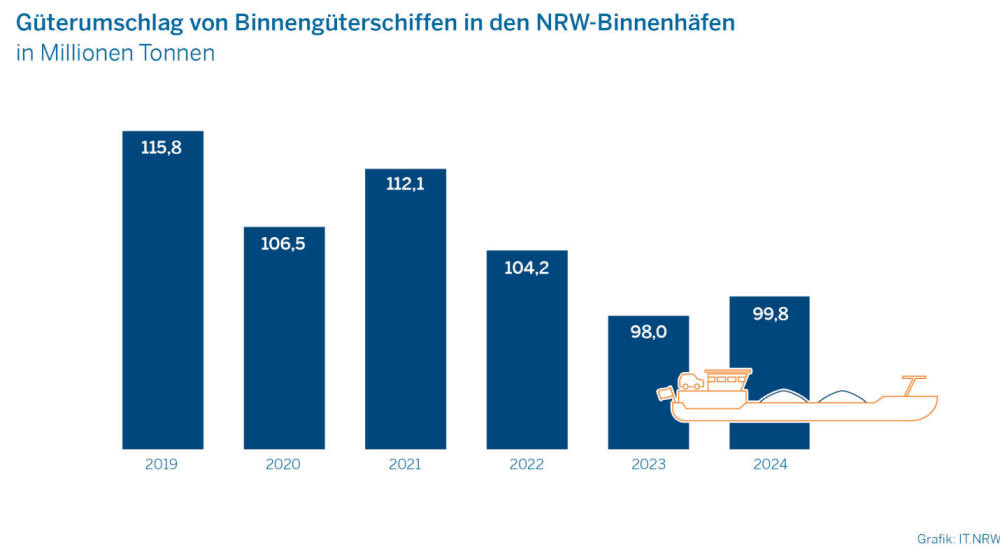
Je nach Wasserstraße wurden schwerpunktmäßig
unterschiedliche Güter umgeschlagen: Auf dem
Rhein und dem Mittellandkanal waren es am
häufigsten Erze, Steine und Erden (35,2 Prozent
aller auf dem Rhein bzw. 23,8 Prozent aller auf
dem Mittellandkanal beförderten Güter) sowie
Kokerei- und Mineralölerzeugnisse (15,6 Prozent
bzw. 24,6 Prozent).
Auf
Binnenschifffen im Westdeutschen Kanalgebiet
wurden vor allem Kohle, rohes Erdöl und Erdgas
(16,5 Prozent) sowie Chemische Erzeugnisse
(15,7 Prozent) tranportiert. Auf der Weser
überwogen landwirtschaftiche Erzeugnisse mit
46,8 Prozent sowie Kohle, rohes Erdöl und Erdgas
mit 28,5 Prozent. Der Containerumschlag war um
6,7 Prozent höher als 2023 Im Jahr 2024 wurden
von allen in den NRW-Binnenhäfen umgeschlagenen
Gütern etwa 926 600 TEU in insgesamt 571 900
Containern verschifft.
Das waren 6,7 Prozent
mehr Container als im Vorjahr.
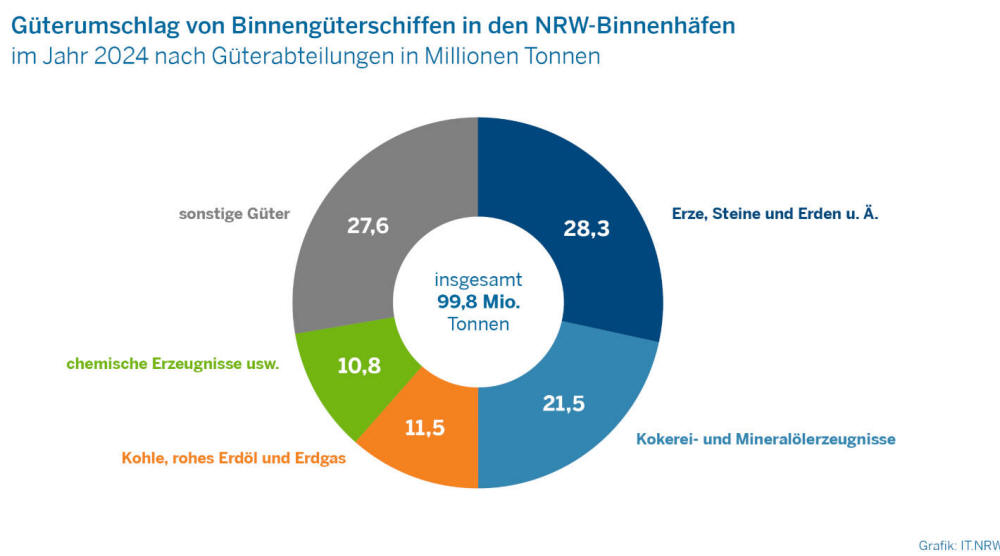
Bei über der Hälfte der Container handelte
es sich um 40-Fuß Container (52,0 Prozent);
gefolgt von 20-Fuß Containern (34,3 Prozent).
Dabei wurden rund 445 700 TEU empfangen und
480 900 TEU versendet. In NRW wurde der Großteil
der Container (94,4 Prozent) auf dem Rhein
transportiert. 4,6 Prozent aller Container
wurden im Westdeutschen Kanalgebiet und
1,0 Prozent im Mittellandkanalgebiet verschifft.
Auf der Weser wurden keine Container
transportiert.
|









 Umstellung
Winter- auf Sommerzeit: 30.03.2025
Uhr-Umstellung von 2 Uhr auf 3 Uhr.
Umstellung
Winter- auf Sommerzeit: 30.03.2025
Uhr-Umstellung von 2 Uhr auf 3 Uhr.