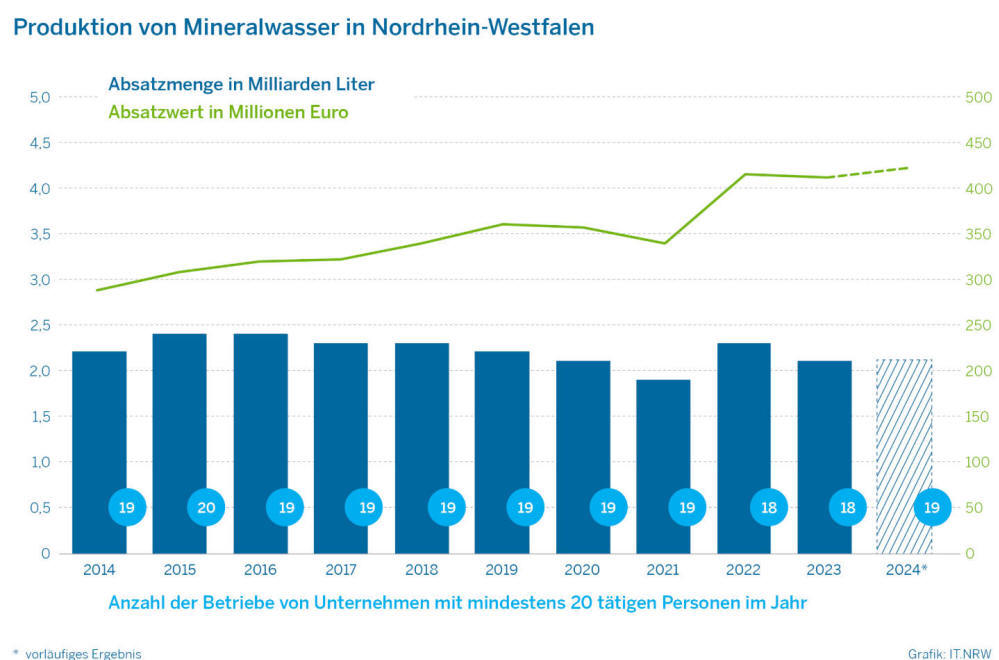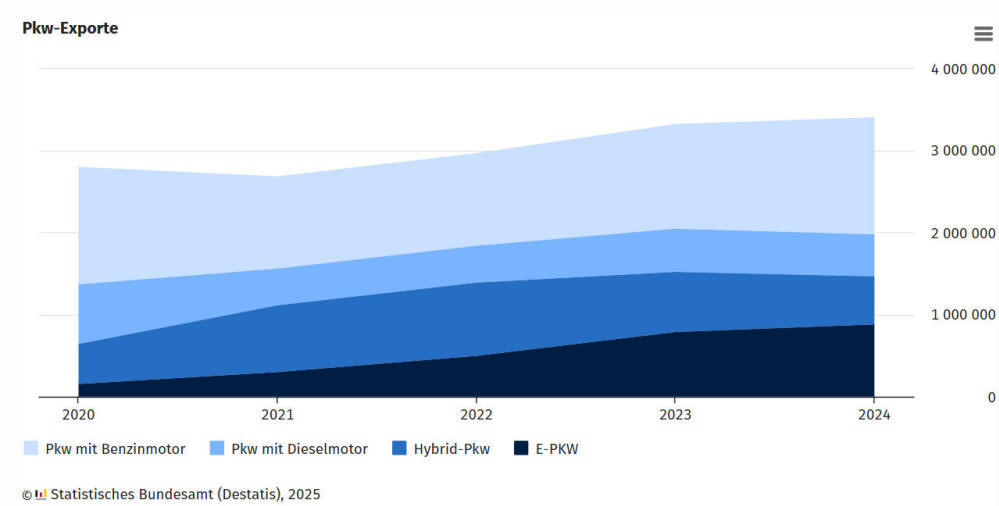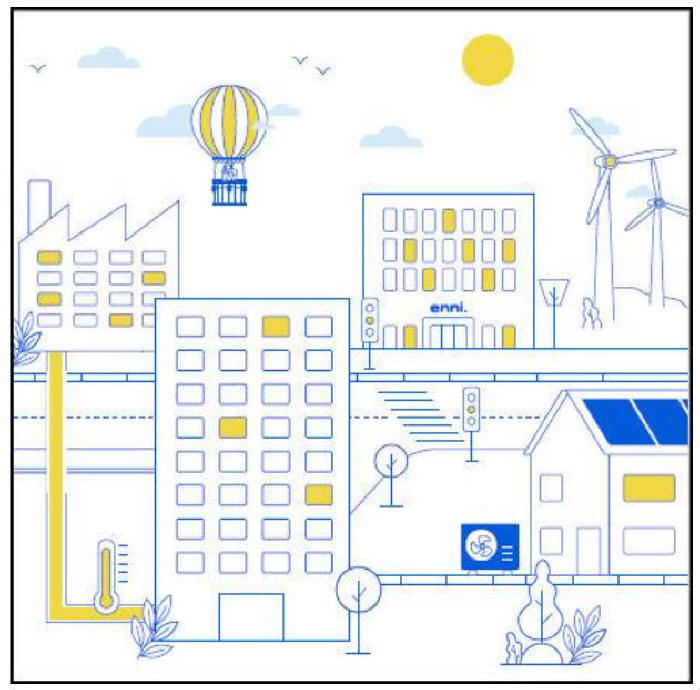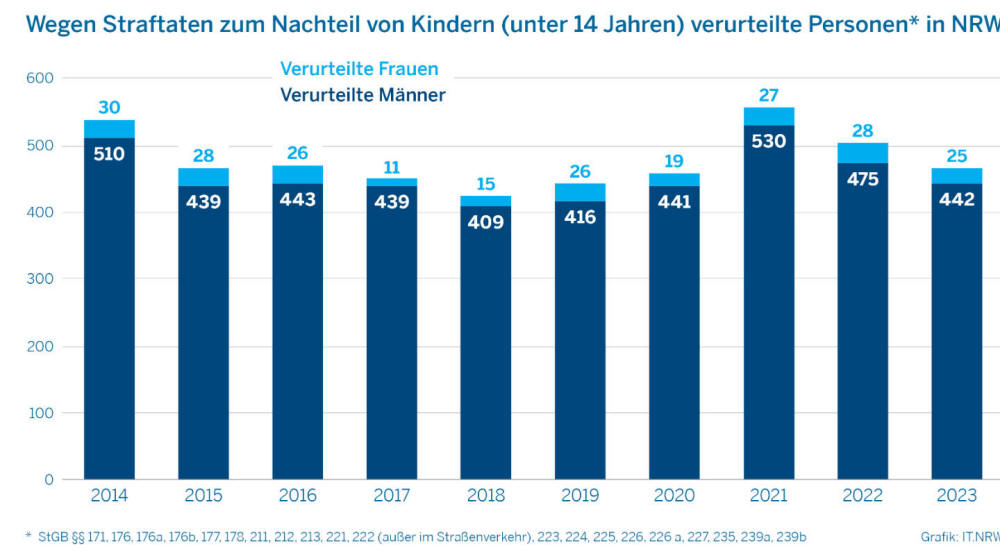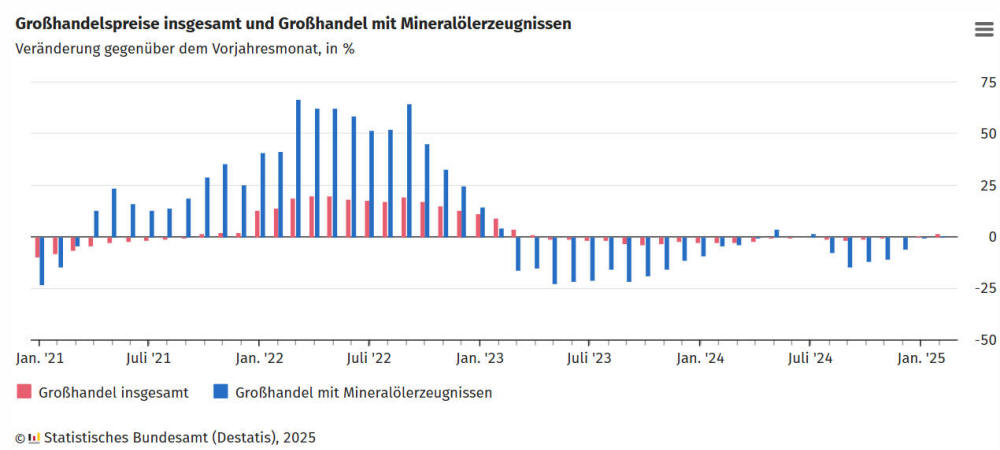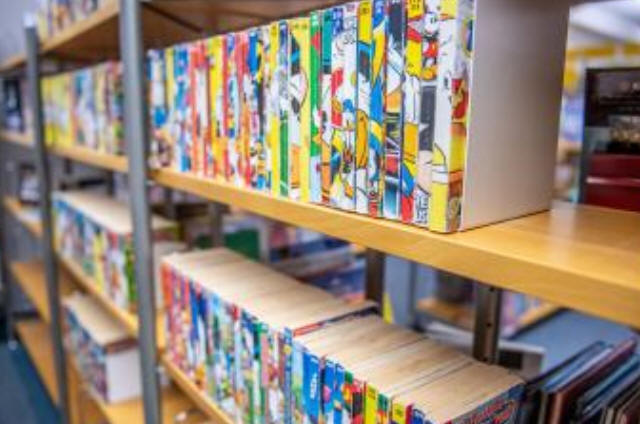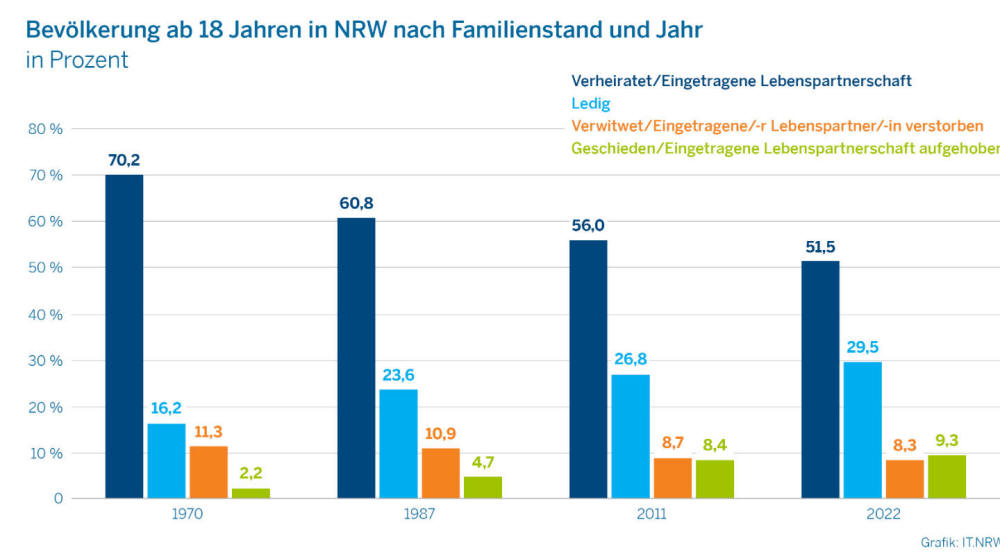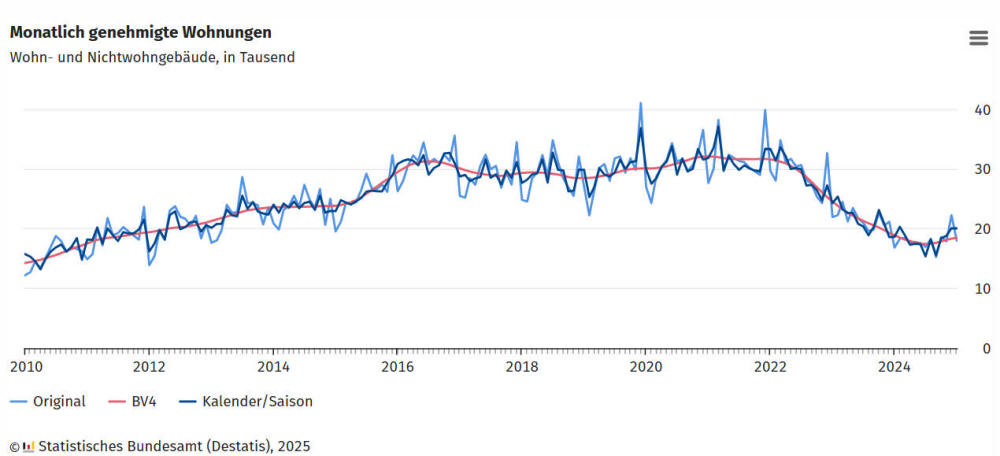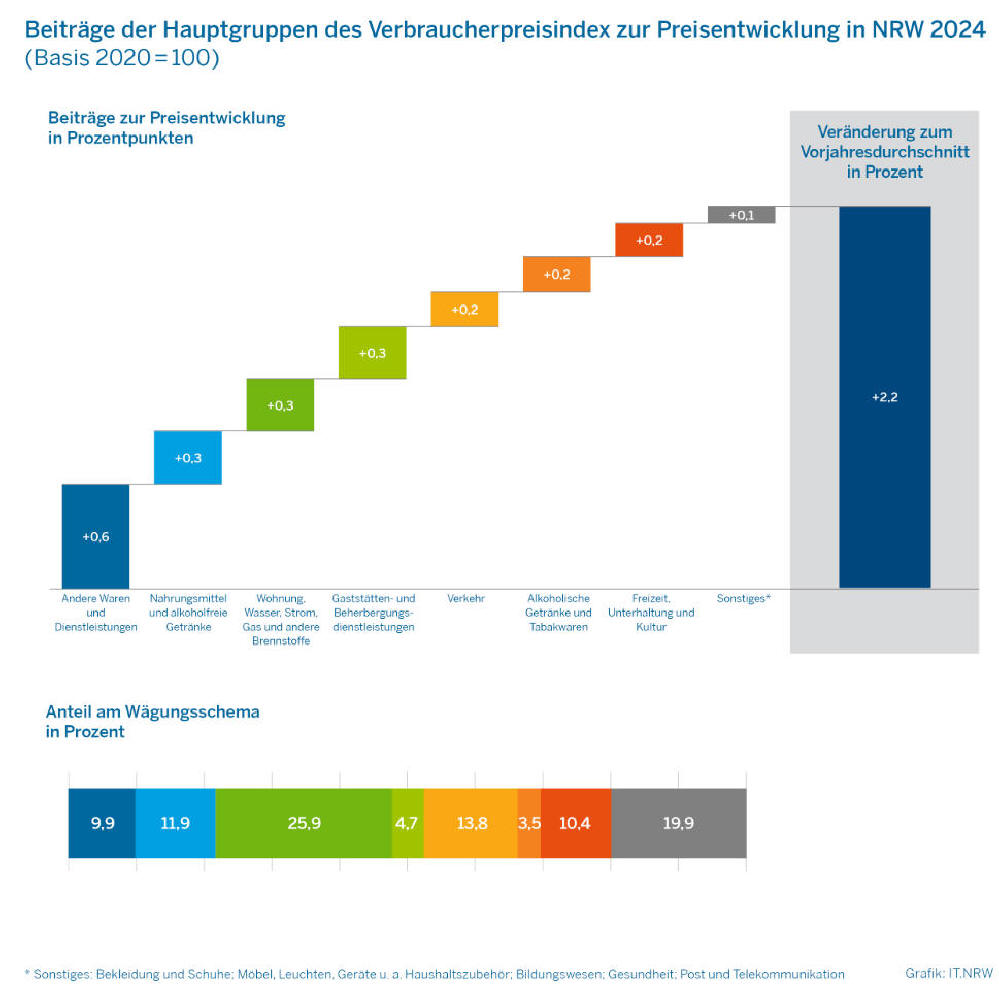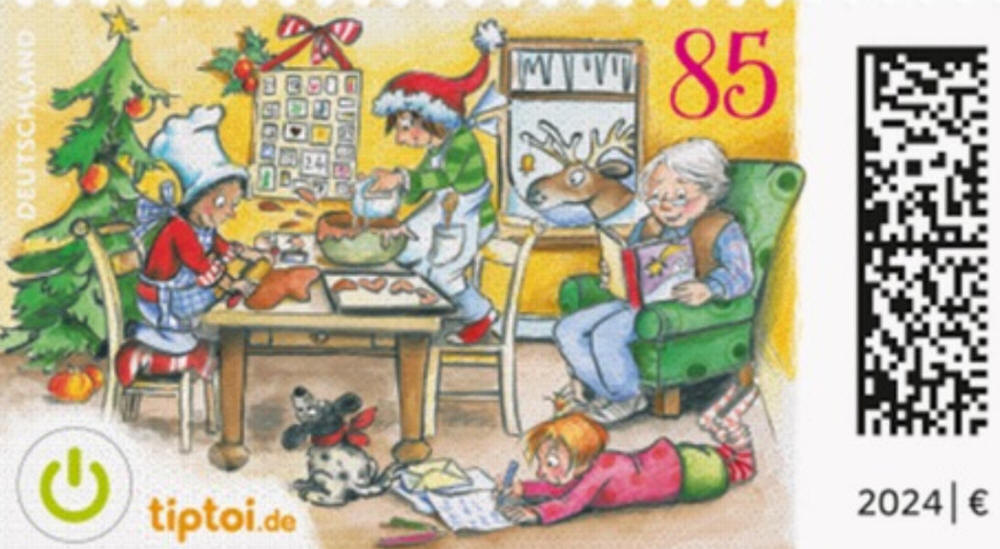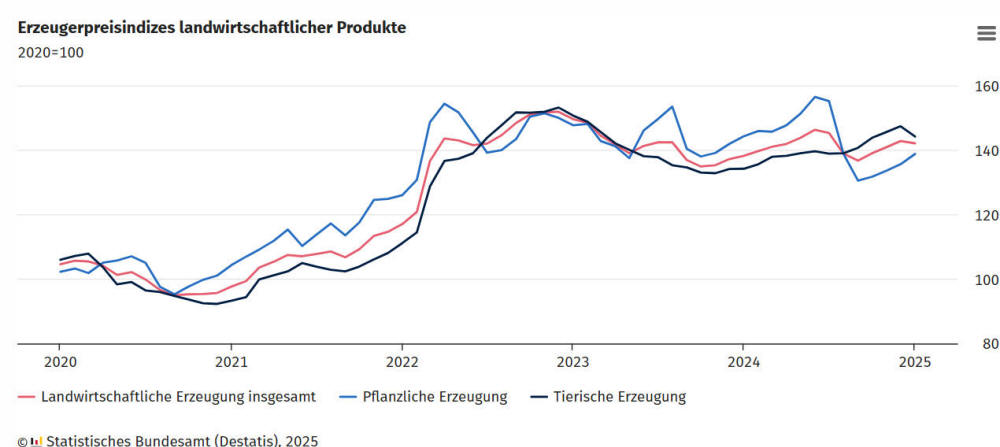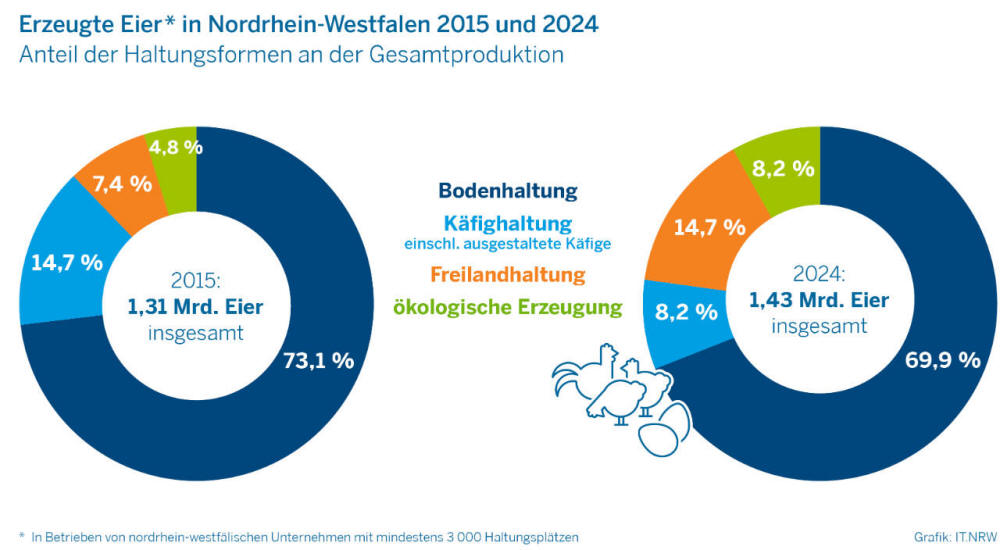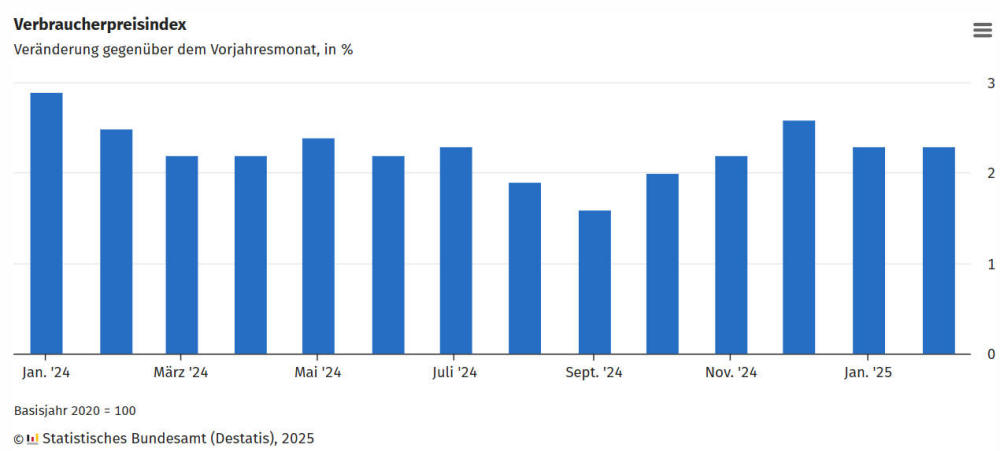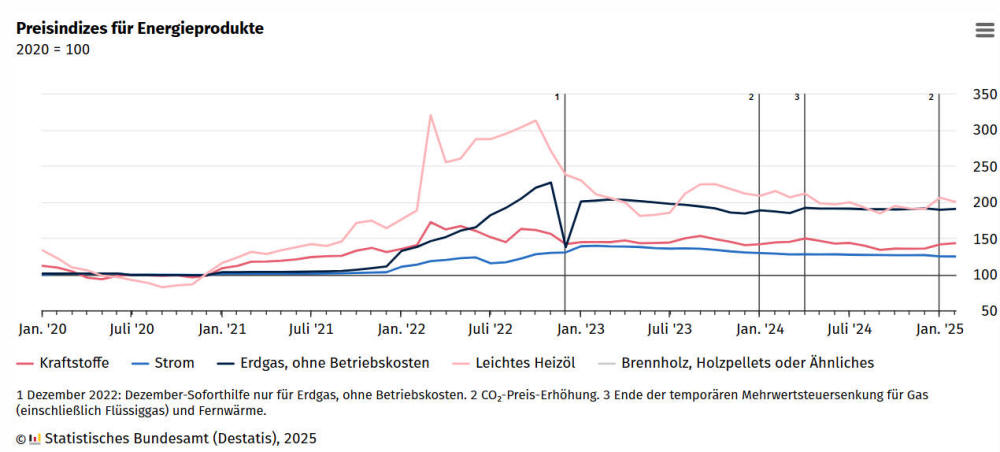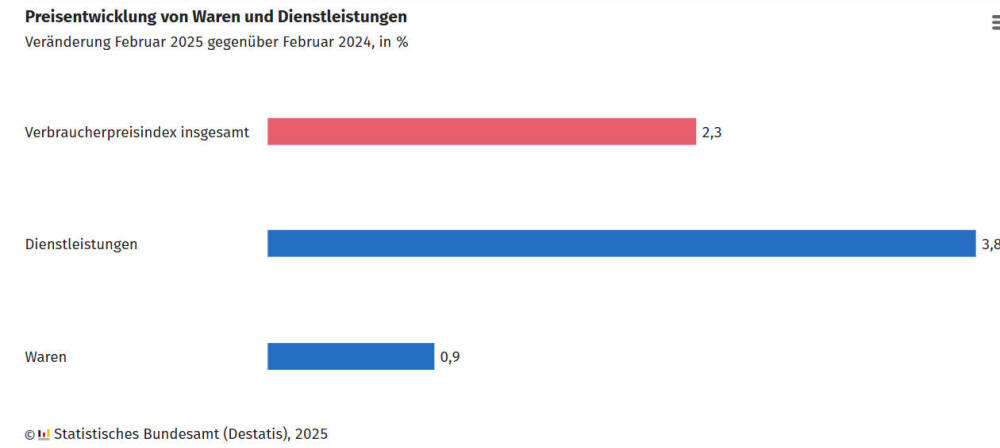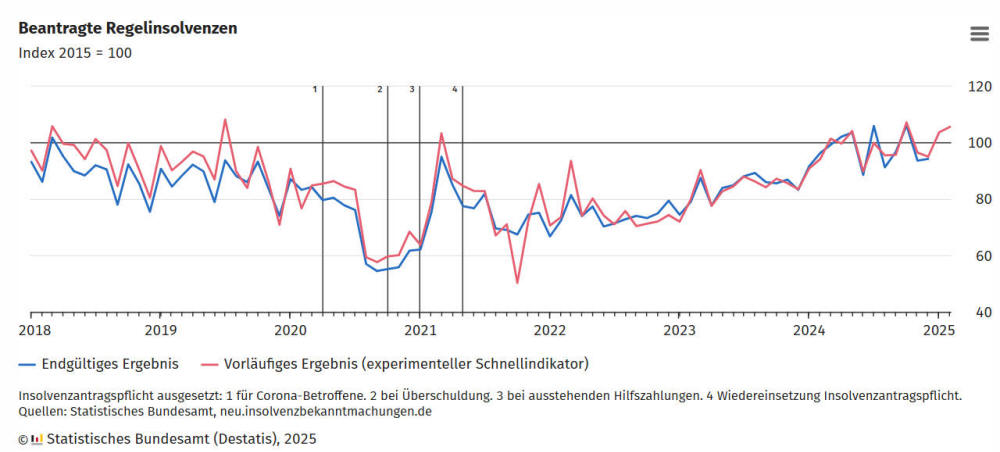|
Samstag, 22., Sonntag, 23. März 2025
- 22. März ist Tag der Kriminalitätsopfer und
Weltwassertag
LKA NRW zum Tag der
Kriminalitätsopfer: Digitale Gewalt erkennen,
stoppen, Hilfe finden!
Weil Opferschutz zu den wesentlichen
polizeilichen Aufgaben zählt, rückt das
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW)
anlässlich des diesjährigen Tags der
Kriminalitätsopfer am 22. März das Thema
digitale Gewalt in den Fokus und weist auf
bestehende Hilfs- und Unterstützungsangebote
hin.
Digitale Gewalt hat viele
Gesichter: Cybermobbing, Cyberstalking,
Sextortion, Romance Scamming, Deepfakes oder das
unaufgeforderte Zusenden von sogenannten
Dickpics gehören dazu. Oft kennen die
Betroffenen die Täterinnen und Täter persönlich
- sei es aus dem familiären oder beruflichen
Umfeld oder aus früheren Beziehungen.
•
Cybermobbing: Insbesondere Kinder und
Jugendliche, aber auch Erwachsene sind dieser
Form der digitalen öffentlichen Belästigung,
Bloßstellung und Beleidigung im Internet
ausgesetzt. Cyberstalking: Aus vermeintlicher
Liebe wird Obsession und es kommt zu penetranter
Nachstellung, Bedrohung und Belästigung im Netz.
Je nach Konstellation können sich Stalkingopfer
weder in ihrem alltäglichen Umfeld noch im
digitalen Raum sicher fühlen.
•
Sextortion: Der Begriff ist zusammengesetzt aus
den englischen Begriffen "sex" und "extortion",
was für Erpressung steht. Die Täter drohen ihren
Opfern, zuvor provozierte intime Aufnahmen zu
veröffentlichen und erpressen so Geld.
•
Romance Scamming: Digital agierende Täter
handeln vergleichbar analoger Heiratsschwindler
und versprechen die große Liebe. Am Ende haben
sie es nur auf Geld abgesehen. Sowohl Frauen als
auch Männer fallen ihnen zum Opfer.
•
Deepfakes sind mittels KI erstellte bzw.
manipulierte Dateien, die zum Beispiel mit
pornografischem Inhalt dazu genutzt werden
können, ein Opfer gezielt zu demütigen oder es
zu erpressen.
• Dickpics ist die
umgangssprachliche Bezeichnung für Bilder von
(meist männlichen) Geschlechtsteilen, die oft
ungefragt an einzelne Empfänger versendet
werden. Solche Aufnahmen zu verschicken kann
strafbar sein und mit einer Freiheitsstrafe von
bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe geahndet
werden.
Die Folgen für Opfer digitaler
Gewalt sind oft gravierend. Hierzu zählen der
soziale Rückzug, psychische Belastungen teils
einhergehend mit körperlichen Symptomen und oft
ein tiefer Vertrauensverlust in Mitmenschen und
Gesellschaft.
Auf
https://polizei.nrw/cybercrime informiert
die Polizei Nordrhein-Westfalen über
Erscheinungsformen digitaler Gewalt und gibt
konkrete Tipps zum Schutz und zur Prävention.
Wichtig ist: Das Internet ist kein
rechtsfreier Raum. Wer digitale Gewalt erfährt,
sollte nicht zögern, Anzeige bei der Polizei zu
erstatten. Zusätzlich bietet das LKA NRW unter
https://lka.polizei.nrw/opferschutz-3
Informationen für Opfer von Kriminalität,
Unfällen oder anderen Unglücksfällen.
Frühlingserwachen am Niederrhein
Wenn sich der Niederrhein langsam wieder in ein
farbenfrohes Naturparadies entwickelt, ziehen
auch die ersten Frühlingsangebote frisch aus der
Region in die Hofläden und in die Gastronomie
ein. Der Frühling ist die perfekte Jahreszeit,
um die Vielfalt der Genussregion Niederrhein zu
entdecken.

Copyright: Patrick Gawandtka
Von
kulinarischen Highlights und regionalen
Spezialitäten bis hin zu verschiedenen
Veranstaltungen und Aktionen bietet der
Niederrhein für jeden das Passende. Frische
regionale Köstlichkeiten wie Spargel und
Erdbeeren machen den frühlingshaften Genuss
perfekt. Ab Ende März beginnen erste
Spargelbetriebe - je nach Wetterlage - mit der
Ernte. Pünktlich zum Start der Saison werden auf
der Webseite www.genussregion-niederrhein.de besondere
Spargelerlebnisangebote und
Einkaufsmöglichkeiten zu finden sein.
Dort sind auch alle anderen
Frühlingsangebote der Genussregion Niederrhein
zusammengestellt. Gerade im Frühling ist es
wieder Zeit für aktive Entdeckungen und
abwechslungsreiche Ausflüge mit der ganzen
Familie. Ob Rad- oder Wandertour durch die
niederrheinische Landschaft, spannende
Outdoor-Abenteuer oder erlebnisreiche
Gästeführungen - unsere Tourenvorschläge halten
für jeden etwas bereit.
Die
vielfältigen Tourenvorschläge sind auf der
Webseite www.kreis-wesel.de/tourismus zu
finden. Genüsslich in den Frühling radeln kann
man beispielsweise auf der 52 Kilometer langen
Genusstour „Frühling küsst Spargel“ rund um
Xanten, Uedem, Sonsbeck und Alpen. Nicht nur
blühende Landschaften sind auf der Tour zu
erradeln, sondern auch die Spezialitäten der
Region in Hofläden und Gastronomiebetrieben
können verkostet werden.
Jugendsportpreis der Stadt Dinslaken vergeben
Am Donnerstagabend, den 20. März 2025, hat die
Stadt Dinslaken gemeinsam mit dem
Stadtsportverband und der Niederrheinischen
Sparkasse RheinLippe Sportler*innen für ihre
herausragenden sportlichen Leistungen geehrt.
Drei Einzelsportlerinnen sowie drei
Sportmannschaften durften sich über den
Jugendsportpreis der Stadt freuen.
„Ich
gratuliere alle Nachwuchssportler*innen zu ihren
Erfolgen. Derartige Erfolge erreicht man nicht
nur über das vorhandene Talent. Derartige
Erfolge erreicht man in der Regel nur mit Fleiß,
einer hohen Anstrengungsbereitschaft und
kontinuierlichem Training. Unsere Dinslakener
Vereine beweisen, dass sie engagiert und
fachlich versiert unsere Kinder und Jugendlichen
trainieren und betreuen.
Den jungen
Sportler*innen gratuliere ich recht herzlich!
Danke auch, an alle, die dazu beigetragen haben,
dass derartige Erfolge erzielt werden konnten",
sagte Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und
verwies damit auf die große Bedeutung
sportlichen Engagements.
„Sport passiert
im Kopf: Er inspiriert uns, macht uns glücklich
und stärkt uns. Beim Sport knüpfen wir
Freundschaften, überwinden Vorurteile und
verfolgen gemeinsame Ziele: Sport ist deshalb
auch ein Motor für Integration. Er bietet
Verständigung über Sprach- und Kulturbarrieren
hinweg", sagt Sportdezernentin Dr. Tagrid
Yousef.
Mit der Auszeichnung wurden
folgende Einzelsportlerinnen und Teams aus
Dinslaken geehrt (Bilder in der hier genannten
Reihenfolge siehe unten):
· Kjell Reinsch
TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld e.V. (Schwimmen): Der
15 Jahre alte Schwimmer holte Bezirk Ruhrgebiet
3 mal Gold und 1 mal Silber. Bei den
NRW-Meisterschaften holte er unter anderem den
zweiten Platz im 200 Meter Schmetterling.
· Alina Sofia Czok – MTV Rheinwacht
Dinslaken e.V. (Rollkunstlauf): Die 14-jährige
Rollkunstläuferin holte unter anderem beim NRW
Kürpokal den 1. Platz, beim Frieda-Else-Ritter
Kürpokal in Bochum den 1. Platz und bei der
Landesnachwuchsmeisterschaft ebenfalls 1. Platz.
Lena Pokorska TC Rot Weiss Dinslaken e.V.
(Tennis): Die 12-Jährige hat den 1. Platz beim
Ratinger Jugendturnier um den Sparkassencup W12,
den 1. Platz beim A.I.T. Juniors Cup und den 1.
Platz beim Bezirks-Jüngsten Cup linksrheinisch
W12 gewonnen.
· Die Jüngstenmannschaft U8
- TC Rot Weiss Dinslaken (Tennis): Jonathan
Achilles (seit letztem Monat 9 Jahre alt),
Ferdinand Schmelt (8 Jahre), Helene Werry (8
Jahre) und Johannes Wille (8 Jahre) lieferten
bei allen Spielen gegen verschiedene Vereine aus
Wesel, Oberhausen und Duisburg eine tolle
Leistung und belegten am Ende der Saison den
zweiten Platz in der Tabelle.
·
Juniorinnen U12 – TC Rot Weiss Dinslaken
(Tennis): Die Juniorinnen der U12 des TC
Rot-Weiß Dinslaken sind im letzten Sommer bei
den Medenspielen (= Mannschafts-Saisonspiele) in
der höchsten Liga dieser Altersklasse im Bezirk
rechter Niederrhein (Bezirksliga) an den Start
gegangen
· Sunshine Formation – TSV
Kastell Dinslaken (Tanzen): In der
Jugendverbandsliga West JMC (Jazz und
Modern/Contemporary) dominierte das Team alle
vier Saisonturniere und sicherte sich mit
konstanten Höchstwertungen (1-1-1-1-1) den
Gesamtsieg. In der Regionalmeisterschaft Nord:
1. Platz und Titel des Regionalmeisters und bei
der Deutschen Meisterschaft in Dresden ertanzte
sich Sunshine den Deutschen Vizemeister-Titel –
bereits zum dritten Mal in Folge.
„Ich
danke euch Sportler*innen für euren tollen
Einsatz in der vergangenen Saison! Ihr tragt
dazu bei, den Namen unserer Stadt als
Botschafter*innen positiv in die Region tragen!
Dafür bin ich euch sehr dankbar“, betonte
Bürgermeisterin Eislöffel, die früher sowohl
haupt- als auch freiberuflich für den
Landessportbund NRW tätig war. Zu den
übergebenen Preisen gehörten auch
Kinogutscheine, die von der Lichtburg und dem
Stadtsportbund gesponsert wurden.
Stadt Kleve sichert frühkindliche
Bildung: 2.020 Betreuungsplätze genehmigt
Die Stadt Kleve stellt sich dem Strukturwandel
mit einem stabilen und zukunftsorientierten
Betreuungsangebot. In seiner jüngsten Sitzung
hat der Jugendhilfeausschuss grünes Licht für
insgesamt 2.020 Betreuungsplätze in Klever
Kindertageseinrichtungen und in der
Kindertagespflege gegeben.

„Seit 2022 gehen die Geburtenzahlen in
Deutschland deutlich zurück“, erklärt Markus
Koch, Leiter des Jugendamtes der Stadt Kleve.
Dies habe unmittelbare Auswirkungen auf die
Planung der Kindertagesbetreuung. „Trotz
möglicher Schwankungen rechnen wir vorerst nicht
mit einem signifikanten Rückgang der
Betreuungsplätze.“ Kleve profitiere von seiner
Attraktivität als Mittelzentrum der Region.
Strukturwandel in der frühkindlichen
Betreuung
Aktuell zeigt sich eine
bemerkenswerte Entwicklung: Noch nie waren so
viele unter Dreijährige in
Kindertageseinrichtungen untergebracht wie in
diesem Kitajahr. Erstmals übersteigt der Anteil
der U3-Kinder in Kitas den der
Kindertagespflege. „Unsere Planungen orientieren
sich stark an den Wünschen der Eltern“, so Koch
weiter. In der Kindertagespflege liegt der Fokus
nun auf qualitativer Weiterentwicklung.
Auch bei den Betreuungszeiten gibt es
strukturelle Veränderungen. Der kontinuierliche
Ausbau von Ganztagsplätzen in Kitas wurde
gestoppt. Seit Ende 2023 gilt eine Obergrenze
von 56 % Ganztagsplätzen, beschlossen vom
Jugendhilfeausschuss. „Viele Kita-Träger stoßen
an ihre Kapazitätsgrenzen – es fehlt schlicht an
Personal, um eine flächendeckende Übermittags-
oder Ganztagsbetreuung sicherzustellen“, erklärt
Koch. Eine flexiblere Gestaltung der
Betreuungszeiten könnte Abhilfe schaffen:
Familien, die individuelle Buchungszeiten wählen
können, benötigen im Durchschnitt weniger
Betreuungsstunden als Eltern mit festen
Kita-Zeiten.
Zukunftsprojekte für die
frühkindliche Betreuung in Kleve
Die Stadt
Kleve setzt weiterhin auf eine nachhaltige
Entwicklung der Betreuungsangebote. In den
kommenden Jahren entstehen Ersatzbauten für die
Kitas St. Lambertus (Donsbrüggen), St. Anna
(Materborn) und Arche Noah (Kellen). Alle drei
Einrichtungen befinden sich in der Trägerschaft
katholischer Kirchengemeinden. Zudem ist in der
Unterstadt die Planung einer neuen Kita in
freier Trägerschaft in vollem Gange.
Mit
diesen Maßnahmen stellt sich die Stadt Kleve den
Herausforderungen des Strukturwandels und sorgt
für ein bedarfsgerechtes und zukunftsfähiges
Betreuungsangebot.
Dinslaken/Duisburg:
Gedenkgottesdienste für die im Krankenhaus
Verstorbenen
Die
Krankenhausseelsorge des Evangelischen
Krankenhauses Dinslaken, des Evangelischen
Krankenhauses Duisburg-Nord und des Herzzentrum
Duisburg laden zu Gedenkgottesdiensten für die
im Krankenhaus Verstorbenen des letzten Jahres
ein.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Hauses werden die Gottesdienste gestalten. Jetzt
in der Passionszeit soll besonders den
Angehörigen Kraft und Zuversicht auf Ihrem Weg
durch die Trauer gegeben werden. Es ist eine
Gelegenheit sich gemeinsam zu vergewissern, dass
das Leben eines Menschen nicht mit dem Tod
verlischt: „Ich habe Dich bei Deinem Namen
gerufen…“, diesem Zuspruch Gottes wird in diesen
Gottesdiensten nachgespürt.
Die
Gedenkgottesdienste finden statt für das
Evangelische Krankenhaus Dinslaken:
am
Sonntag, dem 30. März 2025, um 17.00 Uhr in der
Stadtkirche, Duisburger Str. 9, 46535 Dinslaken.
Für das Evangelische Krankenhaus
Duisburg-Nord und das Herzzentrum Duisburg:
am Sonntag, dem 30. März 2025, um 17.00 Uhr in
der Ev. Kreuzeskirche Marxloh,
Kaiser-Friedrich-Straße 40, 47169 Duisburg.
Zu den Gottesdiensten sind alle Angehörigen und
alle Anteilnehmenden herzlich willkommen.
Beim Mähen die Hälfte vergessen?
Wie die Klever Wildblumenwiesen gepflegt werden
Die verschiedenen Wildblumenwiesen in Kleve sind
vor allem in den Sommermonaten schön anzusehen
und leisten einen wichtigen Beitrag zur lokalen
Artenvielfalt. Im Winter wandelt sich der
Anblick jedoch. Die meisten Pflanzen sind
verblüht oder abgestorben und nicht ganz zu
Unrecht erreichen die Stadt Kleve regelmäßig
Fragen, warum die Flächen über den Winter nicht
gemäht oder tote Pflanzenteile entfernt werden.
Wer aktuell etwa an den Klever Wiesen am
Rathaus vorbeispaziert, dem bietet sich ein
ungewohnter Anblick: Kürzlich wurden die Wiesen
zwar gemäht – allerdings nur streifenweise und
der Grünschnitt wurde liegengelassen. Was hat es
damit auf sich?

Wildblumenwiese März 2025. Während die
Osterglocken schon blühen, wurden die
Wildblumenwiesen bislang nur streifenweise
gemäht.
Wie und wann eine Blumenwiese
gemäht wird, ist individuell von den dort
vorhandenen Pflanzenarten abhängig. In der Regel
werden die Flächen einmal oder zweimal jährlich
mit einem Balkenmäher oder einer Sense gemäht,
um den Bewuchs durch starkwüchsige Gräser gering
zu halten und die Nährstoffe aus dem Boden zu
befördern. So kann eine stabile
Pflanzengemeinschaft entstehen. Es wird darauf
geachtet, die Flächen nicht zu früh zu mähen,
sodass die Samen reifen können und sich die
Pflanzen selbst aussäen.

Idealerweise werden die Flächen zudem
abschnittsweise und zeitlich gestaffelt gemäht,
denn so wird den dort ansässigen Tieren nicht
augenblicklich der komplette Lebensraum
entzogen. Einzelne Streifen oder Reststücke
werden sogar ganzjährig stehen gelassen, um den
Tieren als Rückzugsort oder
Überwinterungsmöglichkeit erhalten zu bleiben.
Grund dafür ist, dass viele Insekten in
hohlen, abgestorbenen Pflanzenteilen
überwintern, dort ihre Eier ablegen oder ihre
Kokons daran befestigen. Genau diese
abschnittsweise Mahd ist aktuell am Rathaus zu
beobachten. In den kommenden Wochen werden
weitere Streifen gemäht, bis die Wiesen im
Frühling wieder austreiben.
Die
Blumenwiesenflächen vor dem Rathaus sind als
Maßnahme des Konzeptes „Insektenfreundliches
Kleve“ angelegt worden, welches als Bestandteil
des Klimaschutzfahrplans der Stadt Kleve laufend
umgesetzt wird. Das Konzept sieht vor, die
Pflege und Mahd von öffentlichen Grünflächen an
den Anforderungen des Ökosystems auszurichten.
Bei Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema
erreichen interessierte Bürgerinnen und Bürger
die Stadt Kleve unter
umwelt@kleve.de.
Klever
Vorgartenwettbewerb: Anmeldungszeitraum wird
verlängert!
Am 15. Februar 2025
startete die Anmeldungsphase für den zweiten
Vorgartenwettbewerb der Stadt Kleve. Ziel des
Wettbewerbs ist es, Vorgärten in Kleve bis
Oktober möglichst insektenfreundlich und
klimaangepasst umzugestalten. Aufgrund der
bisher geringen Anmeldezahlen wird der
Anmeldungszeitraum bis zum 30. April 2025
verlängert. Auf den erstplatzierten Vorgarten
wartet ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro.

Laden zur Teilnahme am Vorgartenwettbewerb der
Stadt Kleve ein (v.l.): Klimaanpassungsmanagerin
Merle Gemke, Grünplaner Luc Boekholt und
Klimaschutzmanager Christoph Bors.
Der diesjährige Vorgartenwettbewerb lädt alle
Kleverinnen und Klever dazu ein, sich Gedanken
über die klimaangepasste Gestaltung ihrer
Vorgärten zu machen. Um am Vorgartenwettbewerb
teilzunehmen, braucht es nichts als ein paar
aktuelle Fotos des eigenen Vorgartens und eine
grundlegende Idee zur Umgestaltung. In einigen
kurzen Sätzen wird die zusammengefasst, mitsamt
den Fotos an die Stadt Kleve gesendet und schon
ist man für den Wettbewerb registriert.
Nach der Registrierung haben Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bis zum 31. Oktober 2025 Zeit, ihren
Vorgarten umzugestalten und davon Fotos zu
schießen. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner
warten Preisgelder in Höhe von insgesamt 4.500
Euro!
Wer kann am Wettbewerb teilnehmen?
Teilnehmen kann grundsätzlich jede Kleverin und
jeder Klever mit Vorgarten. Es können nicht nur
große, ausladende Vorgärten einen Preis gewinnen
und es kommt auch nicht zwingend darauf an,
Pflastersteine, Kies oder Schotter aus dem
eigenen Vorgarten zu verbannen. Auch
Rasenflächen und spärlich bepflanzte Vorgärten
haben das Potenzial, nachhaltig umgestaltet und
ökologisch aufgewertet zu werden. Sie sind damit
ebenso teilnahmeberechtigt, wie vollständig
versiegelte Vorgärten.
Auch die Größe des
Gartens ist nicht ausschlaggebend. Ein kleiner
Garten kann einen großen Beitrag zur
Klimaanpassung und Artenvielfalt leisten. Die
Umgestaltung kann dabei denkbar einfach sein:
Kies, Schotter oder Pflastersteine raus und
Pflanzen rein, schon ist der wichtigste Schritt
getan.
Die entnommenen Materialien
können über drei kostenfreie „Tegel-Taxis“, die
unter allen Teilnehmenden verlost werden,
abgefahren werden. Dazu wird von den USK jeweils
ein Big-Bag auf das Grundstück gestellt, welcher
mit Pflastersteinen, Kies oder Schotter gefüllt
werden kann. Anschließend wird dieser Big-Bag
von den USK wieder abgeholt.
Muss die
Umgestaltung durch eine Firma erledigt werden?
Die Umgestaltung und folgende Umsetzung muss
nicht unbedingt von professionellen Planern oder
Garten- und Landschaftsbauern umgesetzt werden,
sondern kann auch von jedem selbst in die Hand
genommen werden. Ein mit 500 Euro Preisgeld
dotierter Sonderpreis wird die
Vorgartenumgestaltung auszeichnen, die am
einfachsten umsetzbar und am pflegeleichtesten
ist, dennoch aber eine große Wirkung entfaltet.
Alle Informationen zum Vorgartenwettbewerb
der Stadt Kleve finden Interessierte unter
www.kleve.de/vorgartenwettbewerb. Für Fragen
steht Stadt Kleve telefonisch unter 02821/84-408
oder per E-Mail an umwelt@kleve.de zur
Verfügung.
Wesel: Umwelt- und
Planungsausschuss informiert über Kopfbaumpflege
Der Kopfbaum prägt den Niederrhein Kreis Wesel.
Die Kopfweide stellt nicht nur das Wappen des
Kreises Wesel dar, sondern ist das prägende
Element der niederrheinischen Kulturlandschaft.
Ihr naturschutzfachlicher Mehrwert ist enorm.
Zahlreiche Tierarten sind in großem Maße von der
Kopfweide abhängig, ob als Brut-, Fraß- oder
Wohnstätte.
Die Pflege - das
sogenannte Schneiteln - der Kopfgehölze ist
unerlässlich, um deren Auseinanderbrechen zu
verhindern. In den Landschaftsplänen des Kreises
Wesel sind die Kopfbäume als geschützte
Landschaftsbestandteile festgesetzt. Sie
unterliegen damit besonderen Schutzvorgaben und
für ihre Erhaltung sind konkrete Pflegemaßnahmen
verankert.
Die Untere
Naturschutzbehörde des Kreises setzt diese
Maßnahmen in Abstimmung mit Eigentümern und
Nutzungsberechtigten freiwillig um. Auf
Grundlage der vergangenen Förderabwicklung
konnte der Kreis Wesel durch die pauschale
Unterstützung in der Vergangenheit jährlich bis
zu 1.000 Kopfbäume fachgerecht von
EhrenamtlerInnen, EigentümerInnen und
BewirtschafterInnen pflegen lassen.
Zum
Ende des Jahres 2024 ist die bisherige
Fördergrundlage nach dem Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raumes (ELER) ausgelaufen. Für die
Schnittperiode 2024/2025 lagen der
Kreisverwaltung 1.235 Anträge zur Kopfbaumpflege
vor. Trotz der weggefallenen Förderung konnte
durch die kurzfristige Umwidmung von
Kreismitteln in Höhe von 26.700 Euro die Pflege
von 438 akut pflegebedürftigen Kopfbäumen
beauftragt werden.
Eine alternative
pauschale Förderung ist nach den nun hierfür
geltenden Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa)
nicht vorgesehen. Dies stellt aktuell vor allem
die kopfbaumreichen Kreise Wesel und Kleve vor
besondere Herausforderungen: Die bisher
durchgeführte pauschale Förderung der
Kopfbaumpflege mit 60 Euro pro Kopfbaum
(Gesamtvolumen: 60.000 Euro pro Jahr) ist nicht
mehr komplett gegenfinanziert, es verbleibt
voraussichtlich ein Eigenanteil von 20 % bei der
beantragenden Kommune.
Zuwendungsfähig sind außerdem nur noch die im
Rahmen des Kopfbaumschnitts entstehenden
Ausgaben für Fremdleistungen, die von der
Kreisverwaltung unter erheblichem personellen
Mehraufwand vergeben werden müssten. Anders als
bisher sind dann Eigenleistungen von
Privatpersonen, Vereinen und Verbänden nicht
mehr förderfähig. Diese führten die
Kopfbaumpflege im Kreis Wesel bisher
hauptsächlich durch.
Helmut Czichy,
zuständiges Vorstandsmitglied für den Bereich
Naturschutz, erläuterte dem Fachausschuss, was
dies für den Kreis Wesel in Zahlen bedeutet:
Dürfen künftig nur noch Fachfirmen und nicht
mehr EhrenamtlerInnen oder Landwirtinnen und
Landwirte die Kopfbaumpflege durchführen,
stiegen die Kosten von 60 auf geschätzt 150 Euro
pro Baum.
Von diesen 150 Euro verbliebet
ein Eigenanteil von 20 % - also 30 Euro – beim
Kreis Wesel, bei 1.000 Kopfbäumen pro Jahr
ergebe sich gegenüber der vorgeschlagenen
vollständigen Finanzierung über Eigenmittel zwar
eine Einsparung von 30.000 Euro für den
Kreishaushalt.
Wegen des hohen
bürokratischen Aufwandes, der mit der
erforderlichen Ausschreibung, Fremdvergabe und
Leistungsabwicklung verbundenen sei, müsste
diese Einsparung aber mit zusätzlichen
Personalkosten erkauft werden. Am Ende ergebe
sich eine jährliche Mehrbelastung von ca. 14.000
Euro für den Kreishaushalt. Dieser zusätzliche
bürokratische Aufwand passe nicht mehr in die
Zeit und lehne er insofern strikt ab.
Daher, so der zuständige Fachdienstleiter Klaus
Horstmann, sei es für den Kreis Wesel günstiger,
bei dem bisherigen Verfahren der pauschalen
Förderung zu bleiben und die 60.000 Euro für die
Pflege von bis zu 1.000 Kopfbäumen pro Jahr
künftig als Eigenmittel ohne Gegenfinanzierung
zur Verfügung zu stellen.
Dieses
Vorgehen biete außerdem den Vorteil, dass das
Ehrenamt, welches in vielen Fällen die Pflege
übernehme, weiterhin hinreichend gewürdigt
würde. In den Fällen, in denen die
EigentümerInnen und BewirtschafterInnen –
vielfach Landwirtinnen und Landwirte – die
Pflege selbstständig durchführen, müsste kein
beauftragtes Fremdunternehmen die Flächen
betreten bzw. befahren. So entstünde kein
Risiko, dass durch Dritte verursachte Schäden
abgewickelt und beglichen werden müssten.
Da auch die Mitglieder des Umwelt- und
Planungsausschusses geschlossen hinter dem Weg
des Bürokratieabbaus standen, stimmten sie
diesem Beschlussvorschlag der Verwaltung
einstimmig zu. Die endgültige Entscheidung
trifft der Kreistag in seiner Sitzung am 10.
April 2025.
Die Kreise Wesel und Kleve
haben das zuständige Landesministerium für
Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz bereits
auf die bestehende Problematik hingewiesen und
darum gebeten, diese im Rahmen der Novellierung
der Förderrichtlinien angemessen zu
berücksichtigen.
Ziel ist es, künftig
wieder zu einer pauschalen Förderung der
Kopfbaumpflege über eine Festbetragsfinanzierung
zurückzukehren. Dies wäre nicht nur im Sinne
einer effizienteren Mittelverwendung, sondern
würde auch das wertvolle ehrenamtliche
Engagement weiterhin unterstützen.
Moers: Markt zieht vorübergehend auf den
Kastellplatz – Parkverbot an Markttagen
Der Moerser Wochenmarkt ist nicht weg, sondern
nur für knapp fünf Wochen verlegt. Vom 8. April
bis zum 9. Mai findet er dienstags und freitags
sowie wegen Karfreitag am Donnerstag, 17. April,
nicht auf dem Neumarkt, sondern ein paar Meter
weiter auf dem Kastellplatz statt.

Während der Leitungsarbeiten am Neumarkt müssen
die Kundinnen und Kunden auf Frisches vom Markt
nicht verzichten. Die Händler bauen ihre Stände
auf dem Kastellplatz auf. (Foto: Pressestelle)
An den Zeiten ändert sich nichts: Die
Händler bieten ihre Waren von 8 bis 14 Uhr an.
Grund für die Verlegung sind Arbeiten von Enni
am Neumarkt. Die Stromnetze werden erneuert und
Kanäle saniert.
Kein Parken dienstags
und freitags von 5.30 bis 15.30 Uhr
Auf dem
Kastellplatz ist der hintere Bereich für die
Stände reserviert. Deshalb ist dort von 5.30 bis
15.30 Uhr das Parken verboten. Damit der Markt
reibungslos starten kann, müssten dort
abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die
vorderen Reihen können weiterhin als Parkplatz
genutzt werden. Entsprechende Hinweise und
Schilder weisen rechtzeitig auf das Parkverbot
und die Verlegung hin.
Nächste Marktsprechstunde in Meerbeck am 26.
März 2025
Informationen und Beratungen rund ums Ehrenamt
und die Stadtteilentwicklung gibt es bei der
nächsten Marktsprechstunde in Meerbeck am
Mittwoch, 26. März. Von 10 bis 12 Uhr lädt das
Stadtteilbüro Neu_Meerbeck gemeinsam mit der
Freiwilligenzentrale Moers der Grafschafter
Diakonie dazu auf dem Meerbecker Wochenmarkt
(Ecke Lindenstraße/Bismarckstraße) ein.
Neben Tipps und Beratungsmöglichkeiten für
ehrenamtliches Engagement in Meerbeck und
Hochstraß gibt es Infos zu verschiedenen
Freiwilligendiensten, wie dem Freiwilligen
Sozialen Jahr (FSJ), und Einblicke in die
Entwicklung der Stadtteile Meerbeck und
Hochstraß. Interessierte können sich zudem
direkt mit dem Team des Stadtteilbüros
austauschen und mehr über aktuelle Projekte
erfahren.
Für weitere Informationen
steht das Stadtteilbüro Neu_Meerbeck telefonisch
unter 0 28 41/201 – 530 sowie online unter stadtteilbuero.meerbeck@moers.de zur
Verfügung.
vhs Moers –
Kamp-Lintfort: Infos über den Weg zur
klimaneutralen Wärmeversorgung
Wie sieht die Zukunft der klimaneutralen
Wärmeversorgung in Moers aus? Am Dienstag, 1.
April, können sich Bürgerinnen und Bürger von
17.30 bis 19.30 Uhr darüber informieren und
aktiv mitdiskutieren. Im Sitzungssaal des Alten
Landratsamts, Kastell 5b, gibt das Projektteam
Einblicke in den aktuellen Planungsstand und
einen Ausblick auf die Schwerpunkte der
künftigen Wärmeinfrastruktur in Moers.
Die Veranstaltung wird zusätzlich online
übertragen, sodass möglichst viele teilnehmen
können. Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich
anschließend bei Snacks und Getränken über das
Thema auszutauschen. Die Veranstaltung ist eine
Kooperation mit der vhs Moers – Kamp-Lintfort.
Eine Anmeldung ist erforderlich.
Klimagerechte und für alle tragbare Lösung
Die Kommunale Wärmeplanung ist ein strategisches
Planungsinstrument zur Umgestaltung des
Wärmesektors in eine klimaneutrale Zukunft.
Hierbei werden lokale Akteure einbezogen. Eine
gründliche Analyse des Status quo und die
Erhebung von Potenzialen in Moers sollen eine
klimagerechte und für alle Mitbürgerinnen und
Mitbürger tragbare Lösung ermöglichen.
Die Stadt Moers stellt sich dieser
Herausforderung in Kooperation mit der ENNI
Energie & Umwelt Niederrhein GmbH und der BMU
Energy Consulting GmbH. Weitere Informationen
zur Wärmeplanung unter
https://waermeplanung-moers.de/.
Fragen an das Projektteam per E-Mail an waermeplanung@moers.de.
Anmeldungen zur Veranstaltung (im Alten
Landratsamt oder online) bei der vhs Moers –
Kamp-Lintfort unter Telefon 0 28 41 / 201-565
oder online: www.vhs-moers.de (Suchbegriff:
‚Wärmeplanung‘).

NRW-Industrie: 2024 sank die
Mineralwasserproduktion um 2,6 Prozent
Im Jahr 2024 sind nach vorläufigen Ergebnissen
in 19 der 9 747 produzierenden Betriebe des
nordrhein-westfälischen Verarbeitenden Gewerbes
2,1 Milliarden Liter natürliches Mineralwasser
(mit und ohne Kohlensäure) produziert worden.
Die Menge war damit um 2,6 Prozent bzw.
55,9 Millionen Liter niedriger als ein Jahr
zuvor.
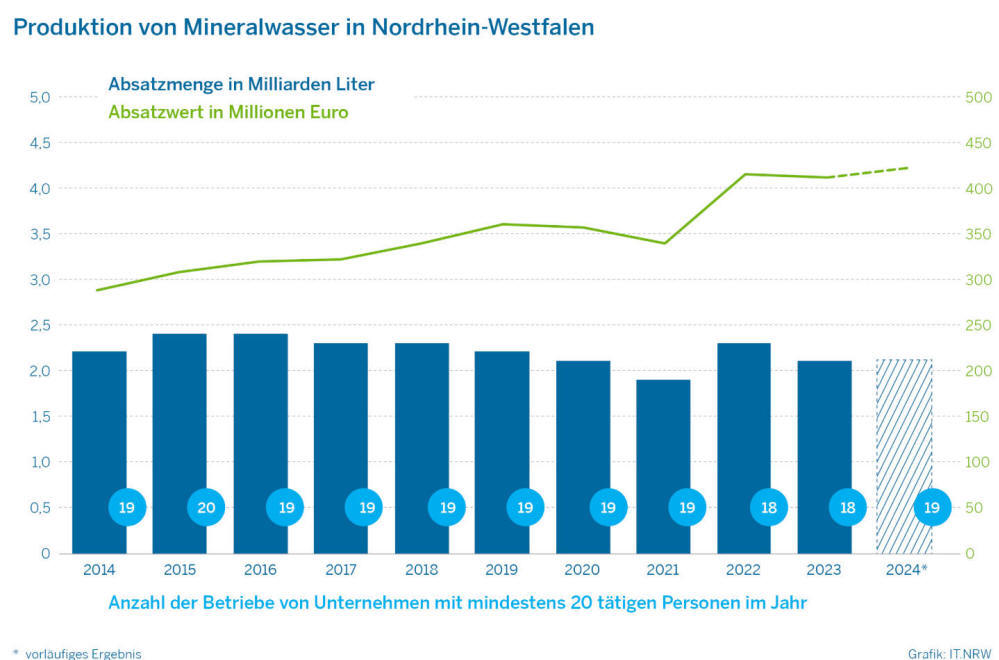
Wie das Statistische Landesamt anlässlich
des „Weltwassertages” am 22. März 2025 mitteilt,
belief sich die Produktionsmenge rein
rechnerisch auf 5,8 Millionen Liter
Mineralwasser pro Tag. Diese Menge würde
ausreichen, um jede Einwohnerin bzw. jeden
Einwohner in Nordrhein-Westfalen täglich mit
einem großen Glas Wasser (0,32 Liter) zu
versorgen.
Die Produktionsmenge ist
seit 2014 annähernd konstant. Im Jahr 2021 war
sie mit 2,0 Milliarden Litern am niedrigsten.
Über 60 Prozent mehr Mineralwasser mit wenig
oder ohne Kohlensäure produziert Von den
2,1 Milliarden Liter Mineralwasser entfielen
etwa 1,3 Milliarden Liter auf Mineralwasser mit
wenig oder ohne Kohlensäure und etwa
820 Millionen Liter auf Mineralwasser mit
klassischem (hohen) Kohlensäuregehalt
(„Sprudel”); im Jahr 2024 wurde damit 60 Prozent
mehr Mineralwasser mit wenig oder ohne
Kohlensäure produziert als Sprudelwasser.
Der überwiegende Teil der Produktion im
Jahr 2024 (98,3 Prozent) war für den Absatz
bestimmt. Die restlichen 1,7 Prozent wurden von
den produzierenden Betrieben in NRW zu anderen
Getränken (z. B. Schorle, Limonade u. Ä.)
weiterverarbeitet. Die Regierungsbezirke
Düsseldorf und Detmold hatten den größten Anteil
an der NRW Produktion 1,5 Milliarden Liter bzw.
71,1 Prozent der NRW-Produktion von
Mineralwasser entfielen auf Betriebe der
Regierungsbezirke Düsseldorf und Detmold.
Durchschnittlicher Absatzwert seit 2014
um über 50 Prozent gestiegen Die zum Absatz
bestimmte Menge des 2024 in NRW hergestellten
Mineralwassers hatte einen Wert von
420,3 Millionen Euro; das waren nominal
10,5 Millionen Euro bzw. 2,6 Prozent mehr als
ein Jahr zuvor. Der durchschnittliche Absatzwert
je Liter Mineralwasser betrug 20,0 Cent und war
damit um 4,7 Prozent höher als 2023.
Gegenüber den Jahr 2014 stieg er um nominal
52,8 Prozent (damals: 13,1 Cent je Liter). Rund
18 Prozent der gesamtdeutschen Produktion
entfiel auf NRW Bezogen auf das Jahr 2023, für
welches bereits endgültige Ergebnisse auf
Bundesebene vorliegen, lag der NRW-Anteil an der
bundesweiten Produktion von Mineralwasser von
damals 12,5 Milliarden Litern bei 17,6 Prozent.
3,4 Millionen neue Autos im
Jahr 2024 aus Deutschland exportiert
• 3,4 Millionen neue Pkw im Wert von 135,0
Milliarden Euro exportiert
• 25,9 % davon
waren reine E-Autos • Importiert wurden 1,8
Millionen neue Pkw
Im Jahr 2024 wurden
rund 3,4 Millionen neue Pkw im Wert von 135,0
Milliarden Euro aus Deutschland exportiert.
Damit stieg der Export mengenmäßig im Vergleich
zum Jahr 2023 um 2,5 % an. Wertmäßig ging der
Export von neuen Pkw leicht um 1,3 % zurück. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
waren das größte Abnehmerland die Vereinigten
Staaten mit einem Anteil von 13,1 % aller
exportierten neuen Fahrzeuge. Auf den Rängen
zwei und drei folgen das Vereinigte Königreich
(11,3 %) und Frankreich (7,4 %).
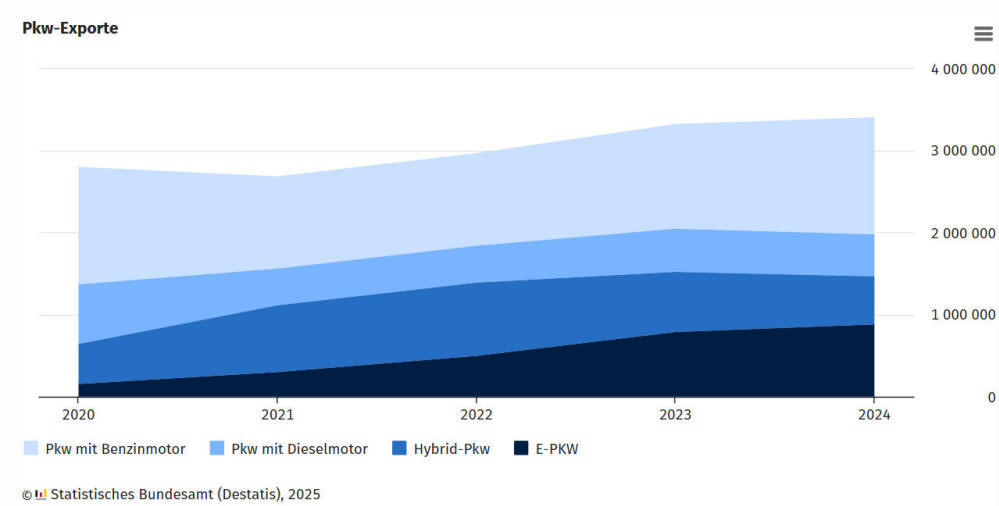
881 000 exportierte Pkw waren reine E-Autos
Der Export von Pkw, die ausschließlich
elektrisch betrieben werden, nahm im Jahr 2024
mengenmäßig um 11,9 % auf 881 000 Pkw zu und
erreichte damit einen Anteil von 25,9 % an allen
exportierten Pkw. Wichtigste Antriebsart bei den
exportierten Automobilen war wie in den
Vorjahren der Benzinmotor mit einem Anteil von
42,0 % (1,4 Millionen Pkw). Hybridfahrzeuge
erzielten einen Anteil von 17,2 % (584 000 Pkw),
gefolgt von Dieselfahrzeugen mit einem Anteil
von 15,0 % (512 000 Pkw).
1,8 Millionen
neue Pkw importiert
Nach Deutschland
importiert wurden im Jahr 2024 insgesamt 1,8
Millionen neue Pkw. Gegenüber dem Vorjahr 2023
sanken die Einfuhren mengenmäßig um 11,5 % und
wertmäßig um 12,8 %. Auch bei den importierten
Fahrzeugen war der Benzinmotor die häufigste
Antriebsart mit 40,3 % oder 742 000 Pkw, gefolgt
vom Dieselmotor mit 24,4 % der importierten
Fahrzeuge. Hybridfahrzeuge machten einen Anteil
von 22,0 % und reine E-Autos von 13,3 % aus. Die
Importe von Pkw mit reinem Elektromotor (244 000
Pkw) gingen im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023
um 46,0 % zurück (2023: 451 000 Pkw).
Freitag, 21. März
2025
Kreis Kleve: Bunte Socken markieren den
Welt-Down-Syndrom-Tag
Mit bunten
Socken machen Landrat Christoph Gerwers sowie
die Bürgermeisterin und Bürgermeister auf den
Welt-Down-Syndrom-Tag am 21.03. aufmerksam.

Viele bunte Socken bei der Konferenz der
Bürgermeisterin und Bürgermeister und des
Landrats des Kreises Kleve. Foto: ©Gemeinde
Kranenburg – Ann-Cathrin Coenen Landrat,
Bürgermeisterin und Bürgermeister beteiligen
sich am Aktionstag
Das Datum steht
für Trisomie 21 – eine Chromosomenstörung, die
ein zusätzliches Chromosom 21 hervorruft,
welches dann beim Genträger in dreifacher Form
vorhanden ist. An diesem Aktionstag wird
weltweit für Chancengleichheit und
Selbstbestimmung geworben. Das Tragen
verschiedenfarbiger Socken wurde in den
vergangenen Jahren zum Symbol des
Welt-Down-Syndrom-Tages.
Bei der
„Bunte-Socken-Aktion“ geht es darum, die
Vielfalt und Einzigartigkeit eines jeden
Menschen als Bereicherung der Gesellschaft zu
sehen. „Wir möchten mit dieser einfachen, aber
wirkungsvollen Geste zeigen, dass Vielfalt
unsere Gesellschaft bereichert. Es ist normal,
verschieden zu sein – und genau das feiern wir
heute!“, betont Landrat Christoph Gerwers.
Niklas Beyer, Inklusionsbeauftragter des
Kreises, lädt dazu ein, sich an der Aktion zu
beteiligen: Am 21. März zwei verschiedene Socken
tragen, ein Foto davon machen und es mit den
Hashtags #bunteSockenfürVielfalt und #WDSD25
teilen.
Dunkel wird’s in Dinslaken:
Earth Hour findet am 22. März statt
In der Stadt wird es auch in diesem Jahr wieder
für eine ganze Stunde dunkel, das Licht am
Rathaus, im Stadthaus, im Museum und an der
Kathrin-Türks-Halle wird ausgeschaltet. Ein
starkes Zeichen für den Klimaschutz.
Am
Samstag, den 22. März 2025, um 20.30 Uhr, findet
unter dem Motto „Licht aus. Stimme an. Für einen
lebendigen Planeten.“ die nächste Earth Hour
statt. Diese weltweite Aktion fordert Menschen,
Unternehmen und Städte dazu auf, das Licht
auszuschalten, um die Dringlichkeit des
Klimaschutzes zu verdeutlichen.
Die
Earth Hour hat in den letzten Jahren an
Bedeutung gewonnen, da die Auswirkungen des
Klimawandels immer offensichtlicher werden.
Waldbrände, Dürren und Überflutungen haben uns
erneut die dramatischen Folgen der Klimakrise
vor Augen geführt. Dieses Jahrzehnt wird
entscheidend dafür sein, ob wir die Erderhitzung
auf ein kontrollierbares Maß begrenzen können,
andernfalls drohen vermehrte
Extremwetterereignisse, der Verlust von
Lebensräumen und das Aussterben vieler Arten.
Um auf diese bedrohliche Entwicklung
aufmerksam zu machen, bleiben weltweit berühmte
Bauwerke sowie Büros, Häuser und Wohnungen für
eine Stunde dunkel. Auch die Stadt Dinslaken
schließt sich dieser globalen Bewegung an. Die
Besonderheit in unserer Stadt: Die Gebäude
bleiben die ganze Nacht verdunkelt.
Der
WWF und die Stadt Dinslaken rufen alle
Bürgerinnen und Bürger auf, sich aktiv an der
Earth Hour 2025 zu beteiligen und auch das Licht
in den eigenen vier Wänden auszuschalten.
Kerzenlicht sorgt dabei für eine stimmungsvolle
Atmosphäre. Jeder Beitrag zählt, um ein Zeichen
für den Klimaschutz zu setzen und die politische
Unterstützung für dringende Klimamaßnahmen zu
stärken. Machen Sie mit!
Infoveranstaltung zur kommunalen
Wärmeplanung in Moers
Referenten/Referentin: Daniel Rosengarten, Björn
Uhlemeyer, Larissa Schlie Nordrhein-Westfalen
hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis
2045 klimaneutral zu wirtschaften. Ein
entscheidender Schritt ist dabei die Wärmewende
mit erneuerbaren Energien. Seit Inkrafttreten
des Landeswärmeplanungsgesetzes am 19. Dezember
2024 sind alle Gemeinden des Landes
verpflichtet, kommunale Wärmepläne zu erstellen.
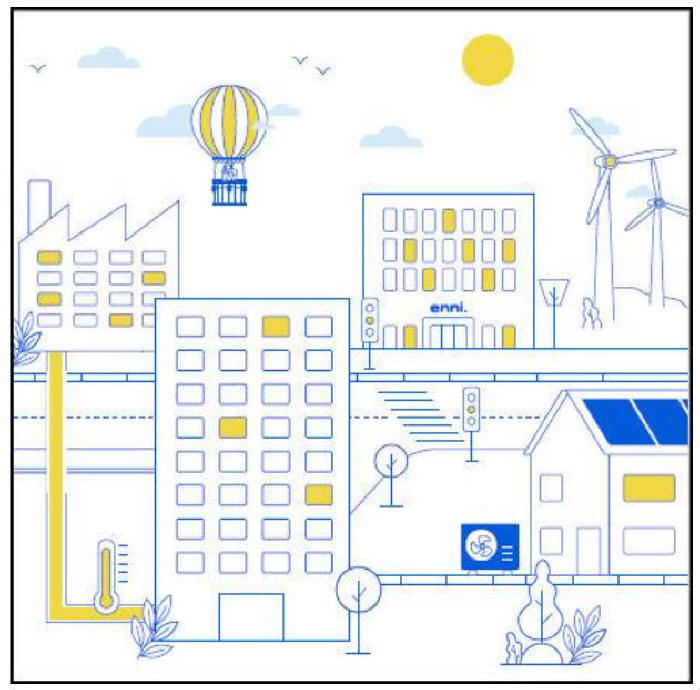
Die Stadt Moers, mit über 100.000
Einwohnern, muss ihren Plan bis zum 30. Juni
2026 vorlegen. Bereits im Juli 2024
unterzeichneten Bürgermeister Christoph
Fleischhauer, ENNI-Vorstand Stephan Krämer und
Dr. Kai Steinbrich eine Vereinbarung, die den
Grundstein für die strategische Wärmeplanung
legte. Seit September 2024 arbeitet ein
Projektteam aus Mitarbeitenden der
Stadtverwaltung, der ENNI und der BMU Energy
Consulting GmbH an einem umfassenden Plan, um
eine flächendeckende, klimaneutrale
Wärmeversorgung für Moers sicherzustellen.
Im Rahmen dieser Infoveranstaltung
informiert das Projektteam über den aktuellen
Planungsstand und gibt einen Ausblick auf die
Schwerpunkte der künftigen Wärmeinfrastruktur in
Moers. Die Veranstaltung findet hybrid statt,
sodass möglichst viele Interessierte teilnehmen
können. Teilnehmende vor Ort haben im Anschluss
die Möglichkeit, bei einer leichten Verpflegung
in den Austausch zu treten.
Bei
Fragen an das Projektteam, können Sie sich gerne
per Mail an waermeplanung@moers.de wenden.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über die
Zukunft der klimaneutralen Wärmeversorgung in
Moers zu informieren und aktiv mitzudiskutieren!
In Kooperation mit dem Fachdienst
Freiraum- und Umweltplanung der Stadt Moers.
Kurs Nr.: F10430E Eine Anmeldung ist unbedingt
erforderlich. Falls Sie online teilnehmen
wollen, geben Sie das bitte bei der Anmeldung
an. Der Link wird Ihnen zwei Tage vor der
Veranstaltung zugesandt. Die Veranstaltung ist
kostenlos. Veranstaltungsdatum 01.04.2025 -
17:30 Uhr - 20:30 Uhr. Veranstaltungsort Altes
Landratsamt.
Moers: Verdiente
Schiedsleute beim Amtsgericht verabschiedet
Zu ihrer regelmäßigen Versammlung trafen sich
die Schiedsleute der Städte Moers und
Neukirchen-Vluyn am Donnerstag, 13. März, in den
Räumlichkeiten des Amtsgerichts Moers. Bei dem
Treffen dankten der stellvertretende Direktor
des Amtsgerichts Bernhard Schröer und
Diplom-Rechtspflegerin Sina Gidaszewski den
ausgeschiedenen Schiedspersonen für ihre
langjährige Tätigkeit.

(Foto: pst)
Ausgeschieden sind Alfred
Mock und Werner Louven. Mock war Schiedsmann im
Bezirk 5 (Hochstraß, Scherpenberg). Sein
Nachfolger ist Jürgen Klein. Louven war im
Bezirk 4 (Hülsdonk, Moers-Mitte) tätig, den nun
Jan-Wilhelm Sperveslage übernommen hat. Beide
Schiedsmänner haben sich durch ihren Einsatz für
sachgerechte Einigungen um das Wohl der Stadt
Moers verdient gemacht.
Die
insgesamt sieben Schiedsfrauen und Schiedsmänner
der Stadt Moers üben ebenso wie die zwei
Schiedspersonen der Stadt Neukirchen-Vluyn eine
wichtige Aufgabe für den Rechtsfrieden aus.
Insbesondere in nachbarrechtlichen
Streitigkeiten gelingen den Schiedspersonen
immer wieder schnelle, kostengünstige und
pragmatische Lösungen, die allen Beteiligten den
Gang zum Gericht ersparen können.
Entwicklung des Innovationscampus Wesel
geht weiter voran – erste Projekte mit lokalen
Unternehmen beantragt
Zur aktuellen
Entwicklung am Innovationscampus Wesel hat die
Stadt Wesel gemeinsam mit Vertretern der
Hochschulen, dem Beratungsunternehmen Hattinger
Büro und der Firma LASE PeCo Systemtechnik GmbH
die Ratsmitglieder in der Ratssitzung am 18.
März 2025 ausführlich informiert.
Die
Kooperation der Hochschulen Rhein-Waal (HSRW)
und Ruhr-West (HRW) mit lokalen Unternehmen in
Wesel hat bereits vor der offiziellen Gründung
des Innovationscampus zu gemeinsamen Projekten
geführt, die mit Fördergeldern umgesetzt werden
sollen.
So wurde auf Basis von
Rückmeldungen der Unternehmen im Förderprogramm
„Innovationswettbewerb NeueWege.IN.NRW“ im
Februar 2025 ein Antrag mit einem Fördervolumen
von über 2,5 Millionen Euro eingereicht. Der
Fokus liegt auf einer Verkehrsflussmessung im
Gewerbegebiet „Am Schornacker“.
Um für
alle Verkehrsteilnehmenden den Verkehrsfluss zu
optimieren und die Risiken zu minimieren, soll
ein digitaler Zwilling mit der dafür notwendigen
Sensorik für das Gewerbegebiet entwickelt
werden. Beteiligt sind das Weseler Unternehmen
LASE PeCo Systemtechnik GmbH, die Hochschule
Ruhr-West und die Bergische Universität
Wuppertal.
„Die Technologie wird in Wesel
und für alle Verkehrsteilnehmenden vor Ort
weiterentwickelt“, so Henry Florin,
Geschäftsführer der LASE PeCo gestern – „Ohne
den Impuls aus dem InnoCampus hätten wir dieses
schlagkräftige Antragskonsortium für Wesel nicht
zusammen bekommen.“
Und ein zweites
Förderprojekt im Förderprogramm „Nachhaltige
Städtische Mobilität für alle“ knüpft daran an.
Hier werden Maßnahmen einer zukunftssicheren und
nachhaltigen Modernisierung des Verkehrssystems
in Städten und Regionen gefördert. Die Stadt
Wesel beantragt mit Unterstützung der Expertise
im Innovationscampus und den beteiligten
Forschungsinstituten die Umgestaltung der völlig
in die Jahre gekommenen Grünstraße.
Ergänzend zu investiven städtebaulichen
Maßnahmen sollen die Verkehrsflüsse im
Stadtgebiet in einem digitalen Zwilling
abgebildet werden, um zukünftige Entscheidungen
zu Sanierung, Modernisierung und Neugestaltung
des Verkehrsraums auf einer wesentlich besseren
Datengrundlage treffen zu können.
Darüber hinaus wurde ein Qualifizierungsangebot
“Modulare Bildungsangebote“ vorgestellt. Die
Hochschulpartner, lokale Unternehmen, die
Bundesagentur für Arbeit und die Volkshochschule
entwickeln ein für alle Bildungswege offenes
Karriereprogramm für Schüler*innen,
Auszubildende, Studierende und Fach- und
Führungskräfte aus Wesel.
„Der
Innovationscampus in Wesel zeigt schon jetzt
sehr deutlich, welchen Mehrwert die Kooperation
für die Unternehmen und die Stadt bringen kann –
und wir stehen damit erst am Anfang!“, fasst
Professor Oliver Locker-Grütjen, Präsident der
HSRW, die vielfältigen Aktivitäten der letzten
Monate zusammen.
Hintergrundinformationen
zum Innovationscampus Wesel
In enger
Kooperation mit den benachbarten Hochschulen
Rhein-Waal (HSRW) und Ruhr-West (HRW) wird der
Innovationscampus von der Stadt Wesel entwickelt
als Plattform zur Zusammenarbeit zwischen der
lokalen Wirtschaft und den Hochschulen der
Region.
Auf Initiative von Rainer
Benien, Beigeordneter der Stadt Wesel, und
Wendelin Knuf, Wirtschaftsförderer der Stadt
Wesel, wurde das Konzept seit 2023 in engem
Austausch mit Professor Dr. Oliver
Locker-Grütjen, Präsident der HSRW, und der
Expertise des Beratungsunternehmens HATTINGER
BÜRO GmbH ausgearbeitet. Der Rat der Stadt Wesel
hat die Umsetzung einstimmig befürwortet.
Seither treiben die Stadt Wesel und die
Hochschulen den Innovationscampus Wesel unter
Einbindung der lokalen Unternehmen mit Nachdruck
voran.
Perspektivisch sollen auch
Räumlichkeiten für den Austausch von
Wissenschaft, Unternehmen und Bürger*innen als
Innovationszentrum in Wesel entstehen. Hierfür
bietet ein Neubau der Niederrheinhalle in der
Kombination mit Forschungs-, Entwicklungs- und
Lehrmöglichkeiten für die umliegenden
Hochschulen ideale Voraussetzungen.
Ein
Architekturbüro wurde mit einer Vorplanung inkl.
Kostenschätzung für den Innovationscampus Wesel
inkl. einer Stadthalle beauftragt. Derzeit
finden dazu Abstimmungen mit den beteiligten
Hochschulen statt.
Inhaltlich fokussiert
der Innovationscampus Wesel auf die Themen
Nachhaltigkeits-transformation und Logistik, die
für die Region von zentraler Bedeutung sind.
Hier braucht es dringend zukunftsfähige Ansätze
für die Region, die am Innovationscampus
anwendungsbezogen und im engen Austausch mit den
Unternehmen in der Region entwickelt werden. Für
erste konkrete Projekte haben die
Projektbeteiligten erste Fördermittel zusammen
mit lokalen Unternehmen beantragt.
Das
Interesse und das Engagement der Unternehmen in
Wesel ist enorm und zeigt den großen Bedarf. Es
haben bereits über 20 Unternehmen ihre
Beteiligung durch eine Absichtserklärung (Letter
of Intent) unterstrichen und laufend kommen
weitere interessierte Unternehmen hinzu. Bei
Interesse wenden Sie sich gerne an die
Wirtschaftsförderung der Stadt Wesel.
Moers: Keine Bereitschaft zur vollen
Kostenübernahme bei Dualen Systemen
Verwaltungsrat entschied schrittweisen Abzug von
wenig genutzten Containern
Die im
Moerser Stadtgebiet verteilten Glascontainer
sind bei Bürgern beliebt. An den Standorten hat
die ENNI Stadt & Service aber hohe
Reinigungsaufwände und Kosten, die die für die
Verwertung von Verpackungsabfällen zuständigen
Dualen Systeme nicht in einem angemessenen
Verhältnis tragen wollen. Um Kosten zu senken,
beschloss der Verwaltungsrat der Enni daher
gestern in der ersten Sitzung des Jahres 13 der
heute 55 Containerstandorte bis 2026
stufen-weise zurückzubauen.
•
Erweitern wird Enni hingegen den Nutzungskatalog
für ihre Sport- und Bädereinrichtungen. Gestern
beschloss der Verwaltungsrat auf-grund der
gestiegenen Nachfrage, dass Privatpersonen und
Unternehmen neben den großen Hallen gegen eine
Gebühr jetzt auch Locations wie das Foyer der
Eventhalle, die komplette Swingolf-Anlage oder
die Wiese im Freibad So-limare zu festen
Entgelten anmieten können. Auch hier wird Enni
bei Veranstaltungen mit gemeinnützigem oder
nicht kommerziellem Hintergrund eine
Sonder-kondition einräumen.
• Weiter
beschloss das Gremium, drei städtische
Trinkwasserbrunnen zu betreiben und den
gesetzlich geforderten Gleichstellungsplan
fortzuschreiben. Mit dem hält Enni an den
Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der heute bei 15
Prozent liegenden Frauenquote im Unternehmen
festhielt.
• Zudem gaben der
Vorstandsvorsitzende Stefan Krämer und seine
Kollegen Lutz Hormes und Dr. Kai Gerhard
Steinbrich dem Gremium gestern mehrere
Sach-standsberichte etwa zur Sanierung des
Hauptfriedhofes in Hülsdonk oder der Moerser
Innenstadt sowie zur Aufwertung des
Freizeitstandortes Solimare. „All diese Projekte
zahlen auf unsere Ziele ein, die Moerser
Infrastruktur für die Zukunft zu rüsten und
Mehrwerte für Bürger zu schaffen“, sagt Krämer.
• Gestern diskutierte der Verwaltungsrat
zunächst zu Maßnahmen an den im Stadtgebiet
verteilten Containerstandorten und den hier
durch den Rat der Stadt zunächst gewünschten
neuen Befestigungen an fünf Stellplätzen. Wegen
der hohen Kosten wird Enni diese zunächst
zurückstellen. Denn für die Reinigung der
Standorte würde das Unternehmen laut Lutz Hormes
durch die verantwortlichen Dualen Systeme seit
2002 eine unveränderte, nicht kostendeckende
Pauschalvergütung erhalten. Dies habe bei
wöchentlicher Reinigung allein im Vorjahr zu
einer nicht mehr vertretbaren Unterdeckung von
74.000 Euro geführt.
Da es in
mehreren Verhandlungsrunden keine Einigung mit
den Vertretern der Dualen Systeme gegeben habe,
empfahl der Vorstand zunächst testweise an den
fünf heute gering frequentierten beziehungsweise
mit Problemen behafteten Standorten, Am Impler
Berg in Repelen, Hinter dem Acker in
Moers-Rheinkamp, der Dr.-Berns-Straße im
Gewerbegebiet Hülsdonk, der Waldstraße in
Schwafheim und Im Ohl in der Stadtmitte, die
Container noch 2025 abzuziehen.
Dabei vereinbarte das Gremium, vor dem Abzug
weiterer Container hier die Auswir-kungen auf
die verbleibenden Plätze zu beobachten und über
die Ergebnisse im neuen Jahr zu berichten.
Weiter diskutierte der Verwaltungsrat gestern
über die drei neue Trinkwasserbrunnen, die Enni
im Auftrag der Stadt Moers am Königlichen Hof,
auf dem Rathausvorplatz und auch an der
Skaterbahn im Freizeitpark aufstellen wird.
Der Verwaltungsrat entschied dabei, dass
Enni den Betrieb übernimmt. Wie Dr. Kai Gerhard
Steinbrich informierte, werden die Brunnen
jährlich in der frostfreien Zeit von April bis
Oktober aufgestellt sein. Die einwand-freie
Trinkwasserqualität wird Enni durch eine
regelmäßige Reinigung und Be-probung der Anlagen
sicherstellen.
• Weiter berichtete
Dr. Kai Gerhard Steinbrich über die auf
Hochtouren laufenden Vorbereitungen der Ende
April im nördlichen und südlichen Teil der
Fieselstraße startenden Hauptmaßnahme zur
Sanierung der Moerser Innenstadt. Hier habe Enni
mittlerweile in 39 Abschnitten, wie der
Friedrich- oder der Niederstraße, Schmutz- und
Regenwasserkanäle wegen des noch vorhandenen
Gefälles und des Zustandes der Kanäle grabenlos
sanieren können.
• Aktuell liefen
Maßnahmen rund um den Neumarkt. In drei
Bauabschnitten werde Enni hier die Schmutz- und
Regenwasserkanäle auf dem Parkplatz und den
beidsei-tig daran verlaufenden Straßen ebenfalls
im sogenannten Liner-Verfahren ohne Erdarbeiten
sanieren. Dabei werde Enni zwischen der
Unterwall- und der Stein-straße parallel zum
Modehaus Braun und in einem kleinen Abschnitt im
Fahrstreifen am Ärztehaus ab Anfang April auch
die Stromleitungen erneuern.
Während
Autofahrer den Neumarkt dabei durchweg anfahren
können, würde der Verkehr über eine
Ersatzfahrspur über den Neumarkt geleitet und
ein Teilstück der Straße vor dem Ärztehaus und
der Parkplatz ab dem 7. April sechs Wochen
gesperrt. „In dieser Zeit entfallen die
Parkplätze und der Wochenmarkt wird dienstags
und freitags in den hinteren Bereich des
Kastellplatzes umziehen“, sagt Steinbrich.
„Fahrzeuge können dort die ersten Reihen des
Platzes aber auch an Markttagen nutzen.“ Allen
Beteiligten sei dabei bewusst, dass das Um-feld
rund um den Neumarkt besonders sensibel ist. Die
Marktbeschicker wurden deswegen vorab bereits
informiert.
• Lutz Hormes berichtete
auch zu seinen Projekten am Freizeitstandort
Solimare und auf dem Hauptfriedhof in Hülsdonk.
Während Enni für die Erweiterung des
Wohnmobilstellplatzes auf dann 29 Plätze, die
Freiraumplanung mit Grillareal, Hundewiese und
Kletterpark im Solimare sowie die Sanierung der
Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof Hülsdonk
aktuell die Ausschreibung der Bauleistungen
vorbereite, würde die energetische Sanierung in
der Moerser Eishalle nach dem Saisonende nun
starten.
• Rund eine Million Euro nimmt
Enni für die Sanierung der Firstkonstruktion in
die Hand, bei der die Monteure die
Glaskuppelkonstruktion demontieren und durch
eine lichtundurchlässige Dacheindekung schließen
würden. Zudem bekommt die Eishalle eine neue
Isolierung der Außenhaut, indem das vorhandene
Mauerwerk eine Wärmedämmung und Klin-kerriemchen
erhält.
Auch die Fenster in den
Fassadenflächen tauscht Enni über den Sommer
gegen eine dann komplett geschlossene Fassade
aus. Energie-sparend werden auch der Austausch
von Flucht- und Rettungswegtüren wirken. „Obwohl
wir im Bauablauf die Nutzung der Halle bei der
Baumesse und beim Moers Festival berücksichtigen
müssen, rechne ich mit der rechtzeitigen
Fertigstellung des Umbaus zur neuen Saison im
Herbst.“
Letztlich blickte Lutz Hormes
auf die durch Enni betriebenen Sport- und
Bädereinrichtungen. Die beiden Freibäder, das
Hallenbad des Enni-Sportparks Rheinkamp und die
Eishalle hätten auch 2024 ein erfreuliches Plus
an Gästen verzeichnet. „Hier kommen unsere
Angebote nach den Coronajah-ren immer besser an
und die ausreichende Zahl an Rettungsschwimmern
ermöglicht uns eine bessere Auslastung der
Anlagen“, so Hormes.
• Ab Mai ändern
sich dabei die Eintrittspreise in den meisten
Bädern, die sich nach ei-nem Gremienbeschluss
entsprechend der Inflationsrate anpassen, wenn
die Kostensteigerung eine 20-Cent-Schwelle
erreicht hat. Während das Ticket im Bettenkamper
Meer mit 3,20 Euro weiter stabil bleibt, wird
Enni die Preise im Sportpark Rheinkamp genau wie
im Aktivbad Solimare um zehn Cent auf 4,50 Euro
anheben. Im Solimare kostet der Freizeitspaß mit
5,60 Euro ebenfalls 10 Cent mehr als in der
letzten Saison. Der Eintritt für Kinder steigt
um 20 Cent auf 3,40 Euro. Insgesamt ist Hormes
überzeugt, dass bei gutem Wetter auch die
kommende Freibadesaison wieder erfolgreich sein
wird.
Landrat Ingo Brohl besucht das Unternehmen DeGIV
GmbH in Kamp-Lintfort
Im Rahmen der
Unternehmensreihe „Digitalstandort Kreis Wesel“
der kreiseigenen Entwicklungsagentur Wirtschaft
(EAW) hat Landrat Ingo Brohl am Donnerstag, 13.
März 2025, die DeGIV GmbH in Kamp-Lintfort
besucht. Die von Dieter Rittinger im Jahr 2013
gegründete Firma startete mit der Idee eine
anwenderorientierte, im Gegensatz zu PC und
Smartphone sozialdatensichere
Interaktionsplattform für alle Menschen
anzubieten.
Niedrigschwelliger,
diskriminierungsfreier Zugang für alle
Bevölkerungsgruppen, die Wahrung der
Privatsphäre sowie eine neutrale,
sektorenübergreifende, multifunktionale und
dadurch höchst kosteneffiziente Servicestruktur
für Institutionen und Dienstleister. Mehr als
300 standortindividuelle Digitale Servicepunkte
bilden seit 2014 als Patiententerminal,
Bürgerterminal oder Gesundheitsterminal in einem
die Grundlage für mehr digitalen
Sozialdatenservice.
Gründer und
Geschäftsführer Dieter Rittinger,
Vertriebsleiter Roman Markus Wygas und IT-Leiter
Julian Schultz stellten Landrat Ingo Brohl und
EAW Leiter Lukas Hähnel ihr Terminal-System vor
und demonstrierten dessen Nutzung. „Der
steigende Kostendruck bei demografischem Verlust
von Personal in Kommune und bei gesetzlichen
Krankenversicherung führt zu
Serviceeinschränkungen wie kürzeren
Geschäftszeiten, Zentralisierung und
Schließungen von Geschäftsstellen.
Es
braucht eine gemeinsam genutzte, gemeinsam
finanzierte und zukunftsfähige, sichere
Interaktionsplattform, welche allen
Bevölkerungsgruppen die informationelle Teilhabe
einer modernen Versorgung und Transformation von
Servicestrukturen ermöglichen. Dafür haben wir
eine einzigartige Lösung entwickelt.“ so Dieter
Rittinger, Geschäftsführender Gesellschafter
Mit diesem System können Bürgerinnen und
Bürger von jedem Terminal-Standort aus unter
Zuhilfenahme ihres Personalausweises oder ihrer
Gesundheitskarte direkt Vorgänge mit ihrer
Kommune oder ihrer Krankenversicherung
abwickeln. Das Prinzip: Der Vorgang muss dabei
für Jeden so einfach sein, wie Geld abzuheben.
Landrat Ingo Brohl: "Die DeGIV GmbH
zeigt eindrucksvoll, wie digitale Innovationen
dazu beitragen können, den Zugang zu wichtigen
Dienstleistungen für alle Bürgerinnen und Bürger
zu erleichtern. Besonders beeindruckend ist, wie
hier ein sicherer und barrierefreier Zugang zu
Verwaltungs- und Gesundheitsleistungen
geschaffen wird. Solche praxisnahen Lösungen
stärken nicht nur die digitale Infrastruktur,
sondern auch den gesamten Digitalstandort Kreis
Wesel."
Mit der Unternehmensreihe
„Digitalstandort Kreis Wesel“ möchte die EAW die
Vielfalt und Bedeutung der Softwarebranche am
Niederrhein sichtbar machen, Einblicke in die
Arbeitsweise der Unternehmen gewinnen und den
Dialog über Chancen und Herausforderungen
stärken.

v.l.: Dieter Rittinger (Geschäftsführer und
Gründer), Roman Markus Wygas (Vertriebsleiter),
Landrat Ingo Brohl, EAW Leiter Lukas Hähnel
Dinslaken: Tridiculous – am 28. März
in der KTH
Tridiculous treten am 28. März in der KTH auf
Geballte Kraft und Dynamik, Musikalität und eine
ordentliche Portion Humor: das ist Tridiculous.
Die smarten Typen mit vielen Skills treten am
28. März in der Kathrin-Türks-Halle auf. Einlass
ist um 19:00 Uhr und Beginn ist um 20:00 Uhr.

Ob Breakdance, Aerial oder Slapstick, ob
Beatbox, Strapaten oder Hand-auf-Hand, ob
Gesang, Pole oder Comedy, die Jungs aus Berlin
beherrschen ihr Fach, mixen ihr Können mit
authentischer Spielfreude und kreieren so
einzigartige Spektakel.
Überdies
sind sie gelebte Multikultur: Ein in Tel-Aviv
aufgewachsener Russe und zwei Ukrainer, die in
der Berliner Breakdance-Szene zuhause waren.
Gemeinsam entwickeln sie ihre Ideen von Kunst
und Entertainment, zu einer Show, die mit Musik,
Artistik, Comedy und ungebremster Energie rockt,
bebt und berührt.
Die drei
internationalen Multitalente spielen zudem all
ihre Fähigkeiten aus und nutzen ihren
spitzbübischen Spieltrieb. Warum nicht den
Schwung des Saltos nutzen, um dabei das
Schlagzeug zu spielen? Warum Musik aus der
Konserve, wenn man seine Artistik musikalisch
und gesanglich auch selbst live begleiten kann?
Schnell, spektakulär, sprunggewaltig
-Tridiculous präsentieren eine rasante Show, die
fasziniert, verzaubert und begeistert!
Bücherflohmarkt Stadtbücherei Kleve am
Samstag, 29. März
Am Samstag, 29. März 2025 wird von 10:00 bis
13:00 Uhr wieder ein Medien- und Bücherflohmarkt
in der Stadtbücherei Kleve, Wasserstraße 30-32,
stattfinden. Angeboten werden Romane, Kinder-
und Sachbücher sowie DVDs und CDs zu kleinen
Preisen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen,
den Bücherflohmarkt zu besuchen. Der reguläre
Ausleihbetrieb findet parallel wie gewohnt von
10:00 bis 13:00 Uhr statt.
Beim
Frauenempfang der Stadt Wesel blieb kein
Lachmuskel verschont
Der
traditionelle Frauenempfang der Stadt Wesel
anlässlich des Internationalen Frauentages war
auch in diesem Jahr wieder ein wahres Fest der
Fröhlichkeit! Am Samstag, 1. März 2025,
verwandelte sich der Ratssaal der Stadt Wesel in
ein buntes und spritziges Highlight.

Mitten in der närrischen Zeit wurde die
Veranstaltung zu einer ausgelassenen
„Damensitzung“, die vor Humor nur so sprühte.

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Wesel hatte
in diesem Jahr die Kabarettistin und
Eselordenträgerin Anka Zink eingeladen. Mit
Auszügen aus ihrem aktuellen Programm
„KO-Komplimente“ brachte sie das Publikum mit
einem Feuerwerk scharfsinniger Pointen zum
Lachen.
Die rund 200 Frauen, die den
Vormittag im Rathaus der Stadt Wesel
verbrachten, erlebten eine unvergessliche
Veranstaltung voller Heiterkeit und guter Laune.
Frauen und Gleichstellung
vhs Moers – Kamp-Lintfort:
Kennenlern-Workshop KEN-DAO
Präzision, Schnelligkeit, Kraft und
Bewegungsästhetik spielen in der Schwertkunst
eine besondere Rolle. Einen Einblick in KEN-DAO,
die Schwertkunst der Achtsamkeit, bietet die vhs
Moers – Kamp-Lintfort Interessierten am Samstag,
29. März, ab 14 Uhr bei einem
Kennenlern-Workshop.
Mit einem
Bokken, einem japanischen Holzschwert, üben die
Teilnehmenden grundlegende dynamische und
meditative Techniken. Veranstaltungsort ist das
Gymnasium Adolfinum, Wilhelm-Schroeder-Straße
4.
Mitzubringen sind Sportkleidung,
Hallenschuhe und eine Bodenunterlage. Bokken
werden zur Verfügung gestellt. Interessierte
können sich für den Workshop telefonisch unter 0
28 41/201 – 565 und online unter www.vhs-moers.de anmelden.
Moers: Sportausschuss und
Schulausschuss tagen im März
Einen Bericht über die aktuellen Baumaßnahmen
erhalten die Mitglieder des Sportausschusses am
Freitag, 21. März. Die Sitzung findet um 16 Uhr
im Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1,
statt. Zudem entscheidet der Ausschuss über die
Ehrungen für hervorragende Verdienste in der
Sportführung.
Am darauffolgenden
Montag, 24. März, tagt der Schulausschuss
ebenfalls um 16 Uhr im Ratssaal. Themen sind
unter anderem die Baumaßnahmen an der
Anne-Frank-Gesamtschule und am Gymnasium in den
Filder Benden sowie die Anmeldezahlen an den
weiterführenden Schulen. Beide Ausschüsse tagen
öffentlich.
vhs Moers –
Kamp-Lintfort: Experimentieren mit verschiedenen
Drucktechniken
Im April bietet die vhs Moers – Kamp-Lintfort
gleich zwei Kurse rund ums Thema Drucken an. Am
Freitag, 4. April, stehen mit der
‚Experimentellen Druckwerkstatt‘ ab 13 Uhr
verschiedene Techniken im Mittelpunkt, die keine
Druckpresse benötigen (Foto: vhs).
Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer
arbeiten mit Stempeldruck, Frottage
(Reibetechnik) und Materialdruck. Der Kurs ist
für Personen ohne Vorkenntnisse geeignet.
Einen Tag später, am Samstag, 5. April,
beginnt um 10 Uhr ‚Experimentelle Monotypien –
ertanzte Überraschung‘. Statt einer Presse wird
hierbei das eigene Körpergewicht genutzt. Flache
Materialien mit strukturierten Oberflächen und
Farbe ergeben mit Schaumstoff bedeckt
interessante Grafiken.
Beide
Workshops finden in den Räumen der vhs Moers,
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, statt. Der
Anmeldeschluss für beide Veranstaltungen ist 28.
März. Anmeldungen sind telefonisch unter 0 28
41/201 565 und online unter www.vhs-moers.de möglich.

9 % mehr neue Auszubildende
zur Pflegefachperson im Jahr 2024
• Rund 5 100 mehr Neuverträge in der
Pflegeausbildung als im Vorjahr
• Drei
Viertel der insgesamt 147 100 Auszubildenden in
der Pflege sind Frauen
• Etwa 1 200
Studierende im Pflegestudium an Hochschulen
Zum Jahresende 2024 befanden sich nach
vorläufigen Ergebnissen des Statistischen
Bundesamtes (Destatis) insgesamt 147 100
Personen in einer Ausbildung zur Pflegefachfrau
beziehungsweise zum Pflegefachmann. Damit hat
sich die Zahl der Auszubildenden in der Pflege
gegenüber dem Jahresende 2023 (146 900
Pflegeauszubildende) kaum verändert. Allerdings
stieg die Zahl der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge 2024 gegenüber dem Vorjahr
um 9 % oder 5 100 auf rund 59 500 Neuverträge.
Weiterhin vor allem Frauen in einer
Pflegeausbildung
Während die Zahl der
weiblichen Auszubildenden im Jahr 2024 leicht um
1 % oder 1 200 auf 108 700 abnahm (2023:
109 900), stieg die Zahl der männlichen
Auszubildenden gegenüber dem Vorjahr um 4 % oder
1 400 auf 38 400. Somit waren immer noch 74 %
der Pflegeauszubildenden Frauen.
Im Jahr
2020, dem Einführungsjahr der generalistischen
Pflegeausbildung, hatte der Frauenanteil bei
76 % gelegen. Damit blieb die
Geschlechterverteilung seit der Einführung der
neuen Pflegeausbildung weitestgehend konstant.
Erstmals vorläufige Ergebnisse zu
Pflegestudierenden
Für das Jahr 2024 liegen
erstmals vorläufige Ergebnisse zu
Pflegestudierenden im Bachelorstudiengang an
Hochschulen vor. Demnach befanden sich zum
Jahresende 2024 rund 1 200 Studierende in einem
Pflegestudium, davon waren etwa 700
Studienanfängerinnen und -anfänger.
Hintergrundinformationen zur Pflegeausbildung
und zum Pflegestudium:
In der Ausbildung
zur Pflegefachperson, die mit dem Pflegeberufereformgesetz
(PflBRefG) von 2017 begründet wurde, wurden
die bis dahin getrennten Ausbildungen in den
Berufen Gesundheits- und Krankenpfleger/-in,
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in sowie
Altenpfleger/-in zum Berufsbild
Pflegefachfrau/-mann zusammengeführt.
Die Ausbildung wird seit 2020 angeboten und
dauert in Vollzeit drei Jahre. Die Ausbildung
findet an Pflegeschulen und in Krankenhäusern,
stationären oder ambulanten Pflegeeinrichtungen
statt. Wie bei den meisten Gesundheits- und
Pflegeberufen handelt es sich nicht um eine
Berufsausbildung innerhalb des dualen
Ausbildungssystems.
Neben der
beruflichen Pflegeausbildung gibt es die
Möglichkeit eines Pflegestudiums an Hochschulen,
welches mit dem Pflegestudiumstärkungsgesetz seit
2024 vergütet und finanziert wird. An einigen
Hochschulen konnte das Pflegestudium bereits vor
dem Jahr 2024 begonnen werden, ab 2024 setzte
die Finanzierung ein.
Das duale Studium
verbindet praktische und theoretische Inhalte
und schließt mit dem akademischen Grad eines
Bachelors ab. Die staatliche Prüfung zur
Erlangung der Berufszulassung ist Bestandteil
der hochschulischen Prüfung. Die
Berufsbezeichnung "Pflegefachfrau"
beziehungsweise "Pflegefachmann" kann mit dem
akademischen Grad geführt werden.
NRW: Zahl der Verurteilungen wegen
Straftaten zum Nachteil von Kindern 2023 um rund
sieben Prozent zurückgegangen
Die Zahl der Personen, die 2023 wegen einer
Straftat zum Nachteil von Kindern unter
14 Jahren rechtskräftig verurteilt wurden, ist
im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent
zurückgegangen. Die Gerichte in
Nordrhein-Westfalen sprachen 2023 insgesamt 467
Verurteilungen wegen Straftaten zum Nachteil von
Kindern aus (2022: 503).
Wie das
Statistische Landesamt anlässlich des Tages der
Kriminalitätsopfer am 22. März 2025 mitteilt,
waren 2023 von den Straftaten insgesamt 614
Kinder betroffen. Das waren 16,7 Prozent weniger
als ein Jahr zuvor; 2022 waren es 737 Kinder
gewesen. Deutlich mehr verurteilte Männer als
Frauen In den letzten zehn Jahren war die Zahl
der verurteilten Männer deutlich höher als die
Zahl der verurteilten Frauen.
Im
Jahr 2023 wurden 25 Frauen und 442 Männer
aufgrund von Straftaten zum Nachteil von Kindern
unter 14 Jahren verurteilt. 2023 waren im Mittel
1,3 Kinder von den Straftaten einer
rechtskräftig verurteilten Person betroffen, die
Höchstzahl lag bei elf Kindern. Ein Jahr zuvor
hatte die Höchstzahl bei neun Kindern gelegen.
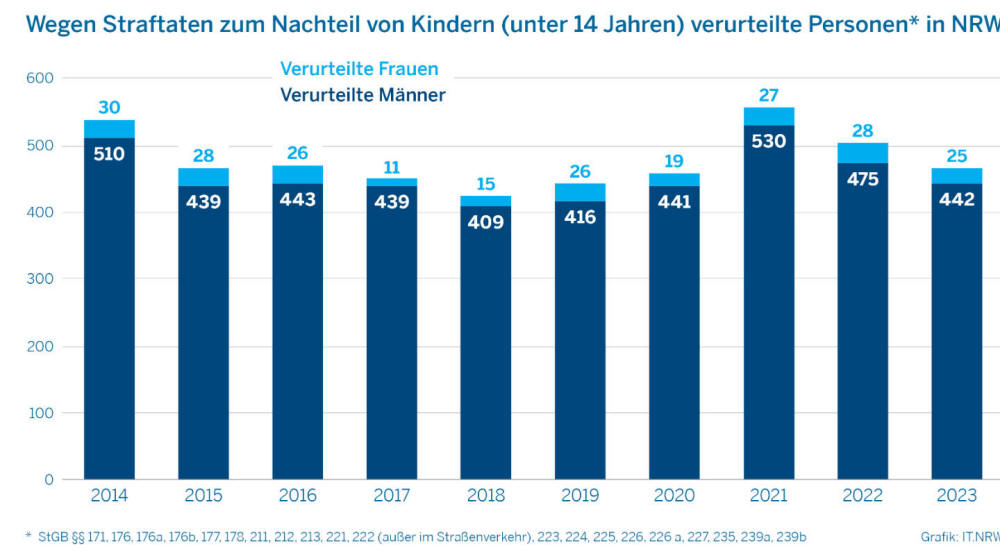
Donnerstag, 20.
März 2025
Der Lenz
ist da!

Wetteronline: Am Donnerstag, den 20. März 2025,
um 10:01 Uhr beginnt der Frühling kalendarisch.
In der Meteorologie hat er bereits am 1. März
begonnen und auch die Natur zeigt den Beginn des
Frühlings an. Die Blühzeiten der Pflanzen dienen
als Marker für die Unterteilung der
Jahreszeiten. Stehen die Forsythien in voller
Blüte, zeigen sie den Erstfrühling an. Quelle:
Pixabay
Bezirksregierung
Düsseldorf: Deichschauen im Stadtgebiet Wesel
Die diesjährigen Deichschauen im Stadtgebiet
Wesel gemäß § 95 III des Wassergesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz –
LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
Juni 1995, neu gefasst durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2021 finden an
folgenden Terminen statt:
29.04.2025
Stadt Wesel
Beginn: 10:00 Uhr
Treffpunkt:
Kläranlage, An der Windmühle/Werftstraße
15.05.2025 Erholungszentrum Grav-Insel GmbH
Beginn: 10:00 Uhr
Treffpunkt: Zufahrt
Campingplatz
19.05.2025 Hafen Emmelsum
Beginn: 10:00 Uhr
Treffpunkt: Einfahrt
Betriebsgelände (Am Schied)
19.05.2025
Hafen Rhein-Lippe (Ölhafen)
Beginn: 10:30 Uhr
Treffpunkt: Einfahrt Betriebsgelände (Zum
Ölhafen)
02.09.2025 Deichverband
Bislich-Landesgrenze: Bislich
Beginn: 10:00
Uhr
Treffpunkt: Oberes Deichende,
Kreisstraße 7 in Wesel- Bislich (Mars)
26.09.2025 Deichschau Flüren
Beginn: 14:00
Uhr
Treffpunkt: Zufahrt Gravinsel
30.09.2025 Deichverband Duisburg-Xanten: Orsoy
bis Büderich
Beginn: 08:30 Uhr
Treffpunkt: Bernshof, Orsoy Land 4, 47495
Rheinberg
09.10.2025 Deichverband
Duisburg-Xanten: Beek bis Büderich
Beginn:
08:30 Uhr
Treffpunkt: Göt-Schleuse,
Eyländer-Weg, 46509 Xanten
Die Deichschau ist
grundsätzlich nicht öffentlich. Die
Teilnahmeberechtigung ist in § 95 II LWG
geregelt. Die Bezirksregierung Düsseldorf kann
weitere Teilnehmer zulassen.
Kreis Wesel: Impfberatung und Reisemedizin –
Sicher und gesund in die Osterferien reisen
Die Osterferien stehen vor der Tür, und viele
Bürgerinnen und Bürger planen bereits ihren
wohlverdienten Urlaub. Damit die Reisezeit
sorgenfrei und gesund verläuft, bietet das
Gesundheitsamt der Kreisverwaltung umfassende
Informationen rund um Impfungen und
reisemedizinische Vorsorge an. Impfungen zählen
zu den effektivsten Präventionsmaßnahmen der
modernen Medizin und schützen vor gefährlichen
Erkrankungen.
Gerade bei Reisen in
bestimmte Regionen, wie tropische Länder, ist es
ratsam, den eigenen Impfschutz frühzeitig zu
überprüfen. Wer unsicher ist, ob die aktuellen
Impfungen ausreichen oder zusätzliche Maßnahmen
notwendig sind, kann sich individuell im
Gesundheitsamt beraten lassen. In der Beratung
gibt es Empfehlungen zum Impfschutz und zur
Gesundheitsvorsorge.
Um optimal
vorbereitet zu sein, sollte die
reisemedizinische Beratung idealerweise
spätestens sechs Wochen vor dem Reiseantritt
erfolgen. Dennoch ist eine Beratung auch bei
kurzfristigen oder Last-Minute-Reisen – wie sie
über die Osterferien häufig geplant werden –
sinnvoll. Die empfohlenen Impfungen werden durch
niedergelassene Ärzte oder spezialisierte
Impfstellen durchgeführt.
Viele
Impfungen sind eine Kassenleistung werden somit
von den Krankenkassen übernommen. Nutzen Sie die
Zeit vor den Osterferien, um sich über Ihren
Impfschutz zu informieren und Ihre Reise
gesundheitsbewusst vorzubereiten. Für weitere
Informationen und zur Terminvereinbarung steht
das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung gerne zur
Verfügung. Weitere Infos gibt es unter https://www.kreis-wesel.de/Impfberatung
Landrat Brohl überreicht den
Heimatpreis 2024
Am Montag, 17. März
2025, überreichte Landrat Ingo Brohl den
Heimatpreis des Kreises Wesel an die drei
Preisträger im Weseler Kreishaus. Die Gewinner
sind die GGKG Fidelio 1951 Moers e. V., die
Tuwas Genossenschaft eG – Radeln ohne Alter
Neukirchen-Vluyn und der Tambourkorps
Hamminkeln.
Landrat Ingo Brohl: „Dieser
Preis ist eine Anerkennung für die, die sich mit
Herz und Tatkraft für unsere Heimat einsetzen.
Sie bewahren nicht nur unsere regionalen
Schätze, sondern stärken sie zusätzlich mit
ehrenamtlichem Engagement, das wirklich
beeindruckend ist. Neben den Bräuchen geht es
den Gewinnerinnen und Gewinnern aber besonders
um die Menschen vor Ort, darum, sie für ihr
jeweiliges Thema zu begeistern und ihnen die
Möglichkeit zu geben, sich einzubringen – egal,
welchen Hintergrund sie haben.“
Insgesamt
hatten sich 22 Vereine und Initiativen für den
Heimatpreis 2024 beworben. Der Weseler Kreistag
hatte in seiner Dezembersitzung 2024 über die
Vergabe entschieden, für den Landeswettbewerb
Heimatpreis wird GGKG Fidelio 1951 Moers e.V.
benannt.
Um die Breite des Engagements
für unsere Heimat zu würdigen, hat der Kreistag
beschlossen, das Preisgeld in Höhe von 10.000
Euro aufzuteilen und drei Preisträger zu je
gleichen Teilen auszuzeichnen.
Ziel ist
es, Menschen für lokale und regionale
Besonderheiten zu begeistern und die positiv
gelebte Vielfalt in Nordrhein-Westfalen deutlich
sichtbar werden zu lassen. Der Kreis Wesel
verleiht den Heimatpreis seit 2019. Auch 2025
wird es einen Heimatpreis geben, Bewerbungen
können vom 4. April bis zum 16. Mai eingereicht
werden.

GGKG Fidelio 1951 Moers e. V.
Das
Vereinsziel ist die Pflege traditioneller
Karnevalsbräuche wie die Durchführung von
verschiedensten Karnevalssitzungen und
Veranstaltungen. Karneval ist bunt, dies bezieht
sich nicht nur auf das Verkleiden, sondern auch
auf die Mitglieder des Vereins. Man ist offen
für Menschen, die den Karneval in seiner Kultur
und seinen Bräuchen pflegen möchten. In der
Tanzgruppe „Wir“ tanzen Menschen mit und ohne
Behinderung. Tradition beibehalten und mit neuen
Aspekten anzupassen ist die Kunst, den Karneval
lebendig zu halten. Der Verein versucht, sich
immer den Lebensumständen anzupassen, um die
Lebensfreude, die der Karneval den Menschen
bringen soll, weiterzugeben.
Tuwas
Genossenschaft eG – Radeln ohne Alter
Neukirchen-Vluyn
Ziel von Radeln ohne Alter
Neukirchen-Vluyn ist es,
mobilitätseingeschränkte Menschen mit Ausfahrten
auf Rikschas Beweglichkeit und Lebensfreude
durch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben der
Stadt zu vermitteln. Die Rikschas dienen dabei
als Medium, um Erfahrungen mit Menschen und
Landschaften der Stadt zu initiieren.
Entscheidend ist dabei der Kontakt zwischen
Rikschas-Pilot/in und den Fahrgästen. Beide
Seiten schenken sich Zeit, um miteinander ins
Gespräch zu kommen, alte und neue Erfahrungen zu
teilen. Durch die Fahrten soll eine Re-Inklusion
gelingen: die ehemals vorhandene Mobilität,
welche z. B. die Teilnahme an Veranstaltungen
oder die selbst initiierte Erschließung der
Heimat möglich machte, soll durch
Rikscha-Ausfahrten erneuert werden.
Tambourkorps Hamminkeln
Der Traditionsverein
ist seit über 100 Jahren in den Bereichen
kulturelle Bildung, Instrumentalunterricht,
Brauchtumspflege sowie Kinder- und Jugendarbeit
aktiv. Er ist Bestandteil der jährlich
stattfindenden Festivitäten und
Brauchtumsveranstaltungen und begleitet u. a.
Schützenfeste und Martinszüge musikalisch.
Als einziges Orchester hat das Korps
2022 und 2023 aktiv bei der Erstellung des
„Kommunalen Gesamtkonzeptes für kulturelle
Bildung“ mitgewirkt, welches durch das Land NRW
ausgezeichnet wurde. Die kulturellen Angebote
sind vielfältig. Auch Inklusion ist ein
wichtiges Thema, z. B. finden offene
Übungsstunden in der örtlichen
Senioreneinrichtung oder einer Wohngruppe des
Kinderheims Wesel statt. Im Verein wird
Inklusion gelebt: Ungeachtet des Handicaps wird
versucht, eine Teilhabe an möglichst allen
Aktivitäten zu ermöglichen.
Kleve: Konzert mit dem TRIO POLLON
Fr., 28.03.2025 - 20:30 - Fr., 28.03.2025 -
22:30 Uhr
Die Klever Jazzfreunde laden zum
Konzert mit "Trio Pollon" in die kleine
evangelische Kirche ein. „Lange kein so
spannendes Konzert mehr gehört. Das junge Kölner
Trio versteht es, höchste Virtuosität auf so
uneitle wie unprätentiöse Weise zu einem
stimmigen Gesamtkonzept zu vereinen, dass einem
erst beim Achten auf die vielen liebevollen
Details aufgeht.

WIE gut das alles ist. Lieber noch (…) lässt
man sich von der beständig fließenden, vom
ersten bis zum letzten Ton angenehm unaufgeregt
erstklassigen (…) Musik in den Bann ziehen. Und:
genießt.“ Robert Fischer, Autor “All That Jazz”,
Reclam 2021
Die Tickets sind in der
Buchhandlung Hintzen, im Elaya Hotel Kleve, in
der Neuen Mitte sowie per Mail an
gig@klever-jazzfreunde.de erhältlich. Der
Einlass zum Konzert ist bereits um 19:30 Uhr.
Kleve: Neuer Niederländischkurs in Rees
Hartelijk welkom!
Wir bieten einen
neuen Kurs für interessierte Teilnehmende in
Rees an. Wenn Sie noch keinen
Niederländisch-Unterricht hatten und die Sprache
systematisch und strukturiert erlernen möchten,
melden Sie sich gerne an. Der Kurs beginnt am
31.3.2025 um 19:30 Uhr im Gymnasium Aspel.
Weitere Informationen erhalten
Kleve: Perspektive Land - Mobilität im
Wandel
Mi., 02.04.2025 - 19:00 -
Mi., 02.04.2025 - 21:00 Uhr
Den Alltag ohne
eigenen Pkw zu bewältigen, war und ist für viele
Bewohner*innen in ländlichen Regionen
unvorstellbar. Viele Haushalte benötigen gar
zwei oder mehr Fahrzeuge. Wo die öffentlichen
Verkehrsmittel nur selten fahren und die Wege
lang sind, scheint das eigene Auto die einzige
zuverlässige Möglichkeit der Fortbewegung zu
sein und die Mobilitätswende noch fern.

Dennoch gibt es gerade in ländlichen
Regionen, wie dem Niederrhein viele Initiativen
und Ideen, wie dieser Problematik begegnet
werden kann. Die Abendveranstaltung bietet einen
Einblick in die Herausforderungen der
Verkehrsinfrastruktur auf dem Land und die
Möglichkeit zum Austausch über verschiedene
Lösungsansätze. Diskutiert wird mit Experten und
über Projekte aus der Region Kleverland,
Niederrhein und darüber hinaus.
Anmeldung
unter:
https://www.wasserburg-rindern.de/veranstaltungen/info/25-114
erforderlich.
Moers: Französische
Klänge bei der diesjährigen Benefizmatinee am
30. März
Freuen sich gemeinsam auf
die 8. Benefizmatinee des Inner Wheel Clubs
Moers und der Musikschule am 30. März:
Musikschulleiter Georg Kresimon, Marlies Stark
(IWC), Saxophonistin Mari Ángeles del Valle,
Evelyn Cillis (IWC), Pianistin Bonju Lee, Ulla
Schaller (IWC) und die stellvertretende
Musikschulleiterin Ulrike Schweinfurth.

(Foto: Pressestelle)
Wer am Sonntag,
30. März, bei der Benefizmatinee des Inner Wheel
Club (IWC) im Kammermusiksaal der Musikschule ab
11.30 Uhr (Einlass ab 11 Uhr) gerne dabei sein
möchte, sollte sich zügig eine der restlichen
Karten besorgen.
„Die Matinee ist stark
gefragt und hat inzwischen ihr Stammpublikum, so
dass es nicht mehr allzu viele Karten gibt“,
freut sich die stellvertretende Leiterin der
Musikschule, Ulrike Schweinfurth. Das
musikalische Programm besteht in diesem Jahr
überwiegend aus französischer Musik, unter
anderem von Frédéric Chopin, Eugéne Bozza und
François Borne.
Es ist mittlerweile
die 8. Benefizmatinee und seit sieben Jahren
laden die Moerser Musikschule und der Inner
Wheel Club Moers gemeinsam dazu ein.
Hochkarätige Musikerinnen Im ersten Programmteil
präsentieren sich die Saxophonistin Mari Ángeles
del Valle und die Pianistin Bonju Lee von der
Musikschule.
Del Valle hat ein
Hochschulstudium am Conservatorio Superior de
Música Manuel Castillo in Sevilla abgeschlossen
und ist seit zwei Jahren neben ihrer
Musikschultätigkeit Dozentin an der Hochschule
für Musik und Tanz in Köln. Die Pianistin Lee
hat an der Musikhochschule in Detmold und der
Hochschule für Musik Saar studiert. Sie konnte
bereits im letzten Jahr das Matineepublikum
gemeinsam mit ihrem Mann in Moers begeistern.
Beide Musikerinnen verzichten auf ihre Gage, die
dem Förderkreis der Moerser Musikschule
zugutekommt.
Den zweiten
Matinee-Teil bestreiten Schülerinnen und Schüler
aus der Begabtenförderung. Besonderes Buffet vom
Inner Wheel Club Ebenso besonders wie die
musikalischen Klänge wird auch das Buffet an
diesem Tag sein. Die Damen vom Inner Wheel Club
bieten wieder passendes Fingerfood an – nun mit
einer französischen Note.
„Wir
möchte unser Buffet-Angebot diesmal noch
erweitern“, kündigen die Clubmitglieder Evelyn
Cillis und Ulla Schaller an. Und Marlies Stark
ergänzt: „Wir sind jedes Jahr mit Freude dabei
und arbeiten für das Ehrenamt aus sozialem
Engagement heraus.“ Und auch Musikschulleiter
Georg Kresimon ist für die Unterstützung
dankbar.
„Der Einsatz des IWC ist
für uns immens wichtig, denn neben dem
finanziellen Aspekt zeigt er auch, wieviel
Wertschätzung unsere Arbeit erfährt.“ Die
wenigen Restkarten sind zum Preis von 29 Euro
bei der Moerser Musikschule, Filder Straße 126,
erhältlich (Öffnungszeiten: Montag, Dienstag,
Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch von 13 bis
16 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr).
ENNI-Ökotouren mit der vhs Moers –
Kamp-Lintfort im März und April
Im März und April bieten die
vhs Moers – Kamp-Lintfort und die ENNI im Rahmen
der Ökotouren wieder verschiedene
Besichtigungsfahrten an. Am Mittwoch, 26. März,
geht es zum Biomasse-Heizkraftwerk im
Technologiepark Eurotec.

Die Besucherinnen und Besucher können sich vor
Ort ein Bild von der hochmodernen
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage machen, die neben
Strom auch Wärme produziert. Treffpunkt ist um
17 Uhr am Technologiepark Eurotec, Eurotec-Ring.
Wind- und Solarpark und Fassadenbegrünungen .
Am Mittwoch, 2. April, steht dann die
Besichtigung regenerativer Leuchtturmprojekte
auf dem Programm. Zunächst geht es zum Windpark
in Repelen und anschließend wird der Solarpark
im Mühlenfeld in Neukirchen-Vluyn besucht. Start
ist um 15.45 Uhr am ENNI Windpark Repelen,
Verbandstraße/Rheinberger-Straße.
Ein weiteres Ziel der Ökotouren ist am Mittwoch,
9. April, das Verwaltungsgebäude der ENNI in
Moers-Hülsdonk (Foto: ENNI). Die drei
Begrünungen an der Ostfassade, im Innenhof und
dem Foyer sind ein vielbeachtetes ökologisches
Vorzeigeprojekt. Neu hinzugekommen sind die
grünen Fassaden am benachbarten neuen
Kreislaufwirtschaftshof.
Die Tour
‚Vertikale Gärten – Grüne Lungen in Städten!‘
startet um 17 Uhr am ENNI-Verwaltungsgebäude, Am
Jostenhof 15. Alle drei Veranstaltungen sind
kostenlos, allerdings ist eine vorherige
Anmeldung notwendig. Diese ist telefonisch unter
0 28 41/201 – 565 und online unter www.vhs-moers.de möglich.
Kostenlose Wanderausstellung „Was ich
anhatte…“ nun auch in Dinslaken Was
hatte sie/er an? War der Rock zu kurz, die Hose
zu eng oder das Oberteil zu weit ausgeschnitten?
In Bezug auf sexualisierte Gewalt sehen sich
betroffene Menschen immer noch mit Vorurteilen
konfrontiert, die eine Mitschuld unterstellen.
Wie wenig aber die Auswahl der
Kleidung mit einem sexualisierten Übergriff zu
tun hat, zeigt die Ausstellung „Was ich
anhatte“, die im April in der
Kathrin-Türks-Halle im Raum Niederrhein zu sehen
ist. Eröffnet wird die Ausstellung am 02.04.25
um 17 Uhr durch Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel und den Arbeitskreis Mädchen- und
Jungenarbeit.
Zusätzlich berichtet
die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
der AWO von ihrer Arbeit. Bis zum 15.04.25
besteht die Möglichkeit, die Ausstellung
wochentags zwischen 17 und 20 Uhr, zu besuchen.
Am Wochenende ist die Ausstellung von 11 bis 16
Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei.
Vormittags können in diesem Zeitraum
Schulen vorab einen Besuch buchen, der dann von
Fachkräften begleitet wird. Nähere Infos
erhalten interessierte Lehrer*innen bei der
Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt in
Dinslaken, Tel. 0 20 64 – 62 18 50 oder asm@awo-kv-wesel.de
Die von der Filmemacherin Beatrix Wilmes
konzipierte Wanderausstellung tourt seit
November 2020 durch verschiedene deutsche
Städte.
Sie zeigt die Erfahrungen
von 12 Menschen, die sexualisierte Gewalt
erfahren haben. Bei den ausgestellten Exponaten
handelt es sich größtenteils um die
Originalkleidung der Betroffenen mit ihrer
individuellen, persönlichen Geschichte und ihrem
Leben danach.
Hier wird schnell
deutlich, dass die Verantwortung niemals bei den
Betroffenen liegt, sondern immer bei den
Täter*innen. Link der Ausstellung www.wasichanhatte.de
Weil der Besuch der Ausstellung aufwühlen kann,
kann es hilfreich sein, sie in Begleitung von
Freund*innen oder Familienmitgliedern zu
besuchen, die unterstützen können. Ansonsten
sind während der Öffnungszeiten immer Fachkräfte
als Ansprechpersonen anwesend.
Freigegeben ist die Ausstellung für Jugendliche
ab 16 Jahre. 14- und 15-Jährige können die
Ausstellung ausschließlich mit einer
sorgeberechtigten Person besuchen. Die Buchung
der Ausstellung wurde durch den Dinslakener
Arbeitskreis Mädchenarbeit ermöglicht. Der
Arbeitskreis Jungenarbeit unterstützt bei der
Begleitung während der Ausstellung.
„NATÜRLICH neu wirtschaften“ mit Sven
Plöger am 3. April 2025 in Kleve
Der
Diplom-Meteorologe und TV-Moderator Sven Plöger
spricht auf Einladung des unternehmerinnen
forums niederrhein, des Förderverein der
Hochschule Rhein-Waal (HSRW) – Campus Cleve e.
V. und des Projekts TransRegINT (Transformation
der Region Niederrhein: Innovation,
Nachhaltigkeit, Teilhabe) der HSRW, über
Nachhaltigkeit in der Wirtschaft.

© Sebastian Knoth
Den Stein für diese
Veranstaltung hat das unternehmerinnen forum
niederrhein ins Rollen gebracht. Das Netzwerk
selbständiger Unternehmerinnen, weiblicher
Führungskräfte und Freiberuflerinnen bietet
immer wieder neue Impulse und möchte mit neuen
Ideen Mut geben. Am Abend des 3. Aprils geht es
konkret um Fragen wie: Was können
Unternehmer*innen, aber auch jede*r Einzelne
tun, um die Zukunft nachhaltig zu gestalten? Wie
mit der Herausforderung Klimawandel umgehen?
Der Vortrag des Dipl.-Met. Sven Plöger
basiert auf seinem Buch „Zieht euch warm an, es
wird noch heißer! Können wir den Klimawandel
noch beherrschen?“. Seine Begeisterung
interessierte Bürger*innen, aber auch regionale
Unternehmen und Fachpublikum näher an die Themen
Wetter und Klima zu führen, zeigt sich in dem
Versuch, komplexe naturwissenschaftliche
Vorgänge in eine für jede*n verständliche
Sprache zu übersetzen. Und trotz der
Ernsthaftigkeit des Themas verzichtet er in
seinen Vorträgen nicht auf eine Prise Humor.
In seinem Buch stellt Dipl.-Met. Sven
Plöger fest: „Alles beginnt – wie immer – mit
der Haltung im Kopf…“ Wo also müssen die
Menschen sich verändern und wo können technische
Lösungen helfen? Er wird sich den vielen
Möglichkeiten widmen, die wir noch haben, die
aber häufig übersehen werden.
Wie
entwickeln wir am Niederrhein das passende
Mindset, also unsere Denkweise? Wie müssen wir
unsere innere Einstellung anpassen, um letztlich
ins Tun zu kommen? Hierzu teilt Prof. Dr.-Ing.
Peter Kisters, Vizepräsident für Forschung,
Innovation und Wissenstransfer der HSRW sowie
Projektleiter von TransRegINT, im Anschluss
seine Gedanken zur Transformation der Region
durch die HSRW. TransRegINT fördert Innovation,
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Teilhabe –
zentrale Aspekte, die das Projekt prägen und die
Region nachhaltig stärken sollen.
Nach
den Vorträgen wird es im Foyer die Möglichkeit
geben bei Musik und Häppchen zu Netzwerken sowie
nachhaltige Initiativen und Projekte von
Unternehmer*innen und des Projektes TransRegINT
kennenzulernen. Für Gespräche und weiteren
Austausch werden unter anderem die Firmen ABS
Safety GmbH, bb med. product GmbH sowie POTTBURI
GmbH vor Ort sein.
Das Kevelaerer
Unternehmen ABS Safety GmbH ist Hersteller von
Absturzsicherungen und versucht auf ganz
unterschiedlichen Wegen, Ressourcen zu schonen
und den CO2-Fußabdruck zu verbessern. Die bb
med. product GmbH produziert als Lohnhersteller
Kosmetik und Medizinprodukte für viele im Markt
etablierte Unternehmen.
Seit Langem
setzt bb med. auf mikroplastikfreie Rezepturen
und geht nun noch einen Schritt weiter: Als
Projektpartner des HSRW-Projekts SUFACHAIN
erforscht das Unternehmen innovative,
nachhaltige Alternativen wie Walnussschalen als
Kosmetikinhaltsstoff. Die POTTBURI GmbH hat
einen zu 100 Prozent biologisch abbaubaren Topf
entwickelt, der mit der Pflanze in die Erde
eingegraben werden kann.
Der öffentliche
Vortrag ist kostenfrei. Da die Veranstaltung bis
auf wenige Restplätze ausgebucht ist, wird um
Anmeldung über
https://www.unternehmerinnenforum-niederrhein.de/events/2025-04-03_sven-ploeger/#em-event-booking-form
gebeten.


Großhandelspreise im Februar 2025: +1,6 %
gegenüber Februar 2024
Großhandelsverkaufspreise, Februar 2025 +1,6 %
zum Vorjahresmonat +0,6 % zum Vormonat
Die
Verkaufspreise im Großhandel waren im Februar
2025 um 1,6 % höher als im Februar 2024. Im
Januar 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber
dem Vorjahresmonat bei +0,9 % gelegen, im
Dezember 2024 bei +0,1 %. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen
die Großhandelspreise im Februar 2025 gegenüber
dem Vormonat Januar 2025 um 0,6 %.
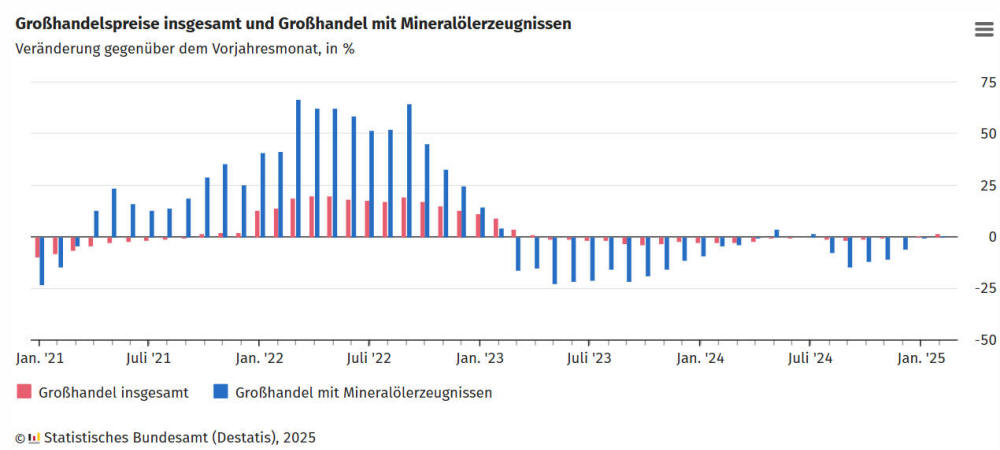
Gestiegene Preise für Nahrungs- und
Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie für
Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und
Nicht-Eisen-Metallhalbzeug
Hauptursächlich für den Anstieg der
Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem
Vorjahresmonat war im Februar 2025 der
Preisanstieg im Großhandel mit Nahrungs- und
Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Die
Preise lagen hier im Durchschnitt um 4,4 % über
denen von Februar 2024. Insbesondere Kaffee,
Tee, Kakao und Gewürze waren auf
Großhandelsebene erheblich teurer als ein Jahr
zuvor (+43,8 %), ebenso Zucker, Süßwaren und
Backwaren (+14,9 %).
Auch für Milch,
Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und
Nahrungsfette (+8,1 %) musste merklich mehr
bezahlt werden als im Vorjahresmonat. Die
Großhandelsverkaufspreise für Nicht-Eisen-Erze,
Nicht-Eisen-Metalle und Halbzeug daraus stiegen
ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat
(+29,7 %).
Dagegen waren die Preise
im Großhandel mit Eisen, Stahl und Halbzeug
daraus 6,1 % niedriger als im Februar 2024. Im
Großhandel mit Datenverarbeitungs- und
peripheren Geräten musste im Schnitt 5,7 %
weniger bezahlt werden als im Vorjahresmonat.
Die Preise im Großhandel mit lebenden Tieren
lagen ebenfalls unter denen von Februar 2024
(-2,0 %).
Seeverkehr 2024:
Güterumschlag 2,3 % höher als im Vorjahr
• Vereinigte Staaten erneut größter
Handelspartner deutscher Seehäfen
• USA
zugleich mit Abstand wichtigster Erdgaslieferant
für Deutschland im Seeverkehr
•
Containerumschlag mit Häfen in der EU legt mit
+17,7 % deutlich zu
Der Güterumschlag
der deutschen Seehäfen ist im Jahr 2024
gegenüber dem Vorjahr um 2,3 % gestiegen. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, wurden insgesamt 274,0 Millionen
Tonnen Güter umgeschlagen. Damit überwand der
Seeverkehr zwei Jahre mit sinkenden
Güterumschlägen, blieb aber noch 6,7 % unter dem
Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 (293,5
Millionen Tonnen).
USA mit
29,8 Millionen Tonnen umgeschlagener Güter
bedeutendster Handelspartner Wichtigstes
Partnerland im Seehandel 2024 waren wie bereits
2023 die USA mit einem Güterumschlag von 29,8
Millionen Tonnen. Damit wuchs der Seehandel mit
den USA im Vorjahresvergleich deutlich um 6,7 %.
In der Rangfolge der wichtigsten
Handelspartner im Seeverkehr 2024 folgten
Norwegen (25,8 Millionen Tonnen; +2,6 % zum
Vorjahr), Schweden (23,8 Millionen Tonnen;
+3,3 %) und China (19,1 Millionen Tonnen;
-4,9 %). Insgesamt entfielen mehr als zwei
Fünftel (13,7 Millionen Tonnen) des
Güterumschlags mit den USA auf den Empfang
fossiler Energieträger.
Fossile
Energieträger nach wie vor wichtige Säule des
Seehandels
In den deutschen Seehäfen gingen
im Jahr 2024 insgesamt 40,1 Millionen Tonnen
Kohle, Erdöl und Erdgas aus dem Ausland ein, das
waren 5,6 % mehr als im Jahr 2023. Bereits 2023
war der Seehandel mit fossilen Energieträgern
markant gestiegen (+5,3 % gegenüber 2022).
Allerdings zeigten sich auch 2024
unterschiedliche Entwicklungen bei den einzelnen
Energieträgern: So ging der Empfang von Kohle
erneut zurück, und zwar um 8,0 % gegenüber dem
Vorjahr auf 6,7 Millionen Tonnen.
Demgegenüber nahm der Empfang von Erdöl um 9,7 %
auf 28,5 Millionen Tonnen zu. Der Empfang von
Erdgas (vornehmlich Flüssiggas), der sich im
Zuge der Energiekrise nach dem Angriff Russlands
auf die Ukraine von 317 000 Tonnen im Jahr 2022
auf 4,8 Millionen Tonnen im Jahr 2023
vervielfacht hatte, wuchs 2024 weiter, und zwar
um 4,0 % auf 5,0 Millionen Tonnen.
Das mit Abstand wichtigste Lieferland für Erdgas
im Jahr 2024 waren die USA mit 4,3 Millionen
Tonnen, gefolgt von Norwegen (294 000 Tonnen)
und Angola (137 000 Tonnen). Beim Empfang von
Erdöl waren Norwegen (7,7 Millionen Tonnen), die
USA (7,4 Millionen Tonnen) und Großbritannien
(4,6 Millionen Tonnen) die wichtigsten
Lieferländer.
China bleibt wichtigster
Partner der deutschen Seehäfen im
Containerverkehr
Der Containerumschlag der
deutschen Seehäfen lag im Jahr 2024 mit
13,3 Millionen TEU (Twenty-foot-Equivalent-Unit)
um 4,9 % über dem Vorjahreswert (12,7 Millionen
TEU). Das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 von
15,0 Millionen TEU wurde damit noch nicht wieder
erreicht.
Knapp ein Fünftel
(2,6 Millionen TEU) des deutschen
Containerumschlags entfiel 2024 auf China,
gefolgt von den USA mit knapp einem Zehntel
(1,3 Millionen TEU). Der Containerhandel mit
China wuchs dabei um moderate 0,8 %, während er
mit den USA rückläufig war (-3,0 %).
Der
deutsche Containerumschlag mit den
Partnerländern der Europäischen Union (3,6
Millionen TEU) wuchs dagegen deutlich um 17,7 %
gegenüber 2023 (3,1 Millionen TEU) und machte
nun mehr als ein Viertel des Containerhandels
der deutschen Seehäfen aus.
Mittwoch, 19.
März 2025
IHK: Nur mit Reformen ist Geld
gut eingesetzt Sondervermögen vor allem an Rhein
und Ruhr
500 Milliarden für
Infrastruktur, 500 Milliarden für Sicherheit:
Das hat die Bundesregierung heute beschlossen.
Dazu äußert sich Werner Schaurte-Küppers,
Präsident der Niederrheinischen IHK: „Es ist
ein gutes Signal, dass investiert wird. Das Geld
muss jetzt allerdings gezielt eingesetzt werden.
Die vielen Mittel dürfen nicht dazu
verleiten, jetzt die nötigen Reformen zu
verschlafen. Deswegen muss die neue
Bundesregierung Bürokratie abbauen, Steuern
senken und Energie bezahlbar machen. Nur so kann
unsere Wirtschaft wieder wachsen.
50
Prozent der Mittel für Infrastruktur sollten in
unseren Ballungsraum Rhein-Ruhr. Wir sind
Verkehrsknotenpunkt und Transit-Region. Davon
hängen sehr viele Arbeitsplätze und Unternehmen
ab.“
DMB-Vorstand Tenbieg: „Infrastrukturmilliarden
sind historische Chance, dürfen aber nicht zur
Bürde für die nächsten Generationen werden“
Der Deutsche Mittelstands-Bund (DMB) begrüßt die
im Bundestag beschlossene Schaffung eines
Sondervermögens. Gleichzeitig betont Marc S.
Tenbieg, geschäftsführender DMB-Vorstand, die
Wichtigkeit einer zielgerichteten Verwendung der
schuldenfinanzierten Ausgaben. Dafür brauche es
massive strukturelle Staatsreformen, so Tenbieg.
Der DMB-Vorstand führt aus: „Dass der
Bundestag heute den Weg für ein in dieser Höhe
historisches Finanzpaket frei gemacht hat, ist
grundsätzlich eine gute Nachricht für den
Mittelstand. Wir beim DMB gehen davon aus, dass
der durch das Sondervermögen finanzierte Ausbau
der Infrastruktur einen dringend notwendigen
Wachstumsimpuls setzen kann. Um international
wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen kleine
und mittlere Unternehmen eine bezahlbare
Energieversorgung und ein zuverlässiges
Glasfaser-, Straßen- und Schienennetz. Genau in
diese Bereiche sollen die zusätzlichen und
schuldenfinanzierten Milliarden Euro vornehmlich
fließen. Der DMB befürwortet dieses klare
Investitionsziel und hofft, dass auch der
Bundesrat dem Finanzpaket zustimmt.
Doch
aus Verbandsperspektive wird es nicht reichen,
einfach nur mehr Geld in Infrastrukturprojekte
zu pumpen. In der Vergangenheit wurden
vorhandene Finanzmittel häufig nicht zeitnah und
vollständig genutzt – aufgrund langwieriger
Bürokratie, komplexer europäischer
Ausschreibungsvorgaben und personeller Engpässe.
Beispielsweise schiebt allein die Förderung von
schnellem Internet derzeit immer noch eine
Milliarden-Euro-Bugwelle vor sich her. Wir
fordern daher von der neuen Bundesregierung,
dass die Investitionen doppelt bei den
Unternehmen ankommen – als Konjunkturprogramm
und in Form einer modernen Infrastruktur.
Damit dies gelingt, braucht es endlich
strukturelle Staatsreformen. Konkret: die
erhebliche Vereinfachung von Planungs- und
Genehmigungsverfahren sowie eine umfassende
Verwaltungsdigitalisierung. Letztere muss dazu
führen, dass Behörden schneller arbeiten.
Bleiben die behördlichen Strukturen so starr wie
bisher, werden die 500 Milliarden Euro ohne den
erhofften konjunkturellen Aufschwung verpuffen.
In diesem Fall wäre nichts gewonnen – schlimmer
noch: Wir verlieren dadurch das Vertrauen der
nachkommenden Generationen, die die Schulden
zurückzahlen müssen.“
Der Deutsche
Mittelstands-Bund (DMB) e.V. ist der
Bundesverband für kleine und mittelständische
Unternehmen in Deutschland. Der DMB wurde 1982
gegründet und sitzt in Düsseldorf. Unter dem
Leitspruch „Wir machen uns für kleine und
mittelständische Unternehmen stark!“ vertritt
der DMB die Interessen seiner rund 30.000
Mitgliedsunternehmen mit über 750.000
Beschäftigten.
Damit gehört der DMB
mit seinem exzellenten Netzwerk in Wirtschaft
und Politik zu den größten unabhängigen
Interessen- und Wirtschaftsverbänden in
Deutschland. Der Verband ist politisches
Sprachrohr und Dienstleister zugleich,
unabhängig und leistungsstark.
Spezielle
Themenkompetenz zeichnet den DMB in den
Bereichen Digitalisierung, Nachfolge, Finanzen,
Internationalisierung, Energiewende und Arbeit &
Bildung aus. Als dienstleistungsstarker Verband
bietet der DMB seinen Mitgliedsunternehmen zudem
eine Vielzahl an Mehrwertleistungen. Weitere
Informationen finden Sie unter
www.mittelstandsbund.de.
Mehr finanzieller
Handlungsspielraum für Verteidigung,
Infrastruktur und Klimaschutz dringend
erforderlich. Schwerpunkte bei der
Modernisierung auf Sicherheit und
Digitalisierung setzen.
Der
Geschäftsführer des TÜV-Verbands, Dr. Joachim
Bühler, kommentiert die heute im Bundestag
beschlossene Reform der Schuldenbremse: „Der
TÜV-Verband begrüßt, dass sich der Bundestag auf
ein umfangreiches Investitionspaket für
Sicherheit, Infrastruktur und Klimaschutz
geeinigt hat. Eine Reform der Schuldenbremse ist
in der aktuellen Situation notwendig.
Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur
sind eine Investition in die Zukunft unseres
Landes. Jetzt kommt es darauf an, dass das Geld
auch wirklich dort ankommt, wo es am
dringendsten gebraucht wird.“ „Unsere
Verkehrsinfrastruktur muss moderner und sicherer
werden. Tausende Verkehrstote und Zehntausende
Schwerverletzte sind eine schwere Bürde. Die
Mittel müssen in moderne Straßen, Schienennetze
und Radwege fließen. Dabei muss berücksichtigt
werden, dass Mobilität sich aktuell stark
verändert und Verkehrsmittel wie Fahr- und
Lastenräder sowie E-Scooter immer wichtiger
werden. Das Rückgrat einer zeitgemäßen
Verkehrsinfrastruktur muss ein moderner
Öffentlicher Personennah- und Fernverkehr sein.“
„Bei der öffentlichen Sicherheit
Deutschlands und Europas sind Investitionen in
die digitale Verteidigungsfähigkeit
entscheidend. Der russische Angriffskrieg in der
Ukraine zeigt, wie sich die Kriegsführung
verändert hat. Deutschland muss seine
Cyberabwehr stärken und dabei auf Drohnen, KI
und Robotik setzen. In einer digitalen,
vernetzten Welt muss auch die zivile
Cybersicherheit der Kritischen Infrastrukturen
verbessert werden, aber auch von Unternehmen,
Behörden oder Gesundheitseinrichtungen.“
„Der TÜV-Verband begrüßt ausdrücklich,
dass der Klima- und Transformationsfonds
gestärkt wird. Investitionen in Klimaschutz,
GreenTech, E-Mobilität und Erneuerbare Energien
wirken als Konjunkturprogramm für die Wirtschaft
und machen Deutschland unabhängiger von
Importen.“
Die wichtigsten Empfehlungen
des TÜV-Verbands für die neue Legislaturperiode
sind hier abrufbar:
https://www.tuev-verband.de/bundestagswahl-2025
Gesundheitsnetzwerk Niederrhein
e. V. & Euregionales Forum
Gesundheitsversorgung: Deutschland und
Niederlande Partner bei Gesundheitsversorgung
Nachbarländer können ihre medizinische
Versorgung verbessern, indem sie
zusammenarbeiten. Das funktioniert besonders gut
in Grenzregionen, so auch am
Niederrhein. Deshalb laden das
Gesundheitsnetzwerk Niederrhein e. V. und die
Euregio Rhein-Waal zu der Infoveranstaltung
"Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der
Gesundheitsversorgung zwischen Deutschland und
den Niederlanden" ein. Diese findet am 19. März
von 15-17 Uhr im Forum der Euregio Rhein-Waal in
Kleve statt.
Im Mittelpunkt der
Veranstaltung steht die aktuelle Situation in
der Gesundheitswirtschaft am Niederrhein und in
den Niederlanden. Beleuchtet werden
Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Chancen.
Anschließend zeigt ein Best-Practice-Beispiel,
wie eine effektive Kooperation in der
Grenzregion zwischen Deutschland und den
Niederlanden aussehen kann.
Denn
dadurch können Probleme wie lange Wege bis zur
medizinischen Versorgung und der
Fachkräftemangel bewältigt werden. Im Nachgang
können sich die Teilnehmer untereinander
vernetzen.
Moers: Kinder- und
Jugendbüro sucht Hilfskräfte für
Spielmobileinsätze
Bald geht das Spielmobil des Kinder- und
Jugendbüros endlich wieder auf Tour. Das
kunterbunte Spiel- und Spaßangebot ist kostenlos
und richtet sich an 5- bis 12-Jährige. Zu den
Spielgeräten zählen verschiedene Fahrzeuge und
Roller, Balanciergeräte, Stelzen,
Jonglage-Material, Wurf- und Ballspiele,
Hüpfstäbe und vieles mehr.
Alle Kinder sind
herzlich eingeladen, vorbeizukommen und
mitzumachen. Hierfür ist keine Anmeldung
erforderlich.
Das sind die Termine im
März und April
Den Auftakt im Mai macht der
Spielplatz Im Angerfeld (Utfort) am Dienstag,
25. März, und Mittwoch, 26. März.
In den
darauffolgenden Wochen macht das Spielmobil an
folgenden Spielplätzen Halt: Spielplatz
Uranusring (Moers Ost) am 1. und 2. April;
Spielplatz Freizeitpark Kapellen (Kapellen) 9.
und 10. April;
Spielplatz Sperlingsweg
(Hülsdonk) am 15. und 16. April;
Spielplatz
Treibweg (Hochstraß) am 29. und 30. April;
Hilfskräfte für Spielmobileinsätze gesucht
Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Moers
sucht außerdem motivierte, junge Menschen ab 16
Jahren, die Spaß an der Arbeit mit Kindern haben
und die Einsätze des Spielmobils unterstützen
möchten. Es bietet von April bis Oktober an zwei
Nachmittagen in der Woche offene Spiel- und
Freizeitangebote für Kinder auf Spielplätzen in
ganz Moers.
Das Team vor Ort ist
Ansprechpartner für Wünsche und Sorgen der
Kinder. Bei besonderen Veranstaltungen oder
Vermietungen ist das Spielmobil auch am
Wochenende im Einsatz. Die Arbeit wird mit einer
Aufwandsentschädigung honoriert. Auf Wunsch
stellt das Kinder- und Jugendbüro einen Nachweis
für Schule, Ausbildung oder Studium aus.
Robert Hüttinger vom Kinder- und
Jugendbüro beantwortet alle Fragen rund um das
Spielmobil. Interessierte, die die
Spielmobileinsätze unterstützen möchten,
erreichen ihn unter der Rufnummer 0 28 41 /
201-883 und per Mail unter spielmobil@moers.de. Alle
Infos zur Spielmobiltour, aber auch
Spielmaterial und Spielmobilausleihe.
Landrat Ingo Brohl lädt
ein: Marktgespräche 2025 starten am 21. März in
Dinslaken
Um mit Bürgerinnen und Bürgern direkt ins
Gespräch zu kommen, veranstaltet Kreis Wesels
Landrat Ingo Brohl auch in diesem Jahr
Marktgespräche in allen 13 kreisangehörigen
Städten und Gemeinden. Der erste Termin in 2025
findet am Freitag, 21. März 2025, von 10 – 12
Uhr Auf dem Altmarkt in Dinslaken statt.
Landrat Ingo Brohl: "Ich freue mich auch
in diesem Jahr sehr auf die Marktgespräche im
Niederrhein Kreis Wesel. Es ist eine wunderbare
Gelegenheit, direkt mit den Menschen in Kontakt
zu kommen und zu erfahren, was sie bewegt."
Landrat Brohl, der auch Leiter der
Kreispolizeibehörde Wesel ist, wird begleitet
von Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde
Wesel, die ebenfalls für Fragen der Bürgerinnen
und Bürger zur Verfügung stehen.
Wesel ist zum zwölften Mal bei der Earth
Hour am 22. März 2025 dabei
Wesel folgt in diesem Jahr wieder dem Aufruf des
WWF Deutschland und beteiligt sich an der „Earth
Hour“, der Stunde der Erde. Mit der Earth Hour
fordern Menschen, Städte und Unternehmen
weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz. Sie
schalten dafür am Samstag, 22. März, um 20:30
Uhr für eine Stunde das Licht aus, um so ein
Zeichen zu setzen.
Bekannte Bauwerke
stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit,
darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor
in Berlin, der Big Ben in London oder die
Christusstatue in Rio de Janeiro. In Wesel
werden zur Earth Hour neben dem Willibrordi Dom,
dem Lutherhaus und der Rheinbrücke auch in
diesem Jahr wieder die Lichter am Kreishaus, am
Wasserturm der Stadtwerke, am Berliner Tor und
an der Zitadelle ausgeschaltet.
Am
Berliner Tor und an der Zitadelle erfolgt die
Abschaltung in Abstimmung mit der Westnetz AG,
da das Unternehmen dort auch für einen Teil der
Beleuchtung verantwortlich ist. „Die Earth Hour
trägt dazu bei, den Klimaschutz und ein
klimafreundliches Verhalten wieder mehr ins
Bewusstsein der Menschen zu rufen“, so Bibiana
Piskurek, Klimaschutzmanagerin der Stadt Wesel.
In diesem Jahr steht die Aktion
unter dem Motto „Licht aus. Stimme an. Für einen
lebendigen Planeten“. Der WWF ruft nicht nur
dazu auf, das Licht auszustellen, sondern auch
die Stimme zu erheben. Ganz egal, ob im Privaten
oder auf der Straße, alleine oder mit Band oder
Chor: Zur Earth Hour können alle Menschen
zeigen, dass ihre Stimme zählt und dass sie ihre
Stimme für den Klima- und Umweltschutz
einsetzen.
Auf der Internetseite www.wwf.de/earth-hour gibt
es hierzu einige Anregungen. Die WWF-Earth Hour
findet seit 2007 jährlich statt. Mittlerweile
wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten
gefeiert.
In den vergangenen Jahren haben
sich tausende Städte in 192 Ländern beteiligt,
allein in Deutschland haben zuletzt 560 Städte
und Gemeinden teilgenommen. Wesel beteiligt sich
zum zwölften Mal an der Earth Hour. Alle Infos
zum Mitmachen gibt es unter wwf.de/earth-hour
Spenden für neue Reckstangen auf
Spielplatz in Vinn
Gemeinsam für die Kinder in Vinn: Die freuen
sich jetzt nämlich nach einer Spendenaktion über
neue Reckstangen auf ihrem Spielplatz an der
Helmholtzstraße.

Spielplatzpatin, Eltern, Kita und das Kinder-
und Jugendbüro haben gemeinsam den Wunsch nach
Reckstangen auf dem Spielplatz Helmholtzstraße
in Vinn erfüllt. (Foto: pst)
Ausgangspunkt war ein Sommerfest, das die
Spielplatzpatin Gertrud Gallmann gemeinsam mit
Familie Luick aus Vinn veranstaltet hat. Dort
haben sich einige Kinder Reckstangen gewünscht.
Daraufhin haben Eltern, Kath. Kita St. Elisabeth
und ihr Förderverein Spenden gesammelt. Es gab
u. a. einen Waffelverkauf.
500 Euro
haben die Spielplatzpatin und Eltern gesammelt,
300 Euro hat der Kita-Förderverein draufgelegt.
Das dann noch fehlende Geld hat die Stadt
beigesteuert. „Das ist ein tolles Beispiel für
bürgerschaftliches Engagement und ein starkes
Signal der Vinner“, freut sich Mark
Bochnig-Mathieu vom Kinder- und Jugendbüro. „Es
zeigt auch, wie wichtig Spielplatzpaten sind,
denn aktuell hatten wir für Reckstangen kein
Budget eingeplant.“
Weitere
Spielplatzpaten gesucht Damit solche Aktionen
keine Einzelfälle bleiben, sucht das Kinder- und
Jugendbüro ständig neue Spielplatzpatinnen und
–paten. Sie setzen sich für die jeweilige Anlage
ein, organisieren kleine Feste, melden
Beschädigungen oder Müll. Ergebnisse sind nicht
nur Feste und Spendenaktionen wie in Vinn,
sondern auch der allgemeine Rückgang von
Vandalismus auf den insgesamt 24 betreuten
Plätzen.
„Die Verantwortung bleibt
natürlich bei uns, aber durch das ehrenamtliche
Engagement wissen wir immer, ob es irgendwo
Probleme oder Wünsche gibt“, erklärt Mark
Bochnig-Mathieu.
Alle Infos zu Spielplatzpaten. Direkter
Kontakt: spielplatz@moers.de,
Telefon: 0 28 41 / 201-834
Volkshochschule Moers -
Kamp-Lintfort: Die 7 größten Fehler bei der
Kapitalanlage Sie lernen in diesem
Vortrag, was Sie bei der Anlage von Geld
grundsätzlich vermeiden sollten, warum ein
einzelner Fehler Ihr ganzes Kapital/Lebenswerk
zerstören kann und warum die Geschichte von den
Eiern im Korb auch bei der Geldanlage wichtig
ist. Kennen Sie schon den Unterschied zwischen
aktiv und passiv gemanagten Fonds oder die große
Gefahr von Klumpenrisiken?
Im
Vortrag erfahren Sie, was es damit auf sich hat.
Sie werden anhand eines Kurzvideos erarbeiten,
wie Ihr Gehirn in Kapitalmärkten arbeitet und
welche emotionsgeladene Handlungen hieraus
erfolgen. Was das alles mit Medien aus TV und
Internet zu tun hat, wird Ihnen ebenfalls
aufgezeigt sowie die Gefahr von
Interessenkonflikten bei der "Anlageberatung".
Ein spannender Vortrag für alle, die
Fehler bei der Geldanlage vermeiden möchten und
zukünftig mehr aus ihrem Ersparten machen
wollen. Eine Anmeldung ist erforderlich.
Referent: Udo Nienhuysen Kurs-Nr.: F10342
Gebühr: 7 Euro.s Veranstaltungsdatum 20.03.2025
- 18:30 Uhr - 20:45 Uhr .Veranstaltungsort.
Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort Adresse
Wilhelm-Schroeder-Straße 10 47441 Moers
Sportgala 2025: Ehrung der Moerser
Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2024.
Veranstaltungsdatum 21.03.2025 - 00:00
Uhr - 22.03.2025 - 02:00 Uhr. Veranstaltungsort
ENNI Sportpark Rheinkamp. Adresse Am
Sportzentrum 5 47445 Moers. Telefon
0 28 41 / 104-475 Internetseite
https://www.enni.de/freizeit/baeder/sportbad-im-enni-sportpark-rheinkamp/
Veranstalter Firma Stadtsportverband Moers e. V.
Moers: ComedyArts - Frau Jahnke hat
eingeladen …
Einlass: 19.30 Uhr ..und zwar
Lieblingskolleginnen aller Genres, Alter,
Haarfarben. Wir wollen nicht mehr darüber reden,
dass es nur so wenige gute Frauen in der Szene
gäbe. Wir sind präsent, und wir sind viele. Wir
behaupten uns elegant und leichtfüßig neben all
dem Männerkabarett. Wir sind nicht in
Konkurrenz.
Wir machen unseren Job –
in Kabarett, Comedy, Liedgut, Slapstick und
Poetry, im TV, im Netz und auf den Bühnen. Wir
sind witzig, politisch, böse, moralisch oder
absurd, wir können singen oder eher nicht, und
meistens sind wir schön! Und live ist das alles
noch viel spannender.
“Frau Jahnke
hat eingeladen” heißt: Wir haben Zeit, und wir
lassen uns gehen. Jeder Abend ist anders, jeder
ist wunderbar. Und inzwischen kommen auch eine
Menge Männer zu unseren Damenshows. Freiwillig!
Das ist gut! Und es geht noch besser – wir
arbeiten dran!
Veranstalter:
Internationales ComedyArts Festival Moers &
Bollwerk Gefördert durch: Sparkasse am
Niederrhein
Ticket online-Shop Veranstaltungsdatum
22.03.2025 - 20:00 Uhr - 22:00 Uhr.
Veranstaltungsort ENNI Eventhalle, Filder Straße
142. 47447 Moers.
Moers:
Streifzug durch die deutsche Fernsehgeschichte
Vor 75 Jahren begann mit der ersten
Testbild-Ausstrahlung die deutsche
Fernsehgeschichte. In einem Vortrag geht die vhs
Moers – Kamp-Lintfort am Donnerstag, 27. März,
mit unterhaltsamen Ausschnitten der Entwicklung
des deutschen Fernsehens nach.
Im
Fokus stehen auch die Veränderungen durch die
Zulassung der Privatsender und es wird mit Blick
auf die Streaming-Dienste eine Zukunftsprognose
gewagt. Der Vortrag ‚Ziele des Fernsehens: Ein
Streifzug durch 75 Jahre deutsche
Fernsehgeschichte‘ beginnt um 19 Uhr in der vhs,
Altes Landratsamt, Kastell 5b.
Eine
rechtzeitige Anmeldung ist erforderlich und
telefonisch unter 0 28 41/201 – 565 oder online
unter www.vhs-moers.de möglich.
Wesel:
Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei
Ende März findet wieder ein großer Flohmarkt in
der Stadtbücherei Wesel statt. Am Donnerstag,
den 27. März 2025, und Freitag, den 28. März
2025, kann von 10.30 Uhr – 18.30 Uhr gestöbert
werden.
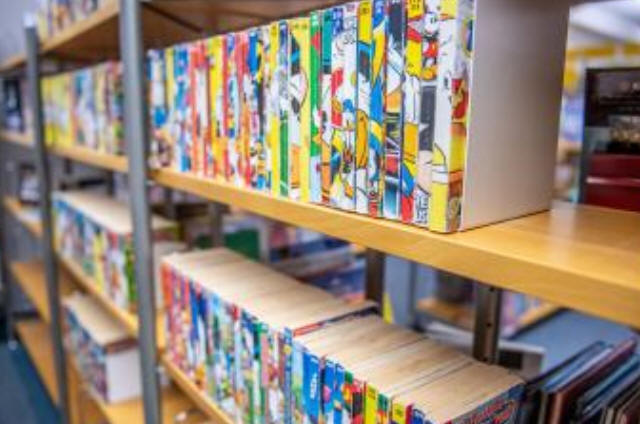
Quelle: Flaggschiff Film
Am
Samstag, den 29. März 2025 stehen die
Flohmarkt-Schätze im zweiten Obergeschoss der
Bücherei von 10 – 13 Uhr bereit. Auf die
Besucher*innen warten gute Reiseführer und
vielfältige Sachbücher, Romane, Kinder- und
Jugendbücher, CDs, DVDs und Zeitschriften zu
kleinen Preisen.
Moers: 120
Jahre Bergbau (Radtour)
Der Streit um Schacht 5 der Zeche Rheinpreußen
ist Anlass, auf einer Fahrradtour die
Entwicklung des Bergbaus in Moerser Raum und
seine Bedeutung für das Landschaftsbild, die
Siedlungs-, Sozial- und Wirtschaftsstruktur
herauszustellen.
Geführt
von Dr. Wilfried Scholten.
Weitere Infos zu den Stadtführungen. Kosten:
10 Euro Event details Veranstaltungsdatum
23.03.2025 - 10:30 Uhr - 14:00 Uhr.
Veranstaltungsort Bahnhof Moers. Homberger
Straße 105, 47441 Moers. Veranstalter Stadt- und
Touristinformation Moers.
Moers: Fynn Jacob: Brennendes Watt
Das Bollwerk 107 lädt zur Krimilesung mit Fynn
Jacob am Donnerstag, 20. März, ein. Zum Roman:
Iska van Loon, erfahrene Beamtin der Nationale
Politie, und der zielstrebige
Kriminalhauptkommissar Marten Jaspari stehen vor
einem brisanten Fall. Luuk Raand, Mitarbeiter
einer Sicherheitsfirma, die das LNG-Terminal bei
Eemshaven schützt, wird tot am Strand von Borkum
angespült.

Foto-Copyright: Jürgen Naber
Eine Spur
führt zu radikalen Umweltschützern, die
Missstände bei der Erdgasverarbeitung aufdecken
wollen, eine andere in das undurchsichtige
private Umfeld des Opfers. Als schließlich im
Hamburger Hafen der Kapitän eines
Containerschiffes verschwindet, erreicht der
Fall ungeahnte Dimensionen.
Iska und
Marten müssen alles riskieren, um zu verhindern,
dass die Nordsee sich in ein Flammeninferno
verwandelt. Zum Autor: Fynn Jacob heißt im
richtigen Leben Christian Kuhn und lebt in
Langenfeld in der Nähe seiner Geburtsstadt Köln,
ist der Nordsee und ihren Inseln jedoch schon
seit Kindertagen verbunden.
Die
unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlichten
Kriminalromane »Nordseedämmerung« und
»Nordseedunkel« spielen auf den ostfriesischen
Inseln Juist und Norderney, die neue Romanreihe
um Marten Jaspari und Iska van Loon an
unterschiedlichen Orten sowohl an der deutschen
als auch der niederländischen Nordseeküste.
Kuhn ist Mitglied im SYNDIKAT e.V., dem
Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur.
Tickets sind unter www.bollwerk107.de erhältlich!
Veranstaltungsdatum 20.03.2025 - 20:00
Uhr - 22:30 Uhr. Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107, 47441 Moers.
Lesung
„Niederrheinische Sagen“ von Ute Heymann genannt
Hagedorn im Kreishaus Wesel
Am Donnerstag, 27. März 2025, findet im Foyer
des Kreishauses Wesel (Reeser Landstraße 31,
46483 Wesel) um 18.30 Uhr eine Lesung von
Autorin Ute Heymann genannt Hagedorn mit dem
Titel „Niederrheinischen Sagen“ statt. Sie ist
in Voerde aufgewachsen und hat neben ihrer
Tätigkeit bei der Stadtverwaltung Wesel das
Handwerk des Schreibens u.a. in Hamburg,
Wolfenbüttel und in Kirchheim unter Teck,
erlernt.
Nachdem sie die Rechte am
Weseler Sagenbuch erworben hatte, schrieb sie es
um. Bei den niederrheinischen Ursprungstexten
handelt sich um kleine Blätter, die Ende der
1930er Jahre als Beilagen in den Tageszeitungen
erschienen sind. Aus den Pressenotizen schuf die
Autorin amüsante Kurzgeschichten, die daraufhin
im Jahrbuch des Kreises Wesel veröffentlicht
wurden. Seit einigen Jahren liegen diese auch
als Hörbuch vor, das Frau Heymann genannt
Hagedorn selbst eingesprochen hat.
Obwohl die Sagen der Autorin inhaltlich
vorgegeben waren, ist es ihr gelungen, sie
unterhaltsam umzuschreiben. In der Lesung im
Kreishaus lässt sie jede Figur mit ihrer eigenen
Stimme und einem eigenen, zuweilen skurrilen
Charakter auftreten. Heymann legt Wert darauf,
mit ihren Texten Mut zu machen und Lösungen
aufzuzeigen. Sie ist davon überzeugt, dass
Menschen grundsätzlich gut sind, Situationen
weniger schwerwiegend, als zunächst angenommen
und Probleme häufig aus vermeidbaren Hemmungen,
Vorurteilen und mangelndem Wissen über andere
entstehen.
„Mit der Lesung von Ute
Heymann genannt Hagedorn im Kreishaus bieten wir
allen Interessierten eine wunderbare
Gelegenheit, in die faszinierende Welt der
Niederrheinischen Sagen einzutauchen. Sie
schafft es auf einzigartige Weise, historische
Erzählungen lebendig und unterhaltsam zu
gestalten. Besonders freut es mich, dass sie mit
ihren Texten nicht nur kulturelles Erbe bewahrt,
sondern auch positive Impulse für den Umgang
miteinander vermittelt.
Ihre
Geschichten zeigen, wie aus vermeintlich
schwierigen Situationen neue Perspektiven und
Lösungen erwachsen können. Ich freue mich auf
einen unterhaltsamen und inspirierenden Abend im
Kreishaus“, so Landrat Ingo Brohl Inzwischen
gibt es von ihr neben dem Hörbuch zahlreiche
Kurzgeschichten, zwei im Mittelalter spielende
Kinderbücher, Kriminalgeschichten und Beiträge
in Anthologien.
Ein Roman um
Flüchtlinge aus dem Jahre 1732 steht kurz vor
der Veröffentlichung. Zur Eröffnung der Lesung
von Ute Heymanns genannt Hagedorns spricht
Landrat Ingo Brohl das Grußwort. Weitere
Informationen gibt Marina Tsoukalas (Tel:
0281-207 2217 oder per Email:
marina.tsoukalas@kreis-wesel.de).

Immer weniger Erwachsene in NRW
verheiratet
Zum Zensusstichtag am 15. Mai 2022 lebten knapp
7,7 Millionen verheiratete Menschen in
Nordrhein-Westfalen. Wie das Statistische
Landesamt mitteilt, war damit etwa jede zweite
volljährige Person in NRW verheiratet
(51,5 Prozent). Zum Vergleich: Zur Volkszählung
1970 belief sich der Anteil verheirateter
Personen ab 18 Jahren noch auf mehr als zwei
Drittel (70,2 Prozent).
Anteil
geschiedener Menschen seit 1970 um mehr als das
Vierfache gestiegen
Im Jahr 1970 lebten rund
273 000 Geschiedene in Nordrhein-Westfalen. 1987
betrug diese Anzahl schon über 642 000; 2022
waren es dann knapp 1,4 Millionen. Gemessen an
der Bevölkerung ab 18 Jahren hat sich der Anteil
Geschiedener damit von 2,2 Prozent im Jahr 1970
auf 9,3 Prozent im Jahr 2022 mehr als
vervierfacht.
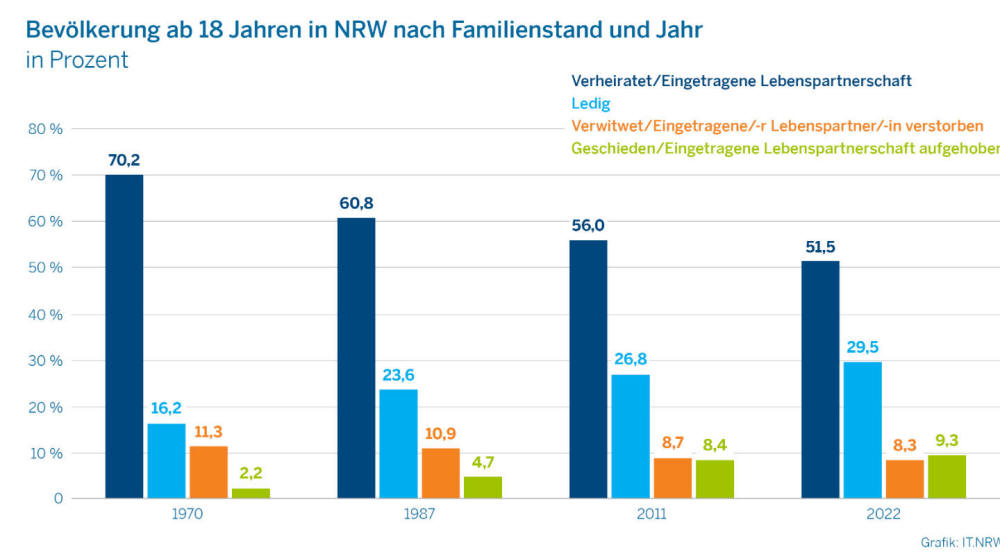
Ebenfalls ist der Anteil lediger Erwachsener
im selben Zeitraum in NRW von 16,2 Prozent auf
29,5 Prozent gestiegen. Dagegen ist die Quote
verwitweter Erwachsener in NRW von 11,3 Prozent
im Jahr 1970 auf 8,3 Prozent im Jahr 2022
zurückgegangen.
Anteil verheirateter
Erwachsener variiert NRW-weit zwischen 37,8 und
62,1 Prozent
Auf Ebene der Gemeinden zeigt
sich, dass Erwachsene in Gemeinden mit
niedrigerem Verstädterungsgrad
überdurchschnittlich häufig verheiratet sind. So
waren 2022 in NRW 57,3 Prozent der volljährigen
Bevölkerung in Gemeinden mit einem niedrigen
Verstädterungsgrad verheiratet.
Demgegenüber waren Erwachsene in Kommunen mit
einem hohen Verstädterungsgrad (wie
beispielsweise in Großstädten im Ruhrgebiet,
entlang des Rheins oder in den
Universitätsstädten Aachen, Münster, Bielefeld
und Paderborn) im Schnitt seltener verheiratet
(47,9 Prozent). Die Spannweite reichte von
Odenthal im Rheinisch-Bergischen Kreis mit
62,1 Prozent verheirateten Erwachsenen bis zur
kreisfreien Stadt Aachen mit 37,8 Prozent
volljährigen verheirateten Personen.
In städtischeren Gebieten leben prozentual
mehr ledige Erwachsene als in ländlicheren
Spiegelbildlich verhielt sich der Anteil
Geschiedener: So waren 7,8 Prozent der
Erwachsenen in Gemeinden mit niedrigem
Verstädterungsgrad zum Zensusstichtag 2022
geschieden. In dicht besiedelten Kommunen lag
dieser Anteil dagegen bei 9,7 Prozent. Ein
ähnliches regionales Muster zeigt sich beim
Anteil lediger Erwachsener in den NRW-Kommunen.
Während in Gebieten mit hohem
Verstädterungsgrad der Anteil lediger
Erwachsenen bei gut einem Drittel lag
(32,9 Prozent), war anteilig in gering
besiedelten Gemeinden durchschnittlich nur etwa
jede vierte volljährige Person ledig
(25,2 Prozent). Beim Anteil der verwitweten
Personen sind für das Jahr 2022 NRW-weit
vergleichsweise geringe Unterschiede zwischen
dicht besiedelten und weniger dicht besiedelten
Gemeinden festzustellen. Allerdings gab es auch
hier regionale Differenzen: So reichte die
Spannweite von 5,9 Prozent in Münster bis zu
13,1 Prozent verwitweten Erwachsenen in Bad
Sassendorf im Kreis Soest.
Baugenehmigungen für Wohnungen im Januar 2025:
+6,9 % zum Vorjahresmonat
Baugenehmigungen in Neubauten im Januar 2025 zum
Vorjahresmonat: +21,7 %
bei
Einfamilienhäusern -10,1 %
bei
Zweifamilienhäusern +5,8 % bei
Mehrfamilienhäusern
Im Januar 2025 wurde
in Deutschland der Bau von 18 000 Wohnungen
genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, waren das 6,9 % oder 1 200
Baugenehmigungen mehr als im Januar 2024. Damit
stieg die Zahl der Baugenehmigungen im
Vorjahresvergleich zum zweiten Mal in Folge,
nachdem sie im Dezember 2024 bereits um 5,1 %
gegenüber Dezember 2023 gestiegen war.
Zuvor war die Zahl der zum Bau genehmigten
Wohnungen seit April 2022 durchgängig gegenüber
dem jeweiligen Vorjahresmonat gesunken. In
diesen Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen
für Wohnungen in neuen Wohn- und
Nichtwohngebäuden als auch für neue Wohnungen in
bestehenden Gebäuden enthalten.
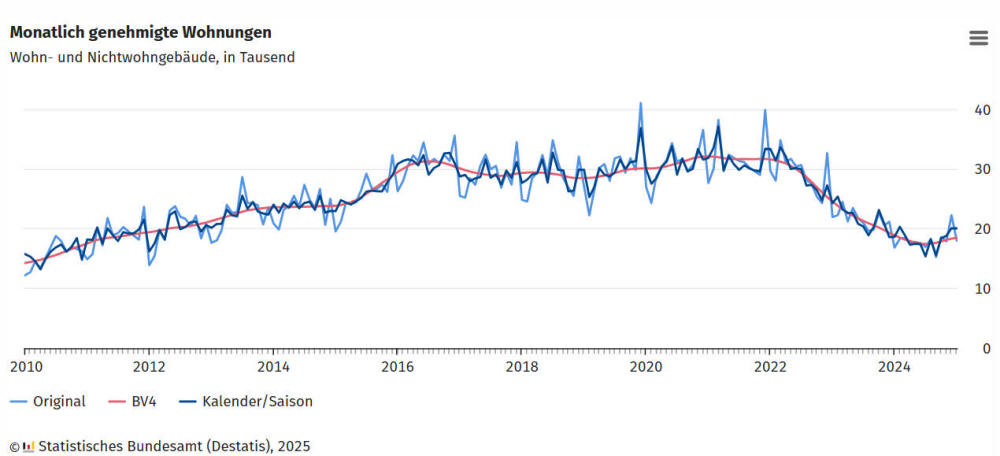
In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden
im Januar 2025 insgesamt 15 100 Wohnungen
genehmigt. Das waren 11,6 % oder 1 600 Wohnungen
mehr als im Vorjahresmonat. Dabei stieg die Zahl
der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um
21,7 % (+600) auf 3 400 Wohnungen an.
Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl
genehmigter Wohnungen um 10,1 % (-100) auf 1 000
Wohnungen. Bei der zahlenmäßig stärksten
Gebäudeart, den Mehrfamilienhäusern, erhöhte
sich die Zahl der genehmigten Wohnungen um 5,8 %
(+500) auf 9 800 Wohnungen.
Verbraucherpreise in NRW: 2024 waren u. a. die
Entgelte für stationäre Pflege, Altenwohnheime
oder betreutes Wohnen preistreibend
Im Jahresdurchschnitt 2024 war der
Verbraucherpreisindex um 2,2 Prozent höher als
ein Jahr zuvor (Basisjahr 2020 = 100). Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, haben im
vergangenen Jahr die Preise der Gütergruppe
„Andere Waren und Dienstleistungen” am stärksten
zur Inflationsrate beigetragen; darunter fallen
unter anderem die Preise für Güter und
Dienstleistungen aus dem Bereich Körperpflege,
Dienstleistungen sozialer Einrichtungen sowie
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen.
Der Beitrag von „Andere Waren und
Dienstleistungen” zur Inflationsrate 2024 lag
bei 0,6 Prozentpunkten. Die Preise für diese
Abteilung sind zwischen 2023 und 2024 mit
6,3 Prozent überdurchschnittlich gestiegen. Hohe
Veränderungsraten verzeichneten vor allem die
Beiträge zur Kraftfahrzeugversicherung
(+29,1 Prozent), die Entgelte für stationäre
Pflege für privat Versicherte (+11,5 Prozent)
sowie gesetzlich Versicherte (+10,5 Prozent) und
die Aufwendungen für Altenwohnheime oder
betreutes Wohnen (+6,2 Prozent).
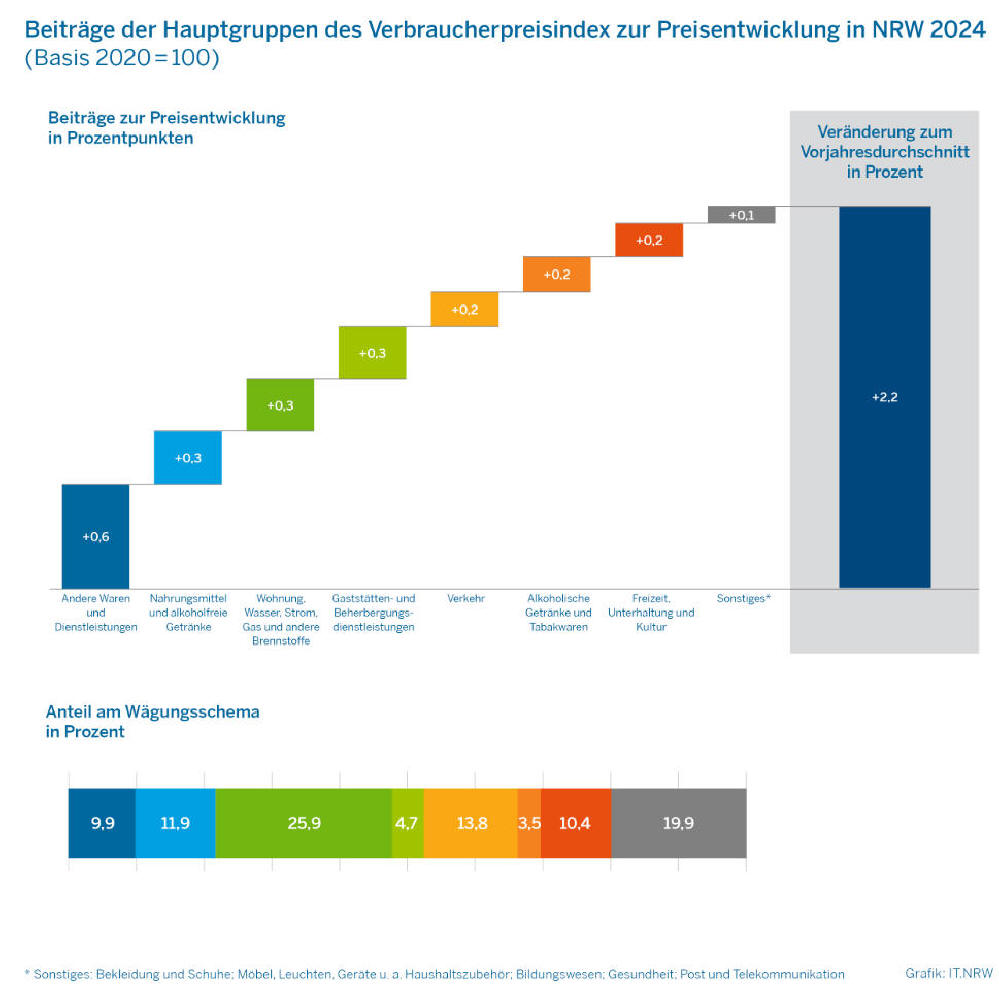
Wie groß der Einfluss der einzelnen Bereiche
auf die Inflationsrate 2024 war, verdeutlicht
die Darstellung der sogenannten Beiträge zur
Inflation in Prozentpunkten. Neben der Höhe der
Preisveränderungen sind für die Berechnung auch
die jeweiligen Gewichtungen (sog. Wägungsanteil)
ausschlaggebend, mit der diese Güter in den
Preisindex insgesamt einfließen.
Speisen
und Getränke in Restaurants, Cafés, Bars u. Ä.
und Übernachtungen sorgten für deutliche
Preisanstiege
Die Abteilung „Gaststätten-
und Beherbergungsdienstleistungen” lieferte –
neben „Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke”
und „Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere
Brennstoffe” – mit 0,3 Prozentpunkten einen der
höchsten Beiträge zur Inflationsrate. Hier
verzeichneten insbesondere Speisen und Getränke
in Restaurants, Cafés, Bars u. Ä. (+7,8 Prozent)
und Übernachtungen (+5,8 Prozent) Preisanstiege.
Dienstag, 18.
März 2025
„Weihnachtsbäckerei“ ist Deutschlands
schönste Briefmarke 2024
Fast 30.000 Personen haben an der Umfrage der
Deutschen Post teilgenommen
Auf den Plätzen 2
und 3: „Hund“ und „Kryptomarke Kölner Dom“
Liedermacher Rolf Zuckowski: „Mit der Briefmarke
wollten wir Kinder für das Schreiben und
Empfangen von Briefen begeistern“
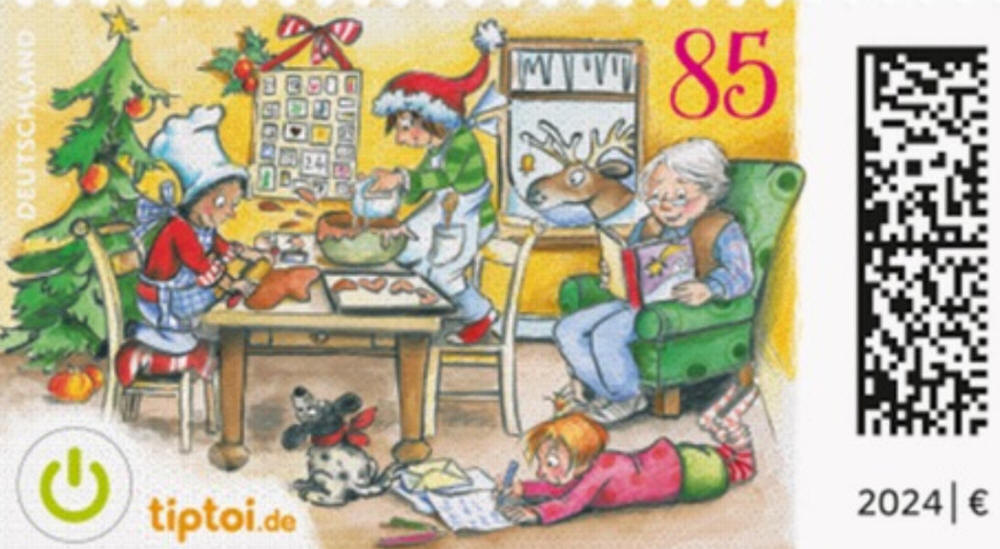
Deutschlands Briefmarkenfreunde haben
abgestimmt: Mit knappem Vorsprung ist die
Briefmarke „Weihnachten für Kinder -
Weihnachtsbäckerei“ zur schönsten Briefmarke des
Jahres 2024 gewählt worden. Die 85 Cent-Marke
hat die Künstlerin Julia Ginsbach illustriert.
Sie zeigt eine adventlich geschmückte Wohnstube,
in der Kinder eifrig Plätzchen backen, während
Opa die Weihnachtsgeschichte vorliest.
Auf Platz 2 folgt das Motiv „Hund“ aus der
Briefmarken-Serie „Beliebte Haustiere“, das
einen freundlich in die Kamera blickenden Border
Collie zeigt. Platz 3 geht an die Krypto-Marke
„Kölner Dom“, deren Motiv von einer Künstlichen
Intelligenz gestaltet wurde. Fast 30.000
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bei der
Umfrage der Deutschen Post mitgemacht.
Die Sonderbriefmarke mit dem Siegermotiv
„Weihnachtsbäckerei“ hatten Deutsche Post,
Liedermacher Rolf Zuckowski und Ravensburger
Verlag gemeinsam Anfang November vergangenen
Jahres präsentiert. Der Clou ist, dass man die
Briefmarke auch hören kann, z. B. Liedzeilen des
Ohrwurms „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf
Zuckowski, kurze Dialoge der abgebildeten
Personen, die Weihnachtsgeschichte oder
Wissenswertes rund um den Advent.
Mit
einem tiptoi® Stift von Ravensburger können
Kinder und Erwachsene die Audioinhalte auf dem
mit viel Liebe zum Detail gestalteten Motiv zum
Klingen bringen. So wurde aus der Weihnachtspost
2024 auch ein echtes, weltweit einmaliges
Hörerlebnis und eine Entdeckungsreise für Jung
und Alt.
Dazu Rolf Zuckowski,
Liedermacher und Komponist: „Ich freue mich
sehr, dass die Sondermarke ‚Weihnachtsbäckerei‘
zur schönsten Briefmarke des Jahres 2024 gewählt
worden ist. Sie würdigt nicht nur die Tradition
des Plätzchenbackens in der Adventszeit, die ich
seit 1987 mit meinem Lied begleite. Mit der
Briefmarke wollten wir zudem Kinder und ihr
Umfeld für das Schreiben und Empfangen von
Briefen begeistern. Das scheint uns gelungen zu
sein und wir haben ein wichtiges kulturelles
Zeichen in dieser zunehmend digitalen Welt
gesetzt. Die Illustratorin Julia Ginsbach hat
mit ihrem bezaubernden Kunstwerk viel dazu
beigetragen. Dafür danke ich ihr von Herzen."
Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket
Deutschland der DHL Group, sagt: „Wir bedanken
uns bei den vielen Menschen, die an unserer
Umfrage zur schönsten Briefmarke teilgenommen
haben. Für die Deutsche Post ist dieses Feedback
sehr wichtig, um auch künftig bei der Gestaltung
neuer Briefmarken-Motive den Nerv unserer
Kundinnen und Kunden zu treffen. Dass diesmal
die ‚Weihnachtsbäckerei-Marke‘ gewonnen hat,
freut mich sehr, denn sie erinnert uns in diesen
unübersichtlichen Zeiten an liebgewonnene
Traditionen – bildlich und akustisch.“
Details zur Umfrage
Insgesamt gefiel den
Umfrageteilnehmern an den drei Siegermotiven die
vermittelte Stimmung und Farbgebung, die
Briefmarke „Weihnachtsbäckerei“ fanden zwei
Drittel originell. 55 Prozent der Teilnehmer an
der Umfrage waren weiblich. Für das Siegermotiv
stimmten sogar 74 Prozent Frauen ab.
64
Prozent aller Teilnehmer gehörten der
Altersgruppe 50+ an, wobei fast die Hälfte
derjenigen, die für das Motiv
“Weihnachtsbäckerei” votierten, zwischen 30 und
49 Jahre alt waren. 13 Prozent bezeichneten sich
selbst als Sammler. Neun der Briefmarken, die es
bei der Umfrage in die „Top Ten“ geschafft
haben, sind von Briefmarkendesignerinnen und
-designern der Deutschen Post gestaltet worden.
Im Zeitraum vom 6. Februar bis 6. März 2025
konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
einer öffentlichen Online-Befragung für ihre
drei Favoriten des vergangenen Jahres abstimmen.
Bereits in den Jahren zuvor hatte die
Deutsche Post eine Wahl zur schönsten Briefmarke
durchgeführt. 2023 gewann das Motiv „100 Jahre
Disney“, davor landete mit dem „Polarlicht“
erstmals ein Naturbild auf Platz 1. 2021 war
„Sendung mit der Maus“ die schönste Briefmarke,
2020 „Die Biene Maja“.
Moers:
Ausschuss berät über Grillen im Park und
Schulwegplanung in Schwafheim
Enni baut auf einem Teil der Fläche des Freibads
Solimare ein Grillareal. Es soll zur Grillsaison
2026 eröffnet werden. Bis dahin ist das Grillen
nur im ausgeschilderten Bereich Bettenkamper
Meer im Freizeitpark möglich, so der Vorschlag
der Verwaltung.
Der Ausschuss für
Stadtentwicklung, Planen und Umwelt entscheidet
am Donnerstag, 20. März, darüber.
Weitere Themen sind die Schulwegplanung für die
Waldschule in Schwafheim, die Sanierung der
Neukirchener Straße und Ehrenmalstraße sowie die
Anlage eines Parkplatzes auf der Fläche des
abgerissenen Parkhauses Kautzstraße. Die
öffentliche Sitzung beginnt um 16 Uhr im
Ratssaal des Rathauses Moers (Rathausplatz 1).
Moers: Kulturausschuss
erhält Bericht über Hüsch-Jahr und
Theater-Jubiläum
Verschiedene
Berichte erhalten die Mitglieder des
Kulturausschusses am Mittwoch, 19. März. Die
Sitzung findet um 16 Uhr im großen Sitzungssaal
des Alten Rathaus (Rathausplatz 1) statt. Der
Zugang ist auch über den Eingang an der
Unterwallstraße möglich.
Auf der
Tagesordnung stehen unter anderem Informationen
zum 50-jährigen Bestehen des Schlosstheaters
Moers und zu den zahlreichen Veranstaltungen im
diesjährigen Hüsch-Jahr. Der Moerser Kabarettist
und Ehrenbürger wäre im Mai 100 Jahre alt
geworden. Zudem stellen die Institutionen des
Eigenbetriebs Bildung ihr Jahresberichte vor.
Moers: Beirat gratulierte
Heinz-Peter Maas zum Verdienstkreuz am Bande
Sein ‚besonderer‘ Tag war der 31.
Januar 2025. Da erhielt Heinz-Peter Maas für
sein langjähriges Engagement u. a. im
Berufsförderwerk für Blinde und Sehbehinderte
sowie im Blinden- und Sehbehindertenverein den
Verdienstorden am Bande der Bundesrepublik
Deutschland. Zudem ist er Gründungsmitglied des
damaligen Behindertenbeirats und seit 1998
dabei.

Karl Rudolf Slavernik (1. von rechts),
Vorsitzender des Beirats für Menschen mit
Behinderung, seine Stellvertreterin Fatime Elezi
(2. von links), die städtische
Behindertenkoordination Kirsten Wortmann (2. von
rechts) und Jörg Rodeike vom KSL (1. von links)
gratulierten Heinz-Peter Maas zur Verleihung des
Verdienstkreuzes. (Foto: pressestelle).
Karl Rudolf Slavernik, Vorsitzender des
heutigen Beirats für Menschen mit Behinderung,
seine Stellvertreterin Fatime Elezi und die
städtische Behindertenkoordination Kirsten
Wortmann haben dem 82-Jährigen in der letzten
Sitzung am Dienstag, 11. März, zu dieser Ehrung
gratuliert.
„Selbst in Ihrem Alter
lassen Sie nicht los und arbeiten weiter am Ziel
der Selbstbestimmung und Mitwirkung von Menschen
mit Behinderung in unserer Gesellschaft“, lobte
ihn Slavernik in seiner kurzen Rede.
Politische Teilhabe stärken
Ein weiteres
Thema der Sitzung war die politische
Partizipation von Menschen mit Behinderung. Jörg
Rodeike vom ‚Kompetenzzentrum Selbstbestimmt
Leben Düsseldorf‘ (KSL) erläuterte die
beabsichtigte Änderung der rechtlichen Lage.
Kommunen können derzeit Interessenvertretungen
für bestimmte Personengruppen oder Beauftragte
bilden bzw. benennen.
Diese
Kann-Bestimmung soll in eine Verpflichtung
umgewandelt werden. Es hat sich inzwischen das
Bündnis ‚GO NRW - politische Teilhabe stärken‘
gebildet, das das Bestreben vorantreibt. Rodeike
koordiniert die Arbeit des Bündnisses mit der
Landespolitik und den kommunalen
Spitzenverbänden.
Moers: Mit
Nachtwächterin durch die Altstadt spazieren
Ausgestattet mit Laterne, Horn und
Schlapphut begrüßt Gästeführerin Erika Ollefs
die Teilnehmenden des Stadtrundgangs am Freitag,
21. März, um 20 Uhr. Start ist am Denkmal von
König Friedrich I. auf dem Neumarkt. In
historischer Gewandung berichtet die
Gästeführerin über die Tätigkeiten des alten
Berufsstandes in Moers. Die Nachtwächter mussten
damals nicht nur die Tore öffnen und schließen,
sondern auch nachts in den Gassen nach dem
Rechten sehen. Die Teilnahme kostet pro Person 8
Euro.
Bergbaugeschichte in
Moers auf dem Rad entdecken
Die über
90-jährige Geschichte des Bergbaus im Moerser
Raum beleuchtet eine Radtour am Sonntag, 24.
März. Start ist um 10.30 Uhr vor dem Bahnhof
Moers, Homberger Straße. Der damalige Streit der
benachbarten Kommunen um Schacht 5 der Zeche
Rheinpreußen ist Anlass der Stadtführung.
Gästeführer Dr. Wilfried Scholten stellt die
Entwicklung des Bergbaus in der Gegend und seine
Bedeutung für das Landschaftsbild, die
Siedlungs-, Sozial- und Wirtschaftsstruktur
heraus. Die Teilnahme kostet pro Person 10 Euro.
Verbindliche Anmeldungen zu den Führungen nimmt
die Stadt- und Touristinformation von Moers
Marketing entgegen: Kirchstraße 27a/b, Telefon 0
28 41 / 88 22 6-0.
Führung
zu Salmorth und Schenkenschanz:
Sa., 22.03.2025 - 14:00 - Sa., 22.03.2025
- 17:00 Uhr
Die Halbinsel Salmorth nördlich
von Kleve ist ein landschaftliches Highlight im
Klever Land und ein „Mekka" für die Gefiederten.
Neben den Kursschwerpunkten Vogelwelt und
Auen-Landschaft erfahren die Teilnehmenden
Wissenswertes aus der wechselvollen Geschichte
der einstigen, umkämpften Festung
Schenkenschanz.

Anmeldung:
https://www.vhs-kleve.de/kurssuche/kurs/Salmorth-und-Sche
Wichtig: Wetterfeste Kleidung, Fernglas, Wanderschuhe
vhs Moers – Kamp-Lintfort: Besuch
der Verbrennungsanlage Asdonkshof
Die
Prozesse der Abfallentsorgung sind komplex und
hochmodern. Ein Bild darüber machen können sich
Interessierte beim Besuch des
Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof mit der vhs
Moers – Kamp-Lintfort am Mittwoch, 26. März.
Unter dem Motto ‚Was passiert mit meinem
Müll? – Abfallentsorgung vor Ort kennenlernen‘
gibt es Einblicke in die Verbrennungs- und die
Schlackenaufbereitungsanlage sowie in das
Kompostwerk.
Treffpunkt ist um 17 Uhr in
Kamp-Lintfort am Asdonkshof, Graftstraße 25.
Die kostenlose Veranstaltung ist eine
Kooperation der vhs mit dem
Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof. Eine
vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich
und telefonisch unter 0 28 41/201 – 565 oder
online unter www.vhs-moers.de möglich.
Mehr als 120
Wissenschaftler*innen rufen zur gesetzlichen
Stärkung von Tarifautonomie und Tarifbindung auf
Mehr als 120 Wissenschaftler*innen rufen in
einem gemeinsamen Appell die Verhandler*innen
von Union und SPD dazu auf, die Tarifautonomie
zu stärken und dazu im Koalitionsvertrag
konkrete gesetzliche Regelungen für mehr
Tarifbindung zu vereinbaren. Die Forschenden,
überwiegend Professor*innen der Wirtschafts-,
der Sozial, und der Rechtswissenschaften,
argumentieren, dass eine hohe Tarifbindung
Niedriglöhne, Armut und soziale Ungleichheit
reduziere.
Das hat nicht nur
gesamtwirtschaftlich positive Auswirkungen,
sondern stärkt nach Analyse der
Unterzeichner*innen auch die Demokratie, weil
ungleiche Gesellschaften von politischer
Polarisierung gekennzeichnet sind. Auch ein
Zusammenhang zwischen schlechten
Arbeitsbedingungen und Entfremdung von
demokratischen Institutionen ist in
verschiedenen Studien belegt.
Gleichzeitig könnten die Tarifparteien in
Tarifverträgen am besten die vielfältigen
Besonderheiten unterschiedlicher Branchen
berücksichtigen und „auf Augenhöhe flexibel auf
wirtschaftliche und soziale Veränderungen
reagieren, um Arbeitsplätze zu sichern“, heißt
es in dem Aufruf.* Die internationale Forschung,
allen voran der Industrieländerorganisation
OECD, zeige, „dass in Ländern mit koordinierten
Lohnsystemen und hoher Tarifbindung eine hohe
Einkommensgleichheit mit vergleichsweise hohen
Beschäftigungsquoten und geringer
Arbeitslosigkeit einhergeht“, betonen die
Fachleute. Zudem könne bessere Bezahlung nach
Tarif wichtige Anreize zur
Fachkräftequalifizierung setzen.
Eine
Erhöhung der Tarifbindung sei damit „nicht nur
sozial erwünscht, sondern auch ökonomisch
machbar und sinnvoll“. Als zielführende
gesetzliche Instrumente nennen die
Wissenschaftler*innen ein
Bundestariftreuegesetz, die Erleichterung von
Allgemeinverbindlicherklärungen (AVE),
Tarifbindung als Kriterium für staatliche
Wirtschaftsförderung, eine längere Nachwirkung
von Tarifverträgen bei Ausgliederungen oder
Betriebsaufspaltungen, verbesserte digitale
Zugangsrechte von Gewerkschaften im Betrieb und
die Stärkung von Arbeitgeberverbänden als
Tarifvertragspartei.
Aktuell haben 124
Wissenschaftler*innen den Aufruf gezeichnet (den
Aufruf und die Liste der Unterzeichner*innen
finden Sie unten verlinkt). Den Aufruf initiiert
hat eine interdisziplinäre Forschungsgruppe
„Stärkung der Tarifbindung“, die von der
Hans-Böckler-Stiftung unterstützt wird.
Ihr gehören an: Prof. Dr. Gerhard Bosch, Senior
Professor an der Universität Duisburg-Essen,
Prof. Dr. Ingrid Artus, Professorin für
Vergleichende Gesellschaftsanalyse an der
Universität Erlangen-Nürnberg, Prof. Dr. Florian
Rödl, Professor für Bürgerliches Recht, Arbeits-
und Sozialrecht an der FU Berlin, Prof. Dr. Till
van Treeck, Professor für Sozioökonomie an der
Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr. Thorsten
Schulten, Leiter des WSI-Tarifarchivs der
Hans-Böckler-Stiftung und Honorarprofessor an
der Universität Tübingen sowie sein Vorgänger
beim WSI-Tarifarchiv, Dr. Reinhard Bispinck.
In ihrem Aufruf erinnern die mehr als 120
Wissenschaftler*innen daran, dass die
Bundesrepublik bis Mitte der 1990er Jahre eine
im internationalen Vergleich geringe
Einkommensungleichheit auszeichnete. Der
wichtigste Grund hierfür sei eine hohe
Tarifbindung gewesen. Rund 85 Prozent aller
Beschäftigten wurden nach einem Tarifvertrag
bezahlt, den Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbände ausgehandelt hatten. Aktuell
gelten Tarifverträge hingegen nur noch für 49
Prozent aller Beschäftigten.
Die Folgen
sind nach Analyse der Forschenden gravierend:
„Das Versprechen, mit harter Arbeit und einer
guten Ausbildung zur Mittelschicht zu gehören,
gilt vielfach nicht mehr.“ Der Niedriglohnsektor
in Deutschland sei vergleichsweise groß. Die
mittleren Einkommensgruppen schrumpften.
Beschäftigte ohne Tarifvertrag verdienen nach
aktuellen Untersuchungen des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der
Hans-Böckler-Stiftung im Durchschnitt gut zehn
Prozent weniger als vergleichbare Beschäftigte
mit Tarifvertrag – und das, obwohl sie pro Woche
auch eine knappe Stunde länger arbeiten müssen.
Besonders groß sind die Unterschiede in
der Bezahlung mit und ohne Tarifvertrag in
Kleinbetrieben, bei Frauen, Migrant*innen sowie
bei An- und Ungelernten. Das trage indirekt auch
zu Fachkräfteengpässen bei: „In prekären
Einkommensmilieus wird weniger in Bildung
investiert, so dass Fachkräfte fehlen“, warnen
die Fachleute.
Der vor gut zehn Jahren
eingeführte gesetzliche Mindestlohn unterbinde
zwar Dumpinglöhne am unteren Rand und habe dazu
beigetragen, den Niedriglohnsektor etwas zu
begrenzen. Als Lohnuntergrenze könne er aber
nicht die Einkommensmitte sichern. Nur
Tarifverträge mit ihren differenzierten
Entgeltgruppen stellten sicher, dass
unterschiedliche Qualifikationen,
Arbeitsanforderungen und Funktionen angemessen
entlohnt werden. Sie sorgten auch dafür, dass
hohe Arbeitsbelastungen, wie etwa Schicht-,
Nacht oder Feiertagsarbeit, durch Geld oder
Freizeit kompensiert werden.
Die
Tarifparteien sind nach Analyse der Forschenden
in der Lage, für Kernbereiche der Wirtschaft
gute Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Ihre
Gestaltungsmacht reiche aber nicht mehr in die
gewachsenen tariflosen Zonen des Arbeitsmarktes.
Zur Wiederherstellung des sozialen
Gleichgewichts sei politische Unterstützung
notwendig.
Aus der internationalen
Arbeitsforschung leiten die Fachleute eine Reihe
von Instrumenten ab, mit denen der Abwärtstrend
bei der Tarifbindung gestoppt und die
Tarifautonomie wieder gestärkt werden kann. Zum
Teil werden diese Instrumente in anderen
EU-Ländern bereits angewendet. Die
Unterzeichner*innen des Appells „fordern daher
die politischen Parteien der künftigen
Koalitionsregierung auf, folgende Maßnahmen in
ihrem Koalitionsvertrag aufzunehmen“:
1.
Erleichterung der Allgemeinverbindlicherklärung
(AVE).
Mit der Allgemeinverbindlicherklärung
werde sichergestellt, dass alle Unternehmen
gleiche tarifvertragliche Mindeststandards
einhalten müssen und der Wettbewerb nicht auf
Kosten der Beschäftigten ausgetragen wird. Um
die AVE zu erleichtern, soll es zukünftig wieder
ausreichen, dass nur eine Tarifpartei den Antrag
auf AVE stellt. Zugleich soll eine AVE nur dann
nicht erfolgen können, wenn sich der
Tarifausschuss mehrheitlich dagegen ausspricht.
2. Einführung eines
Bundestariftreuegesetzes.
Nach dem Vorbild
vieler Bundesländer müsse auch bei Vergaben auf
Bundesebene Tariftreue verlangt werden, so dass
Auftrag- und Konzessionsnehmer im Rahmen ihrer
Tätigkeit für die öffentliche Hand die am
Arbeitsort einschlägigen Tarifverträge einhalten
müssen. Zur Bekräftigung dieser Position solle
Deutschland die ILO-Konvention Nr. 94 „über die
Arbeitsklauseln in den von Behörden
abgeschlossenen Verträgen“ ratifizieren.
3. Tarifbindung als Kriterium der
Wirtschaftsförderung.
Öffentliche
Fördermittel, Wirtschaftshilfen und Subventionen
sollen ab einer bestimmten Fördersumme nur noch
an Unternehmen vergeben werden, die
Tarifverträge einhalten. In allen öffentlichen
Förderprogrammen sollten Unternehmen mit
Tarifbindung generell bevorzugt werden.
4. Erschwerung von Tarifflucht.
Unternehmen
nutzen vielfach Ausgliederungen und
Betriebsaufspaltungen, um sich einer
Tarifbindung zu entledigen. Die bestehende
Verkürzung der Tarifbindung bei
Restrukturierungen solle beseitigt und die
Nachwirkung von Tarifverträgen generell gestärkt
werden.
5. Stärkung von Betriebsräten und
Gewerkschaften.
Die Präsenz von Betriebsräten
und Gewerkschaften im Betrieb ist in der Regel
eine wichtige Voraussetzung für die Durchsetzung
und verlässliche Anwendung eines Tarifvertrages.
Deshalb müssten die (vor allem digitalen)
Zugangsrechte von Gewerkschaften zu den
Beschäftigten ausgebaut und Maßnahmen zur
Behinderung von Betriebsräten stärker bestraft
werden. Außerdem sollten Anreize zum
Gewerkschaftsbeitritt dadurch gestärkt werden,
dass Mitgliedsbeiträge vollständig steuerlich
abgesetzt und in Tarifverträgen effektive
Mitgliedervorteilsregelungen vereinbart werden
können.
6. Stärkung von
Arbeitgeberverbänden als Tarifvertragspartei.
Durch die Einführung der Mitgliedschaft ohne
Tarifbindung (OT-Mitgliedschaft) hätten die
Arbeitgeberverbände ihre originäre Funktion als
Tarifvertragspartei immer mehr geschwächt,
analysieren die Forschenden. Dies widerspreche
der eigentlichen gesetzlichen Aufgabe der
Verbände, an einem stabilen Tarifvertragssystem
mitzuwirken. Die Möglichkeit zur
OT-Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband sollte
aufgehoben werden.

Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte
im Januar 2025: +2,8 % gegenüber Januar 2024
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte
insgesamt, Januar 2025 +2,8 % zum Vorjahresmonat
-0,5 % zum Vormonat Preise für pflanzliche
Erzeugnisse -3,8 % zum Vorjahresmonat Preise für
Tiere und tierische Erzeugnisse +7,4 % zum
Vorjahresmonat
Die Erzeugerpreise
landwirtschaftlicher Produkte waren im Januar
2025 um 2,8 % höher als im Januar 2024. Im
Dezember und November 2024 hatten die
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat jeweils bei
+4,1 % gelegen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, fielen die
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im
Januar 2025 gegenüber dem Vormonat Dezember 2024
um 0,5 %.
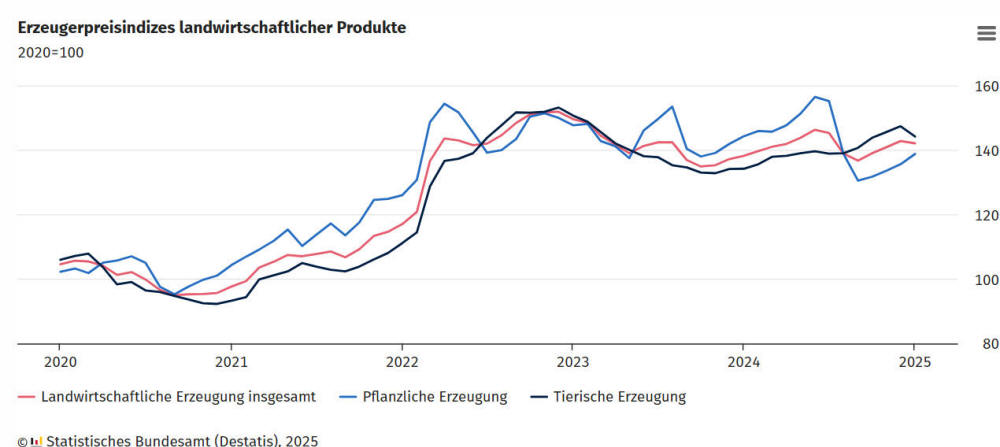
•
Im Vergleich zum Vorjahresmonat
entwickelten sich die Preise für Produkte aus
pflanzlicher und tierischer Erzeugung wie
bereits in den Vormonaten auch im Januar 2025
gegenläufig. So sanken die Preise für
pflanzliche Erzeugnisse um 3,8 % gegenüber
Januar 2024, während die Preise für Tiere und
tierische Erzeugnisse um 7,4 % stiegen. Im
Vergleich zum Vormonat Dezember 2024 waren
Produkte aus pflanzlicher Erzeugung im Januar
2025 teurer (+2,4 %) und Produkte aus tierischer
Erzeugung günstiger (-2,2 %).
•
Preisrückgang bei Speisekartoffeln
gegenüber Vorjahresmonat
Der Preisrückgang
bei pflanzlichen Produkten um 3,8 % im Vergleich
zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die
gesunkenen Preise für Speisekartoffeln
zurückzuführen. Diese waren im Januar 2025 um
37,0 % niedriger als im Januar 2024. Im Dezember
2024 hatte die Vorjahresveränderung bei -32,5 %,
im November 2024 bei -31,7 % gelegen. Gegenüber
dem Vormonat Dezember 2024 stiegen die
Speisekartoffelpreise um 5,5 %.
- Preise
für Obst, Getreide, Handelsgewächse und Wein
gestiegen, für Gemüse und Futterpflanzen
gesunken
- Die Erzeugerpreise für Obst waren
im Januar 2025 um 16,5 % höher als ein Jahr
zuvor. Preisanstiege gab es unter anderem bei
Tafeläpfeln mit +16,9 %.
- Die
Erzeugerpreise für Gemüse gingen gegenüber dem
Vorjahresmonat um 1,5 % zurück. Insbesondere
sanken die Preise für Kohlgemüse (-12,1 %) und
Salat (-7,4 %).
•
Getreide war im Januar 2025 im Vergleich
zum Januar 2024 um 5,5 % teurer (Dezember 2024:
+1,9 % zum Vorjahresmonat). Das Handelsgewächs
Raps verteuerte sich im Januar 2025 im Vergleich
zum Vorjahresmonat um 23,3 %. Preise für
Handelsgewächse insgesamt lagen im Januar 2025
um 8,9 % höher als ein Jahr zuvor. Wein war im
Januar 2025 um 1,1 % teurer als im
Vorjahresmonat. Die Preise für Futterpflanzen
waren im Januar 2025 mit einer Veränderungsrate
von -10,1 % im Vergleich zum Vorjahresmonat
weiterhin rückläufig (Dezember 2024: -10,7 %).
•
Tierische Erzeugung: Preisanstieg bei
Milch, Preisrückgang bei Eiern und Tieren
Der
Preisanstieg für Tiere und tierische Erzeugnisse
um 7,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist
unter anderem auf die gestiegenen Preise für
Milch zurückzuführen. Der Milchpreis lag im
Januar 2025 um 19,1 % höher als im
Vorjahresmonat (Dezember 2024: +23,0 % zum
Vorjahresmonat). Im Vergleich zum Vormonat
Dezember 2024 sanken die Preise für Milch um 1,5
%. Bei Eiern kam es zu einem Preisrückgang von
3,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat (Dezember
2024: -3,7 %).
•
Die Preise für Tiere lagen im Januar 2025
mit -0,1 % auf einem ähnlichen Niveau wie im
Januar 2024 (Dezember 2024: +1,9 % zum
Vorjahresmonat). Dabei stiegen die Preise für
Rinder um 22,7 %, für Schlachtschweine fielen
die Preise hingegen um 12,6 %. Die Preise für
Geflügel waren im Januar 2025 um 4,3 % höher als
im Januar 2024. Ausschlaggebend hierfür waren
insbesondere die Preissteigerungen bei Hähnchen
um 6,6 %. Die Preise für Sonstiges Geflügel
(Enten und Puten) stiegen binnen Jahresfrist um
0,7 %.
NRW: 2024 erstmalig
mehr Eier aus ökologischer Erzeugung als aus
Käfighaltung
Im Jahr 2024 sind in Nordrhein-Westfalen rund
1,43 Milliarden Eier von Legehennen produziert
worden. Wie das Statistische Landesamt mitteilt,
entspricht dies einem Rückgang von 1,3 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Anzahl der
gehaltenen Legehennen verzeichnete einen
Rückgang (−1,4 Prozent) auf 5,02 Millionen
Tiere.
•
Mit rund 285 Eiern pro Legehenne blieb
die Legeleistung im Vergleich zum Jahr 2023
damit konstant. Höchster Zuwachs bei
ökologischen Erzeugungsbetrieben Mit einem
Anteil von 69,0 Prozent machte Bodenhaltung,
trotz weiter sinkender Eiererzeugung
(−3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), nach
wie vor den größten Anteil an der
nordrhein-westfälischen Eierproduktion aus.
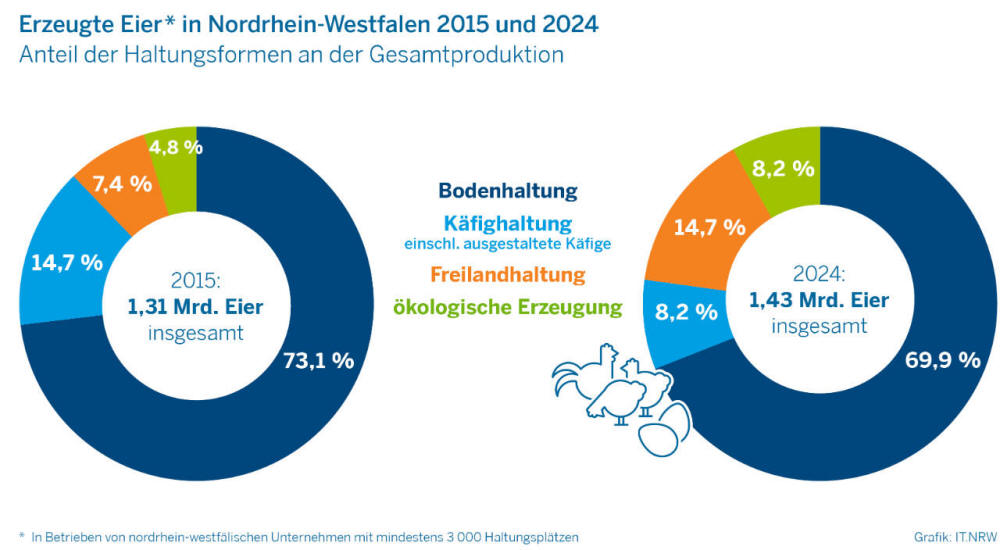
Seit 2016 fällt die Zahl der erzeugten Eier
aus Bodenhaltung erstmalig wieder unter die
Milliarden-Marke (2024: 985 Millionen).
209 Millionen bzw. 14,7 Prozent der produzierten
Eier kamen von Legehennen aus Freilandhaltung.
Die Eiererzeugung in ökologisch anerkannten
Erzeugungsbetrieben verzeichnete den größten
Zuwachs innerhalb eines Jahres (+13,4 Prozent).
So überstieg die Anzahl der Eier aus
ökologisch anerkannten Erzeugungsbetrieben mit
117 Millionen erstmalig die Anzahl derer aus
Käfighaltung einschließlich ausgestalteter
Käfige (116 Millionen). Beide Haltungsformen
machten jeweils im Jahr 2024 einen Anteil von
8,2 Prozent an der Gesamtproduktion der Eier
aus.
•
Eiererzeugung in Freilandhaltung hat sich
mehr als verdoppelt
Die Zahl der erzeugten
Eier aus Käfighaltungen einschließlich
ausgestalteter Käfige hat sich zwischen 2015 und
2024 um 39,5 Prozent verringert – seit dem Jahr
2021 war ein Rückgang von rund 20 Prozent zu
beobachten. In ökologisch anerkannten
Erzeugungsbetrieben wurden im vergangenen Jahr
dagegen 84,0 Prozent mehr Eier erzeugt als noch
2015. Die Eiererzeugung aus Freilandhaltung hat
sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt
(+116,8 Prozent).
Insgesamt wurden
im vergangenen Jahr 9,1 Prozent mehr Eier
erzeugt als 2015. Knapp die Hälfte der Eier
wurde 2024 im Regierungsbezirk Münster erzeugt
Der Großteil der erzeugten Eier kam im
vergangenen Jahr aus dem Regierungsbezirk
Münster. Hier wurden mit 669 Millionen
46,9 Prozent aller Eier in NRW produziert.
Darauf folgten die Regierungsbezirke Detmold
(16,2 Prozent), Köln (13,6 Prozent) und Arnsberg
(13,4 Prozent). Den geringsten Anteil an der
nordrhein-westfälischen Eierproduktion machte
der Regierungsbezirk Düsseldorf (9,9 Prozent)
aus. Rund 40 Prozent der Eier aus ökologischer
Haltung stammte 2024 aus Arnsberg .
Der Regierungsbezirk Münster verzeichnete mit
einem Anteil von 87,5 Prozent sowohl die meisten
Eier aus der Käfighaltung, als auch aus
Bodenhaltung (47,6 Prozent) und Freilandhaltung
(37,3 Prozent). Der Großteil der Eier aus
ökologischer Haltung wurde in den
Regierungsbezirken Arnsberg (38,5 Prozent) und
Detmold (24,0 Prozent) erzeugt.
Montag, 17. März 2025
Dinslaken: Zukunftssicherungsprozess -
Verwaltung informiert
Die Stadtverwaltung Dinslaken bezieht Postition
zum Vorgehen im Haushaltsprozess und verweist
darauf, dass in dem im Frühjahr begonnen Prozess
der Haushaltskonsolidierung bereits erste Pakete
öffentlich diskutiert und beraten wurden. In der
Ratssitzung am 10.12.2024 wurden erste Maßnahmen
im Rat öffentlich beraten, diskutiert und
entschieden. Auch bei der Einbringung des
Haushalts am 30.1.2025 wurde der Prozess
dargelegt und auf das 2. Paket verwiesen, was
jetzt am 25.3.2025 in einer öffentlichen Sitzung
beraten wird.
Die Stadt Dinslaken
verweist darauf, dass dieser Prozess der
Haushaltsberatungen mit einer breit angelegten
Beteiligung aller Fachbereiche der Verwaltung
und im Austausch mit allen politischen
Vertreter*innen unter Begleitung eines externen
Beratungsunternehmens geplant ist und
durchgeführt wird. Gemeinsam mit dem
Beratungsunternehmen sei eine Fülle von Ideen
aus Politik und Verwaltung und seitens des
Unternehmens zusammengetragen worden. Mit
Unterstützung des externen Beratungsunternehmens
wurden 300 Vorschläge innerhalb der Verwaltung
diskutiert.
140 Vorschläge sind das
Ergebnis des internen Prozesses. Über diese 140
Vorschläge wurde zwischen Politik und Verwaltung
zunächst ein vertraulicher Austausch vereinbart.
In diesen anstehenden Gesprächen beraten sich
Politik und Verwaltung über die Auswirkungen auf
die Stadtgesellschaft. In diesem Prozess
arbeiten die politischen Fraktionen und die
Verwaltung vertrauensvoll zusammen, sind im
Austausch, ringen um gute Entscheidungen und
verhandeln miteinander, was sie der Bevölkerung
zumuten können.
"Die veröffentlichte
Liste ist ein internes Arbeitspapier für ein 3.
Paket. Das dieses nun öffentlich diskutiert wird
und so dargestellt wird, als seien die dort
aufgelisteten Vorschläge schon die beschlossenen
Maßnahmen ist unverantwortlich. Dies
verunsichert die Menschen in unserer Stadt in
hohem Maße. Denn, eine Entscheidung liegt weder
vor, noch wird diese ohne einen eingehenden
Beratungsprozess möglich sein.
Für mich
stellt sich die Frage, wer aus dem Kreise der
politisch Verantwortlichen derart grob
fahrlässig ein internes Arbeitspapier
veröffentlicht. Hier verstößt jemand gegen seine
Pflichten und nimmt die Verunsicherung der
Menschen in unserer Stadt billigend in Kauf. Ich
verweise darauf, das wir uns im Beratungsprozess
befinden und selbstverständlich die
Stadtgesellschaft eingebunden und die
Öffentlichkeit über die Ergebnisse informiert
wird."
„Die Beratung in der
Öffentlichkeit findet statt, wenn die
Beschlussvorlage da ist. Es lohnt sich nicht
schon vorher darüber Debatten zu führen“, so
Stadtkämmerer Achim Thomae zum weiteren Ablauf
des Prozesses. 14 Tage vor Ratssitzungen sind
die Tagesordnungen des Rates im Netz unter
https://ris.dinslaken.de öffentlich einsehbar.
Sie können dann alle Vorlagen (Button Vorlagen
anklicken) für die kommenden Ratssitzungen
abrufen. Es ist gewünscht, dass Interessierte
die Diskussion mit den politischen
Vertreter*innen und der Verwaltung suchen. Im
Rahmen aller öffentlichen Sitzungen haben
Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit Debatten
zu verfolgen.
Bürgermeisterin
Michaela Eislöffel verweist darauf, dass für die
Sitzung am 25. März ein 2. Paket zum
Haushaltskonsolidierungsprozess eingebracht
wird, in dem der Rat u.a. über Vorschläge von
Einsparungsmaßnahmen im Personalbereich
entscheiden wird. Die jetzt veröffentlichte
Liste gehört zum 3. Paket für das noch kein
Beratungsweg geplant ist.
Wie der Beratungsweg für das
3. Paket verlaufen wird, ist derzeit noch nicht
entschieden und wird noch mit den Fraktionen
besprochen. Weitere Beratungsfolgen werden sich
anschließen müssen, damit der
Zukunftssicherungsprozess erfolgreich gestaltet
werden kann.
Kämmerer Achim Thomae
und Bürgermeisterin Michaela Eislöffel zeigen
sich jedoch zuversichtlich, dass durch die gute
Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen und
innerhalb der Fachbereiche der Stadtverwaltung
sowie durch konstruktive Gespräche mit der
Politik zeitnah ein rundes
Haushaltskonsolidierungskonzept auf den Weg
gebracht werden kann.
Verweisen aber
auch darauf, dass Bund und Land für eine
auskömmliche Finanzierung der Kommunen sorgen
müssen, um den sozialen Frieden in unseren
Städten zu sichern. Deshalb vertreten beide die
Stadt Dinslaken in dem Aktionsbündnis „Für die
Würde unserer Städte“ und hoffen auch auf die
aktuelle Diskussion um die Altschuldenfrage zur
Unterstützung der Kommunen.
Kreis Wesel startet Igelschutz-Kampagne
und erlässt Nachtfahrverbot für Mähroboter
Unter dem Motto „Igelschutz - Ein sorgenfreies
Zuhause für unsere Stacheltiere“ möchte die
Kreisverwaltung Wesel auf die
Lebensraumsituation des Igels im Kreisgebiet und
insbesondere auf die Gefahren von Mährobotern
für Igel aufmerksam machen.
Die
Aufklärungskampagne richtet sich gezielt an alle
Bürgerinnen und Bürger mit Gärten und informiert
darüber, mit welchen Maßnahmen sich der Igel in
den privaten Grünanlagen ganzjährig wohl und
sicher fühlen kann. In einem ersten wichtigen
Schritt hat die Untere Naturschutzbehörde des
Kreises Wesel jetzt eine Allgemeinverfügung für
ein Verbot des nächtlichen Betriebes von
Mährobotern erlassen (zur
Allgemeinverfügung).
Aber auch
andere Aktivitäten in unseren heimischen Gärten
haben einen negativen Einfluss auf die
Igelpopulationen. An erster Stelle ist hier der
Einsatz von Schneckenkorn zu nennen, der
tödliche Folgen für viele Igel hat, da auch
Schnecken auf ihrem Speiseplan stehen. Der Igel
steht derzeit im Fokus des Artenschutzes.
Die Deutsche Wildtierstiftung hat den
Igel zum Wildtier des Jahres 2024 gewählt, um
auf den stetigen Rückgang der Igelpopulation
aufmerksam zu machen. Igel gehören nach dem
Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders
geschützten Arten. Ihr Bestand nimmt seit Jahren
kontinuierlich ab, was auf den Straßenverkehr,
aber insbesondere auf den Verlust geeigneter
Lebensräume und den Rückgang der
Insektenpopulationen als Hauptnahrungsquelle
zurückzuführen ist.
In ländlichen
Gebieten haben Igel zunehmend ihren natürlichen
Lebensraum verloren. Daher sind Gärten und
Parkanlagen im Siedlungsbereich mittlerweile ein
wichtiges Refugium für den Igel geworden. In
naturnah gestalteten Gärten findet der Igel
einen wichtigen Ersatzlebensraum. Heimische
Pflanzen und Sträucher sowie aufgeschichtete
Laubhaufen kann der Igel als Schlaf- oder
Kinderstube nutzen. Hier findet er auch
ausreichend Insekten – seine
Hauptnahrungsquelle.
Dies kommt
nicht nur dem Igel, sondern der gesamten
Artenvielfalt zugute. Die Siedlungsbereiche
tragen somit eine besondere Verantwortung für
den Schutz der Igel. Indem öffentliche und
private Grünflächen naturnah gestaltet werden
und den Tieren ungehinderten Zugang ermöglichen,
kann ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt dieser
geschützten Art geleistet werden. Die
Hauptaktivitätszeiten von Igeln und anderen
Kleintieren liegen in der Dämmerung und der
Nacht.
In diesen Zeiträumen sind die
Tiere auf Nahrungssuche. Mähroboter, die zu
dieser Zeit aktiv sind, stellen insbesondere für
junge Igel eine große Gefahr dar, da diese bei
Kontakt mit den Geräten nicht flüchten, sondern
sich instinktiv zusammenrollen. Studien belegen,
dass sie in dieser Schutzhaltung schwer
verletzt, verstümmelt oder sogar getötet werden
können, wenn sie von den Klingen erfasst
werden.
Eine aktuelle
Veröffentlichung einer Studie des Berliner
Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung
zeigt auf, dass innerhalb eines Zeitraumes von
16 Monaten 370 verletzte Tiere in
Pflegestationen verbracht wurden, von denen 47 %
an den Folgen ihrer Verletzungen verstarben. Da
sich ein hoher Anteil der leichter verletzten
Igel verstecken, kann von einer deutlich höheren
Sterberate ausgegangen werden.
Alle
Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer können
bereits mit wenigen Maßnahmen einen wertvollen
Beitrag zum Schutz der Igel leisten. Eine
igelgerechte Gartengestaltung ist unkompliziert
und leicht umzusetzen. Die gärtnerischen
Maßnahmen kommen zudem auch anderen Wildtieren
zugute.
Tipps, worauf man bei einer
naturnahen und igelgerechten Gartengestaltung
achten sollte, ob es notwendig ist, die Tiere zu
füttern sowie weitere Informationen über den
Igel, finden Interessierte unter: https://www.kreis-wesel.de/igelschutz oder
https://www.stadt-koeln.de/igelschutz
Plauderbänke in Wesel:
Zahlreiche Teilnehmer stellen neue Plauderbank
vor.
Wo man auch hinblicken mag,
sieht man Menschen, die auf ihr Smartphone
fixiert sind. „Früher war alles anders“, hört
man dann häufig. „Da redeten noch die Menschen
miteinander“. Um das Miteinander zu fördern, hat
der Sozialausschuss in seiner Sitzung am 23. Mai
2024 beschlossen, in jedem Stadtteil eine Bank
zu einer sogenannten „Plauderbank“ umzuwidmen
(Grundlage: Antrag der FDP-Fraktion).

Dahinter steckt die Idee, den Austausch zu
fördern und mit „fremden“ Menschen ins Gespräch
zu kommen, um so Einsamkeit vorzubeugen. 2018
wurde erstmals in England (Burnham-On-Sea) eine
„chat bench“ aufgestellt. Die Idee dazu hatte
der Londoner Polizist Ashley Jones, als er
bemerkte, dass vor allem ältere Bewohner*innen
in Großstädten oftmals einsam sind. Von dort
ging es rasant weiter: die Idee der Plauderbänke
eroberte die ganze Welt. Mittlerweile gibt es
sie unter anderem auch in Amerika.
Dass
Isolation und Einsamkeit aufgrund der
demografischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen auch ein Problem in kleineren
Städten oder Dörfern darstellt, ist inzwischen
bekannt.
In einigen deutschen Städten
(z.B. Erkelenz, Oldenburg, Berlin) sind
ebenfalls Plauderbänke entstanden. Dabei wurden
zum Beispiel bestehende Bänke mit einem Schild
versehen, das auf die Besonderheit „Plauderbank“
hinweist. Auch andere kreative Formen kommen zum
Einsatz, unter anderem werden Fahnen oder
Klappstühle neben einer Bank platziert.
Konzept und Zielsetzung
In einer Welt, in der
oftmals Hektik und Anonymität den Alltag
bestimmen, bieten Plauderbänke eine einfache,
gleichwohl wirkungsvolle Möglichkeit, soziale
Kontakte zu fördern und Einsamkeit zu
reduzieren.
Das Prinzip ist simpel:
Platz nehmen, „hallo“ sagen und ins Gespräch
kommen. Ein kleines Schild, das Menschen - jung
und alt - ermutigt, sich einander zuzuwenden.
Wer auf einer Plauderbank Platz nimmt,
signalisiert, dass er oder sie offen für eine
Unterhaltung ist – sei es mit Fremden, Nachbarn
oder Passanten.
Standorte
Mit Hilfe
aus der Weseler Bürgerschaft konnten insgesamt
zwölf geeignete Plauderbank-Standorte gefunden
werden. Sie befinden sich allesamt in belebten
Arealen, wie einem Park oder in
Einkaufsbereichen. Standorte sind:
Fusternberg:
an der Engel Apotheke (2 Bänke)
im Park an der Niederrheinhalle (3 Bänke)
Bislich:
am Fähranleger (1 Bank)
Obrighoven:
auf dem Marktplatz (1 Bank)
Ginderich:
an der Dorfschule (1 Bank – noch
nicht final entschieden)
Innenstadt:
Berliner-Tor-Platz (1 Bank)
Pastor-Janßen-Straße (1 Bank Nähe Krankenhaus)
Feldmark:
im Dorotheenpark (2 Bänke)
Die
jeweiligen Plauderbänke werden sukzessive mit
Hinweisschildern als solche kenntlich gemacht.
Das Anbringen der Plaketten sowie kleinere
Gestaltungsmaßnahmen rund um die Bänke kosten
insgesamt ca. 400 Euro.
Fazit
Die
Plauderbank ist ein einfaches, aber effektives
Mittel, um das soziale Miteinander zu stärken.
Sie hilft, Einsamkeit zu bekämpfen und spontane
Gespräche zu ermöglichen. In einer immer
umfangreicheren digitaleren Welt kann eine
solche analoge Begegnungsmöglichkeit wertvolle
Verbindungen schaffen – ganz ohne Anmeldung,
Kosten oder Verpflichtungen.
Noch bis zum 28. März
Vorschläge für den „Klimaschutzpreis 2025“ des
Kreises Wesel einreichen!
Im
Jubiläumsjahr 2025 verleiht der Kreis Wesel
erneut den „Klimaschutzpreis“. Der Preis würdigt
und fördert innovative Projekte und Ideen, die
aktiv zur Bekämpfung des Klimawandels oder zur
Anpassung an seine Auswirkungen beitragen.
Teilnehmen können alle Bürgerinnen und Bürger
des Kreises Wesel, Kinder und Jugendliche,
Schulklassen sowie Vereine. Darüber hinaus
können auch Personengruppen, die ehrenamtlich
ein Umwelt- oder Klimaschutzprojekt umgesetzt
haben oder deren Projekt im Jahr 2025 gestartet
ist und im kommenden Jahr realisiert werden
soll, teilnehmen.
Ziel des
Klimaschutzpreises ist es, herausragendes
Engagement für den Klimaschutz zu honorieren und
die Öffentlichkeit für die Dringlichkeit des
Themas zu sensibilisieren. Der Preis macht
vorbildliche Initiativen sichtbar und motiviert
dazu, ebenfalls Verantwortung für den
Klimaschutz zu übernehmen.
Der Kreistag
hat im Juni 2023 folgende Kriterien für die
Vergabe des Preises festgelegt:
Beitrag zum
Klimaschutz
Beitrag zur Klimawandelanpassung
Gesamtgesellschaftlicher Mehrwert
Vollständige Bewerbungsunterlagen
Der
Preis wird in zwei Kategorien vergeben:
„Klimaschutzpreis Kreis Wesel“ und
„Klimaschutzpreis Kinder und Jugendliche“. Für
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gibt es eine
eigene Kategorie. Insgesamt stehen Preisgelder
in Höhe von 4.000 Euro zur Verfügung. Jede
Kategorie wird wie folgt ausgezeichnet: 1.000
Euro für den ersten Platz, 600 Euro für den
zweiten Platz und 400 Euro für den dritten
Platz. Die Gewinner werden von einer Fachjury
ausgewählt.
Vorschläge und Bewerbungen
können alle Einwohnerinnen und Einwohner des
Kreises Wesel sowie Vereine und Institutionen
mit Sitz im Kreis Wesel bis spätestens Mittwoch,
den 28. März 2025, bei der Kreisverwaltung Wesel
einreichen. Entweder per Post (Fachstelle Europa
und nachhaltige Kreisentwicklung, Reeser
Landstr. 31, 46483 Wesel) oder per E-Mail an
petra.huelsken@kreis-wesel.de.
Bewerbungen sind ausschließlich mit dem
Formblatt möglich, das auf der Website des
Kreises Wesel abgerufen werden kann:
https://www.kreis-wesel.de/leben-arbeiten/umwelt-natur-klima/klimaschutz#a5-toggle-content-1-1
Feuerwehr Moers beteiligt sich erneut am
Girls´ Day
Auch beim diesjährigen
Girls´ Day können Schülerinnen ab der 8. Klasse
den Beruf einer Feuerwehrfrau und einer
Notfallsanitäterin bei der Feuerwehr Moers
kennenlernen. Das Angebot findet am Donnerstag,
3. April, von 9 bis 16 Uhr in der Feuer- und
Rettungswache (Am Jostenhof 39) statt.
An dem erlebnisreichen Tag können die
Schülerinnen praktische Erfahrungen in den
unterschiedlichen Aufgabengebieten sammeln.
Unter anderem verlegen und rollen sie Schläuche,
suchen Personen in einem ‚verrauchten Bereich‘
und lernen Grundlagen der Ersten Hilfe kennen.
In der Mittagspause gibt es eine Verpflegung.
Anmeldungen sind möglich auf der
Internetseite des Girls´ Day www.girls-day.de im
Bereich ‚Radar‘ unter den Suchworten ‚Moers‘
oder ‚Feuerwehrfrau‘.
Kleve:
Ostermarkt Haus Riswick am 29. und 30. März:
Straßensperrungen und Parkmöglichkeiten
Am 29. und 30. März 2025 findet der Klever
Ostermarkt auf dem Gelände von Haus Riswick
statt, zu dem – über die beiden Tage verteilt –
rund 6.000 Besucherinnen und Besucher erwartet
werden. Um eine geordnete An- und Abreise zu der
Veranstaltung sicherzustellen, werden für den
Veranstaltungszeitraum verschiedene
Verkehrsmaßnahmen ergriffen.
Für den
Zeitraum vom 29. bis zum 30. März 2025 wird die
Riswicker Straße (K 5), von der Einmündung
Mühlenstraße bis zur Einmündung Koppelstraße zur
Einbahnstraße in Fahrtrichtung Till-Moyland. Das
Befahren der Riswicker Straße ab Einmündung
Koppelstraße in Fahrtrichtung Klever Ring (B 9)
ist für den Zeitraum somit verboten.
Die
Einbahnstraße wird eingerichtet, um auf der
Fahrbahn der Riswicker Straße zusätzliche
Parkplätze für Besucherinnen und Besucher der
Veranstaltung bereitstellen zu können. Gäste des
Ostermarktes können ihre Fahrzeuge dann
rechtsseitig auf der Fahrbahn der Riswicker
Straße in Fahrtrichtung Till-Moyland parken.
Außerdem kann der Parkplatz von Haus Riswick
genutzt werden.
Eine Umleitungsstrecke ab
dem Einmündungsbereich Koppelstraße wird über
die Koppelstraße, Kirchstraße und Kalkarer
Straße (B 57) bis zum Klever Ring eingerichtet.
Für die Anreise zum Ostermarkt wird
empfohlen, den Ostermarkt aus Fahrtrichtung
Till-Moyland ab dem Einmündungsbereich
Sommerlandstraße (K 5)/ Holzstraße, über die
Holzstraße, Kalkarer Straße, Klever Ring und die
Riswicker Straße anzufahren.
ACV warnt vor steigender
Wildwechsel-Gefahr zur Zeitumstellung Ende März
Wildunfälle sind ein oft unterschätztes Risiko
im Straßenverkehr. Jährlich ereignen sich in
Deutschland mehr als 250.000 solcher Unfälle,
oft mit erheblichen Schäden und Verletzungen.
Besonders zum Frühjahr steigt das Risiko, da
sich der Berufsverkehr mit der Hauptaktivzeit
von Wildtieren – der Dämmerung – überschneidet.
Der ACV Automobil-Club Verkehr
informiert daher frühzeitig über entscheidende
Fakten, die Autofahrerinnen und Autofahrer
kennen sollten, um sich selbst und die Tiere zu
schützen.

Die meisten Wildunfälle passieren zwischen 6 und
8 Uhr morgens sowie zwischen 17 und 20 Uhr /
Bildrechte: Marius Holler
1. Der
„Elefanten-Faktor“: Die Wucht eines Wildunfalls
ist enorm
Der Aufprall eines Rothirsches bei
60 km/h hat die Wucht von fünf Tonnen –
vergleichbar mit dem Gewicht eines
ausgewachsenen Elefanten. Selbst ein Reh kann
bei dieser Geschwindigkeit Schäden verursachen,
die einem Frontalcrash mit einem Motorrad
gleichen. Bereits ein Wildschwein kann durch
seine kompakte Masse ein Fahrzeug ins Schleudern
bringen. Dies verdeutlicht, welche Kräfte bei
einem Wildunfall wirken und warum man gerade in
der Wildwechsel-Hochsaison besonders wachsam
fahren sollte.
2. Wildtiere
überqueren Straßen auf festen Routen
Wildtiere bewegen sich instinktiv entlang
vertrauter Pfade, selbst wenn diese durch
Straßen unterbrochen werden. Besonders
gefährdete Straßenabschnitte sind mit
Wildwechsel-Warnschildern gekennzeichnet. Auch
neu gebaute Straßen, die durch Wälder oder
Felder führen, stellen ein Risiko dar, da die
Tiere an ihren angestammten Wegen festhalten.
Zusätzlich gilt: Rehe und Wildschweine sind
selten allein unterwegs. Wer ein Tier in
Straßennähe sieht, sollte stets mit weiteren
rechnen.
3. Dämmerung ist die
gefährlichste Zeit
Die meisten Wildunfälle
passieren zwischen 6 und 8 Uhr morgens sowie
zwischen 17 und 20 Uhr. Besonders im Frühjahr
und Herbst steigt das Risiko, da sich durch
veränderte Lichtverhältnisse der Lebensrhythmus
der Tiere verschiebt. Nach der Zeitumstellung am
30. März sind Autofahrerinnen und Autofahrer
vermehrt in der Dämmerung unterwegs – genau
dann, wenn Wildtiere besonders aktiv sind.
4. Die richtige Reaktion kann Leben retten
Wer ein Wildtier auf der Straße sieht, sollte
besonnen handeln:
Fernlicht differenziert
nutzen: In offenen und übersichtlichen Bereichen
kann Fernlicht helfen, Wildtiere frühzeitig zu
erkennen. In dicht bewaldeten Gebieten ist
jedoch Abblendlicht sicherer, da blendendes
Licht Tiere irritiert und sie dazu verleitet,
auf der Straße stehen zu bleiben. Mitunter kann
auch die Lichthupe helfen, Wildtiere zum Rückzug
zu bewegen.
Unkontrollierte Ausweichmanöver
vermeiden: Plötzliches Ausweichen kann schwerere
Unfälle verursachen als der Aufprall selbst. Wer
stark ausweicht, riskiert von der Straße
abzukommen oder sogar eine Kollision mit
entgegenkommenden Fahrzeugen. Besser ist es, bei
Wildtieren auf der Straße kontrolliert zu
bremsen, die Spur zu halten und dann langsam
vorbeizufahren.
Hupen kann helfen: Die Hupe
kann Wildtiere verscheuchen, bevor sie auf die
Straße laufen. Bei Tieren am Straßenrand kann
die Hupe eine Kollision verhindern.
5.
Das richtige Verhalten nach einem Wildunfall
Kommt es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem
Wildunfall, ist besonnenes Handeln gefragt.
Nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch
gesetzliche Vorgaben müssen beachtet werden:
Unfallstelle sichern: Warnblinker
einschalten, Warnweste anlegen und das
Warndreieck aufstellen, damit keine weiteren
Fahrzeuge auffahren.
Hilfe leisten: Bei
Personenschäden Erste Hilfe leisten und den
Notruf 112 verständigen.
Polizei oder Jäger
informieren: Wildunfälle sollten gemeldet werden
– auch wenn das Tier flüchtet. Die Polizei oder
der zuständige Jagdpächter stellt eine
Wildunfallbescheinigung für die Versicherung
aus.
Verletzte oder tote Tiere nicht
berühren: Verletzte Wildtiere können in Panik
unberechenbar reagieren, auch wenn sie zunächst
regungslos am Boden liegen. Zudem können
Wildtiere Krankheitserreger wie Tollwut oder
Borreliose übertragen. Daher heißt es bei
verletzten oder toten Tieren Abstand halten und
auf Hilfe warten. Außerdem ist das Mitnehmen
eines toten Wildtieres strafbar.
6. Wann
zahlt die Versicherung?
Die
Teilkaskoversicherung deckt in der Regel Schäden
durch sogenanntes Haarwild (Rehe, Wildschweine,
Hirsche) ab. Einige Policen beinhalten auch
weitere Tiere wie Füchse, Marder oder Vögel –
eine Prüfung der Versicherungsbedingungen lohnt
sich.
Nach einem Zusammenstoß mit einem
Tier sollte der Schaden dokumentiert und
umgehend der Versicherung gemeldet werden. Fotos
von der Unfallstelle und eventuelle Zeugen
helfen bei der Schadensregulierung.
ACV
Empfehlung: Vorsicht ist der beste Schutz
Um
Wildunfälle zu vermeiden, rät der ACV:
Geschwindigkeit in bekannten Wildwechselzonen
reduzieren, Warnschilder ernst nehmen und gerade
in der Dämmerung besonders vorsichtig sein.
Von Steuertipps bis Absicherung
gegen Elementarschäden
Verband
Wohneigentum e.V. bietet kostenlose
Online-Infotage an
Die richtige Absicherung
gegen Elementarschäden, Steuertipps für
Wohneigentümer und rechtliche Fragen bei
Vermietung/Teilen von Immobilien – das sind die
Themen der nächsten Online-Informationswoche des
gemeinnützigen Verbands Wohneigentum. Vom 17.
bis zum 19. März 2025 informiert der
Eigentümerverband jeweils ab 18 Uhr.
Information und Anmeldung:
https://www.verband-wohneigentum.de/bv/on245432
Die Termine:
Montag, 17. März, 18 Uhr
Steuerliche Fragen rund um das Wohneigentum
Ein praxisnaher Überblick, wie die eigene
steuerliche Situation optimiert werden kann.
Erläutert werden Abzugsfähigkeiten im
Zusammenhang mit privatem Eigentum sowie
steuerliche Besonderheiten bei Einkünften aus
Vermietung/Verpachtung. Wir klären, welche
Kosten Sie steuerlich geltend machen können.
Dienstag, 18. März, 18 Uhr
Vermietung und
geteilter Besitz – rechtliche Fragen (in
Kooperation mit der Grünen Liga e. V.)
Der
Vortrag befasst sich mit alternativen
Nutzungsmöglichkeiten für die eigene Immobilie
und klärt damit verbundene rechtliche Fragen. Es
geht um Einliegerwohnungen, die
genossenschaftliche Weiterentwicklung des
Eigenheims und unterschiedliche Rechtsformen für
kleine Wohnprojekte.
Mittwoch, 19. März,
18 Uhr
Elementarschäden - wie kann ich mein
Eigentum schützen?
Starkregen und Unwetter
machen vielen Hausbesitzer*innen Angst. Wie kann
das Wohneigentum vor drohenden Elementarschäden
geschützt werden? Ein Überblick über bauliche,
rechtliche und versicherungstechnische Aspekte.
Kabarett mit Jess Jochimsen:
Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben
Jess Jochimsen will raus aus seinem
Gedankenkarussell. Zumindest für einen Abend.
Und mal nachschauen, was die Pandemie
übriggelassen hat. Dazu macht der Kabarettist am
Freitag, 21. März (ausverkauft) und am Samstag,
22. März 2025, 20 Uhr, halt im Dachstudio der
Dinslakener Stadtbibliothek.

Jess Jochimsen (Copyright: Britt Schilling)
Der 1970 in München geborene Jess Jochimsen
studierte Germanistik, Politikwissenschaft und
Philosophie und lebt als Autor und Kabarettist
in Freiburg. Eintrittskarten für sein Programm
„Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben“
sind für 22 Euro in der Stadtinformation am
Rittertor (montags bis samstags von 10 bis 13
Uhr und zusätzlich dienstags bis freitags von 14
bis 17 Uhr) oder bei Sportkultour in Hiesfeld
erhältlich. Online sind die Tickets unter
www.stadt-dinslaken.reservix.de erhältlich.

Inflationsrate im Februar 2025 bei
+2,3 % Inflationsrate bleibt unverändert
- Verbraucherpreisindex, Februar
2025 +2,3 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges
Ergebnis bestätigt) +0,4 % zum Vormonat
(vorläufiges Ergebnis bestätigt)
-
Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Februar
2025 +2,6 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges
Ergebnis: +2,8 %) +0,5 % zum Vormonat
(vorläufiges Ergebnis: +0,6 %)
Die
Inflationsrate in Deutschland − gemessen als
Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum
Vorjahresmonat – lag im Februar 2025 bei +2,3 %.
Im Januar 2025 hatte sie ebenfalls bei +2,3 %
gelegen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, hat sich der
Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln im Februar
2025 verstärkt.
Zudem blieben
insbesondere die überdurchschnittlichen
Preiserhöhungen bei Dienstleistungen
inflationstreibend. Dagegen dämpfte die
Preisentwicklung bei Energie auch im Februar
2025 die Inflationsrate. Gegenüber dem Vormonat
Januar 2025 stiegen die Verbraucherpreise im
Februar 2025 um 0,4 %.
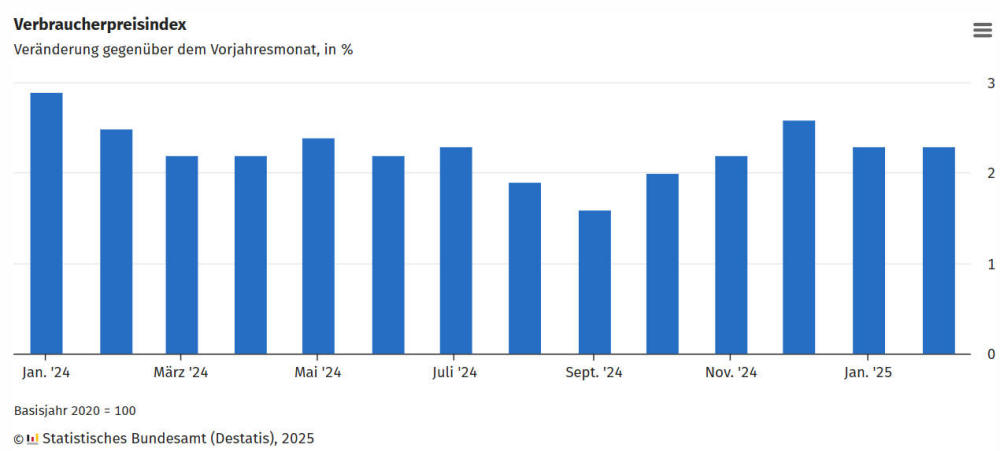
Energieprodukte verbilligten sich um
1,6 % gegenüber Februar 2024
Die Preise für Energieprodukte lagen
im Februar 2025 um 1,6 % niedriger als im
Vorjahresmonat. Bereits im Januar 2025 und
Dezember 2024 hatte der Preisrückgang jeweils
bei -1,6 % gelegen. Binnen Jahresfrist gingen im
Februar 2025 die Preise sowohl für Kraftstoffe
(-0,7 %) als auch für Haushaltsenergie (-2,2 %)
zurück.
Hier konnten die
Verbraucherinnen und Verbraucher von günstigeren
Preisen für Strom (-3,0 %), Brennholz,
Holzpellets oder andere Brennstoffe (-5,0 %) und
leichtes Heizöl (-6,9 %) profitieren. Erdgas
(+2,0 %) und Fernwärme (+9,7 %) waren hingegen
teurer als ein Jahr zuvor.
Preisindizes
für Energieprodukte Line chart with 5 lines.
2020 = 100 1 Dezember 2022: Dezember-Soforthilfe
nur für Erdgas, ohne Betriebskosten. 2
CO₂-Preis-Erhöhung. 3 Ende der temporären
Mehrwertsteuersenkung für Gas (einschließlich
Flüssiggas) und Fernwärme.
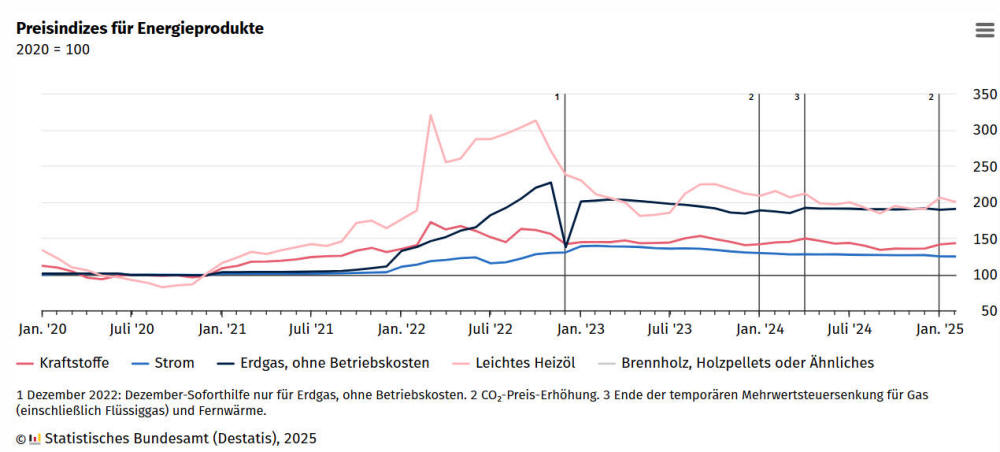
Nahrungsmittel verteuerten sich binnen
Jahresfrist um 2,4 %
Die Preise für
Nahrungsmittel lagen im Februar 2025 um 2,4 %
höher als im Vorjahresmonat, nach +0,8 % im
Januar 2025. Der Preisauftrieb
bei Nahrungsmitteln hat sich damit deutlich
verstärkt und lag im Februar 2025 knapp über der
Gesamtteuerung.
Noch deutlicher waren
die Nahrungsmittelpreise zuletzt im Januar 2024
gestiegen (+3,8 % gegenüber Januar 2023). Von
Februar 2024 bis Februar 2025 verteuerten sich
vor allem Speisefette und Speiseöle (+11,9 %,
darunter Butter:
+27,9 %). Auch für Obst (+4,0 %), Gemüse
(+3,9 %) und Molkereiprodukte (+3,7 %) lag die
Preiserhöhung weiterhin deutlich über der
Gesamtteuerung. Für einige Nahrungsmittelgruppen war
auch eine geringere Preiserhöhung zu beobachten,
zum Beispiel für Brot und Getreideerzeugnisse
(+1,1 %) sowie für Fleisch und Fleischwaren
(+0,2 %).
Inflationsrate ohne
Nahrungsmittel und Energie bei +2,7 % Im Februar
2025 lag die Inflationsrate ohne Energie bei
+2,7 %. Die Inflationsrate
ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und
Energie, häufig auch als Kerninflation
bezeichnet, lag im Februar 2025 ebenfalls bei
+2,7 %. Die beiden Kenngrößen liegen seit über
einem Jahr über der Gesamtteuerung und
verdeutlichen somit, dass die Teuerung in
anderen wichtigen Güterbereichen
überdurchschnittlich hoch war.
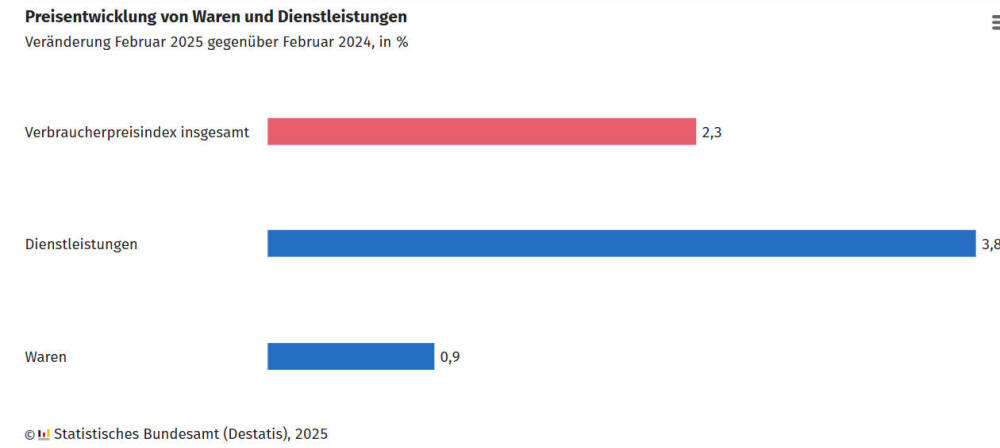
Dienstleistungen verteuerten sich binnen
Jahresfrist überdurchschnittlich um 3,8 %
Die
Preise für Dienstleistungen insgesamt lagen im
Februar 2025 um 3,8 % über dem Niveau des
Vorjahresmonats. Von Februar 2024 bis Februar
2025 erhöhten sich Preise vor allem für
kombinierte Personenbeförderung (+11,4 %), für
Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+10,4
%) und für Versicherungen (+9,4 %). Deutlich
teurer waren unter anderem auch stationäre
Gesundheitsdienstleistungen (+6,5 %), die
Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+5,6 %)
sowie Gaststättendienstleistungen (+4,4 %).
Bedeutsam für die Preisentwicklung bei
Dienstleistungen bleiben zudem die
Nettokaltmieten, die Teuerungsrate lag hier bei
+2,1 % und damit knapp unter der Inflationsrate.
Dagegen waren weiterhin nur wenige
Dienstleistungen günstiger als im
Vorjahresmonat, zum Beispiel Telekommunikation
(-1,2 %).
Waren verteuerten sich
gegenüber Februar 2024 um 0,9 %
Waren
insgesamt verteuerten sich von Februar 2024 bis
Februar 2025 um 0,9 %. Die Preise für
Verbrauchsgüter (+1,4 %) erhöhten sich, dagegen
gaben die Preise für Gebrauchsgüter (-0,1 %)
leicht nach. Neben dem Preisanstieg bei
Nahrungsmitteln (+2,4 %) wurden einige andere
Waren deutlich teurer, vor allem alkoholfreie
Getränke (+5,9 %) und Tabakwaren (+4,3 %).
Preisrückgänge hingegen waren außer bei der
Energie (-1,6 %) beispielsweise bei
Mobiltelefonen (-8,9 %) und
Informationsverarbeitungsgeräten (-7,7 %) zu
verzeichnen.
Preise insgesamt
stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 %
Im
Vergleich zum Januar 2025 stieg der
Verbraucherpreisindex im Februar 2025 um 0,4 %.
Merklich teurer binnen Monatsfrist wurden unter
anderem Pauschalreisen (+9,1 %). Die Preise für
Nahrungsmittel insgesamt stiegen binnen
Monatsfrist um 1,1 %, unter anderem zogen hier
die Preise für frisches Gemüse (+4,5 %) und für
Obst (+2,5 %) an.
Günstiger wurden
hingegen Speisefette und Speiseöle (-1,6 %,
darunter Butter: -3,1 %). Energie insgesamt
verteuerte sich um 0,4 % gegenüber dem Vormonat.
Im Einzelnen standen auch hier den
Preissteigerungen beispielweise bei Kraftstoffen
(+1,2 %) und Erdgas (+0,6 %) Preissenkungen bei
leichtem Heizöl (-2,8 %) gegenüber.
Beantragte Regelinsolvenzen im Februar
2025: +12,1 % zum Vorjahresmonat
Jahr 2024: 22,4 % mehr Unternehmens- und 6,5 %
mehr Verbraucherinsolvenzen als im Jahr 2023
Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in
Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Februar
2025 um 12,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat
gestiegen.
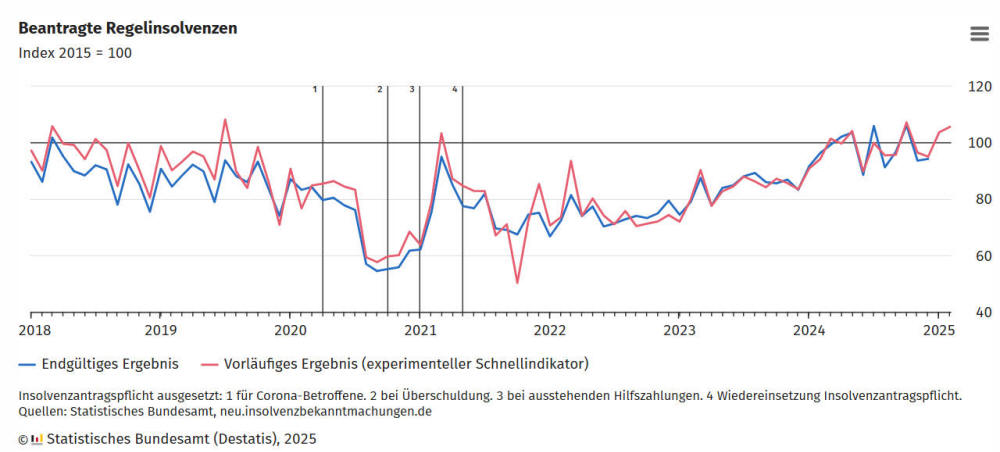
Mit Ausnahme des Juni 2024 (+6,3 %) liegen
die Zuwachsraten im Vorjahresvergleich damit
seit Juni 2023 im zweistelligen Bereich. Bei den
Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die
Anträge erst nach der ersten Entscheidung des
Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen.
Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags
liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate
davor.
|