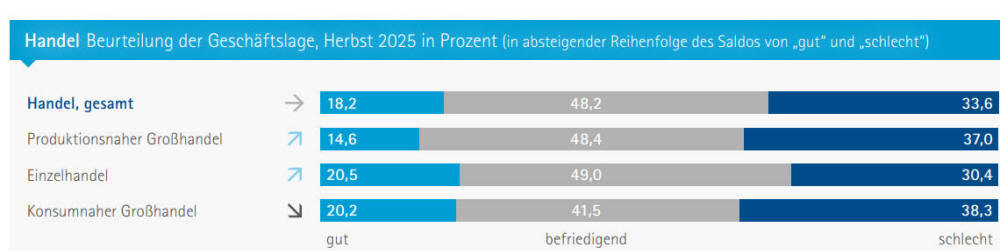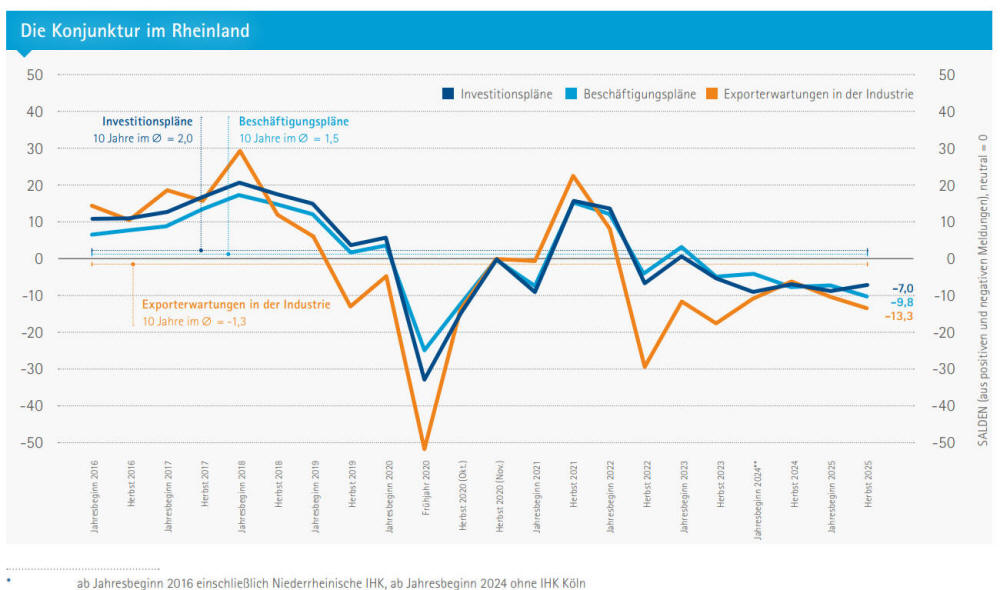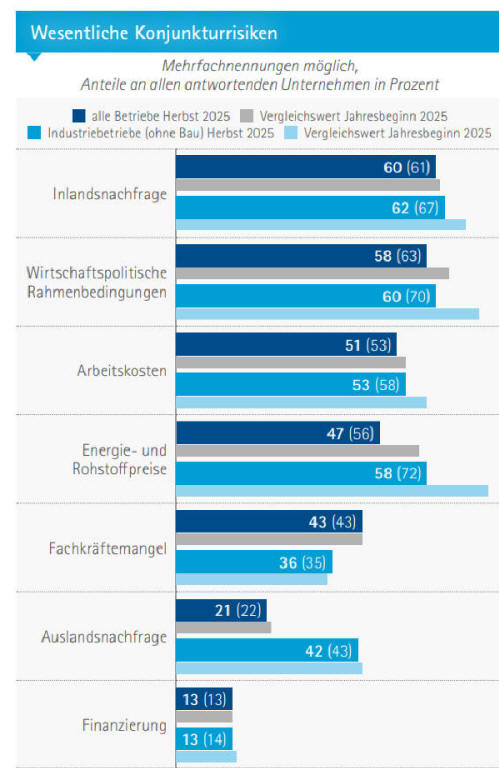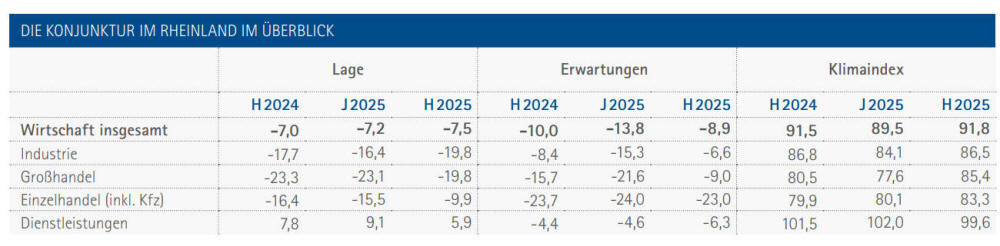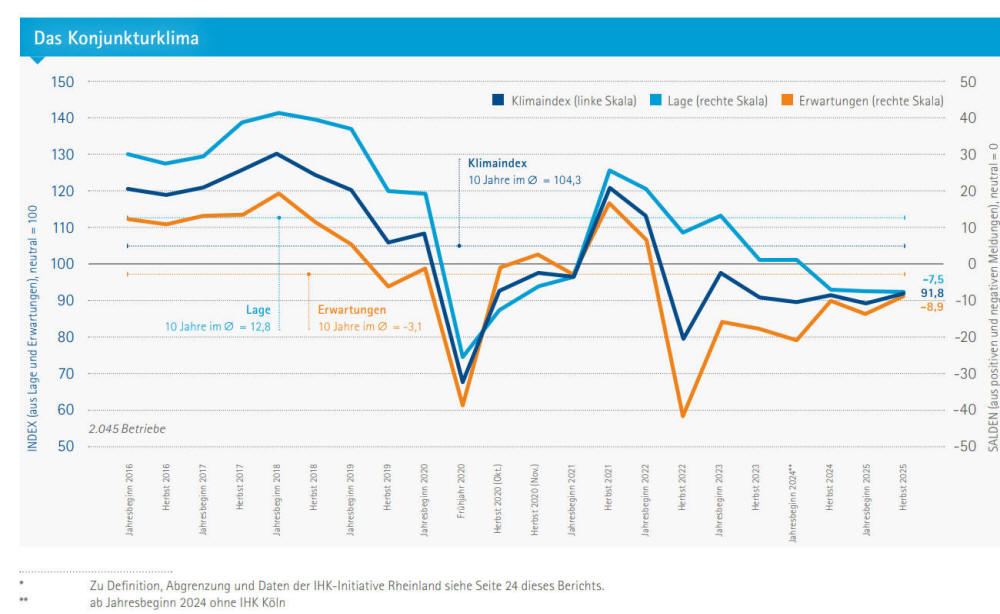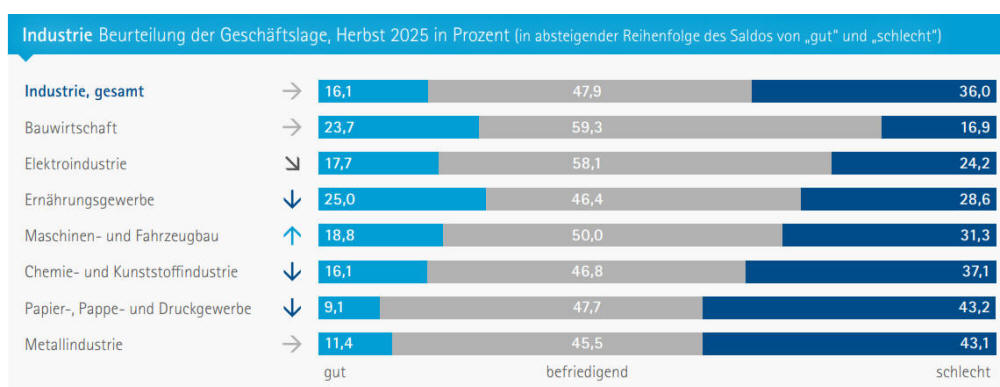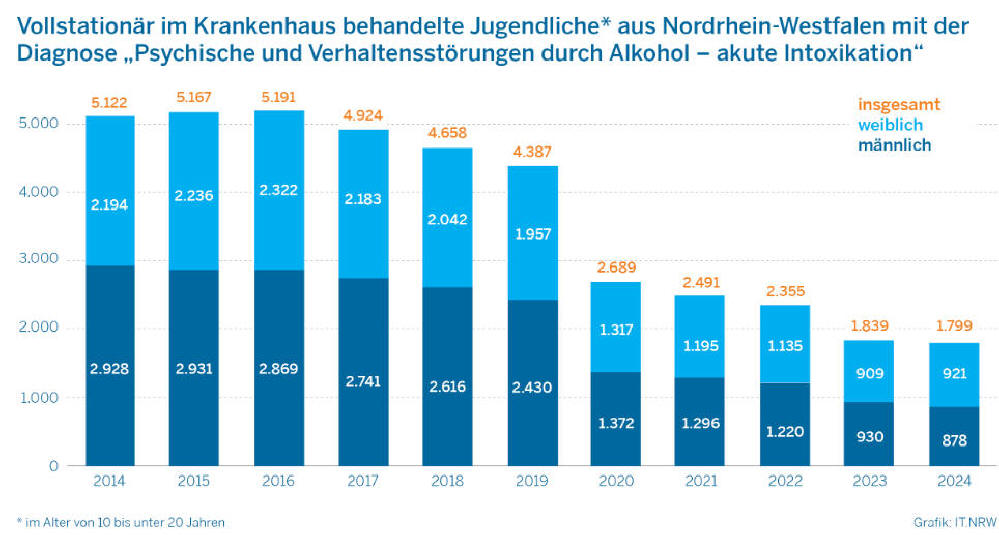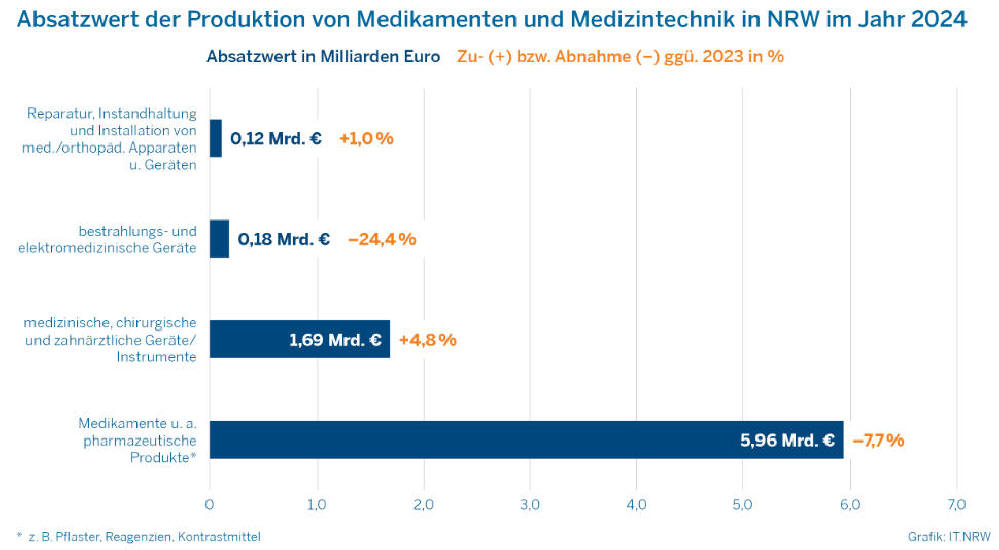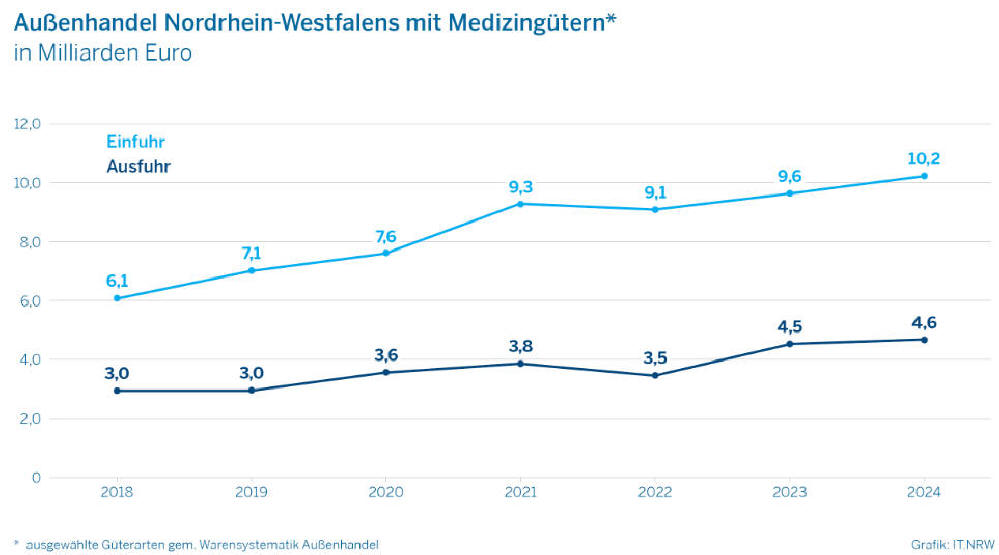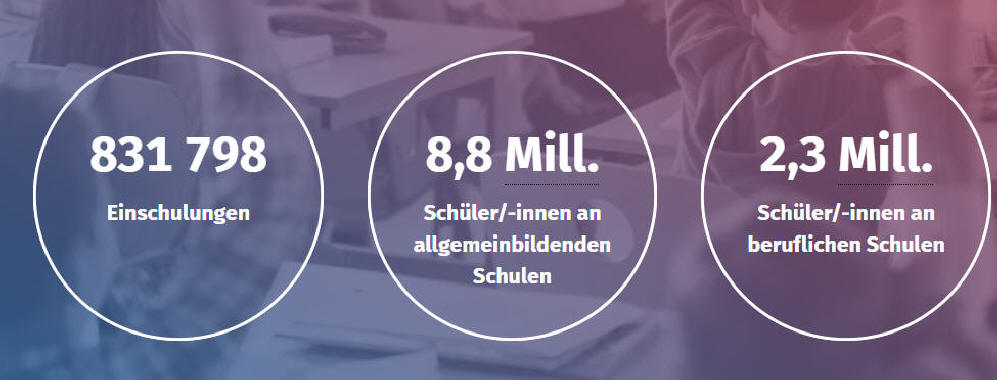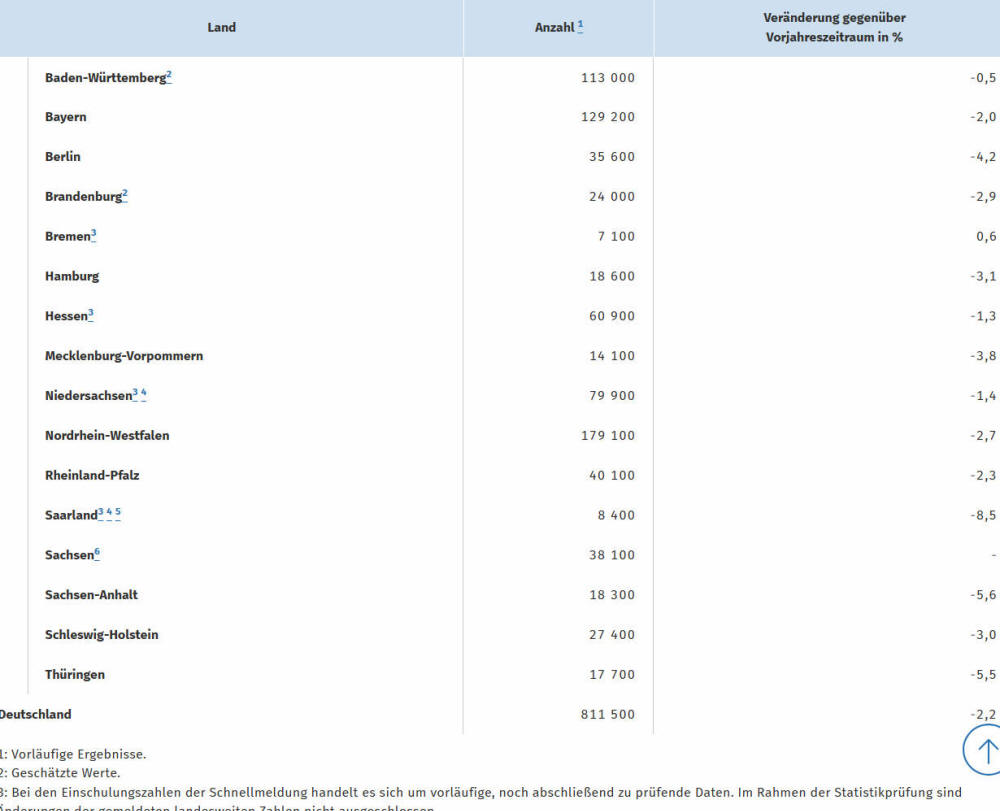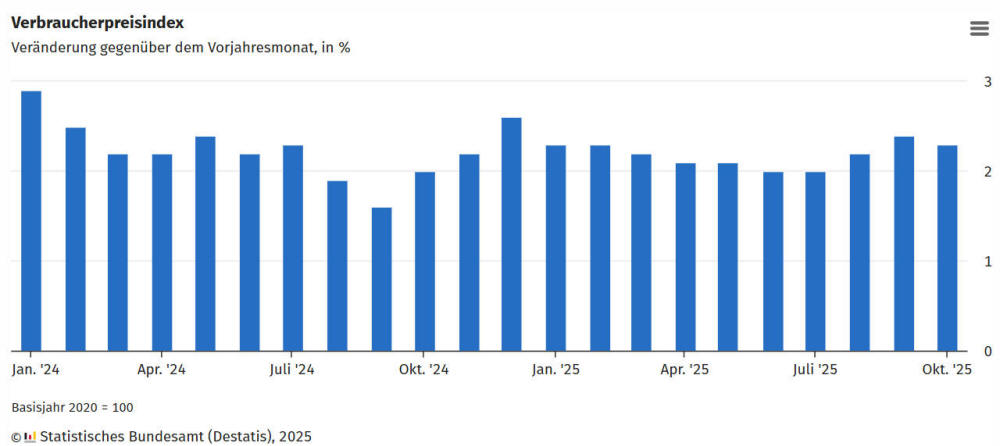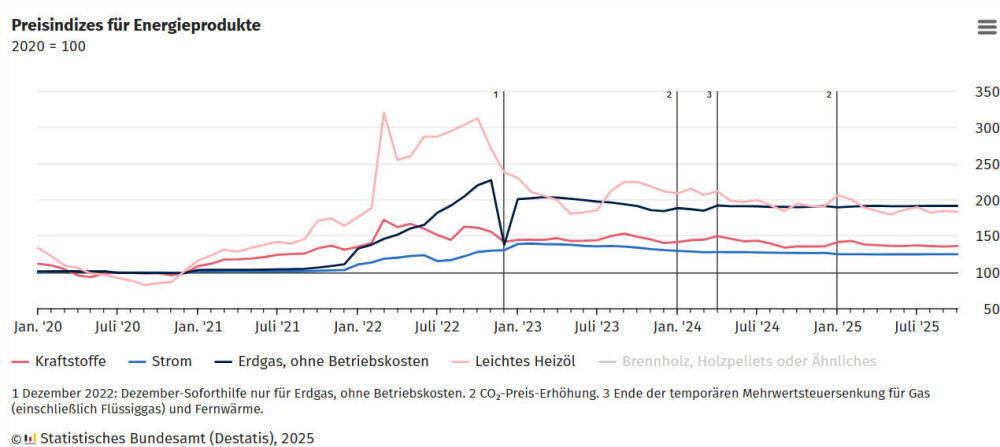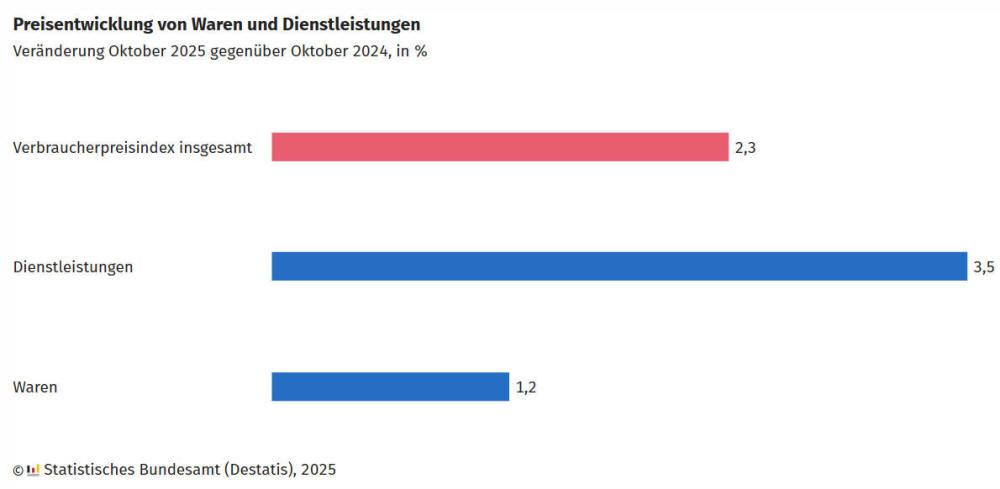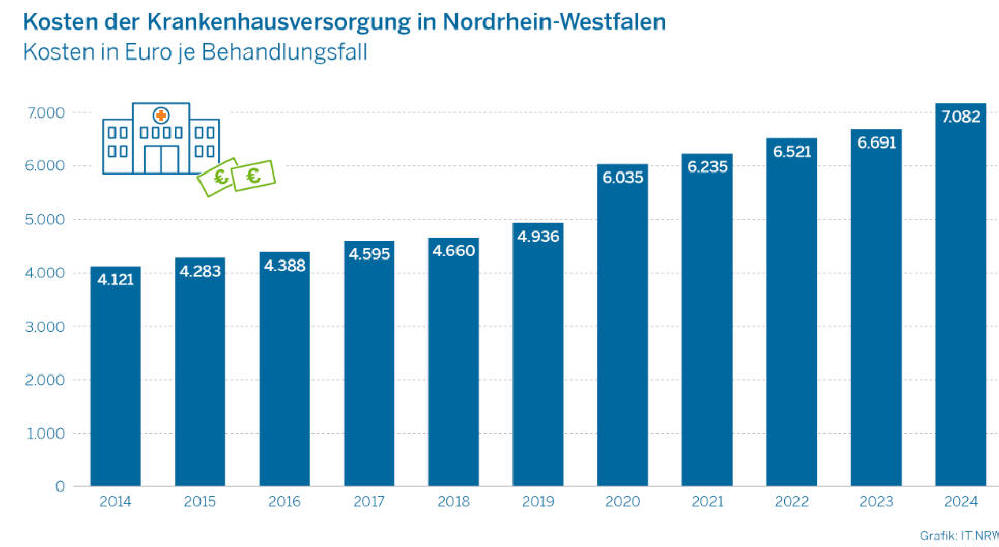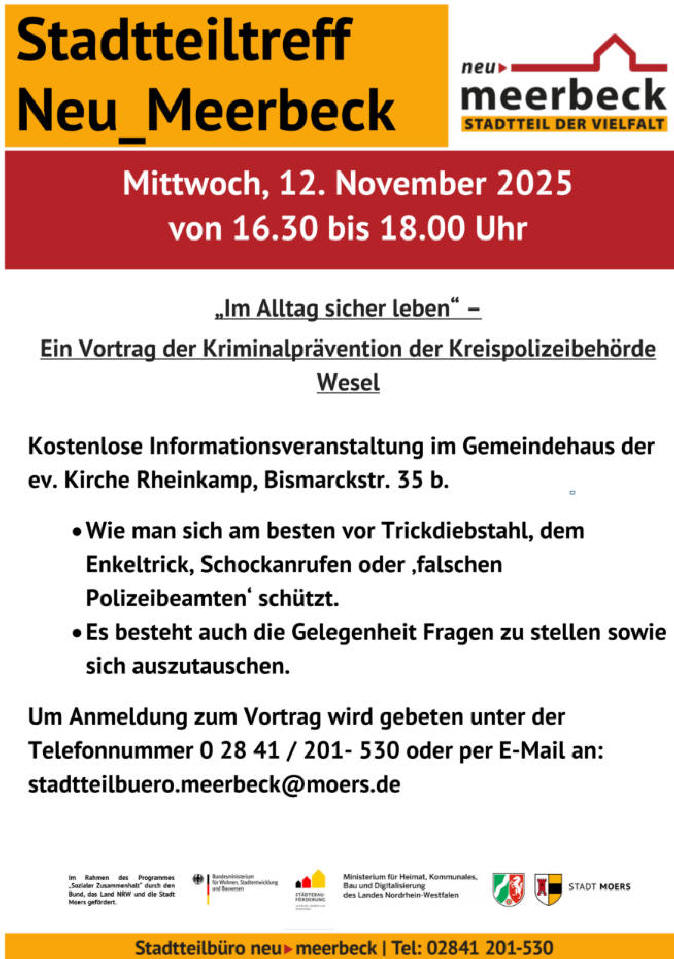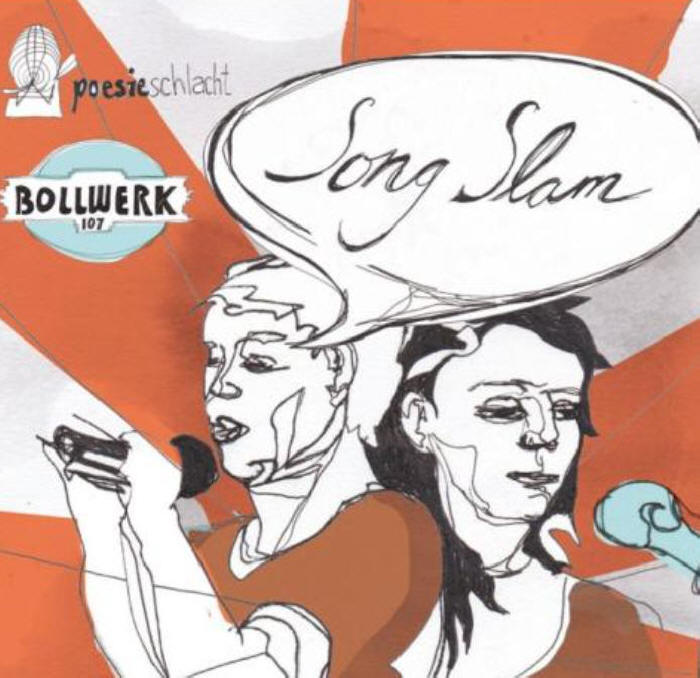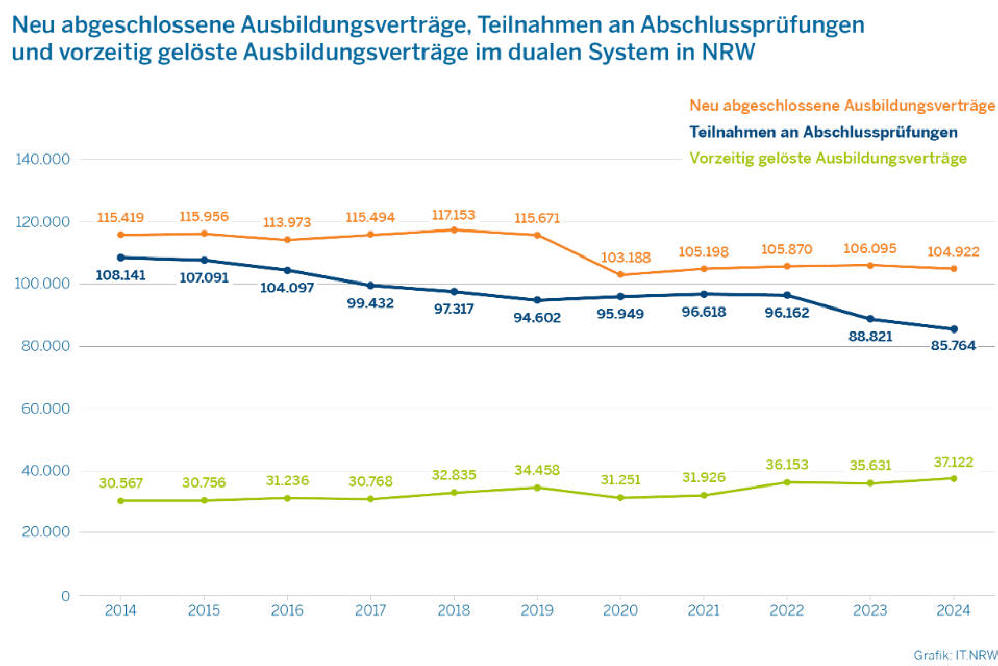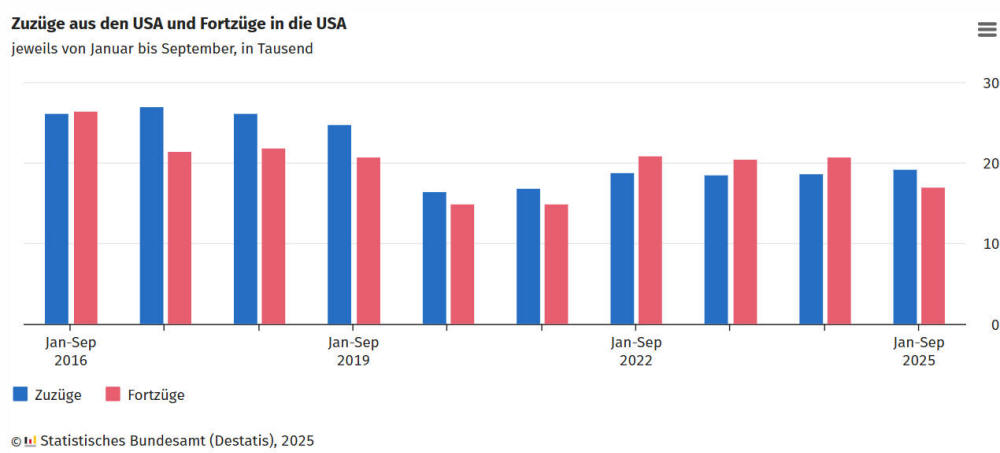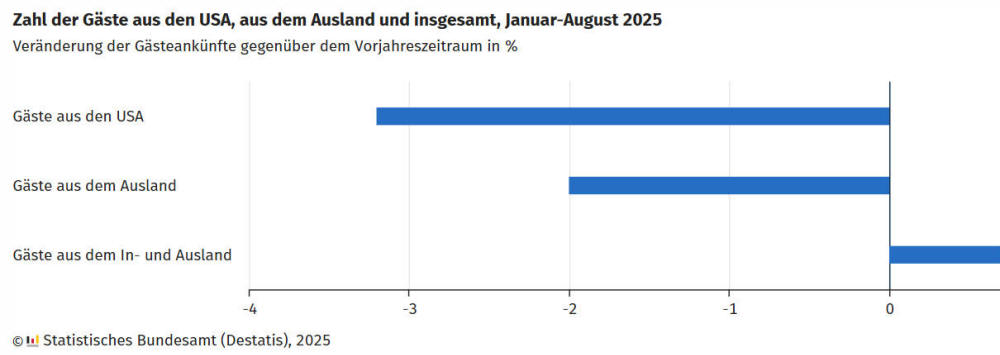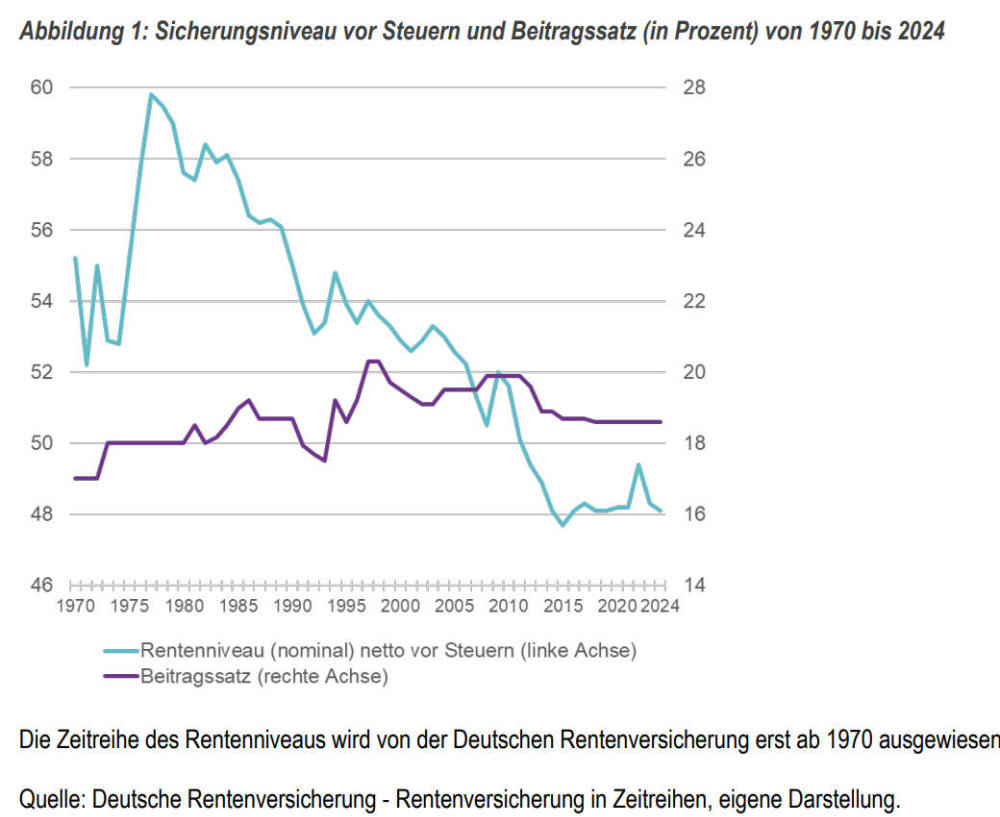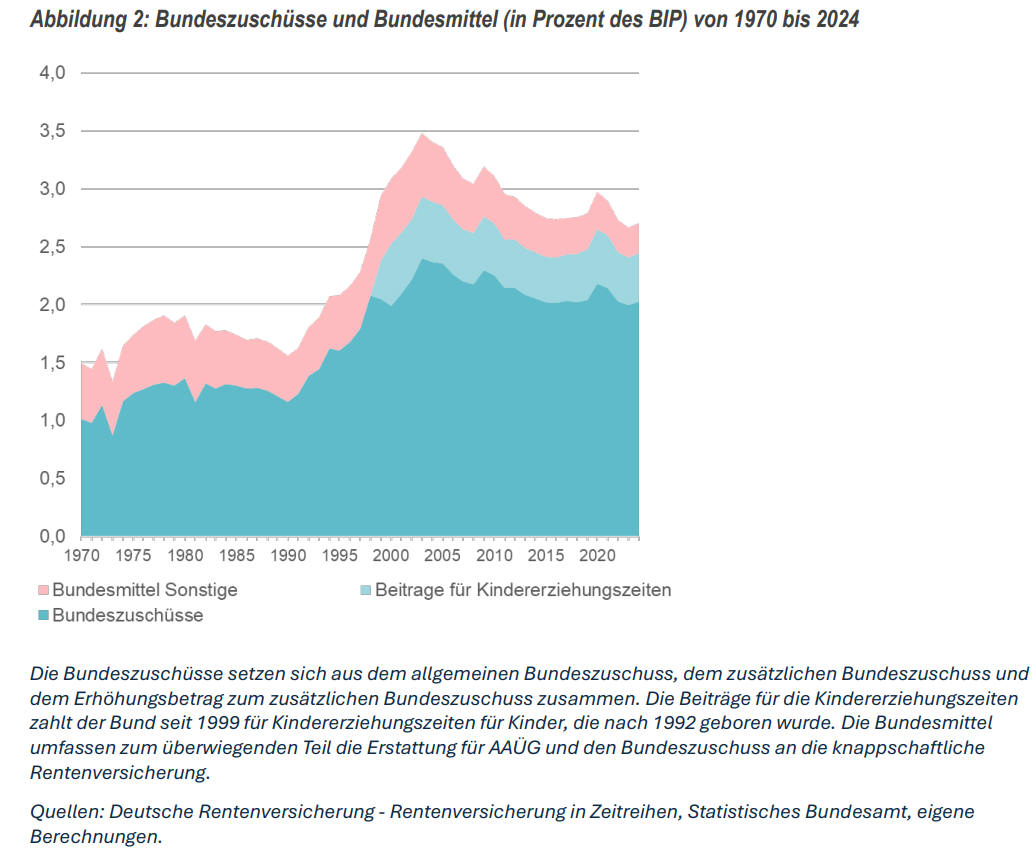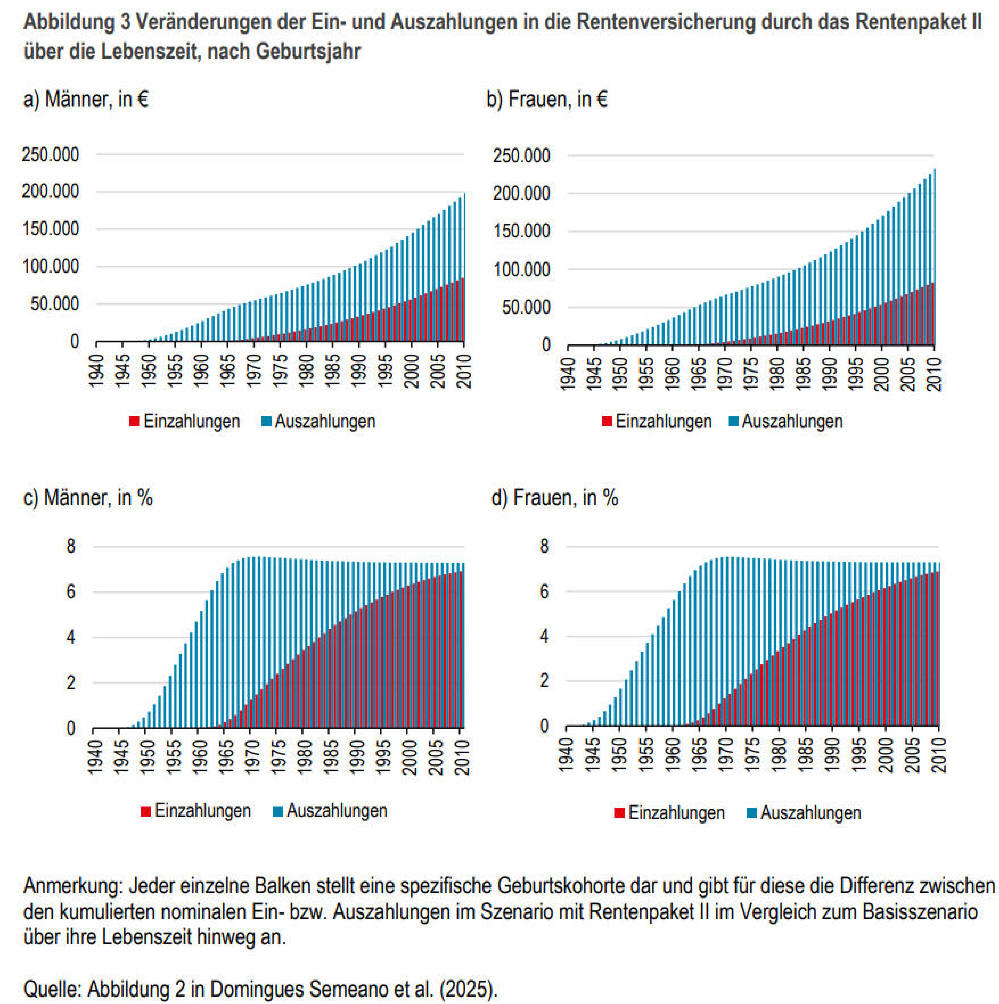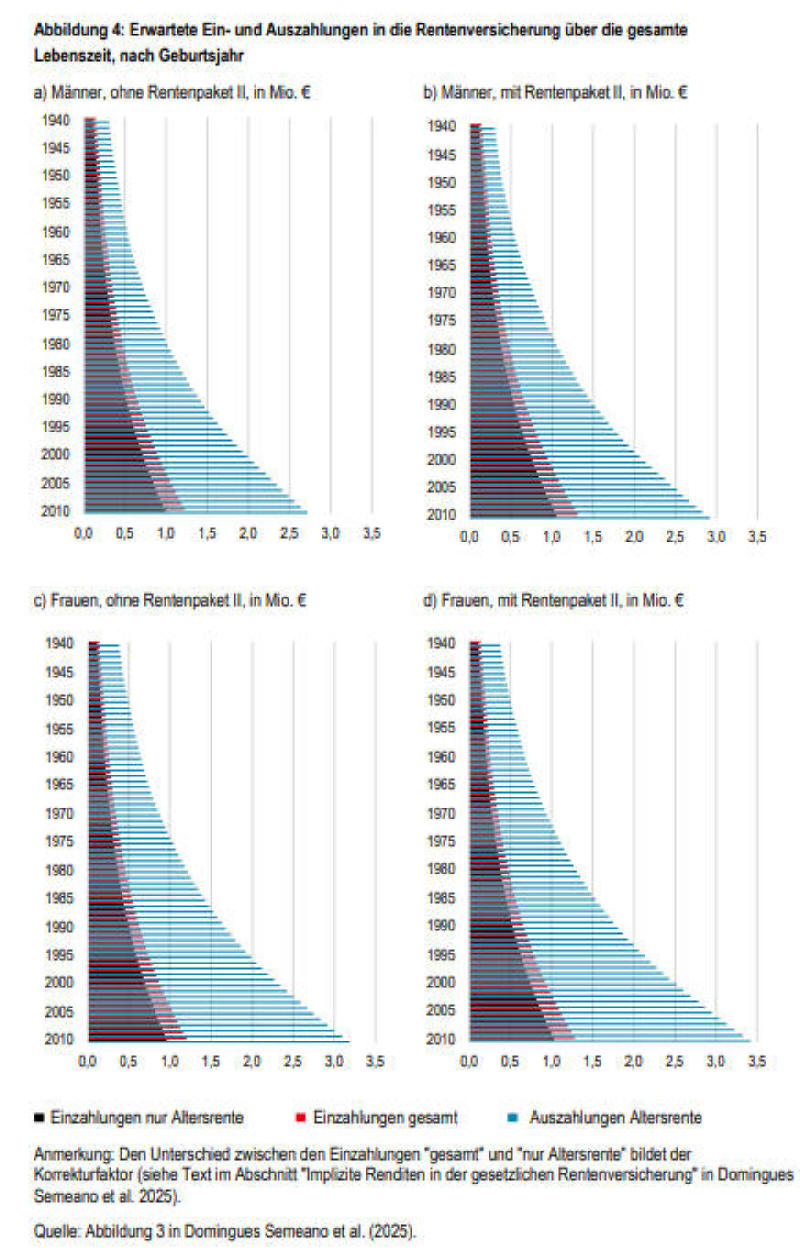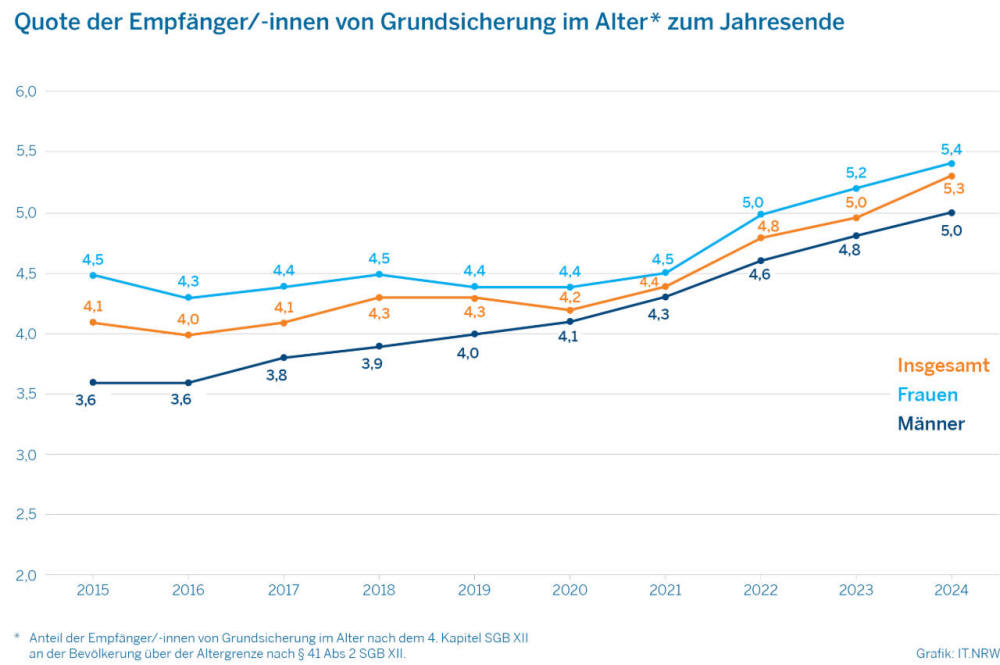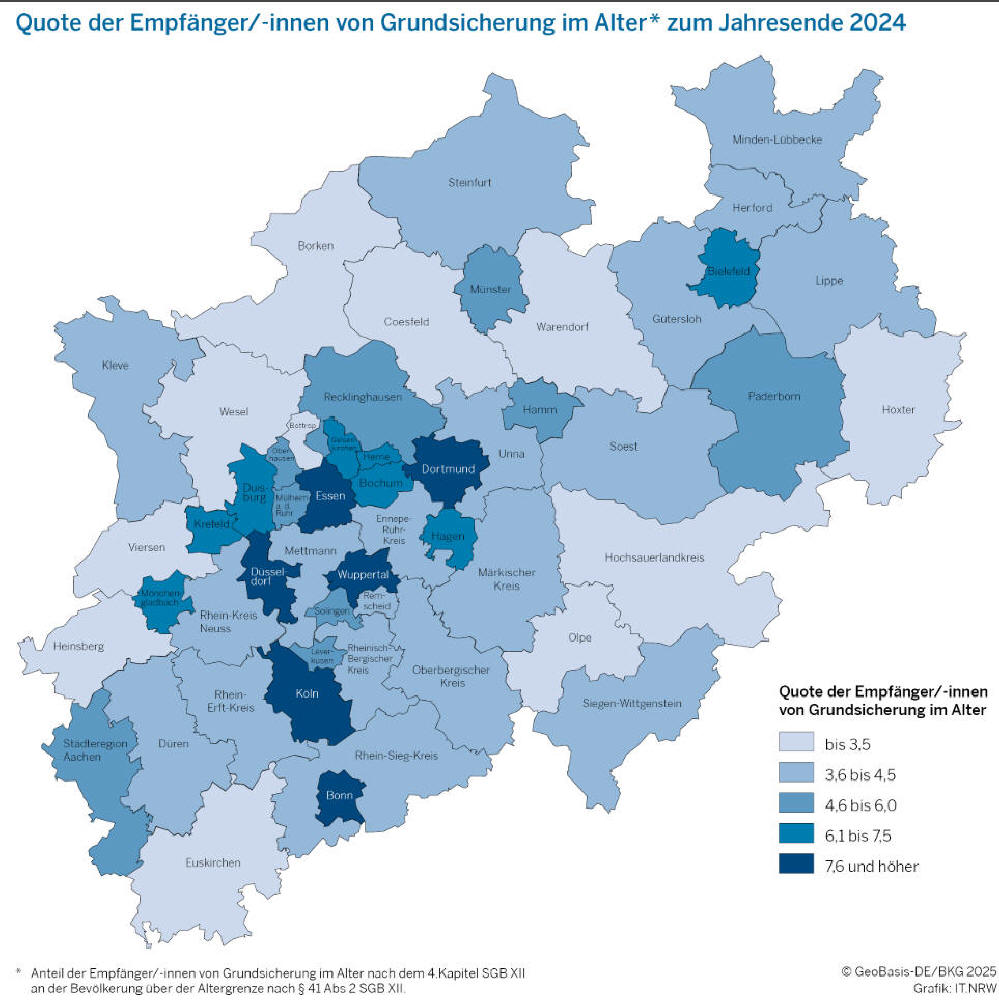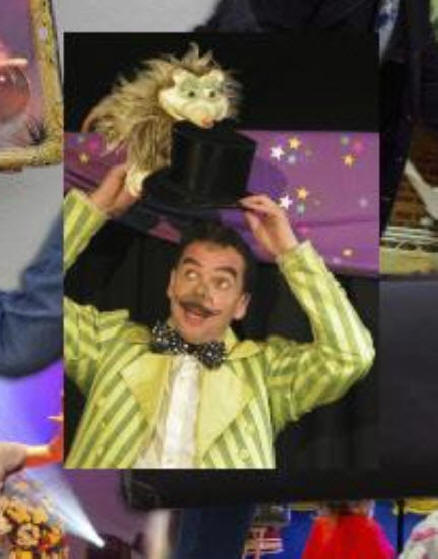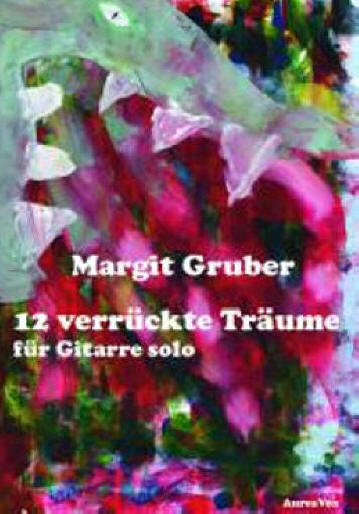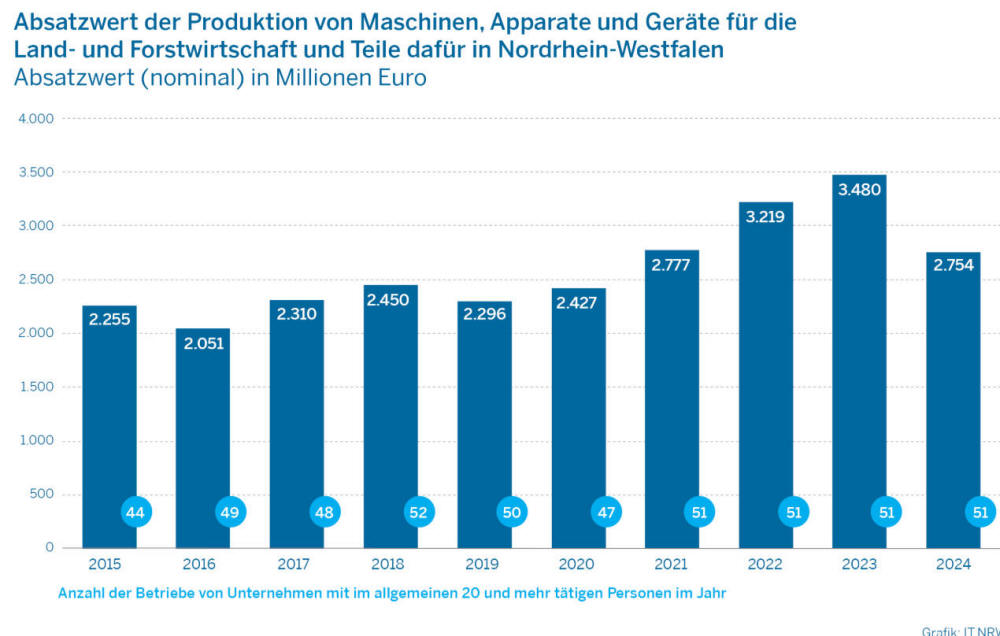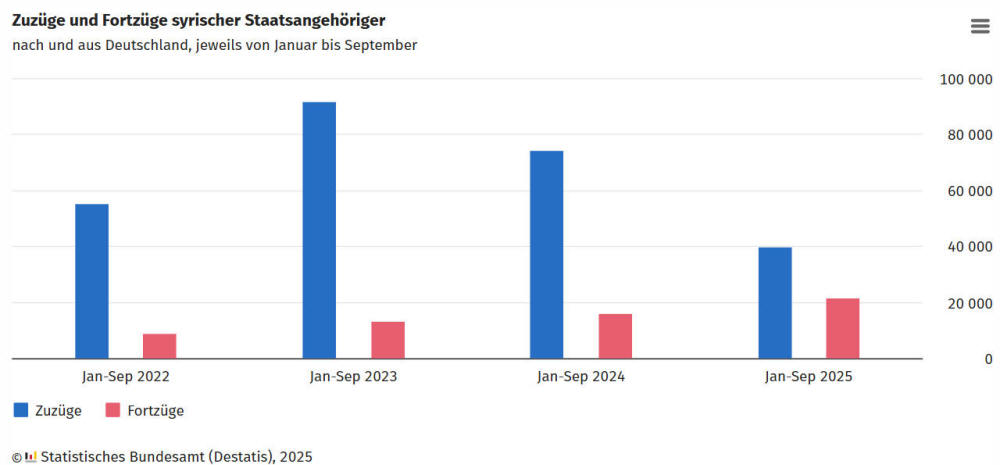|
„Dinslaken,
Ehrensache!“ – Stadt würdigte ehrenamtliches
Engagement
Beim Ehrenamtspreis
2025 gab es zahlreiche Auszeichnungen. Am
Freitag, 14.11.2025, fand in der
Kathrin-Türks-Halle die Preisverleihung
„Dinslaken, Ehrensache!“ statt. Gewürdigt wurde
das vielfältige ehrenamtliche Engagement in der
Stadtgesellschaft.

Beim Ehrenamtspreis 2025 gab es zahlreiche
Auszeichnungen.
Bürgermeister Simon Panke
dankte allen Anwesenden für ihren Einsatz: "Ohne
Ehrenamt funktioniert das Team Dinslaken nicht.
In den nächsten Jahren werden wir noch stärker
darauf angewiesen sein, dass Menschen sich in
den Dienst der Gesellschaft stellen. Sie alle
tragen dazu bei, dass unsere Stadt ein Ort
bleibt, an dem man sich hilft, zusammenhält und
gerne lebt.“
Bei der Verleihung der
Ehrenamtspreise, die in diesem Jahr bereits zum
vierten Mal in Folge vergeben wurden, zeichneten
zahlreiche Laudatorinnen und Laudatoren
Dinslakener Ehrenamtliche aus, die sich das
ganze Jahr über für andere Menschen einsetzen.
Bei der feierlichen Veranstaltung wurden der
mit jeweils 500 Euro dotierte
Maria-Euthymia-Preis in den vier Kategorien
Kultur, Soziales/Integration, Kinder/Jugend und
Sport sowie der mit 750 Euro dotierte
Sonderpreis für besondere Verdienste im
ehrenamtlichen Sektor verliehen.

• Im Bereich Kultur ging die Auszeichnung an den
Bach-Chor Dinslaken. Seit 55 Jahren bereichert
er das musikalische Leben der Stadt mit
Oratorien und Messen von hoher Qualität. Die
Laudatio hielt Kulturdezernentin Dr. Tagrid
Yousef.
• In der Kategorie Soziales/Integration erhielten
die Minigolf-Frauen Lohberg den Preis. Seit drei
Jahrzehnten pflegen sie die besondere
Minigolfanlage im Stadtteil Lohberg. Sie ist ein
Treffpunkt für Menschen aller Generationen aus
Lohberg und ganz Dinslaken. Die Laudatio sprach
Susanne Gülzau.
• Der Preis im Bereich Kinder/Jugend ging an das
Kinder- und Jugendparlament Dinslaken (KiJuPa).
Das KiJuPa bringt junge Menschen zusammen, die
Ideen und Visionen für das Miteinander in der
Stadt entwickeln und die Interessen der jungen
Generation in die Stadtpolitik einbringen. Die
Laudatio hielt Bastian Kischkewitz.

• In der Sparte Sport wurde der SuS 09 Dinslaken
ausgezeichnet. Der Verein leistet seit vielen
Jahren einen bedeutenden Beitrag zur
Sportlandschaft und engagierte sich während der
Sanierung des Sportparks Voerder Straße etwa
beim Bau der Kunstrasenfelder und der neuen
Tribünenüberdachung. Laudator war Peter Lange.
• Den Maria-Euthymia-Sonderpreis 2025 erhielt
Jörg Delere vom Pfadfinderstamm St. Vincentius.
In diesem Jahr beendet er seine 41-jährige
ehrenamtliche Leitertätigkeit. In dieser Zeit
hat er unzählige Kinder und Jugendliche
begleitet, Gruppenstunden vorbereitet, Fahrten
und Lager organisiert sowie den Stamm nachhaltig
geprägt. Die Laudatio hielt Maite Blümer.

• Im Rahmen von „Dinslaken, Ehrensache!“ wurde
auch der Heimat-Preis NRW 2025 vergeben.
Preisträgerin ist die DLRG-Ortsgruppe Dinslaken.
Die Mitglieder übernehmen große Verantwortung in
Krisensituationen, engagieren sich für die
Schwimmausbildung von Kindern und sichern Leben
auf und am Rhein. Auch in Hochwasserregionen war
die Ortsgruppe in den vergangenen Jahren im
Einsatz.
Die Auszeichnung überreichte
Bürgermeister Simon Panke, der zugleich die
Laudatio hielt. Eine Jury hatte im Vorfeld über
alle Preisträgerinnen und Preisträger
entschieden. Moderiert wurde die festliche
Preisverleihung von Thomas Pieperhoff und Filiz
Göcer.
Großflächige Pflanzung von Blumenzwiebeln am
Spoykanal in Kleve
Entlang des
Leinpfades, direkt am Klever Spoykanal, wurden
kürzlich zahlreiche Blumenzwiebeln eingepflanzt.
Schon im Frühjahr sollen sie farbenprächtig
blühen.

Im kommenden Jahr wird es bunt entlang des
Spoykanals am Hochschulgelände! Vergangene Woche
hat eine niederländische Fachfirma im Auftrag
der Stadt Kleve am Leinpfad zwischen Hochschule
Rhein-Waal und Ringbrücke zahlreiche
Blumenzwiebeln gesetzt.
Die Maßnahme
wurde im Rahmen des Leitpapiers
„Insektenfreundlichen Kleve“ umgesetzt, welches
Teil des Klimaschutzfahrplans der Stadt Kleve
ist. Unter anderem wurden Schneeglöckchen,
Elfenkrokusse, Blausternchen und
Dichternarzissen gepflanzt, sodass eine
farbenfrohe Mischung entsteht, die bereits im
zeitigen Frühjahr für leuchtende Akzente sorgen
wird.
Die Pflanzung ist ein erster
Schritt in der Vorbereitung der
Landesgartenschau-Flächen, auf denen bis 2029
nach und nach attraktive Grün- und Freiräume
entstehen sollen. Gleichzeitig verfolgt die
Stadt Kleve mit der Blumenzwiebelpflanzung das
Ziel, die Pflege der Grünflächen in diesem
Bereich extensiver zu gestalten. Die Flächen
wurden auch bisher nur selten gemäht, jedoch
soll die Mahd künftig auf zwei Termine im Jahr
reduziert werden.
In Zukunft wird dort
einmal im Hochsommer und einmal im Spätherbst
gemäht. So erhalten die Blumenzwiebeln
ausreichend Zeit zu wachsen und sich zu
vermehren, während sich gleichzeitig wertvolle
Lebensräume für Insekten und andere Tiere
entwickeln können.
„Ich freue mich sehr,
dass wir mit dieser Pflanzung einen Vorgeschmack
auf das geben können, was die Menschen bei der
Landesgartenschau erwartet“, sagt Bürgermeister
Markus Dahmen. „Schon im Frühjahr wird sich der
Leinpfad in prächtigen Farben zeigen. Ein
schönes Zeichen dafür, wie vielfältig und
lebendig unsere Stadt ist.“
Auch Luc
Boekholt, Grünplaner der Stadt, blickt
erwartungsvoll auf die kommenden Monate. „Die
Pflanzung von Blumenzwiebeln ist eine kleine
Maßnahme mit großer Wirkung. Wenn sich im März
die ersten Blüten zeigen, entsteht nicht nur ein
wunderschönes Bild, sondern auch ein wichtiger
Beitrag zur Förderung der Biodiversität in
unserer Stadt.
Die Pflanzung war eine
Initialpflanzung mit verschiedenen Arten, die
sich in den kommenden Jahren versamen und somit
einen dichten Blütenteppich bilden werden.“ Mit
dieser Aktion möchte die Stadtverwaltung
zugleich die Anwohnenden sowie
Spaziergängerinnen und Spaziergänger dazu
einladen, die Entwicklung der Flächen aufmerksam
zu begleiten und sich schon jetzt auf das bunte
Frühlingserwachen am Spoykanal zu freuen!
Haushalt des Bundesbauministeriums wächst
weiter
Bundeshaushalt 2026: 13 Milliarden
Euro für den Wohnungsbau
Der
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat
in seiner gestrigen Bereinigungssitzung den
Regierungsentwurf für den Haushalt 2026
beschlossen und dabei noch einige Anpassungen
vorgenommen. Der Etat des Bundesbauministeriums
kann erneut einen deutlichen Aufwuchs
verzeichnen. Insgesamt hat der Haushalt des
Einzelplans 25 ein Volumen von fast 13
Milliarden Euro – ein Plus von rund 8% gegenüber
2025.
Die Gesamtausgaben liegen bei rund
7,7 Milliarden Euro, die
Verpflichtungsermächtigungen bei rund 5,2
Milliarden Euro. Zusätzliche Programmmittel
kommen im Klima- und Transformationsfonds (KTF)
in Höhe von rund 875 Millionen Euro und im
Sondervermögen für Infrastruktur und
Klimaneutralität (SVIK) in Höhe von rund 3,4
Milliarden Euro hinzu.
Verena Hubertz,
Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen:
„Ich danke den Mitgliedern des
Haushaltsausschusses für den erneuten
Mittelaufwuchs im Wohnungsbau. Der starke
Haushalt des Bundesbauministeriums zeigt die
klare Prioritätensetzung der Bundesregierung und
des Parlaments: Wir schaffen mehr bezahlbaren
Wohnraum.

Mit 800 Millionen Euro machen wir aus fertigen
Planungen in gebaute Häuser. Das Abschmelzen des
Bauüberhangs ist ein wichtiges Signal an die
Bauwirtschaft
und an alle Menschen in unserem
Land, die dringend mehr Wohnraum brauchen. Noch
2025 wollen wir damit starten. Dazu investieren
wir in 2026 vier Milliarden Euro in die soziale
Wohnraumförderung, um die Trendwende hin zu mehr
Sozialwohnungen zu schaffen.
Aber wir
investieren nicht nur in Steine und Beton,
sondern auch in das soziale Miteinander. Damit
Städte und Gemeinden gut für die Zukunft
aufgestellt
sind und das Zusammenleben vor
Ort gestärkt wird, erhöhen wir die
Städtebauförderung 2026 auf eine Milliarde Euro.
Außerdem stehen rund 580 Millionen Euro für die
Sanierung von Sportstätten und Schwimmbädern
bereit.“
Mit dem Haushalt 2026 wurden im
Einzelplan 2025 unter anderem „frische“
Programmmittel für folgende Punkte verabredet:
· 4 Milliarden Euro für den Sozialen
Wohnungsbau (inkl. Junges Wohnen, 2025: 3,5
Milliarden Euro)
· 1 Milliarde Euro für die
Städtebauförderung (2025: 790 Millionen Euro)
· 24,9 Millionen Euro für den Erwerb von
Genossenschaftsanteilen (2025: 15 Millionen
Euro)
Aus dem Sondervermögen für
Infrastruktur und Klimaneutralität sowie dem KTF
wurden unter anderem „frische“ Programmmittel
für folgende Punkte verabredet:
· 800
Millionen Euro für die Aktivierung des
Bauüberhangs (Förderung EH55-Standard mit 100 %
Erneuerbaren Energien)
· 1,1 Milliarden Euro
für das KfW-Programm klimafreundlicher Neubau
(KFN). In diesem Programm stehen aus dem Budget
2025 und 2026
bis zu 800 Millionen Euro für
die Aktivierung des Bauüberhangs (Förderung EH55
EE-Standard) zur Verfügung
· 600 Millionen
Euro für das KfW-Programm klimafreundlicher
Neubau im Niedrigpreissegment (KNN)
· 350
Millionen Euro für das KfW-Programm
Wohneigentumsförderung für Familien (WEF)
·
250 Millionen Euro für das KfW-Programm Jung
kauft Alt (JkA)
· 300 Millionen Euro für das
geplante KfW-Programm Gewerbe zu Wohnen (GzW)
· 75 Millionen Euro für das Programm
Energetische Stadtsanierung
· 333 Millionen
Euro für die Sanierung kommunaler Sportstätten
sowie zusätzliche 250 Millionen Euro für die
Sanierung kommunaler Schwimmstätten und -bäder
· 150 Millionen Euro für die Sanierung von
Frauenhäusern
· 50 Millionen Euro für
barrierefreies und altersgerechtes Umbauen
Neuer Kreistag legt Ausschüsse,
Ausschuss-Vorsitzende und Vertretung beim
Landschaftsverband Rheinland fest
In
der Sitzung des Kreistags am Donnerstag, 13.
November 2025, wählten die Kreistagsmitglieder
die Vertreterinnen und Vertreter des Kreises
Wesel beim Landschaftsverbands Rheinland (LVR).
Künftig werden Frank Berger, Michael Nabbefeld
(beide CDU), Thomas Cirener (SPD), Hubert Kück
(Bündnis 90 / Die Grünen) und Birgit Ullrich
SPD) die Interessen des Kreises Wesel in der
Landschaftsversammlung vertreten.
Der
LVR ist eine übergeordnete Körperschaft und
übernimmt für den Kreis Wesel unter anderem
Aufgaben in der Sozial- und Jugendhilfe, bei der
Kulturförderung und im Denkmalschutz und in der
Bildung. Der LVR stellt somit sicher, dass
übergreifende Aufgaben und Projekte, die eine
Vielzahl von Kommunen betreffen, koordinierter
und effizienter durchgeführt werden.
Darüber hinaus bildete der Kreisausschuss
Fachausschüsse besetzte sie personell und legte
deren Vorsitze für die kommenden fünf Jahre
fest:
Gremium Vorsitz Stellvertretender
Vorsitz
- Kreisausschuss Ingo Brohl (CDU)
Günter Helbich (CDU)
- Ausschuss für
Wirtschaft, Beteiligungen und
Regionalentwicklung Jürgen Preuß (SPD) Udo
Bovenkerk (SPD)
- Rechnungsprüfungsausschuss
Wolfgang Weinkath (AfD) Jan-Eric Reismann (AfD)
- Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und
Integration Richard Stanczyk (SPD) Karsten
Schubert (CDU)
- Wahlprüfungsausschuss für
die Kommunalwahlen 2025 Patrick Marhofen (SPD)
Rainer Gardemann (CDU)
- Ausschuss für
Planung und Umwelt Arnd Cappell-Höpken (CDU)
Bernfried Kleinelsen (SPD)
- Ausschuss für
Soziales und Arbeit Michael Nabbefeld (CDU) Dr.
Doris Beer (SPD)
- Ausschuss für Gesundheit,
Bevölkerungs- und Verbraucherschutz Frank Berger
(CDU) Edgar Stary (SPD)
- Ausschuss für Bauen
und Abfallwirtschaft Lars Löding (CDU) Maria
Fütterer (SPD)
- Ausschuss für
Digitalisierung und Verwaltung Hubert Kück
(Bündnis 90 /Die Grünen) Celina Mara Damschen
(Bündnis 90 /Die Grünen)
- Ausschuss für
Mobilität und Verkehr Gabriele Wegner (SPD) Timo
Juchem (CDU)
Landrat Ingo Brohl
verleiht Verdienstkreuz am Bande Georg Schneider
aus Voerde

Würdigung jahrzehntelangen Engagements für
Brauchtum, Sport und Kommunalpolitik - Landrat
Ingo Brohl mit dem Ehepaar Schneider und dem
Voerder Bürgermeister Dirk Haarmann
Landrat Ingo Brohl zeichnete am Freitag, 14.
November 2025, Georg Schneider aus Voerde in der
Neuling Weinbar (Voerde) mit dem Verdienstkreuz
am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland für sein herausragendes
ehrenamtliches Engagement aus.
Der
73jährige Georg Schneider hat sich über
Jahrzehnte hinweg in den Bereichen Brauchtum,
Sport und Kommunalpolitik in besonderem Maße
verdient gemacht. Der verheiratete Vater von
vier Kindern ist Senior-Chef einer Spedition und
seit seiner Jugend in zahlreichen Vereinen und
Initiativen aktiv.
Bereits mit 14
Jahren trat Georg Schneider dem
Bürgerschützenverein (BSV) Friedrichsfeld „Alter
Emmelsumer 1868 e.V.“ bei. 1991 wurde er zum
stellvertretenden Präsidenten gewählt, von 2005
bis 2019 stand er dem Verein als Präsident vor.
Unter seiner Leitung entwickelte sich
der BSV Friedrichsfeld zu einem lebendigen und
modernen Verein: Die Mitgliederzahlen stiegen
deutlich, das Vereinsheim wurde erweitert, und
auf sein Engagement hin entstand eine neue große
Mehrzweckhalle – ein Projekt, das er nicht nur
initiierte, sondern auch finanziell
unterstützte. Auch bei der Freiwilligen
Feuerwehr Voerde war Schneider über viele Jahre
hinweg aktiv.
Mit 16 Jahren trat er –
mit Sondergenehmigung – in die Feuerwehr ein, wo
er bis zur Übernahme der elterlichen Spedition
an nahezu allen Einsätzen teilnahm und den
Dienstgrad des Unterbrandmeisters erwarb. 2003
wechselte er in die Alters- und Ehrenabteilung.
Die Feuerwehr konnte stets auf seine materielle
und politische Unterstützung zählen.
Neben seinem Engagement in Vereinen und im
Brandschutz prägt Schneider seit Jahrzehnten
auch die kommunalpolitische Landschaft Voerdes.
Mit 19 Jahren trat er in die CDU ein, seit 1999
gehört er dem Rat der Stadt Voerde an – und
wurde bei jeder Wahl direkt gewählt.
Als
Vorsitzender des Bau- und Betriebsausschusses
sowie als langjähriger Fraktionsvorsitzender
(2013–2017) begleitete er zahlreiche
städtebauliche und infrastrukturelle Projekte,
darunter die Neugestaltung des Friedrichsfelder
Marktplatzes, den Bau der Feuerwehrgerätehäuser
Löhnen und Friedrichsfeld, die 3-fach-Turnhalle
am Schulzentrum Voerde-Süd und die Sanierung der
Sportanlage Am Tannenbusch.
Darüber
hinaus setzt sich Georg Schneider in besonderem
Maße für die Sportförderung in Voerde ein. 1998
war er Mitinitiator des Sportpreises des Monats,
der erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler mit
einer finanziellen Anerkennung würdigt. 2002
rief er die Veranstaltung „Sport im Ort“ ins
Leben – einen jährlichen Weitsprungwettbewerb
für Grundschulkinder im Rahmen des Dorffestes.
Zudem fördert er den Wettbewerb um das
Deutsche Sportabzeichen an Grundschulen, bei dem
die erfolgreichste Schule prämiert wird. Auch
der Martinsmarkt in Friedrichsfeld profitiert
von seinem stetigen Einsatz. Das Wirken von
Georg Schneider ist geprägt von Ideenreichtum,
Tatkraft und Beharrlichkeit. Viele Projekte,
Veranstaltungen und Vereine in Friedrichsfeld
und Voerde tragen seine Handschrift und haben
das gemeinschaftliche Leben nachhaltig
bereichert.
Landrat Ingo Brohl fasste in
seiner Laudatio zusammen: „Lieber Herr
Schneider, vor einigen Wochen waren Sie
gemeinsam mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter zu
unserem Ordensvorgespräch im Kreishaus. Dabei
haben Sie mich mit Ihrer Offenheit und Ihrer
Bescheidenheit tief beeindruckt. Es war deutlich
zu spüren, wie sehr Sie mit Ihrem Engagement
verbunden sind – und wie viel Ihnen diese Ehrung
bedeutet. Für mich wurde dabei sichtbar, mit
welchem Herzen Sie Ihr Leben gestaltet haben:
Sie sind ein Mann, der nie sich selbst in den
Mittelpunkt gestellt hat, sondern stets die
Gemeinschaft – und ganz besonders die Jugend.“
Neukirchen-Vluyn: Kostenloser
Elternstart NRW-Kurs startet ab sofort – jetzt
freie Plätze sichern!
Jetzt
kostenlos anmelden! Für den neuen Elternstart
NRW-Kurs in Neukirchen-Vluyn sind noch Plätze
frei. Das Angebot richtet sich an Eltern mit
Babys aus dem Geburtszeitraum 01–03/2025 und
unterstützt beim Start ins Familienleben –
kostenlos, wohnortnah und alltagspraktisch.
[Neukirchen-Vluyn] Die DRK-Familienbildung
Niederrhein bietet ab sofort wieder einen
kostenlosen Elternstart NRW-Kurs für Eltern mit
Kindern im Geburtszeitraum Januar bis März 2025
an. Für den Kurs, der in Neukirchen-Vluyn
startet, sind noch Plätze verfügbar. Das
Programm Elternstart NRW richtet sich an Mütter
und Väter mit ihrem Säugling und unterstützt sie
in den ersten Monaten nach der Geburt. Im
Mittelpunkt stehen der Austausch mit anderen
Eltern, Informationen rund um den Familienalltag
sowie Anregungen zur kindlichen Entwicklung.

Eltern und Kinder genießen die gemeinsame Zeit
im Elternstart NRW-Kurs des DRK – Austausch,
Spiel und frühe Förderung in gemütlicher
Atmosphäre.
Das Angebot ist kostenfrei
und wird durch das Land Nordrhein-Westfalen
gefördert. Anmeldungen und Rückfragen nimmt die
DRK-Familienbildung Niederrhein telefonisch
unter 0281 3001-8100 oder per E-Mail an
familienbildung@drk-niederrhein.de entgegen.
Weitere Informationen zum Programm finden
Interessierte auf der Website des DRK
Niederrhein.
Die Familienbildung des DRK
Niederrhein steht für lebensnahe, vielfältige
und qualitativ hochwertige Bildungsangebote. Im
vergangenen Jahr konnten wir 169 Kurse mit
insgesamt 3447 Unterrichtsstunden erfolgreich
durchführen. Rund 1700 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer nutzten unsere Angebote zur Förderung
von Erziehungskompetenz, Familienalltag und
persönlicher Entwicklung. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in unserer Breitenausbildung
im Bereich Erste Hilfe.
Hier wurden 218
Kurse zu Themen wie Erste Hilfe, Erste Hilfe am
Kind und Fortbildungen angeboten – mit einer
beeindruckenden Teilnahme von 2700 Personen. Mit
unserem Engagement tragen wir zur Stärkung von
Familien und zur Sicherheit im Alltag bei –
praxisnah und kompetent.
Bilanz
Martinikirmes Dinslaken 2025
Die
Stadt Dinslaken zieht eine positive Bilanz der
diesjährigen Martinikirmes. Das traditionsreiche
Volksfest lockte vom 7. bis 11. November 2025
wieder Zehntausende Besucher*innen auf das
Gelände der ehemaligen Trabrennbahn.

Ein gelungenes Fest für die ganze Familie -
Martinikirmes 2025 in der Vogelperspektive.
Bei überwiegend trockenem Herbstwetter
genossen Familien, Kinder und Kirmesfans aus der
gesamten Region fünf Tage voller Spaß, Begegnung
und Unterhaltung. Rund 120 Schausteller*innen
sorgten mit ihren Fahrgeschäften, Buden und
kulinarischen Angeboten für ein buntes
Kirmeserlebnis.
Insgesamt kamen nach
ersten Schätzungen ca. 165.000 Menschen zur
Martinikirmes, womit das Niveau der Vorjahre
überschritten wurde. Mit einem Höhenfeuerwerk
endete die Kirmes am gestrigen 11. November.
Bürgermeister Simon Panke zeigte sich
erfreut über den erfolgreichen Verlauf: „Die
Martinikirmes ist Teil unserer Stadtidentität
und gehört ganz fest zu Dinslaken. Sie verbindet
Generationen, Vereine, Nachbarschaften und
Familien. Ich freue mich, dass so viele Menschen
friedlich und fröhlich zusammengekommen sind, um
diese Tradition gemeinsam zu leben. Mein
herzlicher Dank gilt allen Schaustellerinnen und
Schaustellern, Einsatzkräften, Helferinnen und
Helfern sowie allen, die zum Gelingen und zur
Sicherheit der Kirmes beigetragen haben.“
Dank des gut abgestimmten
Sicherheitskonzepts konnte das
Sicherheitspersonal rückblickend eine positive
Bilanz über das friedliche Miteinander auf der
Kirmes ziehen. Auch die eingerichteten An- und
Abreisemöglichkeiten – darunter der Pendelbus
zwischen Innenstadt und Festplatz – wurden von
den Besucherinnen und Besuchern rege genutzt.
Die Vorfreude auf das nächste Jahr darf bereits
beginnen: Die Martinikirmes 2026 findet vom 6.
bis 10. November auf dem Gelände der ehemaligen
Trabrennbahn statt
Amtsblatt vom
13.11.2025
Am 13. November ist ein
neues Amtsblatt der Stadt Dinslaken erschienen.
Es enthält zwei öffentliche Bekanntmachungen der
Stadt Dinslaken. Das Amtsblatt ist auch online
zu finden: https://www.dinslaken.de.
IHKs besorgt:
„Lage vieler Unternehmen verschlechtert sich
weiter“ Wirtschaft im Rheinland braucht echte
Reformen
Die Wirtschaft
im Rheinland kommt nicht Schwung. Schließungen,
Stellenabbau und fehlende Investitionen
betreffen die ganze Region, das zeigt das
Konjunkturbarometer der IHKs im Rheinland.
Besonders die wichtige Grundstoffindustrie
leidet: Stahl- und Chemieprodukte lassen sich
schlecht verkaufen.
Bürokratie,
Energiepreise und marode Straßen bremsen die
Wirtschaft. Die Wettbewerbsfähigkeit vieler
Unternehmen sinkt. Das neue Konjunkturbarometer
ist eine deutliche Mahnung an die
Bundesregierung.
Zu wenig, zu verzagt – so
urteilen die Unternehmen über die neue
Bundesregierung. Viele Betriebe haben sich mehr
erhofft. Von den bisherigen Reformen kommt bei
der Wirtschaft zu wenig an. Der Mittelstand ist
durch Berichtspflichten, endlose Verfahren und
eine entrückte Verwaltung gefesselt. Die
Industrie kann die Standortnachteile nicht mehr
durch Produktivität ausgleichen.

IHK-Geschäftsführer im Bereich Regionalpolitik
und Konjunktur Ocke Hamann sowie
IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan
Dietzfelbinger stellen das neue
Konjunkturbarometer Rheinland vor. Foto:
Niederrheinische IHK / Jacqueline Wardeski
„Jeder vierte Betrieb will Beschäftigte
entlassen. Jeder Dritte will weniger
investieren. Das zieht andere mit in den
Abwärtsstrudel“, warnt IHK-Hauptgeschäftsführer
Dr. Stefan Dietzfelbinger.
Strompreise müssen runter
Die IHKs
im Rheinland sind in Sorge um ihre Industrie.
Die leeren Auftragsbücher machen der rheinischen
Wirtschaft besonders zu schaffen. „Wir müssen
alles tun, um unsere Produktionsketten intakt zu
halten. Ein Chemieunternehmen, das seine Tore
schließt, kommt nicht mehr zurück. Im Gegenteil,
es zieht weitere mit sich. Das Rheinland ist der
Energie-Standort in Deutschland.
Die
Energiekosten müssen dringend runter. Die
Bundesregierung hat ihr Versprechen nicht
gehalten, die Stromsteuer für alle zu senken.
Besonders der Mittelstand ist enttäuscht. Auch
beim geplanten Industriestrompreis bleiben
Mittelständler außen vor. Zudem ist es nur eine
Brückenlösung – der Strom wird nach drei Jahren
wieder teuer. Die Energiepreise müssen aber
dauerhaft für alle Betriebe sinken. Hier muss
Berlin dringend nachbessern“, so der IHK-Chef.
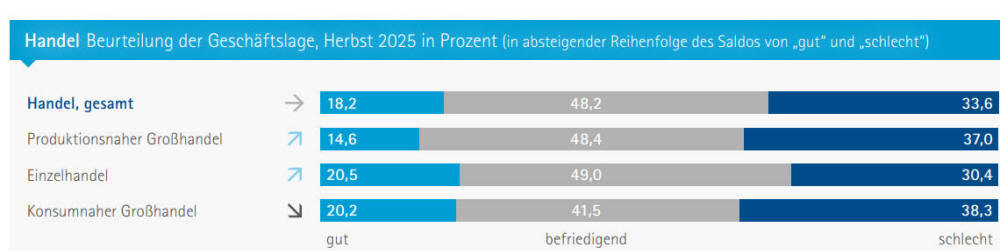
Bürokratie bleibt Hemmschuh
Vorschriften, Formulare und Genehmigungen sind
für knapp 60 Prozent der Unternehmen die größte
Bremse. Aktuell ist es nur der Staat der mehr
investiert. Für den dringend notwendigen
Aufschwung reicht das nicht. Wichtig ist, dass
die privaten Investitionen anspringen.
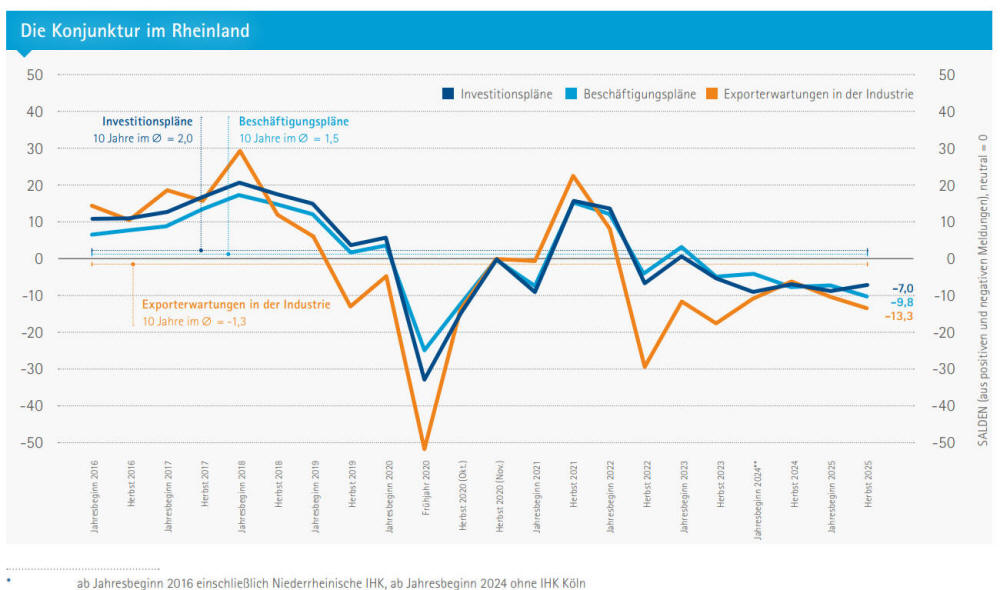
„Unser Konjunkturklimaindex zeigt wie
zurückhaltend die Wirtschaft ist. Er tritt mit
91 Punkten auf der Stelle. Seit mehr als drei
Jahren gibt es kaum positive Impulse. Auch, weil
die Bürokratie uns im Weg steht. Wir brauchen
grundlegende Reformen. Ankündigungen alleine
reichen nicht. Wenn unsere Verwaltungen nicht
umdenken, wird es nicht gehen. Sie sollten
digitaler und kundenfreundlicher werden“, so
Dietzfelbinger.
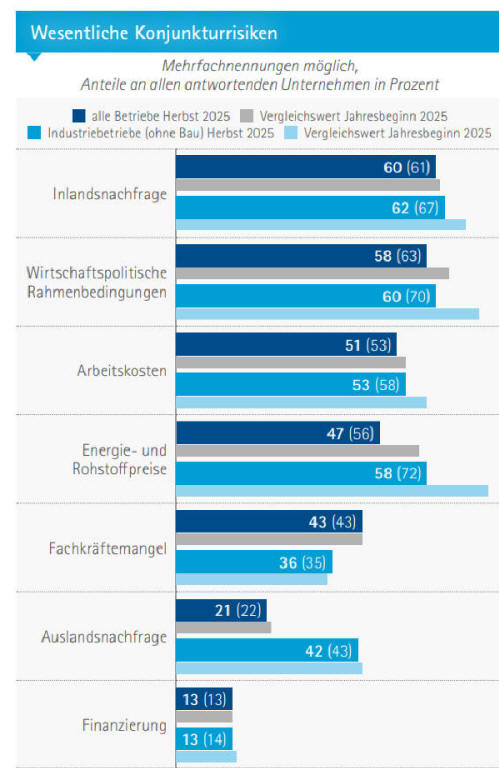 
Mehr Freiheit für Unternehmen
Gleichzeitig bleibt der Fachkräftemangel ein
Risiko – fast jedes zweite Unternehmen sieht
darin eine Gefahr. Gleichzeitig machen ihnen die
gestiegenen Arbeitskosten zu schaffen. Und auch
bei der Infrastruktur zeigt sich ein
alarmierendes Bild: Marode Verkehrswege,
schleppende Genehmigungen und fehlende
Digitalisierung gefährden den Standort.
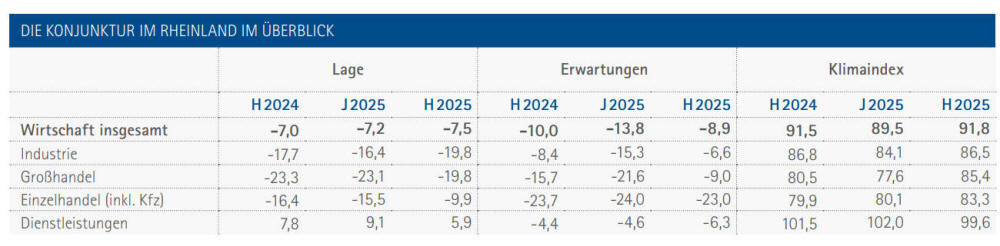
All das führt laut den IHKs zu einer
gefährlichen Mischung: Unternehmen verlieren
Vertrauen – in die Zukunft, in die Politik, in
die Planbarkeit. „Das Rheinland ist stark.
Unsere Unternehmen sind innovativ,
anpassungsfähig, bereit für Wandel. Aber sie
brauchen endlich die Freiheit, wieder
unternehmerisch handeln zu können. Wer Wachstum
will, muss Verlässlichkeit schaffen. Wer
Transformation will, muss Investitionen
ermöglichen. Und wer Wohlstand sichern will,
muss die Wirtschaft endlich ernst nehmen“,
betont Dietzfelbinger.
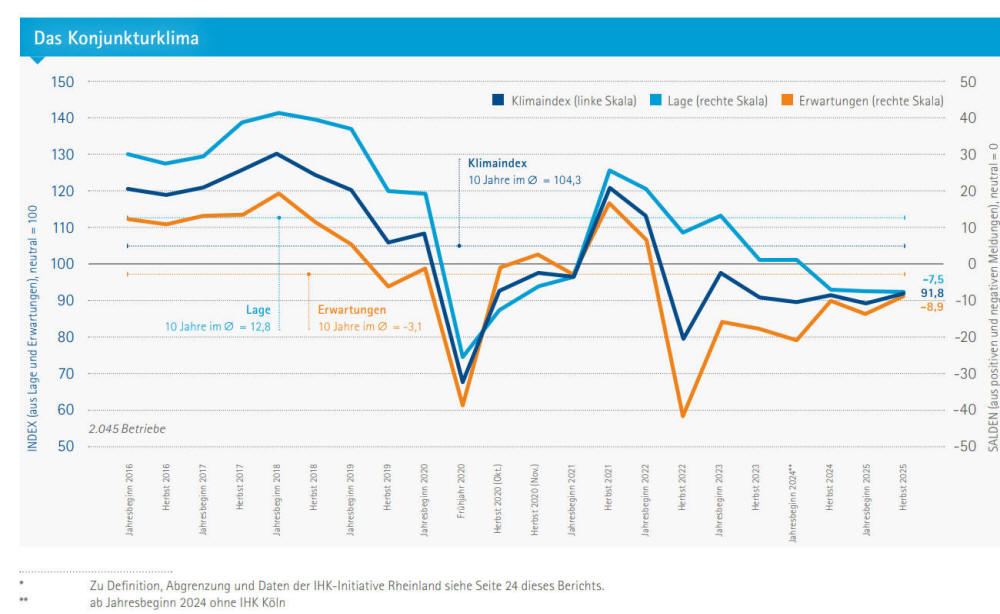
Konjunkturbarometer Rheinland
Die
IHK-Initiative Rheinland veröffentlicht
halbjährlich ein Konjunkturbarometer. Mehr als
2000 Unternehmen aus Industrie, Handel und
Dienstleistungen haben im Herbst 2025
teilgenommen. Teil der Initiative sind die IHKs
Aachen, Bonn/Rhein-Sieg, Düsseldorf, Mittlerer
Niederrhein, die Bergische sowie die
Niederrheinische IHK.
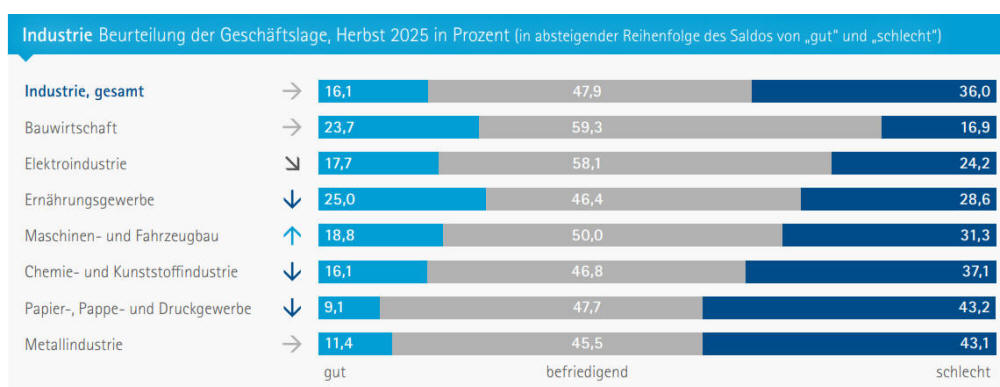
Wesel: Wärmepumpen als kostengünstige und
umweltschonende Heizungstechnologie –
Themenabend am 18. November
Nicht
erst seit dem sogenannten „Heizungsgesetz“ ist
klar: Hauseigentümer*innen müssen sich Gedanken
machen, wie Ihre Immobilie in Zukunft beheizt
wird. Obwohl das Thema Wärmepumpe in der
jüngeren Vergangenheit immer öfters Thema in den
Medien war, gibt es weiterhin eine große
Verunsicherung zu technischen Voraussetzungen
und Fördermöglichkeiten.
Um
Hauseigentümer*innen zu informieren, findet eine
Veranstaltung im Energiequartier Schepersfeld
statt. Bei diesem Themenabend werden unter
anderem folgende Fragen behandelt: Welche
Vorteile hat die Wärmpumpe gegenüber
herkömmlichen Heiztechnologie? Welche Arten von
Wärmepumpe gibt es? Wie können Wärmepumpen in
Ihren Bestandsgebäuden effizient einsetzen?
Welche Fördermittel gibt es und wie hoch sind
die Gesamtkosten? Antworten und Tipps dazu hat
Energieberater Philipp Pospieszny,
Sanierungsmanager im Energiequartier
Schepersfeld.
Der Themenabend findet am
18. November 2025 um 18:00 Uhr im
MehrGenerationenHaus, Am Birkenfeld 14, statt.
Zur besseren Planbarkeit wird um Anmeldung
gebeten: info@energiequartier-schepersfeld.de.
Die kostenlosen Angebote der Sanierungsberatung
richtet sich an Eigentümer und Eigentümerinnen
von Immobilien im Stadtteil Schepersfeld und
können nur noch bis zum 30. April 2026 in
Anspruch genommen werden.
Die Beratungen
finden nach vorheriger Absprache vor Ort im
Sanierungsbüro Am Birkenfeld 14 oder an der
eigenen Immobilie statt. Die Beratung kann auch
telefonisch unter 0281/203-2778 oder via E-Mail
stattfinden. Eine vorherige Terminvereinbarung
ist gewünscht und kann telefonisch oder unter
info@energiequartier-schepersfeld.de abgestimmt
werden. Aktuelle Termine und Informationen zum
Energiequartier Schepersfeld sind über die
Projektwebseite
www.energiequartier-schepersfeld.de abrufbar.
Dinslaken: Gedenkfeier zum
Volkstrauertag auf dem Parkfriedhof
Am Sonntag, 16. November 2025, findet auch auf
dem städtischen Parkfriedhof in Dinslaken wieder
eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag statt.
Beginn der Veranstaltung ist um 11:00 Uhr am
Soldatengräberfeld. Die Stadt Dinslaken lädt
ein, gemeinsam der Opfer von Krieg,
Gewaltherrschaft und Terror zu gedenken.
Der Volkstrauertag erinnert an das Leid der
Vergangenheit und mahnt, sich auch heute für
Frieden, Freiheit und Demokratie einzusetzen.
Bürgermeister Simon Panke wird die Gedenkrede
halten. Im Anschluss folgen weitere Gedenkworte
durch Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen
sowie musikalische Beiträge, die den feierlichen
Rahmen der Veranstaltung gestalten.
Im
Verlauf der Feier werden Kränze am Ehrenmal
niedergelegt, unter anderem durch die Stadt
Dinslaken, den Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V. sowie örtliche Vereine
und Verbände. Zum Abschluss wird gemeinsam eine
Schweigeminute zum stillen Gedenken abgehalten.
Mit dieser Gedenkfeier möchte die Stadt
Dinslaken ein Zeichen für Frieden, Gemeinschaft
und Verantwortung setzen und lädt alle
Interessierten herzlich zur Teilnahme ein.

NRW:
Krankenhausbehandlungen aufgrund akuter
Alkoholvergiftung bei Jugendlichen auch 2024
rückläufig
* 2,2 % weniger
Behandlungsfälle gegenüber 2023.
* Mehr als
die Hälfte waren Mädchen und junge Frauen.
*
Anteil der Behandlungsfälle in Hamm am höchsten
und in Köln am niedrigsten.
Im Jahr 2024
sind 1.799 junge Menschen aus
Nordrhein-Westfalen im Alter von 10 bis unter
20 Jahren mit der der Diagnose „psychische und
Verhaltensstörungen durch Alkohol – akute
Intoxikation” vollstationär im Krankenhaus
behandelt worden. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, waren das 2,2 % weniger
Behandlungsfälle als 2023. Damit setzt sich die
seit 2017 beobachtete, rückläufige Entwicklung
dieser Behandlungsfälle fort, wenn auch weniger
stark als bisher.
Im Jahr 2023 ging die
Zahl der wegen Alkoholvergiftung behandelten
Jugendlichen noch um 21,9 % gegenüber dem
vorangegangenen Jahr zurück. Im Jahr 2022 waren
es −5,5 %. Den stärksten Rückgang an wegen
Alkoholvergiftung vollstationär behandelten
Kindern und Jugendlichen hatte es mit −38,7 % im
Jahr 2020 gegeben, als die Einschränkungen durch
die Corona-Pandemie begannen. Im Vergleich zum
Berichtsjahr 2014 ist die Zahl der
Behandlungsfälle um fast 65 % zurückgegangen.
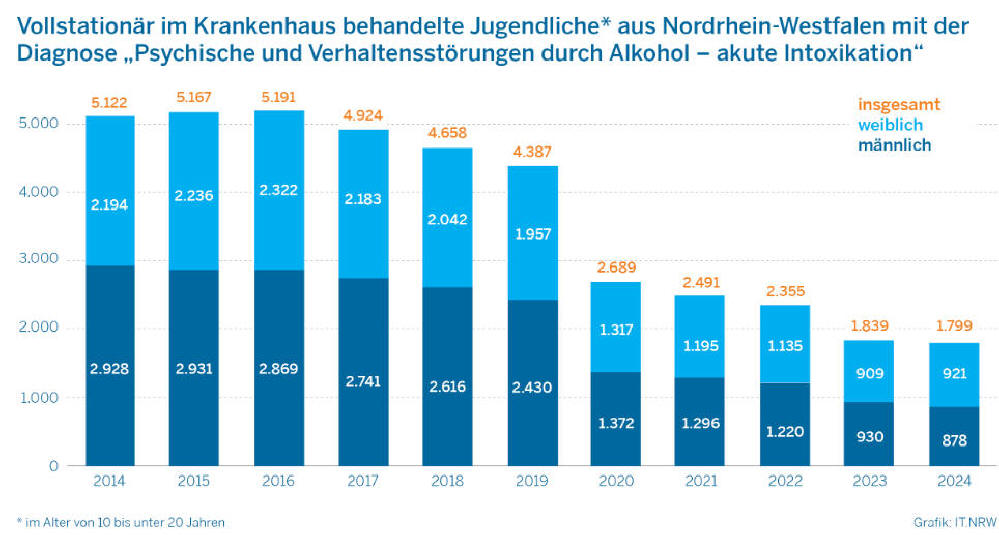
Anstieg der vollstationären Behandlungen bei
Mädchen und jungen Frauen
Der Rückgang der
alkoholbedingten Behandlungsfälle im Jahr 2024
ist ausschließlich auf die Jungen und jungen
Männer zurückzuführen. Während die Zahl der
vollstationären Behandlungen von männlichen
Jugendlichen sich um 5,6 % verringerte, stieg
die Anzahl bei den weiblichen Jugendlichen um
1,3 %.
Von den insgesamt 1.799
Behandlungsfällen entfiel mit 921 Behandlungen
bzw. 51,2 % mehr als die Hälfte auf Mädchen und
junge Frauen. Der Anteil von Kindern im Alter
von 10 bis 14 Jahren an den
Krankenhausbehandlungen von unter 20-Jährigen
mit Alkoholvergiftung entsprach mit rund 14 %
dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.
In Hamm gab es anteilig die meisten und in Köln
die wenigsten Behandlungen Der Anteil der
aufgrund einer akuten Alkoholvergiftung
vollstationär behandelten 10- bis unter
20-jährigen Patientinnen und Patienten an der
gleichaltrigen Bevölkerung lag im Jahr 2024 im
Landesdurchschnitt bei 105 je 100.000
Einwohnerinnen und Einwohner.
Regional
betrachtet gab es die höchsten Anteile im Jahr
2024 für Patientinnen und Patienten aus Hamm mit
228 je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner,
gefolgt vom Kreis Soest mit 217 und dem
Märkischen Kreis mit 171. Die niedrigsten
Anteile ermittelte das Statistische Landesamt
für Köln mit 48, den Kreis Gütersloh mit 49 und
den Rhein-Erft-Kreis mit 59 je 100.000
Einwohnerinnen und Einwohner.
NRW-Industrie: Absatzwert von produzierten
Medikamenten und Medizintechnik 2024 um fast 6 %
gesunken
* Die Hälfte des
Absatzwertes erzielten Betriebe im
Regierungsbezirk Köln.
* Zuwächse im
Außenhandel mit Medizingütern.
* Im ersten
Halbjahr 2025 sind Produktionsabsatzwert und
Außenhandel gestiegen.
Im Jahr 2024 sind in 387
produzierenden Betrieben des
nordrhein-westfälischen Verarbeitenden Gewerbes
Medikamente und Medizintechnik im Wert von
7,9 Milliarden Euro hergestellt worden. Wie das
Statistische Landesamt anlässlich der
internationalen Fachmesse für Medizin „MEDICA”
vom 17. bis 20. November in Düsseldorf mitteilt,
waren das nominal 476,3 Millionen Euro bzw.
5,7 % weniger als ein Jahr zuvor.
50,3 %
des Absatzwertes der 2024 in NRW produzierten
Medikamente und Medizintechnik wurde in 100
Betrieben im Regierungsbezirk Köln erzielt. Mit
6,0 Milliarden Euro machten Medikamente und
andere pharmazeutische Produkte wie Pflaster,
Reagenzien und Kontrastmittel einen Anteil von
Dreiviertel des Absatzwertes aus. Neben
Pharmazieprodukten wurden im Vorjahr in NRW auch
Produkte aus dem Bereich Medizintechnik
hergestellt.
Darunter fielen
medizinische, chirurgische und zahnärztliche
Geräte und Instrumente im Wert von
1,7 Milliarden Euro und bestrahlungs- und
elektromedizinische Geräte im Wert von
0,18 Milliarden Euro produziert. Mit der
Reparatur, Instandhaltung und Installation von
medizinischen und orthopädischen Apparaten und
Geräten wurde zudem ein Absatzwert von
0,12 Milliarden Euro erzielt.
Importe
von Medizingütern um 6,3 % und Exporte um 2,3 %
gestiegen Im Gegensatz zur Produktion waren im
Außenhandel Zuwächse zu verzeichnen. Im Jahr
2024 sind Medizingüter im Wert von rund
10,2 Milliarden Euro nach NRW importiert worden.
Als Medizingüter werden zum Beispiel
Arzneiwaren, Prothesen und Gehhilfen oder
medizinische Verbrauchsartikel erfasst.
Wie das Landesamt für Statistik weiter mitteilt,
stieg damit der Importwert im Vergleich zum
Vorjahr um 6,3 %. Die Ausfuhren von
Medizingütern aus NRW im Jahr 2024 stiegen
gegenüber dem Vorjahr um 2,3 % auf
4,6 Milliarden Euro.
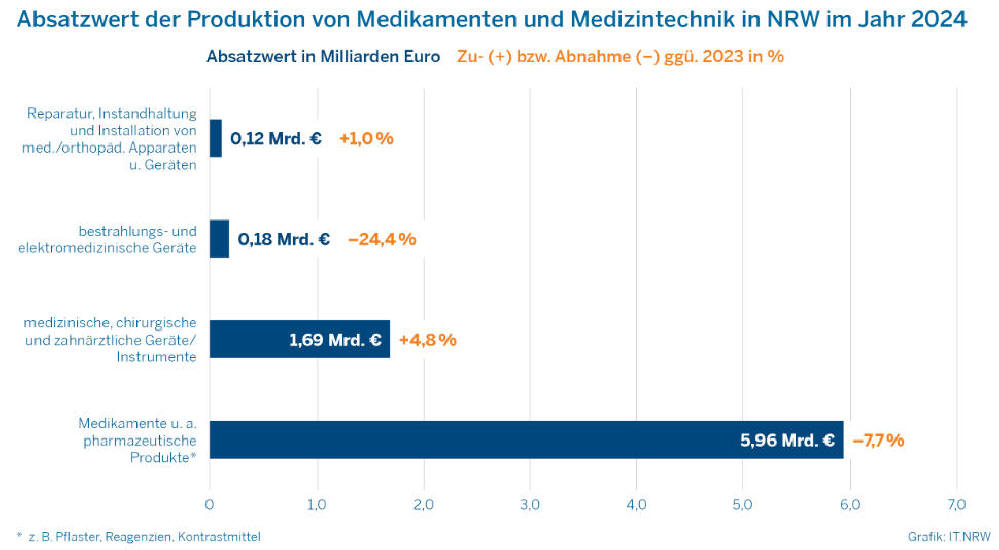
Erstes Halbjahr 2025 zeigt positive
Entwicklung beim Außenhandel und
Produktionsabsatzwert
Die Daten für das
erste Halbjahr 2025 zeigen eine positive
Entwicklung auf: Nach vorläufigen Ergebnissen
produzierten nordrhein-westfälische Betriebe zum
Absatz bestimmte Medikamente und Medizintechnik
im Wert von 4,5 Milliarden Euro, was einer
Steigerung von 8,7 % gegenüber dem
entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht.
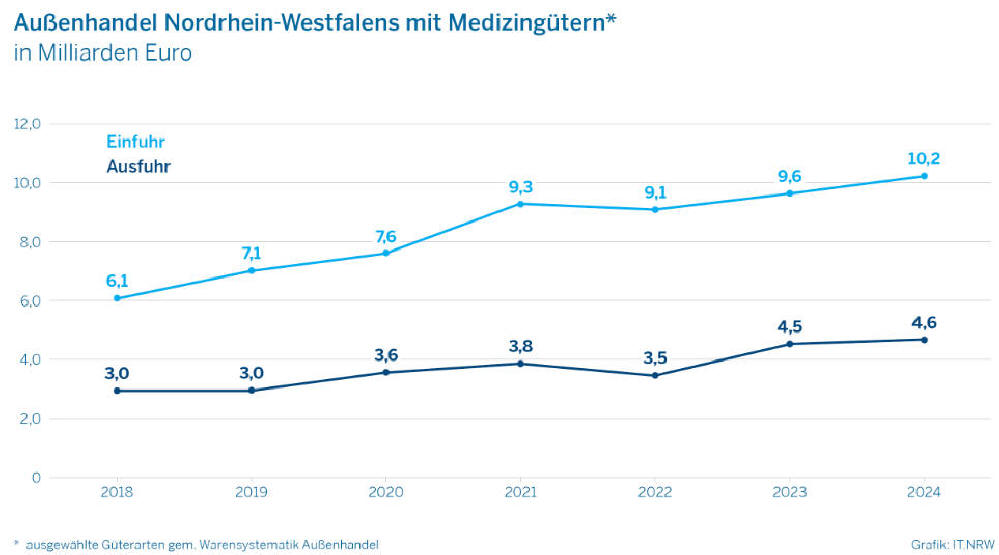
Im gleichen Zeitraum importierte die
NRW-Wirtschaft Medizingüter mit einem Warenwert
von 5,6 Milliarden Euro. Dieser war damit um
9,3 % höher als im Vorjahreszeitraum. Der
Warenwert der ausgeführten Medizingüter betrug
2,5 Milliarden Euro. Dies ist ein Anstieg von
9,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
„Tag der Orthopädie“ am Evangelischen
Krankenhaus Dinslaken
Medizin zum Mitmachen
und Verstehen am 22. November 2025
Gelenkverschleiß, Knieschmerzen, chronische
Rückenschmerzen: Erkrankungen des
Bewegungsapparats sind weit verbreitet und
schränken die Betroffenen im Alltag oft
erheblich ein. Wie moderne orthopädische
Behandlungen helfen können und was sich hinter
den Kulissen eines Krankenhauses abspielt, zeigt
der „Tag der Orthopädie“ im Evangelischen
Krankenhaus Dinslaken. Am Samstag, dem 22.
November 2025, lädt das Krankenhaus von 13 bis
18 Uhr zu einem spannenden Aktionstag ein.
Die Teams aus den Bereichen Orthopädie,
Wirbelsäulenchirurgie, Schmerzmedizin,
Anästhesie, Pflege, Rehabilitation sowie
Nachsorgemanagement geben mit Vorträgen,
Mitmachaktionen und vielfältigen Angeboten
Einblicke in ihre Arbeit. Beim Format „Meet the
Doc“ können Besucherinnen und Besucher in
persönlichen Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten
individuelle Fragen stellen, Therapien
kennenlernen und eigene Beschwerden
thematisieren. Zudem besteht die Möglichkeit,
einen modernen OP-Saal zu besichtigen.
Interessierte können außerdem an einer
Simulationspuppe selbst eine Intubation
ausprobieren.
Der Tag der Orthopädie
richtet sich an die ganze Familie. Auch für die
jüngsten Gäste gibt es Spannendes zu entdecken.
Im Teddybärkrankenhaus werden verletzte
Kuscheltiere liebevoll versorgt. Dabei wird auf
kindgerechte Weise medizinisches Wissen
vermittelt. EVA, das Maskottchen des Klinikums,
steht für Fotos zur Verfügung.
Das
Programm wird durch Infostände, einen
Rettungswagen zum Erkunden sowie durch Speisen
und Getränke ergänzt. Auch externe Partner, wie
Implantathersteller und Sanitätshäuser, werden
vor Ort sein und über ihr Angebot informieren.
Tag der Orthopädie
Ort: Evangelisches
Krankenhaus Dinslaken, Kreuzstr. 28, 46535
Dinslaken
Datum: Samstag, 22. November 2025
Uhrzeit: 13.00 - 18.00 Uhr
Eintritt frei,
keine Anmeldung erforderlich
Alle Infos auf:
https://www.evkln.de/orthopaedietag.html
Rat der Stadt Moers hat Bildung und
Besetzung der Ausschüsse beschlossen
Die Bildung, Zusammensetzung und Vorsitzende
der Ausschüsse hat der Stadt in seiner Sitzung
am Mittwoch, 13. November, beschlossen. Damit
können die Gremien die inhaltliche Arbeit
vorbereiten und fachliche Themen vertiefend
beraten. Mit der Entscheidung ist die
Arbeitsfähigkeit des Rates in allen kommunalen
Themenfeldern sichergestellt.
Die
Besetzungen sind in Kürze im
Ratsinformationssystem ris.moers.de zu
finden. Bereits jetzt sind dort alle
Sitzungstermine hinterlegt. Noch keine
abschließende Entscheidung gab es zur
Weiterführung des Rats-TV der Stadt Moers. Die
Verwaltung soll für die nächste Ratssitzung am
Mittwoch, 17. Dezember, darstellen, wie lange
die Aufnahmen gespeichert werden könnten.
Moers: Toilettenanlage im
Freizeitpark wird umgebaut
Im
Freizeitpark Moers wird derzeit die
Toilettenanlage am Skatepark umgebaut. Die
Stadtbau Moers erneuert die Ausstattung, nachdem
es in der Vergangenheit wiederholt zu
Vandalismusschäden gekommen war.
Toilettenschüsseln, Urinale und Waschbecken
werden durch besonders robuste
Edelstahl-Ausführungen ersetzt. Während der
Arbeiten bleibt die Anlage voraussichtlich bis
Ende November geschlossen.
Gemeinsame Verantwortung für das kulturelle
Gedächtnis - Treffen des Arbeitskreises der
Kommunalen Archive im Kreis Wesel
Der Arbeitskreis der kommunalen Archive im Kreis
Wesel traf sich am Mittwoch, 12. November 2025,
zu seiner Herbstsitzung im Kreishaus, um
aktuelle fachliche Themen zu besprechen und den
kollegialen Austausch zu pflegen. Im Mittelpunkt
stand dieses Mal besonders das gegenseitige
Kennenlernen der neuen Mitglieder.
Auch
Janine Weigel, die künftig die Koordinierung und
den Austausch der kommunalen Archive im Kreis
übernehmen wird, war das erste Mal in ihrer
neuen Rolle als Kreisarchivarin dabei. Sie
betonte die Wichtigkeit der Archivierungsarbeit.
„Archive sind das Gedächtnis unserer
Gesellschaft und der kommunalen Verwaltungen.
Sie bewahren Schriftgut und Dokumente, die
Auskunft über Verwaltungshandeln, regionale
Geschichte und gesellschaftliche Entwicklungen
geben“, so die neue Kreisarchivarin.
„Damit sichern sie nicht nur die Rechts- und
Informationsgrundlagen für Verwaltungen und
Öffentlichkeit, sondern leisten auch einen
wichtigen Beitrag zur historischen Forschung und
kulturellen Bildung.“ Neben dem persönlichen
Austausch stand ein zentrales Thema auf der
Tagesordnung: das Notfallmanagement zum Schutz
von Kulturgut.
Angesichts zunehmender
Extremwetterereignisse und den Erfahrungswerten
aus vergangenen Katastrophen, wie dem Brand der
Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, dem Einsturz
des Kölner Stadtarchivs oder der
Ahrtal-Überschwemmung wird das Archivwesen
sensibler für potentielle Gefahren. Die
Herausforderungen moderner Archivarbeit sind
dadurch gewachsen und eine enge Vernetzung umso
wichtiger. „Archive sind mehr als nur
Aufbewahrungsorte für altes Papier- sie sind
Bewahrer unseres kollektiven Gedächtnisses.
Damit dieses Wissen auch in Zukunft erhalten
bleibt, müssen wir Vorsorge treffen. Ein
Notfallmanagement bedeutet: gelebte
Verantwortung für unser kulturelles Erbe“,
betonte Janine Weigel. Ein wirksames
Notfallmanagementkonzept muss künftig viele
Aspekte berücksichtigen: die Sicherstellung
schneller Alarmierungs- und Kommunikationswege,
die Bereitstellung von Notfallmaterialien und
die enge Abstimmung mit den benachbarten
Archiven als fachliche Ersthelfende.
Ziel ist es, im Ernstfall schnell und
koordiniert reagieren zu können, um
unwiederbringliche Verluste an historisch
einzigartigem Kulturgut zu verhindern. Die
Teilnehmenden des Arbeitskreises tauschten erste
Erfahrungen aus, diskutierten mögliche
Vorgehensweisen und vereinbarten, den
Notfallplan im kommenden Jahr zu konkretisieren
und durch praktische Übungen mit Leben zu
füllen.
Mit dem Treffen wurde nicht nur
die Grundlage für eine enge Zusammenarbeit im
Bereich des Kulturgutschutzes gelegt, sondern
auch das Netzwerk der kommunalen Archive im
Kreisgebiet gestärkt.

hinten v.l.n.r. Claudia Kienzle
(StiftsMuseum/Archiv/Bibliothek Xanten), Lukas
Petzolz (Stadt Xanten), Sarah Boudaroui
(Gemeinde Alpen), Janine Weigel (Kreis Wesel,
Dr. Gregor Patt (LVR Archiv- und
Fortbildungszentrum), Christoph Moß (Stadt
Wesel). Vorne v.l.n.r. Katharina Schinhan (Stadt
Dinslaken), Kirsten Lehmkuhl (Stadt
Voerde/Gemeinde Hünxe) und Petra Schwarzmann
(Stadt Neukirchen-Vluyn)
Kreis Wesel:
Symposium „Gemeinsam gegen Gewalt an Schulen –
Durch die Brille des Anderen“
Der
Kreis Wesel setzt Zeichen für eine gemeinsame
Verantwortung in der Gewaltprävention. Wie kann
Gewalt an Schulen wirksam begegnet werden?
Welche Maßnahmen sind erforderlich, um
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler nachhaltig
zu schützen und ein respektvolles Miteinander zu
fördern?
Mit diesen Fragen befasste sich
das Symposium „Gemeinsam gegen Gewalt an Schulen
– Durch die Brille des Anderen“, das am
Dienstag, 11. November 2025, im Kreishaus
stattfand. Eingeladen hatte der Kreis Wesel
Vertreterinnen und Vertreter aus den Schulen der
Sekundarstufe I und II, den Schulträgern, der
Polizei, den Jugendämtern, der Schulaufsicht,
der Schulpsychologie sowie der Drogenberatung.

Symposium „Gemeinsam gegen Gewalt an Schulen –
Durch die Brille des Anderen“ im Kreishaus
Ziel war es, ein gemeinsames Verständnis für
Ursachen und Erscheinungsformen von Gewalt zu
schaffen und Handlungsoptionen für eine
verbesserte Präventionsarbeit zu erarbeiten.
Landrat Ingo Brohl eröffnete die Veranstaltung
und hob in seiner Ansprache hervor: „Getreu dem
Gedanken, dass es ein ganzes Dorf braucht, um
ein Kind zu erziehen und zu bilden, tragen wir
gemeinsam Verantwortung.
In der
Erstverantwortung sind natürlich die Eltern,
aber gerade im Bereich Schule tragen Lehrkräfte,
Schulsozialarbeitende, Polizei, Jugendhilfe und
Verwaltung gemeinsam Verantwortung für das, was
an unseren Schulen geschieht. Diese Sichtweise
verbindet uns. Denn wir wissen: Wir handeln in
dem Wissen, dass wir gemeinsam Schulen wieder
stärker zu Orten machen können, an denen Kinder
und Jugendliche sich sicher fühlen, an denen sie
wachsen und lernen können – in einem Klima von
Respekt, Vertrauen und Zusammenhalt. Und dieses
Klima haben auch alle verdient, die sich um
unsere Kinder kümmern.“
Stefanie Hain
führte die rund 150 Teilnehmenden durch die
Veranstaltung. Schulministerin Dorothee Feller
(Dritte v.l.) gab in ihrem fachlichen Impuls
einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und
Herausforderungen im schulischen Alltag.

„Schulen sind ein Spiegelbild unserer
Gesellschaft, was bedeutet, dass wir es leider
auch im Schulalltag mit Gewalterfahrungen zu tun
haben. An unseren Schulen ist kein Platz für
Gewalt, Schulen müssen sichere Orte sein – und
wir lassen sie bei diesem Thema nicht allein. In
unserem Internetauftritt, dem Bildungsportal,
haben wir sehr viele Unterstützungsangebote
aufgelistet und im Detail beschrieben.
Unsere Handlungsempfehlungen umfassen unter
anderem Interventionsmöglichkeiten, klare
Anleitungen für Konfliktlösungen, die
Darstellung von rechtlich zulässigen
Ordnungsmaßnahmen und Informationen darüber,
welche externen Organisationen eingebunden
werden können und wann die Polizei hinzugezogen
werden sollte. Auch eine Übersicht über
Fortbildungsangebote ist enthalten. Wir passen
unsere Angebote ständig an und erweitern dort,
wo es nötig ist.
Dabei hilft auch der
Expertenbeirat zum Umgang mit Gewalt, der um
weitere Fachleute aus Medizin und Psychologie
erweitert worden ist. Klar ist aber auch: Es
braucht eine Zusammenarbeit von ganz vielen
Behörden, Institutionen und Menschen, um dem
Problem zu begegnen. Daher ist die heutige
Veranstaltung eine gute Chance, mit vielen
verschiedenen Akteuren ins Gespräch zu kommen“,
betonte die Ministerin.
Im weiteren
Verlauf des Symposiums kamen Fachkräfte aus
unterschiedlichen Arbeitsfeldern zu Wort:
Vertreterinnen und Vertreter der Polizei
(Prävention und Jugendsachbearbeitung), der
Schulsozialarbeit, der Schulleitungen und der
Jugendämter schilderten ihre Erfahrungen und
gaben Einblicke in bewährte sowie neue Ansätze
im Umgang mit Gewalt an Schulen.
„Dieses Symposium zeigt eindrucksvoll, dass eine
landratsgeführte Kreispolizeibehörde einem
Polizeipräsidium in nichts nachsteht. Im
Gegenteil: Der Landrat als gemeinsamer
Behördenleiter von Polizei, der Unteren
Verwaltungsbehörde, als kommunale Behörde und
Bindeglied zwischen den kreisangehörigen
Gemeinden bewegt ganz viel und ist ein
Erfolgsmodell für vernetztes Arbeiten.
So
ist ein Forum entstanden, in dem Wissen,
Erfahrung und Engagement für eine ganzheitliche
und wirkungsvolle Gewaltprävention an den
Schulen im Kreis Wesel zusammenfließen“, so
Ulrich Kühn, Abteilungsleiter der
Kreispolizeibehörde Wesel.
In der
anschließenden Podiumsdiskussion wurde deutlich,
dass Gewaltprävention nur dann wirksam ist, wenn
sie interdisziplinär gedacht und aufeinander
abgestimmt umgesetzt wird. Schulen stehen
zunehmend vor der Herausforderung, mit komplexen
sozialen Dynamiken, neuen Kommunikationsformen
und veränderten elterlichen Haltungen umzugehen.
Die Teilnehmenden waren sich einig, dass
Präventionsarbeit strategisch, sensibel und
langfristig angelegt sein muss.
Der
Kreis Wesel wird die im Symposium gewonnenen
Erkenntnisse bündeln und in ein Handlungskonzept
zur Gewaltprävention an Schulen einfließen
lassen. Dieses soll die bestehende
Präventionsarbeit ergänzen und Strukturen
schaffen, um Kooperation, Austausch und
Handlungssicherheit bei allen beteiligten
Akteuren zu stärken. Brohl betonte abschließend:
„dieser Tag ist ein Anfang – ein Signal, dass
wir nicht wegschauen, sondern handeln.
Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass
Schule ein Ort ist, an dem Kinder und
Jugendliche nicht nur lernen, sondern sich auch
sicher fühlen. Ein Ort, an dem Konflikte nicht
verdrängt, sondern konstruktiv gelöst werden.
Ein Ort, an dem Gemeinschaft und gegenseitiger
Respekt den Ton angeben. Denn: Gewaltprävention
ist keine Aufgabe einzelner – sie ist eine
gemeinsame Verantwortung.“
Sondervermögen muss in die Zukunft wirken: IHK
NRW fordert Nachteilsausgleich für den
Verkehrsstandort NRW
Aktuelle
Planungen der Bundesregierung zur
Mittelausstattung im Bundeshaushalt und den
Vergaberegeln im Sondervermögen benachteiligen
NRW
IHK NRW warnt anlässlich der finalen
Haushaltsverhandlungen im Bundestag vor
Standortnachteilen für Nordrhein-Westfalen bei
der Finanzierung der Verkehrsinfrastrukturen:
„Gerade hier ist der Zustand der
Verkehrsinfrastruktur besonders kritisch –
bröckelnde Brücken, überlastete Autobahnen und
veraltete Wasserstraßen gefährden Lieferketten
und Wettbewerbsfähigkeit“, betont Dr. Ralf
Mittelstädt, Hauptgeschäftsführer von IHK NRW.
„Doch so wie Haushalt und Sondervermögen derzeit
ausgestaltet sind, droht NRW weniger und nicht
mehr Investitionsmittel zu erhalten. Das ist das
Gegenteil dessen, was dieses Land jetzt
braucht.“
NRW trägt im Bundesvergleich
eine überdurchschnittliche Last im Verkehrsnetz:
Fast 30 Prozent der Autobahnbrücken im Land sind
sanierungs- oder ersatzbedürftig (Bund: teils
unter 10 %).
Ersatzneubauten in NRW sind in
der Regel mit Ausbau verbunden – und fallen
damit aus vielen Förderzugriffen des
Sondervermögens heraus.
Die wichtigsten
Wasserstraßen für Industrie und Hafenstandorte
sind im Sondervermögen kaum berücksichtigt.
Zahlreiche Verkehrsprojekte verzögern sich, weil
Planungsverfahren in dicht besiedelten Räumen
besonders komplex sind.
„Die Lage ist
eindeutig: Der Bedarf in NRW ist am größten –
aber die Mittelzuweisung berücksichtigt das
nicht“, erklärt Ocke Hamann, verkehrspolitischer
Sprecher von IHK NRW. „Das gefährdet die
industrielle Basis und die Logistikdrehscheibe
NRW. Wir können nicht akzeptieren, dass das Land
mit dem größten Erhaltungs- und Ersatzbedarf am
Ende am wenigsten bauen kann. NRW braucht jetzt
eine faire Mittelverteilung und
Planungssicherheit. Jeder Euro, der hier eine
Brückensperrung verhindert, ist ein Gewinn für
den gesamten Standort.“
IHK NRW fordert
daher, dass sich die Vergabe aus Haushalt und
Sondervermögen am tatsächlichen Instandsetzungs-
und Ersatzbedarf orientieren, nicht an formalen
Kriterien. Komplexe Förderprogramme müssen durch
klare Prioritäten, schnellere Planungsverfahren
und zentrale Unterstützung für Kommunen ersetzt
werden. Für Hafenstandorte, Stahl, Chemie und
Logistik sind funktionierende Wasserwege und
belastbare Brücken wirtschaftskritische
Infrastruktur – diese müssen im Sondervermögen
verbindlich berücksichtigt werden.
Die
besondere NRW-Betroffenheit zeigt sich bei den
folgenden Baustellen:
NRW-Baustelle Nummer 1
In NRW sind die Autobahnen und Bundesstraßen am
Limit. Deshalb gibt es praktisch keine Reparatur
ohne Ausbau. Fast jede Brücke, die ersetzt wird,
bekommt eine zusätzliche Spur. Das bedeutet: Sie
kann nicht aus dem Sondervermögen bezahlt
werden.
NRW-Baustelle Nummer 2
Durch
Umschichtungen der Mittel im Bundeshaushalt ist
dieser nicht so gewachsen wie gedacht. Für den
Straßenbau fehlt daher dringend benötigtes Geld.
Da sehr viele Maßnahmen in NRW nicht vom
Sondervermögen profitieren, sondern auf den
Haushalt angewiesen sind, kann bei uns
vergleichsweise weniger gebaut werden.
NRW-Baustelle Nummer 3
Schnell gebaut wird
besonders dort, wo die Planungen fertig sind.
Das Bundesverkehrsministerium hat mit seinem
Netz zur Brückensanierung
(Brückensanierungsprogramm) an Autobahnen
Prioritäten gesetzt. Ein Nachteil für NRW, denn
der Anteil der als Priorität eingestuften
Streckenabschnitte ist bei uns verglichen mit
anderen Bundesländern geringer.
NRW-Baustelle Nummer 4
Auf der vom
Bundesverkehrsministerium veröffentlichten
Liste, welchen Vorhaben eine Verzögerung droht,
stehen besonders viele NRW-Projekte (29 von 74).
Das liegt auch daran, dass in NRW in der Regel
in hochverdichteten Räumen gebaut wird. Diese
Verfahren sind deshalb sehr komplex und leiden
besonders häufig unter den hohen Anforderungen
der Planfeststellung. NRW würde folglich von den
angekündigten Schritten zur
Planungsbeschleunigung sehr profitieren – genau
diese Vorhaben der Bundesregierung aber sind
noch nicht umgesetzt.
NRW-Baustelle
Nummer 5
In keinem anderen Bundesland sind
die Wasserstraßen für den Betrieb der Industrie
wichtiger. Ob Stahl, Chemie, Baustoffe,
Container oder Futtermittel – in den Häfen NRWs
wird rund die Hälfte der Mengen, die mit
Binnenschiffen in Deutschland transportiert
werden, umgeschlagen. Kein anderes Bundesland
braucht die Wasserstraße mehr, um Straßen und
Schienen zu entlasten. Dass im Haushalt kein
zusätzliches Geld für Wasserstraßen
bereitgestellt wird und die Wasserstraßen vom
Sondervermögen ausgenommen sind, trifft NRW
deshalb besonders hart.
Appell an die
NRW-Verkehrspolitik
IHK NRW fordert daher,
dass NRW in den finalen Haushaltsberatungen
bessere Chance bekommt, seinen
Wettbewerbsnachteile auszugleichen. „Beim
Zustand der Straßen, Schienen und Wasserwege
muss NRW dringend zu den anderen Bundesländern
aufschließen, sonst droht die Industrie
schneller abzuwandern, als uns lieb sein kann“,
so IHK NRW-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf
Mittelstädt zu den aktuellen NRW-Baustellen.
„Unser Bundesland braucht einen adäquaten
Nachteilsausgleich. Jede Brücke, die für LKW
gesperrt wird, ist eine Vollsperrung für die
Wirtschaft. Umgekehrt ist jeder Euro, der eine
Sperrung verhindert, besonders gut investiert,“
drängt abschließend Ocke Hamann,
verkehrspolitischer Sprecher von IHK NRW, auf
eine breitere Nutzung der Mittel aus dem
Sondervermögen und Vergabe nach Bedarf.
Wesel: Konstituierende Rat-Sitzung am 4.
November 2025 - Impressionen
Am 4.
November 2025 hat sich der Rat der Stadt Wesel
konstituiert.

Dabei wurde der neue Bürgermeister
der Stadt Wesel, Rainer Benien, ins Amt
eingeführt sowie Altbürgermeisterin Ulrike
Westkamp verabschiedet.

Der Rat hat drei Stellvertretungen des
Bürgermeisters gewählt und über seine Ausschüsse
entschieden.

Mobilitätserhebung in der Stadt Wesel –
Teilnahme nur noch bis Ende November möglich
Ende Oktober startete die Mobilitätserhebung in
der Stadt Wesel. Insgesamt 4.780 zufällig
ausgewählte Weseler Haushalte erhielten Post vom
Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Wesel mit
der Bitte, sich an der Mobilitätserhebung zu
ihren Mobilitätsgewohnheiten zu beteiligen. Nach
Beginn der Erhebung sind bereits über 300
ausgefüllte Fragebögen eingetroffen.
Die
Stadt bittet weiter um eine rege Teilnahme, um
das Ziel von insgesamt mehr als 1.000 befragten
Personen bis Ende November 2025 zu erreichen.
Die Teilnahme ist bis Ende November für alle
bisher angeschriebenen Haushalte möglich. Die
Teilnahme ist freiwillig und anonym. Wer an der
Befragung teilnimmt, kann zudem wertvolle Preise
gewinnen.
Unter anderem werden ein iPad
im Wert von 400 Euro sowie Gutscheine für das
RheinBad verlost. Die Projektverantwortlichen
hoffen, dass sich möglichst viele Personen an
der Umfrage beteiligen – unabhängig davon, ob
sie viel unterwegs oder wenig mobil sind. Erste
Ergebnisse sind für das erste Quartal 2026
angekündigt.
Gemeinsam die
Mobilitätswende gestalten – dafür bildet die
Mobilitätserhebung einen wichtigen Baustein. Um
den Mobilitätsbedürfnissen der Weseler
Bevölkerung auch in Zukunft gerecht zu werden,
ist die Teilnahme der Bevölkerung sehr wichtig.
Je mehr Personen mitmachen, desto
aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Die
Teilnahme ist dabei freiwillig und anonym.

Großhandelspreise im Oktober 2025:
+1,1 % gegenüber Oktober 2024
Großhandelsverkaufspreise, Oktober 2025
+1,1
% zum Vorjahresmonat
+0,3 % zum Vormonat
Die Verkaufspreise im
Großhandel waren im Oktober 2025 um 1,1 % höher
als im Oktober 2024. Im September 2025 hatte die
Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat
bei +1,2 % gelegen, im August 2025 bei +0,7 %.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, stiegen die Großhandelspreise im
Oktober 2025 gegenüber dem Vormonat September
2025 um 0,3 %.
Zahl der
Schulanfängerinnen und -anfänger 2025 um 2,2 %
gesunken
811 500 Kinder zum
Schuljahresbeginn 2025/2026 eingeschult
Zu Beginn des Schuljahres 2025/2026 wurden
in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen rund
811 500 Kinder eingeschult. Das waren 18 200
oder 2,2 % weniger Schulanfängerinnen und
-anfänger als im Vorjahr. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ging die
Zahl der Einschulungen in fast allen
Bundesländern zurück.
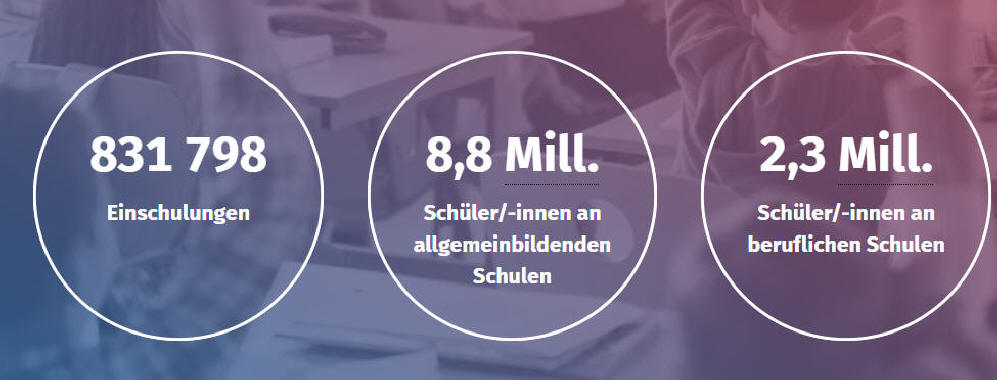
Den größten prozentualen Rückgang gab es im
Saarland (-8,5 % bzw. -780), gefolgt von
Sachsen-Anhalt (-5,6 % bzw. -1 080), Thüringen
(-5,5 % bzw. -1 040) und Berlin (-4,2 % bzw. -1
570). Nur in Bremen (+0,6 % bzw. +40) stieg die
Zahl der Einschulungen leicht.
Anteil
der Einschulungen an Förderschulen leicht
gestiegen
Der überwiegende Teil der Kinder
(93 %) startete seine Schullaufbahn an einer
Grundschule. 3,5 % wurden an Förderschulen
eingeschult, 2,5 % an Schularten mit drei
Bildungsgängen sowie 0,9 % an Freien
Waldorfschulen. Bundesweit begannen im Vergleich
zum Vorjahr 0,5 % mehr Kinder ihre Schullaufbahn
an Förderschulen.
An Grundschulen
(-2,3 %) Schularten mit drei Bildungsgängen
(-2,0 %) und an Freien Waldorfschulen (-4,0 %)
sanken dagegen die Einschulungen. 51 % der zum
Schuljahresbeginn 2025/2026 eingeschulten Kinder
waren Jungen und 49 % Mädchen. Während das
Geschlechterverhältnis an Grundschulen (49 %
Mädchen), Schularten mit drei Bildungsgängen
(49 % Mädchen) und Freien Waldorfschulen (52 %
Mädchen) weitgehend ausgeglichen war, wurden
deutlich mehr Jungen (69 %) als Mädchen in
Förderschulen eingeschult.
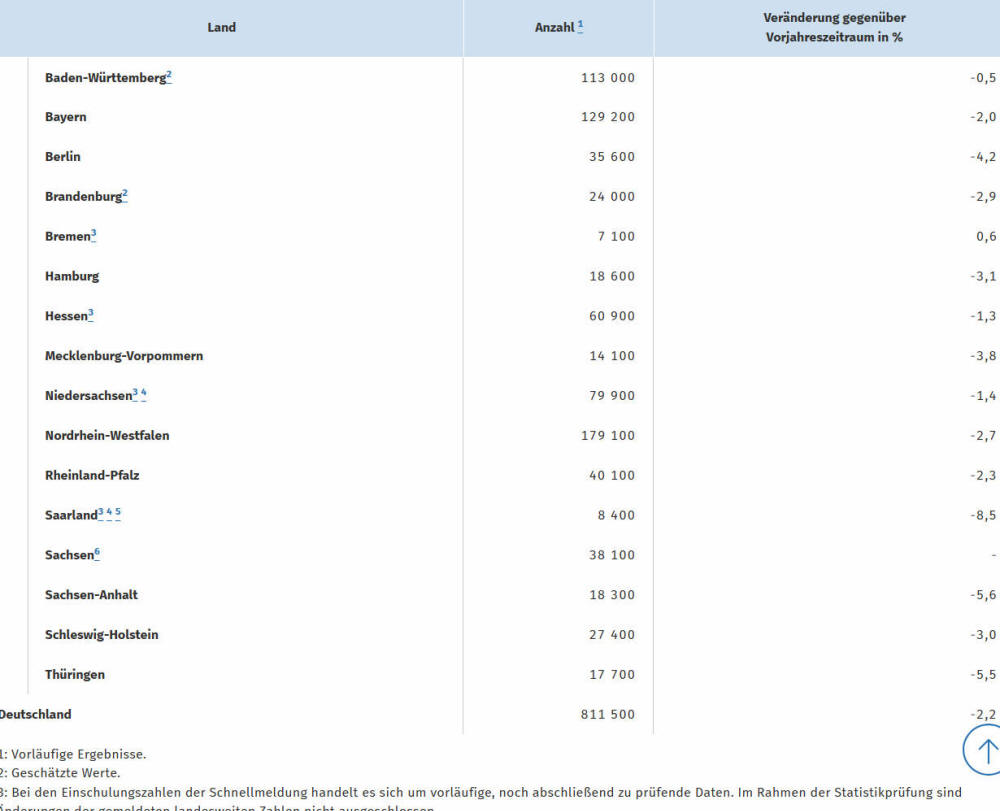
Von romantisch bis bergmännisch:
Weihnachtsmärkte und Winterzauber
      
Wenn die Tage kürzer werden und die
Temperaturen sinken, dann beginnt das
Ruhrgebiet, sich auf Weihnachten einzustimmen.
Zwischen Industriekulisse, Fachwerkcharme und
Klostermauern lädt die Region zu ganz
unterschiedlichen vorweihnachtlichen Erlebnissen
ein.
Sogar einen Weihnachtsmarkt unter
Tage gibt es! Natürlich darf in keiner großen
Stadt der Region der traditionelle
Weihnachtsmarkt fehlen: In Duisburg weht schon
ab dem 13. Novemberder Duft von Glühwein und
gebrannten Mandeln durch die Innenstadt, einen
Tag später (14. November) eröffnen die Märkte in
der Essener Innenstadt und am Centro Oberhausen.
Am 20. November folgen u. a. Dortmund,
Bochum und Herne. Neben den großen
Weihnachtsmärkten in den Innenstädten locken
zahlreiche kleine, aber feine Angebote:
Stimmungsvoll wird es ab dem 24. November in der
Hattinger Altstadt, wo die Stände vor
mittelalterlicher Kulisse stehen. Am Alten
Rathaus erscheint Frau Holle jeden Nachmittag um
17 Uhr.
Das LWL-Freilichtmuseum Hagen
öffnet vom 28. bis 30. November seine Tore für
den romantischen Weihnachtsmarkt, und das
LWL-Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop
verbindet auf seinem Weihnachtsmarkt am 29. und
30. November Industriekultur und Adventsflair.
"Weihnachten am Strand" feiert der
Dortmunder Revierpark Wischlingen in Dortmund an
allen vier Adventswochenenden. Am See entsteht
eine winterliche Strandlandschaft mit
Glashäusern, Fondue-Abenden und Kunsthandwerk.
Der Landschaftspark Duisburg-Nord erstrahlt
"tief im Westen" vom 28. bis 30. November beim
Lichtermarkt mit Lichtskulpturen,
Laserprojektionen und Kunsthandwerk.
Über den Adventsmarkt im Kloster Kamp kann am
13. und 14. Dezember gebummelt werden. Am 29.
November öffnen in Hünxe-Krudenburg die
Einwohner ihre Türen und Fenster und verwandeln
den historischen Dorfkern in ein lebendiges
Weihnachtsdorf. Ende November verwandelt sich
auch der Maximilianpark Hamm ganz im Osten des
Ruhrgebiets in ein Lichtermeer.
Den
Weihnachtsmarkt unter Tage öffnet zum zweiten
Mal das Trainingsbergwerk in Recklinghausen am
13. und 14. Dezember. 50 Stände im Bergwerk
bieten u. a. regionales Handwerk und
"Ruhrgebiet-Gedöns". Da schaut sogar das
Christkind vorbei – auf einem Grubenrad. idr -
Weitere Infos zu den großen und kleinen
Weihnachtsmärkten in der Region unter
https://www.ruhr-tourismus.de/das-ruhrgebiet/weihnachtsmaerkte-im-ruhrgebiet
Christkindpostfiliale
Engelskirchen eröffnet – 40 Jahre himmlische
Tradition
Auftakt: Zum 40jährigen
Jubiläum eröffnen Ministerpräsident Hendrik Wüst
und DHL-Vorständin Nikola Hagleitner die
himmlische Schreibstube
Am ersten Arbeitstag
des Christkindes sind bereits fast 9.000
Wunschzettel eingetroffen
Pferd mit rosa
Stulpen, Dinosaurier, DIY-Zubehör und Labubus
aktuell im Trend
Jeder Brief wird beantwortet
- in 14 Sprachen und erstmals mit interaktiver
Video-Botschaft.
Engelskirchen, 12.
November 2025: Sechs Wochen vor Heiligabend
öffnet die Christkindpostfiliale der Deutschen
Post wieder ihre Pforten und das Christkind
beginnt mit seiner Arbeit am Engels-Platz in
Engelskirchen. Seit 40 Jahren gibt es diese
beliebte Tradition in der oberbergischen
Gemeinde mit dem wohlklingenden Namen. Seit 1985
beantwortet das Christkind gemeinsam mit zwanzig
fleißigen Helferinnen und Helfern liebevoll
Wunschzettel und Briefe von Kindern aus aller
Welt.

Adresse für Wunschzettel:
An das Christkind, 51777 Engelskirchen
Weitere Infos:
https://www.deutschepost.de/engelskirchen
In dieser Zeit gingen
insgesamt fast 3 Millionen Zuschriften aus rund
60 verschiedenen Ländern ein! Heute, am ersten
Arbeitstag des Christkindes in diesem Jahr,
stapeln sich bereits nahezu 9.000 Wunschzettel
prall gefüllt mit Herzenswünschen im
„himmlischen Wunschzettel-Büro“.
Zum
Auftakt der Jubiläumssaison eröffneten heute
Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes
Nordrhein-Westfalen, und Nikola Hagleitner,
Vorständin Post & Paket Deutschland der DHL
Group, die festlich geschmückte Schreibstube des
Christkindes im „Alten Baumwolllager“ in
Engelskirchen.

.l.n.r. Lukas Miebach, Burgermeister von
Engelskirchen; Nikola Hagleitner, Vorständin
Post und Paket Deutschland; Hendrik Wüst,
Ministerpräsident NRW
Ministerpräsident
Hendrik Wüst: „Seit 40 Jahren schreiben Kinder
aus aller Welt ihre Wünsche an das Christkind in
Engelskirchen – und sie alle erhalten eine
liebevolle Antwort. Über 130.000 Briefe aus mehr
als 50 Ländern zeigen jedes Jahr, wie lebendig
diese Tradition ist und wie besonders dieser Ort
bleibt. Die Christkindpostfiliale steht für
gelebtes Brauchtum und Herzlichkeit, die unser
Land prägen und den besonderen Zauber der
Vorweihnachtszeit. Mein Dank gilt allen, die mit
großem Engagement und viel Herz dafür sorgen,
dass der Traum vom Christkind Jahr für Jahr
Wirklichkeit wird.“
Nikola Hagleitner:
„Ich freue mich, heute gemeinsam mit
Ministerpräsident Hendrik Wüst unsere
Christkindpostfiliale in Engelskirchen zu
eröffnen. Fast 3 Millionen Wunschzettel in 40
Jahren, das hat Engelskirchen weltweit bekannt
gemacht. Dabei erzählt jeder Brief seine eigene
Geschichte.
Ich bin stolz, dass wir diese
Briefe als Post & Paket Deutschland
transportieren und beantworten dürfen. Ganz
besonders finde ich: Die Briefe ans Christkind
fördern Schreib- und Lesekompetenz, denn oft ist
der Wunschzettel der erste Brief, den Kinder
verfassen. Einen eigenen Brief zu erhalten – und
dann noch vom Christkind – ist für Kinder ein
unvergessliches Erlebnis.“
29
Kindergartenkinder aus Engelskirchen übergaben
dem Christkind ihre Herzenswünsche
höchstpersönlich. „Jeder Brief wird gelesen und
beantwortet“, verspricht das Christkind. Die
Wunschzettel-Adresse ist auf der ganzen Welt
bekannt. Sogar aus Australien, Malaysia und
Singapur sind bereits erste Briefe eingetrudelt.
Vielfältige Wünsche – von Klassikern bis
Kreativideen
Die Wunschzettel spiegeln die
ganze Bandbreite kindlicher Fantasie wider. Sie
sind liebevoll gestaltet, oftmals mit Engeln
bemalt und mit Glitzer beklebt. Teilweise sind
sie sogar versiegelt oder in Form eines „Himmel-
und Hölle“-Spiels. Die ersten Wünsche, die das
Christkind erreichen sind Perlenwebrahmen,
Schmuckkästchen mit Schlüssel, Piratenschiff und
Schachspiel.
Für die sechsjährige Elin
darf es ein Pferd mit rosa Stulpen sein, Via
hingegen wünscht sich einen Zauberstab, eine
Meerjungfrau und Sonnencreme für Puppen. Leo aus
Hamm würde sich über eine Drohne mit Controller
freuen und verspricht: „dann bist du das beste
Christkind!“ Dinosaurier sind auf der ganzen
Welt beliebt, sogar bei Yuito aus Japan stehen
sie hoch im Kurs. Er schenkt dem Christkind noch
ein Origami.
Eunice aus Singapur wünscht
sich mehr Zeit und Geld zum Reisen in 2026.
Alyssa aus den USA mag Deutschlernen, aber sie
schreibt „ich konjugiere nicht gern“. Sie
wünscht sich eine Reise nach Deutschland, wo sie
Schlösser sehen und Schnitzel essen kann.
Klassiker wie Bücher, Puppenwagen,
Kuscheltiere und Fahrräder sind weiterhin
gefragt.
Birgit Müller, mit 35 Jahren
Arbeitsjubiläum in der Christkindpostfiliale die
dienst-älteste Helferin, sagt: „Das Christkind
und wir Helferinnen sind oftmals gerührt über
den exklusiven Einblick in die Kinderherzen.
Über neueste Trends sind wir stets gut
informiert.“
In diesem Jahr neu dabei:
der Wunsch nach einem Labubu – einer beliebten
Sammlerfigur. Ebenso ist viel
Do-It-Yourself-Zubehör gefragt. Ebenso
gemeinsame, wertvolle Zeit mit der Familie zu
verbringen, ist den Kleinen wichtig. Und – wie
der kleine Lucas schreibt: - „dass wir alle
zusammen glücklich sind“. „Schenk bitte auch den
Armen etwas“, steht oftmals auf den Wünschen und
Emil mahnt: „Vergiss keine Kinder auf der Erde
glücklich zu machen.“

Antworten in 14 Sprachen und Blindenschrift –
Neu: mit Videobotschaft vom Christkind
Damit
alle Kinder eine persönliche Rückmeldung
erhalten, antwortet das Christkind in 14
Sprachen – darunter Deutsch, Englisch,
Französisch, Chinesisch, Japanisch, Polnisch,
Spanisch, Niederländisch, Tschechisch,
Ukrainisch, Hindi, Griechisch, Thailändisch und
Taiwanisch – sowie individuell auch in
Blindenschrift.
Jedes Kind, das seinen
Wunschzettel bis zum 18. Dezember schickt,
erhält eine Antwort. Das Christkind berichtet
darin über seine Arbeit und die Vorbereitungen
auf´s Weihnachtsfest. Ein weihnachtlicher
Basteltipp ist ebenfalls enthalten. Die
Antworten werden auf himmlischem Briefpapier
verfasst, mit Weihnachtsbriefmarken beklebt und
einem eigenen Sonderstempel versehen.
Neu in
diesem Jahr: Per QR-Code auf dem
Antwortschreiben können Kinder sich eine
Videobotschaft vom Christkind ansehen. Damit
wird das Himmelswesen auf interaktive Weise
lebendig und verzaubert die Post-Empfänger mit
weihnachtlicher Vorfreude.
Im letzten
Jahr hat das Christkind 132.000 Zuschriften aus
53 Ländern beantwortet.
Diejenigen, die
ihre Wunschzettel höchstpersönlich übergeben
möchten, empfängt das Christkind in seinem
himmlischer Postfiliale am Engels-Platz am 12.
Dezember 2025 zwischen 15 Uhr und 18 Uhr und am
13. und 14. Dezember 2025 jeweils zwischen 13
Uhr und 18.00 Uhr.
Geschichte
1985
tauchten erstmals Briefe in den gelben
Briefkästen der Deutschen Post auf, die „An das
Christkind bei den Engeln“ adressiert waren.
Schnell war den Mitarbeitern klar: Eine
schnelle, praktische Lösung muss her, um die
kleinen Absender nicht zu enttäuschen. Gefunden
wurde diese Lösung in der oberbergischen
Gemeinde Engelskirchen. In der dortigen
Postfiliale nahm sich eine Mitarbeiterin der
Weihnachtsbriefe an, öffnete und beantwortete
sie. So entstand die Christkindpostfiliale
Engelskirchen.
BdSt NRW
vergleicht Friedhofsgebühren 2025 in Großstädten
=> Download: Tabelle Friedhofsgebühen 2025 [pdf]
Die Friedhofsgebühren in
Nordrhein-Westfalen steigen weiter, wie der Bund
der Steuerzahler NRW in seinem jährlichen
Vergleich unter den 30 Großstädten festgestellt
hat. Bei den Sargwahlgräbern bleibt Leverkusen
teurer Spitzenreiter, bei den Urnengräbern ist
es Köln.

Der BdSt-Vergleich zeigt: Mehr als 5.000 Euro
kostet eine Sargbestattung in Leverkusen. In
Gütersloh sind es knapp unter 2.000 Euro. (Foto:
Thomas Lammertz / BdSt NRW)
Teurer Abschied: Friedhofsgebühren in NRW
steigen
BdSt NRW vergleicht die Gebühren für
die 30 größten Städte im Land
Eine
Sargbestattung in einem einstelligen Wahlgrab
kostet in diesem Jahr im NRW-Durchschnitt 3.644
Euro – ein Plus von 4 % gegenüber 2024. Damit
liegen die Gebühren deutlich über der
allgemeinen Preissteigerung von 2,3 %.
Eine Urnenbestattung im Reihengrab ist mit 1.612
Euro im Durchschnitt nur halb so teuer. Auch
hier sind die Gebühren gestiegen, um 5 %.
Sargbestattung: Leverkusen bleibt mit 5.273 Euro
Spitzenreiter bei den Sargwahlgräbern. Gütersloh
ist mit 1.934 Euro am günstigsten. Bemerkenswert
ist, dass sich in Gütersloh die kirchlichen
Friedhöfe offensichtlich positiv auswirken. Sie
sorgen für Konkurrenz und halten die städtischen
Gebühren im Zaum.
In einigen Städten
sanken die Gebühren – etwa in Bonn (-10 %) oder
Hamm (-3 %). Andere Städte wie z.B. Bottrop (+19
%), Oberhausen (+18 %) und Neuss (+12 %)
meldeten kräftige Aufschläge. Urnenbeisetzungen:
2.452 Euro zahlt man für eine Urnenbestattung in
Köln. Mit 531 Euro ist diese Form der Beisetzung
in Gütersloh am günstigsten. Besonders auffällig
sind die Steigerungen für eine Urnenbeisetzung
in Bottrop (+78 %), Oberhausen (+21 %),
Mönchengladbach (+19 %) und Neuss (+12 %). In
Bonn dagegen sanken die Gebühren um 6 %.
Die hohe Gebührensteigerung in Bottrop ist
auf die Einführung des sogenannten „Kölner
Modells“ zurückzuführen. Bei dieser Art der
Berechnung fallen nicht nur Kosten für die
Grabstelle an, sondern es wird anteilig auch die
Infrastruktur des Friedhofs berücksichtigt. Die
Verantwortung für die Höhe der Friedhofsgebühren
liegt bei den Stadträten – sie beschließen die
jeweilige Gebührensatzung und sollten prüfen,
wie sie die Gebühren mindestens stabil halten
können.
Trauerhallen und
Verwaltungsgebühren: Große Preisspannen
Die
Kosten für die Nutzung der Trauerhalle fallen je
nach Kommune höchst unterschiedlich aus.
In Gelsenkirchen kostet ein kleiner Feierraum 83
Euro, in Recklinghausen sind es 385 Euro für
eine Trauerhalle. Zusätzlich verlangen viele
Friedhofsverwaltungen Verwaltungsgebühren etwa
für die Genehmigung von Grabmalen oder das
Bearbeiten von Grabnutzungsrechten.
Der
BdSt NRW kritisiert solche Zusatzkosten –
insbesondere, wenn sie rein formaler Natur sind.
Tipp: Gebühren vorab vergleichen Gerade in
Zeiten steigender Kosten lohnt sich
ein Gebührenvergleich zwischen kommunalen und
kirchlichen Friedhöfen. Angehörige sollten sich
daher frühzeitig informieren und Kosten
transparent gegenüberstellen – pietätvoll und
mit Blick auf die eigene finanzielle Belastung.
Die Verantwortung für die Höhe der
Friedhofsgebühren liegt bei den Stadträten – sie
beschließen die jeweilige Gebührensatzung und
sollten prüfen, wie sie die Gebühren mindestens
stabil halten können Fazit: Eine würdevolle
Bestattung darf kein Kostenrisiko sein. Der BdSt
NRW fordert die Städte auf, die Belastungen für
Hinterbliebene zu begrenzen und die
Gebührenstrukturen regelmäßig zu überprüfen – im
Sinne der Bürger und ihrer Angehörigen.
Der Bund der Steuerzahler NRW berücksichtigt in
seinem Friedhofsgebührenvergleich ausschließlich
die städtischen Gebühren für Grabüberlassung,
Grabbereitung und Nutzung einer Trauerhalle.
Aufwendungen für eine Kremierung, für den
Bestatter, den Steinmetz und den
Friedhofsgärtner fallen zusätzlich an. Manche
Städte erheben zusätzlich eine
Verwaltungsgebühr, etwa für die Genehmigung von
Grabmalen oder das Bearbeiten von
Grabnutzungsrechten. Der BdSt NRW kritisiert
solche Zusatzkosten – insbesondere, wenn sie
rein formaler Natur sind.
Rettungsmedaille
des Landes für Polizeioberkommissar Chris
Szargiej aus Wesel
Dr. Markus
Postulka (Beigeordneter der Stadt Wesel)
zusammen mit Polizeioberkommissar Chris Szargiej
(Mitte) mit seiner Familie sowie der
Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen,
Herbert Reul. Wer Zivilcourage beweist, riskiert
oftmals sein eigenes Leben, so auch
Polizeioberkommissar Chris Szargiej aus Wesel.

Zusammen mit seinem Kollegen Polizeikommissar
Maximilian Zorle rettete er mehrere Menschen aus
einer brennenden Wohnung. Für Ihren Einsatz und
Mut wurden die beiden am Freitag, 7. November
2025, mit der Rettungsmedaille des Landes
Nordrhein-Westfalen geehrt.
Bei der
Verleihung durch Ministerpräsident Hendrik Wüst
im Schloss Horst in Gelsenkirchen war auch
Wesels Beigeordneter Dr. Markus Postulka als
Vertreter der Stadt Wesel dabei. Er übermittelte
im Namen der Stadt Wesel Glückwünsche und vor
allem Anerkennung für die Auszeichnung und der
damit verbundenen Heldentat. Diese besondere
Würdigung wird Menschen verliehen, die unter
Einsatz ihres eigenen Lebens andere Menschen aus
lebensbedrohlichen Notlagen retten.
Festlicher Weihnachtsbaum am Moerser
Neumarkt
Die Tanne stammt diesmal
aus der Nachbarstadt Krefeld An dieser
Tradition haben alljährlich viele Menschen in
der Moerser Innenstadt ihre Freude: Auch in der
kommenden Weihnachtszeit gibt es am Neumarkt
wieder einen geschmückten Tannenbaum, der
diesmal aus dem Garten von Anneliese Berretz aus
Krefeld-Uerdingen stammt.

Mit einem Kraftakt haben Mitarbeiter der ENNI
Stadt & Service Niederrhein (Enni) die gut zwölf
Meter hohe Weißtanne gestern in der Moerser
Nachbarstadt gefällt. Mit einem Tieflader des im
Hülsdonker Gewerbegebiet ansässigen
Bergeunternehmens Krause reiste der
tonnenschwere Koloss am Dienstag über die
Stadtgrenze zum Moerser Neumarkt, wo ihn
Mitarbeiter mit einem Spezialkran zentral auf
dem Marktplatz aufgestellt haben.
Dort
hat Björn Ewert als zuständiger
Sachgebietsleiter der Enni den Baum mit seinen
Kollegen zurechtgestutzt und mit Lichterketten
geschmückt. Bis zum Dreikönigstag sorgt die
Weißtanne nun in der Moerser Innenstadt für
festliche Stimmung und hüllt den Marktplatz
passend zu dem am 14. November beginnenden
Weihnachtsmarkt in festlichen Glanz.
„Durch einen Kontakt zu Familie Berretz konnten
wir auch in diesem Jahr wieder einen echten
Bürgerbaum aufstellen“, dankt Ewert. Um die
Aktion weiter durchführen zu können, bittet er
Bürgerinnen und Bürger, auch für 2026 um eine
Baumspende. „Wer Platz im Garten schaffen
möchte, sollte sich bei uns schon jetzt melden,
damit wir die Aktion dann abstimmen können.“
Dann gibt es auch im nächsten Jahr ganz sicher
wieder einen Bürgerbaum.
Studium
Generale: Schritt für Schritt die Welt
verändern: Studieren und Arbeiten an der
Hochschule Rhein-Waal
Di.,
25.11.2025 - 18:00 - 19:00 Uhr
Interkulturelle Bildung, für grenzübergreifende
Zusammenarbeit und nachhaltige Bildung.
Studierende aus aller Welt erwerben hier Wissen
und Kompetenzen, tragen nach ihrem Abschluss zur
Linderung des Fachkräftemangels bei und bringen
neue Perspektiven in Unternehmen. Kehren sie ins
Ausland zurück, wirken sie als Botschafter*innen
Deutschlands.

Foto: Hochschule Rhein Waal
Wir stellen
Ihnen Perspektiven, Projekte und
Persönlichkeiten der HSRW vor. Prof. Dr. Oliver
Serfling (Professor mit dem Schwerpunkt
Wirtschaftspolitik und Entwicklungsökonomik)
Imke Hans (Career Service und Employability /
Transfermanagerin für Capacity Building in der
Region) Die Veranstaltungen in Kleve finden im
Audimax statt: Marie-Curie-Str. 1
(Navigationsadresse: Wiesenstraße 35), 47533
Kleve, Gebäude 01 EG 010. Parkmöglichkeit:
Parkplatz Briener Straße.
Geflügelpest im
Kreis Wesel - Neuer Verdachtsfall in
Kamp-Lintfort, Zahl der betroffenen Wildvögel
nimmt zu
Im Rahmen der
vorgeschriebenen Kontrolluntersuchungen in der
3-Kilometer-Schutzzone um den von Geflügelpest
betroffenen Putenmastbetrieb wurde in einem
Hobbybetrieb in Kamp-Lintfort am vergangenen
Freitag bei Enten die Aviäre Influenza vom Typ
H5 festgestellt. Klinisch waren die Tiere bei
der Kontrolle am 6. November 2025 unauffällig
gewesen.
Die Untersuchung von Hühnern
aus demselben Bestand ergab ein fragliches
Ergebnis. Damit besteht auch in diesem Betrieb
der Verdacht auf Geflügelpest. Der vorhandene
Geflügelbestand – insgesamt 37 Hühner, Gänse und
Enten – wurde durch Mitarbeitende des
Veterinäramtes des Kreises Wesel getötet. Die
entnommenen Proben wurden zur weiteren
Untersuchung an das Friedrich-Loeffler-Institut
geschickt.
Die Zahl der tot
aufgefundenen Wildvögel, bei denen mittlerweile
die Geflügelpest vom Typ H5N1 nachgewiesen
wurde, nimmt in Deutschland rasant zu. Auch im
Kreis Wesel wurden zahlreiche Wildvögel
untersucht. Für folgende Tiere liegt inzwischen
eine Bestätigung des Erregers vor: 2 Wildgänse
aus Dinslaken 1 Wildente aus Hünxe 1 Wildgans
aus Xanten 1 Wildgans aus Kamp-Lintfort 1
Graureiher aus Moers 1 Bussard aus Rheinberg 1
Wildgans aus Rheinberg.
Es ist davon
auszugehen, dass die Zahl der Nachweise weiter
ansteigen wird. Im gesamten Kreisgebiet muss
derzeit von einem sehr hohen Risiko für die
Einschleppung der Geflügelpest in
Geflügelbestände ausgegangen werden. Das
Veterinäramt appelliert daher eindringlich an
alle Geflügelhaltenden, die Aufstallungspflicht
strikt einzuhalten und die geltenden
Hygienemaßnahmen konsequent zu beachten.
Das Landesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit hat mitgeteilt, dass
Tauben von der Aufstallungspflicht ausgenommen
werden können. Der Kreis Wesel hat die
Allgemeinverfügung vom 30. Oktober 2025
entsprechend angepasst.

Inflationsrate im
Oktober 2025 bei +2,3 %
Inflationsrate geht
nach zwei Anstiegen in Folge leicht zurück
Verbraucherpreisindex, Oktober 2025: +2,3 %
zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis
bestätigt) +0,3 % zum Vormonat (vorläufiges
Ergebnis bestätigt) Harmonisierter
Verbraucherpreisindex, Oktober 2025: +2,3 % zum
Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)
+0,3 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis
bestätigt)
Die Inflationsrate in
Deutschland – gemessen als Veränderung des
Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat –
lag im Oktober 2025 bei +2,3 %. Im September
2025 hatte sie +2,4 % und im August 2025 +2,2 %
betragen. "Nach zwei Anstiegen in Folge ging die
Inflationsrate im Oktober wieder leicht zurück",
sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen
Bundesamtes (Destatis).
"Inflationstreibend wirkten dabei die weiterhin
überdurchschnittlich steigenden Preise für
Dienstleistungen." Gegenüber dem Vormonat
September 2025 stiegen die Verbraucherpreise im
Oktober 2025 um 0,3 %.
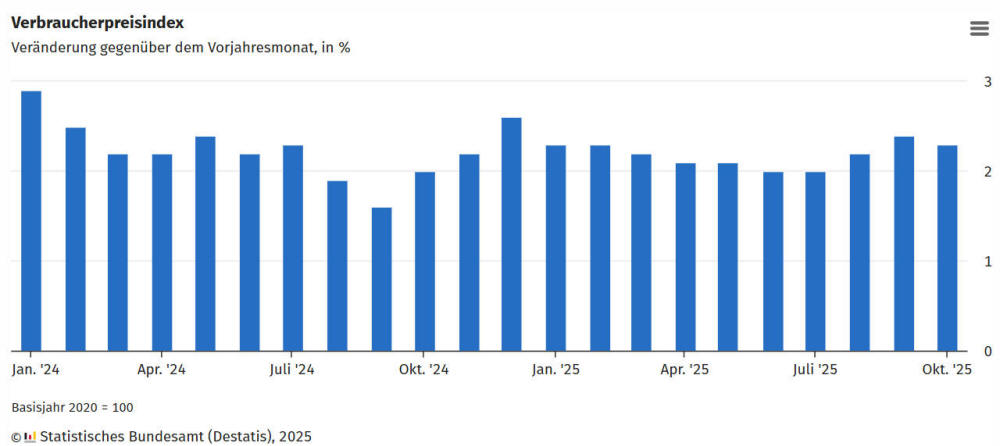
Energieprodukte verbilligten sich um 0,9 %
gegenüber Oktober 2024
Die Preise
für Energieprodukte lagen im Oktober 2025 um
0,9 % niedriger als im Vorjahresmonat. Der
Preisrückgang für Energie hat sich damit wieder
leicht verstärkt (-0,7 % gegenüber September
2024). Von Oktober 2024 bis Oktober 2025
verbilligte sich die Haushaltsenergie um 1,7 %.
Insbesondere konnten die Verbraucherinnen und
Verbraucher von günstigeren Preisen für leichtes
Heizöl (-6,0 %) profitieren.
Etwas
günstiger als ein Jahr zuvor wurden Strom
(-1,4 %) und Fernwärme (-1,0 %). Teurer unter
der Haushaltsenergie waren hingegen Erdgas
(+0,9 %) sowie Brennholz, Holzpellets oder
andere Brennstoffe (+2,5 %). Die
Kraftstoffpreise erhöhten sich binnen
Jahresfrist um 0,4 %.
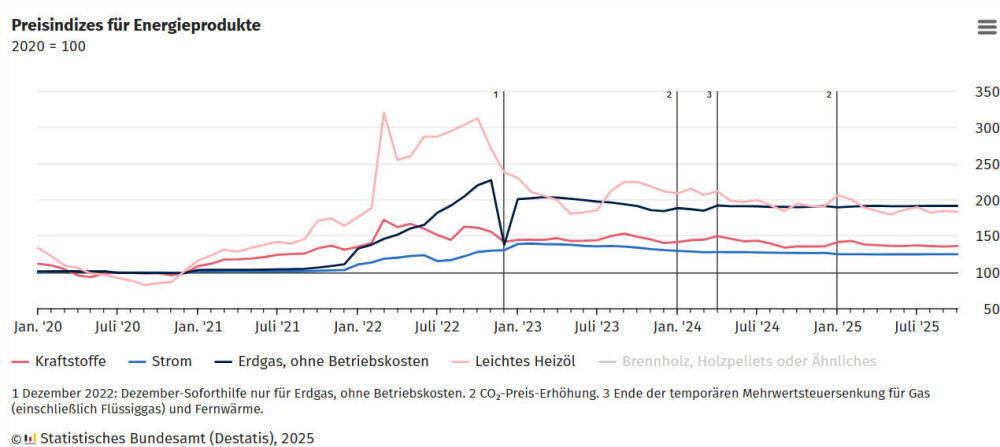
Nahrungsmittel verteuerten sich binnen
Jahresfrist unterdurchschnittlich um 1,3 %
Die Preise für Nahrungsmittel waren im Oktober
2025 um 1,3 % höher als im Vorjahresmonat. Im
Oktober 2025 hat sich damit der Preisauftrieb
für Nahrungsmittel deutlich abgeschwächt
(September 2025 gegenüber September 2024:
+2,1 %).
Eine noch niedrigere
Teuerungsrate für Nahrungsmittel wurde zuletzt
im Januar 2025 erreicht (+0,8 %). Von Oktober
2024 bis Oktober 2025 waren vor allem
Speisefette und Speiseöle (-12,6 %, darunter
Olivenöl: -22,7 %; Butter: -16,0 %) günstiger.
Zudem verbilligte sich Gemüse gegenüber dem
Vorjahresmonat (-4,0 %, darunter Kartoffeln:
-12,6 %).
Einige andere
Nahrungsmittelgruppen wurden hingegen spürbar
teurer als ein Jahr zuvor, insbesondere Zucker,
Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+8,2 %,
darunter Schokolade: +21,8 %). Auch für Fleisch
und Fleischwaren (+4,3 %) sowie Obst (+3,1 %)
fiel die Preiserhöhung deutlich aus.
Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie
bei +2,8 %
Im Oktober 2025 lag die
Inflationsrate ohne Energie bei +2,5 %, nach
+2,7 % im September 2025. Die Inflationsrate
ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und
Energie, häufig auch als Kerninflation
bezeichnet, verharrte im Oktober 2025 bei +2,8 %
(September 2025: +2,8 %). Beide Kenngrößen
verdeutlichen, dass die Teuerung in anderen
wichtigen Güterbereichen weiterhin
überdurchschnittlich hoch war.
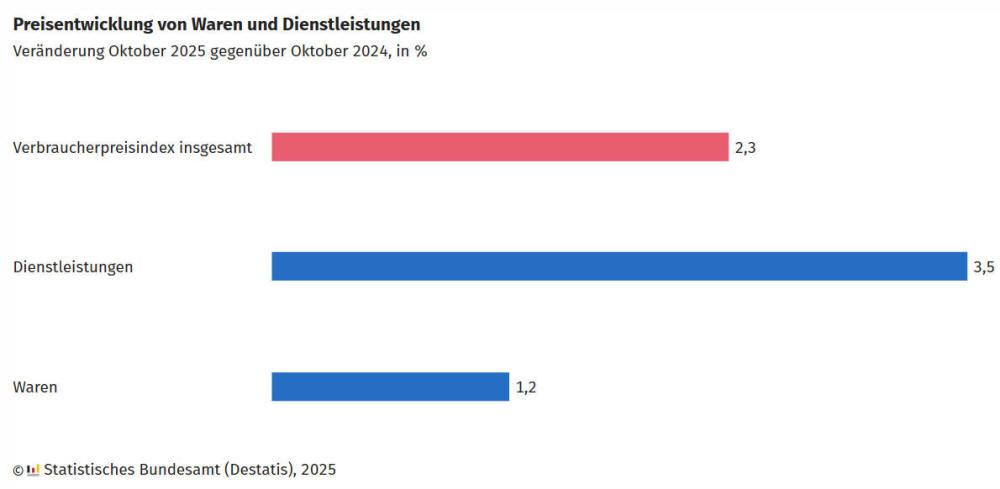
Dienstleistungen verteuerten sich binnen
Jahresfrist überdurchschnittlich um 3,5 %
Die Preise für Dienstleistungen
insgesamt lagen im Oktober 2025 um 3,5 %
höher als im Vorjahresmonat, nach +3,4 % im
September 2025. Von Oktober 2024 bis Oktober
2025 erhöhten sich die Preise vor allem für kombinierte
Personenbeförderung (+11,4 %) und
Dienstleistungen sozialer Einrichtungen
(+8,0 %).
Deutlich teurer als ein Jahr
zuvor waren unter anderem auch stationäre
Gesundheitsdienstleistungen (+6,5 %), die
Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+5,3 %),
Pauschalreisen (+5,1 %) sowie Wasserversorgung
und andere Dienstleistungen für die Wohnung
(+3,9 %).
Bedeutsam für die
Preisentwicklung insgesamt blieben auch im
Oktober 2025 die Nettokaltmieten mit
+2,0 %. Dagegen waren nur wenige
Dienstleistungen günstiger als im
Vorjahresmonat, zum Beispiel
Telekommunikationsdienstleistungen (-0,7 %).
Waren verteuerten sich gegenüber Oktober
2024 um 1,2 %
Waren insgesamt verteuerten
sich von Oktober 2024 bis Oktober 2025 um 1,2 %
(September 2025: +1,4 %). Die Preise für
Verbrauchsgüter stiegen dabei um 1,3 % und für
Gebrauchsgüter um 1,0 %. Neben dem Preisanstieg
bei Nahrungsmitteln (+1,3 %) wurden einige
andere Waren deutlich teurer, insbesondere
alkoholfreie Getränke (+7,2 %, darunter Kaffee
und Ähnliches: +21,3 %) sowie gebrauchte Pkw
(+5,5 %).
Für die meisten Waren wurde
eine moderate Preiserhöhung ermittelt, zum
Beispiel für Bekleidungsartikel (+1,2 %) sowie
für Möbel und Leuchten (+0,9 %). Preisrückgänge
waren hingegen außer bei der Energie (-0,9 %)
unter anderem bei Mobiltelefonen (-4,0 %) und
Geräten der Unterhaltungselektronik (-3,2 %) zu
verzeichnen.
Preise insgesamt stiegen
gegenüber dem Vormonat um 0,3 %
Im Vergleich
zum September 2025 stieg der
Verbraucherpreisindex im Oktober 2025 um 0,3 %.
Deutlich teurer gegenüber dem Vormonat wurden im
Oktober 2025 Flugtickets (+19,4 %). Die Preise
für Energie insgesamt stiegen im gleichen
Zeitraum geringfügig um 0,2 %. Insbesondere
wurde hier Kraftstoff teurer (+0,5 %), dagegen
gaben die Preise für leichtes Heizöl nach
(-0,8 %). Die Preise für Nahrungsmittel
insgesamt blieben binnen Monatsfrist stabil
(+0,0 %), unter anderem sanken die Preise für
Butter (-10,0 %) und Äpfel (-6,5 %) deutlich.
Kosten der NRW-Krankenhäuser für
die stationäre Versorgung waren 2024 um 7,7 %
höher als ein Jahr zuvor
*
30,2 Milliarden Euro Kosten für die stationäre
Versorgung in 2024.
* Durchschnittliche
Kosten von 7.082 Euro je Behandlungsfall.
*
62 % der Gesamtkosten entfallen auf
Personalkosten.
Im Jahr 2024 summierten
sich die Kosten der 316 nordrhein-westfälischen
Krankenhäuser für die stationäre
Krankenhausversorgung auf rund 30,2 Milliarden
Euro. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, waren das 7,7 % mehr als ein Jahr
zuvor.
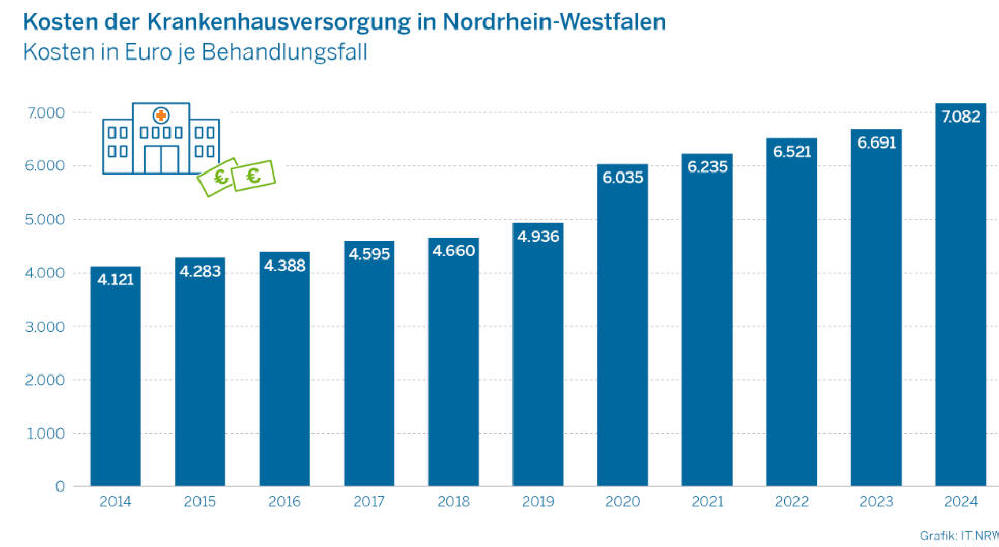
Zusammen mit den Kosten für nichtstationäre
Leistungen ergaben sich für die
Krankenhausversorgung Kosten in Höhe von rund
35,6 Milliarden Euro; das waren 7,0 % mehr als
2023. Die Zahl der vollstationären
Behandlungsfälle ist im selben Zeitraum um 1,8 %
gestiegen.
Die Kosten je Behandlungsfall
erneut gestiegen
Die Pro-Kopf-Kosten waren
2024 um 391 Euro bzw. 5,8 % höher als ein Jahr
zuvor: Umgerechnet auf alle rund 4,3 Millionen
vollstationär versorgten Patientinnen und
Patienten lagen die durchschnittlichen Kosten
bei 7.082 Euro je Behandlungsfall.
Bei
29,3 Millionen vollstationären Berechnungs- bzw.
Belegungstagen im Jahr 2024 ergaben sich für
einen Krankenhaustag durchschnittliche Kosten in
Höhe von 1.029 Euro. Damit kostete ein
Belegungstag im Schnitt 72 Euro bzw. 7,5 % mehr
als im Jahr 2023.
Knapp zwei Drittel der
Gesamtkosten entfielen auf das Personal, mehr
als ein Drittel waren Sachkosten Die
Personalkosten der NRW-Krankenhäuser hatten mit
22,1 Milliarden Euro im Jahr 2024, wie auch in
den Jahren zuvor, einen Anteil von nahezu zwei
Dritteln (62,0 %) an den Gesamtkosten.
Mit
36,4 % machten Sachkosten gut ein Drittel der
Gesamtkosten aus. Die restlichen 1,6 % entfielen
auf Kosten für Ausbildungsstätten, Zinsen und
ähnliche Aufwendungen sowie Steuern.
Gedenken
an die Reichspogromnacht in Moers
Nach einem ökumenischen Gottesdienst
versammelten sich am Sonntag (9. November) über
100 Teilnehmende am Mahnmal Synagogenbogen in
der Altstadt. Bürgermeisterin Julia Zupancic und
Daniel Schirra, Lehrer am Gymnasium Adolfinum
und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Moers e. V.,
gingen auf die bleibende Bedeutung des Gedenkens
ein.

Foto: O. Laakmann Auch in diesem Jahr erinnerten
zahlreiche Menschen in Moers an die
Reichspogromnacht vom 9. November 1938.
Schülerinnen und Schüler von fünf Moerser
Schulen gestalteten die anschließende
Veranstaltung mit eigenen Beiträgen zu Themen
wie Sprache im Nationalsozialismus,
Erinnerungskultur und Verantwortung heute.
Ein Mitglied des Auschwitzprojekts am
Gymnasium Adolfinum, berichtete vom Besuch der
Gedenkstätte und rief mit eindringlichen Worten
zur Menschlichkeit auf: „Es waren doch Menschen
wie du und ich, Menschen mit Familien, mit
Leben, mit Hoffnungen.“ Zum Abschluss wurden die
Namen der ermordeten und verschleppten Moerser
Jüdinnen und Juden verlesen und Kränze sowie
Rosen niedergelegt.
Kostenlose
Hebammensprechstunde im Familienzentrum
Eine Schwangerschaft oder die Zeit mit
einem Neugeborenen ist voller Fragen: Wie
erkennt man, ob das Baby genug trinkt? Was hilft
gegen Bauchweh? Und wann wird der Alltag endlich
wieder etwas planbarer? Antworten und gute Tipps
gibt es in einer offenen Hebammensprechstunde.
Sie startet kurzfristig im Städtischen
Familienzentrum Diergardtstraße.
Die
Stadt Moers nutzt dafür Restfördermittel, damit
kann das Angebot noch in diesem Jahr ermöglicht
werden – ohne Anmeldung und vor allem
kostenfrei. Der erste Termin ist bereits am
Montag, 17. November, von 9.30 bis 11.30 Uhr.
Leiterin ist die erfahrene Hebamme Katharina
Ijagwu. Sie nimmt sich Zeit für die
individuellen Anliegen – egal ob es um Stillen,
Ernährung, Schlaf oder Entwicklung des Babys
geht.
Willkommen sind Schwangere und
‚junge‘ Mütter, aber auch Väter dürfen
mitkommen. Die Stadt Moers möchte mit dem
Angebot Familien stärken und ihnen unkompliziert
Zugang zu fachlicher Unterstützung ermöglichen.
Das sind die weiteren Termine
im Städtischen Familienzentrum Diergardtstraße
(Diergardtstraße 46): Freitag, 28. November,
13.30 bis 15.30 Uhr Mittwoch, 3. Dezember, 13.30
bis 15.30 Uhr Montag, 8. Dezember, 9.30 bis
11.30 Uhr Donnerstag, 18. Dezember, 9.30 bis
11.30 Uhr Rückfragen unter Telefon: 0 28 41 / 2
98 83
Rat beschließt am Mittwoch
Bildung von Ausschüssen
Die
Bildung, Zusammensetzung und Vorsitze der
Ausschüsse ist Thema der Ratssitzung am
Mittwoch, 12. November. Die Sitzung findet um 16
Uhr im Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1,
statt. Sie wird auch wieder über einen
Livestream übertragen:
Zum Stream ohne Untertitel.
Zum Stream mit Untertiteln. Weitere Themen
sind unter anderem die Vertretung der Stadt
Moers in Organen von Unternehmen, Gesellschaften
oder anderen Institutionen und die Weiterführung
des Streamingangebots für Ratssitzungen.
Volksbank Niederrhein fördert
die Moerser ‚Kulturstrolche‘
Rund
380 junge Moerser ‚Kulturstrolche‘ von sechs
Moerser Grundschulen erkunden in diesem Jahr die
Moerser Kulturlandschaft und lernen lokale
Kulturschaffende kennen.

Die Klasse 4a der Meerbecker Uhrschule mit ihrer
Klassenlehrerin Andrea Skroch (letzte Reihe, 1.
v.l.) zu Gast im Atelier der Moerser
Kinderbuchillustratorin Katja Jäger (letzte
Reihe, 1. v.r.) sowie Guido Lohmann,
Vorstandsvorsitzender Volksbank Niederrhein
(letzte Reihe, 2.v.r.) und Katja Roters,
Kulturbüro Moers (letzte Reihe, 2.v.l.) (Foto:
pst)
Das Kulturbüro der Stadt Moers
koordiniert das vom NRW Kultursekretariat
geförderte Programm zur kulturellen Bildung von
Grundschulkindern. Auch in diesem Jahr
ermöglicht die Volksbank Niederrhein wieder
zusätzliche Projekte. Das Geldinstitut
finanziert „Was macht eine
Kinderbuchillustratorin?“ mit der Moerser
Illustratorin Katja Jäger für insgesamt drei
Schulklassen.
Wesel: Bernd
Stelter erhält den Eselorden 2026
Bernd Stelter wird Träger des Eselordens 2026
der Stadt Wesel.
Dies gab Ulla Hornemann,
Präsidentin des Närrischen Parlaments, am 11.
November 2025 um 11.11 Uhr in Wesel bekannt.
Stelter folgt damit auf die Band Rebell Tell,
die im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurde.
Das Närrische Parlament würdigte heute den
Kabarettisten als eine Persönlichkeit, die mit
"Humor, Herz und Haltung" den rheinischen
Karneval präge - und das, obwohl er aus
Westfalen stammt.

(C) Wesel Marketing
Als Moderator der
Quiz-Sendung "Das NRW-Duell", fragte er dereinst
seine Kandidaten, ob es in Nordrhein-Westfalen
wohl einen Eselorden gibt. In wenigen Wochen
kann er die Auszeichnung überall rumzeigen. Die
Eselordenverleihung findet am Karnevalssonntag
(15. Februar) statt.
Präsidentin
Ulla Hornemann erläuterte die Entscheidung des
Närrischen Parlaments und würdigte Stelter als
eine Persönlichkeit, die mit Humor, Herz und
Haltung den rheinischen Karneval prägt und über
Jahrzehnte hinweg Menschen zum Lachen bringt:
Auch wenn man unseren
zukünftigen Eselordensträger in den kommenden
Monaten wieder häufig in Köln trifft, er ist
kein Rheinländer, sondern ein westfälischer
Dickkopf. Als er 1961 in Stockum (heute Unna)
geboren wurde, hatte die Gemeinde lt. Wikipedia
297 Einwohner. Zwei davon waren seine Eltern.
Und damit der Jung auch etwas Vernünftiges
lernt, wurde er nach Bonn geschickt, um dort
Volkswirtschaftslehre zu studieren.
Na
gut, das Studium hat er zwar kurz vor dem
Abschuss hingeschmissen, trotzdem darf er
mittlerweile einen Doktorhut tragen. Er
promovierte nämlich im letzten Jahr an der
Dülkener Narrenakademie und wurde damit zum
neuen Doctor humoris causa. Unser zukünftiger
Eselordenträger ist ein Tausendsassa. Er ist zum
Beispiel ein Schriftsteller, der eine ganze
Reihe literarisch anspruchsvolle Ratgeber
geschrieben hat, die sogar in der
Spiegel-Bestsellerliste auftauchten.
So
zum Beispiel die Bücher: „Das Leben ist zu kurz,
um schlechten Wein zu trinken“ oder aber „Wer
abnimmt, hat mehr Platz im Leben“. Aber auch
das Schreiben großer Kriminalromane, wie
beispielsweise „Der Killer kommt auf leisen
Klompen“ oder „Mode, Mord und Meeresrauschen“
bereitet ihm sichtliches Vergnügen. So ganz
nebenbei möchte ich erwähnen, dass die
Filmrechte angeblich noch zu haben sein sollen –
also, dass war jetzt der Werbeblock.
Außerdem ist er auch noch ein Musiker, der unter
anderem Klavier und Gitarre spie-len kann und
ein Schauspieler ist er sowieso. Das so einer
irgendwann als Moderator beim Radio und beim
Fernsehen landet, bleibt ja gar nicht aus. Als
Moderator der Quiz-Sendung „Das NRW-Duell“,
fragte er dereinst die Kandidaten, ob es in
Nord-rhein-Westfalen wohl einen Eselorden gibt?
In 2 Monaten und 5 Tagen kann er ihn
überall rumzeigen. Unser zukünftiger
Eselordenträger ist auch ein begnadeter
Liedermacher. Seine Lie-der „Mahatma“, „Das Lied
vom Kaninchen“ und „Hörst du die Regenwürmer
husten?“ oder aber „Ich hab drei Haare auf der
Brust“ kennt ja wohl jeder.
Mittlerweile hat er sich aber mehr zu einem
Kabarettisten der nachdenklichen Töne
entwickelt. Mehr so in Richtung Hans-Dieter
Hüsch, unserem Eselordenträger von 1992, der im
Mai diesen Jahres 100 Jahre alt geworden wäre.
Auch zu unserem Eselordenträger 2010 hat er
einen besonderen Bezug, er ist nämlich Pate der
Herman-van-Veen-Stiftung.
Sie sehen
also, dass sich der neue Träger geradezu
aufgedrängt hat. Als er einmal etwas Kritisches
zu Wesel sagen sollte, ist ihm nichts
eingefallen. Also hat er die Behauptung
aufgestellt, dass in Wesel immer gutes Wetter
sein müsste, denn immer, wenn er hier war,
schien die Sonne. Ich glaub ja, der Kerl kann
auf seiner Schleimspur Pirouetten drehen.
Seit Veröffentlichung des Rätsels, haben
mich natürlich schon eine ganze Reihe Leute
gefragt, wer denn dieser Dickkopf ist. Einige
lagen mit ihrer Vermutung sogar richtig, und
mittlerweile dürfte ja wohl jedem hier klar
sein: Unser neuer Eselordenträger ist: der
Musiker und Kabarettist Bernd Stelter.“
Präsentation des Stadtordens
Im Rahmen der
Pressekonferenz stellte Bürgermeister Rainer
Benien außerdem den Stadtorden 2026 vor, der an
die Eröffnung des neuen RheinBads erinnert. Wie
schon in den Vorjahren stammt das Design des
Stadtordens vom Weseler Künstler Jens Müller.
Eselordenverleihung im Festzelt Die Verleihung
des Eselordens hat in Wesel eine lange
Tradition: Sie wurde 1972 von Wilhelm
Schulte-Mattler ins Leben gerufen und findet
2026 bereits zum 28. Mal statt. Die
Eselordenverleihung findet am Sonntag, 15. März,
ab 10.30 Uhr im Karnevalszelt auf der Festwiese
am Rhein statt.
Krankenhaus
Bethanien Moers macht zum Weltdiabetestag auf
die Volkskrankheit aufmerksam
Früherkennung und Verständnis für Betroffene
stehen im Mittelpunkt Anlässlich des
Weltdiabetestages am 14. November möchte das
Krankenhaus Bethanien Moers auf die wachsende
Bedeutung der Volkskrankheit Diabetes hinweisen.
Deutschlandweit sind ca. neun Millionen Menschen
betroffen – viele, ohne es zu wissen.
Frühzeitige Warnzeichen sollten daher ernst
genommen und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen
wahrgenommen werden. „Diabetes ist keine seltene
Erkrankung – und sie betrifft Menschen jeden
Alters“, betont Dr. Ali Yüce, Chefarzt der
Klinik für Diabetologie & Endokrinologie.
„Viele Betroffene leben über Jahre mit
Symptomen, ohne eine Diagnose zu erhalten. Dabei
kann eine frühzeitige Behandlung schwerwiegende
Folgeerkrankungen verhindern.“ Typische
Warnsignale wie starker Durst, häufiges
Wasserlassen, unerklärlicher Gewichtsverlust,
Müdigkeit oder schlecht heilende Wunden sollten
ernst genommen werden. Je früher Diabetes
erkannt wird, desto besser kann er behandelt
werden.
Erste Anlaufstelle bei Verdacht
auf Diabetes sind die Hausärzt:innen. Sie können
durch einfache Blutuntersuchungen feststellen,
ob ein erhöhter Blutzuckerwert vorliegt, und die
weitere Behandlung einleiten. Bei schwereren
oder unklaren Fällen arbeiten sie eng mit den
Fachärzt:innen im Krankenhaus Bethanien
zusammen. Dort stehen spezialisierte
Diabetolog:innen sowie ein interdisziplinäres
Team bereit, um die bestmögliche Diagnostik und
Therapie sicherzustellen.
Neben der
medizinischen Aufklärung ist dem Team rund um
Chefarzt Dr. Ali Yüce auch der gesellschaftliche
Umgang mit der Erkrankung ein wichtiges
Anliegen. „Menschen mit Diabetes leben oft mit
Vorurteilen und Missverständnissen“, erklärt er.
„Wir möchten dazu beitragen, dass mehr
Verständnis für die Betroffenen entsteht und sie
in ihrem Alltag unterstützt werden.
Jede
und jeder Einzelne kann dazu beitragen, indem er
bzw. sie Offenheit zeigt, Rücksicht auf
besondere Bedürfnisse – etwa bei Mahlzeiten,
Arbeitszeiten oder körperlicher Belastung –
nimmt und Betroffene nicht verurteilt. Ein
verständnisvoller Umgang hilft, den Alltag mit
der Erkrankung besser zu meistern.“ Das
Krankenhaus beteiligt sich rund um den
Weltdiabetestag mit einem Informationsstand im
Foyer der Klinik, um über Risikofaktoren,
Prävention und Behandlungsmöglichkeiten
aufzuklären.

Patient:innen und Besucher:innen können sich
dort von 11 bis 13 Uhr zu modernen Therapien,
Ernährung und Bewegung beraten und außerdem
ihren Blutzucker messen lassen. Pressefoto Dr.
Ali Yüce (Foto), Chefarzt der Klinik für
Diabetologie & Endokrinologie am Krankenhaus
Bethanien Moers, betont anlässlich des
Weltdiabetestages, wie wichtig es ist,
Warnzeichen für Diabetes ernst zu nehmen.
Erfolgreicher Abschluss an der
Bethanien Akademie Moers
13
Teilnehmer:innen legen Externenprüfung zum
Erwerb des Berufsabschlusses „staatlich
anerkannte:r Pflegefachassistent:in“ mit Erfolg
ab 13 Teilnehmer:innen absolvierten vor Kurzem
die Externenprüfung an der Bethanien Akademie
Moers mit Erfolg und dürfen nun die
Berufsbezeichnung „staatlich anerkannte:r
Pflegefachassistent:in“ führen.
Die
Kursteilnehmer:innen aus dem Krankenhaus
Bethanien, dem Seniorenstift Bethanien, von der
AWO Seniorendienste gGmbH und vom Neukirchener
Erziehungsverein haben dazu in einem Zeitraum
von rund sechs Monaten einmal wöchentlich am
Vorbereitungskurs an der Bethanien Akademie
teilgenommen und wurden dabei umfassend auf die
Prüfung vorbereitet.
Die formalen
Voraussetzungen für die Zulassung zu einer
solchen Externenprüfung und die Anforderungen in
der Prüfung selbst entsprechen denen der
regulären Bildungsgänge. Voraussetzung für den
Erwerb des Berufsabschlusses „staatlich
anerkannte:r Pflegefachassistent:in“ ist etwa
ein Nachweis über eine mindestens 30-monatige
Vollzeittätigkeit in der Pflege, zum Beispiel
als Pflegehilfe oder Pflegeassistenz.
Bei einer Examensfeier in den Räumlichkeiten der
Akademie Ende Oktober kamen unter anderem
Pflegedirektorin Angelika Linkner, die
Akademieleitungen, Pflegedienstleitungen,
Praxisanleiter:innen und weitere
Wegbegleiter:innen sowie Angehörige zusammen, um
gemeinsam mit den Absolvent:innen die
Zeugnisübergabe zu feiern.
„Das Tolle an
der Externenprüfung ist, dass wir so zum einen
das Ziel des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
erreichen. Mit ihr soll langjährigen
Pflegehilfskräften in NRW – durch Anrechnung
ihrer Praxiserfahrung – ermöglicht werden, einen
staatlich anerkannten Abschluss als
Pflegefachassistentin bzw. -assistent zu
erlangen“, erklärt Birsel Kasilmis, Schulleitung
der Pflegefachschule der Bethanien Akademie.
„Die Prüfung bietet außerdem eine Chance auf
berufliche Weiterentwicklung und den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit,
zu sehen, was sie eigentlich alles schaffen
können. Denn bei vielen ist der Schulabschluss
schon etwas länger her. Da können schon einmal
Ängste aufkommen. Mit der Prüfung steigt so auch
das Selbstwertgefühl. Das ist schön zu sehen.
Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen
Berufsabschluss und ihre langjährige Erfahrung
in der Pflege wird honoriert“, betont Angelika
Linkner, Pflegedirektorin der Stiftung Bethanien
Moers. Bereits zum dritten Mal bot die Bethanien
Akademie einen Kurs zur Externenprüfung an und
wird das auch in Zukunft tun: „Ab dem 05. März
2026 starten wir mit dem nächsten Kurs.

Insgesamt 13 Kursteilnehmer:innen legten die
Externenprüfung zum Erwerb des Berufsabschlusses
„staatlich anerkannte:r Pflegefachassistent:in“
mit Erfolg an der Bethanien Akademie ab.
Interessierte Mitarbeiterinnen,
Mitarbeiter und Arbeitgeberinnen sowie
Arbeitgeber können sich jederzeit unter
akademie@bethanienmoers.de oder telefonisch
unter +49 (0) 2841 200 2402 melden“, so Birsel
Kasilmis.
DRK-Wesel: „Probier’s
mal mit Genuss“ – Ein Abend rund ums gute Essen
und neue Perspektiven
Viele denken
bei „Essen auf Rädern“ noch an einfache
Hausmannskost ohne Abwechslung – doch das hat
sich längst geändert. Mit der Veranstaltung
„Probier’s mal mit Genuss“ lädt das DRK
Niederrhein am Dienstag, 18. November 2025, um
18:30 Uhr ins DRK-Zentrum Wesel ein, um zu
zeigen, wie modern, frisch und vielfältig der
heutige Menüservice ist.

„Gut beraten beim DRK Niederrhein: In der
persönlichen Pflegeberatung erhalten
Interessierte wertvolle Informationen zu
Unterstützungsangeboten“. Viele Menschen
verbinden mit „Essen auf Rädern“ noch immer
altmodische Vorstellungen – von fadem Geschmack,
eingeschränkter Auswahl oder liebloser
Zubereitung. Dass es auch ganz anders geht,
möchte das DRK Niederrhein mit seiner
Veranstaltung „Probier’s mal mit Genuss“ zeigen.
Im Rahmen der Themenreihe
„DRK-Pflegeberatung“ lädt das DRK herzlich zu
einem kostenlosen Testessen am Dienstag, 18.
November 2025, ab 18:30 Uhr ins DRK-Zentrum,
Handwerkerstraße 5 in Wesel ein. Teilnehmende
können sich selbst überzeugen, wie vielfältig,
frisch und hochwertig moderne Menüservices heute
sind.
Der DRK-Menüservice bietet
regionale Gerichte, frisch zubereitet und 365
Tage im Jahr direkt nach Hause geliefert – ideal
für alle, die gutes Essen und bequemen Service
schätzen. Vor Ort erhalten Gäste spannende
Einblicke in die Herstellung und Zubereitung der
Menüs, erfahren Wissenswertes über die
regionalen Lieferketten und dürfen aus drei
verschiedenen Gerichten wählen – natürlich zum
Probieren.
„Viele wissen gar nicht,
wie modern und abwechslungsreich unser
Menüservice inzwischen ist“, betont Monika
Dörnemann als verantwortliche Teamleiterin. „Mit
dieser Veranstaltung möchten wir zeigen, dass
gutes Essen Lebensfreude bedeutet – unabhängig
vom Alter.“
Da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist, wird um Anmeldung unter Telefon:
02 81 – 30 01 – 12 oder E-Mail:
mahlzeitendienst@drk-niederrhein.de gebeten.
Über den DRK Menüservice Der Menüservice des DRK
Niederrhein steht für Qualität, Frische und
Regionalität. Täglich werden abwechslungsreiche
Menüs zubereitet – mit Liebe gekocht und
zuverlässig bis an die Haustür geliefert.
Das Angebot richtet sich
an alle, die Wert auf gutes Essen, Flexibilität
und Service legen. Erwärmt und appetitlich
angerichtet bringen DRK-Mitarbeiter an 365 Tagen
im Jahr zuverlässig ein köstliches Mittagessen
direkt nach Hause. Bei Bedarf unterstützen sie
auch beim Schneiden und Portionieren der
Speisen.
Kirchliche Präsenz in
der Arbeitswelt und im öffentlichen Raum
Gedankenimpulse und Podiumsdiskussion in der
Marxloher Kreuzeskirche
Um
kirchliche Präsenz in der Arbeitswelt und im
öffentlichen Raum geht es am 2. Dezember bei
einer Veranstaltung in der Kreuzeskirche
Duisburg-Marxloh, Kaiser-Friedrich-Str. 40. Dr.
Johannes Rehm, Pfarrer i.R., Nürnberg, von 2006
bis 2023 Leiter des Kirchlichen Dienstes in der
Arbeitswelt der Evang.-Luth. Kirche in Bayern,
spricht „Über die Notwendigkeit kirchlicher
Präsenz an öffentlichen Orten“.

Kreuzeskirche Duisburg-Marxloh - Foto Tanja
Pickartz
Prof. Dr.
Traugott Jähnichen, Lehrstuhl für Christliche
Gesellschaftslehre, Evangelisch-Theologische
Fakultät, Ruhr-Universität Bochum, spricht
anschließend zum Thema „Kirchliche Präsenz in
der Arbeitswelt“. Beide Vorträge sind auch
Impulse für die Podiumsdiskussion mit den beiden
Referenten, Dr. Christoph Urban, Superintendent
des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, und
Dr. Kathrin Kürzinger von der Evangelischen
Akademie im Rheinland.
Sie reden über
aktuelle Herausforderungen für das Verhältnis
von Kirche und Arbeitswelt. Zum Abschluss folgt
eine Einladung zu einem informellen Ausklang mit
einem kleinen Imbiss – daher ist eine Anmeldung
bis zum 21. November unter laboratorium@ekir.de
oder Mobil: 0179 758 7289 erforderlich, der
Eintritt ist frei.
Zu der Veranstaltung
lädt das „laboratorium“ der Evangelischen
Kirchenkreise Dinslaken, Duisburg, Moers und
Wesel herzlich ein. Die Kreissynoden der fünf
Kirchenkreises hatten 1992 den Kirchlichen
Dienst in der Arbeitswelt Duisburg-Niederrhein
geschaffen. Er sollte dazu beitragen, das
sozialethische Profil der Kirchen am Niederrhein
zu schärfen und sie glaubwürdig an den Nöten,
Sorgen und Hoffnungen vieler Menschen in dieser
vom Strukturwandel getroffenen Region teilhaben
zu lassen.
Die Idee für ein kleines,
fokussiertes Bildungsprogramm, um die
öffentliche Diskussion über gegenwärtige
Herausforderungen in der Region zu bereichern
und dazu eigene Kooperationsformen zu
entwickeln, führte 2010 zur Gründung des
„laboratorium“. Seit dem ist das „laboratorium“
in einem regionalen Netzwerk mit vielfältigen
Kooperationspartnern und Akteuren als
Einrichtung der politischen Bildung tätig und
hat sich als eigenständige protestantische
Stimme im öffentlichen Diskurs in der
Arbeitswelt und in der Gesellschaft etabliert.
Mit dem Jahresprogramm 2025 wir das
„laboratorium“ mit Auslaufen des
Kooperationsvertrages zwischen den
Kirchenkreisen Dinslaken, Duisburg, Moers und
Wesel eingestellt.
Dinslaken:
„Baugrundsondierung im Vorfeld von Kanalneubau
Hülsemannshof, Rolandstraße und Kanzlerstraße:
Emschergenossenschaft und Lippeverband führen im
November Bohrungen durch
Zur
Vorbereitung von Kanalbaumaßnahmen in den
Bereichen Hülsemannshof, Rolandstraße und
Kanzlerstraße lassen die
Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft
und Lippeverband (EGLV) in Abstimmung mit der
Stadt Dinslaken vorlaufende
Baugrunduntersuchungen durchführen.
Diese finden zwischen dem 10. und dem 21.
November statt. EGLV bitten um Verständnis. Der
ungefähre Zeitplan ist wie folgt aufgeteilt: In
der Straße Hülsemannshof sollen die Sondierungen
voraussichtlich am 10. und 11. November
stattfinden, in der Rolandstraße vom 11. bis 18.
November und in der Kanzlerstraße vom 17. bis
zum 21. November. Der eigentliche Ersatz der
vorhandenen Trennsysteme beginnt voraussichtlich
im zweiten Halbjahr 2026.
Bei den drei
Maßnahmen Hülsemannshof, Rolandstraße und
Kanzlerstraße verlegen Emschergenossenschaft und
Lippeverband im Rahmen einer
wasserwirtschaftlichen Kooperation mit der Stadt
Dinslaken insgesamt rund 1.800 Meter an
Kanalrohren (900 Meter Regenwasserkanäle und 900
Meter Schmutzwasserkanäle) bei Innendurchmessern
der Rohre zwischen zirka 20 und 40 Zentimetern.
Über den Beginn dieser eigentlichen
Maßnahmen werden Emschergenossenschaft und
Lippeverband rechtzeitig informieren.“
Zur Kooperation: Die
Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft
und Lippeverband (EGLV) haben gemeinsam mit der
Stadt Dinslaken im Januar 2024 eine
Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.
Gegenstand der Vereinbarung ist die Koordination
und Kooperation bei der Durchführung
wasserwirtschaftlicher Maßnahmen aus dem
Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) auf dem
Stadtgebiet. Dazu zählen Kanalisationsmaßnahmen,
ökologische Gewässerumbaumaßnahmen sowie
Abkopplungsmaßnahmen im Bereich städtischer
Liegenschaften.
EGLV setzen die Projekte
in Abstimmung mit der Stadt Dinslaken planerisch
und baulich um. Nach Abschluss der Maßnahmen
werden die Anlagen betriebsbereit an die Stadt
Dinslaken übergeben. Emschergenossenschaft und
Lippeverband Emschergenossenschaft und
Lippeverband (EGLV) sind öffentlich-rechtliche
Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee
des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip
leben.
Die Aufgaben der 1899 gegründeten
Emschergenossenschaft sind unter anderem die
Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung
und -reinigung sowie der Hochwasserschutz. Der
1926 gegründete Lippeverband bewirtschaftet das
Flusseinzugsgebiet der Lippe im nördlichen
Ruhrgebiet und baute unter anderem den
Lippe-Zufluss Seseke naturnah um.
Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und
Lippeverband rund 1.800 Beschäftigte und sind
Deutschlands größter Abwasserentsorger und
Betreiber von Kläranlagen und Pumpwerken (rund
782 Kilometer Wasserläufe, rund 1533 Kilometer
Abwasserkanäle, 544 Pumpwerke und 59
Kläranlagen). www.eglv.de
Wesel: Verlegung der Marktstände des
Großen Marktes anlässlich des Adventsmarktes am
29.11.2025
Aufgrund des
Adventsmarktes werden die Markthändler des
Großen Marktes am Samstag, 29.November 2025, auf
die Dimmerstraße und auf den Kornmarkt
ausweichen.
Neu_Meerbeck:
Kreispolizei informiert kostenlos zur
Kriminalprävention
Wie man sich am besten vor
Trickdiebstahl, dem Enkeltrick, Schockanrufen
oder ‚falschen Polizeibeamten‘ schützt, darüber
informiert im Rahmen des Stadtteiltreffs
Neu_Meerbeck Richard Devers,
Kriminalhauptkommissar der Kriminalprävention
Wesel.
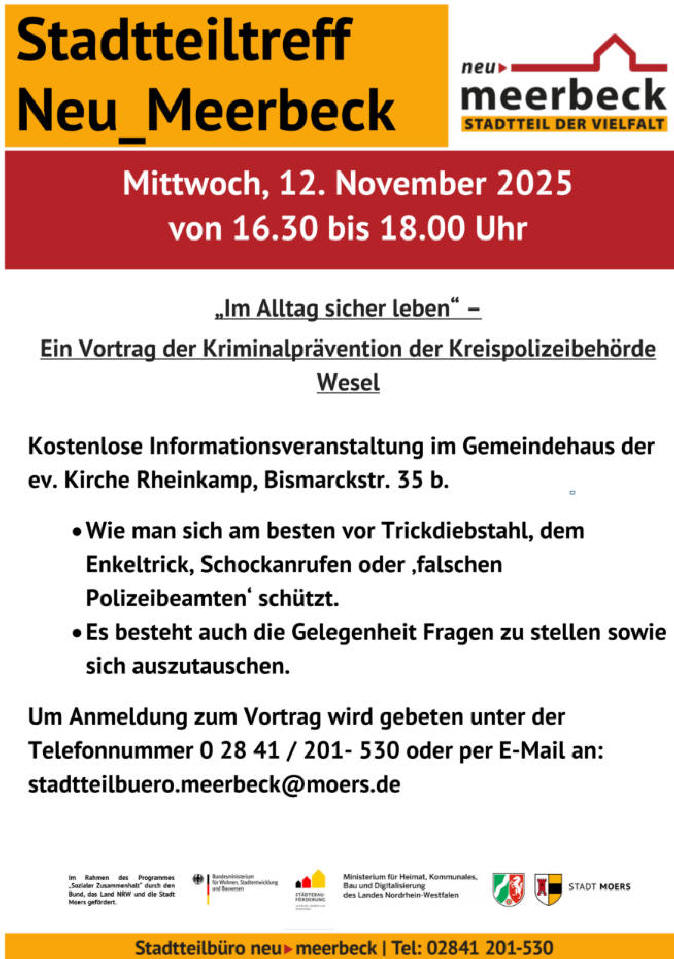
Es besteht auch Gelegenheit, Fragen zu
stellen sowie sich auszutauschen. Die
Veranstaltung ist kostenlos. Veranstaltungsdatum
12.11.2025 - 16:30 Uhr - 18:00 Uhr.
Veranstaltungsort Bismarckstraße 35b, 47443
Moers. Veranstaltungsort Gemeindehaus der ev.
Kirche Rheinkamp.
Dinslaken:
Geänderte Öffnungszeiten wegen
Personalversammlung am Dienstag, 11.11.
Wegen der jährlichen Personalversammlung
sind die Dienststellen der Dinslakener
Stadtverwaltung am Dienstag, 11. November 2025,
für den Publikumsverkehr nur bis 12 Uhr
geöffnet. Das gilt auch für Bürgerbüro,
Stadtbibliothek, Archiv, Stadtinformation und
Wertstoffhof. Die Stadtverwaltung bittet um
Verständnis.
1.
Bastelwerkstatt „Dekozauber“ für Kinder ab 4
Jahren
Sterne, Engel, Rentiere und
andere Kleinigkeiten zur vorweihnachtlichen
Dekoration können an diesem Nachmittag gebastelt
werden. Hinweis Eine vorherige Anmeldung ist
erforderlich, für das Material wird ein
Kostenbeitrag von 2€ erhoben.
Nähere
Infos und Anmeldung unter Telefon: 0 28 41 /
201-751, unter jubue@moers.de oder
direkt in der Bibliothek Moers.
Veranstaltungsdatum 13.11.2025 - 15:00
Uhr - 16:00 Uhr. Veranstaltungsort
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 47441 Moers.
Moers: Spieleabend
Du
hast Lust mal wieder zu zocken? Aber nicht am
PC, sondern gemütlich bei uns in der Kneipe?
Dann komm zu unserem offenen Spieleabend. Egal
ob Brett-, Karten- oder Rollenspiele – Hier bist
du richtig! Als Spieleerklärer und Tippgeber
steht euch unser Spiele-Experte Nöh mit Rat und
Tricks zur Seite! Veranstaltungsdatum 13.11.2025
- 19:00 Uhr - 22:30 Uhr. Veranstaltungsort Zum
Bollwerk 107. 47441 Moers.
18.
Moerser Tanznacht
Moerser Tanznacht
geht weiter!
Am 14. November ab 19
Uhr laden wir euch herzlich ein, gemeinsam zu
tanzen, zu feiern und eine Nacht voller
pulsierender Rhythmen zu erleben – im
enni.sportpark rheinkamp. Was euch erwartet:
Tanzspaß pur: Discofox-Workshop gefolgt vom
kostenlosen Free-Style auf den Beats der Nacht
DJ-Sets mit frischen Hits, die zum Durchtanzen
einladen Eine Atmosphäre, die gute Laune und
neue Moves ganz natürlich entstehen lässt.

Ab 19 Uhr: Discofox-Tanzkurs für jedermann
Ab 20 Uhr: offene Tanznacht
Eintritt: 5
Euro Mindestverzehr: 10 Euro Tickets sichern
unter: https://esn-eg.de/events/18.moerser-tanznacht.html
Veranstaltungsdatum 14.11.2025 - 19:00
Uhr - 15.11.2025 - 00:00 Uhr. Veranstaltungsort:
ENNI Sportpark Rheinkamp. Am Sportzentrum 5,
47445 Moers.
Moers: Das Kriminal
Dinner - Krimidinner für Jung und Alt
Teilen Sie auch diese
Leidenschaft für spannende Krimis und
kulinarische Highlights? Dann freuen Sie sich
auf ein spannendes Krimidinner! Lassen Sie den
Alltag hinter sich und genießen Sie einen
Streifzug durch die einzigartige Küche der
Region umrahmt von einem packenden Live-Krimi!

Werden Sie zum Meisterdetektiv /
Meisterdetektivin und erleben Sie einen
unvergleichlichen Krimidinner Abend!
Veranstaltungsdatum 14.11.2025 - 19:00
Uhr - 22:00 Uhr. Veranstaltungsort Hotel Moers
van der Valk, Adresse Krefelder Straße 169,
47447 Moers.
Puppentheater auf
dem Moerser Weihnachtsmarkt
An geänderte
Vorstellungszeiten gewöhnen müssen sich ab
diesem Jahr die Fans der Homberger Kasperbühne
auf dem Moerser Weihnachtsmarkt. Damit passt
sich das Puppentheater an veränderte
Besuchsgewohnheiten seiner Gäste an. Insgesamt 6
spannende Puppenspiele gibt es zu erleben, wenn
in diesem Jahr das Puppentheater auf dem
Kastellplatz von Freitag, 14. November, bis
Montag, 22. Dezember, zu Gast sein wird.
Puppenspieler Gebhard Cherubim (68) ist
bereits zum 37. Mal mit seinem Kindertheater auf
dem Moerser Weihnachtsmarkt vertreten. Die etwa
30minütigen Vorstellungen beginnen im beheizten
Theaterzelt auf dem Kastellplatz an
den Wochentagen jetzt immer um 16, 17 und 18
Uhr. Samstags und sonntags wird jeweils von 13
bis 18 Uhr zu jeder vollen Stunde gespielt. Der
Eintritt beträgt 6 Euro pro Person.

Immer samstags wechselt das Programm, so dass in
jeder Woche ein anderes Stück zu sehen ist.
"Kasper und das Krokodil vom Nil" heißt es zu
Beginn. Eigentlich wollte Kasper ja einen
Zoobesuch mit den Kindern machen. Doch daraus
wird leider nichts mehr, weil das Krokodil aus
seinem Gehege entwischt ist und ganz
Kaspershausen in Angst und Schrecken versetzt.
Zudem muss auch noch die ahnungslose
Prinzessin Siebenschön samt ihrem
Lieblings-Schäfchen Wuschel vor dem hungrigen
Großmaul in Sicherheit gebracht werden. Alles in
allem jede Menge Arbeit und Action für Kasper
und seine kleinen Zuschauer und Zuschauerinnen.
"Kasper und der Tortengeist" sorgt dann in der
folgenden Woche für Spaß und Spannung im
Puppentheater.
Kasper ist ganz
aufgeregt, weil seine Freundin Gretel ihn zu
ihrem Geburtstag eingeladen hat. Nur zu dumm,
dass auch Kaspers frecher Hund Struppi, eine
diebische kleine Maus und der stets hungrige
Räuber Raffzahn Wind vom geplanten
Geburtstagsessen bekommen. So landet das
köstliche Festmahl denn auch prompt in den
falschen Bäuchen.
Das lässt Kasper natürlich
nicht lange auf sich sitzen und zahlt es den
drei frechen Leckermäulern mit einer List so
richtig heim. “Kasper und der verschwundene
Ball" heißt dann die Produktion in der 3.
Spielwoche. Kasper zeigt den Kindern stolz
seinen neuen Ball. Als er aber damit spielt,
fliegt der Ball über die Gartenmauer geradewegs
in den Hexenkessel der Hexe Wackelzahn, die
darin gerade einen neuen Zaubertrank zum
unsichtbar werden zusammenbraut.
Zwar
gibt sie dem Kasper den Ball zum Glück zurück.
Doch der am Ball noch klebende Rest des
Zaubertrankes, von Kaspers Hund Struppi
abgeleckt, sorgt mit einem plötzlich
unsichtbaren Vierbeiner für reichlich
Verwirrung. „Kasper und der falsche
Polizist“ sorgt in der folgenden Woche für
reichlich Verwirrung in Kaspershausen. Denn
ausgerechnet Räuber Raffzahn findet eben jene
Dienstmütze, die kurz zuvor der Wachtmeister
verloren hat.
Wie er damit, als falscher
Polizist verkleidet, Kaspers Großmutter um deren
Würstchen bringt, die sie für Kasper und Struppi
gekauft hat, und wie Kasper dem Betrug auf die
Schliche kommt und das Würstchenessen rettet,
erzählt dieser turbulente Puppenspaß. “Kasper
und das Einhorn” bringt sodann eine märchenhafte
Atmosphäre ins kleine Weihnachtstheater.
Dabei muss Kasper den vorwitzigen Seppel
retten. Der nämlich will einen schönen
Weihnachtsbaum im Wald absägen, was indes dem
Waldgeist als Hüter des Waldes gar nicht
gefällt. Kurzerhand verwandelt er den armen
Seppel zur Strafe in ein Einhorn. Allein eine
Wunderblume, streng bewacht von der Hexe
Wackelzahn, kann Seppel wieder erlösen. So muss
es schließlich Kasper wieder richten, damit zum
guten Schluss einem schönen Weihnachtsfest
nichts mehr im Wege steht.
"Kasper und
der Weihnachtshase" können die Kinder dann in
der letzten Woche auf dem Kastellplatz erleben.
Verkehrte Weihnachtswelt sollte man meinen, denn
Kasper begegnet zu seiner großen Überraschung
dem Osterhasen an Weihnachten. Ostereier statt
Weihnachtskugeln? Wer oder was steckt dahinter
und, vor allem, wo bleibt denn bloß der
Weihnachtsmann?
Gruppen aus
Kindergärten, Schulen oder Vereinen oder auch
Kindergeburtstage haben die Möglichkeit zu einem
Gruppenbesuch nach telefonischer Voranmeldung
zum ermäßigten Preis von nur 5 Euro pro Person.
Dies gilt sowohl für die täglich angesetzten
Vorstellungen, als auch außerhalb der regulären
Vorstellungszeiten in den Vormittagsstunden. Das
Theaterzelt verfügt über ausreichend Sitzplätze,
so dass Einrichtungen mit bis zu drei Gruppen
bzw. Schulen mit drei bis vier Klassen in einer
Vorstellung problemlos Platz finden.
Der
Moerser Weihnachtsmarkt hat täglich ab den
Mittagsstunden geöffnet, weshalb der
vormittägliche Besuch einer vorab gebuchten
Sondervorstellung auch gut mit einem Gang über
den Markt kombinierbar ist. Reservierungen für
geschlossene Gruppen werden unter Telefon: 0171
/ 4 16 33 04 jederzeit gerne entgegengenommen.
Weitere Informationen über das
Puppentheater finden sich auch im Internet
unter: www.pommispuppen.com.
Veranstaltungsdatum 14.11.2025 - 16:00
Uhr - 22.12.2025 - 18:00 Uhr .
Veranstaltungsort Kastellplatz, 47441 Moers.
Veranstaltungsort Moerser Weihnachtsmarkt.
Moers: Der Frieden
nach Aristophanes
und Antoine Vitez - Deutsch von Claus Bremer,
Hartmut Kirste und Lothar Sprees
In
"Der Frieden" ist der Krieg nichts Neues, er ist
nach 13 Jahren zum Alltag geworden. Der
Weinbauer Trygaios macht sich auf den Weg, von
den Göttern im Olymp Antworten zu verlangen,
doch die haben sich aus Enttäuschung über die
Menschen längst verabschiedet. Bis auf den Gott
des Krieges, der nun freie Bahn für eine
potenzielle Alleinherrschaft hat.

Intendant und Regisseur Daniel Kunze geht in
seiner ersten Inszenierung am Schlosstheater der
alten, aber dennoch unbeantworteten Frage nach,
warum Menschen sich bekriegen.
Eintritt: 22
Euro, ermäßigt 8 Euro Tickets unter Telefon: 0
28 41 / 88 34-110 oder www.schlosstheater-moers.de
Veranstaltungsdatum 14.11.2025 - 19:30
Uhr - 21:30 Uhr. Veranstaltungsort
Schlosstheater - Schloss. Kastell 9, 47441
Moers.
Moers: Song Slam
Songwriter und Songwriterinnen, ein Moderator
und ein Publikum - mehr braucht es nicht für
einen guten Abend. Ein gemütliches
Wohnzimmerkonzert, bei dem die Wärme
selbstgemachter Musik auf den harten Wettbewerb
des Slams trifft. Die Regeln folgen der
Tradition des Poetry Slam: jede Musikerin /
jeder Musiker versucht mit selbstgeschriebenen
Liedern in begrenzter Zeit die Herzen des
Publikums zu erobern.
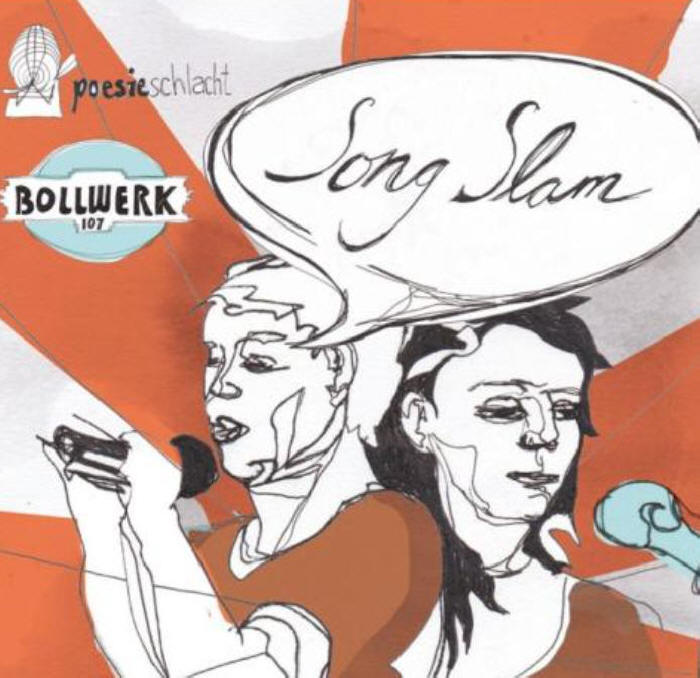
Das Publikum stimmt für seine Favoriten ab und
stellt sich so über mehrere Runden sein
Lieblingskonzert selbst zusammen. Gefördert
durch das Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und
SozioKultur NRW.
Veranstaltungsdatum
14.11.2025 - 20:00 Uhr - 22:30 Uhr.
Veranstaltungsort Zum Bollwerk 107, 47441 Moers.
Veranstalter Jugend-Kultur-Zentrum 'Bollwerk
107.
Männergesundheit im Fokus -
Vortrag „Muskelentspannung auf Fingerdruck“ am
17. November 2025 um 14:00 Uhr im Rathaus der
Stadt Wesel
Im Rahmen des
Internationalen Männertages lädt die
Gleichstellungsstelle der Stadt Wesel zu einem
informativen Vortrag zum Thema
„Muskelentspannung auf Fingerdruck“ ein. Am
Montag, 17. November 2025, 14:00 Uhr, referiert
Peter Jedamski, Therapeut für die
EMMETT-Technik, im Ratssaal der Stadt Wesel.
Muskelverspannungen sind ein
weitverbreitetes Problem, mit dem viele Menschen
zu kämpfen haben. Stress, falsche Haltung oder
körperliche Überlastung können dazu führen, dass
sich Muskeln verhärten und Schmerzen
verursachen. Eine weniger bekannte, aber
wirkungsvolle Methode zur Entspannung der
Muskulatur ist die EMMETT-Technik.
Diese
achtsame Methode zur Muskelentspannung nutzt
gezielten Druck auf spezifische Punkte, löst
Verspannungen, lindert Schmerzen und verbessert
die Beweglichkeit. Der Therapeut sendet über das
Faszien- und Bindegewebe Impulse an das Gehirn,
um Blockaden zu lösen und das
Körpergleichgewicht wiederherzustellen.
Die EMMETT-Technik ist für Menschen jeden Alters
geeignet und kann oft kurzfristig Verspannungen
entgegenwirken. Damit bietet diese Technik eine
hilfreiche Möglichkeit, das allgemeine
Wohlbefinden zu fördern. Der Vortrag ist
kostenlos und dauert etwa eine Stunde.
Dieser Vortrag richtet sich ausschließlich an
Männer. Zur besseren Planung melden sich
Interessierte bitte verbindlich bis zum 13.
November 2025 per Mail unter gleichstellung@wesel.de an.

NRW: Zahl der
Abschlussprüfungen in der dualen Ausbildung auf
historischem Tiefststand
* Zahl der
Prüfungsteilnahmen sank im Zehnjahresvergleich
um knapp 21 %.
* Grund sind weniger neue und
mehr vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge.
* Fast neun von zehn Abschlussprüfungen wurden
bestanden.
Im Jahr 2024 wurden rund
85.800 Abschlussprüfungen im dualen System in
NRW abgelegt. Wie das Statistische Landesamt
mitteilt, lag die Zahl der Abschlussprüfungen
damit auf einem historischen Tiefststand: Seit
Beginn der Erhebung der Berufsbildungsstatistik
im Jahr 1976 haben noch nie so wenige duale
Auszubildende an einer Abschlussprüfung
teilgenommen wie im Jahr 2024.
Im Jahr
2014 hatten noch rund 108.100 Auszubildende ihre
Abschlussprüfung absolviert. Damit sank die Zahl
der Prüfungsteilnahmen im Zehnjahresvergleich um
20,7 %. Im Vergleich zum Jahr 2023 hat die Zahl
der Prüfungsteilnahmen um 3,4 % abgenommen.
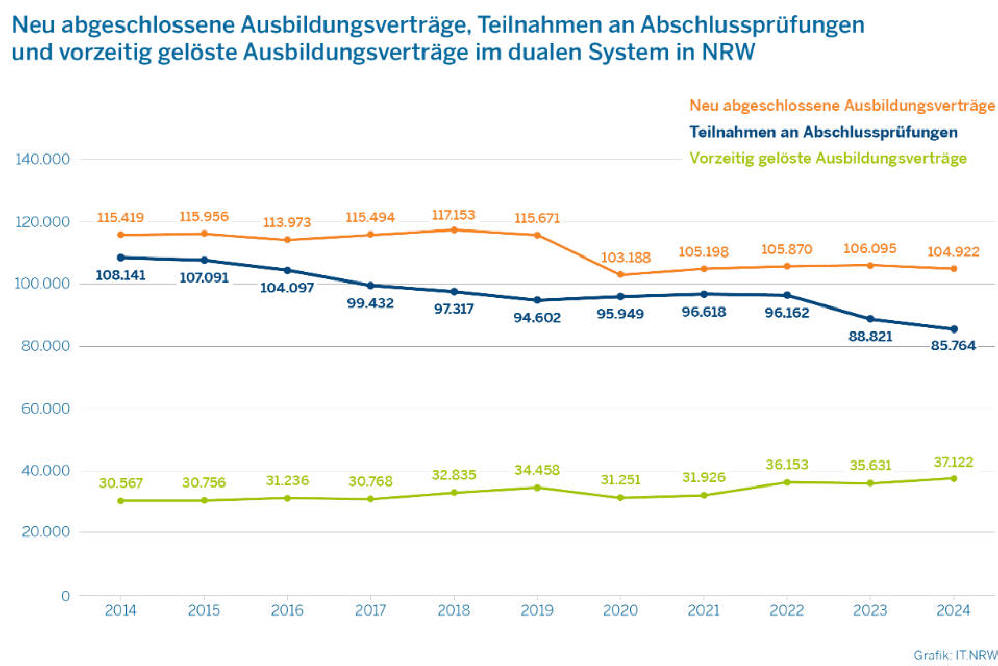
Weniger Abschlussprüfungen aufgrund weniger
neuer Azubis und mehr vorzeitig gelöster
Ausbildungsverträge
Die rückläufige
Entwicklung der Abschlussprüfungen ist zum Teil
dadurch bedingt, dass die Zahl der neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträge während der
Corona-Pandemie stark gesunken war. Im Jahr 2020
hatten knapp 103.200 neue Azubis eine duale
Ausbildung begonnen und damit rund 10,8 %
weniger als im Jahr zuvor. In den Jahren nach
2020 blieb die Zahl der neuen
Ausbildungsverträge nahezu unverändert.
Da eine duale Ausbildung in der Regel drei bis
dreieinhalb Jahre dauert, beendeten diese
schwächer besetzten Corona-Jahrgänge ihre
Ausbildung größtenteils in den Jahren 2023 und
2024. Neben dem Rückgang der neuen
Ausbildungsverträge im dualen System war in den
letzten Jahren ein Anstieg der Zahl der
vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge zu
verzeichnen.
Im Jahr 2024 wurden über
37.100 Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst; das
waren 21,4 % mehr vorzeitige Lösungen als 2014
und der Höchststand im Zehnjahresvergleich. Eine
Vertragslösung kann ein endgültiger Abbruch der
Berufsausbildung sein oder bedeuten, dass die
Ausbildung in einem anderen Ausbildungsbetrieb
oder in einem anderen Ausbildungsberuf
fortgesetzt wird. Dies kann sich entsprechend
auf die Zahl der Abschlussprüfungen in den
einzelnen Berichtsjahren auswirken.
Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen blieb im
Zehnjahresvergleich stabil
Von den rund
85.800 Abschlussprüfungen im Jahr 2024 wurden
über 75.500 erfolgreich bestanden. Damit lag der
Anteil der bestandenen Abschlussprüfungen an
allen Abschlussprüfungen, die sogenannte
Erfolgsquote, bei 88,1 %. Die Erfolgsquote ist
in den letzten zehn Jahren nahezu konstant
geblieben: Im Jahr 2014 waren 89,2 % der
Prüfungen erfolgreich abgeschlossen worden. Mit
90,4 % war die höchste Erfolgsquote im Jahr 2019
erreicht worden.
17,8 % weniger
Fortzüge in die USA von Januar bis September
2025 als im Vorjahreszeitraum
•
Zahl der Zuzüge aus den USA im selben Zeitraum
um 3,4 % gestiegen
• 3,2 % weniger
Übernachtungsgäste aus den USA hierzulande von
Januar bis August 2025 als im Vorjahreszeitraum
• Zahl der Flugpassagiere mit Reiseziel USA
von Januar bis September 2025 um 1,3 % gegenüber
Vorjahreszeitraum gesunken
Seit Anfang
des Jahres sind weniger Menschen aus Deutschland
in die USA fortgezogen. Von Januar bis September
2025 gab es 17,8 % weniger Fortzüge in die USA
als im Vorjahreszeitraum. Rund 17 100 Fortzüge
in die USA wurden bis einschließlich September
dieses Jahres in Deutschland von den
Meldebehörden registriert, wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger
Wanderungszahlen mitteilt.
Von Januar
bis September 2024 waren es rund 20 800 Fortzüge
von Deutschland in die USA. In den ersten neun
Monaten des laufenden Jahres waren die Fortzüge
in die USA auf dem tiefsten Stand seit dem von
Reisebeschränkungen geprägten Pandemiejahr 2021.
Zudem lag die Zahl der Fortzüge 2025 in jedem
Monat unter der des jeweiligen Vorjahresmonats.
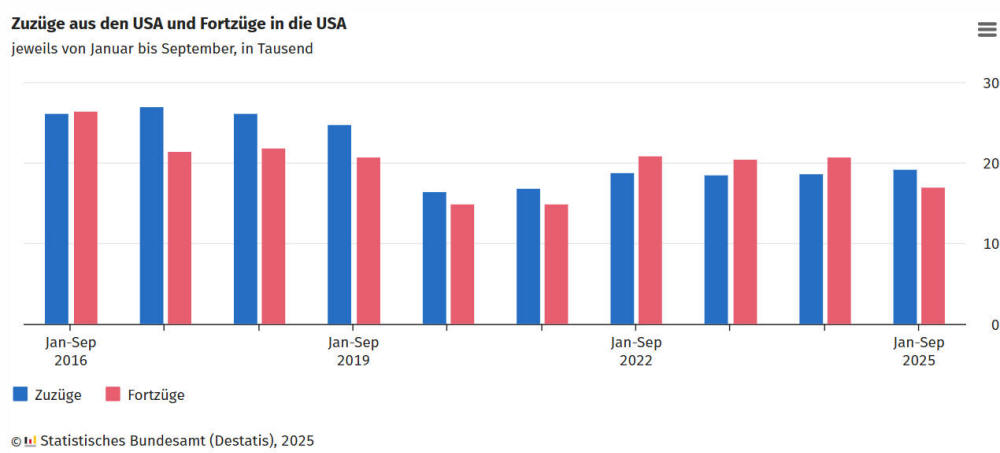
Von Januar bis September mehr Menschen aus
den USA nach Deutschland gezogen als umgekehrt –
erstmals seit 2021
Die Zahl der Zuzüge aus
den USA ist dagegen leicht gestiegen. Sie lag
von Januar bis September 2025 bei gut 19 300 und
damit 3,4 % höher als im Vorjahreszeitraum mit
knapp 18 700 Zuzügen. Damit sind erstmals seit
2021 in den ersten neun Monaten des Jahres 2025
mehr Menschen aus den USA nach Deutschland
gezogen als umgekehrt.
Zahl der
Übernachtungsgäste aus den Vereinigten Staaten
zurückgegangen
Seit Anfang 2025 sind zudem
weniger Touristinnen und Touristen aus den USA
nach Deutschland gekommen. Von Januar bis August
dieses Jahres wurden hierzulande 1,96 Millionen
Ankünfte von Gästen aus den USA verzeichnet. Das
war ein Rückgang von 3,2 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum (2,02 Millionen Ankünfte).
Zum Vergleich: Die Zahl der Gäste aus dem
In- und Ausland insgesamt stieg in der Zeit von
Januar bis August 2025 gegenüber dem
Vorjahreszeitraum an – um 0,7 % auf 128,4
Millionen. Besonders deutlich fielen die
Rückgänge in den Besuchszahlen in den
Sommermonaten dieses Jahres aus.
Im Juli
2025 kamen mit 345 000 Gästen aus den USA 10,2 %
weniger als im Vorjahresmonat. Im Juni 2025 lag
die Zahl der Gäste aus den USA bei 346 000 und
damit 9,1 % unter der vom Juni 2024. Die Zahl
der Gäste aus dem In- und Ausland in Deutschland
insgesamt lag im Juli 2025 um 0,9 % unter der
des Vorjahresmonats, im Juni 2025 um 2,8 %
darüber.
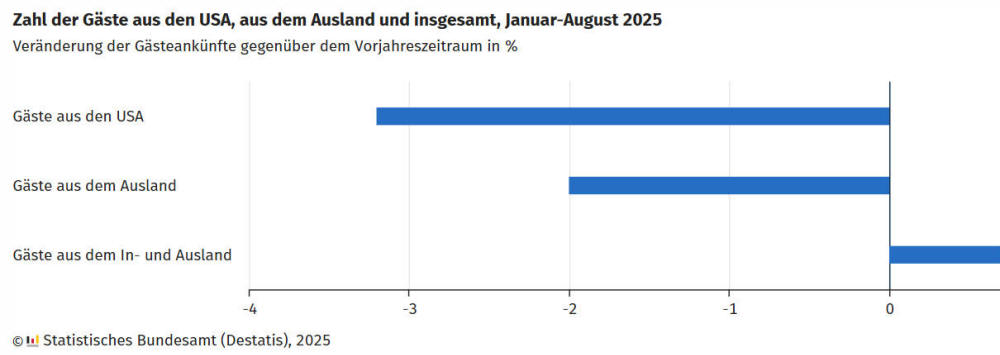
Etwas weniger Passagiere
fliegen in die USA
An deutschen Flughäfen
stiegen im Zeitraum Januar bis September dieses
Jahres 1,3 % oder rund 67 200 weniger Fluggäste
mit dem letztbekannten Streckenziel USA ein als
im Vorjahreszeitraum. Im selben Zeitraum ist die
Zahl der Fluggäste mit einem anderen
außereuropäischen Ziel um 4,3 % gestiegen.
Mit rund 5,0 Millionen Fluggästen in der Zeit
von Januar bis September 2025 lagen die USA
immer noch auf Platz 1 der beliebtesten
außereuropäischen Ziele von deutschen Flughäfen
aus – vor Ägypten mit 1,6 Millionen Fluggästen.
Moers: Vortrag über den Dalai
Lama am 19. November
Das
spirituelle Oberhaupt aller Tibeter, der Dalai
Lama, ist in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden.
Ein Vortrag der vhs Moers – Kamp-Lintfort am
Mittwoch, 19. November, beleuchtet die Rolle des
Dalai Lama im Verlauf jahrhundertealter
tibetischer Geschichte. Diese ist geprägt von
wechselnden Phasen relativer Unabhängigkeit und
chinesischer Unterdrückung.
Allerdings
verfolgt China seit den 50er Jahren eine
antitibetische Politik, der tausende Tibeter im
Widerstand zum Opfer fielen. Der Vortrag geht
auch auf die Funktion des Dalai Lama in diesem
Konflikt ein. Er beginnt um 19 Uhr im Alten
Landratsamt in Moers, Kastell 5b. Infobox Eine
vorherige Anmeldung ist telefonisch unter 0 28
41/ 201 – 565 oder online unter www.vhs-moers.de möglich.
IMK:
Stabilisierung des Rentenniveaus ist
generationengerecht und finanzierbar
Die Stabilisierung des Rentenniveaus
ist sozialpolitisch notwendig,
generationengerecht und finanziell tragbar.
Gerade mit Blick auf Generationengerechtigkeit
sollte eine Stabilisierung auf Dauer angelegt
sein und nicht nur bis 2031, wie es der aktuelle
Gesetzesentwurf der Bundesregierung vorsieht.
Zusätzlich brauche es eine bessere Verzahnung
aus Renten- und Arbeitsmarktpolitik, um
ungenutzte Potenziale für eine stärkere
Erwerbsbeteiligung zu erschließen.
Das
betont Dr. Ulrike Stein, Rentenexpertin des
Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung in einer Stellungnahme für
die heutige Expert*innenanhörung im Ausschuss
für Arbeit und Soziales des Deutschen
Bundestags.*
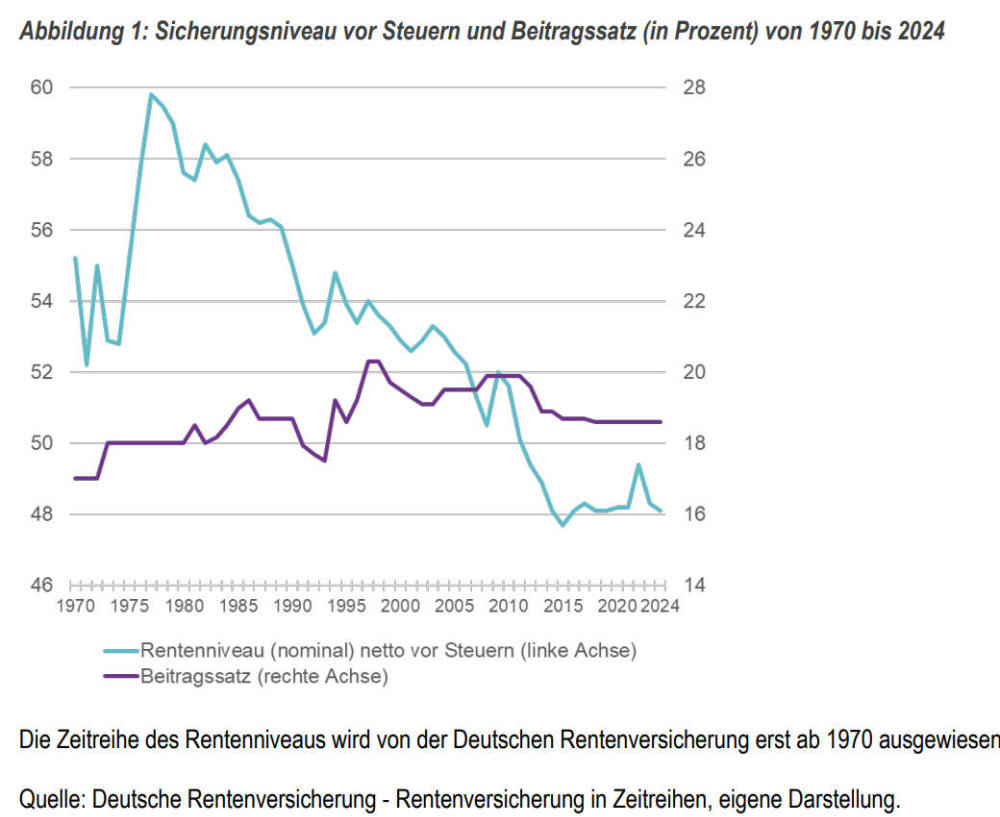
„Ein stabiles Rentenniveau ist entscheidend
für die Sicherung des Lebensstandards und stärkt
das Vertrauen in die gesetzliche
Rentenversicherung – über Generationen hinweg“,
so Stein. „Unsere Analysen zeigen: Von der
Stabilisierung profitieren Jung und Alt
gleichermaßen, jüngere Generationen werden nicht
benachteiligt.“
Eine aktuelle
IMK-Studie** zeigt detailliert, dass eine
langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus,
wie sie im gescheiterten Rentenpaket II der
Ampelkoalition vorgesehen war, für Menschen
aller Geburtsjahrgänge zwischen den 1940ern und
2010 die interne Rendite der gesetzlichen Rente
erhöht. Das heißt: Alle heute Erwerbstätigen
sowie junge Menschen, die aktuell kurz vor
Eintritt ins Berufsleben stehen und ein
wesentlicher Teil der heutigen Rentner*innen
erhalten durch eine Stabilisierung im Verhältnis
zu ihren Beiträgen überproportional mehr Rente
(Link zur Studie unten).
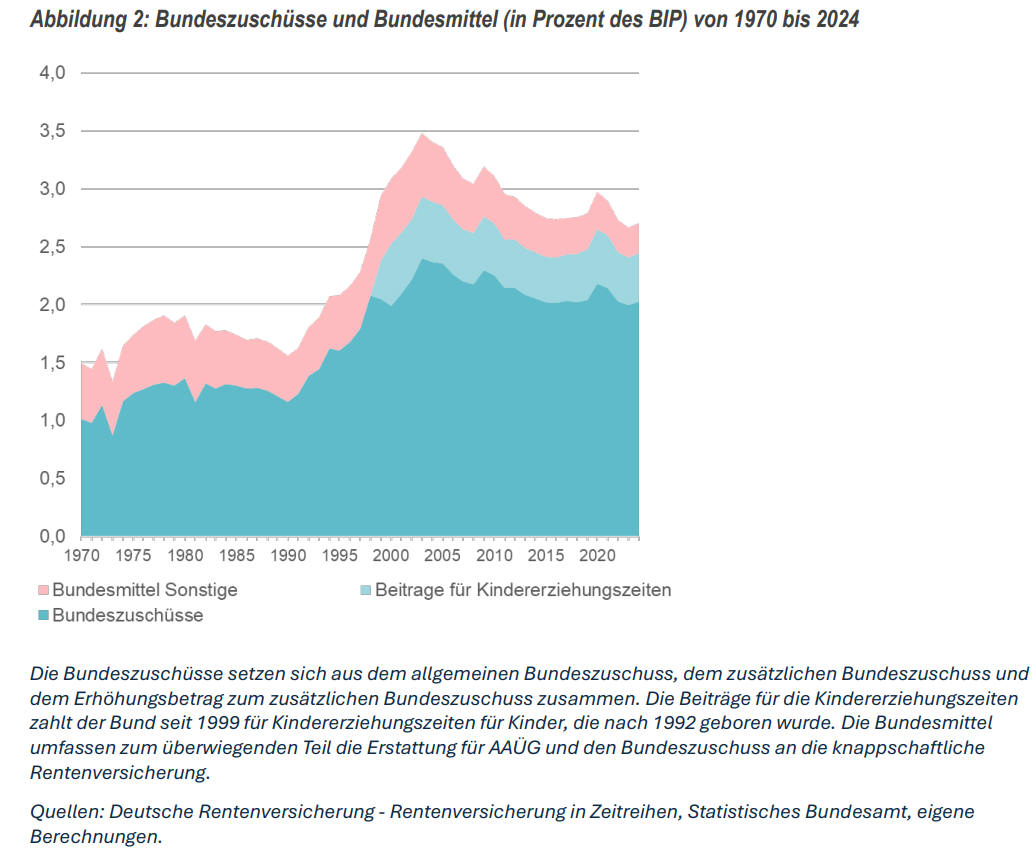
Seit den späten 1970er Jahren ist das
Rentenniveau von knapp 60 Prozent auf rund 48
Prozent gesunken, wo es nach dem Gesetzentwurf
bis 2031 stabilisiert werden soll, zeigt Steins
Analyse. Der Beitragssatz zur gesetzlichen
Rentenversicherung hat sich dagegen seit 1970
lediglich von 17 auf 18,6 Prozent erhöht.
Stein betont, dass ein weiter sinkendes
Rentenniveau nicht nur die individuelle
Lebensstandardsicherung vieler Menschen
gefährde, sondern einen wesentlichen Teil der
Kosten für die Allgemeinheit lediglich in die
Grundsicherung verlagern würde. „Eine solide
Haltelinie wirkt der Zunahme von Armutsrisiken
entgegen und sorgt dafür, dass die gesetzliche
Rente weiterhin eine tragende Säule des
Sozialstaats bleibt“, so Stein.
Die
Stabilisierung sei zudem grundsätzlich
finanzierbar. Dass sich der Bund im Rahmen des
Rentenpakets 2025 stärker über Steuermittel an
der Finanzierung beteiligen möchte, ist
ebenfalls ein akzeptabler Weg, analysiert die
IMK-Expertin. Seit 2003 ist der Anteil der
Gesamtausgaben des Bundes an der Finanzierung
der Rentenversicherung, gemessen an der
Wirtschaftsleistung, von 3,5 auf 2,7 Prozent des
BIP gesunken – obwohl die Zahl der Altersrenten
um 16 Prozent gestiegen ist.
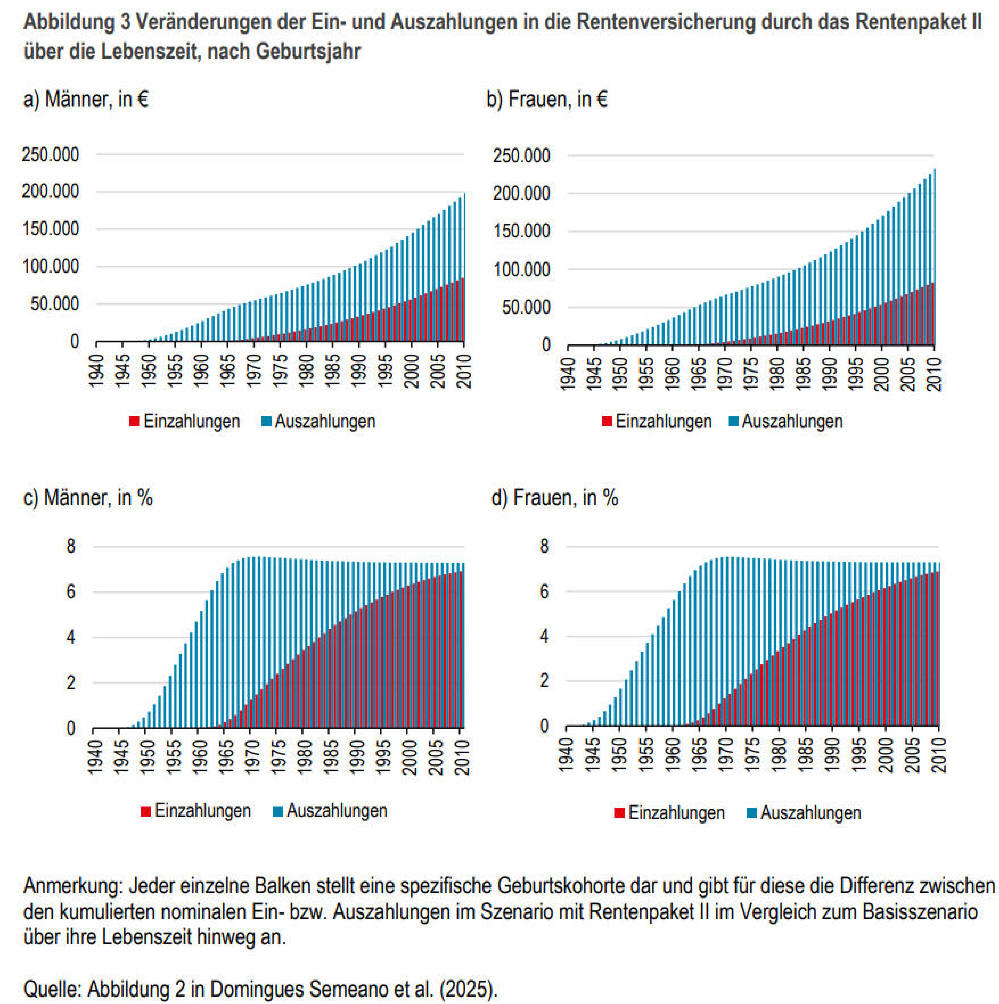
Die Bundeszuschüsse und -mittel dienen dazu,
Leistungen im gesamtgesellschaftlichen Interesse
zu finanzieren, die nicht über Beiträge gedeckt
sind. Dazu zählen etwa Folgekosten der deutschen
Wiedervereinigung. Allerdings decken die
Bundeszuschüsse laut Deutscher
Rentenversicherung die nicht beitragsgedeckten
Leistungen längst nicht vollständig ab; allein
2023 betrug die Finanzierungslücke rund 40
Milliarden Euro. „Die gesetzliche Rente bleibt
finanzierbar – wenn die Politik bereit ist,
ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen
nachzukommen“, so Stein.
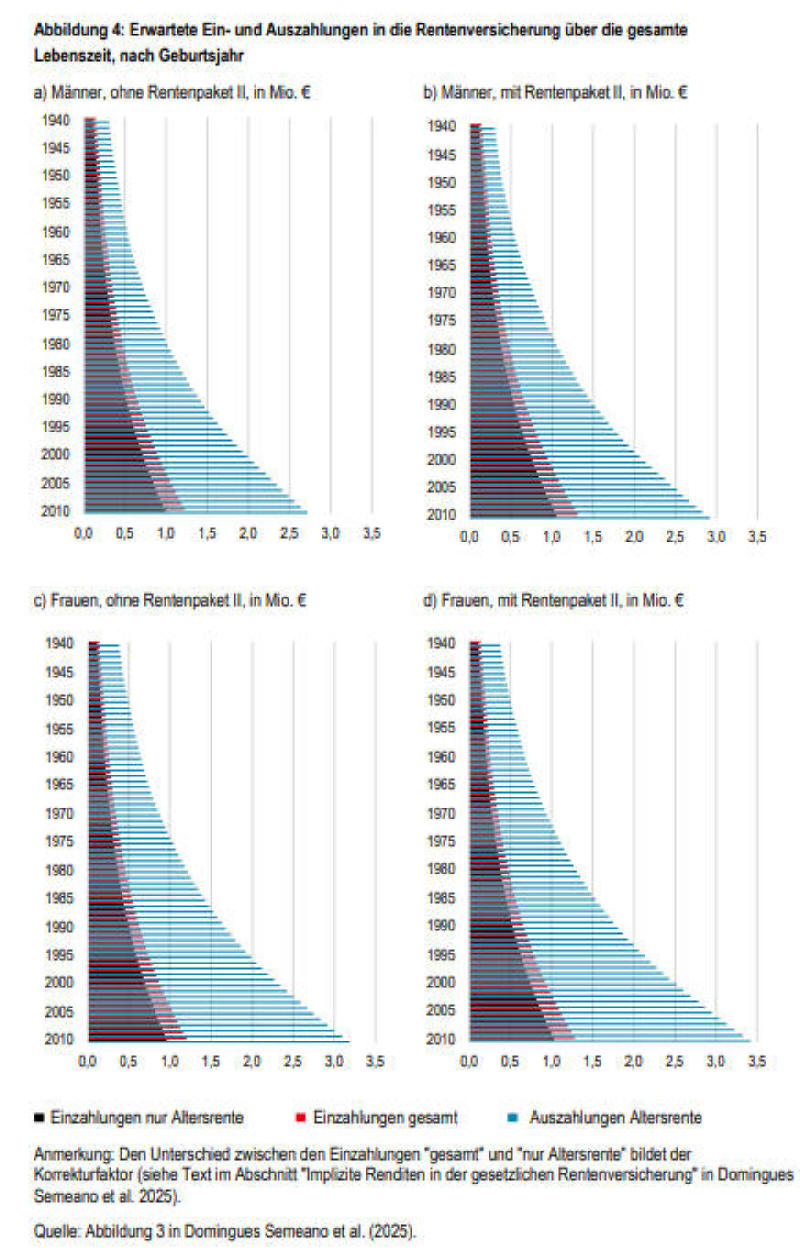
Das Rentenpaket 2025 enthält zudem die
Einführung der Mütterrente III, die eine
vollständige Gleichstellung der
Kindererziehungszeiten vorsieht. Aus
Gerechtigkeitsperspektive ist diese Maßnahme
laut IMK nachvollziehbar. Allerdings ist nach
Einschätzung von Stein der bürokratische Aufwand
hoch, die individuelle Entlastung gering, und
die volkswirtschaftlichen Kosten beträchtlich.
Die Maßnahme koste rund fünf Milliarden Euro,
bringe den Betroffenen aber netto oft nur rund
15 Euro monatlich pro Kind. Das Geld sei in
anderen Bereichen sinnvoller eingesetzt.
Generell bewertet das IMK das Rentenpaket 2025
vor allem wegen der Stabilisierung des
Rentenniveaus als Schritt in die richtige
Richtung. An anderer Stelle scheue die
Bundesregierung in ihrer Rentenpolitik aber vor
einer notwendigen Veränderung der
Schwerpunktsetzung zurück: „Anstatt zu
diskutieren, wie Rentner*innen mit befristeten
Arbeitsverträgen weiterbeschäftigt, die
Regelaltersgrenze erhöht oder teure Anreize zum
Weiterarbeiten (Aktivrente) geschaffen werden
können, sollte der Fokus darauf liegen,
ungenutzte Erwerbspotenziale unter Personen im
erwerbsfähigen Alter besser zu aktivieren“,
schreibt die Forscherin in ihrer Stellungnahme.
Besonders bei Frauen und jungen Menschen
mit niedrigem Bildungsabschluss gebe es
erhebliche Reserven. Stein verweist auf Defizite
im Bildungssystem und Fehlanreize im Steuer- und
Abgabensystem, die eine Ausweitung des
individuellen Arbeitsvolumens behinderten.
Wichtig sei zudem ein besserer Ausbau der
Betreuungsinfrastruktur für Kinder und
Pflegebedürftige. Nur so könnten mehr Menschen –
insbesondere Frauen – ihre Erwerbstätigkeit
ausweiten und die soziale Sicherung langfristig
stabilisieren.
vhs Moers –
Kamp-Lintfort: Zentangle® für Fortgeschrittene
Eine kleine Auszeit von der
hektischen Vorweihnachtszeit verspricht der Kurs
‚Zentangle® für Fortgeschrittene –
Weihnachtsmotive‘ der vhs Moers – Kamp-Lintfort
am Samstag, 29. November.
Diese kreative
Zeichenmethode abstrakter, sich wiederholender
Muster bietet Entspannung und Meditation
zugleich. Der Workshop beginnt um 11 Uhr in den
Räumen der vhs Moers, Wilhelm-Schroeder-Straße
10. Entsprechend der Jahreszeit werden
Weihnachtsmotive gezeichnet.
Das Angebot
richtet sich an alle, die bereits den
Zentangle®- Einsteigerkurs besucht haben bzw.
sicher im Tanglen sind. Infobox Für den Kurs ist
eine vorherige Anmeldung erforderlich, die
telefonisch unter 0 28 41/ 201 565 oder online
unter www.vhs-moers.de möglich
ist.
Kochen und kommunizieren in
Kamp-Lintfort
Die Kulinarischen
Sprach-Tandems der vhs Moers – Kamp-Lintfort in
Kooperation mit der Hochschule Rhein-Waal gehen
in die dritte Runde: Am Dienstag, 2. Dezember,
heißt es in der vhs-Küche in Kamp-Lintfort
wieder ‚Kochen und kommunizieren‘.
Ab 18
Uhr backen diesmal fünf Studierende der
Hochschule, die besser deutsch sprechen möchten,
mit fünf Personen, die gerne ihr Englisch
verbessern möchten.
Beim Plätzchen
backen zum Thema ‚Internationale
Weihnachtsbäckerei‘ ist viel Gelegenheit zum
sprachlichen Austausch. Da die Plätze begrenzt
sind, ist eine rechtzeitige Anmeldung bis zum
25. November erforderlich.
Das letzte
Kulinarische Sprach-Tandem der Reihe findet dann
am 13. Januar statt. Infobox Anmeldungen sind
telefonisch unter 0 28 41 / 201 - 565 und online
unter www.vhs-moers.de möglich.
Hier gibt es auch weitere Infos zu der
Veranstaltung.

Karnevalsauftakt in NRW: Rund 51.500
Menschen feiern am 11.11. Geburtstag
* Seit 2000 wurden rund 10.900 Kinder zum
Karnevalsauftakt geboren.
* Am 11.11.2024
wurden 452 Kinder in NRW geboren.
*
Tagesscharfe Daten ab 2000 für alle Kreise und
kreisfreien Städte im Geburtenkalender NRW.
In Nordrhein-Westfalen dürfen am kommenden
Dienstag schätzungsweise rund 51.500 Menschen
nicht nur den Karnevalsauftakt, sondern auch
ihren Geburtstag feiern. Wie das Statistische
Landesamt auf Basis von Meldungen der
Standesämter mitteilt, wurden im letzten Jahr am
11. November 452 Kinder geboren. In den
Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Bonn
wurden 24 bzw. 19 und 10 Geburten am 11.11.2024
verzeichnet.
Seit dem Jahr 2000 sind
insgesamt rund 10.900 Kinder in NRW zu Beginn
der fünften Jahreszeit zur Welt gekommen. Das
macht einen Anteil von 0,29 % an allen Geburten
in diesem Zeitraum aus. Mit einem Klick auf den
interaktiven Geburtenkalender unter
https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/geburtenkalender-nrw
können Sie für jedes Datum herausfinden, wie
viele Kinder seit dem Jahr 2000 in ganz NRW oder
den nordrhein-westfälischen Kreisen und
kreisfreien Städten geboren wurden.
NRW: Anteil der Menschen mit Bezug von
Grundsicherung im Alter das vierte Jahr in Folge
gestiegen
* 5,3 % der über
66-Jährigen bezogen Ende 2024 Grundsicherung im
Alter.
* NRW-Quote um 1,2 Prozentpunkte
höher als der Bundesschnitt.
* In Köln und
Düsseldorf bezog jeweils mehr als jede zehnte
Person über der Altersgrenze Grundsicherung.
Ende 2024 bezogen in NRW 5,3 % der über
66-Jährigen Menschen Grundsicherung im Alter.
Ein Jahr zuvor hatte ihr Anteil noch bei 5,0 %
gelegen. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, ist die Quote der Personen mit Bezug
dieser Leistung in Nordrhein-Westfalen das
vierte Jahr in Folge gestiegen.
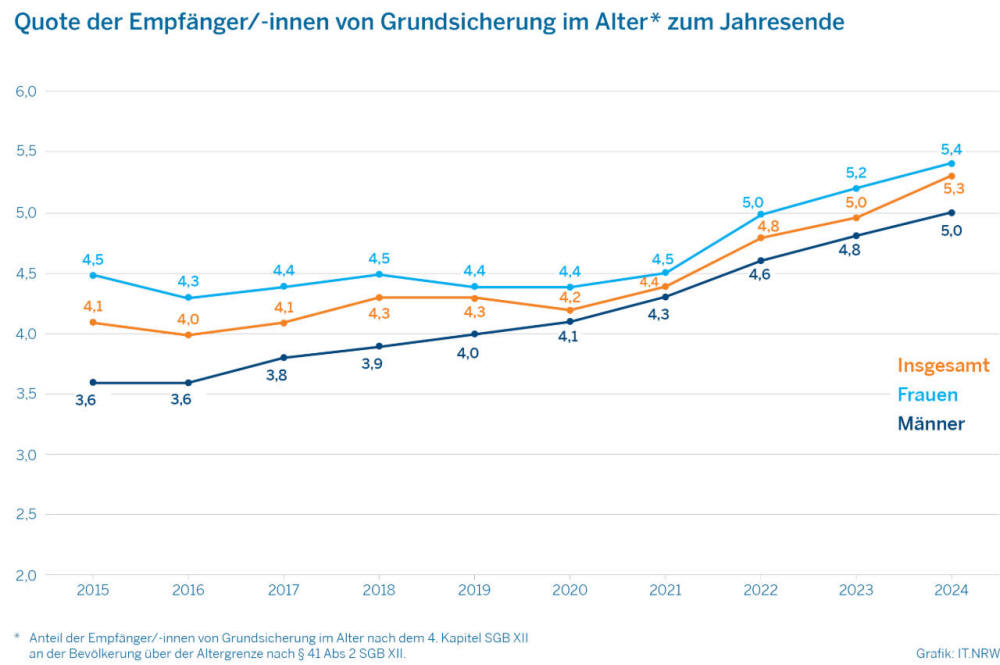
Die Quote in NRW lag um 1,2 Prozentpunkte
höher als im gesamten Bundesgebiet: Ende 2024
bezogen bundesweit 4,1 % der über 66-Jährigen
Grundsicherung im Alter. Anspruch auf diese
Leistung haben Personen, die die Altersgrenze
nach § 41 Absatz 2 SGB XII erreicht haben und
die ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen
und Vermögen bzw. dem ihres (Ehe)Partners nicht
sicherstellen können.
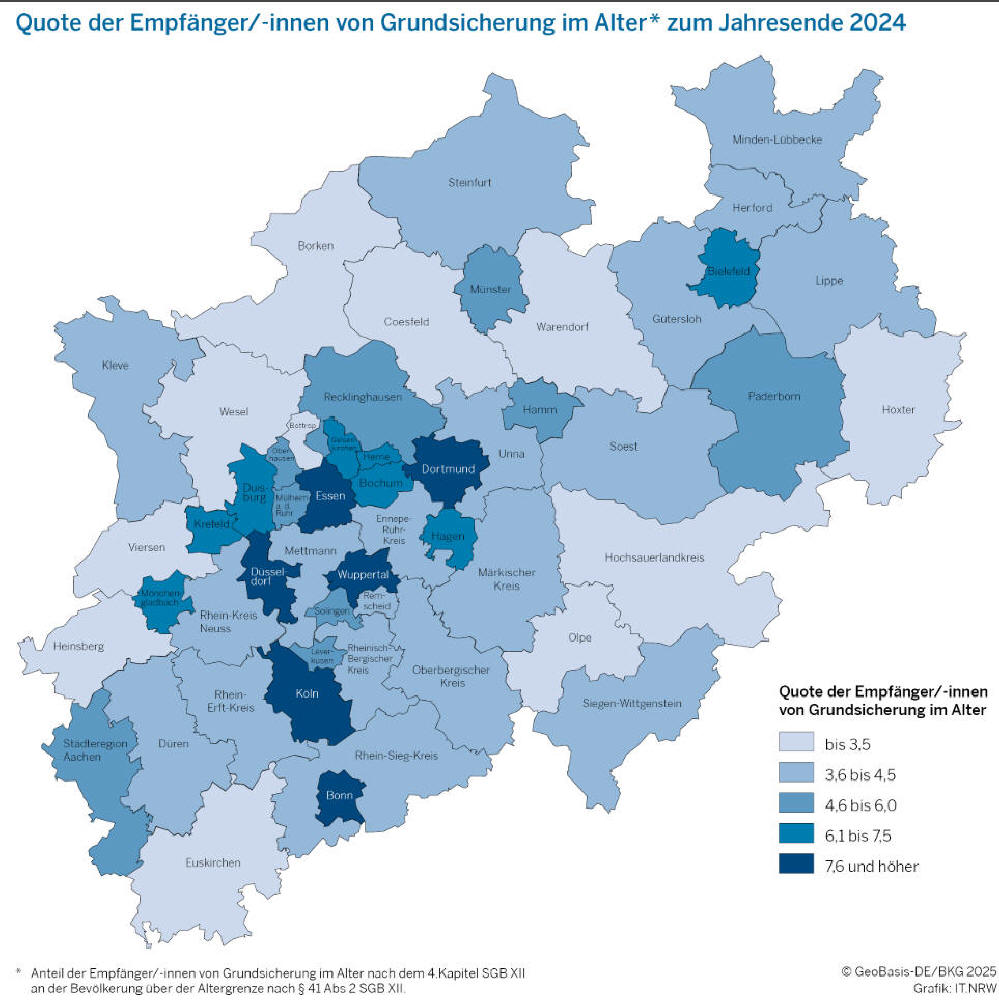
Die an dem gesetzlichen Renteneintrittsalter
orientierte Altersgrenze lag im Dezember 2024
bei 66 Jahren. Ende 2024 lag die Zahl der
Menschen in NRW die Grundsicherung im Alter
erhielten bei 195.965. Bis Ende Juni 2025 stieg
ihre Zahl weiter an auf insgesamt 199.020
Empfängerinnen und Empfänger.
Frauen
beziehen häufiger Grundsicherung im Alter als
Männer
Über 66-jährige Frauen bezogen Ende
2024 zu 5,4 % Grundsicherung im Alter. Bei den
Männern fiel die Quote mit 5,0 %, wie schon in
den Vorjahren, niedriger aus. Während die Quote
bei den Männern jedoch in den letzten zehn
Jahren kontinuierlich gestiegen ist, stagnierte
sie bei den Frauen von 2015 bis 2021 auf einem
Niveau von 4,3 % bis 4,5 %.

Nachdem ab Juni 2022 geflüchtete Menschen
aus der Ukraine im entsprechenden Alter bei
Bedarf Leistungen der Grundsicherung im Alter
beantragen konnten, stieg die Quote auch bei den
Frauen weiter an. Ende 2024 lag die Zahl der
Ukrainerinnen und Ukrainer mit Bezug von
Grundsicherung im Alter bei 21.600 Personen und
damit 3,9-mal höher als Ende 2021.
Höchste Quoten in den Großstädten Köln und
Düsseldorf
Am höchsten waren die Quoten der
Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung
im Alter in den Großstädten Köln und Düsseldorf.
Ende 2024 erhielt hier mit einem Anteil von
10,3 % bzw. 10,2 % mehr als jede zehnte Person
über der Altersgrenze Grundsicherungsleistungen.
Im Kreis Olpe und im Kreis Höxter
bezogen anteilig die wenigsten älteren Menschen
Grundsicherung im Alter: Hier lagen die Quoten
bei 2,5 % bzw. 2,8 %. Daten der Abbildung
https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/324k_25.xlsx
XLSX, 103,39 KB Überdurchschnittlich hohe Quoten
finden sich vor allem im städtischen Raum, wo
bei angespannten Wohnungsmärkten oft
vergleichsweise hohe Wohnkosten anfallen.
Dadurch reichen häufiger die Alterseinkünfte
nicht aus, um den Lebensunterhalt zu decken.
38 Tage Moerser
Weihnachtsmarkt 2025
14.11.2025 -
12:00 Uhr - 22.12.2025 - 20:00 Uhr
Der
Moerser Weihnachtsmarkt lockt mit vielseitigem
Programm und spannenden Neuheiten. Zentraler
Anziehungspunkt der Veranstaltung sind die
festlich geschmückten Weihnachtshütten. Dort
entdecken Besucher und Besucherinnen dank des
wechselnden Angebots immer wieder neue
Geschenkideen – von selbstgebackenen
Köstlichkeiten über handgefertigte Dekorationen
bis hin zu liebevoll gestalteten Kunst- und
Handwerksarbeiten.
Für das leibliche
Wohl sorgen zahlreiche Gastronomiestände, die
mit herzhaften Spezialitäten vom Grill, heißen
Getränken, veganen Gerichten und süßen
Leckereien verwöhnen. In den sogenannten
Sozialhütten laden gemeinnützige Vereine zu
Gesprächen über ihre Projekte ein. Hier stellen
sich unter anderem der Förderverein des Moerser
Streichelzoos, verschiedene Schul- und
Kindergartenfördervereine sowie mehrere
Sportvereine vor und berichten über ihre Arbeit.
Besinnliche Adventsstimmung entsteht bei
stimmungsvoller Weihnachtsmusik an den
Ausschankständen und bei winterlichen
Programm-Highlights. Ein besonderes Erlebnis
bietet zudem der bespielte Schlossplatz zwischen
Pulverhäuschen und Schlossgebäude: An einem
Wochenende verwandelt sich dieser Ort in eine
mittelalterliche Welt mit Marktständen, Zelten
und Spielen, die Groß und Klein in vergangene
Zeiten eintauchen lassen.
Öffnungszeiten
Sonntag bis Donnerstag: 12 bis 20 Uhr
Freitag und Samstag: 12 bis 22 Uhr
An
Totensonntag geschlossen.
Veranstaltungsort:
Rund um den Kastell sowie in der Haag- und
Meerstraße
Wesel:
Reaktivierung der Oststrecke der Kreisbahn in
Richtung Industriepark Bucholtwelmen
Die notwendigen Baumaßnahmen bei der
Oststrecke der Kreisbahn sind abgeschlossen und
eine Wiederinbetriebnahme ist für Donnerstag,
den 13.11.2025, geplant. Ab diesem Termin wird
wieder regelmäßig Eisenbahnverkehr auf der
Strecke stattfinden. In diesem Zusammenhang wird
darauf hingewiesen, dass das Betreten der
Bahnanlage strengstens verboten ist und die
Querung des Gleises nur über die ausgewiesenen
Bahnübergänge „Bogenstraße“, „Kurierweg“ und „Am
Franzosenfriedhof“ erfolgen kann.
Durch
die nun vorgenommene Reaktivierung der Strecke
wird die Möglichkeit geschaffen, zukünftig Güter
umweltschonender über die Schiene in und aus den
Industriepark Bucholtwelmen zu transportieren
und die ansonsten dafür notwendigen LKW-Verkehre
damit zu vermeiden. Durch diese alternative
Transportmöglichkeit wird ein Beitrag zur
CO2-Reduzierung und zum Klimaschutz geleistet.
Dieses Projekt wurde maßgeblich durch
die Hafengesellschaft DeltaPort initiiert und
umgesetzt. Das Ostgleis der Kreisbahn wurde 1960
entlang des Wesel-Datteln-Kanals mit einer Länge
von 4,2 Kilometern errichtet, um die damals in
Hünxe angesiedelte BP Raffinerie an das
Streckennetz der Bundesbahn anzuschließen. Mitte
der 80er-Jahre wurde mit der Stilllegung der
Raffinerie der Betrieb auf der Oststrecke
eingestellt.
Dinslaken:
Asphaltarbeiten mit Straßensperrungen
Im Auftrag der Stadt Dinslaken werden auf
einem Teilstück der Lingelmannstraße (von der
Ruschstraße bis zur Straße Hinter den Kämpen),
auf der Ruschstraße und auf der Straße Hinter
den Kämpen (von der Stadtgrenze Oberhausen bis
zur Lingelmannstraße) von Dienstag, 11.11., bis
Samstag, 15.11., Asphaltarbeiten durchgeführt.
Für diesen Zeitraum sind die Straßen für den
Durchgangsverkehr gesperrt. Mit den betroffenen
Anliegern wurden individuelle Absprachen
getroffen.
Kleve: Die
Zirkusratte - Kindertheater in der Stadthalle
Am Mittwoch, den 12. November 2025 um lädt die
Stadt Kleve um 16 Uhr zu einem fröhlichen
Kindertheater-Nachmittag in die Stadthalle Kleve
ein. Theater Mika & Rino bringt mit „Die
Zirkusratte“ eine liebevoll erzählte Geschichte
über Mut, große Träume und die Magie der Manege
auf die Bühne.
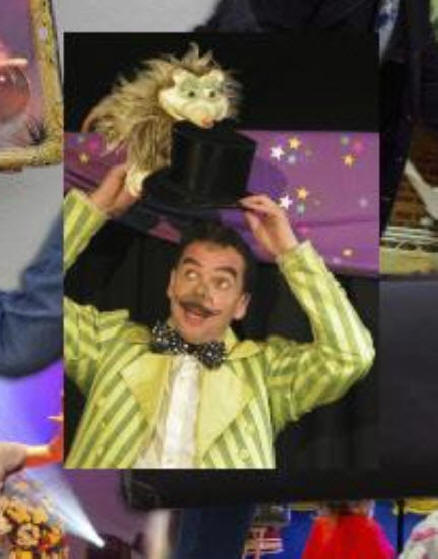
Die Zirkusratte (c) Theater Mika & Rino (Michael
Gödde)
Im Mittelpunkt steht die kleine
Ratte Fred, die im Zirkus eigentlich nur im
Verborgenen lebt – bis sie ihren Mut
zusammennimmt und selbst in der Manege stehen
will. Zwischen Zauberhut, Clownsnase und
Artistentricks stolpert Fred mitten hinein ins
Rampenlicht und erlebt ein turbulentes Abenteuer
voller Komik, Herz und überraschender
Kunststücke.
Das Stück ist geeignet für
alle Kinder ab 4 Jahren. Der Eintritt beträgt 4
Euro. Karten sind erhältlich an allen bekannten
Vorverkaufsstellen, online unter www.reservix.de
sowie beim Fachbereich Schulen, Kultur und Sport
der Stadt Kleve. Ansprechpartnerinnen sind Gina
Haven (Tel. 02821 / 84-680) und Laura Foresta
(Tel. 02821 / 84-254).
Dinslaken: „Um Vier
im Quartier“ – Bei jedem Wetter draußen Spaß
haben
Erlebnispädagoge Philipp
Hassel macht spannende Angebote in Lohberg und
im Blumenviertel
Downloads Philipp Hassel in Aktion. Ab
Mittwoch, 12. November, wird es bis Jahresende
für Kinder von 6 bis 14 Jahren wöchentlich
abwechslungsreiche Bewegungsangebote im Bergpark
Lohberg und am Blumenwagen in der Talstraße
geben.
Erlebnispädagoge Philipp Hassel
wird mit Interessierten im Beisein der Eltern
(Aufsichtspflicht) klettern, die Natur
entdecken, Gemeinschaft fördern und kleine
abenteuerliche Erlebnisse vorbereiten. Das alles
umsonst und draußen und bei jedem Wetter. So
werden nicht nur Spaß und Spiel gefördert,
sondern das Immunsystem gleich mit gestärkt.
Sozialdezernentin Dr. Tagrid Yousef begrüßt
diese Form der aufsuchenden Arbeit in den
Quartieren: „Wir sind froh, dass wir unseren
Kindern und Jugendlichen ein so
entdeckungsreiches Programm direkt vor ihrer
Haustüre bieten können. Ich würde am liebsten
selbst mitmachen!“. Möglich gemacht wird das
Format durch Fördermittel aus dem Landesprogramm
„kinderstark – NRW schafft Chancen“.
Philipp Hassel ist freiberuflicher
Sozialpädagoge und setzt sich für
Gewaltprävention ein. Als ehemaliger Soldat, der
13 Jahre in der Kampftruppe gedient hat, hat er
sich auf Themen wie „Rangeln & Raufen“ oder
„Fairprügeln“ spezialisiert. Es geht darum, in
der Gruppe Gemeinschaft zu erleben, seinen Platz
im Team zu finden und gemeinsam Lösungen zu
erarbeiten.
Insbesondere das Üben von
Frustrationstoleranz und lösungsorientierter
Kommunikation ist ein wichtiger Teil seiner
Arbeit. Er wird mit den Kindern klettern,
Abenteuer- und Vertrauensspiele machen und für
viel Spaß und Bewegung sorgen. Es wird
wetterfeste Kleidung empfohlen. Eine Anmeldung
ist nicht nötig.
Termine
Blumenviertel Blumenwagen, Talstraße Jeweils
von 16 bis 18 Uhr Mi, 12.11. Do, 20.11. Do,
27.11. Do, 04.12. Mi, 10.12. Do, 18.12.
Lohberg Bergpark, Riesenrutsche Jeweils von 16
bis 18 Uhr
Do, 13.11. Fr, 21.11. Fr, 28.11.
Fr, 05.12. Do, 11.12. Fr, 19.12.
um4imquartier.pdf (PDF, 4 MB)
"12 verrückte Träume" Ausstellung im
Wasserturm Wesel am 14.11.2025
Am
14.11.2025 um 18:00 Uhr lädt die Musik- und
Kunstschule Wesel zur Ausstellungseröffnung „12
verrückte Träume“ in den Stadtwerke Wasserturm
Wesel ein. Ausgangspunkt sind zwölf Werke für
Gitarre der Wiener Komponistin Margit Gruber –
Traumgeschichten, schillernd zwischen Fantasie
und Wirklichkeit.
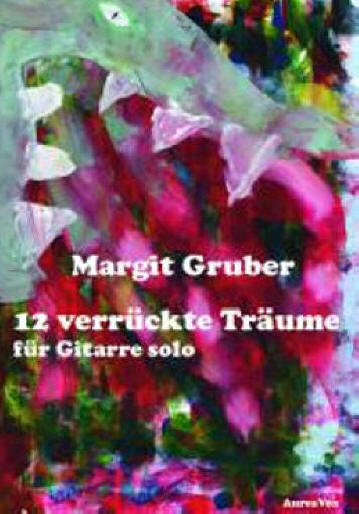
Dazu haben Schüler*innen der Musik- und
Kunstschule unter der Leitung von Christiane
Frohne farbenprächtige Bilder geschaffen-
Ausdruck innerer Welten, mal verspielt, mal
geheimnisvoll, immer berührend. Musikalisch wird
die Ausstellungseröffnung von Prof. Hans-Werner
Huppertz, Gitarre begleitet.
So entsteht
ein sinnliches Gesamtergebnis – ein Dialog
zwischen Ton und Farbe, Traum und Erwachen.
Rainer Hegmann, Geschäftsführer der Stadtwerke,
sowie die Komponistin selbst und die
Künstler*innen werden die Gäste begrüßen. Die
Ausstellung bleibt bis zum 09.01.2026 weiter
geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Dinslaken: Mitmachausstellung
„Mobilität: Unterwegs mit Rädern, Flügeln und
Raketen“ verlängert
Die
Stadtbibliothek Dinslaken verlängert die
Mitmachausstellung „Mobilität: Unterwegs mit
Rädern, Flügeln und Raketen“ bis zum 15.
November 2025. Damit haben Besucherinnen und
Besucher noch zwei Wochen länger Gelegenheit,
die Ausstellung in der Kinderbibliothek zu
entdecken. Wie schon seit Februar lädt die
Mitmachausstellung dazu ein, sich auf
spielerische und informative Weise mit dem Thema
Mobilität – von den Anfängen bis zu den Visionen
von morgen – auseinanderzusetzen.
Die
Ausstellung ist im Bereich der Kinderbibliothek
entlang der Fenster sowohl von außen als auch
von innen sichtbar und richtet sich an Kinder,
Familien und alle Interessierten. Ein besonderes
Highlight ist weiterhin das Bastelangebot für
kleine Miniaturautos, die aus
Streichholzschachteln gebaut werden können.
Die passenden Räder werden
mit dem 3D-Drucker der Stadtbibliothek
hergestellt. Wer also bisher noch keinen Blick
in die Ausstellung werfen konnte, hat nun bis
zum 15. November die Möglichkeit dazu. elisa.rickert@dinslaken.de
Weseler Winter 2025: Eisbahn,
Adventmarkt und Hüttenzauber bringen festliche
Stimmung in die Stadt
Mit einem
abwechslungsreichen Programm lockt der Weseler
Winter auch in diesem Jahr wieder zahlreiche
Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt.
Zwischen Eisbahn, Adventmarkt, Hüttenzauber und
kreativen Aktionen des Einzelhandels erwartet
die Gäste ein unvergessliches Wintererlebnis.
Darüber hinaus gibt es auch wieder die
Diersfordter Waldweihnacht und dicke Rote Kerzen
in Ginderich am 3. Adventwochenende.
„Der
Weseler Winter verbindet sportliche Aktivitäten,
festliche Märkte und gemeinschaftliche
Erlebnisse in einzigartiger Weise“, sagt Dagmar
van der Linden Geschäftsführerin von
WeselMarketing. „Wir freuen uns, dass wir
gemeinsam mit vielen Partnern erneut ein
Programm auf die Beine stellen konnten, dass
Jung und Alt begeistert.“
Auftakt mit
Wesel on Ice
Bereits am 21. November startet
der Weseler Winter mit einem bunten
Rahmenprogramm zur Eröffnung von Wesel on Ice am
Berliner Tor. Alle kleinen Eisläuferinnen und
Eisläufer sind ab 19 Uhr eingeladen, eine Stunde
kostenlos das Eis zu testen. Am darauffolgenden
Tag wird die Eisbahn offiziell in Betrieb
genommen. „Zur Eröffnung dürfen wir uns über die
Eistheater Schule mit Auszügen aus ihrem neuen
Programm freuen“, ergänzt Sonja Christ von
WeselMarketing.

Ab dem 22. November steht die Eisbahn allen
Schlittschuhfans an sieben Tagen pro Woche zur
Verfügung. Unterstützt durch die
Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe bietet
die Eisfläche ein Erlebnis für alle
Altersgruppen. Wie im vergangenen Jahr wird die
Eisfläche zwischen Berliner Tor und
Fußgängerzone aufgebaut und schafft damit eine
direkte Verbindung ins weihnachtlich geschmückte
Zentrum. „So holen wir die einzigartige Stimmung
in die Innenstadt“, betont van der Linden.
„Unsere Pyramide steht in diesem Jahr direkt
an der Eisbahn – das ergibt ein wunder-schönes
Gesamtbild und sorgt für eine besonders
stimmungsvolle Atmosphäre“, freut sich Simone
Stackebrandt von der Niederrheinischen Sparkasse
Rhein-Lippe
Eisstockschießen,
Schulaktionen und
Stadtwerke-Stadtmeisterschaften
Ein
Publikumsmagnet ist traditionell das
Eisstockschießen. Die begehrten Plätze für die
Stadtwerke-Stadtmeisterschaften sind bereits
Wochen im Voraus vergeben. Möglich wird dies
durch die Unterstützung der Stadtwerke Wesel.
Parallel finden vormittags auch die Stadtwerke
Schulmeisterschaften statt.
Am Nachmittag
und an den Wochenenden dürfen bis zu vier Teams
gleichzeitig zum freien Spiel antreten – ob mit
Freunden, Kollegen oder als sportliches
Highlight für einen Kindergeburtstag.
„Wir tragen intern bei den Stadtwerken ebenfalls
eine eigene Stadtmeisterschaft im
Eisstockschießen aus – da bin ich auf jeden Fall
dabei!“, erzählt ein Rainer Hegmann,
Geschäftsführer der Stadtwerke Wesel mit einem
Augenzwinkern.
An den Vormittagen sind
außerdem die Weseler Kitas und Grundschulen zum
Eislaufen eingeladen. Für 30 Euro je Gruppe oder
Klasse können die Kinder über das Eis flitzen
und erste Schlittschuherfahrungen sammeln.
„Wir haben sowohl für die
Stadtwerke-Schulmeisterschaften im
Eisstockschießen noch Restplätze als auch freie
Termine für das Eislaufen für Kitas und
Grundschulen“, erklärt Sonja Christ von
WeselMarketing.
„Am 28. November wird
außerdem das Ergebnis der Kroni-Aktion hier an
der Eis-bahn präsentiert“, kündigt Bürgermeister
Rainer Benien an. „Wenn genug Kronkorken
zusammengekommen sind, gibt der ASG an diesem
Abend die Getränke aus.“
Adventmarkt am
Dom
Vom 28. bis 30. November lädt der
beliebte Adventmarkt am Dom mit verkaufsoffenem
Sonntag zum weihnachtlichen Bummel ein. Über 50
Vereine präsentieren ihr vielfältiges Angebot –
von kulinarischen Genüssen über Selbstgemachtes
bis hin zu kreativen Geschenkideen. Möglich wird
das durch die Unterstützung der Volksbank
Rhein-Lippe.
„Der Adventmarkt ist ein
Schaufenster für das Engagement unserer Vereine
und trägt entscheidend zur besonderen Atmosphäre
in der Innenstadt bei“, erklärt Dagmar van der
Linden.
Weseler Hüttenzauber im
Heubergpark
Nur wenige Schritte von der
Eisbahn entfernt verwandelt sich der Heubergpark
vom 3. bis 7. Dezember in eine stimmungsvolle
Weihnachtswelt. Der Weseler Hüttenzauber
begeistert mit Geschenkartikeln, Dekoration,
Accessoires und kulinarischen Leckereien. Ein
buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie
rundet den Weihnachtsmarkt im Heubergpark ab.
Adventskalender der Weseler Einzelhändler
Unter dem Label „Gemeinsam.Wesel“ öffnen
Händlerinnen und Händler aus der Innenstadt im
Dezember ein „Türchen“ ihres Adventskalenders.
Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf
kleine Überraschungen in den teilnehmenden
Geschäften freuen.
Termine im Überblick
•
21.11. – Offizielle Eröffnung Weseler Winter
• 22.11.–14.12. – Wesel on Ice am
Berliner-Tor-Platz (geschlossen am
Totensonn-tag)
• 28.-30.11. – Adventmarkt am
Dom mit verkaufsoffenem Sonntag
• 03.–07.12.
– Weseler Hüttenzauber im Heubergpark
•
12.-14.12. - Diersfordter Waldweihnacht
•
13.-14.12. - Dicke Rote Kerzen, Ginderich
•
Im Dezember – Adventskalender Gemeinsam.Wesel
Alle Informationen zum Programm, Tickets für das
Eislaufen, das Eisstockschießen sowie die
Stadtwerke Schulmeisterschaften sind online
erhältlich auf wesel-tourismus.de
Kleve: Herbstliche Themenführung
der WTM
Das Lichterevent „China
Lights“ begeistert seit Anfang Oktober
zahlreiche Besucherinnen und Besucher und
verwandelt den Tiergarten Kleve in ein
farbenfrohes Lichtermeer. Passend dazu bietet
die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt
Kleve GmbH (WTM) am 16. November 2025 um 17 Uhr
ein weiteres Mal die Themenführung „Illuminierte
Gartenanlagen & China Lights“ an.

Gartenführer Hans Heinz Hübers führt die
Teilnehmenden durch die historischen
Gartenanlagen und schlägt dabei den Bogen über
mehr als 70 Jahre Klever Lichterfest. Als
ehemaliger Gärtnermeister der Stadt Kleve war er
selbst viele Jahre an der Vorbereitung des
traditionsreichen Ereignisses beteiligt. Mit
Anekdoten und persönlichen Erinnerungen
berichtet er von den aufwendigen Vorbereitungen
hinter den Kulissen – von den ersten Teelichtern
auf den Kanalinseln bis hin zu modernen
Lichtinszenierungen.
„Wir freuen uns
sehr, dass China Lights so großen Zuspruch
findet. Mit der Themenführung möchten wir den
Gästen nicht nur das Lichtermeer im Tiergarten
zeigen, sondern auch die Geschichte und
Entwicklung der Klever Garten- und
Lichttradition erlebbar machen“, sagt Martina
Gellert, die den Bereich Tourismus & Freizeit
bei der WTM leitet.
Die Führung startet
um 17 Uhr am Museum Kurhaus Kleve
(Tiergartenstraße 41), dauert rund eine Stunde
und endet mit einem individuellen Besuch der
Ausstellung „China Lights“ im Tiergarten Kleve.
Der Eintritt in den Tiergarten ist im Preis von
20 Euro pro Person enthalten. Der Aufenthalt
dort ist bis 21 Uhr möglich. Tickets sind online
unter
www.kleve-tourismus.de oder telefonisch
unter 02821 84-806 buchbar.
Stadt Kleve und USK nehmen an der 15. Nacht der
Ausbildung teil
Am 14. November
2025 öffnet das Rathaus seine Türen für die 15.
Nacht der Ausbildung. Nach dem Erfolg aus den
letzten Jahren werden die Stadt Kleve und die
Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR (USK) am
Freitag, 14.11.2025 von 17.00 Uhr – 20.00 Uhr an
der 15. Nacht der Ausbildung teilnehmen.

Die Stadt Kleve und die USK werden dann wieder
die Türen des Klever Rathauses, Minoritenplatz
1, für alle Interessierten öffnen. Vor Ort gibt
es am Abend eine ganze Reihe spannender
Ausbildungsberufe zu entdecken:
Verwaltungsfachangestellte*r, Stadtinspektor*in,
Bauzeichner*in, Fachinformatiker*in sowie
Erzieher*in sind nur einige der Berufe, in denen
die Stadt Kleve ausbildet.
Hinzu
kommen als Ausbildungsberufe der USK noch
Straßenwärter*in, Gärtner*in – Garten- und
Landschaftsbau, KFZ-Mechatroniker*in,
Industriemechaniker*in, Umwelttechnologe /
-technologin für Abwasserbewirtschaftung,
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement und
Umwelttechnologe/ -technologin für Kreislauf-
und Abfallwirtschaft.
Über sämtliche
Ausbildungsberufe sowie die weiteren beruflichen
Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten werden
die Stadt Kleve und die Umweltbetriebe
informieren. Hierfür stehen sowohl Auszubildende
als auch erfahrene Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zum Austausch sowie bei Rückfragen
zur Verfügung. Außerdem können im Rahmen der
Nacht der Ausbildung unterschiedliche Praktika
vermittelt werden.
Alle Interessierten
sind daher herzlich eingeladen, sich zwischen
17:00 und 20:00 Uhr im Rathaus über die
Ausbildungsberufe der Stadt Kleve und der
Umweltbetriebe der Stadt Kleve in lockerer
Atmosphäre und bei kühlen Getränken zu
erkundigen. Weitere Informationen gibt es auf www.kleve.de/ausbildung oder
direkt auf der Internetseite der Nacht der
Ausbildung unter www.nachtderausbildung.de.
Gedenkfeiern zum Volkstrauertag
2025 in Kleve
In ganz Kleve finden
zum Volkstrauertag Gedenkveranstaltungen statt.
Bundesweit wird am Volkstrauertag jährlich
der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
gedacht. Auch in Kleve werden zu diesem Anlass
Gedenkfeiern im gesamten Stadtgebiet
organisiert.

Die zentrale Gedenkfeier der Stadt Kleve, zu der
alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen
sind, findet am Sonntag, 16. November 2025, um
15.00 Uhr am Ehrenmal in Düffelward statt.
Bürgermeister Markus Dahmen wird einen Kranz
niederlegen und das Totengedenken sprechen.
Gemeinsam soll bei der Gedenkfeier am
Volkstrauertag ein Zeichen gesetzt werden, für
Menschlichkeit, Barmherzigkeit, Toleranz,
Herzlichkeit und Frieden einzustehen.
In
den anderen Ortsteilen der Stadt Kleve finden
wie folgt Gedenkfeiern statt:
Bimmen Am
Ehrenmal 17:45 Uhr
Brienen Am Ehrenmal 09:45
Uhr
Keeken Am Ehrenmal 17:30 Uhr
Schenkenschanz Am Ehrenmal 10:30 Uhr
Griethausen Am Ehrenmal 10:00 Uhr
Reichswalde
Am Kreuz 09:30 Uhr
Kellen Neues Mahnmal 11:30
Uhr
Mahnmal am alten Friedhof 12:00 Uhr
Materborn Am Ehrenmal 12:00 Uhr
Donsbrüggen
Am Ehrenfriedhof 11:30 Uhr
Rindern Am
Ehrenmal 10:00 Uhr
Warbeyen Am Ehrenmal
Samstag, 15.11., 18:30 Uhr
Chargeback –
wann und wie die Rückbuchung einer
Kreditkartenzahlung möglich ist
Viele Verbraucherinnen und Verbraucher kennen
das sogenannte Chargeback-Verfahren nicht –
obwohl es ihnen in bestimmten Fällen ermöglicht,
Kreditkartenzahlungen rückgängig zu machen. Mit
einem aktualisierten Online-Artikel informiert
das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ)
Deutschland über das Verfahren, gibt
Hilfestellung bei der Beantragung und erklärt,
welche Probleme insbesondere bei
grenzüberschreitenden Fällen auftreten können.
Beispiel aus der Fallarbeit des
EVZ Deutschland
Ein Ehepaar aus
Baden-Württemberg machte Urlaub auf Gran
Canaria. An der Strandpromenade wurden sie von
einer Frau angesprochen, die ihnen drei Lose
anbot – eines entpuppte sich als angeblicher
Hauptgewinn. Daraufhin ließ sich das Ehepaar zu
einer Besichtigung einer Ferienanlage überreden.
Dort wurden sie in ein Verkaufsgespräch
verwickelt, in dem ihnen ein „Urlaubszertifikat“
angeboten wurde – angeblich mit exklusiven
Reisevorteilen. Unter Druck unterschrieben sie
schließlich einen Vertrag und zahlten 4.000 Euro
per Kreditkarte.
Erst später bemerkten
sie, dass es sich um eine typische
Urlaubs-Masche handelte, aus dem ein Rücktritt
kaum möglich war. Die Familie wandte sich an das
EVZ Deutschland. Nach unserer Empfehlung
beantragten sie bei ihrer Bank ein Chargeback –
mit Erfolg: Die 4.000 Euro wurden vollständig
erstattet.
Was ist ein
Chargeback-Verfahren?
Das Chargeback ist ein
Rückbuchungsverfahren für Kredit- und
Debitkartenzahlungen. Es wurde von den
Kreditkartenorganisationen (z. B. Visa,
Mastercard) entwickelt und ermöglicht es,
Geldbeträge zurückzufordern, wenn eine Abbuchung
fehlerhaft oder unrechtmäßig war.
Da das
Verfahren auf den Regeln der Kartenanbieter
basiert und nicht gesetzlich geregelt ist, kommt
es nach den Erfahrungen des EVZ Deutschland in
der Praxis häufig zu Missverständnissen oder
Ablehnungen durch Banken.
In diesen
Fällen ist ein Chargeback-Verfahren möglich
Ein Chargeback kann zum Beispiel in folgenden
Fällen beantragt werden:
- eine im Internet
bestellte Ware wurde nicht geliefert,
- ein
Online-Händler erstattet trotz fristgerechtem
Widerruf und Rücksendung kein Geld,
- ein
Betrag wurde doppelt oder falsch abgebucht,
-
ein Unternehmen hat Insolvenz angemeldet,
-
es wurden unberechtigte Zusatzkosten belastet –
zum Beispiel nach einer Mietwagen- oder
Hotelbuchung,
- es handelt sich um eine
betrügerische Abbuchung oder einen Fake-Shop –
hier sollte zusätzlich Anzeige bei der Polizei
erstattet werden.
So läuft die
Beantragung eines Chargeback ab
Das
Chargeback wird über die kartenausgebende Bank
beantragt. Viele Banken stellen dafür
Reklamationsformulare bereit. Dem Antrag sollten
alle relevanten Belege beigefügt werden.
Fristen und Nachweise beachten
Kreditkartenunternehmen setzen für Chargebacks
in der Regel Fristen von bis zu 120 Tagen nach
der Abbuchung. Verbraucherinnen und Verbraucher
sollten sich aber so schnell wie möglich an ihre
Bank wenden.
Die Bank prüft den Fall und
stößt das Verfahren im besten Fall an – häufig
über spezialisierte Zahlungsdienstleister.
Händler können der Rückbuchung widersprechen; in
solchen Fällen kann sich die Klärung verzögern –
teils über mehrere Monate.
Verbraucher-Tipp: Hartnäckig bleiben
Nach den
Erfahrungen des EVZ Deutschland sind
Bankangestellte oftmals nicht mit dem
Chargeback-Verfahren vertraut oder lehnen es
ohne nachvollziehbare Begründung ab. Hier lohnt
es sich, nachzuhaken und auf die Regeln der
Kreditkartenunternehmen zu verweisen. Zur
Unterstützung können Verbraucherinnen und
Verbraucher auch den EVZ-Artikel mitschicken.
Weitere Informationen und praktische Tipps zum
Chargeback-Verfahren
Bidirektionales Laden: Grundlagen für sichere
Markteinführung schaffen
Elektroautos sollen Strom nicht nur laden,
sondern auch zurückspeisen können. Das
vergünstigt die Energiewende und entlastet das
Stromnetz. TÜV-Verband legt Positionspapier vor
und fordert klare Vorgaben für Technik,
Sicherheit und Zuständigkeiten.
Elektroautos können nicht nur lokal
emissionsfrei fahren, sondern auch als
universeller Stromspeicher dienen. Beim
sogenannten bidirektionalen Laden geben die
Batterien der E-Autos überschüssigen Strom
wieder ins Netz oder ins eigene Haus zurück. Mit
diesem Konzept können Lastspitzen erneuerbarer
Energien aufgenommen werden. Das senkt die
Stromkosten für alle und stabilisiert die
Stromnetze. „Bidirektionales Laden ist ein
wichtiger Baustein für eine sichere, bezahlbare
und resiliente Energieversorgung“, sagt Robin
Zalwert, Referent für Nachhaltige Mobilität beim
TÜV-Verband.
„Damit diese Technologie in
Deutschland zügig in den Markt kommt, brauchen
wir verbindliche technische Vorgaben, eine gute
Koordination und eine leistungsfähige digitale
Infrastruktur.“ Der TÜV-Verband veröffentlicht
heute ein Positionspapier und fordert darin
verbindliche technische Regeln, eine gute
Koordination dieses Querschnittsthemas innerhalb
der Bundesregierung sowie den schnellen Ausbau
digitaler Infrastruktur.
Großes Potenzial
für Energiewende und Verbraucher:innen
Mit
bidirektionalem Laden werden Elektroautos zu
mobilen Energiespeichern. Sie können
Verbrauchsspitzen abfedern und Strom speichern.
Studien wie vom Fraunhofer ISI und Fraunhofer
ISE zeigen: Durch die Nutzung von
Fahrzeugbatterien als Zwischenspeicher könnten
in Deutschland bis 2040 bis zu 8,4 Milliarden
Euro pro Jahr eingespart werden. Auch private
Haushalte und Unternehmen könnten profitieren,
indem sie Strom flexibler nutzen und
zurückspeisen.
Von der Strategie in die
Umsetzung
Im Masterplan Ladeinfrastruktur
2030 des Bundesverkehrsministeriums (BMV) wird
das Thema erstmals konkretisiert. Dennoch fehlen
verbindliche Regelungen und klare
Zuständigkeiten. „Europa – insbesondere
Deutschland – zählt beim bidirektionalen Laden
derzeit zu den führenden Technologiestandorten“,
sagt Zalwert. „Dieser Vorsprung ist jedoch nicht
gesichert und könnte ohne entschlossenes Handeln
schnell verloren gehen. Denn bidirektionales
Laden betrifft Energie-, Verkehrs- und
Digitalpolitik. Nur wenn Ministerien,
Netzbetreiber und Energieversorger eng
zusammenarbeiten, kann die Technologie schnell
in den Markt kommen.“
Kernforderungen für
den Markthochlauf
Für den erfolgreichen Start
des bidirektionalen Ladens schlägt der
TÜV-Verband vier zentrale Schritte vor.
Technische Regeln festlegen: Dafür braucht es
einheitliche Sicherheits- und Prüfstandards,
klare technische Vorgaben und ein transparentes
Zertifizierungssystem für Fahrzeuge, Ladepunkte
und Software.
Koordiniert vorgehen: Das setzt
eine enge Abstimmung zwischen Verkehrs- und
Wirtschaftsministerium voraus sowie
Förderprogramme, die verlässlich ausgestattet
sind und nicht unter Finanzierungsvorbehalt
stehen.
Digitale Infrastruktur
beschleunigen: Dazu zählen der rasche Ausbau
intelligenter Stromzähler, deutlich
beschleunigte Genehmigungsverfahren für
Ladeinfrastruktur von Depots und Flotten und
klare Rahmenbedingungen für flexible
Stromtarife.
Qualität und Sicherheit prüfen:
Die TÜV-Organisationen bringen ihre
Prüferfahrung ein und testen sowie zertifizieren
Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und IT-Systeme. So
wird sichergestellt, dass bidirektionale
Ladelösungen sicher, nutzerfreundlich und
verlässlich funktionieren.
Die
Technologie ist bereit. Jetzt müssen die
politischen Weichen gestellt werden. Ziel ist
es, Pilotversuche in einen bundesweiten Markt zu
überführen und Verbraucher:innen sichere,
verständliche und wirtschaftliche Lösungen
anzubieten.
Bürgerenergie in NRW:
Umfrage zeigt Fortschritte – aber auch
dringenden Handlungsbedarf
Eine
Umfrage des Genoverband e.V. unter
Energiegenossenschaften in Nordrhein-Westfalen
zeigt ein interessantes Stimmungsbild: Die
Bürgerenergie erfährt zunehmend Rückenwind,
steht jedoch weiterhin vor erheblichen
Herausforderungen. Zwischen dem 14. August und
dem 25. September 2025 nahmen 71
Vorstandsmitglieder von Energiegenossenschaften
in NRW an der Umfrageteil.
Positive
Impulse durch das Bürgerenergiegesetz
Nur
etwa ein Drittel der Befragten sehen
Verbesserungen. Wenn Verbesserungen gesehen
wurden, sind diese am häufigsten durch die
geregelten finanziellen
Beteiligungsmöglichkeiten durch das
Bürgerenergiegesetz in NRW wahrgenommen worden.
Die Mehrheit der befragten
Energiegenossenschaften bieten direkte
Beteiligungen an, dicht gefolgt von
Direktzahlungen an Gemeinden. Derartige
Beteiligung ist ein wichtiger Schritt für mehr
lokale Teilhabe und Akzeptanz der Windenergie.
Genehmigungsprozesse und Netzausbau als
zentrale Hürden
Als Hemmnis bei den
Genehmigungsverfahren geben die meisten der
Befragten die Dauer von Genehmigungsverfahren an
und sehen Verbesserungsbedarf. Besonders das
sogenannte „Lex Sauerland“ – eine
landesrechtliche Übergangsregelung in NRW – hat
die Genehmigungen außerhalb geplanter
Windgebiete in Konflikt mit Bundesrecht
gebracht, was viele Windenergie-Projekte in NRW
verzögert oder beendet hat.
Auch der
schleppende Netzausbau und fehlende
Speicherlösungen bereiten Sorgen: Die Mehrheit
der befragten Windenergiegenossenschaften in NRW
sehen hier ein zentrales Problem. Der Ausbau
erneuerbarer Energien kann nur dann Wirkung
entfalten, wenn die erzeugte Energie auch
eingespeist und gespeichert werden kann. In
offenen Antwortfeldern forderten die
Genossenschaften, gezielte Flächenausweisungen
in der Nähe von Netzeinspeisepunkten zu
ermöglichen, sowie eine netzdienliche Anbindung
von Speichern.
Ungleiche
Wettbewerbsbedingungen bei der Flächenvergabe
Zudem kritisieren viele Genossenschaften in der
Befragung die Konkurrenz mit großen,
kapitalstarken Unternehmen bei der
Flächenvergabe. Sie fordern faire
Rahmenbedingungen und eine gezielte Förderung,
um die Bürgerenergie als demokratische Säule der
Energiewende zu stärken.
„Energiegenossenschaften sind das Modell für
Bürgerbeteiligung. Die Akzeptanz von
Windenergieanlagen steigt, wenn die Menschen vor
Ort in die Projekte eingebunden werden“, betont
Peter Götz, Vorstandsmitglied beim Genoverband
e.V.
Die Umfrage zeigt: Die Bürgerenergie
in NRW ist auf einem guten Weg, braucht aber
weiterhin politische Unterstützung und faire
Rahmenbedingungen. Das Land NRW arbeitet
intensiv an Lösungen und hat durch Leitfäden,
Checklisten und Standardisierungen schon vieles
auf den Weg gebracht. Ein Expertenworkshop 30.
September 2025 im Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr (MUNV NRW) diente der
Evaluation dieser Maßnahmen und für den
Erfahrungsaustausch weitere Lösungen zu
entwickeln.
Hinweis zur Umfrage: Die
verwendeten Daten beruhen auf einer
Online-Umfrage des Genoverband e.V. unter
Vorständen von Energiegenossenschaften. Von den
etwa 120 Mitgliedsgenossenschaften im
Verbandsgebiet haben sich zwischen dem 14.8. –
25.9.2025 n=71 Vorstände an der Umfrage
beteiligt. N= 31 davon sind im Bereich
Windenergie tätig.
Der Genoverband e.V.
ist der Prüfungs- und Beratungsverband,
Interessenvertreter und Bildungsträger für rund
2.800 Mitgliedsgenossenschaften. Als moderner
Dienstleister betreut er Genossenschaften aus
den Bereichen Kreditwirtschaft, Landwirtschaft,
Agrarwirtschaft, Verkehr und Logistik sowie
Handel, Gewerbe und Dienstleistungen mit
insgesamt über acht Millionen Mitgliedern. Mehr
Informationen unter:
www.genoverband.de

NRW-Industrie:
Absatzwert von Maschinen und Maschinenteilen für
die Land- und Forstwirtschaft 2024 um fast 21 %
gesunken
* Zahl der Betriebe seit
2021 konstant.
* NRW-Anteil am
Bundesabsatzwert sank 2024 auf 10-Jahrestief.
* Rückgang des Absatzwertes auch im ersten
Halbjahr 2025.
In Nordrhein-Westfalen
sind 2024 in 51 Betrieben des Verarbeitenden
Gewerbes Maschinen, Apparate und Geräte für die
Land- und Forstwirtschaft sowie Teile dafür im
Wert von 2,8 Milliarden Euro hergestellt worden.
Wie das Statistische Landesamt anlässlich der
Weltleitmesse für Landtechnik AGRITECHNICA (09.
bis 15. November 2025 in Hannover) mitteilt, war
der Absatzwert nominal um 726,7 Millionen Euro
bzw. 20,9 % niedriger als ein Jahr zuvor.
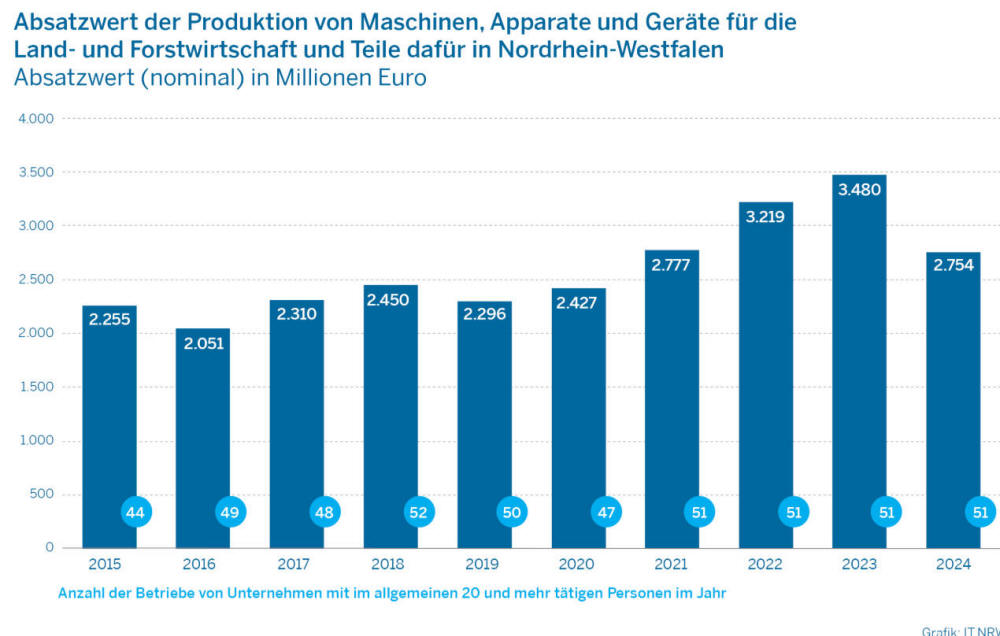
Nachdem der Absatzwert von 2020 bis 2023
vier Jahre in Folge gestiegen ist, sank er 2024
erstmalig wieder gegenüber dem Vorjahr.
Gegenüber dem Jahr 2015 stieg er nominal um
498,8 Millionen Euro bzw. 22,1 %. Zahl der
Betriebe seit 2021 konstant bei 51 Von den 51
Betrieben stellten im letzten Jahr 35 Betriebe
Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und
Forstwirtschaft wie Schlepper, Anhänger,
Bodenbearbeitungs- und Erntemaschinen mit einem
nominalen Absatzwert von 2,1 Milliarden Euro
her.
27 Betriebe produzierten Teile für
Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und
Forstwirtschaft mit einem nominalen Absatzwert
von 675,7 Millionen Euro; auch hier sank der
Absatzwert um 20,9 % gegenüber dem Vorjahr.
Außerdem gaben 24 Betriebe an für 24,9 Millionen
Euro land- und forstwirtschaftliche Maschinen
repariert bzw. instandgehalten zu haben, was
einer Steigerung von 1,1 % zum Vorjahr
entspricht.
NRW-Anteil am
Bundesabsatzwert auf 10-Jahrestief
Auch
bundesweit sank im Jahr 2024 der Absatzwert der
Produktion von Maschinen, Apparate und Geräte
für die Land- und Forstwirtschaft und von Teilen
dafür um 19,9 % auf nominal 12,8 Milliarden
Euro. Der NRW-Anteil am bundesdeutschen
Absatzwert lag 2024 bei 21,4 %; er sank damit
auf den niedrigsten Stand der letzten 10 Jahre
(2015: 25,5 %).
Rückgang setzt sich auch
in der ersten Jahreshälfte 2025 fort
Im
ersten Halbjahr 2025 produzierten nach
vorläufigen Ergebnissen 49
nordrhein-westfälische Betriebe Maschinen,
Apparate und Geräte für die Land- und
Forstwirtschaft sowie Teile dafür im Wert von
1,6 Milliarden Euro. Der Absatzwert sank damit
um 11,1 % gegenüber dem entsprechenden
Vorjahreszeitraum.
46,5 %
weniger Zuzüge syrischer Staatsangehöriger von
Januar bis September 2025 als im
Vorjahreszeitraum
• Zahl der
Fortzüge von Syrerinnen und Syrern im selben
Zeitraum um 35,3 % gestiegen
• Ende 2024
waren 22 % der Schutzsuchenden in Deutschland
Syrerinnen und Syrer
• 1,22 Millionen
Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte
leben in Deutschland, 19 % von ihnen sind hier
geboren
Nach dem Sturz des
Assad-Regimes in Syrien Ende 2024 ist die Zahl
der Zuzüge syrischer Staatsangehöriger im
laufenden Jahr um 46,5 % gesunken. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von
vorläufigen Ergebnissen der Wanderungsstatistik
mitteilt, registrierten die Meldebehörden von
Januar bis September 2025 rund 40 000 Zuzüge von
Syrerinnen und Syrern. Von Januar bis September
2024 waren es noch gut 74 600 Zuzüge.
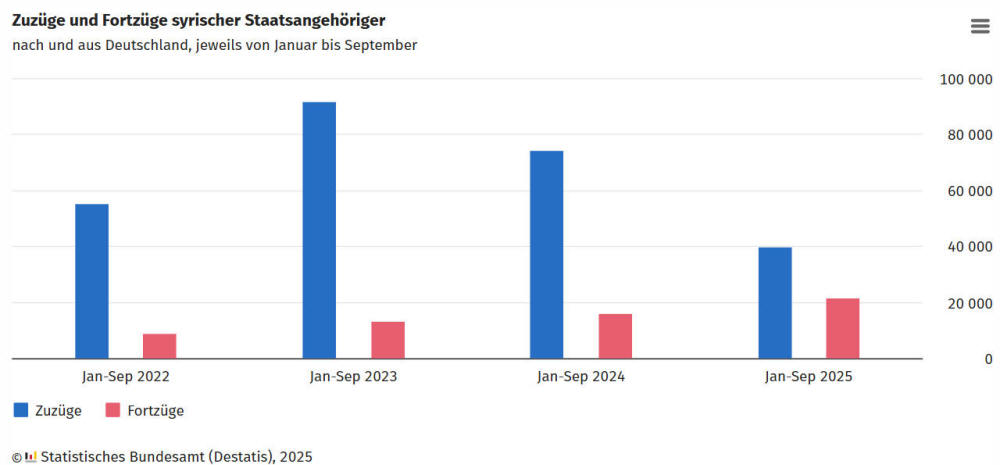
Die Zahl der syrischen Staatsangehörigen,
die aus Deutschland fortzogen, hat sich im
selben Zeitraum dagegen um mehr als ein Drittel
erhöht (+35,3 %). Von Januar bis September 2025
wurden gut 21 800 Fortzüge von Syrerinnen und
Syrern registriert, im Vorjahreszeitraum waren
es gut 16 100. Die Wanderungszahlen beziehen
sich auf syrische Staatsangehörige, sagen also
nichts über die Gründe oder den etwaigen Asyl-
oder Schutzstatus der Abwandernden und
Zuwandernden aus.
Der Rückgang bei den
Zuzügen und der Anstieg bei den Fortzügen
syrischer Staatsangehöriger führten dazu, dass
die Nettozuwanderung deutlich gesunken ist. Von
Januar bis September 2025 lag die
Nettozuwanderung (Zuzüge abzüglich der Fortzüge)
bei 18 100 Personen. Von Januar bis September
2024 war sie noch mehr als dreimal so hoch
(58 500 Personen).
67 % weniger
Erstanträge auf Asyl von Syrerinnen und Syrern
von Januar bis September 2025
Auch im
laufenden Jahr haben Syrerinnen und Syrer Schutz
in Deutschland gesucht. Von Januar bis September
2025 verzeichnete das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge gut
19 200 entsprechende Erstanträge auf Asyl. Das
waren 67,1 % weniger Erstanträge als im
Vorjahreszeitraum (58 400). Mit einem Anteil von
21,9 % blieben syrische Staatsangehörige die
größte Gruppe unter den insgesamt
87 800 Menschen, die von Januar bis September
2025 in Deutschland erstmals Asyl beantragten.
Für die gesamte Europäische Union (EU)
liegen Daten bis einschließlich Juli 2025 vor.
In den ersten sieben Monaten des Jahres gingen
laut EU-Statistikbehörde Eurostat
26 200 Erstanträge auf Asyl von Syrerinnen und
Syrern ein. Das waren 68,8 % weniger als im
Vorjahreszeitraum mit rund 84 100 Erstanträgen.
Syrien war damit im Jahr 2025 nur noch das
drittgrößte Herkunftsland Asylsuchender in der
EU (7 % aller Erstanträge aus Nicht-EU-Staaten)
nach Venezuela (14 %) und Afghanistan (9 %).
Mehr als die Hälfte (61 % bzw. rund 16 000)
aller Anträge von Syrerinnen und Syrern in der
EU in den ersten sieben Monaten des Jahres 2025
wurden in Deutschland gestellt. Insgesamt gab es
von Januar bis Juli EU-weit 396 700 Erstanträge
auf Asyl aus Nicht-EU-Staaten (-27,0 % gegenüber
dem Vorjahreszeitraum).
Nach Angaben
des Flüchtlingshilfwerk
der Vereinten Nationen (UNHCR) sind im
Zeitraum vom 8. Dezember 2024 bis September 2025
weltweit rund 1,0 Million Geflüchtete nach
Syrien zurückgekehrt, ebenso wie
1,8 Millionen Binnenvertriebene innerhalb des
Landes. Laut UNHCR leben weiterhin mehr als
4,5 Millionen Geflüchtete im Ausland und mehr
als 7 Millionen Binnenvertriebene innerhalb
Syriens.
713 000 syrische Schutzsuchende
lebten Ende 2024 in Deutschland – zweitgrößte
Gruppe hinter Ukrainerinnen und Ukrainern
Zu
Schutzsuchenden in Deutschland liegen Daten aus
dem Ausländerzentralregister (AZR) zum Stichtag
31. Dezember 2024 vor – die Entwicklungen nach
dem Regimewechsel in Syrien dürften sich deshalb
noch kaum darin widerspiegeln. Zum Jahresende
2024 waren hierzulande rund 713 000 syrische
Schutzsuchende registriert.
Mit knapp
22 % der insgesamt
3,30 Millionen Schutzsuchenden waren Syrerinnen
und Syrer damit die zweitgrößte Gruppe nach
ukrainischen Staatsangehörigen (33 %).
Schutzsuchende sind Menschen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit, die sich unter Berufung auf
völkerrechtliche, humanitäre oder politische
Gründe in Deutschland aufhalten.
Zu
einem großen Teil leben syrische Schutzsuchende
schon seit Längerem in Deutschland: Knapp die
Hälfte von ihnen (48 %) kam in den Jahren vor
und bis einschließlich 2016 erstmals nach
Deutschland, lebte Ende 2024 also bereits
acht Jahre oder länger hier. 12 % der syrischen
Schutzsuchenden waren in Deutschland geboren.
Die große Mehrheit der syrischen Schutzsuchenden
verfügte Ende 2024 über einen humanitären
Aufenthaltstitel und somit über einen
anerkannten Schutzstatus (642 200 oder 90 %).
In den meisten Fällen handelte es sich
dabei um einen Schutzstatus für Flüchtlinge nach
der Genfer Flüchtlingskonvention (247 700 oder
35 % aller syrischen Schutzsuchenden) oder um
subsidiären Schutz (295 700 oder 41 %). Der
subsidiäre Schutz greift ein, wenn weder der
Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung
gewährt werden können und im Herkunftsland
ernsthafter Schaden droht.
Bei weiteren
knapp 64 200 syrischen Schutzsuchenden war der
Schutzstatus noch offen (9 %). Rund 6 600 (1 %)
hatten einen abgelehnten Schutzstatus, etwa weil
der Asylantrag abgelehnt wurde. Bei 92 % der
rund 642 200 syrischen Schutzsuchenden mit
anerkanntem Schutzstatus war dieser befristet.
83 200 Syrerinnen und Syrer im Jahr 2024
eingebürgert
Deutlich größer als die Zahl
der syrischen Schutzsuchenden ist hierzulande
die der Menschen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte. Laut Mikrozensus lebten
2024 in Deutschland rund
1,22 Millionen Menschen, die selbst (81 %) oder
deren beide Elternteile aus Syrien eingewandert
und die hier geboren sind (19 %). Rund ein
Viertel (24 %) von ihnen besaß die deutsche
Staatsbürgerschaft, etwa durch Einbürgerung.
Laut Einbürgerungsstatistik wurden allein im
Jahr 2024 rund 83 200 Syrerinnen und Syrer
eingebürgert, sie machten mit gut 28 % den
größten Anteil an allen Einbürgerungen aus. Die
meisten Menschen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte lebten in
Nordrhein-Westfalen (363 000, 30 %).
Gut
10 % lebten in Niedersachsen, gefolgt von
Baden-Württemberg und Bayern mit je rund 10 %.
Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte
vergleichsweise jung Personen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte waren 2024
durchschnittlich 26,6 Jahre alt.
Zum
Vergleich: Personen mit Einwanderungsgeschichte
insgesamt hatten ein Durchschnittsalter von
38,2 Jahren. 57 % aller Personen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte waren männlich, 43 %
weiblich. Auch aufgrund des vergleichsweise
niedrigen Altersdurchschnitts waren 723 000 oder
59 % der 1,22 Millionen Personen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte ledig, 450 000 waren
verheiratet (37 %).
17 % der 15- bis
64-Jährigen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte noch in (Aus)-Bildung
Rund 845 000 Menschen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte waren 2024 im
erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren. Davon
waren 46 % bzw. 387 000 Personen erwerbstätig,
8 % bzw. 64 000 erwerbslos und 47 % bzw.
394 000 Nichterwerbspersonen, etwa weil sie noch
in (Aus-)Bildung waren, weil sie
krankheitsbedingt nicht arbeiten konnten oder
weil sie keine Arbeitserlaubnis hatten.
Der Anteil der Nichterwerbspersonen ist deutlich
höher als bei der Bevölkerung mit
Einwanderungsgeschichte insgesamt (26 %) oder
der Bevölkerung ohne Einwanderungsgeschichte
(17 %) im jeweiligen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ein Grund dafür ist, dass sich ein hoher Anteil
der Bevölkerung mit syrischer
Einwanderungsgeschichte aufgrund des niedrigen
Durchschnittsalters noch in (Aus-)Bildung
befindet.
So waren 17 % aller 15- bis
64-Jährigen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte noch in Schule oder
Ausbildung. Zum Vergleich: Dies traf auf 11 %
aller Personen mit Einwanderungsgeschichte bzw.
10 % aller Personen ohne Einwanderungsgeschichte
in dieser Altersgruppe zu.
23 % der
Personen mit syrischer Einwanderungsgeschichte
im Alter von 15 bis 64 Jahren verfügten 2024
über einen berufsqualifizierenden Abschluss
(197 000), davon besaßen 105 000 einen
akademischen Abschluss. 59 % bzw.
502 000 Personen mit syrischer
Einwanderungsgeschichte hatten keinen
berufsqualifizierenden Abschluss. 17 % befanden
sich noch in (Aus-)Bildung.
|