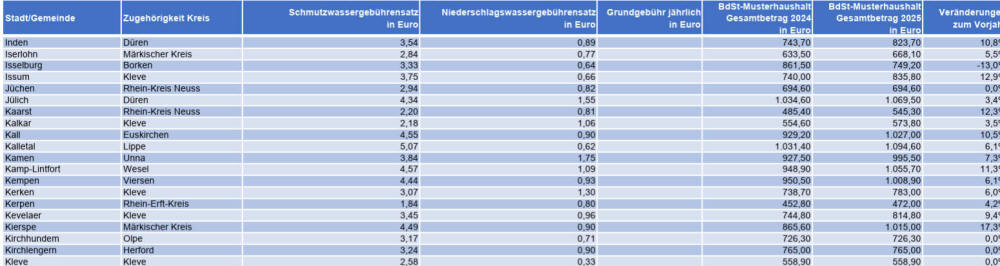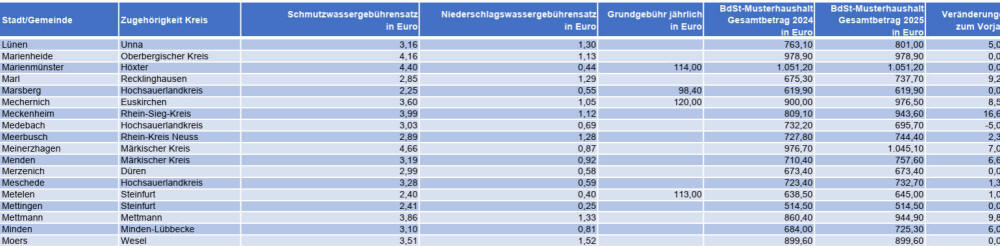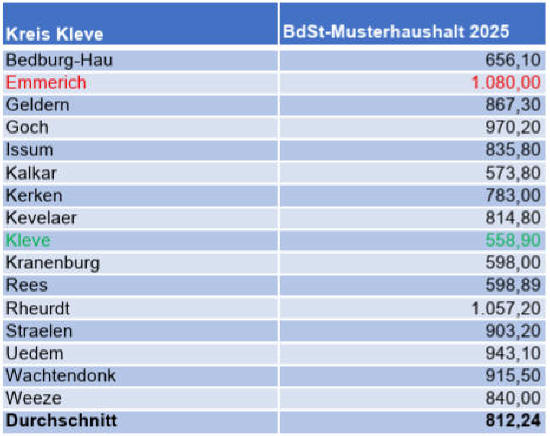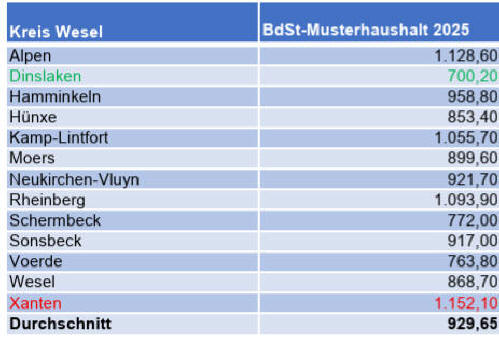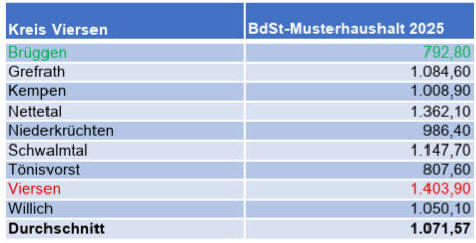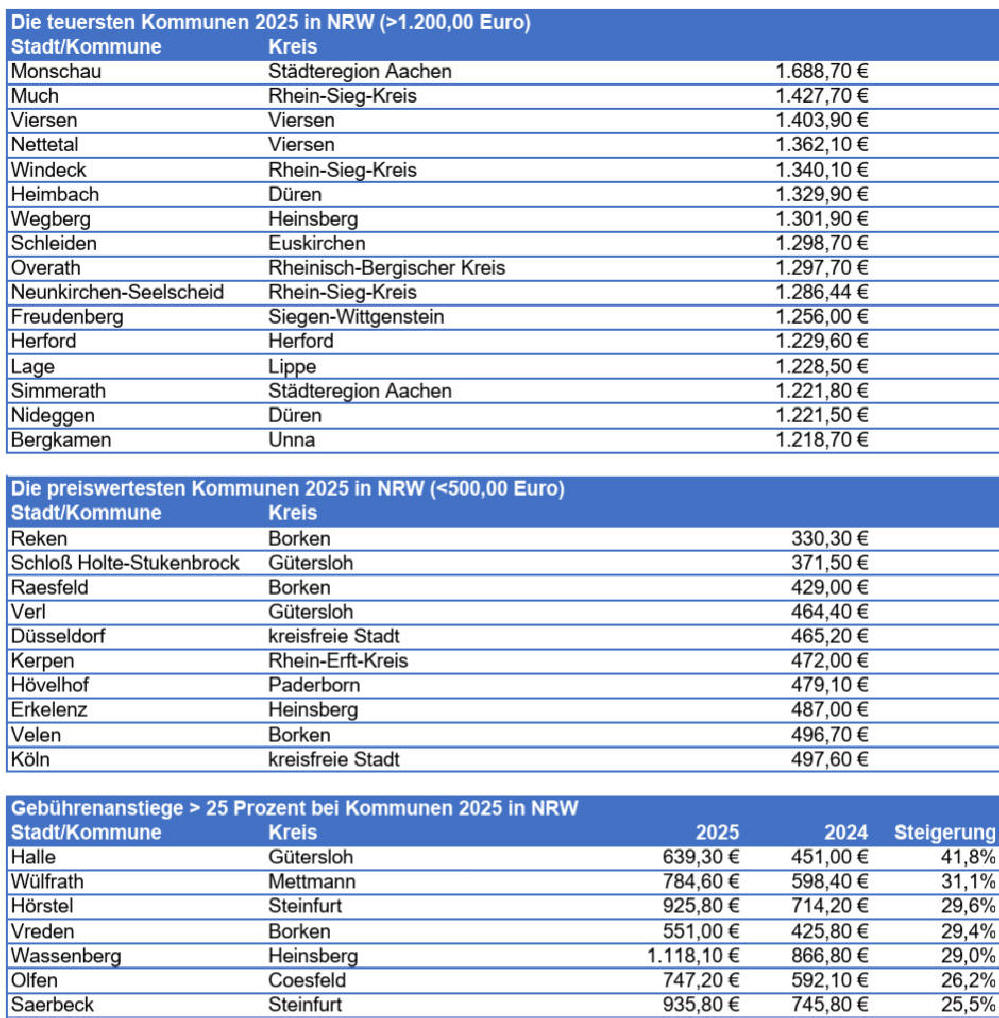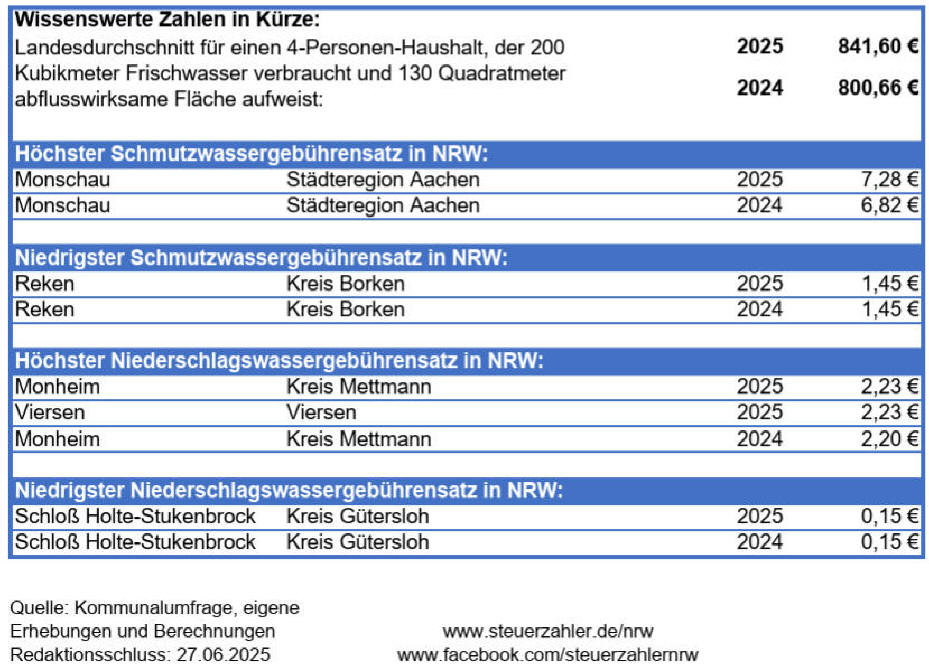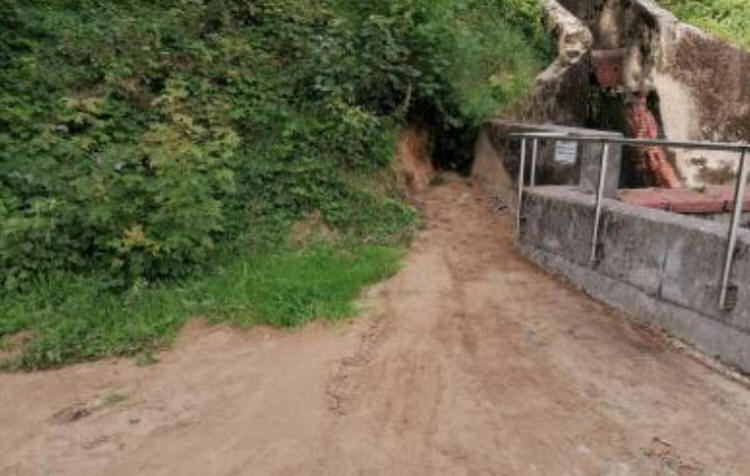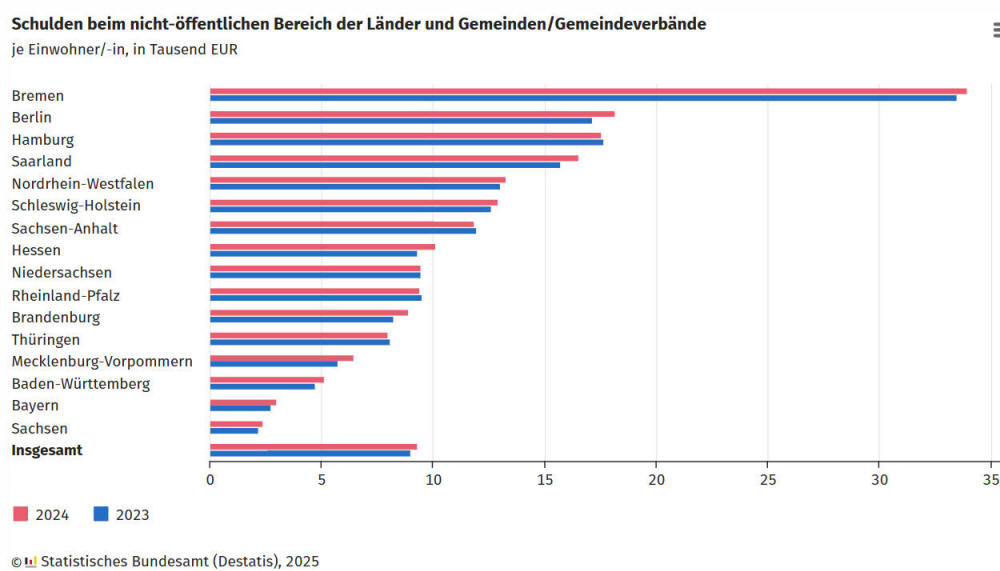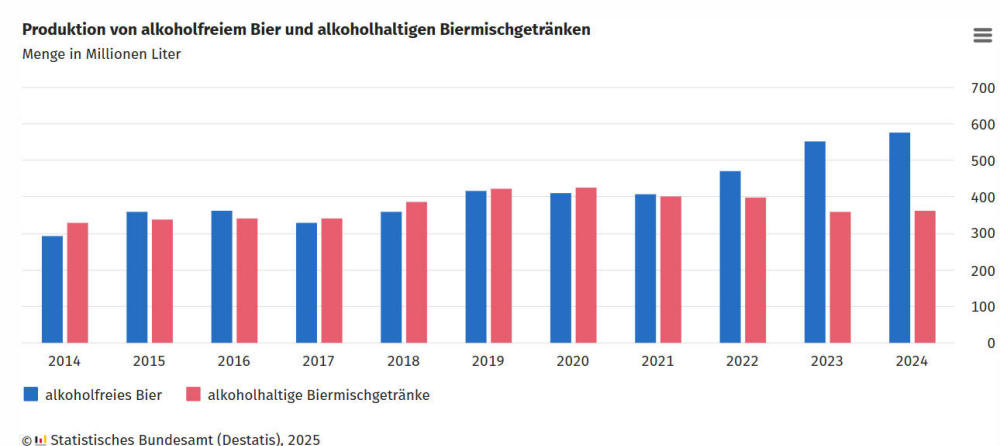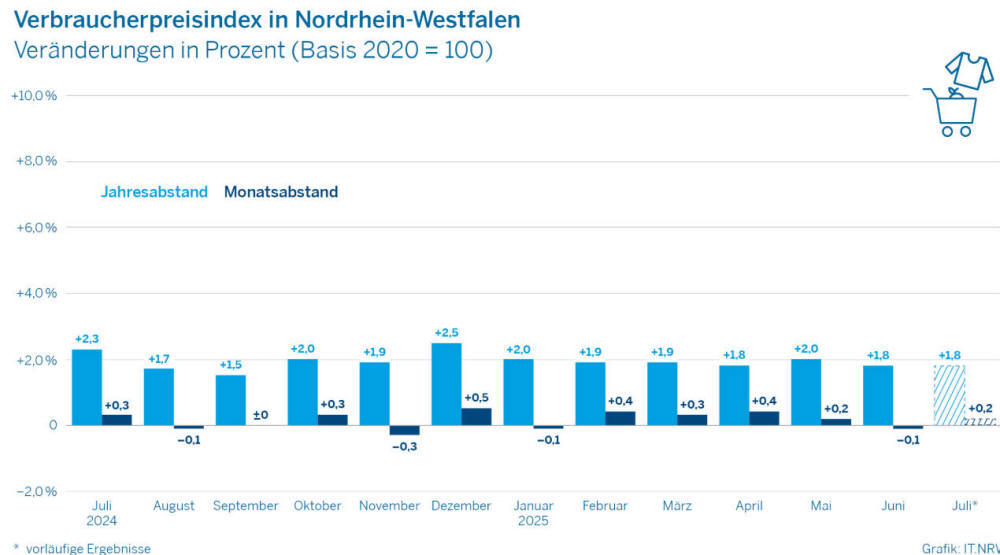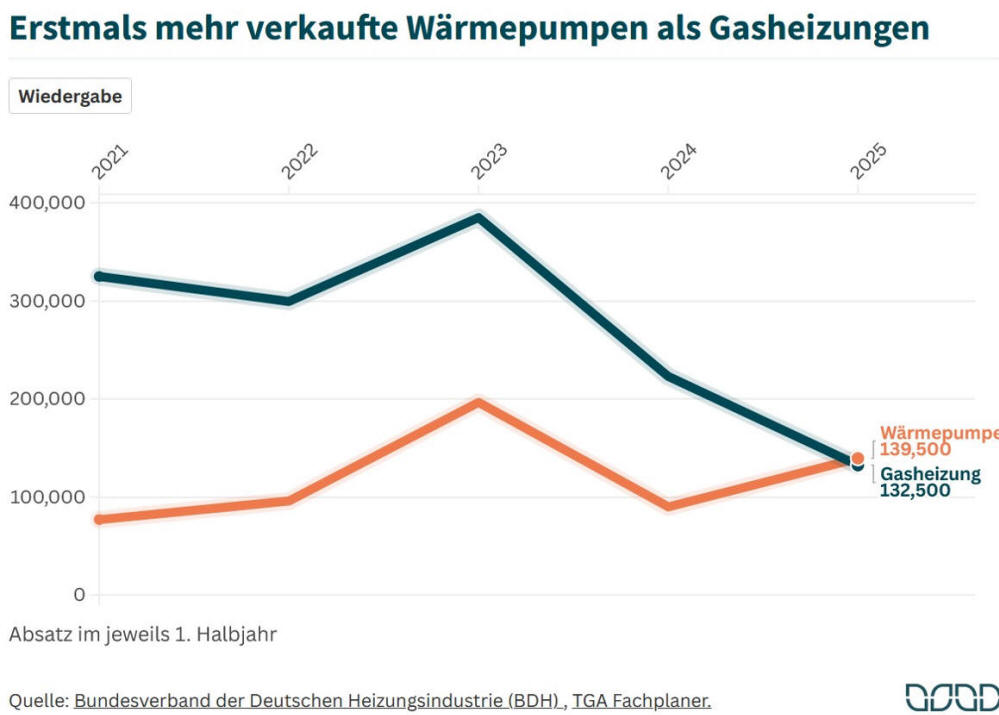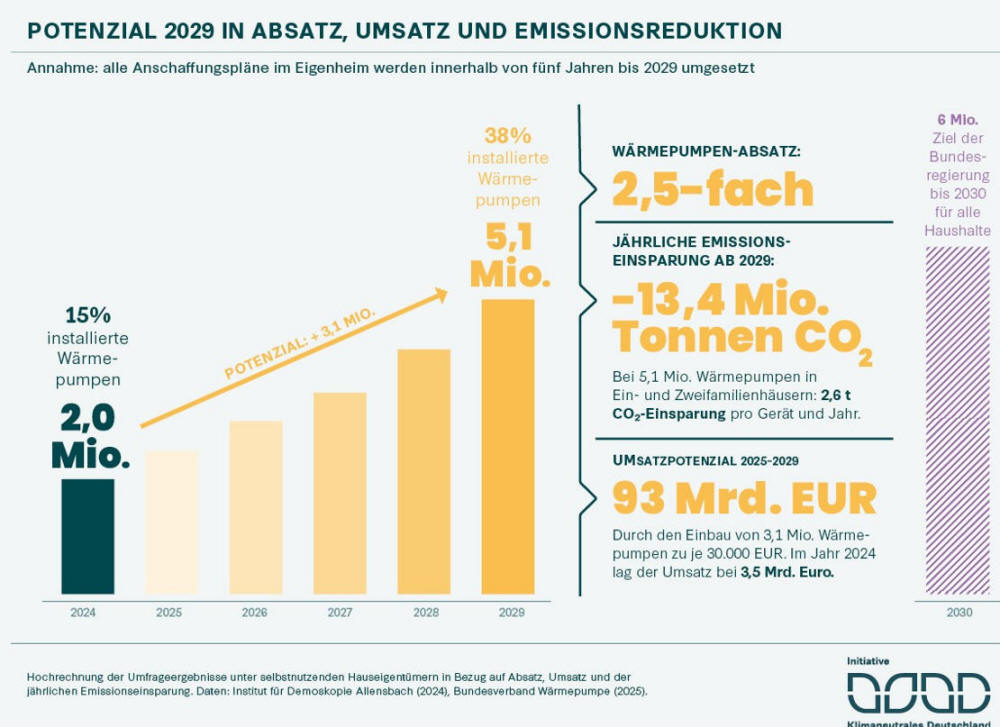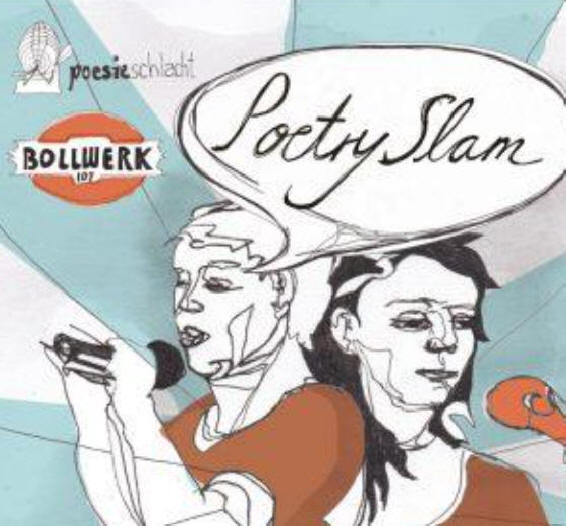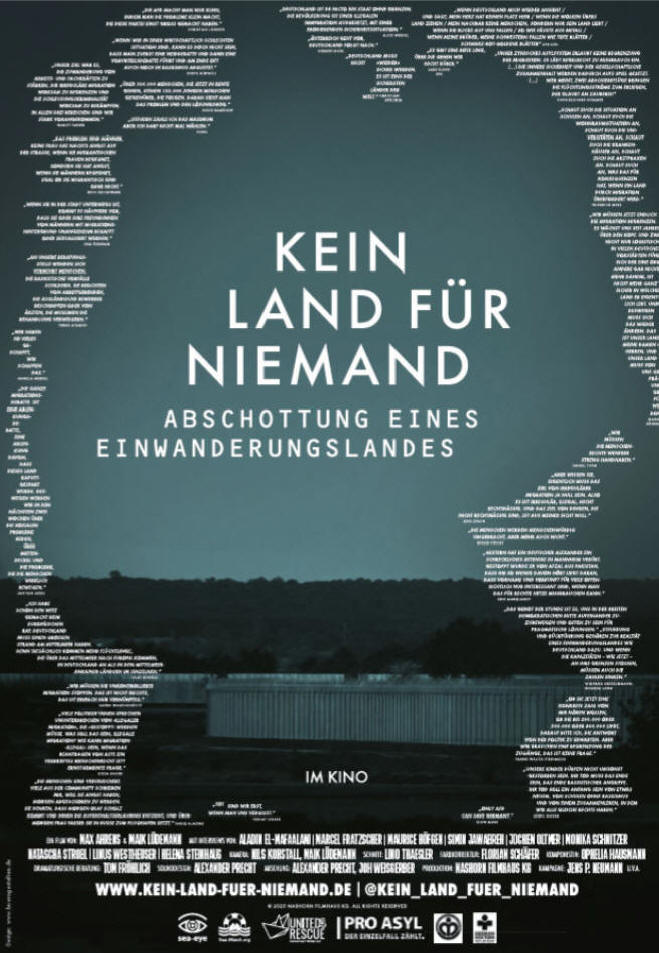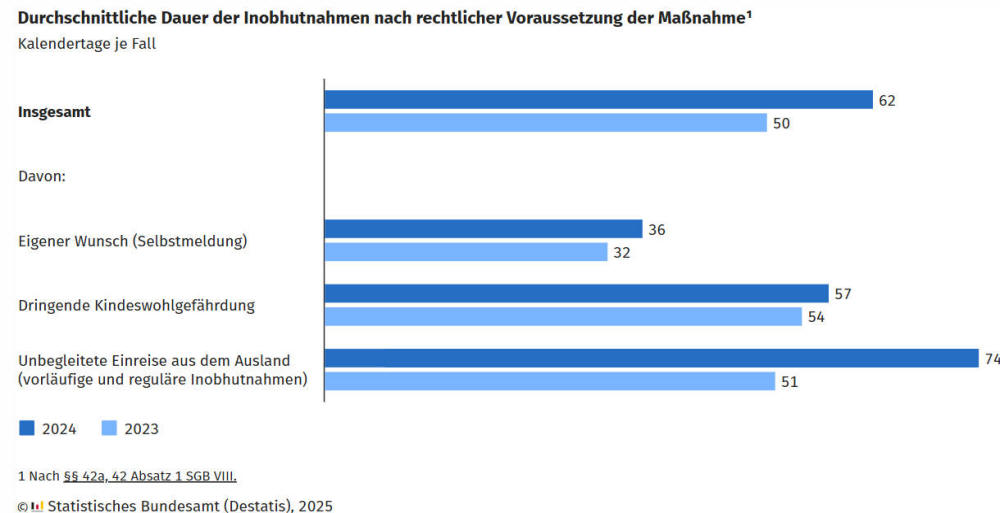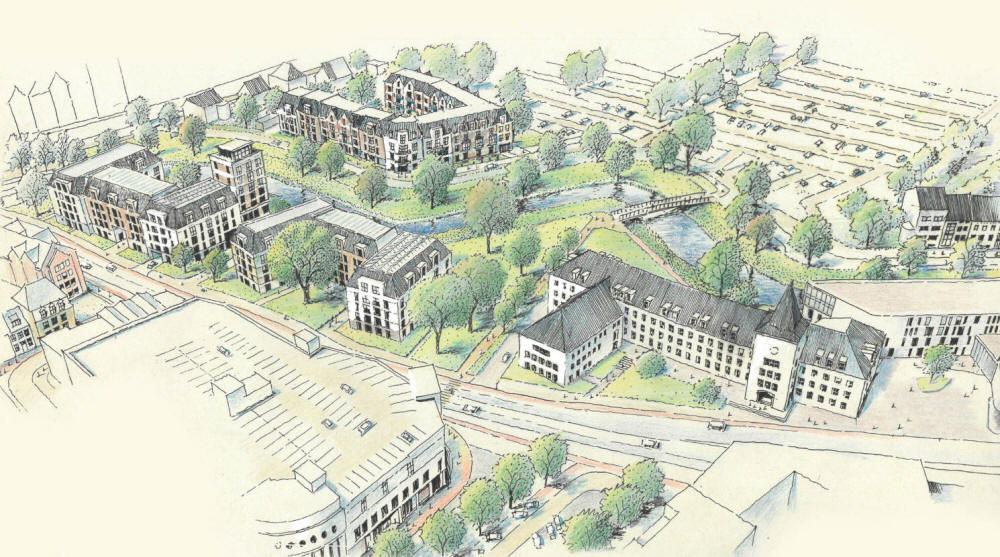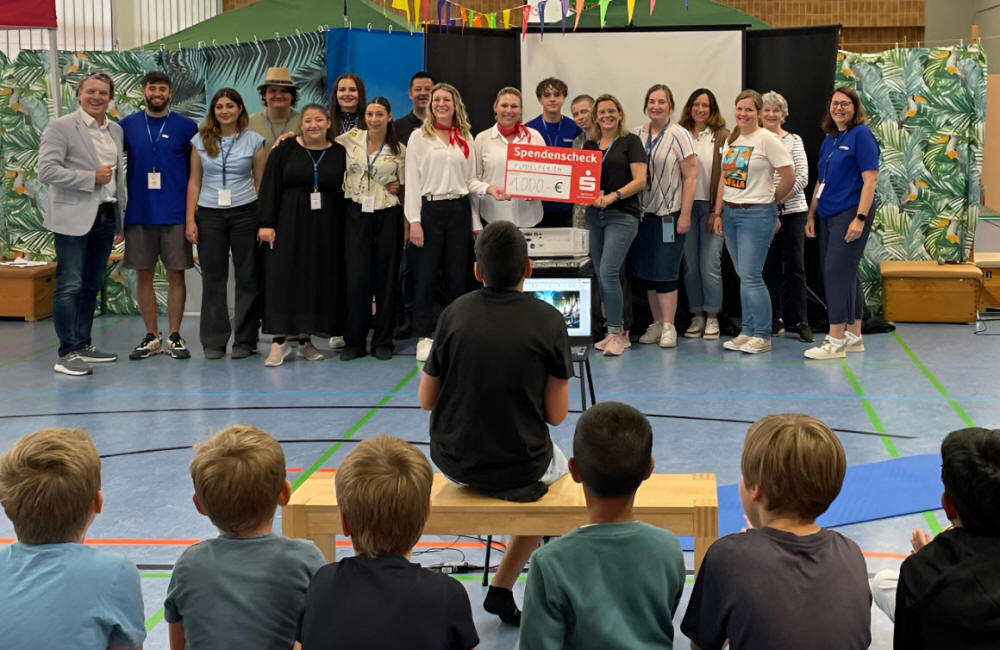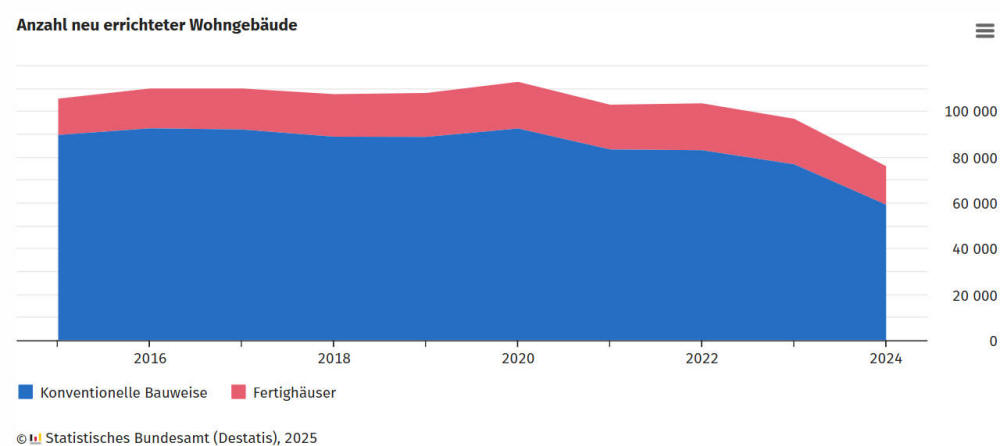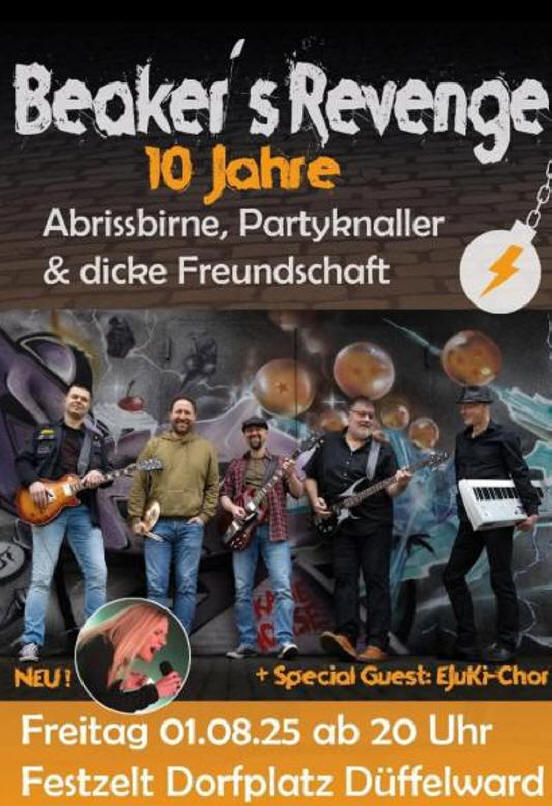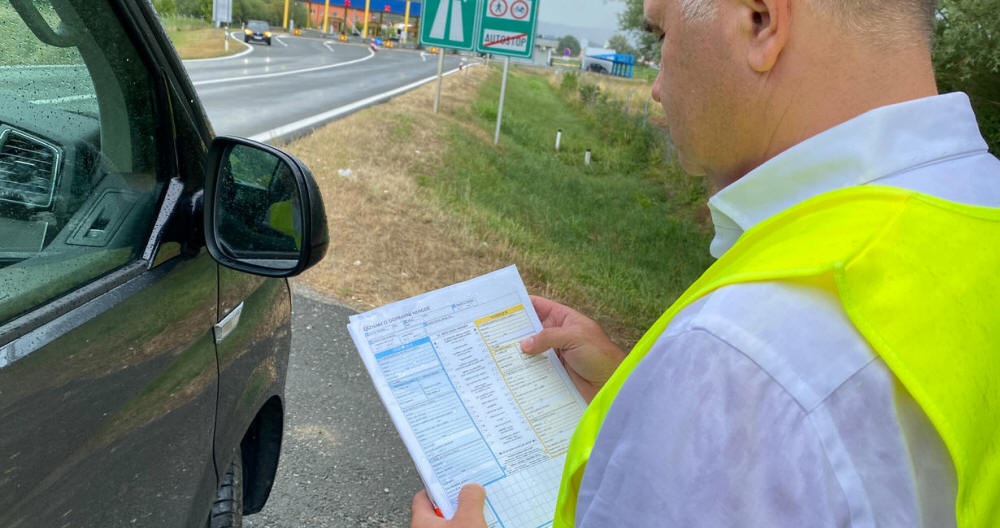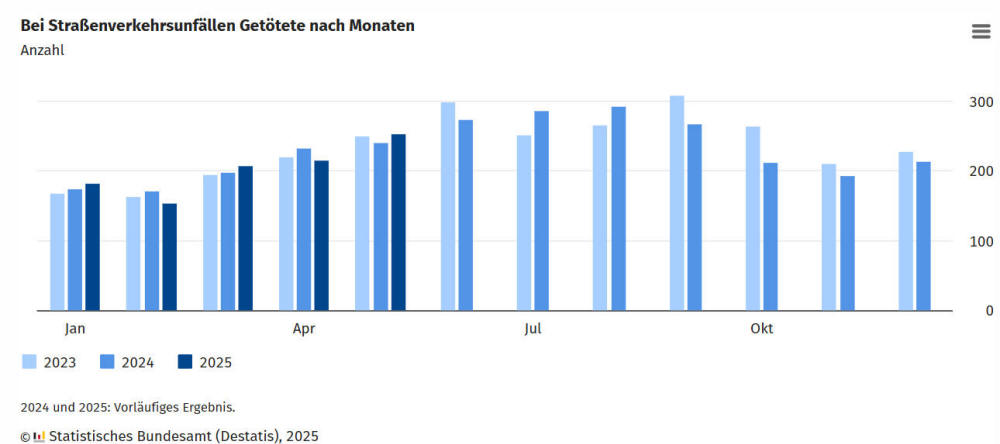|
KW 31: Montag, 28. bis Sonntag, 3. August 2025
Themen u.a.: 1. August ist der
internationalen Tag des Bieres
Gebührenvergleich 2025 für Abwasser in NRW
Der Bund der Steuerzahler gibt jährlich einen
Vergleich der Abfall- und Awassergebühren in NRW
heraus. Am 1. August hat Rik Steinheuer,
Vorsitzender des BdSt NRW, die aktuellen Zahlen
für 2025 und die Forderungen des BdSt auf der
Landespressekonferenz in Düsseldorf vorgestellt:
Wenn Wasserentsorgung zum Luxus wird
Die
Abwassergebühren in NRW erreichen neue
Höchststände. Fast 5,1 % mehr – das ist die
durchschnittliche Steigerung der
Abwassergebühren in NRW für 2025. Für den
Musterhaushalt des BdSt (vier Personen, 200 m³
Schmutzwasser und 130 m² versiegelte Fläche)
bedeutet das eine Jahresrechnung von teils über
1.000 Euro – in 77 von 370 Kommunen, die sich an
der BdSt-Kommunalumfrage beteiligt haben. Im
vergangenen Jahr war es nur in 57 Kommunen so
teuer.
Extreme Unterschiede zwischen den
Kommunen
Die Bandbreite ist enorm: Während in
Reken nur 330 Euro fällig werden, verlangt
Monschau satte 1.688 Euro – über 400 %
Unterschied für dieselbe Leistung. In einigen
Städten wie Halle, Wülfrath oder Vreden sind die
Gebühren binnen eines Jahres sogar um über 25 %
gestiegen.
Woran liegt das? Der BdSt NRW
hat die Ursachen analysiert:
Preissteigerungen bei den
Wasserwirtschaftsverbänden, die von den Kommunen
an die Gebührenzahler weitergegeben werden
Tarifbedingte höhere Personalkosten
Neue
gesetzliche und technische Vorgaben (z. B.
EU-Wasserrahmenrichtlinie, vierte
Reinigungsstufe)
Und vor allem:
kalkulatorische Abschreibungen vom teuren
Wiederbeschaffungszeitwert statt von den
günstigeren Anschaffungskosten
Der letzte
Punkt ist besonders brisant, denn die
Abschreibungen vom Wiederbeschaffungszeitwert
sind auf dem Vormarsch: 2022 haben 51 % der
Kommunen vom teureren Wiederbeschaffungszeitwert
abgeschrieben, heute sind es schon 55 %. Dieser
Trend ist ein langfristiger. Im Jahr 2010 waren
die Kommunen, die vom Wiederbeschaffungszeitwert
abgeschrieben haben, mit 37,5 % noch deutlich in
der Minderzahl. Die Folge: höhere Gebühren für
die Verbraucher und damit eine versteckte
Mehrbelastung bei den Wohnkosten für
Grundstückseigentümer und Mieter.
Was der
BdSt NRW fordert
Abschreibungen sollen sich
am Anschaffungswert orientieren – nicht am
teureren Wiederbeschaffungszeitwert. Solange die
Kommunen in NRW vom Wiederbeschaffungszeitwert
abschreiben dürfen, sollte das KAG verbindlich
regeln, dass der Abwassergebührenzahler den
allgemeinen Haushalt der Kommune nicht
subventioniert.
Generell klare gesetzliche
Regelungen: Gewinne aus Gebührenhaushalten
dürfen nicht in den allgemeinen Haushalt
abfließen. Doppelbelastungen für Eigentümer
(z. B. durch Abschreibung beitragsfinanzierten
Vermögens) müssen gesetzlich verhindert werden.
NRW sollte sich an gesetzlichen Vorbildern wie
Sachsen und Brandenburg orientieren.
Lichtblicke gibt es auch Es geht auch anders:
Kommunen wie Welver, Emsdetten, Rosendahl oder
Sonsbeck senken die Gebühren – zum Beispiel,
indem sie Überschüsse aus Vorjahren zur
Entlastung der Bürger nutzen.
Der BdSt
sagt:
„Viele Kommunen nutzen die Spielräume
im Gesetz zu Lasten der Gebührenzahler aus. Das
muss ein Ende haben“, betont Rik Steinheuer,
Vorsitzender des BdSt NRW. „Wir brauchen
gesetzliche Leitplanken, damit Gebühren nicht
zur versteckten Einnahmequelle werden.
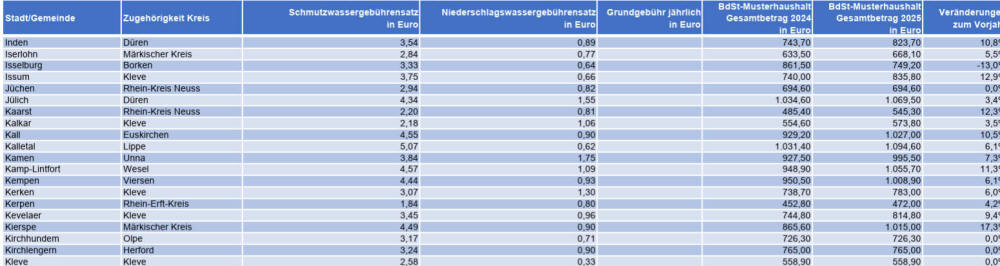
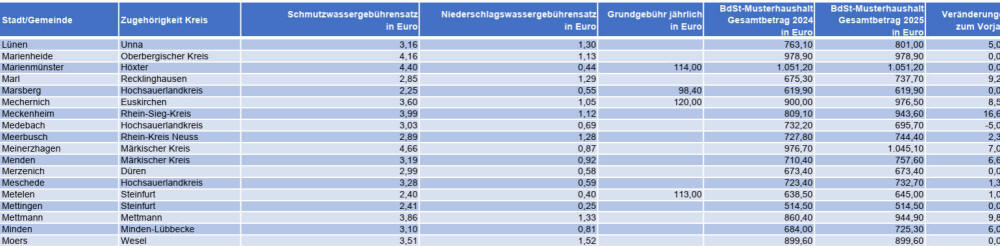
Kreisvergleich:
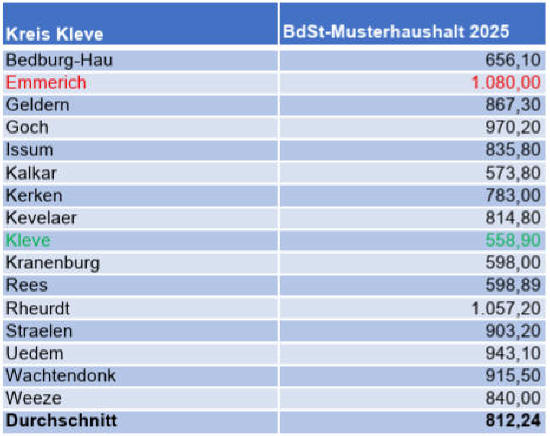
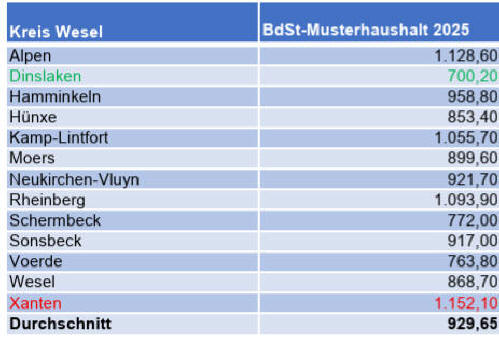
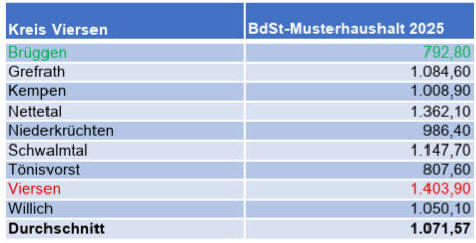
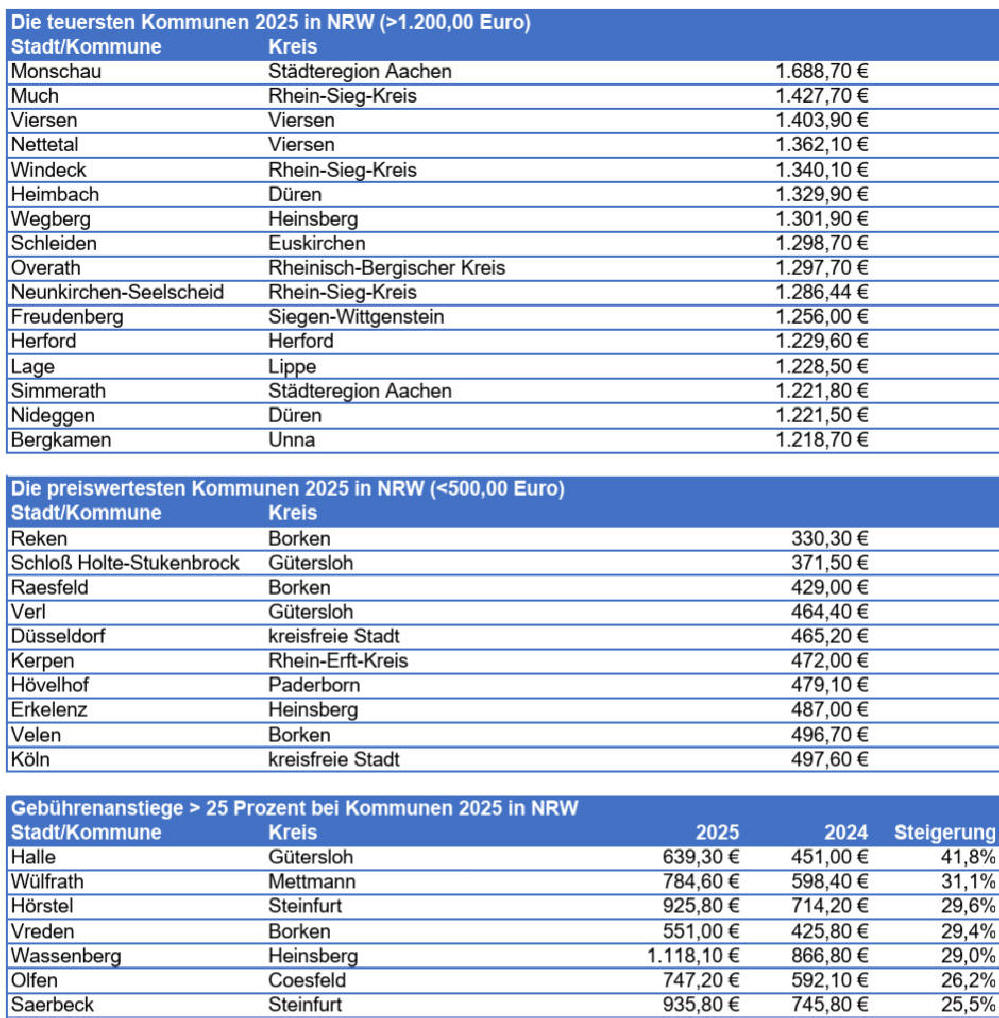
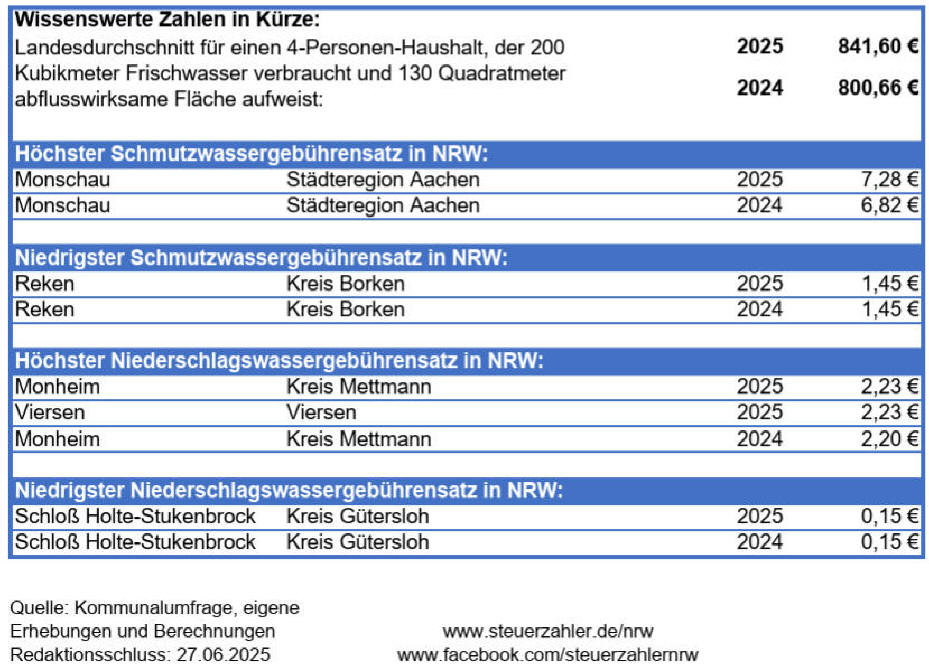
Moers: Enni-Jubiläum - Erlebnistour mit tollen
Angeboten und Preisen
Zum Jubiläum veranstaltet Enni mit regionalen
Partnern und der Maus ein großes Familienfest
Die Enni feiert ihren 25. Markengeburtstag – und
das mit einem Fest für die ganze Familie: Am 30.
August verwandelt sich der Firmensitz der
Unternehmensgruppe am Jostenhof in Moers dabei
ab 14 Uhr in eine riesige Erlebnisfläche, mit
viel Action und spannenden Einblicken in die
Welt der Enni und einiger ihrer regionalen
Partner.
Für den Vorstandsvorsitzenden
Stefan Krämer geht es beim Enni-Erlebnistag um
mehr als eine reine Leistungsschau: „Wir wollen
den Menschen unserer Region neben tiefen
Einblicken in unsere Aufgaben vor allem einen
unterhaltsamen Tag mit Freizeitspaß bieten. Mit
vielen Mitmachaktionen und einem unterhaltsamen
Programm ist für Groß und Klein vieles dabei,“
ist Krämer sicher.

Vor dem vertikalen Garten am Firmensitz sind die
Vorstände Stefan Krämer und Dr. Kai Gerhard
Steinbrich mit dem Vorbild eines Fahrzeuges, das
es für Teilnehmer eines Gewinnspiels am
Aktionstag für ein Jahr zu gewinnen gibt.
Damit dies gelingt, können Besucher an
neun Erlebnispunkten in unterschiedliche
Themenwelten der Enni eintauchen. Auf der
Aktionsbühne gibt es zudem ein tolles Programm
und auf einem Street-Food-Markt und in einer
Cafeteria, die die Bäckerei Büsch als
Kooperationspartner im Innenhof der Verwaltung
betreibt, ein gastronomisches Angebot zu
familienfreundlichen Preisen. Ab 18 Uhr steigt
eine Party, mit dem Gesangsduo Edwina De Pooter
und Dirk Elfgen sowie der 70er-Jahre-Glitterband
Glam Bam als Local Hero und Headliner.
„Der Niederrhein ist eingeladen, mit uns ein
tolles Fest zu feiern“, rechnet Krämer mit
vielen Besuchern. Da der Jostenhof hierfür keine
Parkplätze bietet, sollten Gäste mit dem Fahrrad
oder dem eingerichteten Shuttleservice kommen.
„Der Berufsbildungscampus und das Handwerkliche
Bildungszentrum in der Repelener Straße geben
uns die Möglichkeit, hier einige hundert
Parkplätze zu nutzen, von denen aus zwei Busse
in wenigen Minuten zu uns pendeln.“
So
wird die Enni ihren gemeinsam erst 2021
bezogenen Firmensitz erstmals der Region
vorstellen, von dem aus heute rund 600
Mitarbeiter viele kommunale Aufgaben erledigen,
Sport- und Freizeitstätten betreiben und dem
Niederrhein Energie geben. Da hier mit Ausnahme
der im Stadtgebiet verstreuten
Freizeiteinrichtungen heute Unternehmensteile
ansässig sind, gibt es viel zu sehen.
An
neun Stationen präsentieren Teams ihre
Arbeitsbereiche, vielfach unterstützt durch
regionale Partner. Dabei sind mehrere
Autohäuser, E-Bike-Anbieter, ein Landwirt und
auch die LINEG, der Asdonkshof oder die Bäckerei
Büsch, die aus dem Moerser Wasserschutzgebiet
Sommerrogen für Vollkornbrot bezieht. Auch Radio
KW ist dabei, aus dem Gläsernen Studio berichten
Moderatoren live vor Ort. „Ob Technik, Umwelt,
Energie oder Sport – an allen
Erlebnispunkten wird ausprobiert, gestaunt,
gespielt und gelacht“, sagte Dr. Kai Gerhard
Steinbrich, der gestern mit Stefan Krämer das
Veranstaltungsplakat vorstellte.
Dabei
führt die sogenannte Erlebnisrallye Besucher
durch alle Stationen, an denen sie auf einer
Karte Punkte für ein Gewinnspiel sammeln können.
Hier winken attraktive Preise, wie ein
Elektroauto, das Enni in Kooperation mit
Automobile Minrath als ihrem direkten Nachbarn
für ein Jahr kostenlos an den Hauptgewinner
übergibt. Für Kinder gibt es spezielle Preise,
wie Geburtstagsfeten in den Sport-einrichtungen.
Übrigens: Jeder Teilnehmer an der Rallye
erhält ein Gläschen des am Bienenstock des
Jostenhofs gewonnenen Honigs.
Der
Erlebnistag bietet aber mehr: Ganz praktisch
gestaltet sich beispielsweise das Thema ‚Neue
Energie‘ mit E-Auto-Probefahrten,
E-Bike-Parcours, VR-Panoramaschaukel mit Flug
über den Niederrhein und einer Kreativwerkstatt
zur Energiewende. Spektakulär wird es hier am
Überschlagsimulator der DEKRA. Sportlich geht es
beim Enni-Mehrkampf im Sportbereich zu, bei dem
Penalty-Challenge, Torwandschießen oder ein
Klettergarten – als Vorgeschmack auf das
zukünftige Angebot im Solimare – angesagt sind.
An vielen Stationen können Besucher
sowieso gleich mitmachen.
Wer besonders mutig
ist, kann sich aus einem Kanal retten lassen
oder schwere Geräte und Fahrzeuge ausprobieren.
Beim Besuch des Salzlagers erfahren Besucher wie
Winterdienst funktioniert und am
Kreislaufwirtschaftshof gibt es pro Stunde eine
Road-Show mit Führungen.
Auf die
jüngsten Besucher wartet ‚Die Maus‘ des WDR, das
Enni-Maskottchen und an der Wasserstation eine
Wasserbaustelle und ein kleiner Bauernhof mit
Hühnern und Mähdrescher. Den bringt der Landwirt
Fritz Eickhaus mit, der im Wasserschutzgebiet
mit seinem Betrieb wirtschaftet und den durch
die Bäckerei Büsch benötigten Roggen anbaut.
Kinder können zudem an einer Kinderbaustelle
einen Bagger fahren, an einem Bobby-Car-Rennen
teilnehmen, im Lerntheater Abfall Spaß haben und
in der Radio KW-Radio-Box lernen, wie Radio
geht. Letztendlich öffnet Enni auch ihre
Verwaltung. Da es hier ansonsten kaum Besucher
gibt, bietet Enni am Erlebnistag exklusive
Führungen durch das Gebäude inklusive eines
Abstechers in die Vorstandsetage an.
Hierzu müssen sich Interessierte aber im Vorfeld
unter
www.enni.de/erlebnistag anmelden. Dort gibt
es auch weitere Informationen zum Angebot. „Es
ist also angerichtet und wir freuen uns auf gut
gelaunte Besucher“, sagen die beiden Vorstände
unisono.
Die NATO verstärkt ihre maritime
Präsenz in der Arktis und im hohen Norden
Nordatlantik – Eine maritime Einsatzgruppe der
NATO ist derzeit in den Gewässern der Arktis und
des hohen Nordens im Einsatz und bekräftigt
damit das Engagement des Bündnisses für die
kollektive Sicherheit in dieser zunehmend
strategischen Region. Im Rahmen der Operationen
werden Schiffe und Flugzeuge der Ständigen
Maritimen Gruppe 1 der NATO (SNMG1)
zusammengeführt, um in der gesamten Region
maritime Präsenzoperationen durchzuführen.
Die Operationen in der Arktis und im hohen
Norden spiegeln das anhaltende Engagement des
Bündnisses für Frieden, Stabilität und Freiheit
der Schifffahrt wider. Operationen in dieser
Region erfordern Widerstandsfähigkeit,
Anpassungsfähigkeit und reibungslose
Zusammenarbeit – Eigenschaften, die die
NATO-Streitkräfte täglich unter Beweis stellen.“

Schiffe der Ständigen Maritimen Gruppe Eins der
NATO in Formation für eine Fotoübung in der
Barentssee während ihres Einsatzes im hohen
Norden und in der Arktis
Die maritime
Präsenz der NATO in der Region spiegelt die
zunehmende internationale Aufmerksamkeit für die
Arktis wider, wo das schmelzende Meereis neue
Schifffahrtswege und den Zugang zu natürlichen
Ressourcen eröffnet. Gleichzeitig verbessert das
Bündnis seine maritimen Kenntnisse in der
gesamten Region, um die Umwelt besser zu
verstehen und die Reaktionsbereitschaft auf
Eventualitäten zu erhöhen.
Die
Seestreitkräfte der NATO müssen sich zudem mit
der Herausforderung auseinandersetzen, in einem
dynamischen und sich wandelnden maritimen Umfeld
wie der Arktis und dem hohen Norden zu
operieren. Angesichts des zunehmenden
Seeverkehrs arbeiten die NATO-Streitkräfte
weiterhin eng mit regionalen Verbündeten und
Partnern zusammen, um sichere Seewege zu
gewährleisten, operative Erfahrungen in der
Region zu sammeln und potenziell
destabilisierende Aktivitäten zu verhindern.
Durch die Aufrechterhaltung einer
routinemäßigen und belastbaren maritimen Präsenz
stellt das Bündnis sicher, dass diese
strategisch wichtige Region für alle Nationen
sicher, zugänglich und friedlich bleibt. Sieben
Bündnisstaaten – Kanada, Dänemark, Finnland,
Island, Norwegen, Schweden und die Vereinigten
Staaten – verfügen über Gebiete innerhalb des
Polarkreises und spielen eine Schlüsselrolle bei
der Unterstützung des kooperativen und
integrativen Ansatzes des Bündnisses zur
Sicherheit in der Arktis.
Die SNMG1 ist
eine der vier ständigen maritimen Einsatzgruppen
der NATO unter der operativen Kontrolle des
Allied Maritime Command (MARCOM). Diese
Einsatzgruppen bilden die maritime Kernkompetenz
der Allied Reaction Force (ARF) der NATO und
gewährleisten die kontinuierliche maritime
Fähigkeit zur Durchführung von NATO-Missionen
über das gesamte Operationsspektrum hinweg.
Sie demonstrieren Solidarität und stärken
den Zusammenhalt und die Interoperabilität
zwischen den alliierten Seestreitkräften. Das
Allied Maritime Command (MARCOM) ist das
zentrale Kommando aller Seestreitkräfte der NATO
und der MARCOM-Kommandeur ist der wichtigste
maritime Berater des Bündnisses.
Stadt Wesel wählt im Herbst
ehrenamtliche Schiedspersonen für die
Schiedsamtsbezirke Wesel I und Wesel III und
sucht noch Kandidaten
Schiedsfrauen und Schiedsmänner helfen den
Beteiligten bei kleineren zivil- und
strafrechtlichen Streitigkeiten, ihre
Auseinandersetzung unbürokratisch und
kostengünstig beizulegen.

Wesel - Amtsgericht am Herzogenring 33 Quelle:
Flaggschiff Film
Schiedspersonen arbeiten
ehrenamtlich und werden unter Aufsicht des
Amtsgerichtes tätig. Sie entscheiden nicht wie
ein Richter, sondern haben die Aufgabe, zwischen
den sich streitenden Parteien zu schlichten.
Die Schiedsamtsbezirke Wesel I und Wesel
III sind im Herbst 2025 neu zu besetzen. Daher
macht die Stadt Wesel darauf aufmerksam,
dass sich interessierte Personen um das Amt
bewerben können und Bewerbungen von Menschen mit
Migrationshintergrund ausdrücklich erwünscht
sind. Schiedspersonen können wiedergewählt
werden.
Aktuell stellt sich die
amtierende Schiedsperson für den Schiedsbezirk
Wesel I für eine Wiederwahl zur Verfügung. Für
den Schiedsamtsbezirk Wesel III liegen bislang
noch keine Bewerbungen vor.
Interessierte Personen, die diese ehrenamtliche
Aufgabe wahrnehmen möchten, sollten über ein
ausgeprägtes Rechtsempfinden verfügen, in dem
jeweiligen Schiedsamtsbezirk ihren Wohnsitz
haben und mindestens 25 Jahre alt sein.
Der Schiedsamtsbezirk Wesel I umgrenzt
folgendes Gebiet: Nördliche Innenstadt,
Schepersfeld, Feldmark bis Grenze Flüren. Der
Schiedsamtsbezirk Wesel III erstreckt sich auf
das Gebiet von Grav-Insel über Flürener Feld und
Flürener Heide bis einschließlich Blumenkamp.
Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Mitzubringen sind gesunde
Menschenkenntnis, Lebenserfahrung, Geduld, die
Fähigkeit zur Abfassung von schriftlichen
Protokollen und Vergleichen sowie die
Bereitschaft, an Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Nicht
gewählt werden kann, wer die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt und
wer unter Betreuung steht. Zur Schiedsperson
soll nicht gewählt werden, wer das 75.
Lebensjahr vollendet hat.
Die
Schiedspersonen werden durch den Rat der Stadt
Wesel für die Dauer von fünf Jahren gewählt.
Anschließend bestätigt die Leitung des
Amtsgerichts Wesel die Wahl und bestellt die
Gewählten zu Schiedspersonen. Bewerbungen können
schriftlich bei der Stadt Wesel (Rechtsservice,
Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel) bis zum 01.
September 2025 eingereicht werden.
Neben
Angaben zur Person (Name, Vorname, Geburtsname,
Geburtstag, Geburtsort, Beruf, Anschrift) sollte
die Bewerbung auch einen kurzen Lebenslauf
beinhalten. Für Rückfragen stehen die
Mitarbeiter*innen des Rechtsservice der Stadt
unter der Rufnummer 0281/203-2511 sowie 203-2412
zur Verfügung
.
Kleve: Prinz-Moritz-Weg:
Uferwanderweg am Kermisdahl vorübergehend
gesperrt
Die Bodenausspülung
am Fuße der Kaskade. Infolge der
Starkregenereignisse in der vergangenen Woche
muss der Uferwanderweg entlang des Kermisdahls
auf Höhe der Kaskade vorübergehend gesperrt
werden.
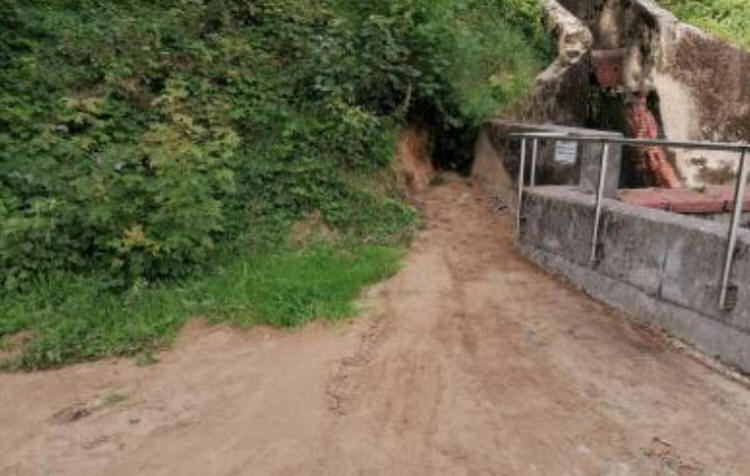
Bodenausspülung Kaskade Juli 2025
Starker Niederschlag hat am Fuße der Kaskade
stellenweise zu Bodenausspülungen geführt, die
auch den Fußweg vor der Kaskade betreffen und
dort zu einer erhöhten Rutschgefahr führen. Im
Rahmen der Verkehrssicherung wurde nun die
Entscheidung getroffen, den betroffenen Bereich
zu vorübergehend sperren.
Schäden an dem
Kaskadenbauwerk sind nicht eingetreten, der Hang
ist durch die eingebrachten Spundwände weiterhin
gesichert. Der Böschungsbereich wird nun
kurzfristig wieder angefüllt und befestigt.
Voraussichtlich dauern die Arbeiten rund zwei
Wochen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der
Uferwanderweg wieder freigegeben.
Amtsblatt
Die Stadt Moers hat ein Amtsblatt
veröffentlicht. Alle veröffentlichten
Amtsblätter finden Sie unter https://www.moers.de/rathaus-politik/amtsblaetter
Amtsblatt Nr. 13 vom 31.07.2025 (812.22 KB)

NRW: Flächen für Weizenanbau im Jahr 2025 um
21 % gestiegen
* Getreide wird auf 51,7 % der Ackerfläche
angebaut.
* Kartoffelflächen nehmen weiter
zu.
* Rückgang bei den Flächen für den Anbau
von Silo- und Körnermais.
Die
Anbaufläche für Weizen wurde in
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2025 gegenüber 2024
um 21,2 % auf 253.000 Hektar ausgedehnt (2024:
208.800 Hektar). Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
anhand von ersten, vorläufigen Ergebnissen der
Bodennutzungshaupterhebung mitteilt ist das die
größte Fläche für Weizenanbau seit 2019.

C Pixabay
Getreide wird auf 51,7 % der
Ackerfläche angebaut Den größten Anteil an der
nordrhein-westfälischen Getreidefläche hat
traditionell Winterweizen. Mit 248.600 Hektar
wurde er in diesem Jahr auf 23,2 % des
Ackerlandes angebaut; die Fläche dieser
Getreideart war damit um 50.000 Hektar (+25,2 %)
größer als 2024. Beim Sommerweizen nahm die
Anbaufläche auf 4.400 Hektar ab (−5.800 Hektar).
Insgesamt bauten die
nordrhein-westfälischen Landwirte im Jahr 2025
auf 553.700 Hektar (+5,2 % gegenüber 2024)
Getreide an; das ist etwas mehr als die Hälfte
der gesamten Ackerfläche (51,7 %). Einen
Rückgang der Anbauflächen gab es bei Silo- und
Körnermais: Silomais wurde in diesem Jahr auf
210.400 Hektar angebaut; das waren 2,3 % weniger
als 2024 (damals: 215.300 Hektar).
Die
Anbaufläche von Körnermais wurde von
84.700 Hektar um 14,3 % auf 72.500 Hektar
verringert. Bei Silomais wird die gesamte
Pflanze geerntet, zu Silage verarbeitet und in
Silos gelagert, um z. B. als Futtermittel oder
als Substrat für Biogasanlagen verwendet zu
werden.
Beim Körnermais werden nur die
Maiskörner geerntet, die restlichen
Pflanzenbestandteile verbleiben auf dem Feld.
Kartoffelflächen auch 2025 ausgeweitet Die
Anbaufläche für Winterraps wurde 2025 wieder
ausgedehnt, nachdem 2024 ein Rückgang zu
verzeichnen war. Winterraps wurde auf
57.400 Hektar angebaut (2024: 52.900 Hektar).
Die Anbaufläche von Kartoffeln erhöhte
sich dem Trend der letzten Jahre entsprechend
weiter um 6,7 % auf 47.800 Hektar (2024:
44.800 Hektar). Die Anbaufläche von Zuckerrüben
gingen um 6,4 % auf 57.200 Hektar (2024:
61.100 Hektar) zurück.
Der Durchschnittsmensch in
Deutschland: Wie er lebt, wohnt und arbeitet
• Ende 2024 war der Durchschnittsmensch 44,9
Jahre alt, die Durchschnittsfrau war gut
zweieinhalb Jahre älter als der
Durchschnittsmann
• Der Durchschnittsmensch
lebt mit einer weiteren Person zusammen in einem
Haushalt, die Durchschnittswohnung hat 94,4
Quadratmeter
Ob von jung bis alt, von
klein bis groß oder von arm bis reich: Mal
angenommen, ein Mensch in Deutschland stünde für
alle 83,6 Millionen, die hier leben. Dann wäre
dieser Durchschnittsmensch 44,9 Jahre alt zum
Jahresende 2024. Das teilt das Statistische
Bundesamt (Destatis) zum Start einer Sonderseite
mit, die den Durchschnittsmenschen in
Deutschland in vielen verschiedenen
Lebensbereichen beschreibt.

Die Durchschnittsfrau war mit 46,2 Jahren gut
zweieinhalb Jahre älter als der
Durchschnittsmann (43,5 Jahren).
Das
höhere Durchschnittsalter von Frauen hängt mit
ihrer höheren Lebenserwartung zusammen. Bei
Geburt im Jahr 2024 betrug die Lebenserwartung
der Durchschnittsfrau 83,5 Jahre. Mit 78,9
Jahren hatte der Durchschnittsmann eine um etwa
viereinhalb Jahre geringere Lebenserwartung.
Lebt der Durchschnittsmensch in einer
Familie, dann hat diese 3,4 Mitglieder im
Haushalt Laut Mikrozensus 2024 hat die Familie
des Durchschnittsmenschen 3,4 Mitglieder.
Familien sind hier im engeren Sinne definiert
als alle Eltern-Kind-Konstellationen, die
zusammen in einem Haushalt leben.

Betrachtet man sämtliche Haushaltsformen vom
Einpersonenhaushalt bis zur Großfamilie, dann
lebt der Durchschnittsmensch mit einer weiteren
Person zusammen in einem Haushalt
(2,0 Mitglieder je Haushalt). Wie der
Durchschnittsmensch wohnt, zeigen die Ergebnisse
der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus
2022.
Die Durchschnittswohnung hat
demnach eine Wohnfläche von 94,4 Quadratmetern
und kostet 7,28 Euro Nettokaltmiete pro
Quadratmeter. Vollzeitbeschäftigte verdienten im
Durchschnitt 4 634 Euro brutto im April 2024 –
Medianverdienst bei 3 978 Euro Betrachtet man
alle abhängig Beschäftigten in Vollzeit, dann
verdiente der vollzeitbeschäftigte
Durchschnittsmensch im April 2024 ohne
Sonderzahlungen 4 634 Euro brutto.

Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienten im
Schnitt 4 214 Euro brutto im Monat und damit
deutlich weniger als vollzeitbeschäftigte Männer
mit 4 830 Euro. Insbesondere bei Verdienstdaten
wird deutlich, dass Durchschnittswerte mit Blick
auf Aussagekraft und Interpretation limitiert
sein können.
Der Durchschnittswert, auch
arithmetisches Mittel genannt, ist anfällig für
extreme Werte und kann ein verzerrtes Bild
liefern. Da wenige Personen mit sehr hohen
Verdiensten den Durchschnitt stark beeinflussen
können, wird hier häufig auch der Median als
aussagekräftiger Mittelwert herangezogen.
Er teilt eine Verteilung in zwei gleich
große Hälften: 50 % der Werte liegen unterhalb
des Medians und 50 % liegen darüber. Betrachtet
man die Medianverdienste, verdiente ein
Vollzeitbeschäftigter im Mittel 3 978 Euro
brutto im April 2024 (ohne Sonderzahlungen). Mit
einem mittleren Bruttomonatsverdienst von 3 777
Euro brutto verdiente die vollzeitbeschäftigte
Frau exakt 300 Euro weniger als der
vollzeitbeschäftigte Mann mit 4 077 Euro.
Pro-Kopf-Verschuldung steigt im
Jahr 2024 auf über 30 000 Euro
Öffentlicher
Schuldenstand steigt um 63,4 Milliarden Euro auf
2 510,5 Milliarden Euro
Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder,
Gemeinden und Gemeindeverbände sowie
Sozialversicherung einschließlich aller
Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen
Bereich zum Jahresende 2024 mit 2 510,5
Milliarden Euro verschuldet. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach
endgültigen Ergebnissen weiter mitteilt,
entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung in
Deutschland von 30 062 Euro. Das waren 669 Euro
mehr als Ende 2023. Zum nicht- öffentlichen
Bereich gehören Kreditinstitute und der sonstige
inländische und ausländische Bereich, zum
Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.
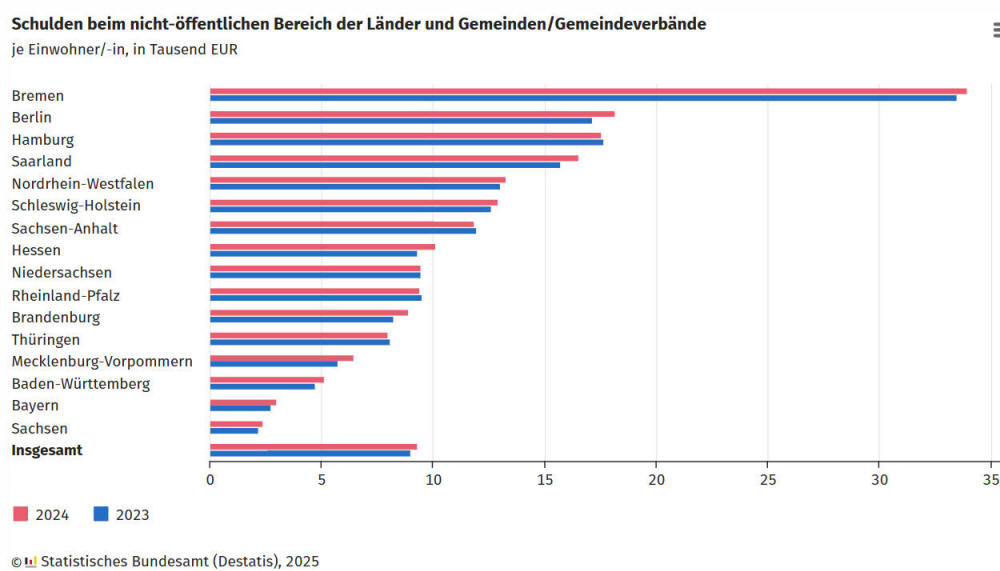
Gegenüber dem Jahresende 2023 stieg die
öffentliche Verschuldung zum Jahresende 2024 um
2,6 % (63,4 Milliarden Euro).
Der Zuwachs
kam durch Schuldenanstiege bei allen
Gebietskörperschaften zustande, wobei der
prozentuale Anstieg bei den Gemeinden und
Gemeindeverbände am größten war. Schulden des
Bundes steigen um 35 Milliarden Euro Der Bund
war Ende 2024 mit 1 732,7 Milliarden Euro
verschuldet.
Der Schuldenstand stieg
damit gegenüber dem Jahresende 2023 um 2,1 %
beziehungsweise 35,0 Milliarden Euro. Auf die
Bevölkerungszahl umgerechnet betrugen die
Schulden des Bundes 20 748 Euro pro Kopf (2023:
20 391 Euro).
Anstieg der Länderschulden
ebenfalls bei 2,1 %
Die Schulden der Länder
stiegen 2024 um 2,1 % (12,5 Milliarden Euro) auf
607,3 Milliarden Euro. Dies war der erste
Anstieg gegenüber einem Vorjahr seit dem Jahr
2021, als die Verschuldung auf 638,6 Milliarden
Euro angewachsen war. Der durchschnittliche
Länder-Schuldenstand pro Kopf im Jahr 2024
betrug 7 273 Euro (2023: 7 145 Euro).
Die Schulden pro Kopf waren Ende 2024 in den
Stadtstaaten wie in den Vorjahren am höchsten:
Sie lagen in Bremen bei 33 934 Euro (2023:
33 483 Euro), in Hamburg bei 17 571 Euro (2023:
17 642 Euro) und in Berlin bei 18 173 Euro
(2023: 17 155 Euro). Zu beachten ist, dass die
Stadtstaaten – anders als die Flächenländer –
auch kommunale Aufgaben wahrnehmen.
Unter den Flächenländern hatte das Saarland mit
13 697 Euro (2023: 12 934 Euro) pro Kopf
weiterhin die höchste Verschuldung, gefolgt von
Schleswig-Holstein mit 10 903 Euro (2023:
10 784 Euro). Am niedrigsten war die
Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich wie in
den Vorjahren in Bayern mit 1 353 Euro (2023:
1 321 Euro) und in Sachsen mit 1 482 Euro (2023:
1 417 Euro).
Kommunale Verschuldung
erhöht sich um 10,3 %
Die Verschuldung der
Gemeinden und Gemeindeverbände wuchs im fünften
Jahr in Folge und erhöhte sich im
Vorjahresvergleich um 10,3 %
(15,9 Milliarden Euro) auf
170,5 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich eine
Pro-Kopf-Verschuldung von 2 206 Euro (2023:
2 005 Euro) an kommunalen Schulden.
Mit
einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3 577 Euro
(2023: 3 158 Euro) waren wie im Vorjahr die
Kommunen in Nordrhein-Westfalen am höchsten
verschuldet. Es folgen die hessischen Kommunen
mit einer Verschuldung pro Kopf von 3 009 Euro
(2023: 2 734 Euro). Auf Platz drei der am
höchsten verschuldeten Kommunen liegen trotz der
Entlastung durch den "Saarlandpakt" die
saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbände
mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2 824 Euro
(2023: 2 796 Euro).
Die kommunale Ebene
von Rheinland-Pfalz, die im Jahr 2022 noch am
höchsten pro Kopf verschuldet war, ist aufgrund
der Entlastungen im Rahmen des Landesprogramms
"Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in
Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) erstmals nicht mehr
unter den Top 3 der am höchsten verschuldeten
Kommunen vertreten (2024: 2 388 Euro, 2023:
3 076 Euro).
Die geringste kommunale
Pro-Kopf-Verschuldung verzeichneten 2024 die
Kommunen in Brandenburg mit 581 Euro (2023:
556 Euro), gefolgt von den Kommunen in Thüringen
mit 867 Euro (2023: 898 Euro) und in Sachsen mit
892 Euro (2023: 758 Euro). Die
Sozialversicherung war Ende 2024 mit 0,12 Euro
(2023: 0,48 Euro) pro Kopf verschuldet. Die
Gesamtschulden verringerten sich dabei um 73,9 %
auf 10 Millionen Euro (2023: 40 Millionen Euro).
Metall
trifft auf Metal – Modellbahnhersteller Märklin
erstmals live beim Wacken Open Air
Märklin goes Metal. Nach einem fulminanten
Jahresauftakt mit der rockigen AC/DC Black Ice
Lokomotive zündet der Traditionshersteller die
nächste Stufe: Erstmals in seiner Geschichte ist
der Modellbahnhersteller Märklin auf dem
legendären Wacken Open Air, das von 30.07. bis
02.08.2025 im Norden Deutschlands stattfindet,
vertreten.
Was liegt näher für ein
Unternehmen, das für seine detailreichen
Produkte aus Metall bekannt ist, als sich
inmitten der größten Heavy Metal Community der
Welt zu präsentieren. „Märklin freut sich
darauf“, so Marketingleiter Jörg Iske, „in
dieser einzigartigen Atmosphäre mit alten und
neuen Fans zu feiern und die Leidenschaft für
Miniaturwelten mit der Energie des Metal zu
verbinden.“
Ein besonderes Highlight:
Passend zum Wacken-Debüt legt Märklin exklusive
Wacken-Waggons auf, die ihre erstmalige
Präsentation direkt auf dem Festivalgelände im
Wacken United Bereich erleben werden. Märklin
lädt alle United Besucher herzlich ein, dort
vorbeizuschauen und die Marke in einem völlig
neuen Kontext zu entdecken.
Das Wacken
Open Air ist weit mehr als nur ein Festival – es
ist der jährliche Treffpunkt der globalen
Metal-Familie. Im Wacken United Bereich kommen
nicht nur die besten Fans der Welt zusammen,
sondern auch Bands, Partner, Pressevertreter,
Plattenfirmen, Promoter, Manager und Booker.
Hier entsteht in entspannter Atmosphäre ein
einzigartiger Raum für Austausch und Networking.
Ob Branchentreff, Marktplatz,
Klassentreffen, Musikmesse, Party-Metalzone,
Zeitreise, Chill-Area oder Kontaktbörse – Wacken
United ist das Herzstück der Community. Märklin
freut sich darauf, Teil dieser pulsierenden Zone
zu sein und lädt alle ein, dabei zu sein,
Märklin neu zu erleben und mit jedem Ticketkauf
die Arbeit der Wacken Foundation zu
unterstützen.
Wesel feiert das 45.
PPP-Stadtfest – Ein Sommerhighlight mit
Tradition und Vielfalt
In
diesem Jahr feiert Wesel mit großer Vorfreude
das 45. PPP-Stadtfest – ein Jubiläum, das die
besondere Bedeutung dieses Festes unterstreicht.
„Das PPP-Stadtfest hat nicht nur einen hohen
Bekanntheitsgrad in unserer Region, sondern ist
ein echtes Markenzeichen unserer Stadt“, betont
Rainer Benien. Vom 01. bis 03. August verwandelt
sich Wesel in eine lebendige Festmeile voller
Erlebnisse, Emotionen und Begegnungen.
Pauken, Plunder, Promenade: Ein Fest mit Herz
und Geschichte
Seit 1977 steht das
PPP-Stadtfest für gelebte Tradition und kreative
Weiterentwicklung. Ob Schützentag, Kirmes oder
Trödelmarkt – die beliebten Klassiker bilden
auch 2025 wieder das Herzstück des Festes. Die
Kirmes am Rhein, die seit Beginn von der Familie
Böttner organisiert wird, bietet für Groß und
Klein ein buntes Potpourri an Fahrgeschäften,
Leckereien und Unterhaltung.
Die
feierliche Eröffnung erfolgt am Freitag, 01.
August, um 18 Uhr mit dem traditionellen
Fassanstich durch Bürgermeisterin Ulrike
Westkamp – Freibier inklusive.
Der
Trödelmarkt, organisiert von der Firma Sven Vogt
Veranstaltungsservice, lädt am Wochenende zum
Stöbern ein. Wer selbst noch mittrödeln möchte,
kann sich gerne
beim Veranstaltungsbüro Sven
Vogt: info@vogt-sven.de oder Tel. 0151/11646999
anmelden.
Den Schützentag richtet in
diesem Jahr der Bürgerschützenverein Wesel Vorm
Brüner Tor 1922 e.V. aus. Hunderte Schützen
marschieren vom Berliner Tor und Großen Markt
durch die Fußgängerzone zur Zitadelle. Höhepunkt
des Abends ist der „Große Zapfenstreich“.
Feiern am Rhein: Musikzelt & Ibiza-Vibes
Neu in diesem Jahr ist das Musikzelt am Rhein,
das an allen drei Tagen für ausgelassene
Stimmung sorgt. Von Freitag bis Sonntag gibt es
dort DJ-Sounds und beste Feierlaune in direkter
Nähe zum Kirmesgelände – ein Treffpunkt für
alle, die das Fest bis in die Nacht genießen
möchten.
Ein besonderes Highlight
erwartet die Besucher*innen am Freitagabend: Das
Welcome Hotel Wesel lädt zur stilvollen
Ibiza-Party ein. Mediterrane Beats, entspannte
Atmosphäre und kühle Drinks direkt am Wasser
versprechen echtes Urlaubsfeeling mitten in
Wesel.
Himmlische Erlebnisse und
strahlende Highlights auf dem Flugplatz
Römerwardt
Der Flugplatz Römerwardt wird
erneut zum beliebten Treffpunkt für die ganze
Familie. Neben einem abwechslungsreichen
Kinderprogramm, kulinarischen Angeboten und
Live-Musik von DJ Domic und DJ Olli, erwartet
die Besucher*innen ein ganz besonderes
Highlight: das stimmungsvolle Ballonglühen am
Samstagabend gegen 21:45 Uhr. Rund zwanzig
Heißluftballone verwandeln das Gelände in ein
emotionales Lichtermeer, begleitet von passender
Musik.
„Ein solches Event verlangt nicht
nur Leidenschaft, sondern auch präzise Planung –
und natürlich spielt das Wetter eine
entscheidende Rolle“, verrät Ballonexperte
Benjamin Eimers, der das Ballonglühen mit viel
Herzblut organisiert.
Sportliche Action
auf dem Wasser
Auch am Auesee wird es
sportlich: Die RTGW Surfabteilung lädt am
Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr zu
den Stadtmeisterschaften im Windsurfen ein.
Parallel dazu findet bereits zum sechsten Mal
die Stadtmeisterschaft im Stand-Up-Paddling
statt. Zuschauerinnen sind herzlich eingeladen,
die Athlet*innen am Surferstrand lautstark zu
unterstützen.
Live-Musik am Kornmarkt –
für jeden Musikgeschmack etwas dabei
Musikalisch ist das Stadtfest ebenfalls bestens
aufgestellt. Am Kornmarkt sorgen an allen drei
Tagen hochkarätige Acts für beste Stimmung:
•
Freitag (20–24 Uhr): Die Band Splash aus
Recklinghausen bringt aktuelle Hits und
Klassiker mit beeindruckender Stimmgewalt auf
die Bühne.
• Samstag (20–24 Uhr): Die Classic
Rock Cover Band Big Block liefert eine
energiegeladene Performance mit Songs von AC/DC
bis Queen.
• Sonntag (16–18 Uhr): Das
Acoustic Duo Take Me Anywhere begeistert mit
gefühlvollen Balladen und handgemachter Musik.
Buntes Vereinsleben und kulturelle Vielfalt
Am Samstag präsentieren sich rund 40 Vereine in
der Innenstadt. Beim Vereinsfest können
Besucher*innen das bunte Spektrum des Weseler
Vereinslebens entdecken – mit Mitmachaktionen
wie dem Kuscheltierkrankenhaus,
Instrumente-Ausprobieren oder einer Fotobox.
Falknerei, Tanzvorführungen und Einsätze von
THW, DRK und Maltesern runden das vielseitige
Angebot ab.
Am Samstagabend lädt die
FREDDO Espressobar bei „Klangwellen“ ab 19 Uhr
auf dem Leyens-Platz zum Entspannen bei
loungiger Musik und kulinarischen Genüssen ein.
Am Sonntag sorgen die Oldtimerfreunde Schermbeck
e.V. auf dem Großen Markt für nostalgische
Momente mit ihrer Ausstellung automobiler
Klassiker.
Service & Organisation
•
Eine Fahrradwache steht an allen drei Tagen in
der Karl-Jatho-Straße bei „Tante Ju“ bereit.
• Wer mit dem PKW anreist, folgt einfach dem
städtischen Parkleitsystem. Wichtig: Öffentliche
Parkplätze sind wochentags ab 16 Uhr sowie am
Wochenende kostenfrei nutzbar.
• Der
Stadtwerke-Wasserturm lädt zur Besichtigung ein,
genauso wie der Willibrordi-Dom inkl. Café
Willibrord und Turmbesteigung
• Das
offizielle Programmheft erscheint in Kürze und
wird an alle Weseler Haushalte verteilt. Es
liegt außerdem in der Stadtinformation aus und
steht auf wesel-tourismus.de/ppp zur Verfügung.
Darüber hinaus werden die Programmpunkte bei
Social Media vorgestellt.
Moers: ‚Lichtspiele‘ werden ins Alte Landratsamt
verlegt
Wegen der Wetterprognose mit
Regen und kühleren Temperaturen werden die
‚Lichtspiele Schlosshof Open Air‘ in das Alte
Landratsamt verlegt. Sie finden 31. Juli bis zum
3. August statt.

Fotomontage: Sommerkino mit Hanns Dieter Hüsch
und Dieter Hildebrandt, Hanns Dieter Hüsch
Nachlass/Grafschafter Museum
Der Auftakt
am Donnerstag, 31. Juli, mit einem
Musical-Thriller ist bereits ausgebucht. Wenige
Restplätze sind noch für die drei anderen Abende
übrig. Am Freitag, 1. August, ist eine
eindrucksvolle Filmbiografie über das Leben der
Kriegsfotografin Lee Miller zu sehen.
In
Kooperation mit Sea-Eye und der Seebrücke Moers
wird am Samstag, 2. August, der Dokumentarfilm
‚Kein Land für Niemand – Abschottung eines
Einwanderungslandes‘ gezeigt, der den Einsatz
des Seenotrettungsschiffs Sea-Eye 4 und die
dramatische Lage von Geflüchteten eindrucksvoll
dokumentiert.
Mit legendären Sketchen
von Hanns Dieter Hüsch und Dieter Hildebrandt
schließt die Reihe am Sonntag, 3. August. Der
Einlass beginnt jeweils um 20.30 Uhr, die Filme
starten immer um 21.30 Uhr. Für die Teilnahme an
den kostenlosen Filmabenden ist eine
telefonische Anmeldung unter 0 28 41 / 201-6 82
00 nötig.
Dinslaken: Stadtverwaltung
kümmert sich um Fußgängerbrücken am Rotbach in
Eppinghoven
Die
Stadtverwaltung nutzt die Ferienzeit und
repariert die beiden Rotbach-Holzbrücken in
Eppinghoven in Höhe Thomashof und im Bereich
Schanzenpfad / Damaschkeweg. Hier werden
Holzteile ausgetauscht und verstärkt. Auch
Fundamentarbeiten sind erforderlich, um für eine
dauerhafte Verkehrssicherheit der beiden
Fußgänger-Brücken zu sorgen.
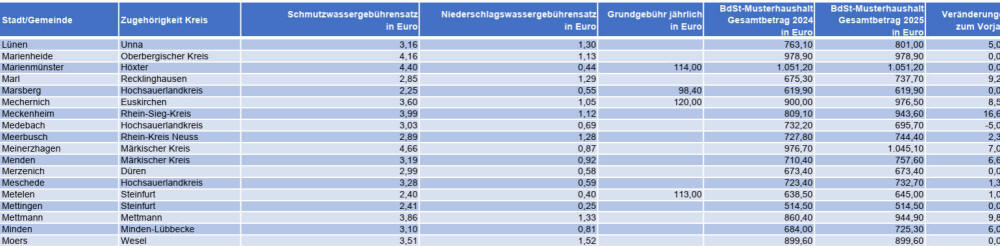
Ab Montag, 4. August 2025, müssen die
Brücken dazu für rund drei Wochen gesperrt
werden. Entsprechende Hinweisschilder werden
aufgestellt. Die Stadtverwaltung empfiehlt, die
Brücken an der Gneisenaustraße, Rotbachstraße
oder Eppinkstraße zu benutzen. Das Team der
Verwaltung dankt allen Dinslakener*innen für ihr
Verständnis.
Kostenloses Eltern-Kind-Spielangebot
in der Weseler Innenstadt
Für
junge Eltern, die mit ihrem Kleinkind eine
schöne Zeit verbringen möchten, gibt es ein
neues kostenfreies Angebot in der Weseler
Innenstadt. Immer mittwochs um 10:30 Uhr trifft
sich die Eltern-Kind-Spielgruppe im
Familienzentrum Brüner Tor, Caspar-Baur-Straße
1, 46483 Wesel, in der Turnhalle.
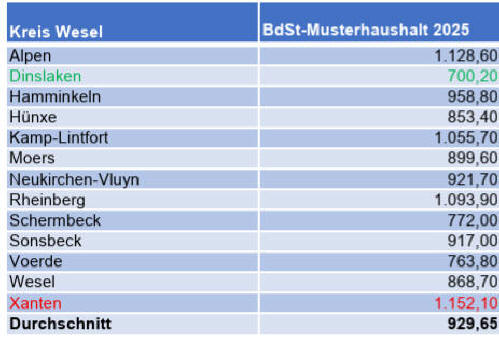
Unter der Leitung von Sabrina Deppenkemper und
Mimi Antonova erhalten Eltern und Kinder
außerdem viele interessante und nützliche Spiel-
und Bewegungstipps. Eine Anmeldung für das
Angebot ist nicht erforderlich. Bei Rückfragen
steht die Mitarbeiterin der Koordinationsstelle
Frühen Hilfen unter folgender Rufnummer zur
Verfügung: 0281/203-2566.
Moers: Abschied und Aufbruch im
Moerser Freizeitpark
Ein
begehbares Gehege, in dem Zwergziegen vorsichtig
an Kinderhänden schnuppern. Ein grünes
Klassenzimmer, um die Natur zu entdecken. Ein
Biogarten mit seltenen Gemüsesorten. So wird der
Streichelzoo im Freizeitpark als
‚Außerschulischer Lernort‘ bald aussehen. Ende
der Sommerferien beginnt der Umbau. Noch leben
die Tiere hier. Doch ab Mitte August ziehen sie
um - ein emotionaler Moment für alle. Zwei
Landwirte, die die Tiere bereits kennen und
betreuen, nehmen sie auf.
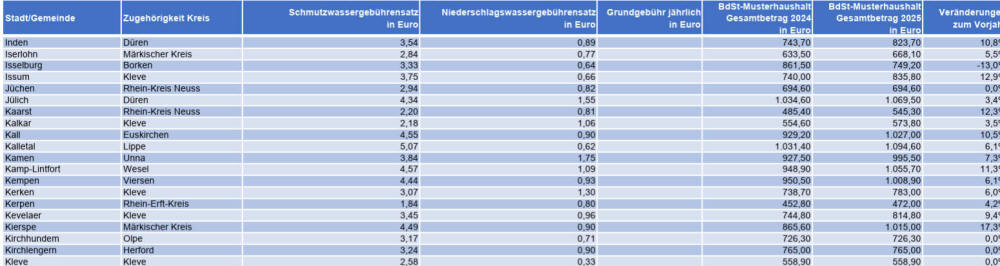
Darstellung des neuen Streichelzoos.
Hier fühlen sich bald Alpakas und Menschen wohl.
(Illustration: Tervoort & Banczyk)
Die
vertrauten Stallungen werden mitgenommen und
dort wieder aufgebaut. Der Fachdienst Freiraum-
und Umweltplanung und der Förderverein
Streichelzoo halten in der Umbauzeit engen
Kontakt zu den Landwirten und Tieren. Nach dem
Auszug beginnt der Abriss der Gebäude und der
Toilettenanlage. Die Baustraße führt über die
Dr.-Karl-Hirschberg-Straße durch das benachbarte
Neubaugebiet.
Noch besser auf Familien
zugeschnitten
Der Streichelzoo wird auch ein
Ort für Bildung, Schulungen und Begegnung. Die
neuen Toiletten sind barrierefrei. Die
Außenflächen werden komplett neugestaltet, der
Japanische Garten überarbeitet. Tiere gibt es
natürlich auch – und zwar mehr als jetzt. Auf
Schweine wird aus Kostengründen verzichtet,
dafür sind hier bald Alpakas, Schafe, Ziegen,
Kaninchen, Sittiche, Hühner und Meerschweinchen
zu Hause. Der neue Streichelzoo wird nicht nur
schöner für alle Menschen, die Natur und Tiere
nah erleben wollen. Er wird abwechslungsreicher
und noch besser auf Familien zugeschnitten.
Fertigstellung bis Anfang 2027
Voraussichtlich im Sommer 2027 können die ersten
Bildungsangebote im neuen Gebäude starten. Die
Tiere sollen im Frühjahr 2027 zurückkehren. Die
Gesamtkosten liegen bei rund 3,4 Millionen Euro.
80 Prozent davon werden durch
Städtebaufördermittel von Bund und Land gedeckt.
Auch ENNI und der Förderverein unterstützen das
Projekt mit Engagement und Spenden.
Dinslaken:
Infoveranstaltung am 5. August - Werden Sie
Solarberater*in
Viele Menschen interessieren sich für eine
Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Hausdach.
Aktuell sucht die Stadt Dinslaken Interessierte,
die sich zu ehrenamtlichen
BürgerSolarBerater*innen schulen lassen wollen.
Als BürgerSolarBerater*innen beraten sie
kostenlos und neutral Eigentümer*innen von Ein-
bis Zweifamilienhäusern. Auf nachbarschaftliche
Weise vermitteln sie praktische und wertvolle
Tipps.
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel
unterstreicht: "Unsere Stadt zeichnet sich durch
das vielfältige ehrenamtliche Engagement der
Dinslakener*innen aus. Ein starkes Netzwerk
ehrenamtlich engagierter Solarberater*innen
trägt dazu bei, dass Interessierte eine
kompetente und unabhängige Beratung erhalten.
Photovoltaik ist ein zentraler Baustein für den
verantwortungsvollen Umgang mit unseren
natürlichen Ressourcen. Sie schützt das Klima
und verbessert die Lebensqualität für kommende
Generationen."
Am Dienstag, 5. August
2025, findet ab 18:30 Uhr ein
Online-Vorabinfo-Termin statt. Diese
Infoveranstaltung vermittelt allen, die
Interesse an der Schulung haben, eine gute
Vorstellung davon, was sie erwartet, wenn sie
mitmachen. Es gibt ausreichend Zeit, um vor dem
Start der Schulung alle offenen Fragen zu
klären.
Interessierte können sich gerne
per E-Mail an ne-office@dinslaken.de melden.
Nach der Infoveranstaltung bietet die
Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Projekt
"Energiesparhaus Ruhr" vom Regionalverband Ruhr
eine kostenlose Basisschulung an. In vier
Online-Workshops wird das Grundwissen
vermittelt.
Die Schulung wird von
Metropolsolar durchgeführt. Das ist ein
bundesweit tätiger gemeinnütziger Verein, der
sich für die vollständige Umstellung auf
erneuerbare Energien einsetzt. Die Schulung wird
sich über alle vier September-Samstage
erstrecken und jeweils vier Stunden dauern. Sie
findet online statt.
Feierabendmarkt Dinslaken:
Musik, Pizza und mehr
Besser kann der August eigentlich gar nicht
beginnen: Die Stadt Dinslaken lädt herzlich zum
nächsten Feierabendmarkt auf den Altmarkt ein.
Am Freitag, 1. August 2025, verwandelt sich das
Herz der Altstadt von 16 bis 20 Uhr wieder in
einen Treffpunkt für alle Dinslakener*innen und
Gäste.
In entspannter Atmosphäre können
Sie den Start ins Wochenende unter freiem Himmel
genießen und sich auf ein abwechslungsreiches
Programm freuen. Für die musikalische Begleitung
sorgt dieses Mal Mark Bennett. Mit seiner
ausdrucksstarken Stimme und gefühlvollen Songs
schafft der Singer-Songwriter eine besondere
Stimmung und bringt echtes Sommerfeeling auf den
Altmarkt.
Kulinarisch wird es ebenfalls
ein Highlight geben: Solo Pizza ist mit dem
beliebten Pizza-Truck vor Ort und verwöhnt die
Gäste mit frischen, knusprigen Pizzen, ein
Genuss für alle Fans italienischer
Streetfood-Küche. Natürlich dürfen auch weitere
Foodtrucks, regionale Spezialitäten und
erfrischende Getränke nicht fehlen.
Der
perfekte Mix für einen gelungenen Sommerabend.
Der Eintritt ist wie immer frei. Die Stadt
Dinslaken freut sich auf zahlreiche
Besucher*innen und einen stimmungsvollen
Sommerabend im Herzen der Altstadt.

Zum Tag des Bieres: Produktion von
alkoholfreiem Bier mit +96,1 % in den
vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt
Biergenuss ohne Alkohol – das wird in
Deutschland immer beliebter. Im Jahr 2024 wurden
hierzulande knapp 579 Millionen Liter
alkoholfreies Bier im Wert von rund 606
Millionen Euro produziert. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) zum Internationalen Tag des
Bieres am 1. August mitteilt, hat sich die zum
Absatz bestimmte Produktionsmenge von
alkoholfreiem Bier in den vergangenen zehn
Jahren damit fast verdoppelt (+96,1 %). 2014
hatte sie noch bei gut 295 Millionen Litern
gelegen.
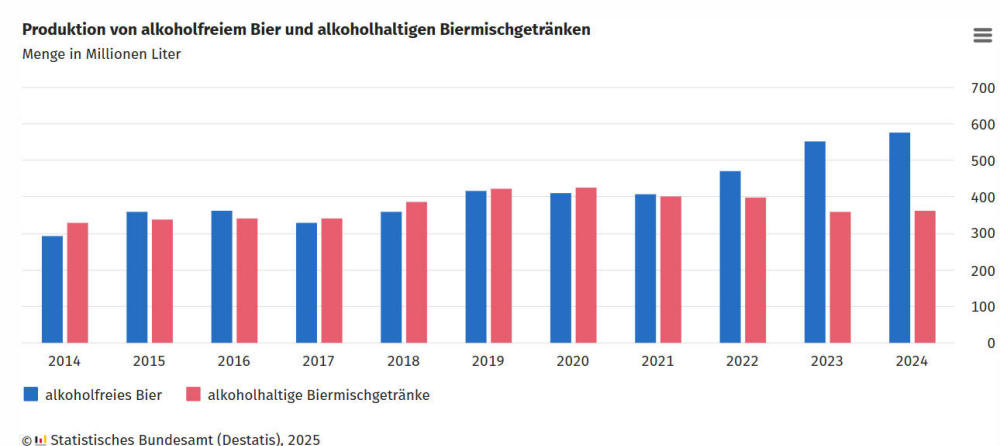
Allerdings wird hierzulande immer noch
deutlich mehr Bier mit Alkohol produziert: Im
Jahr 2024 haben die Brauereien in Deutschland
gut 7,2 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier im
Wert von rund 6,6 Milliarden Euro hergestellt.
Insgesamt ist die Produktion von alkoholhaltigem
Bier in Deutschland in den vergangenen zehn
Jahren jedoch um 14,0 % zurückgegangen.
2014 wurden hierzulande noch gut 8,4 Milliarden
Liter alkoholhaltiges Bier produziert. Während
damals noch gut 28 Liter Bier mit Alkohol auf
einen Liter alkoholfreies Bier kamen, waren es
2024 rund 12 Liter. Produktion von
alkoholhaltigen Biermischgetränken mit deutlich
geringerer Zunahme Niedrigprozentiger als
reguläres Bier, aber nicht gänzlich alkoholfrei
sind Biermischgetränke wie etwa Radler.
Deren Produktion nahm in den vergangenen zehn
Jahren ebenfalls zu: von knapp 333 Millionen
Litern im Jahr 2014 auf rund 364 Millionen Liter
im Jahr 2024. Das entspricht einem Zuwachs von
9,3 %. Im Zehn-Jahres-Vergleich fällt der
Anstieg somit deutlich geringer aus als bei der
Produktion von alkoholfreiem Bier.
Bierabsatz im 1. Halbjahr 2025 um 6,3 %
niedriger als im Vorjahreszeitraum
Brauereien und Bierlager verzeichnen
absatzschwächstes Halbjahr seit 1993
Der Bierabsatz in Deutschland ist im 1. Halbjahr
2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,3 %
oder 262 Millionen Liter auf rund 3,9 Milliarden
Liter gesunken. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, fiel der Bierabsatz damit
erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1993
in einem Halbjahr unter 4 Milliarden Liter. In
den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk
sowie das aus Ländern außerhalb der Europäischen
Union (EU) importierte Bier nicht enthalten.
Ähnlich starker Rückgang nur zu Beginn der
Corona-Pandemie Vergleichbar hohe
Absatzrückgänge hatten die in Deutschland
ansässigen Brauereien und Bierlager bisher nur
zu Beginn der Corona-Pandemie im 1. Halbjahr
2020 (-6,6 % zum Vorjahreszeitraum auf
4,3 Milliarden Liter) sowie im 2. Halbjahr 2023
(-6,2 % auf 4,2 Milliarden Liter) verzeichnet.
Inlandsabsatz sinkt um 6,1 % zum
Vorjahreszeitraum, Exporte gehen um 7,1 % zurück
81,9 % des gesamten Bierabsatzes waren im
1. Halbjahr 2025 für den Inlandsverbrauch
bestimmt und wurden versteuert. Der
Inlandsabsatz sank im Vergleich zum 1. Halbjahr
2024 um 6,1 % auf 3,2 Milliarden Liter. Die
restlichen 18,1 % beziehungsweise
711,2 Millionen Liter wurden steuerfrei (als
Exporte und als sogenannter Haustrunk)
abgesetzt.
Das waren 7,1 % weniger als
im Vorjahr. Davon gingen 406,9 Millionen Liter
(-5,0 %) in EU-Staaten, 299,6 Millionen Liter
(-9,9 %) in Nicht-EU-Staaten und
4,7 Millionen Liter (-8,0 %) unentgeltlich als
Haustrunk an die Beschäftigten der Brauereien.
Bei den Biermischungen – Bier gemischt mit
Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen
alkoholfreien Zusätzen – war im 1. Halbjahr
dagegen ein Plus zu verzeichnen. Gegenüber dem
1. Halbjahr 2024 wurden 8,0 % mehr
Biermischungen abgesetzt. Sie machten mit
220,8 Millionen Litern allerdings nur 5,6 % des
gesamten Bierabsatzes aus.
NRW-Inflationsrate liegt im Juli 2025
bei 1,8 %
* Preise für
Bohnenkaffee gestiegen (+21,6 %).
*
Energiepreise sanken im selben Zeitraum
(−2,2 %).
* Preis für die stationäre Pflege
stieg u. a. für gesetzlich Versicherte um 5,8 %.
Die Inflationsrate in
Nordrhein-Westfalen – gemessen als Veränderung
des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat –
liegt im Juli 2025 bei 1,8 %. Wie das
StatistischesLandesamt mitteilt, stieg der
Preisindex gegenüber dem Vormonat (Juni 2025) um
0,2 %.
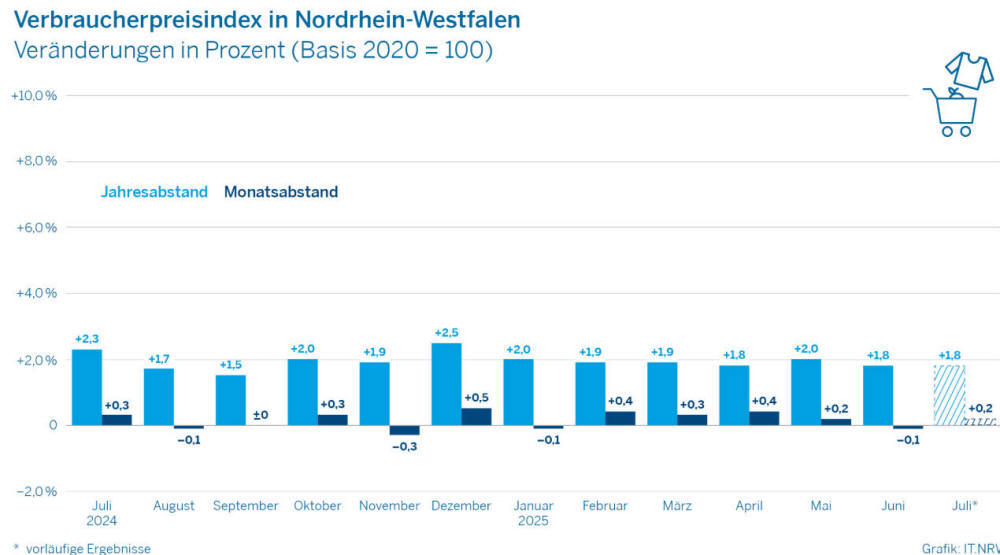
Vorjahresvergleich: Preise für Obst um 10,3
% gestiegen Zwischen Juli 2024 und Juli 2025
stiegen u. a. die Preise für Obst um 10,3 %,
darunter beispielsweise Zitrusfrüchte (+23,4 %)
sowie Pfirsiche, Kirschen oder anderes
Stein-/Kernobst (+21,8 %). Die Preise für
Bohnenkaffee zogen um 21,6 %, die für Pralinen
um 20,6 % und die für Schokoladentafeln um
16,4 % an.
Der Preis für die stationäre
Pflege stieg u. a. für gesetzlich Versicherte um
5,8 %. Dies steht auch im Zusammenhang mit der
jährlichen Rentenanpassung wodurch die zu
zahlenden Eigenanteile gestiegen sind. Die
Energiepreise wirken nach wie vor preisdämpfend
auf die Inflation: So sanken diese im Vergleich
zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 2,2 %:
Dabei wurden Haushaltsenergien um 0,3 % und
Kraftstoffe um 5,2 % günstiger angeboten.
Vormonatsvergleich: Paprika um 8,6 %
günstiger als im Juni 2025 Zwischen Juni 2025
und Juli 2025 sanken z. B. die Preise für
Bekleidung: Bekleidung für Kinder wurde 4,2 %
sowie für Damen und Herren jeweils 3,7 %
günstiger angeboten. Im Bereich der
Nahrungsmittel verzeichnete u. a. Butter einen
Preisrückgang (−3,5 %).
Gemüse wurde um
durchschnittlich 1,8 % günstiger angeboten,
insbesondere Paprika (−8,6 %) sowie
Kopf-/Eisbergsalat (−5,6 %). Gleichzeitig
verteuerten sich beispielsweise Gurken um 9,4 %,
Äpfel um 4,6 % und Hartkäse um 3,7 %. Ebenso
wurden Fitnessgeräte binnen Monatsfrist um 3,8 %
teurer.
Wichtige Preisveränderungen
https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/220_25.xlsx
XLSX, 25,74 KB
37 400 erfolgreich ausgebildete
Pflegefachfrauen und -männer im Jahr 2024
• 59 400 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge
zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann
• Rund
ein Fünftel der Auszubildenden in der Pflege
sind älter als 30 Jahre
• 1 200 Studierende
befinden sich in einem Studiengang zur
Pflegefachperson
Im Jahr 2024 haben im
zweiten Abschlussjahrgang nach Einführung der
generalistischen Pflegeausbildung etwa 37 400
Personen ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau
beziehungsweise zum Pflegefachmann erfolgreich
beendet. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, wählten dabei
weiterhin die meisten Absolventinnen und
Absolventen (99 %) die 2020 bundesweit
eingeführte generalistische Berufsbezeichnung
und nur rund 1 % erwarb einen Abschluss mit
Schwerpunkt Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
(rund 280 Abschlüsse) oder Altenpflege (rund 80
Abschlüsse).
9 % mehr neu abgeschlossene
Ausbildungsverträge als im Vorjahr
Knapp
59 400 Personen haben im Jahr 2024 eine
berufliche Ausbildung zur Pflegefachfrau
beziehungsweise zum Pflegefachmann begonnen.
Insgesamt stieg damit die Zahl der neuen
Ausbildungsverträge unter den Auszubildenden
gegenüber dem Vorjahr (2023: 54 400) um rund 9 %
an.
Insgesamt, also über alle
Ausbildungsjahre hinweg, befanden sich
146 700 Personen in einer solchen
Pflegeausbildung (2023: 146 900). Ein Fünftel
der Auszubildenden sind 30 Jahre oder älter,
drei Viertel sind Frauen Die Hälfte der
Pflegeauszubildenden, die 2024 ihre Ausbildung
begonnen haben, war 21 oder jünger.
Das
Durchschnittsalter lag bei 24 Jahren. Mit 19 %
begannen aber auch viele Personen ab einem Alter
von über 30 Jahren noch eine Ausbildung zur
Pflegefachperson. Über alle Ausbildungsjahre
hinweg waren 21 % der Pflegeauszubildenden
30 Jahre oder älter. Knapp drei Viertel aller
Pflegeauszubildenden zum Ende des Jahres (74 %)
waren Frauen und gut ein Viertel (26 %) Männer.
Neue Auszubildende vor allem in
Krankenhäusern und stationären
Pflegeeinrichtungen beschäftigt
Der
praktische Teil der Ausbildung zur
Pflegefachperson kann in einem Krankenhaus,
einer stationären Pflegeeinrichtung oder einer
ambulanten Pflegeeinrichtung absolviert werden.
Im Jahr 2024 absolvierten die
Pflegeauszubildenden mit neu abgeschlossenem
Ausbildungsvertrag mit rund 51 % (30 300)
besonders häufig ihre Ausbildung in
Krankenhäusern.
Darauf folgten
stationäre Pflegeeinrichtungen mit 35 % (21 000)
und anschließend ambulante Pflegeeinrichtungen
mit einem Anteil von rund 11 % (6 700). Im
Hinblick auf die Art der Trägerschaft begannen
44 % oder 26 100 der neuen Pflegeauszubildenden
ihre berufliche Ausbildung bei einem
freigemeinnützigen Träger, also in
Einrichtungen, die einer sozialen, humanitären
oder religiösen Vereinigung angehören.
29 % (17 000) der neuen Auszubildenden fingen
bei einem privaten Träger an und 25 % (14 900)
bei einem öffentlichen Träger der praktischen
Ausbildung. 1 200 Studierende im Pflegestudium
nach dem Pflegeberufegesetz Im Jahr 2024 konnten
erstmals Zahlen zu Studierenden im Pflegestudium
nach dem Pflegeberufegesetz ermittelt werden.
Zum Jahresende befanden sich insgesamt
etwa 1 200 Studierende in einem Pflegestudium,
davon 740 Studienanfängerinnen und -anfänger.
Den Bachelor-Abschluss inklusive einer
Berufszulassung zur Pflegefachperson erreichten
2024 rund 140 Studierende. An einigen
Hochschulen konnte das Studium bereits vor 2024
begonnen werden.
Kreis Wesel fördert erneut die Pflege
von Kopfbäumen: Online-Antragstellung bis zum
15. August 2025 möglich
Der Kreis Wesel unterstützt auch in der
kommenden Schnittperiode den Erhalt und die
Pflege von Kopfbäumen – vor allem von Kopfweiden
und Kopfeschen. Interessierte können für bis zu
1.000 Kopfbäume jeweils 60 Euro Förderung
beantragen. Die Schnittsaison läuft vom 1.
Oktober 2025 bis zum 28. Februar 2026.
Wer eine Förderung erhalten möchte, muss den
Antrag bis spätestens Freitag, 15. August 2025,
online einreichen. Später eingehende Anträge
können nicht berücksichtigt werden. Zum Antrag
gehören neben dem Formular ein Lageplan mit
eindeutig markierten Baumstandorten sowie eine
Fotodokumentation der Bäume.
Die
Antragstellerinnen und Antragsteller führen den
Pflegeschnitt – das sogenannte Schneiteln – im
zugelassenen Zeitraum durch. Beim Abtransport
des Schnittguts müssen sie die geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften einhalten.
Nach dem Rückschnitt muss der Pflegenachweis
der Kreisverwaltung bis spätestens 15. März 2026
vorliegen. Dieser muss ebenfalls einen Lageplan
und eine Fotodokumentation der gepflegten Bäume
enthalten. Nur bei fristgerechtem Eingang des
Nachweises wird die Förderung ausgezahlt. Ein
verspäteter Nachweis kann zum Verlust der
Zuwendung führen.
Vorstandsmitglied
Helmut Czichy, zuständig für den Bereich Umwelt
und Naturschutz bei der Kreisverwaltung Wesel:
„„Ich freue mich sehr, dass wir die Pflege der
ökologisch besonders wertvollen Kopfbäume –
unseres Symbol- und Wappenbaums – nach dem
Beschluss des Kreistages im April wieder in dem
früheren Umfang fördern können.
Nach den
intensiven Diskussionen im Vorfeld ist es ein
wichtiges Signal für den Naturschutz im Kreis
Wesel, dass wir dieses kulturprägende Element
unserer Landschaft weiterhin stärken.“
Wichtig: Der Kreis kann nur Bäume fördern, die
in den letzten sieben Jahren nicht gepflegt
wurden. Gibt es jedoch Hinweise darauf, dass ein
Baum vor Ablauf dieser Frist
auseinanderzubrechen droht, ist unter bestimmten
Voraussetzungen eine frühere Pflege förderfähig.
In solchen Fällen sollten Interessierte
frühzeitig Kontakt mit den zuständigen
Ansprechpersonen aufnehmen.
Ausbildungslücke belastet KMU –
DMB-Vorstand Tenbieg: „Koalition muss Zusagen
einhalten und schnell handeln.“
Anlässlich des Ausbildungsstarts am 1. August
fordert der Deutsche Mittelstands-Bund (DMB) die
Bundesregierung auf, ihr Versprechen aus dem
Koalitionsvertrag einzulösen und die berufliche
Ausbildung nachhaltig zu stärken. „Für den
Mittelstand ist es essenziell, dass die
Ausbildungslücke nicht noch dramatischer
zunimmt“, sagt Marc S. Tenbieg,
geschäftsführender DMB-Vorstand.
Im
vergangenen Jahr blieben mehr als ein Drittel
der Ausbildungsstellen unbesetzt, gleichzeitig
finden viele junge Menschen keinen
Ausbildungsplatz – die Ausbildungslücke
vergrößert sich somit von Jahr zu Jahr. Darunter
leiden insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen. Denn diese Betriebe stellen die
überwiegende Mehrheit der Ausbildungsplätze. Aus
Sicht des DMB muss die Bundesregierung dringend
Maßnahmen ergreifen, um das Passungsproblem auf
dem Ausbildungsmarkt zu lösen.
Marc S.
Tenbieg, geschäftsführender DMB-Vorstand,
betont: „Die Bundesregierung hat sich im
Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, dass jeder
junge Mensch eine Ausbildung absolvieren kann.
Das ist lobenswert – aktuell sind wir von diesem
Ziel jedoch noch weit entfernt. Bei der
praktischen Berufsausbildung erleben wir eine
verkehrte Welt: Obwohl gerade in
mittelständischen Betrieben Fachkräfte fehlen,
absolvieren immer mehr junge Menschen keine
Ausbildung.

Foto DMB
Als Mittelstandsverband begrüßen
wir das Vorhaben von Union und SPD, die
Berufsorientierung in Schulen sowie die
Jugendberufsagenturen zu stärken. Allerdings
darf es nicht bei politischen
Lippenbekenntnissen bleiben – die Umsetzung von
zielführenden und vermittelnden Maßnahmen auf
dem Ausbildungsmarkt muss schnellstmöglich
erfolgen. Für den Mittelstand ist es essenziell,
dass die Ausbildungslücke nicht noch
dramatischer zunimmt.“
Verbundausbildung
muss gefördert werden
Akuter Handlungsbedarf
besteht aus Verbandsperspektive vor allem in der
besseren Vernetzung zwischen
Ausbildungsbetrieben und Schulen. „Hier spielen
die Jugendberufsagenturen als Bindeglied eine
Schlüsselrolle, sie müssen gezielt gefördert
werden“, sagt Tenbieg. Der Verbands-Vorstand
spricht sich zudem für die Förderung der
sogenannten Verbundausbildung aus, bei der sich
mehrere Betriebe bei der praktischen
Berufsausbildung ergänzen.
„Gerade im
ländlichen Raum kann die Kooperation von
Unternehmen ein sinnvoller Weg sein, um jungen
Menschen einen erfolgreichen Einstieg ins
Berufsleben zu ermöglichen. Dafür braucht es
neben der Bereitschaft der Unternehmen aber auch
die entsprechende Unterstützung durch die
Kommunen.“
Eine aktuelle repräsentative
Umfrage im Auftrag des DMB zeigt: KMU können vor
allem durch ihre regionale Verwurzelung, flache
Hierarchien und den starken Zusammenhalt unter
den Mitarbeitenden punkten. „Der Mittelstand
genießt einen exzellenten Ruf in der
Bevölkerung. Nun gilt es insbesondere jungen
Menschen diese Vorteile näherzubringen, um im
Wettbewerb um Talente erfolgreich zu sein“, sagt
Tenbieg.
Der Deutsche Mittelstands-Bund
(DMB) e.V. ist der Bundesverband für kleine und
mittelständische Unternehmen in Deutschland. Der
DMB wurde 1982 gegründet und sitzt in
Düsseldorf. Unter dem Leitspruch „Wir machen uns
für kleine und mittelständische Unternehmen
stark!“ vertritt der DMB die Interessen seiner
rund 33.000 Mitgliedsunternehmen mit über
800.000 Beschäftigten.
Damit gehört der
DMB mit seinem exzellenten Netzwerk in
Wirtschaft und Politik zu den größten
unabhängigen Interessen- und
Wirtschaftsverbänden in Deutschland. Der Verband
ist politisches Sprachrohr und Dienstleister
zugleich, unabhängig und leistungsstark.
Spezielle Themenkompetenz zeichnet den DMB
in den Bereichen Digitalisierung, Nachfolge,
Finanzen, Internationalisierung, Energiewende
und Arbeit & Bildung aus. Als
dienstleistungsstarker Verband bietet der DMB
seinen Mitgliedsunternehmen zudem eine Vielzahl
an Mehrwertleistungen. Weitere Informationen
finden Sie unter
www.mittelstandsbund.de.
Wesel: Eine große Dame wird 110
Jahre alt - Ingeborg ten Haeff
Ingeborg ten Haeff wurde am 31. Juli 1915 in
Düsseldorf geboren. Zu dieser Zeit war eine
selbst bestimmte Lebensgestaltung für Frauen nur
mit der Zustimmung des Vaters oder Ehemannes
möglich. Hinzu kam, dass der Erste Weltkrieg
sämtliche Lebensbereiche überschattete. Schon
früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für die
Kunst, die ihr Leben prägen sollte.

Von 1917 bis 1928 lebte sie in Wesel, der
Heimatstadt ihres Vaters, im Haus Rohleerstraße
11. Diese Kindheitsjahre waren geprägt von dem
frühen Tod ihres Vaters. 1928 verließen Ingeborg
ten Haeff, ihre Mutter und ihre Schwester Wesel
und zogen nach Berlin. Die Hauptstadt des
Deutschen Reiches war damals eine pulsierende
Metropole und galt als Zentrum der
avantgardistischen Kunst- und Kulturszene.
Ingeborg ten Haeff bei der
Ausstellungseröffnung 2006 in Wesel.
Von 1933
bis 1940 widmete sich Ingeborg mit Leidenschaft
dem Studium von Musik und Gesang. Hier begegnete
sie sowohl ihrer künstlerischen Bestimmung als
auch ihrer ersten Liebe: Dr. Lutero Vargas, dem
Sohn des brasilianischen Präsidenten Getúlio
Vargas. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde
das Paar vor eine schwere Entscheidung gestellt,
denn Dr. Vargas musste in seine Heimat Brasilien
zurückkehren. Ingeborg folgte Dr. Lutero Vargas
nach Rio de Janeiro, wo das junge Paar im
gleichen Jahr heiratete.
Bereits 1944
trennten sich die Eheleute. Ingeborg zog es nach
New York, einer Stadt voller Inspiration und
Kreativität. Dort fand sie die Freiheit, sich
ganz ihrer Kunst zu widmen. Nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs wurde ihre Ehe offiziell
geschieden. Ingeborg wurde Teil der pulsierenden
Kunstszene New Yorks. In der Galerie des
renommierten Kunsthändlers Israel Ber Neumann,
der viele europäische Künstler vertrat, die vor
der Verfolgung durch die Nationalsozialisten
geflohen waren, fand sie nicht nur Inspiration,
sondern auch einen Zugang zur klassischen
Moderne Europas.
Hier lernte sie ihren
zweiten Ehemann, den visionären Architekten und
Stadtplaner Paul Lester Wiener, kennen und
lieben. Gemeinsam bereisten sie Mittel- und
Südamerika. In den späten 1950er Jahren lebte
Ingeborg ten Haeff ihre Leidenschaft für die
Malerei aus und begann, an der University of New
York zu studieren. Bald darauf feierte sie erste
Erfolge mit Einzelausstellungen, darunter eine
bemerkenswerte Präsentation im Hudson River
Museum.
Nach dem Verlust ihres zweiten
Ehemannes 1967 zog sich Ingeborg vorübergehend
aus der Kunstszene zurück. 1969 fand sie in John
Lawrence Githens, einem Professor für Russisch
am Vassar College in Poughkeepsie, New York,
eine neue Liebe und ihren dritten Ehemann.
In den 1970er Jahren experimentierte sie in
ihren Porträts mit abstrahierten Motiven, die
ihre künstlerische Entwicklung widerspiegelten.
In ihrem Spätwerk kehrte sie jedoch wieder zur
Zeichnung zurück. 2006 erfreute die Galerie im
Zentrum der Stadt Wesel die Besucher*innen mit
einer Ausstellung der Werke der bekannten
Künstlerin Ingeborg ten Haeff.
Zur
festlichen Eröffnung am 19. Februar kehrte die
Künstlerin persönlich, begleitet von ihrem
Ehemann, ein letztes Mal nach Wesel zurück.
Ingeborg ten Haeff lebte ein selbstbewusstes und
künstlerisch erfülltes Leben, in dem sie sich
gegen die Normen einer von Männern dominierten
Gesellschaft behauptete. Ihre unerschütterliche
Kreativität und Entschlossenheit machten sie zu
einer inspirierenden Persönlichkeit, deren
Einfluss weit über ihre Zeit hinausreicht. Sie
verstarb 2011 in New York.
Ihr
Lebenswerk hinterlässt ein bleibendes Erbe.
Ingeborgs Geschichte ermutigt Frauen bis heute,
ihre Träume zu leben. Im Jahr 2020 beschloss der
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und
Nachhaltigkeit des Rates der Stadt Wesel, einen
Weg, den Ingeborg-ten-Haeff-Weg in
Wesel-Feldmark, zu benennen, um ihr
künstlerisches Erbe und ihren Einfluss auf die
Stadt zu würdigen.
Seit Juli 2025 ziert
ein Porträt der Künstlerin die „FrauenWege“ in
der Sandstraße. Ihr Porträt kann dort zusammen
mit denen weiterer bedeutender Frauen, die die
Stadtgeschichte maßgeblich geprägt haben,
bewundert werden. Wer sich neben Ingeborg ten
Haeff auch über andere inspirierende Frauen aus
Wesel informieren möchte, kann im Rathaus vor
Zimmer 116 in der ersten Etage eine kostenlose
Broschüre mit dem Titel „Die WEGgefährtinnen“
mitnehmen.
Moers: Grabenlose
Kanalsanierung in der Unterwallstraße Straße
wird eine Woche zur Sackgasse
Die Modernisierung der Moerser Innenstadt
schreitet voran, bei der die ENNI Stadt &
Service Niederrhein (Enni) in den kommenden
Jahren auch mehrere Kilometer der alten Schmutz-
und Regenwasserkanäle austauschen wird. Während
die Kanalsanierung in der Fieselstraße und der
Straße Im Rosenthal mittlerweile in offener
Bauweise läuft, wird Enni noch in den
Sommerferien, ab Montag, 11. August, in der
Unterwallstraße den letzten möglichen
Kanalabschnitt im Inlinerverfahren sanieren.
Wie zuvor am Neumarkt oder in der Burg- und
Haagstraße lässt der Zustand der Kanäle und
deren Gefälle auch hier das grabenlose
Sanierungsverfahren zu. „Diese schnelle Methode
hat sich in der Innenstadt bereits mehrfach
bewährt“, sagt Bernd Focke als zuständiger
Bauleiter der Enni. „Die Unterwallstraße müssen
wir wegen der Lage der Kanalschächte während der
einwöchigen Arbeiten aber zwischen Neumarkt und
Trotzburg-Kreuzung für den Durchgangsverkehr
sperren.“
Das Inlinerverfahren
ermöglicht es, harzgetränkte Schläuche über die
Kanalschächte in die beschädigten Kanäle
einzuziehen und diese anschließend mit UV-Licht
auszuhärten. Die sonst notwendigen aufwändigen,
das Umfeld teils Monate einschränkenden
Erdarbeiten können hierbei entfallen. So wird
der Verkehr auch in diesem sensiblen
Innenstadtbereich rund um das Rathaus schnell
wieder rollen.
Während der einwöchigen
Sperrung wird der Verkehr in beiden
Fahrtrichtungen über die Repelener, die Mühlen-
und die Rheinberger Straße umgeleitet. Der
Wochenmarkt findet wie gewohnt statt, da der
Neumarkt genau wie das Modehaus Braun von
Hülsdonk kommend jederzeit erreichbar bleibt.
Autofahrer können auch die Ausfahrt am
Wallzentrum an der Oberwall-/ Unterwallstraße
durchweg nutzen.
Wie üblich hat Enni
auch diese Sanierungsmaßnahme mit den
zuständigen Fachbereichen der Stadt Moers, der
Polizei, der Feuerwehr und auch der NIAG
abgestimmt. Fragen hierzu beantwortet Enni am
Baustellentelefon unter 02841 104-777.
TÜV-Verband begrüßt
NIS-2-Umsetzung – und fordert Nachbesserungen
Nationales Umsetzungsgesetz der EU-Richtlinie
führt zu höherer Cybersicherheit in der
deutschen Wirtschaft. Ausnahmeregelungen
schärfen oder streichen. Unternehmen sollten
klare Vorgaben haben, wie Nachweise für die
Umsetzung zu erbringen sind.
Das
Bundeskabinett hat am 30. Juli 2025 das
nationale Umsetzungsgesetz der europäischen
NIS-2-Richtlinie beschlossen.
Dazu sagt
Marc Fliehe, Fachbereichsleiter Digitalisierung
und Bildung beim TÜV-Verband: „Deutschland ist
Ziel hybrider Angriffe und Cyberattacken auf
Unternehmen, kritische Infrastrukturen und
politische Institutionen gehören zur
Tagesordnung. Die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie
in nationales Recht ist ein wichtiger Schritt,
um die Cybersicherheit in der deutschen
Wirtschaft zu verbessern. Das Gesetz ist längst
überfällig und muss angesichts der
Bedrohungslage im Cyberraum zügig beschlossen
werden. Mit dem aktuellen Entwurf liegt eine
solide Grundlage vor – jetzt braucht es den
politischen Willen, offene Punkte im
parlamentarischen Verfahren konstruktiv und
schnell zu klären.“
Aus Sicht des
TÜV-Verbands ist es nun Aufgabe des Bundestags,
den Gesetzesentwurf an entscheidenden Stellen zu
schärfen, um die Wirksamkeit in der Praxis zu
erhöhen. Besonders relevant sind dabei folgende
Punkte:
1. Ausnahmeregelungen klar
definieren oder streichen
Aus Sicht des
TÜV-Verbands wirft die neu eingeführte Ausnahme
für „vernachlässigbare“ Geschäftstätigkeiten
erhebliche Fragen auf.
Der Begriff ist
unbestimmt und wird im Gesetz nicht näher
definiert. Es bleibt unklar, nach welchen
Kriterien eine Tätigkeit als vernachlässigbar
gelten soll. „Ohne präzise Vorgaben besteht die
Gefahr uneinheitlicher Auslegung und einer
Rechtsunsicherheit für Unternehmen“, sagt
Fliehe. Zudem könnte diese nationale
Sonderregelung zu einem faktischen Ausschluss
regulierungspflichtiger Tätigkeiten führen, die
laut NIS-2-Richtlinie eigentlich erfasst sein
sollten.
Der TÜV-Verband sieht daher die
Gefahr, dass der deutsche Gesetzgeber mit dieser
Öffnungsklausel vom europäischen
Harmonisierungsziel abweicht und fordert eine
eindeutige und EU-rechtskonforme Ausgestaltung
dieser Ausnahme.
2. Nachweispflichten
überarbeiten
In der NIS-2-Richtlinie ist
eine regelmäßige Nachweispflicht für „besonders
wichtige Einrichtungen“ vorgesehen, die aus
Sicht des TÜV-Verbands im deutschen Gesetz nicht
ausreichend umgesetzt ist. „In der Praxis läuft
es auf stichprobenartige Einzelfallprüfungen
hinaus, was nicht der Intention der Richtlinie
entspricht und sicherheitstechnisch bedenklich
ist“, sagt Fliehe. „Die Behörden müssen die
Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen überprüfen
und durchsetzen können.“
In diesem
Zusammenhang sieht der TÜV-Verband auch die
Verlängerung der Nachweisfristen für die
Betreiber kritischer Infrastrukturen von zwei
auf drei Jahre sehr negativ. Fliehe: „Die
Betreiber kritischer Infrastrukturen sind
regelmäßig gezielten Cyberangriffen ausgesetzt.
Eine Verlängerung des Nachweiszyklus ist vor
diesem Hintergrund mehr als kontraproduktiv.“
3. Vertrauen schaffen durch unabhängige
Zertifizierungen
Nur bei Einbindung
unabhängiger Dritter ist aus Sicht des
TÜV-Verbands sichergestellt, dass das notwendige
Vertrauen in die Umsetzung von
Cybersicherheitsanforderungen geschaffen werden
kann. Deshalb regt der TÜV-Verband an,
Zertifizierungen durch akkreditierte und
unabhängige Konformitätsbewertungsstellen
verbindlich in dem Prozess der
Nachweiserbringung (§ 39 BSIG-E) durch die
Hersteller vorzusehen.
4. Absicherung
der Lieferketten ausformulieren
Mit Blick
auf die weitgefassten Formulierungen zur
Absicherung der Lieferkette ist es erforderlich,
den Unternehmen eine Handreichung und
Orientierungshilfe zur Gestaltungstiefe der
Maßnahmen zur Absicherung der Lieferkette an die
Hand zu geben. In diesem Sinne ist
beispielsweise die Forderung „Security by
Design“ recht vage und bedarf weiterer
Detaillierungen.
Eine Orientierungshilfe
kann sowohl Mindestmaßnahmen aufzeigen als auch
Interpretations- und Auslegungsspielräume
reduzieren und leistet somit einen Beitrag zur
Erhöhung der Klarheit und Handlungssicherheit
der Verpflichteten.
Hintergrund: Das
NIS-2-Umsetzungsgesetz (NIS2UmsuCG) gilt für
rund 30.000 Unternehmen in Deutschland. Es
verpflichtet die Unternehmen unter anderem zur
Durchführung und Einführung von Risikoanalysen
und Sicherheitskonzepten, Maßnahmen zur
Vorbeugung und Reaktion auf
IT-Sicherheitsvorfälle, Zugangskontrollen,
Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung,
Mitarbeiterschulungen, Notfallplänen sowie
Maßnahmen für die Absicherung der Lieferkette.
Diese Anforderungen müssen „dem Stand der
Technik“ entsprechen und unterscheiden sich je
nach Größe, Branche und Kritikalität des
Unternehmens.
Die richtigen Worte im richtigen
Moment finden
Freier Redner:
Zertifikatslehrgang startet im August
Geburt, Hochzeit, Abschied – besondere
Lebensereignisse verdienen besondere Worte.
Freie Redner begleiten Menschen dabei: mit
einfühlsamen Texten und dem richtigen Gespür.
Der Zertifikatslehrgang der Niederrheinischen
IHK „Freier Redner (IHK)“ vermittelt das nötige
Handwerkszeug.
Der Kurs umfasst 50
Unterrichtseinheiten und richtet sich an alle,
die Reden professionell gestalten möchten. Die
Teilnehmer lernen, Sprache gezielt einzusetzen,
ihren eigenen Stil zu entwickeln und
wirkungsvoll aufzutreten. Im Mittelpunkt stehen
praxisnahe Übungen, bei denen Schritt für
Schritt eine eigene Rede entsteht. Diese wird
zum Abschluss des Lehrgangs präsentiert.
Der Lehrgang startet am 30. August als
Blended-Learning-Format. Die Teilnehmer kommen
teils nach Duisburg, teils lernen sie über
Microsoft Teams. Der Unterricht findet samstags
von 9:00 bis 18:00 Uhr sowie einmal freitags von
13:00 bis 17:00 Uhr statt. Das Seminar endet am
27. September. Bei erfolgreicher Teilnahme gibt
es ein IHK-Zertifikat.
Fragen beantwortet
Sabrina Althoff unter Tel. 0203 2821-382 oder
per E-Mail an althoff@niederrhein.ihk.de.
Anmeldung und weitere Informationen:
www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen
Kleve: Eis für alle trotz Nieselregens -
Bürgermeister Gebing und Stadtkämmerer Keysers
besuchen den „Robi“
Leichtes
Nieseln und grauer Himmel konnten die gute Laune
nicht trüben: Im Rahmen der städtischen
Sommerferienaktion besuchten am
Freitagvormittag, 25. Juli 2025, Bürgermeister
Wolfgang Gebing sowie der Erste Beigeordnete und
Stadtkämmerer Klaus Keysers den Klever
Abenteuerspielplatz „Robinson“. Für die rund 50
teilnehmenden Kinder hatten sie eine süße
Überraschung im Gepäck: Eis für alle.

Bürgermeisterbesuch auf dem Robinsonspielplatz
„Auch bei bedecktem Himmel – Eis geht
immer“, war die einhellige Meinung der Kinder,
die in den ersten vier Ferienwochen das
abwechslungsreiche Programm des
Robinson-Spielplatzes genießen. Trotz des
durchwachsenen Wetters herrschte fröhliche
Stimmung. Die Kinder tobten, bastelten, spielten
und freuten sich über den besonderen Besuch aus
dem Rathaus.

Gruppenbild Robi 2025
Das städtische
Ferienangebot auf dem Abenteuerspielplatz ist
seit Jahren ein beliebter Bestandteil der Klever
Sommerferien. Ein Kind brachte es auf den Punkt:
„Abwechslungsreiches Programm, nette Betreuer.“
Das spiegelt die große Zufriedenheit und den
Erfolg der Maßnahme wider, die Jahr für Jahr
schnell ausgebucht ist.
Bürgermeister
Gebing zeigte sich beeindruckt vom Einsatz des
Betreuungsteams vor Ort: „Es ist großartig zu
sehen, wie engagiert hier gearbeitet wird – die
Kinder erleben echte Ferienabenteuer.“ Auch
Klaus Keysers betonte die Bedeutung solcher
Angebote: „Der Robinson-Spielplatz steht für
Kreativität, Gemeinschaft und Freude. Das ist
gelebte Kinderfreundlichkeit in Kleve.“
Das
gesamte Sommerferienprogramm der Stadt Kleve ist
hier zu finden:
www.kleve.de/sommerferien
Digitale
Fallübergabe im Notdienst - KVNO-Pilotprojekt
mit konkreten Verbesserungen – Roll-out für ganz
Nordrhein dringend notwendig
Nach über sechs Monaten im Live-Betrieb in Bonn
ist klar: Die elektronische Vernetzung der
beiden Rufnummern 116 117 sowie 112, bringt für
Patienten, den Rettungsdienst, die Disponenten
in der Leitstelle sowie die Ärztinnen und Ärzte
in der ambulanten Versorgung viele Vorteile. Das
Pilotprojekt zeigt aber auch, dass die teilweise
deutlichen Vorteile nur dann das gesamte
Gesundheitssystem entlasten können, wenn
politische Weichen gestellt werden. Die KVNO
bietet sich weiter als Partner an.
Seit
November 2024 läuft der Schulterschluss im
Notdienst in der Bundesstadt Bonn. Zum Start
sagte Dr. med. Frank Bergmann,
Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen
Vereinigung Nordrhein (KVNO): „Es ist mehr
Zusammenarbeit gefragt, wenn wir den wachsenden
Anforderungen in der Akut- und Notfallversorgung
auch künftig gerecht werden wollen. Gemeinsam
mit der Stadt Bonn haben wir einen wichtigen
Schritt getan. Die Steuerung über einen
zentralen Kontaktpunkt ermöglicht eine
systemschonende und am medizinischen Bedarf
orientierte Zuweisung der Anrufenden.“
Die Prognose des KVNO-Chefs zum Projektstart:
„Das verbessert nicht nur die
Patientensicherheit, sondern hilft auch dabei,
Informationsabbrüche, Wartezeiten und weitere
Reibungsverluste zu vermeiden.“
•
Heute (29. Juli 2025) ist
klar: Diese Erwartungen haben sich erfüllt.
Bereits über 1.200-mal konnten die Anrufenden
nach erfolgter strukturierter medizinischer
Einschätzung jeweils vom KVNO-Patientenservice
an den Notruf 112 oder umgekehrt übergeben
werden. Bergmann: „Gerade die direkte Übergabe
samt aller wichtigen Informationen an den Notruf
spart wertvolle Zeit und kann Leben retten!“
•
Bessere Verfügbarkeit und
weniger Kosten für das belastete System
Ebenso bietet der umgekehrte Weg eine deutliche
Entlastung für den Rettungsdienst. „Jeder Fall,
der von der rettungsdienstlichen Maßnahme in die
vertragsärztliche Versorgung überführt werden
kann, steigert auch die Verfügbarkeit des
Rettungsdienstes für die tatsächlichen
Notfallpatienten. Gleichzeitig fallen enorme
Kosten weg, da die vertragsärztliche Behandlung
nur einen Bruchteil der Rettungsdienst- und
stationären Versorgungskosten benötigt.“
•
Herausforderung Roll-out
für ganz Nordrhein
Warum also nicht ein
Roll-out für ganz Nordrhein oder gleich ganz
NRW? Bergmann erklärt: „In Nordrhein-Westfalen
fehlt bisher eine digitale Infrastruktur, die
die Systeme des ambulanten Bereitschaftsdienstes
(116 117) und die des Rettungsdienstes (112)
effizient miteinander verbindet.“
•
Wichtig für den Erfolg
eines solchen Roll-outs sei es, dass die Frage
der Umsetzung und der Zeitpunkt der Einführung
nicht dem individuellen Ermessen einzelner
Leitstellen überlassen bleiben, so Bergmann. „Es
braucht eine klare politische und finanzielle
Rahmensetzung sowie betriebliche Unterstützung,
damit alle 52 Leitstellen in NRW diese wichtige
Infrastruktur zeitnah und koordiniert einführen
können.“
•
Wunsch nach politischer
Verbindlichkeit
Ohne eine solche
Verbindlichkeit bestünde die Gefahr, dass
regionale Pilotprojekte, wie aktuell in Köln und
Mettmann geplant, nicht priorisiert werden -
trotz vorhandener technischer Machbarkeit und
Kooperationsbereitschaft, so der KVNO-Vorstand.
„Diese Piloten können nur erfolgreich sein, wenn
sie politisch durch verbindliche strukturelle
und wirtschaftliche Planungssicherheit flankiert
werden.“
•
Arbeitsgruppe in Abstimmung
mit handelnden Personen
„Wir wollen und
werden uns weiter für eine zukunftsfeste
Versorgung in Nordrhein und NRW einsetzen und
begrüßen daher auch die in der Zwischenzeit
entstandene Arbeitsgruppe mit dem MAGS, allen
Fachverbänden der Rettungsleitstellen in NRW und
den beiden Kassenärztlichen Vereinigungen“, so
Bergmann. „Wir wünschen uns als Ergebnis einen
klaren Fahrplan, um die elektronische Vernetzung
der Rufnummern 116 117 und 112 so schnell wie
möglich in NRW umsetzen zu können.“
Die
Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein
stellt die ambulante medizinische Versorgung für
fast zehn Millionen Menschen im Rheinland
sicher. Zu ihren Mitgliedern zählen rund 24.000
Vertragsärzte, Psychotherapeuten und
Ermächtigte.
Für die Mitglieder trifft
die KV Nordrhein unter anderem Vereinbarungen
mit den Krankenkassen, die die Grundlage für die
Behandlung der Patienten, die Honorierung der
Ärzte und die Qualitätssicherung bilden. Zu den
weiteren Aufgaben zählen das Abrechnen der
ärztlichen Leistungen und die Verteilung des
Honorars an die Ärzte. Darüber hinaus setzt sich
die KV Nordrhein als Interessenvertreter ihrer
Mitglieder ein, die sie in allen Fragen von der
Abrechnung bis zur Zulassung berät.
Deutschland im Stau: Erstes
August-Wochenende wird zur Geduldsprobe
Alle Bundesländer in den Ferien
Heimreiseverkehr nimmt deutlich zu
Stauprognose vom 1. bis 3. August

©imago images/Steinsiek.ch
Das erste
Augustwochenende dürfte zu den staureichsten des
Sommers zählen. Autofahrerinnen und Autofahrer
müssen sich auf erhebliche Verzögerungen
einstellen, sowohl auf dem Weg in den Urlaub als
auch bei der Rückreise. Besonders viele Reisende
starten jetzt in die Ferien, da nun auch in
Baden-Württemberg und Bayern die Sommerferien
beginnen. Damit sind nun alle Bundesländer in
den Ferien. Gleichzeitig nimmt der
Rückreiseverkehr deutlich zu, denn in zwei
Wochen enden die Ferien in den ersten
Bundesländern.

Wer flexibel ist, sollte auf einen Reisetag
unter der Woche ausweichen, idealerweise
zwischen Dienstag und Donnerstag. In der
Ferienzeit ist der Berufsverkehr werktags
deutlich geringer, was sich positiv auf den
Verkehrsfluss auswirkt.
Bei gutem Wetter
sorgen zusätzlich zahlreiche Tagesausflügler und
spontan Reisende für Belastung auf den Straßen.
Besonders häufig kommt es zu Verzögerungen an
den bundesweit 1.200 Baustellen.
Zur
Entlastung des Ferienverkehrs gilt auf den
wichtigsten Autobahnen ein Lkw-Fahrverbot für
Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Es greift an allen
Samstagen vom 1. Juli bis einschließlich 31.
August, jeweils zwischen 7 und 20 Uhr.
Unverändert bleibt das ganzjährig geltende
Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen - es gilt
von 0 bis 22 Uhr auf dem gesamten Straßennetz.
Staugefährdete Autobahnen (in beiden
Richtungen)
• Fernstraßen zur und von der
Nord- und Ostsee
• A1 Köln – Dortmund sowie
Bremen – Hamburg
• A3 Frankfurt – Nürnberg –
Passau
• A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt –
Dresden
• A5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel
• A6 Mannheim – Nürnberg
• A7 Hamburg –
Flensburg sowie Würzburg – Füssen/Reutte
• A8
Karlsruhe – München – Salzburg
• A9 Berlin –
Nürnberg – München
• A10 Berliner Ring
•
A11 Berlin – Dreieck Uckermark
• A19 Dreieck
Wittstock – Rostock
• A24 Hamburg – Berlin
• A61 Mönchengladbach – Ludwigshafen
• A81
Stuttgart – Singen
• A93 Inntaldreieck –
Kufstein
• A95/B2 München –
Garmisch-Partenkirchen
• A96 München – Lindau
• A99 Umfahrung München
Auch auf den
europäischen Ferienrouten ist Geduld gefragt,
sowohl bei der An- als auch bei der Rückreise.
Besonders staugefährdet sind die Transitrouten
in und durch Österreich, die Schweiz, Italien
und Frankreich.
Zu den Problemstrecken
zählen im Reisesommer unter anderem Tauern-,
Inntal-, Rheintal-, Pyhrn-, Fernpass-, Brenner-,
Karawanken- und Gotthard-Route sowie die
Fernstraßen zu den italienischen, kroatischen
und französischen Küsten.
Auch bei Reisen
nach Nordeuropa muss mit Verzögerungen gerechnet
werden, ebenso auf den Hauptachsen aus und in
Richtung Polen, Tschechien und die Niederlande.
An zahlreichen Grenzübergängen finden
weiterhin stichprobenartige Kontrollen statt.
Die Schwerpunkte deutscher Kontrollen liegen an
den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien,
Frankreich und der Schweiz. Wartezeiten von 30
bis 60 Minuten sind keine Seltenheit. Auch Polen
kontrolliert bei der Einreise. Mit Staus ist
etwa an den Grenzübergängen A4 Ludwigsdorf
(Görlitz), A11 Pomellen (Stettin), A12 Frankfurt
(Oder) und A15 Forst zu rechnen.
Reisende, die nach Griechenland oder in die
Türkei fahren, müssen mit längeren Aufenthalten
an den Grenzen rechnen, die teilweise mehrere
Stunden dauern können.
Stadtteilgeld Lohberg:
Finanzierungsmöglichkeit für erstes Halbjahr
gefunden
Die Stadt Dinslaken
informiert über aktuelle Entwicklungen bei der
Städtebauförderung im Stadtteil Lohberg. Im
Rahmen der sogenannten vorläufigen
Haushaltsführung dürfen nur Auszahlungen
geleistet werden, zu denen die Stadt gesetzlich
verpflichtet ist. Mit dem Stadtteilgeld konnten
seit dem Jahr 2023 Projekte in Lohberg gefördert
werden, die dem Zusammenhalt, dem Image oder
auch dem kulturellen Austausch der Menschen
untereinander dienten.
Im Rahmen der
vorläufigen Haushaltsführung steht das
Stadtteilgeld derzeit leider nicht zur
Verfügung, da es zu den freiwilligen Leistungen
gehört, die nicht gesetzlich vorgeschrieben
sind. Neue Förderzusagen können daher
grundsätzlich nicht mehr ausgesprochen werden.
Aufgrund der hohen Bedeutung des
Stadtteilgeldes für das bürgerschaftliche
Engagement in Lohberg hat die Stadtverwaltung
erfolgreich Lösungswege geprüft, um zumindest
Anfragen aus der ersten Jahreshälfte bewilligen
zu können. Mithilfe einer zugesagten Spende
konnte hierfür eine tragfähige Lösung gefunden
werden.
Neue Anträge können jedoch
leider nicht mehr bearbeitet oder bewilligt
werden. Leider ebenfalls nicht fortgesetzt
werden konnte das Hof- und Fassadenprogramm, ein
zentrales Förderinstrument zur gestalterischen
Instandsetzung privater, teils
denkmalgeschützter Gebäude.
Das Programm
unterstützte Hauseigentümer*innen insbesondere
bei der denkmalgerechten Sanierung von Bauteilen
wie Haustüren und Fensterläden. Aufgrund der
haushaltsrechtlichen Vorgaben der
Gemeindeordnung musste das Programm im
vergangenen Jahr zunächst ausgesetzt werden.
Das Hof- und Fassadenprogramm läuft am
31.12.2025 aus. Aufgrund der vorläufigen
Haushaltsführung kann es schon jetzt nicht
weiter umgesetzt werden, da es sich um eine
freiwillige Maßnahme handelt. Unsere Empfehlung:
Die Stadt empfiehlt betroffenen Eigentümerinnen
und Eigentümern, auf die Denkmalförderung des
Landes Nordrhein-Westfalen zurückzugreifen.
Das Programm des Ministeriums für Heimat,
Kommunales, Bau und Digitalisierung bietet
finanzielle Unterstützung für den Erhalt und die
Pflege denkmalgeschützter Immobilien. Weitere
Informationen zum Denkmalförderprogramm finden
Sie auf der Website des Ministeriums:
www.mhkbd.nrw/foerderprogramme/denkmalfoerderprogramm
Amtsblatt informiert über Zulassung von
Wahlvorschlägen
Am 25. Juli
2025 ist ein neues Amtsblatt der Stadt Dinslaken
erschienen. Es informiert über die Zulassung von
Wahlvorschlägen für die Kommunalwahl und für die
Wahl des Integrationsrates am 14. September
2025. Die
Amtsblätter können unter anderem auf der
städtischen Homepage eingesehen werden
EU im
Würgegriff des US-Potentaten Trump - ÖDP
kritisiert Einknicken der EU-Kommission als
„Bankrotterklärung für konsequenten Klimaschutz“.
EU im Würgegriff des US-Potentaten Trump ÖDP
kritisiert Einknicken der EU-Kommission als
„Bankrotterklärung für konsequenten
Klimaschutz“. „EU-Kommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen (CDU) hat unseren Planeten
verraten.“
Drastisch urteilt Prof. Dr.
Herbert Einsiedler als Vorstandsmitglied der
Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP – Die
Naturschutzpartei) über den jüngsten „Deal“ zur
Begrenzung der drohenden US-Zölle, mit dem die
Trump-Administration der
EU-Kommissionspräsidenten eine Vereinbarung zu
Lasten von Verbrauchern und Wirtschaft
abgenötigt hat.
Diese „Einigung“ macht
ökonomisch keinen Sinn, befürchten
Wirtschaftsexperten und rechnen mit Schäden
in Milliardenhöhe. Mit der Verhandlung
torpedierte die EU-Chefin zudem – und schlimmer
noch! – ihren eigenen Green Deal, um sich die
Gunst des Rambos im Weißen Haus mit einem mehr
als wackligen Versprechen zu sichern: Die
Staaten des alten Kontinents müssen innerhalb
von drei Jahren für 750 Milliarden Dollar
fossile Brennstoffe – und damit klimaschädliche
CO2-Schleudern - aus der Neuen Welt kaufen.
Heißt konkret: Klimaschutz ade! „Wir
brauchen schnellstens 100 Prozent erneuerbare
Energie“, fordert stattdessen
ÖDP-Bundesvorstandsmitglied Helmut Kauer: „Das
schützt nicht nur das Klima, sondern uns auch
vor solchen Erpressungen durch das Ausland.“ Der
ÖDP-Bundesvorsitzende Günther Brendle-Behnisch
spricht vom Kotau von der Leyens vor dem
Möchtegern US-Potentaten Trump: „Das war ein
Offenbarungseid.“
Einsiedler ergänzt:
„Damit wird die Energiewende sabotiert und dem
Green Deal der Todesstoß versetzt.“ Selbst wenn,
was einige Medien und EU-Politiker in Brüssel
munkeln, dieser Energiezukauf der Europäer
in Trumpland „unrealistisch“ ist, bleibt das
bloße Abnicken zur Erpressung des US-Präsidenten
ungeheuerlich. Für Brendle-Behnisch ein
„Kniefall vor der Macht“. Besser wäre es,
empfiehlt der ÖDP-Chef und selbst ehemaliger
Unternehmer, „sich auf andere Märkte zu
konzentrieren und sich möglichst schnell aus
diesem Würgegriff zu befreien.“
Kammermusikfest
Kloster Kamp
Das Kammermusikfest
Kloster Kamp präsentiert zum 21. Mal Werke der
Klassik und Romantik. Beim Eröffnungskonzert am
31. Juli, 20 Uhr, in der Abteikirche Kloster
Kamp in Kamp-Lintfort stehen Kompositionen von
Wolfgang Amadeus Mozart, Peteris Vasks und Anton
Arensky auf dem Programm.
Für
Frühaufsteher ist das Sonnenaufgangskonzert mit
anschließendem Frühstück am 2. August, 6 Uhr, im
Rokokosaal Kloster Kamp. Der Konzertreigen endet
am 3. August, 19 Uhr, mit der Aufführung von
Werken von Josef Suk, Robert Schumann und
Johannes Brahms in Schloss Bloemersheim in
Neukirchen-Vluyn. idr
https://www.kammermusikfest-klosterkamp.de
Wärmepumpen-Run statt Zwang
Deutsche Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer
sind bereit für die hauseigene Energiewende: Bis
2029 wollen vier von zehn eine Wärmepumpe zum
Heizen nutzen. Das ist das Ergebnis einer
repräsentativen Umfrage des Instituts für
Demoskopie Allensbach im Auftrag der Initiative
Klimaneutrales Deutschland. Der Anteil der
selbstgenutzten Eigenheime mit Wärmepumpe könnte
sich mehr als verdoppeln und damit eine enorme
Nachfragewelle auslösen, von der Handwerk und
Mittelstand profitieren.
Derzeit heizen
laut der Allensbach-Umfrage 15 Prozent der
selbstnutzenden Hausbesitzerinnen und -besitzer
in Deutschland mit einer Wärmepumpe. Bis 2029
könnte sich diese Zahl mehr als verdoppeln, auf
fast 40 Prozent. Dass viele von ihnen gerade
ihre Pläne in die Tat umsetzen, zeigen aktuelle
Zahlen des Bundesverbands der Deutschen
Heizungsindustrie BDH: Im ersten Halbjahr 2025
wurden erstmals mehr Wärmepumpen verkauft als
Gasheizungen.
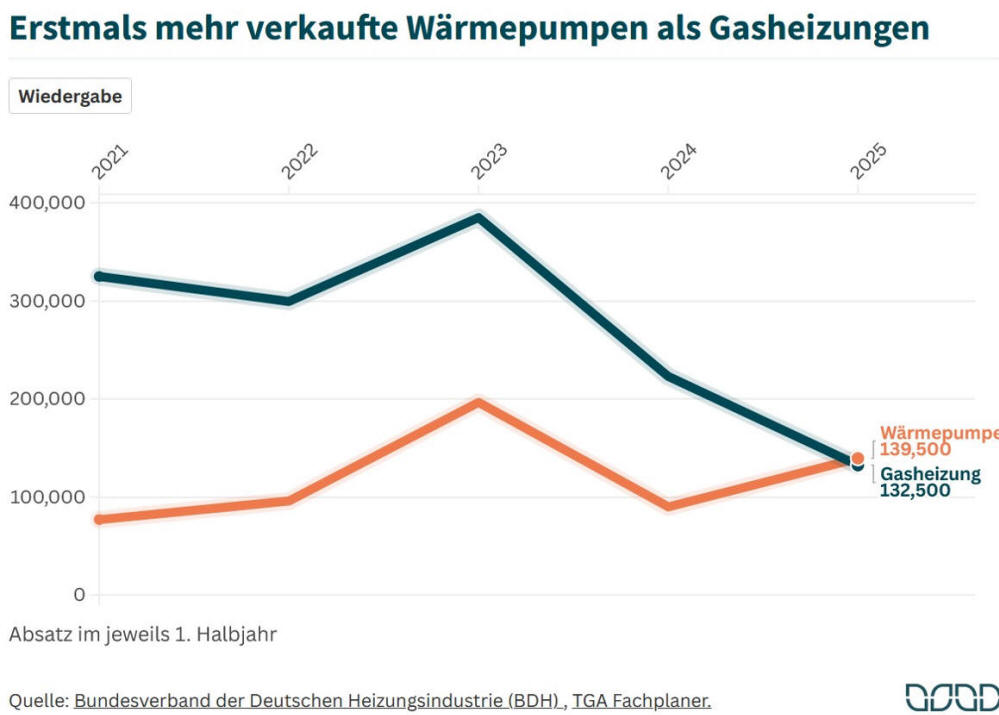
Milliardenpotenzial für den deutschen
Mittelstand
Deutschlandweit wohnen rund
13,5 Millionen Haushalte im eigenen Haus. Wenn
sich die Anschaffungspläne aus der Umfrage
realisieren, könnten allein in den kommenden
Jahren über drei Millionen zusätzliche
Wärmepumpen installiert werden – das bisherige
bisherige Spitzenjahr 2023 kommt auf 356.000
verkaufte Anlagen. Für Hersteller und
Installateure bedeutet das ein riesiges
Umsatzpotenzial. In wirtschaftlich
herausfordernden Zeiten eine gute Botschaft.
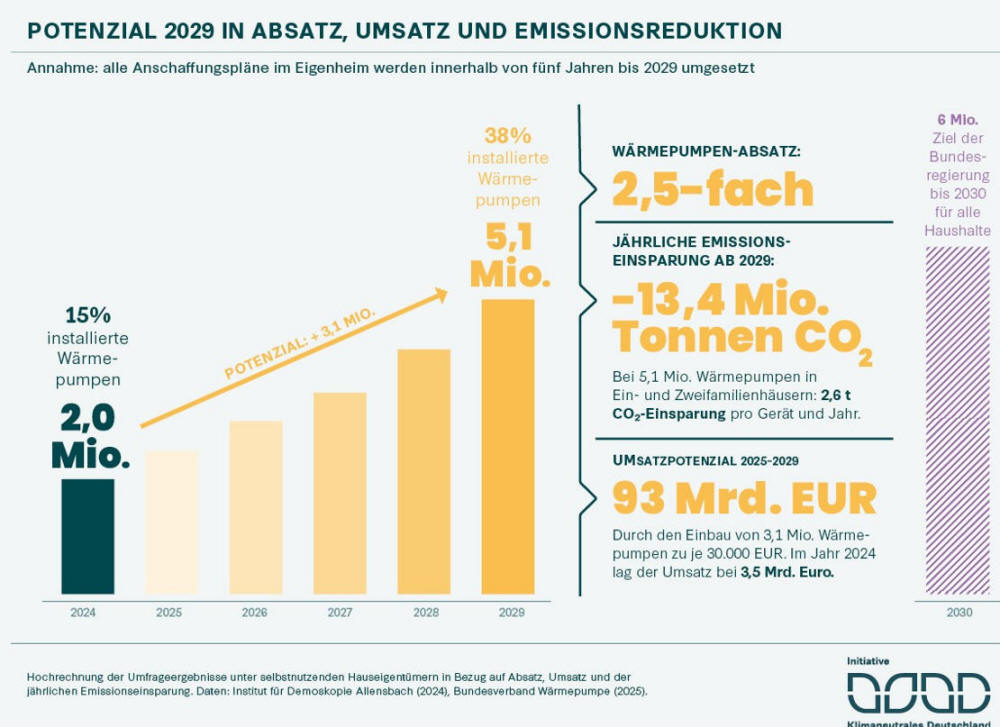
Carolin Friedemann, Gründerin und
Geschäftsführerin der IKND, bewertet die Daten
wie folgt: „Immer mehr Hausbesitzende
entscheiden sich aus Überzeugung für eine
Wärmepumpe, denn sie wünschen sich
Unabhängigkeit von Öl und Gas und sie sehen,
dass sich die Investition rechnet. Derzeit sehen
wir einen echten Wärmepumpen-Run – ganz ohne
Zwang. Um diesen Trend zu verstetigen, braucht
es nun Planungssicherheit statt Signale des
Rückschritts. Verunsicherung ist Gift für
Heizkosten, Mittelstand und Klima.“
Wärmepumpen als Motor für Klimaschutz
Der vor
Kurzem bekanntgewordene Klimaschutzbericht 2025
des Bundesumweltministeriums konstatiert erneut,
dass der Gebäudesektor zu viele Emissionen
verursacht. Ohne eine Senkung der Treibhausgase
in diesem Bereich sind die Klimaziele nicht zu
schaffen. Sollte sich die Anschaffungspläne für
Wärmepumpen der Hausbesitzenden bis 2029
materialisieren, könnten allein diese Haushalte
jährlich ein Zehntel der heutigen Emissionen im
Gebäudesektor einsparen.
Methodik
Die
Umfrage wurde im Herbst 2024 vom Institut für
Demoskopie Allensbach durchgeführt. Befragt
wurden 4.089 Hausbesitzer ab 18 Jahren, die im
eigenen Haus wohnen. Die Befragung wurde online
durchgeführt. Sie ist repräsentativ für die
Gesamtheit aller Hausbesitzer in Deutschland,
die im eigenen Haus wohnen.
Bei 17,3
Millionen Haushalten (lt. Zensus), die in Ein-
oder Zweifamilienhäusern leben, und einer
Eigentumsquote von 78 Prozent entspricht das
rund 13,5 Millionen Haushalten.
Moers-Kapellen: Bürgerfreundlich
sanieren
Am Bendmannsfeld in
Moers-Kapellen erneuert Enni den
Schmutzwasserkanal grabenlos
Die ENNI
Stadt & Service Niederrhein (Enni) arbeitet im
Rahmen ihrer Erneuerungsstrategie derzeit an
zahlreichen Stellen des Stadtgebietes an der
Zukunft des Moerser Kanalnetzes. Ab Montag, dem
4. August, wird das Unternehmen dabei in der
Straße Am Bendmannsfeld in Moers-Kapellen den
Schmutzkanal erneuern. Bernd Focke wird als
zuständiger Bauüberwacher der Enni mit den rund
fünf Wochen dauernden Arbeiten in Höhe der
Hausnummer 13 beginnen.
In mehreren
Bauphasen werden sich die Monteure bis zur
Hausnummer 68 vorarbeiten und dabei das
sogenannte Schlauchliner-Verfahren einsetzen.
Gut für Anwohner, da Enni so ohne große
Tiefbauarbeiten auskommt. Voruntersuchungen
hatten ergeben, dass die Art der Schäden an dem
alten Kanal hier die grabenlose Arbeitsweise
zulassen. Hierdurch kann Enni die Bauzeit
verkürzen und Einschränkungen in dem Wohngebiet
reduzieren.
Die Straße wird dabei
allerdings in Höhe der Hausnummer 13 für die
gesamte Bauzeit zur Sackgasse. „Da wir hier
während der Arbeiten das anfallende
Schmutzwasser über einen in der Fahrbahnmitte
liegenden Kanalschacht ableiten müssen, wird die
Straße über die gesamte Bauzeit dort gesperrt
sein.“
Mit der speziellen Technik des
Schlauchliner-Verfahrens hat Enni an vielen
anderen Stellen des Stadtgebietes gute
Erfahrungen gemacht. Auch Am Bendmannsfeld
werden die Monteure die Teilabschnitte des alten
Schmutzwasserkanals zunächst über die Schächte
ausfräsen und nachfolgend in einem zweiten
Arbeitsschritt harzgetränkte Schläuche in die
alten Kanäle einziehen, die dann mithilfe von
UV-Licht aushärten. „Hierdurch müssen wir die in
rund drei Metern Tiefe liegenden Kanäle nicht in
klassischer Bauweise freilegen.“
So
bekommen Bürgerinnen und Bürger wenig von den
Arbeiten mit. Lediglich an den in der
Straßenmitte liegenden Kanalschächten, in die
die Monteure den Inliner einziehen, wird es für
den Autoverkehr einige Tagen zu Behinderungen
und in den Arbeitsbereichen zu Halteverboten
kommen.
Fußgänger können die Straßen
ungehindert passieren, Anwohner ihre Häuser
jederzeit erreichen. Sobald die Kanäle saniert
sind, wird Enni in einem weiteren Arbeitsschritt
bis September die Zulaufanbindungen der
anliegenden Häuser an den Hauptkanal mit einem
Roboter ebenfalls ohne Tiefbau grabenlos
sanieren. Wie üblich hat Enni auch dieses
Projekt zuvor mit der Stadt Moers, der Feuerwehr
und der Polizei abgestimmt. Fragen zu der
aktuellen Maßnahme beantwortet Enni gern unter
der Rufnummer 104-600.
Langenscheidt:
Jugendwort des Jahres 2025 - Jetzt wird
abgestimmt: Die Top 10 sind da
Jugendliche
zwischen 11 und 20 Jahren waren aufgerufen, ihr
Jugendwort des Jahres einzureichen. Wie bereits
in den Jahren zuvor, sind es vor allem die
Social Media, die die Sprache von Gen Z und Gen
Alpha prägen. Eltern, Großeltern, Onkel und
Tanten verstehen dann oft nur Bahnhof.

Und dies sind die Top 10, ihre Bedeutung und wie
sie genutzt werden:
•
„Checkst du“ – Wird genutzt, um sicherzugehen,
dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es
gerade geht. Diese neue Variante des „Verstehst
du?“ steht meist am Ende eines Satzes, um
nachzufragen, ob der oder die andere überhaupt
zugehört hat.
•
„Das crazy“ – Dieser Ausdruck wird als
Allzweckwaffe der Sprachlosigkeit genutzt. Er
wird immer dann verwendet, wenn jemand nicht
weiß, was er sagen soll, keine Lust hat zu
antworten oder einfach nur höflich bleiben will,
um das Gespräch am Laufen zu halten. Er ist
somit vergleichbar mit einem „Aha, cool“ oder
„Okay“.
•
„Digga(h)“ – Ein klassisches
Slangwort als Synonym für Bro, Bruder, Freund
und Freundin oder einfach irgendeine Person.
Funktioniert auch als Anrede, Ausruf oder
Reaktion und ist damit locker, direkt und
universell einsetzbar.
•
„Goonen“ – Ein Slangwort für
Selbstbefriedigung. Ursprünglich wurde es
benutzt, wenn es nicht bei einer kurzen Handlung
blieb, sondern auf eine Dopaminsucht schließen
ließ. Inzwischen wird es als allgemeines Synonym
genannt.
(Anmerkung des
Langenscheidt-Gremiums: Für uns gehören auch
sexuelle Begriffe zur Jugendsprache. Wir möchten
transparent damit umgehen, aber auf Risiken
hinweisen. Langes Selbstbefriedigen kann eine
Dopaminsucht begünstigen und zu einer ungesunden
Beziehung mit der eigenen Sexualität führen.)
•
„Lowkey“ – Der Begriff bedeutet so viel wie „ein
bisschen“, „unauffällig“ oder „unterschwellig“.
Er wird benutzt, um etwas auszudrücken, ohne
dabei zu dramatisch zu wirken – beispielsweise,
wenn es um Gefühle geht, Ansichten oder auch
Geschmäcker.
•
„Rede“ – Meint „Lauter! Alle sollen es hören!“
und wird genutzt, wenn jemand genau das
ausspricht, was alle fühlen und denken. Diese
Zustimmung mit Nachdruck ist besonders beliebt
in Gesprächen – und wenn man merkt: „Der hat
gerade komplett delivert!“
•
„Schere“ – Ein Begriff, der aus der Gaming-Szene
kommt und ebenso wie „Diggah“ bereits im letzten
Jahr in den Top 10 war. Er wird genutzt als
digitaler Handschlag, der ausdrückt „Mein
Fehler!“. Wer Mist baut und dazu steht, hebt
metaphorisch die Schere. Im Fußball wäre dies
die gehobene Hand zur Entschuldigung nach einem
Foul.
•
„Sybau“ – Ein Wort, das süßer klingt als es
gemeint ist. Es steht für „Shut your bitch ass
up“ und wird gerne in Videos und
Kommentarspalten geschrieben. Ältere
Generationen sagten noch „Halt die Fresse“ –
wobei sybau im Gegensatz dazu auch durchaus
ironisch und mit Augenzwinkern rüberkommen soll.
•
„Tot“ – Ein Begriff, der etwas oder eine
Situation beschreibt, die komplett daneben ist –
oder einfach lahm, peinlich oder unbeabsichtigt
uncool. Beispiel: Stehst mit Freundinnen auf
‘ner Homeparty, Musik leise, alle sitzen am
Handy. Tot.“
•
„Tuff“ – Ein Slangwort, das für „krass“ oder
„cool“ steht. Es ist damit eine positive Art zu
sagen, wie beeindruckt man ist. Ob Aussehen,
Skills oder Aktionen – „tuff“ passt immer, wenn
es richtig „ballert“.
Jugendsprache: von
unverständlich bis absurd
„Viele Begriffe wie
‚sybau‘ oder ‚das crazy‘ wirken auf den ersten
Blick absurd“, weiß Patricia Kunth, Marketing
Managerin bei Langenscheidt und Verantwortliche
für das Jugendwort des Jahres. „Doch
Jugendsprache lebt von Abkürzungen,
Bedeutungsverschiebungen und kreativen
Wortbildungen oder Neuschöpfungen, die nicht
jeder sofort versteht.“
Obwohl dies
bereits ihre dritte Jugendwort-Kampagne ist, ist
sie erneut beeindruckt, wie schnell Trends
aufgegriffen, weiterentwickelt und in den
Sprachgebrauch übernommen werden. Kunth weiter:
„Manche Begriffe verschwinden nach kurzer Zeit
wieder, und andere bleiben, weil sie gut
klingen, vielfältig nutzbar und von angesagten
Online-Persönlichkeiten oft verwendet werden.
Auch die diesjährige Top 10 zeigt, wie stark die
Online-Welt Jugendsprache beeinflusst. Ein Wort
trifft den Zeitgeist – und plötzlich spricht das
halbe Internet so.“
Wo Jugendsprache
draufsteht, ist auch Jugendsprache drin
Über
die Website Jugendwort.de durften die Begriffe
seit dem 29. Mai eingereicht werden. Die Anzahl
der Einreichungen lag im sechsstelligen Bereich.
88,62 Prozent wurden von den Generationen Z und
Alpha eingereicht und damit im Voting
berücksichtigt.
Die Top 10 zeigen, dass
Jugendwörter nicht zwingend aus dem Deutschen
stammen müssen. Viele Begriffe, die Jugendliche
heute verwenden, kommen schließlich aus dem
Englischen. In den vergangenen Jahren waren auch
Ausdrücke aus dem türkischen oder arabischen
Sprachraum dabei.
Und auch wenn
grundsätzlich jeder sein persönliches Jugendwort
des Jahres vorschlagen durfte, wurden nur jene
im Voting berücksichtigt, die von Teilnehmenden
im Alter zwischen 11 und 20 Jahren eingereicht
worden waren. Ebenfalls ausgeschlossen werden in
jedem Jahr Begriffe, die eine Diskriminierung
jedweder Art zum Ausdruck bringen oder im Rahmen
einer Kampagne eingereicht wurden und nicht zum
typischen Sprachgebrauch der Jugendlichen
gehören. In diesem Jahr waren dies „Ralf
Schumacher“, „Fotzenfritz“, „Jet2Holiday“ sowie
„Agatha“.
Am 3. September werden die Top
3 bekanntgegeben und das Voting geht in die
finale Runde. Die Verkündung des Jugendwortes
2025 erfolgt dann am 18. Oktober um 14 Uhr live
auf der Frankfurter Buchmesse.
Öffentliche
Trinkwasserspender für Moers sind in Betrieb
gegangen
Die Stadt Moers
macht einen weiteren Schritt in Richtung
öffentlicher Daseinsvorsorge: Am Königlichen Hof
ist seit Dienstag, 22. Juli ein moderner
Trinkwasserspender installiert.

Innenstadtkoordinator Mathis Günther nimmt den
ersten Trinkwasserspender am Königlichen Hof in
Betrieb. (Foto: pst)
Zwei weitere
Standorte folgen in Kürze - an der Skateanlage
im Freizeitpark sowie direkt am Rathaus. Beim
Spender im Freizeitpark, der am Freitag, 25.
Juli in Betrieb gegangen ist, fließt das Wasser
vorerst permanent. Ein fehlendes Steuerelement
wird in der Winterpause eingebaut, so dass der
Brunnen im nächsten Frühjahr den Normalbetrieb
aufnehmen kann.
Die Idee zur
Aufstellung der Wasserspender ist durch Anträge
von mehreren Fraktionen des Stadtrats
entstanden. „Ziel ist es, allen Bürgerinnen und
Bürgern sowie Besucherinnen und Besuchern der
Stadt einen einfachen Zugang zu kostenlosem,
frischem Trinkwasser zu ermöglichen - besonders
an stark frequentierten Orten und bei steigenden
Temperaturen“, erläutert Mathis Günther vom Stab
Innenstadtkoordination.
Die bauliche
Umsetzung hat die ENNI übernommen. Die Stationen
werden regelmäßig gewartet und bieten hygienisch
einwandfreies Leitungswasser. Die
Trinkwasserspender sollen auch den Gebrauch von
Einwegplastikflaschen reduzieren.
Moers: Hochschauen lohnt sich -
Architekturführung durch die Innenstadt
Um ‚Architekturen in der Moerser Innenstadt‘
geht es bei der Führung am Sonntag, 3. August.
Treffpunkt ist um 10.30 Uhr vor den
Oranierhäusern in der Haagstraße 63.

Foto pst
Entlang den Moerser
Haupt-Geschäftsstraßen entdecken die
Teilnehmenden Gebäude aus ganz unterschiedlichen
Zeiten. Oft ist ihre Architektur verkleidet oder
verändert worden. Wer hochschaut, entdeckt aber
gerade an den Fassaden oberhalb der
Ladengeschosse Details, die Auskunft über die
Geschichte der Häuser geben.
Ein
Schwerpunkt der Führung sind die Oranierhäuser,
die in der Blütezeit der Grafenstadt unter der
Herrschaft von Moritz von Oranien entstanden
sind. Die Hintergründe erläutert Gästeführerin
und Architektin Eva-Maria Eifert.
50 Jahre Kreis Wesel:
Ranger-Spaziergänge am Freitag, 1. August –
Natur erleben, verstehen und respektieren
Am Freitag, 1. August, finden die nächsten
Spaziergänge unter dem Motto „Sand, Moor und
Heide - Die abwechslungsreiche Heimat des
fliegenden Hirsches, der Moosjungfer und des
Moorfrosches“ im Naturschutzgebiet Diersfordter
Wald“ statt. Es sind noch Plätze frei.
Hier geht es zur Anmeldung: Freitag (01.08.2025)
von 9.00 – 12.00 Uhr Naturschutzgebiet
Diersfordter Wald Treffpunkt: Parkplatz
„Diersfordter Wald“ Anmeldung:
https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013494
Freitag (01.08.2025) von 13.00 – 16.00 Uhr
Naturschutzgebiet Diersfordter Wald Treffpunkt:
Parkplatz „Diersfordter Wald“
Anmeldung:
https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1013495
Im Rahmen des Jubiläumsjahres „50 Jahre Kreis
Wesel“ laden die Ranger des Kreises Wesel in
Zusammenarbeit mit der Unteren
Naturschutzbehörde des Kreises Wesel zu
besonderen Spaziergängen in ausgewählten
Schutzgebieten ein.
Interessierte
Bürgerinnen und Bürger haben dabei die
Gelegenheit, die spannende Arbeit der Ranger
kennenzulernen und mehr über die vielfältige
Natur im Kreis Wesel zu erfahren. Bei den
geführten Spaziergängen geben die Ranger
spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit,
berichten von Begegnungen im Gelände und
beantworten Fragen rund um Naturschutz,
Artenvielfalt und den richtigen Umgang mit der
Natur.
Unterstützt werden sie dabei von
Förstern sowie Mitarbeitenden der Unteren
Naturschutzbehörde des Kreises Wesel. Die
Teilnahme ist kostenlos aber auf 30 Teilnehmende
je Termin beschränkt. Eine vorherige Anmeldung
ist erforderlich (siehe Termine).
Moers: Bastelwerkstatt „SLC-Logbuch
gestalten“
Offen für alle Teilnehmer/innen des
Sommerleseclubs
Nachdem wir letztes Jahr bei
der Abschlussfeier das schönste Logbuch gekürt
haben, möchten wir euch dieses Jahr die Chance
geben, euer Logbuch bei uns zu gestalten, euch
auszutauschen und Inspirationen zu sammeln. Wir
stellen euch verschiedenstes Bastelmaterial
bereit, damit ihr eurer Kreativität freien Lauf
lassen könnt.
Bitte das SLC-Logbuch zur
Veranstaltung mitbringen!
Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich, für das Material
wird ein Kostenbeitrag von 2 Euro erhoben.
Nähere Infos und Anmeldung unter Telefon: 0 28
41 / 201-751, unter E-Mail jubue@moers.de oder
direkt in der Bibliothek Moers.
Veranstaltungsdatum 30.07.2025 - 10:30 Uhr -
12:00 Uhr. Veranstaltungsort
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 47441 Moers.
Moers: Zeichenschule „Die Schule der
magischen Tiere“ für Kinder ab 8 Jahren
Wir zeigen dir, wie du „Leander“, „Juri“ und
„Casper“ aus „Die Schule der magischen Tiere“
zeichnen kannst. Wer mag, darf gerne eigene
Zeichensachen mitbringen. Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich, für das Material
wird ein Kostenbeitrag von 2 Euro erhoben.
Nähere Infos und Anmeldung unter Telefon: 0
28 41 / 201-751, unter E-Mail jubue@moers.de oder
direkt in der Bibliothek Moers.
Veranstaltungsdatum 31.07.2025 - 14:30
Uhr - 16:00 Uhr. Veranstaltungsort
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 47441 Moers.
Moers: Open Air Lichtspiele
"Emilia Perez"
Auch in diesem
Jahr freuen wir uns sehr über die bewährte
Kooperation mit dem Grafschafter Museum im
Rahmen der jährlichen Open Air Lichtspiele. Zum
Auftakt am Donnerstag, den 31. Juli 2025, zeigen
wir den Oscar-prämierten Film „Emilia Perez“
(FSK 12).

Der bewegende Film erzählt die Geschichte eines
mexikanischen Drogenkartellchefs, der mithilfe
einer engagierten Anwältin seinen Traum von
einer Geschlechtsangleichung verwirklicht.
Wann: Donnerstag, 31.07.2025 Wie spät:
Einlass ist um 20:30 Uhr und Filmstart um 21:30
Uhr Wo: Innenhof Schloss Moers Wie in jedem
Jahr sorgt der beliebte Cocktailstand des
Soroptimist Club Moers-Niederrhein, vor und
während der Veranstaltung, für erfrischende
Getränke. Bei schlechtem Wetter findet die
Veranstaltung im Haus der Demokratiegeschichte
im Alten Landratsamt statt. Der Eintritt ist
frei.
Wir bitten um Anmeldung unter: 0
28 41 / 201-6 82 00. Bitte merken Sie sich den
Termin schon jetzt vor. Veranstaltungsdatum
31.07.2025 - 20:30 Uhr - 23:40 Uhr.
Veranstaltungsort Innenhof.
Moers: Sommerspiele
Dieses
Jahr haben sich Josy & Jule für Euch zwei ganz
besondere Sommerspielevents ausgedacht. Es
erwarten Euch ganz neue Spiele auf dem Weg zum
Champion des Sommers!
Einfach vorbeikommen
am Bollwerk 107 und den Herausforderungen
stellen! Gefördert durch den Paritätischen NRW.
Veranstaltungsdatum 01.08.2025 - 20:00
Uhr - 22:30 Uhr .Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107, 47441 Moers .Veranstaltungsort Outdoor
Moers: Poetry Slam Slam
im Bollwerk
Eine wundervolle
Tradition! Wie immer entscheidet eine
Publikums-Jury, was gefällt. Für die Slam-Poeten
/ Slam-Poetinnen gibt es nur wenige Regeln: ein
Zeitlimit von 6 Minuten, nur selbst verfasste
Texte und außer dem Manuskript keinerlei
Hilfsmittel.
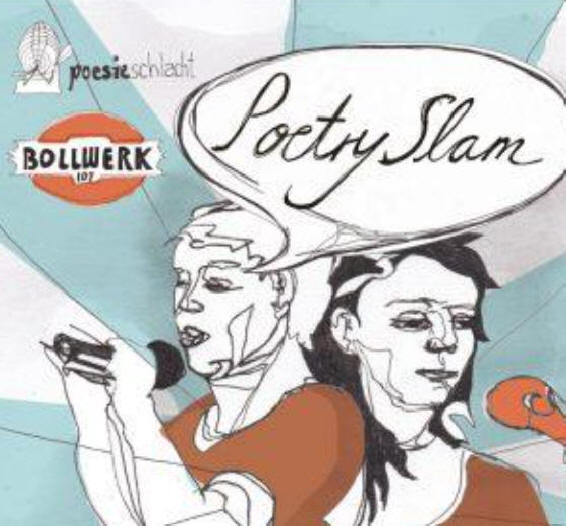
Ansonsten ist erlaubt, was gefällt, sei es nun
Gedicht, Geschichte oder frei vorgetragene
Improvisation. Ihr als Publikum entscheidet –
und kürt den/die Sieger*in. Diese
unwiderstehliche Mischung aus Lesung,
Performance und Popkultur ist ein mitreißendes
Fest rund um das gesprochene Wort.
Unterhaltsam durch den Abend führt der Moderator
Markim Pause.
Tickets gibt es
ausschließlich an der Abendkasse für 5 Euro
(ermäßigt) und 7 Euro (regulär).
Veranstaltungsdatum 01.08.2025 - 20:00
Uhr - 22:30 Uhr. Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107 ,47441 Moers.
Moers:
Open-Air Filmvorführung Britische Filmbiografie
Der Film behandelt das Leben der
Kriegsfotografin Lee Miller (Titel darf
aus lizenzrechtlichen Gründen nicht genannt
werden). Kate Winslet beeindruckt in der
Verfilmung der wahren Geschichte des ehemaligen
Fotomodells Lee Miller, die mitten im Krieg als
Fotoreporterin an die Front geht und über Monate
die Schrecken des Zweiten Weltkriegs
dokumentiert.
Lees Bilder werden zu
Zeugnissen entsetzlicher Verbrechen, lassen aber
auch Miller selbst bis an ihr Lebensende nicht
mehr los. Einlass ab 20.30 Uhr, Beginn des Films
ca. 21.30 Uhr Bei schlechtem Wetter werden die
Kinoabende ins Alte Landratsamt gelegt, die
Uhrzeiten bleiben bestehen Speisen für den
eigenen Verzehr dürfen mitgebracht werden,
Getränke können vor Ort erworben werden.
Der Eintritt ist frei! Um Anmeldung wird
gebeten unter 0 28 41 / 201 - 6 82 00.
Veranstaltungsdatum 01.08.2025 - 20:30
Uhr - 23:30 Uhr. Veranstaltungsort Schlosshof.
Moers: Open-Air Filmvorführung: Kein
Land für Niemand - Abschottung eines
Einwanderungslandes
Seebrücke Moers und Sea-Eye
präsentieren gemeinsam mit dem Grafschafter
Museum den Film:Kein Land für Niemand -
Abschottung eines Einwanderungslandes
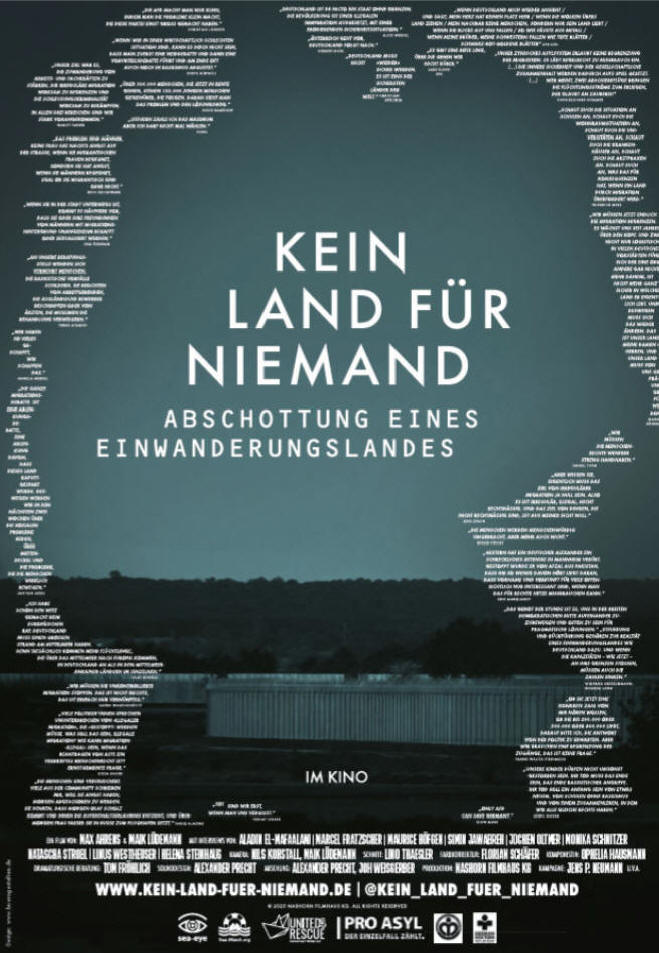
Am Samstag, 02.08.2025 um 21 Uhr zeigt die
Seebrücke Moers in Zusammenarbeit mit der
Seenot-Rettungsorganisation Sea-Eye und dem
Grafschafter Museum im Rahmend des Sommerkinos
„Open Air Lichtspiele im Schlosshof“ den
Dokumentarfilm „Kein Land für Niemand –
Abschottung eines Einwanderungslandes“.
Dieser zeigt die drastischen Folgen der
aktuellen europäischen Abschottungspolitik und
analysiert, wie es dazu kommen konnte. Ein Film
über eine Krise, die weit mehr ist als eine
Debatte über Grenzen – sondern eine über
Menschlichkeit, Verantwortung und die Zukunft
Europas.
Der Film begibt sich auf die
Suche nach den Ursachen dieser politischen Zäsur
und nimmt die Zuschauer*innen mit auf eine
aufrüttelnde Reise. Die Dokumentation beginnt an
den europäischen Außengrenzen, wo eine
andauernde humanitäre Katastrophe auf staatliche
Ignoranz trifft, aber auch auf ziviles
Engagement.
Sie begleitet einen Einsatz
des Seenot-Rettungsschiffes Sea-Eye 4 auf dem
Mittelmeer, dokumentiert die katastrophale Lage
aus der Luft und erzählt die Geschichten von
Überlebenden, die trotz Gewalt und tödlicher
Risiken den Weg nach Deutschland gefunden haben.
Mit diesem Film möchte die Seebrücke
Moers über die aktuelle Situation auf dem
Mittelmeer und an den europäischen und deutschen
Außengrenzen informieren und Raum schaffen für
Diskussion und Engagement. Am Filmabend stehen
Vertreter und Vertreterinnen von Sea-Eye und der
Seebrücke Moers für ein Gespräch zur Verfügung.
Der Eintritt ist frei. Event details
Veranstaltungsdatum 02.08.2025 - 21:00 Uhr.
Veranstaltungsort Schlosshof.
Von Komödie bis Kammermusik - Kleves
Kulturprogramm in neuem Licht
Verena Krauledat, Laura Foresta, Christian
Schoofs, Gina Haven und Bürgermeister Wolfgang
Gebing (v.l.n.r.) präsentieren das
Kulturprogramm der Stadt Kleve für die Saison
2025/26.

Foto: Daniel Hendricks / Stadt Kleve.
Verena Krauledat, Laura Foresta, Christian
Schoofs, Gina Haven und Bürgermeister Wolfgang
Gebing (v.l.n.r.) präsentieren das
Kulturprogramm der Stadt Kleve für die Saison
2025/26. Foto: Daniel Hendricks / Stadt Kleve.
Mit der neuen Spielzeit 2025/26 lädt die
Stadt Kleve erneut zu einem abwechslungsreichen
Kulturprogramm ein. Ob Theater, Konzert oder
Kindervorstellung – das Spektrum der Angebote
ist so vielfältig wie das Publikum selbst. In
den kommenden Monaten erwartet
Kulturinteressierte ein sorgfältig kuratiertes
Programm mit bekannten Künstlerinnen und
Künstlern, frischen Inszenierungen,
musikalischen Höhepunkten und inspirierenden
Spielorten.
Die kommende Spielzeit
markiert zugleich einen personellen Wandel in
der städtischen Kulturarbeit. Nach dem
Ausscheiden von Stephan Derks wurde die
Verantwortung für Planung und Organisation neu
aufgestellt. Im Fachbereich Schulen, Kultur und
Sport haben Gina Haven und Laura Foresta die
Aufgaben übernommen. Die künstlerische Leitung
der Konzerte liegt nun bei Verena Krauledat, die
auf Sigrun Hintzen folgt.
Das
Theaterprogramm der neuen Spielzeit umfasst
sechs abwechslungsreiche Produktionen, die
verschiedene Genres und Themen aufgreifen – von
unterhaltsamer Komödie bis zum Psychothriller.
Den Auftakt macht die Beziehungskomödie
„Die Niere“, in der sich ein Ehepaar mit einer
medizinischen wie moralischen Entscheidung
konfrontiert sieht, ist eine clevere Mischung
aus Humor und Ernst. Mit „Hausmeister Krause –
Du lebst nur zweimal“ folgt eine Bühnenadaption
von und mit Tom Gerhardt der sich auf eine
verrückte Mission begibt. Satirisch und
pointiert geht es weiter mit „Kardinalfehler“,
einer bissigen Komödie rund um kirchliche
Doppelmoral, politischen Druck und die Frage
nach der Wahrheit zwischen Beichtstuhl und
Talkshow.
Ganz anders der Ton in „Black
Mountain“, einem intensiven Psychothriller, der
eine Paarbeziehung an den Rand der Auflösung
führt und das Publikum mit knisternder Spannung
in Atem hält.
Warmherzig und melancholisch
erzählt das Stück „Sommerfest“ von Heimat,
Verlust und der Rückkehr ins Ruhrgebiet und
verspricht einen Abend zwischen Ruhrpott-Charme
und leiser Nostalgie. Abgerundet wird das
Programm mit der Gesellschaftskomödie „Kurz und
nackig“, in der es um generationsübergreifende
Lebensfragen innerhalb der Familie geht.
Als Sonderveranstaltung findet darüber
hinaus die szenische Lesung „Liebe, Lust &
Hexenschuss“ statt, die einen humorvollen
Streifzug durch das Beziehungsleben im besten
Alter in die Klever Stadthalle bringt. Zudem
wird in der Kultursaison das Abiturstück „Der
zerbrochne Krug“ von Heinrich von Kleist
angeboten und richtet sich insbesondere an
Schülerinnen und Schüler der gymnasialen
Oberstufe.
Eintrittskarten sind in zwei
Kategorien erhältlich und kosten 16 Euro in den
ersten zehn Reihen und 18 Euro auf den übrigen
Plätzen. Schülerinnen und Schüler sowie
Studierende erhalten einen Sonderpreis von 5
Euro pro Ticket. Weitere Ermäßigungen sind
möglich.
Mit zehn abwechslungsreichen
Inszenierungen lädt die Stadt Kleve auch in der
kommenden Spielzeit wieder zu unvergesslichen
Theatererlebnissen für Kinder ab vier Jahren in
die Stadthalle ein.
Den Auftakt macht
„Die kleine Hexe“, die mit viel Witz und Mut
beweist, dass man auch als junge Hexe Großes
erreichen kann. In „Lotta kann fast alles“ zeigt
eine Fünfjährige, wie man selbstbewusst und mit
Fantasie den Alltag meistert. „Vier sind dann
mal weg“ nimmt das junge Publikum mit auf eine
abenteuerliche Reise mit Märchen im Gepäck.
„Die Zirkusratte“ handelt von einer
tierischen Erzählung aus dem Schaustellerleben
über Selbstbehauptung und das Bedürfnis nach
Anerkennung. Zur Weihnachtszeit erzählt
„Weihnachten auf der Erde“ in einem
Weltraum-Theaterstück eine Geschichte der
Gebrüder Grimm über Armut und Reichtum.
Im neuen Jahr geht es mit Jules Vernes Klassiker
„Kapitän Nemo – 20.000 Meilen unter dem Meer“
auf spannende Tauchfahrt in fantastische
Tiefsee-Welten. In „Der gestiefelte Kater“
erleben Kinder, wie ein listiger Kater seinem
Herrn zu Glück und Ruhm verhilft. Die
Märchenadaption „Die kleine Meerjungfrau“ der
Theatergruppe Zick-Zack aus Pfalzdorf erzählt
vom Mut, für die eigene Stimme einzustehen.
In „Alice im Wunderland“ begegnen die
Zuschauer einem fantasievollen Figurenkosmos
voller Überraschungen und Magie. Und bei der
Kinderzaubershow mit Helmut Appenzeller heißt es
Staunen, Lachen und Mitmachen wenn Magie
plötzlich ganz nah wird.
Tickets für das
Kindertheater sind zum Preis von 4 Euro pro
Person erhältlich.
Die acht Reihenkonzerte in
der Stadthalle präsentieren ein buntes
musikalisches Spektrum. Eröffnet wird die Saison
mit einem hochkarätig besetzten Klavierquintett
um Silke Avenhaus, das seinem Programm „Take
Five“ unterschiedliche Farbtöne aus Jazz und
Klassik verleiht.
„Eternity“ heißt das
Programm von Gülru und Ensari und Herbert
Schuch, die unterschiedliche musikalische
Antworten auf die Frage nach dem Klang der
Ewigkeit präsentieren. Im November folgen die
Brüder Lionel und Damian Martin mit
Violoncello‑Klavier‑Improvisationen dem Moment.
Zum Advent erklingt englische Vokalmusik
in festlichem Glanz mit dem Kammerchor Chorwerk.
Acht Mitglieder aus dem Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks stellen Musik auf
künstlerische Weise als Gewebe dar. Ein
besonderes Highlight ist auch das Konzert
„Schöne Welt, wo bist du?“ mit Bariton Benjamin
Appl, dessen Liederabend zu einem intensiven
Klangerlebnis wird.
Ein markantes
Konzert von herausragenden Nachwuchsmusikern
bietet das Landesjugendorchester mit dem
Programm „Verwandlung“ das Energie und
Klangfülle eindrucksvoll verbindet. Mit dem
Arcis Saxophon Quartett und ihrem Programm
„Nightclub Chronicles“ zieht Jazz‑ und
Club‑Stimmung in die Stadthalle ein.
Eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn findet
jeweils die Konzerteinführung „Das dritte Ohr“
statt, bei der es interessante Fakten zum
Programm und den Musikern gibt. Eintrittskarten
für die Reihenkonzerte kosten 18 Euro.
Schülerinnen, Schüler und Studierende erhalten
ein ermäßigtes Ticket zum Preis von 5 Euro.
Weitere Ermäßigungen sind möglich.
Die
vier Konzerte der „Besonderen Reihe“ versprechen
eindrucksvolle Musikerlebnisse jenseits des
klassischen Konzertformats an Spielorten wie dem
Museum Kurhaus und der Kleinen Kirche an der
Böllenstege. Im Konzert „Metamorphosen“ loten
zwei junge Musikerinnen die Übergänge zwischen
Vergangenheit und Gegenwart aus. Mit
„Zaubermusik“ dürfen sich Familien auf ein
unterhaltsames und magisches Programm freuen.
Hier begegnen sich klassische Filmmusik,
Klangzauber und Konzertpädagogik auf
fantasievolle Weise.
Einen musikalischen
Kriminalfall mit augenzwinkernder Raffinesse
bietet die Spurensuche „Tatort Barock“. Den
Abschluss der Reihe bildet das Konzert „Ich
werde mit Vergnügen in deinen Armen liegen“, das
die menschliche Stimme und den Klang der Gambe
zu einem intimen Dialog verbindet. Der Eintritt
zu den Konzerten der „Besonderen Reihe“ kostet
12 Euro. Auch bei dieser Veranstaltungsreihe
werden für Schülerinnen, Schüler und Studierende
Tickets zum vergünstigten Preis von 5 Euro
angeboten.
Einzeltickets und verschiedene
Abonnements für die Theaterstücke und Konzerte
sind ab sofort erhältlich. Eine Buchung ist
möglich über die Website kleve.reservix.de oder
direkt bei den bekannten Vorverkaufsstellen wie
die Rathaus-Info Kleve, Buchhandlung Hintzen und
die Niederrhein Nachrichten sowie bei der Stadt
Goch, in der Tourist-Information Kalkar und dem
Theaterbüro Emmerich am Rhein.
Für
Fragen und Anmerkungen stehen Gina Haven und
Laura Foresta täglich von 9 bis 12 Uhr sowie von
Montag bis Donnerstag zwischen 14 und 15.30 Uhr
unter den Telefonnummern 02821 84-680 und 02821
84-254 oder über die E-Mail-Adresse
kultur@kleve.de zur Verfügung.

Kinderschutz: Rund 69 500 Kinder und
Jugendliche im Jahr 2024 vom Jugendamt in Obhut
genommen
• Weniger Inobhutnahmen durch unbegleitete
Einreisen (-22 %), aber mehr durch dringende
Kindeswohlgefährdungen (+10 %) und
Selbstmeldungen (+10 %)
• Größter Anstieg
bei körperlichen Misshandlungen und
Vernachlässigungen
• Eine Maßnahme dauerte
im Schnitt gut zwei Monate – fast zwei Wochen
mehr als
Die Jugendämter in Deutschland
haben im Jahr 2024 rund 69 500 Kinder oder
Jugendliche zu ihrem Schutz vorübergehend in
Obhut genommen. Das waren gut 5 100 Jungen und
Mädchen weniger als im Jahr zuvor (-7 %). Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, ist damit die Zahl der Schutzmaßnahmen
erstmals wieder zurückgegangen, nachdem sie
zuvor drei Jahre in Folge angestiegen war.

Trotz Rückgang: die meisten Inobhutnahmen
wegen unbegleiteter Einreisen
Trotz ihres
Rückgangs wurden 2024 die meisten
Schutzmaßnahmen (44 %) aufgrund von
unbegleiteten Einreisen durchgeführt. Dazu
zählten vorläufige
Inobhutnahmen (24 %), die direkt nach der
Einreise eingeleitet wurden, und reguläre
Inobhutnahmen (20 %), die in der Regel –
nach einer bundesweiten Verteilung der
Betroffenen – daran anschließen.
Weitere
42 % der Schutzmaßnahmen erfolgten wegen
dringender Kindeswohlgefährdungen und 13 %
aufgrund von Selbstmeldungen, also weil Kinder
oder Jugendliche aus eigenem Antrieb Hilfe beim
Jugendamt gesucht hatten. Größter Zuwachs bei
körperlichen Misshandlungen und
Vernachlässigungen Neben der unbegleiteten
Einreise (44 %) zählten 2024 zu den häufigsten
Anlässen für eine Schutzmaßnahme:
Überforderungen der Eltern (25 %),
Vernachlässigungen (12 %), körperliche
Misshandlungen (11 %) und psychische
Misshandlungen (8 %).
Während im
Vergleich zu 2023 vor allem unbegleitete
Einreisen an Bedeutung verloren haben, sind die
Nennungen bei 9 von insgesamt 13 möglichen
Anlässen gestiegen: Am größten war das Plus bei
körperlichen Misshandlungen (+1 026 Nennungen)
und Vernachlässigungen (+939 Nennungen).
Deutlich zugenommen haben auch
Überforderungen der Eltern (+896 Nennungen) und
psychische Misshandlungen (+843 Nennungen). Bei
den Anlässen waren Mehrfachnennungen möglich.
Fast zwei Wochen mehr als im Vorjahr: Maßnahme
dauerte im Schnitt gut zwei Monate Während der
Schutzmaßnahme wurden gut drei Viertel (77 %)
der Betroffenen in einer Einrichtung und knapp
ein Viertel bei einer geeigneten Person oder in
einer betreuten Wohnform untergebracht.
Dabei konnte zwar knapp jeder dritte Fall (30 %)
in weniger als einer Woche beendet werden, jeder
fünfte Fall (21 %) dauerte allerdings drei
Monate oder länger. Im Schnitt endete eine
Inobhutnahme nach 62 Tagen – also gut
zwei Monaten. Vergleichsweise schnell beendet
werden konnten zum Beispiel Schutzmaßnahmen
aufgrund von Selbstmeldungen der betroffenen
Jungen oder Mädchen: 2024 dauerten sie im
Schnitt 36 Tage.
Höher war der Klärungs-
und Hilfebedarf offenbar bei dringenden
Kindeswohlgefährdungen. In diesen Fällen endete
die Inobhutnahme im Schnitt erst nach 57 Tagen.
Am längsten dauerten die Maßnahmen nach
unbegleiteten Einreisen aus dem Ausland: Mit
durchschnittlich 74 Tagen waren sie gut doppelt
so lang wie bei den Selbstmeldungen (36 Tage).
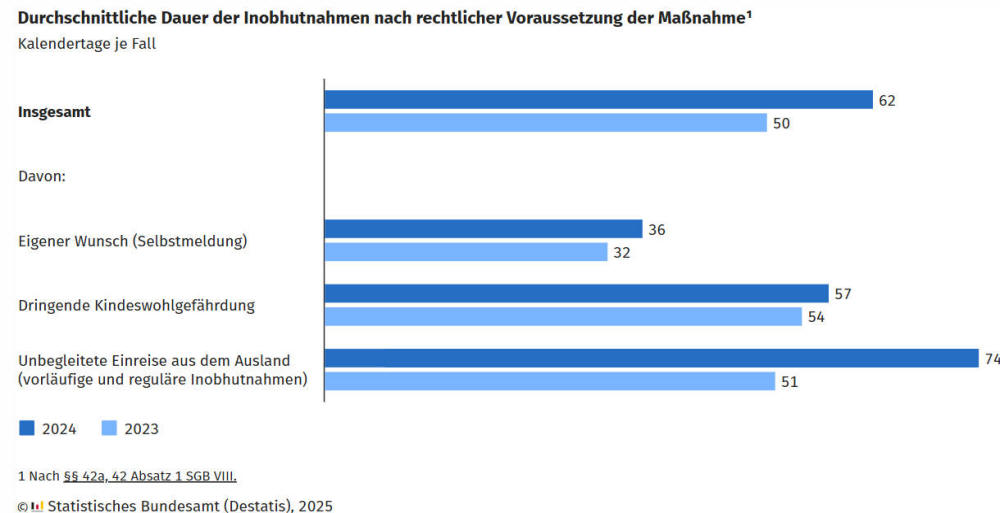
Im Vergleich zum Vorjahr stieg die
durchschnittliche Dauer der Schutzmaßnahmen um
12 Tage – also knapp 2 Wochen – an. Das Plus
betrifft sowohl Selbstmeldungen (+4 Tage) als
auch Fälle von dringender Kindeswohlgefährdung
(+3 Tage). Am höchsten fiel der Zuwachs aber bei
den Inobhutnahmen nach unbegleiteter Einreise
aus: Mit 23 Tagen lag er fast zweimal über dem
Durchschnitt (12 Tage).
Rund ein Viertel
der Betroffenen kehrt an bisherigen
Aufenthaltsort zurück Im Anschluss an die
Inobhutnahme kehrte etwa ein Viertel (24 %) der
Minderjährigen an den vorherigen Aufenthaltsort
zurück. Weitere 45 % der Kinder oder
Jugendlichen wurden nach der Schutzmaßnahme an
einem neuen Ort untergebracht, und zwar am
häufigsten in einem Heim, einer betreuten
Wohngruppe oder einer anderen Einrichtung.
In jeweils etwa jedem zehnten Fall wurden
die Betroffenen von einem anderen Jugendamt
übernommen (9 %) oder beendeten die Inobhutnahme
selbst (13 %), teils auch, indem sie aus der
Maßnahme ausrissen. In weiteren 9 % der Fälle
wurde die Inobhutnahme anderweitig beendet.
Diese Angaben zum Maßnahmen-Ende beziehen sich
nur auf reguläre Inobhutnahmen (ohne vorläufige
Inobhutnahmen).
22,5
Millionen Tonnen gefährliche Abfälle in
Deutschland im Jahr 2023
• Menge gefährlicher Abfälle sinkt auf
niedrigsten Stand seit 2015
• Bau- und
Abbruchabfälle weiterhin mit größtem Anteil am
Gesamtaufkommen
m Jahr 2023 sind 22,5
Millionen Tonnen gefährliche Abfälle in
Deutschland angefallen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank die Menge
gefährlicher Abfälle damit um 2,4 % oder 0,6
Millionen Tonnen gegenüber dem Jahr 2022 (23,1
Millionen Tonnen) und erreichte den niedrigsten
Stand seit 2015 (22,3 Millionen Tonnen).
Gefährliche Abfälle sind Abfallarten mit
bestimmten Gefährlichkeitsmerkmalen, die eine
Bedrohung für Mensch und Umwelt darstellen. Sie
können beispielsweise brandfördernd,
krebserregend oder reizend sein. Für sie sind
Begleitscheine zu führen und sie müssen
speziellen Entsorgungswegen und -verfahren
zugeführt werden, die eine sichere und
umweltverträgliche Zerstörung der enthaltenen
Schadstoffe gewährleisten.
Bau- und Abbruchabfälle machen über ein Drittel
aller gefährlichen Abfälle aus
Nach Abfallarten betrachtet machten Bau- und
Abbruchabfälle wie schon in den Vorjahren den
größten Anteil an der Gesamtmenge gefährlicher
Abfälle aus. Im Jahr 2023 betrug ihr Anteil
8,6 Millionen Tonnen oder 38,4 % des
Gesamtaufkommens.
Die zweitgrößte Menge
stammte aus Abfallbehandlungsanlagen,
öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie
aus der Aufbereitung von Wasser für den
menschlichen Gebrauch und für industrielle
Zwecke (darunter Kläranlagen und Wasserwerke)
mit zusammen 7,0 Millionen Tonnen oder 31,0 %.
Im Jahr 2022 hatten die Anteile beider
Abfallarten 40,2 % (9,3 Millionen Tonnen)
beziehungsweise 29,3 % (6,8 Millionen Tonnen)
der Gesamtmenge gefährlicher Abfälle betragen.
Mehr als 60 % der gefährlichen Abfälle aus zwei
Wirtschaftsabschnitten Der Großteil der
gefährlichen Abfälle wurde im Jahr 2023, wie in
den Vorjahren, in zwei Wirtschaftsabschnitten
erzeugt: 9,1 Millionen Tonnen oder 40,3 % der
Abfälle stammten aus dem Abschnitt
"Wasserversorgung; Abwasser- und
Abfallentsorgung und Beseitigung von
Umweltverschmutzungen" (2022:
9,4 Millionen Tonnen; 40,8 %).
Dazu
zählen beispielsweise Entsorgungsanlagen wie
Deponien oder Anlagen zur Aufbereitung flüssiger
und wasserhaltiger Abfälle mit organischen
Stoffen, die bei unsachgemäßer Entsorgung über
das Abwasser indirekt in Gewässer und damit in
die Umwelt gelangen können. 4,9 Millionen Tonnen
oder 21,5 % der gefährlichen Abfälle (2022:
4,7 Millionen Tonnen; 20,4 %) stammten aus dem
Wirtschaftsabschnitt "Verarbeitendes Gewerbe",
und dort insbesondere aus Betrieben zur
Herstellung von Maschinen, Metallerzeugnissen
und chemischen Erzeugnissen.
Überwiegender Anteil durch Primärerzeuger
16,1 Millionen Tonnen (71,6 %) der gefährlichen
Abfälle stammten im Jahr 2023 von
Primärerzeugern, bei denen die Abfälle im
eigenen Betrieb erstmalig angefallen sind. Das
waren 5,3 % oder 0,9 Millionen Tonnen weniger
als im Jahr 2022. 6,4 Millionen Tonnen (28,4 %)
waren sogenannte sekundär erzeugte Abfallmengen
aus Zwischenlagern oder von Abfallentsorgern,
bei denen der Abfall nicht ursprünglich
entstanden ist. Die Menge gefährlicher Abfälle
sank hier gegenüber 2022 um 5,5 % oder
0,3 Millionen Tonnen.
Handel: Einigung
zwischen EU und USA
Brüssel/Niederrhein, 28. Juli 2025 -
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen und Handelskommissar Maros Šefčovič haben
betont, dass die mit US-Präsident Donald
Trump getroffene Zoll- und Handels-Vereinbarung
Stabilität bringt. Von der Leyen sagte nach dem
Gespräch gestern Abend in Schottland: „Der Deal
schafft Gewissheit in unsicheren Zeiten“ und
Stabilität und Vorhersehbarkeit für Bürgerinnen
und Bürger sowie Unternehmen auf beiden Seiten
des Atlantiks.
„Nur wenige Wochen nach
dem NATO-Gipfel ist dies der zweite Baustein,
der die transatlantische Partnerschaft
bekräftigt.“ Kommissar Šefčovič sprach bei einer
Pressekonferenz heute Mittag in Brüssel von
einem Durchbruch, der die Tür zur strategischen
Zusammenarbeit öffne.
Ausgewählte
Details des Abkommens Von der Leyen und
Handelskommissar Šefčovič gingen bei ihren
Pressestatements auf wesentliche Aspekte der
Einigung ein: Sie sieht einen Zollsatz von 15
Prozent für die überwiegende Mehrheit der
EU-Ausfuhren vor. Das beinhaltet auch Autos, für
die derzeit ein Zollsatz von 27,5 Prozent gilt.
Es wird eine Liste von Waren geben, auf die
beide Seiten einen Nullzollsatz anwenden werden.
Dazu gehören Flugzeuge und Komponenten,
bestimmte Chemikalien und Generika,
Halbleiterausrüstung, bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse, Ressourcen und
kritische Rohstoffe. Diese Liste bleibt für
Ergänzungen offen. Für Stahl und Aluminium soll
ein Quotensystem eingeführt werden. Die
Zusammenarbeit im Energiebereich soll verstärkt
werden, die EU wird russisches Gas und Öl durch
bedeutende Käufe von US-LNG, Öl und
Kernbrennstoffe ersetzen.
Auch der
strategische Kauf von US-KI-Chips ist
vorgesehen, um den technologischen Vorsprung so
zu stärken, dass beide Seiten davon profitieren.
Weitere Schritte Die Kommission hat heute früh
sowohl die Mitgliedstaaten als auch die
Mitglieder des Europäischen Parlaments
informiert.
Kommissar Šefčovič
betonte: „Wir standen in ständigem Dialog mit
unseren Mitgliedstaaten und wichtigen
Interessenträgern, und ich möchte ihnen
aufrichtig für ihr Vertrauen in die Kommission
und unsere anhaltende Einheit während dieses
gesamten Prozesses danken.“
Der
Kommissar sprach von einem Abkommen mit
beiderseitigem Nutzen und ergänzte: „Ich hoffe,
es wird in Zukunft ein Sprungbrett für ein
umfassenderes Handels- und Investitionsabkommen
zwischen der EU und den USA sein und
gleichzeitig unsere gemeinsamen Anstrengungen
zur Bewältigung dringender globaler
Herausforderungen wie der dringend benötigten
Reform der WTO fördern.“
Kommissionspräsidentin von der Leyen
betonte: „Dieses Abkommen bietet einen Rahmen,
von dem aus wir die Zölle auf mehr Produkte
weiter senken, nichttarifäre Handelshemmnisse
angehen und im Bereich der wirtschaftlichen
Sicherheit zusammenarbeiten werden. Denn wenn
die EU und die USA als Partner zusammenarbeiten,
sind die Vorteile auf beiden Seiten greifbar.“
Deutscher-Mittelstands-Bund (DMB) zum
USA-EU-Zollabkommen
„Die jüngste Einigung
zwischen der US-Regierung und der Europäischen
Union beendet vorerst die drohende Eskalation im
transatlantischen Handelskonflikt um Zölle. Für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in
Deutschland und Europa schafft das zwar eine
‚Atempause‘ und temporär etwas mehr
Planungssicherheit.
Aus Sicht des
Deutschen Mittelstands-Bund (DMB) ist die neue
Einigung jedoch kein Erfolg – sie ist vielmehr
Ausdruck europäischer Schwäche im
internationalen Handel. Die Leidtragenden sind
insbesondere der deutsche und europäische
Mittelstand: Höhere Zölle sowie zusätzliche
bürokratische Hürden verteuern Exporte,
erschweren Lieferketten und führen zu erhöhtem
Zeit- und Kostenaufwand. Dadurch wird die
internationale Wettbewerbsfähigkeit des
Mittelstands massiv gefährdet.
Der
‚Deal‘ ist auch ein politisches Alarmsignal: Die
USA nutzen die Zölle zunehmend als
machtpolitisches Instrument zur Deckung
finanzieller Defizite im eigenen Land. Sie
untergraben damit die Prinzipien eines freien
und fairen Welthandels. Während die USA ihre
‚America First‘-Strategie konsequent verfolgen,
tragen die europäischen Unternehmen die
Hauptlast dieser Vereinbarung.
Zwar
verhindert die Einigung kurzfristig weitere
Eskalationen, doch bleibt die Planungssicherheit
durch die unberechenbare Handelspolitik der USA
fragil. Gleichzeitigt wurden zentrale
Streitpunkte wie die europäische
Dienstleistungssteuer, Digitalregulierung und
Künstliche Intelligenz vertagt und nicht gelöst.
Europa darf sich mit diesem Kompromiss nicht
zufriedengeben.
Die EU muss den Dialog
weiter aktiv fortführen und auf
Nachverhandlungen drängen. Europa muss seine
ökonomischen Interessen konsequent vertreten,
seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und sowohl
wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch
unabhängiger werden. Nur dann kann Europa seine
Rolle als größter Wirtschaftsraum der Welt
behaupten und langfristig Innovationen,
Arbeitsplätze sowie Wohlstand sichern.
Dazu gehört auch eine zukunftsgerichtete,
innovationsfreundliche und selbstbewusste
Handelsstrategie – einschließlich eines
verstärkten Engagements für neue
Freihandelsabkommen. Hier braucht es mehr Tempo,
insbesondere bei der überfälligen Ratifizierung
bestehender Verträge wie dem Mercosur-Abkommen
sowie bei der intensiven Weiterverhandlung mit
wichtigen Partnerstaaten wie Indien, Indonesien
und Australien.
Europa muss aber vor
allem seine eigene Sicherheitspolitik
grundlegend stärken. Die Schwäche Europas im
Handel mit den USA ist eng mit seiner
sicherheitspolitischen Abhängigkeit verbunden:
Solange Europa auf den militärischen Schutz der
USA angewiesen ist, bleibt es auch
wirtschaftlich erpressbar. Nur wenn die
Europäische Union in Verteidigungsfragen
unabhängiger agiert, kann sie ihre
wirtschaftlichen Interessen glaubhaft und
durchsetzungsstark vertreten – und ihre Stellung
als größter Wirtschaftsraum der Welt behaupten,
Innovationen fördern sowie langfristig
Arbeitsplätze und Wohlstand sichern.“
Zoll-Deal mit USA
IHK mahnt:
Langfristige Sicherheit nötig
Zölle von 15 Prozent auf EU-Produkte: Darauf
haben sich USA und EU geeinigt. Der
Handelsstreit ist nicht eskaliert, doch die
Zölle bleiben zu hoch. So gelten für Stahl und
Aluminium weiterhin 50 Prozent. Das trifft den
Stahlstandort Niederrhein hart.
IHK-Geschäftsführer für Außenwirtschaft, Jürgen
Kaiser, macht deutlich: „Unsere Region ist vom
Export abhängig. Wird er durch hohe Zölle
erschwert, belastet das die Wirtschaft unserer
Region. Dringend benötigte Investitionen sind in
Gefahr. Das gilt auch für grünen Stahl,
Duisburgs Zukunftsträger.
Die Einigung
im Konflikt ist ein wichtiges Signal für unsere
Unternehmen. Allerdings wird der Handel zwischen
Europa und den USA schwieriger und teurer. Das
schadet beiden Parteien. Was wir brauchen, ist
ein langfristig faires und stabiles
Handelsabkommen. Die Politik sollte verstärkt
Abmachungen mit weiteren Wirtschaftspartnern
umsetzen. Märkte wie Südamerika, Asien oder
Australien haben enormes Potenzial.“

Foto: Niederrheinische IHK/Jacqueline Wardeski
Naturzerstörung entzieht
Menschen die Lebensgrundlage
ÖDP
zum Welttag des Naturschutzes am 28. Juli:
Gesunde Umwelt ist Basis jeder stabilen
Gesellschaft, deshalb fordert die Partei die
„Rechte der Natur“ im Grundgesetz zu verankern.

Foto: anaterate/Pixabay CC/PublicDomain
Naturzerstörung entzieht Menschen die
Lebensgrundlage
ÖDP zum Welttag des
Naturschutzes: Gesunde Umwelt ist Basis jeder
stabilen Gesellschaft, deshalb fordert die
Partei die „Rechte der Natur“ im Grundgesetz zu
verankern.
„Eine gesunde Umwelt sichert
das Wohlergehen der derzeit lebenden Menschen
sowie zukünftiger Generationen“, betont zum
Welttag des Naturschutzes (28. Juli) Prof. Dr.
Herbert Einsiedler als Mitglied im
Bundesvorstand der Ökologisch-Demokratischen
Partei (ÖDP – Die Naturschutzpartei). Deshalb
ist Natur und ihr Schutz für die ÖDP kein
„Nice-to-have“. Die ÖDP setzt darauf, die
„Rechte der Natur“ im Grundgesetz zu verankern.
„Das wird zu einem Mind-shift führen“, betont
Kirsten Elisabeth Jäkel als 1. stellvertretende
Bundesvorsitzende: „Nur so schützen wir bedrohte
Ökosysteme.“
Einsiedler: „Naturschutz ist
Menschenschutz.“ Deshalb steht beides
unverrückbar oben auf der Prioritätenliste der
Partei: „Hierzu zählt auch der Erhalt der
natürlichen Ressourcen“, so Einsiedler. Denn wer
Raubbau an der Natur betreibt, zerstört Mittel-
und langfristig die menschliche Lebensgrundlage.
Davon sind die ÖDP und ihre Mitglieder
überzeugt. Daran richten sie ihre Politik aus.
Sie will die Trennung von Menschen und Natur
beenden: „Wir sind Teile der Natur“, sind die
Parteimitglieder überzeugt. „Es wird daher Zeit,
dass wir unseren verengten Blick auf Natur als
Objekt weiten und Tiere, Pflanzen und Ökosysteme
als eigenständige Subjekte anerkennen“,
begründet Jäkel.
Technisches Dezernat präsentiert
Skizzen für ehemaliges Moerser Finanzamt
Der Bau- und
Liegenschaftsbetrieb des Landes
Nordrhein-Westfalen (BLB) hat am Montag, 21.
Juli das Bieterverfahren zum Verkauf des
ehemaligen Finanzamtes gestartet.

Blick Unterwallstraße
Die erste Stufe
des Bieterverfahrens dauert zwei Monate. Daran
schließt sich die zweite Stufe mit der finalen
Angebotsabgabe an, an der auch die Stadt Moers
teilnehmen kann. Voraussetzung ist, dass der Rat
der Stadt dies nach der Sommerpause beschließt.
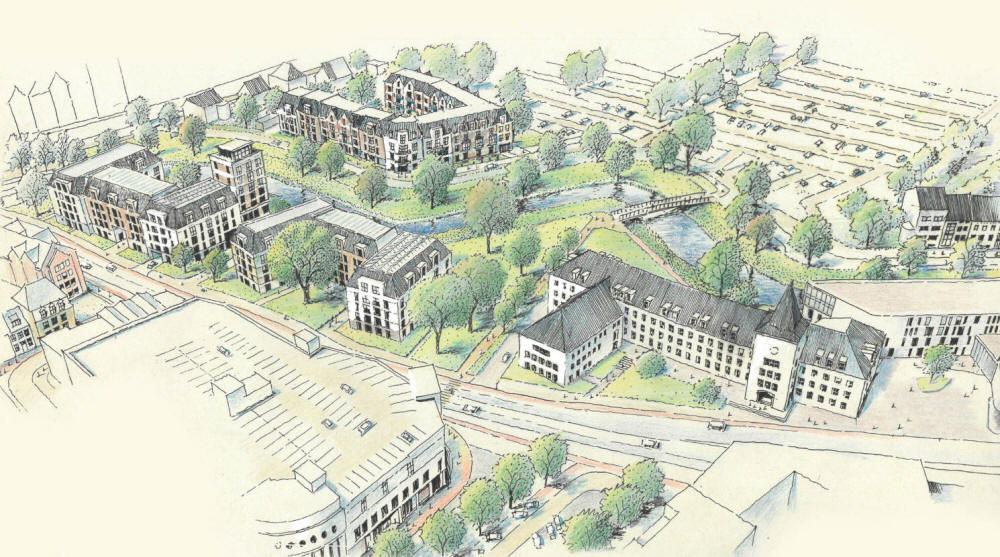
Blick Vogelschauperspektive
Laut Website
des BLB steht es den potenziellen Investoren
frei, sich selbst bei der Stadt Moers über die
Vorgaben der Stadtplanung zu informieren.
Passend zum Beginn des Bieterverfahrens hat das
Technische Dezernat skizzenhafte Perspektiven
(Skizzen: Stadt Moers) veröffentlicht, die
veranschaulichen wie eine Neubebauung aussehen
könnte.

Blick vom Nordring
„Ziel ist die
Schaffung eines Quartiers am Stadtgraben, das
sich in das Stadtbild und die Struktur der
Altstadt von Moers einfügt“, erläutert der
Technische Beigeordnete Thorsten Kamp.
Entsprechende Änderungen an den gestalterischen
und städtebaulichen Rahmenbedingungen im
Bebauungsplanentwurf sind in der Sitzung des
Ausschusses für Stadtentwicklung Planung und
Umwelt am 26. Juni einstimmig beschlossenen
worden.
Auch der Erhalt von Teilen des
vorhandenen Gebäudebestandes wird mit den
Änderungen des städtebaulichen Konzeptes nun
ermöglicht.
Moers: Die
schönsten Seiten von Moers als Kulisse nutzen
Mit dem neuen Selfie-Point vor
dem Moerser Schloss will die städtische
Wirtschaftsförderung weiter die Innenstadt
beleben und den Tourismus fördern. Ab sofort ist
ein Aufkleber auf dem Schlossplatz zu finden,
von dem man am besten ein Selfie mit dem
Wahrzeichen der Stadt schießen kann.

Die Wirtschaftsförderer Frank Putzmann und Jens
Heidenreich (v.l.) haben den ersten Selfie-Point
in Moers geklebt. (Foto: pst)
„Mit
dem neuen Selfie‑Point wollen wir sowohl
Touristen als auch Bürger dazu einladen, sich
kreativ mit einer unserer Sehenswürdigkeiten
auseinanderzusetzen“, erläutert der städtische
Wirtschaftsförderer Frank Putzmann. Den
Hintergrund bildet ein Antrag einer Fraktion des
Stadtrates, Selfie-Points in der Stadt
einzurichten.
In Absprache mit der
MoersMarketing GmbH hat sich die
Wirtschaftsförderung mit dem Aufkleber für eine
kostengünstige und leicht umsetzbare Variante
entschieden. „Das ist ein idealer Start – wir
können jederzeit flexibel reagieren und bei
positiver Resonanz das Angebot leicht
ausweiten.“
Bauliche Lösungen wären zu
kostenintensiv geworden. Weitere
Sehenswürdigkeiten, wie Schacht IV und der
geografische Mittelpunkt des Regierungsbezirks
Düsseldorf am Bettenkamper Weg wurden ebenfalls
markiert.
Altes und modernes
Moers bei Stadtführung entdecken
Bei einem Rundgang durch die Altstadt am
Samstag, 2. August bietet Gästeführer und Autor
Dr. Wilfried Scholten interessante Einblicke in
die Entwicklung von Moers im 20. und 21.
Jahrhundert.
Der Rundgang startet um
10.30 Uhr am Haupteingang des Moerser Schlosses.
Den tiefgreifenden Wandel, den das ehemals
kleinstädtische Moers durch den Bergbau erfahren
hat, verfolgen die Teilnehmenden dabei bis in
die Gegenwart einer modernen Stadt.

Foto privat)
Verbindliche Anmeldungen zu den
Führungen sind in der Stadt- und
Touristinformation von Moers Marketing möglich:
Kirchstraße 27a/b, Telefon 0 28 41 / 88 22 6-0.
Die Teilnahme kostet pro Person 8 Euro.
Scheckübergabe: Sparkasse
unterstützt wieder die Moerser Tummelferien
„Mein Hobby ist Ferien! Da mach ich immer,
immer, immer was ich will …“ tönt es laut im
Chor. Mit dem fröhlichen Refrain und dem
Tummelferien-Tanz begrüßten die Kinder des
Spielpunkts in Asberg gut gelaunt den Besuch aus
dem Rathaus und die Vertreterinnen der Sparkasse
am Niederrhein am Donnerstag, 24. Juli. Anlass
war die symbolische Übergabe eines Schecks über
1.000 Euro, mit dem das Geldinstitut die
Tummelferien erneut unterstützt.
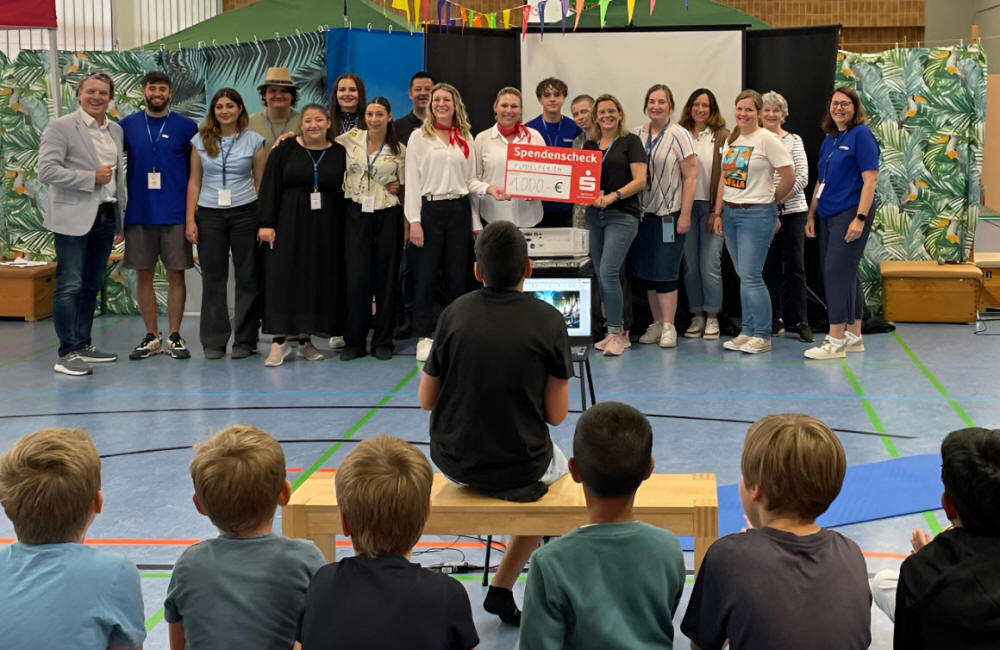
Stellvertretend für den Spielpunkt Asberg nahm
Spielpunktleitung Claudia Deselaers den Scheck
entgegen. (Foto: pst)
Melanie Peschik
und Nadine Lenzken von der Sparkasse
überreichten den überdimensionalen Spendenscheck
vor einer bunt geschmückten Bühne an die
Mitarbeitenden der Offenen Einrichtung für
Kinder ‚Asbär‘ der AWO. Diese organisieren in
Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro der
Stadt Moers den Tummelferien-Spielpunkt in
Asberg, einen von insgesamt sechs Standorten im
Stadtgebiet.
Neben rund 80 teilnehmenden
Kindern freuten sich auch die Betreuerinnen und
Betreuer über den Besuch und die Anerkennung für
ihr Engagement. Der Spielpunkt war gleichzeitig
Startpunkt der offiziellen
Bürgermeisterrundfahrt, bei der sich
Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung und
Politik ein Bild vom bunten Ferienprogramm an
den verschiedenen Spielpunkten machten und Eis
an alle Kinder verteilten.
Moers: Eis für alle - Bürgermeister besucht
Tummelferien-Spielpunkte
Eine süße Erfrischung sorgte am Donnerstag, 24.
Juli, für strahlende Gesichter bei den
Tummelferien-Kindern: Bürgermeister Christoph
Fleischhauer besuchte gemeinsam mit
Jugendfachbereichsleiterin Vera Breuer und
Atilla Cikoglu, Vorsitzender des
Jugendhilfeausschusses, alle sechs Spielpunkte
und brachte Fruchteis für die rund 850
teilnehmenden Kinder mit.
Die
Aktion wurde mit viel Begeisterung aufgenommen.
Neben der Eisverteilung nutzten die Gäste die
Gelegenheit, mit den Teams vor Ort ins Gespräch
zu kommen und einen Eindruck vom bunten
Ferienprogramm in Repelen, Kapellen, Asberg,
Meerbeck, Eick und im Freizeitpark zu gewinnen.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer und
Jugendfachbereichsleiterin Vera Breuer verteilen
Eis an die Kinder im Freizeitpark. (Foto: pst)

2024 wurden 15,5 % weniger Wohngebäude aus
Fertigteilen errichtet
·
Rückgang fällt geringer aus als bei
konventionell errichteten Wohngebäuden (-23,0 %
· Niedrigster Wert bei neuen
Einfamilien-Fertighäusern seit 2014
· Preise
für Einfamilien-Fertighäuser: +0,5 % gegenüber
2023
Die schwache Baukonjunktur wirkt
sich auch auf den Wohnungsbau aus Fertigteilen
aus – allerdings weniger stark als auf den
konventionellen Neubau. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden im Jahr
2024 rund 16 900 Wohngebäude im Fertigteilbau
errichtet – 15,5 % weniger als im Jahr zuvor.
Starke Rückgänge gab es bei neuen
Einfamilien-Fertighäusern (-14,9 % gegenüber
2023) und bei Wohngebäuden in Fertigteilbauweise
mit zwei Wohnungen (-24,2 % gegenüber 2023); bei
in Fertigteilbauweise hergestellten Wohngebäuden
mit mindestens drei Wohnungen gab es ein Minus
von 4,9 %. Dagegen gab es bei der Fertigstellung
in Fertigteilbauweise errichteten Wohnheimen
einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 53,8 %.
Der Neubau von Wohngebäuden in
konventioneller Bauweise ging 2024 gegenüber dem
Vorjahr um 23,0 % auf 59 200 zurück. Insgesamt
war im Jahr 2024 mehr als jedes fünfte (22,2 %)
fertiggestellte Wohngebäude ein vorgefertigtes
Haus aus der Fabrik. Das Bauen aus Fertigteilen
wird angesichts erhöhter Baukosten
möglicherweise als günstigere und zeitsparende
Alternative diskutiert.
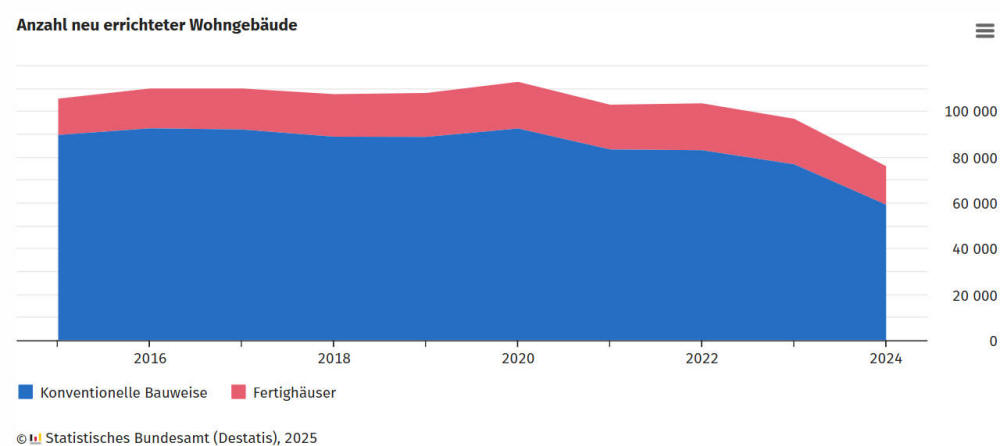
Fertigstellung von Einfamilienhäusern in
konventioneller Bauweise geht stärker zurück als
Fertigteilbauten
Ein Rückgang
der Bauvorhaben zeigte sich deutlich bei
klassischen Einfamilien-Fertighäusern, die mit
85,1 % den größten Anteil an den Wohngebäuden im
Fertigteilbausegment haben: Im Jahr 2024 wurden
mit 14 300 Einfamilien-Fertighäusern 14,9 %
weniger als im Vorjahr fertiggestellt.
Weniger Einfamilien-Fertighäuser als 2024 wurden
zuletzt vor zehn Jahren errichtet (2014: 14 100
Fertigstellungen).
In konventioneller
Bauweise wurden im Jahr 2024 rund 40 100
Einfamilienhäuser gebaut. Das war der niedrigste
Wert seit der Wiedervereinigung und 24,3 %
weniger als 2023 (53 000). Auch beim Neubau von
Zwei- und Mehrfamilienhäusern wirkte sich die
schwache Baukonjunktur aus: Im Jahr 2024 wurden
rund 1 700 Zweifamilien-Fertighäuser (-24,2 %
gegenüber 2023) und 720 Wohngebäude mit
mindestens drei Wohnungen im Fertigteilbau
errichtet (-4,9 % gegenüber 2023).
Noch
stärker waren die Rückgänge beim Neubau von
Zwei- und Mehrfamilienhäusern in konventioneller
Bauweise: Im Jahr 2024 wurden rund 7 100
Zweifamilienhäuser fertiggestellt – ein Minus
von 26,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der
konventionell fertiggestellten Gebäude mit
mindestens drei Wohnungen sank im Jahr 2024
gegenüber dem Vorjahr um 15,4 % auf rund 11 900
Fertigstellungen.
Mehr Bauvorhaben gab
es bei der Fertigstellung von Wohnheimen im
Fertigteilbau: Im Jahr 2024 wurden 60 Wohnheime
in solcher Bauweise errichtet – ein Plus von
53,8 % gegenüber dem Vorjahr. In konventioneller
Bauweise waren es 2024 rund 100 Wohnheime
(-11,6 % gegenüber 2023).
Bauherren im
Wohnungsbau aus Fertigteilen waren im Jahr 2024
mehrheitlich private Haushalte. Sie machten
einen Anteil von 90,9 % aus. Danach folgten mit
7,9 % Unternehmen und mit 1,1 % öffentliche
Träger (einschließlich Organisationen ohne
Erwerbszweck).
Einfamilien-Fertighäuser
im Jahr 2024 um 0,5 % verteuert
Im Jahr 2024
stiegen die Baupreise für
Einfamilien-Fertighäuser um 0,5 % im Vergleich
zum Jahresdurchschnitt 2023. Zum Vergleich: Der
Baupreisindex für Wohngebäude in konventioneller
Bauart lag im Jahr 2024 bei +2,9 % gegenüber
2023. Im Zehnjahresvergleich verteuerte sich der
Bau von Einfamilien-Fertighäusern um 62,2 %, der
Bau konventioneller Wohngebäude kostete 67,5 %
mehr.
Sozialhilfeausgaben stiegen 2024 im
Ruhrgebiet um 15,7 Prozent
Die
Nettoausgaben für Leistungen der Sozialhilfe im
Ruhrgebiet lagen im Jahr 2024 bei knapp 1,5
Milliarden Euro und waren damit um rund 203
Millionen Euro oder 15,7 Prozent höher als ein
Jahr zuvor. Das geht aus den aktuellen Zahlen
des Statistischen Landesamtes IT.NRW hervor.
NRW-weit wuchsen die Ausgaben um 16,4
Prozent auf rund fünf Milliarden Euro. Gestiegen
sind sowohl die Zahl der Empfänger als auch die
durchschnittlichen Aufwendungen für die
Leistungsberechtigten. Mit 882.241 Millionen
Euro wurde 2024 mehr als die Hälfte der gesamten
Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung ausgegeben.
Der
zweitgrößte Ausgabeposten war die Hilfe zur
Pflege mit 397.638 Millionen Euro. Für die Hilfe
zum Lebensunterhalt lagen die Nettoausgaben bei
114.075 Millionen Euro; 92.398 Millionen Euro
wurden für Hilfen zur Gesundheit gezahlt. 13.423
Millionen Euro fielen auf den Ausgabeposten
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten. idr
Bundeskanzler
Friedrich Merz erklärt am 27. Juli 2025 zur
Einigung von Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen und Präsident Donald Trump in den
EU-US-Verhandlungen:
„Ich
begrüße die Einigung zwischen Ursula von der
Leyen und Donald Trump in den Verhandlungen
zwischen der Europäischen Union und den
Vereinigten Staaten. Es ist gut, dass Europa und
die USA sich geeinigt haben und so eine unnötige
Eskalation in den transatlantischen
Handelsbeziehungen vermeiden.
Die
Einigkeit der Europäischen Union und die harte
Arbeit der Verhandler haben sich ausgezahlt.
Mein besonderer Dank gilt daher Ursula von der
Leyen und Handelskommissar Maroš Šefčovič mit
ihren Teams für den unermüdlichen Einsatz in den
letzten Wochen.
Mit der Einigung ist es
gelungen, einen Handelskonflikt abzuwenden, der
die exportorientierte deutsche Wirtschaft hart
getroffen hätte. Dies gilt besonders für die
Automobilwirtschaft, bei der die gegenwärtigen
Zölle von 27,5 Prozent auf 15 Prozent fast
halbiert werden. Gerade hier ist die schnelle
Zollsenkung von größter Bedeutung.
Wir
haben so unsere Kerninteressen wahren können,
auch wenn ich mir durchaus weitere
Erleichterungen im transatlantischen Handel
gewünscht hätte. Von stabilen und planbaren
Handelsbeziehungen mit Marktzugang für beide
Seiten profitieren alle - diesseits wie jenseits
des Atlantiks, Unternehmen wie Verbraucher.
In den nun anstehenden Verhandlungen über
die Details der Einigung hat die Europäische
Kommission meine volle Unterstützung. Wir müssen
weiter daran arbeiten, unsere Handelsbeziehungen
mit den USA zu stärken.
Deutschland und
die Europäische Union stehen für freien und
fairen Welthandel. Daher werde ich auch
weiterhin für Zollsenkungen und den Abbau von
Handelshemmnissen eintreten. Das gilt auch für
die Verhandlungen über weitere
Freihandelsabkommen mit unseren Partnern in der
Welt und vor allem für den Abschluss des
Abkommens mit den Ländern des Mercosur in
Südamerika.“
|
|
Mit Mut in eine neue
Zukunft: Wie internationale Azubis Betriebe
bereichern Michal Kramer
begleitet als Willkommenslotsin der
Niederrheinischen IHK Unternehmen und
internationale Azubis. Denn der Fachkräftemangel
erschwert vielen Betrieben die Nachwuchssuche.
Eine Lösung liegt für einige im Blick über die
Grenze. Immer mehr junge Menschen aus dem
Ausland kommen nach Deutschland, um hier eine
Ausbildung zu machen.

Foto: Niederrheinische IHK/Jacqueline Wardeski
Unterstützung bietet dabei das Projekt
„Passgenaue Besetzung – Willkommenslotsen“. Im
Interview erklärt Michal Kramer die Chancen,
aber auch mögliche Stolpersteine auf dem
gemeinsamen Weg. Welche Beweggründe
gibt es für Unternehmen, Auszubildende aus dem
Ausland einzustellen? Kramer: Manche Unternehmen
finden kaum noch passende Bewerber für ihre
Ausbildungsplätze. Bis 2030 werden am
Niederrhein bis zu 40.000 Fachkräfte fehlen. Für
Betriebe kann die Suche im Ausland sinnvoll
sein.
Gleichzeitig bietet Deutschland
jungen Menschen aus dem Ausland gute Chancen für
den Berufseinstieg. Für beide Seiten entsteht
eine Win-win-Situation: Der Betrieb besetzt
einen offenen Ausbildungsplatz – der Azubi
bekommt eine berufliche Perspektive. Bei der
Niederrheinischen IHK zeigt sich dieser Trend
besonders im Einzelhandel und in der Gastronomie
– hier steigt die Zahl der internationaler
Azubis.
Welche
Herausforderungen können dabei auftreten?
Vor allem die Bürokratie stellt viele vor
Hürden. Visa beantragen, Aufenthaltstitel
klären, Versicherungen abschließen und eine
Wohnung suchen: viele junge Menschen brauchen
dabei Unterstützung. Hinzu kommen sprachliche
und kulturelle Unterschiede. Häufig reichen die
Deutschkenntnisse, mit denen die Azubis zu uns
kommen, nicht aus. Für einen erfolgreichen
Prüfungsabschluss sind bessere Sprachkenntnisse
notwendig.
Deshalb sollte die
Sprachförderung von Anfang an Teil der
Ausbildung sein. Für viele Azubis ist zudem
alles neu: das Klima, die Umgebung, der Alltag.
Ohne Begleitung kann das schnell überfordern.
Wie können Betriebe auf solche
Hindernisse reagieren?
Gute Vorbereitung und
klare Erwartungen sind der Schlüssel.
Unternehmen sollten wissen: In der Anfangszeit
braucht es Zeit, Geduld und zusätzliche
Betreuung. Arbeitgeber übernehmen oft mehr als
nur die fachliche Anleitung. Sie sind auch erste
Ansprechperson, sozialer Halt oder
Orientierungshilfe im neuen Alltag. Hilfreich
ist alles, was das Ankommen unterstützt.
Zum Beispiel eine Willkommensmappe,
Alltagstipps oder Hinweise auf Supermärkte mit
vertrauten Lebensmitteln. Auch der Kontakt zu
lokalen Communities kann helfen, Heimweh
vorzubeugen und neue Netzwerke aufzubauen.
Vorausschauendes Planen kann entlasten. Dazu
gehören: das Team frühzeitig einbinden, das
Onboarding vorbereiten, Sprachunterstützung
organisieren und sich mit dem Thema Kulturschock
auseinandersetzen.
Unterstützung bietet
auch das Projekt „Willkommenslotsen“. Es berät
individuell, gibt rechtliche Orientierung und
begleitet Unternehmen und Auszubildende. Und was
können Azubis tun? Auch die Azubis können sich
vorbereiten. Etwa, indem sie sich über soziale
Medien oder Videos vorab ein Bild vom Leben in
Deutschland machen. Wichtig ist: weiter Deutsch
lernen, auch über den Sprachkurs im Heimatland
hinaus.
Nach der Ankunft in Deutschland
können dabei weitere Kurse oder Sprach-Apps
helfen. Welchen Mehrwert bringt die Ausbildung
internationaler Azubis? Neben einem neuen
Mitarbeiter oder einer neuen Mitarbeiterin
gewinnen Unternehmen auch eine neue Perspektive.
Internationale Azubis bringen Vielfalt und große
Lernbereitschaft mit.
Wer offen ist und
sie begleitet, investiert nicht nur in eine
zukünftige Fachkraft, sondern schenkt einem
jungen Menschen eine echte Zukunftschance. Das
Projekt „Passgenaue Besetzung –
Willkommenslotsen“ ist gefördert vom Ministerium
für Wirtschaft und Energie.
Kleve: Beaker´s Revenge Live in Düffelward
Fr., 01.08.2025 - 21:00 Uhr
Abrissbirne,
Partyknaller und dicke Freundschaft - unter
diesem Motto rockt die (Hard-) Rock-Coverband
Beaker's Revenge seit 10 Jahren die Bühnen des
oberen Niederrheins. Und das will am 01.08.25 im
Rahmen der Kirmes Düffelward mit unbändiger
Spielfreude und Geschrammel-Garantie im Festzelt
zusammen mit dem EJuKi-Chor gebührend gefeiert
werden.
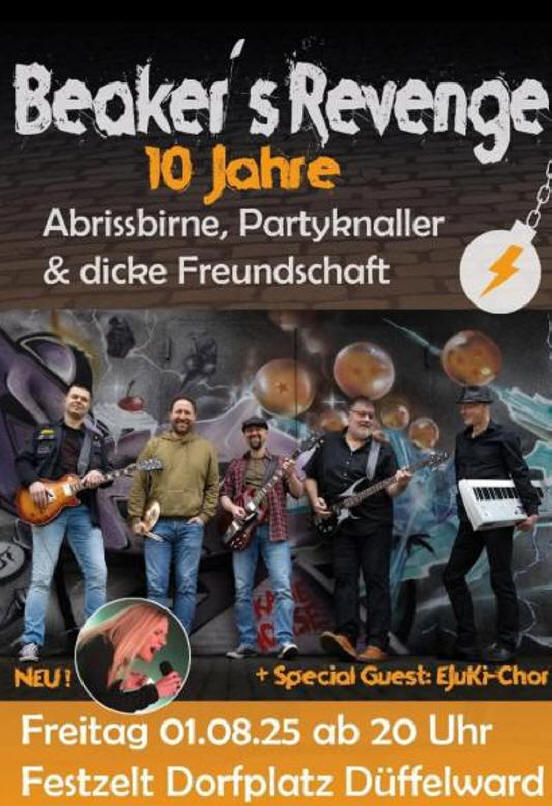
Ab 21 Uhr (19:30 Uhr Einlass) geht es mit
den Songs von U2, den Toten Hosen, Europe, den
Ärzten und Motörhead richtig zur Sache. Das
Publikum erwartet alles, was Spaß macht und
fetzt. Mitsingen, und -hüpfen eindeutig
erwünscht.
Die Krebsberatung
Niederrhein e. V. und „Die Pflege“ laden von
Krebs Betroffene zu einem Kreativ-Event am 14.
August 2025 ein
„Pinselstrich und Tintenfass“ –
kunsttherapDeutischer Workshop
Am 14. August
2025 sind von Krebs Betroffene herzlich zur
Veranstaltung „Pinselstrich und Tintenfass“ von
der Krebsberatung Niederrhein e. V. und „Die
Pflege“ eingeladen. Von 17 bis 18.30 Uhr geht es
am Hauptsitz der Krebsberatung (Eurotec-Ring 40,
47445 Moers) im kunsttherapeutischen Workshop
darum, gemeinsam kreativ zu werden.
Geleitet wir der anderthalbstündige Workshop von
Psychoonkologin und Diplom Sozialarbeiterin
Ursula Ellermann von „Die Pflege“. Außerdem wird
Kerstin Zimmer-Derks, Fachliche Leitung der
Krebsberatung Niederrhein e. V. und
Psychoonkologin (DKG), als Gesprächspartnerin
für die Teilnehmer:innen da sein.
„Ziel
dieser Kooperation und des Kreativ-Events ist
es, den Betroffenen in ihrer besonderen und
herausfordernden Lebenssituation eine
Möglichkeit zu geben, ihre Gedanken und Gefühle
über Farben und das gemeinsame Zeichnen zum
Ausdruck zu bringen – und so einen Zugang zu
ihnen zu finden“, erklärt Ursula Ellermann. Was
gezeichnet wird, bleibt den Teilnehmer:innen
selbst überlassen.
„Wir geben einen
Impuls vor und dann sind die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gefragt, um das weiße Blatt Papier zu
füllen.“ Kerstin Zimmer-Derks betont: „Im Rahmen
einer Krebserkrankung kommt den Patientinnen und
Patienten oft eine eher passive Rolle zu. Beim
Zeichnen und gemeinsame Malen ändert sich das.
Sie erleben das Ganze aktiv und gehen darüber in
den Austausch. Gleichzeitig entsteht durch das
entstandene Bild eine Distanz zu den Gedanken
und Gefühlen, die in Verbindung mit der
Krankheit aufkommen.“
„Wir freuen uns
sehr, dass wir den Workshop zusammen auf die
Beine stellen konnten und sind gespannt und
neugierig auf diese neue Erfahrung“, erklären
Kerstin Zimmer-Derks und Ursula Ellermann.

Kerstin Zimmer-Derks (li.) von der Krebsberatung
Niederrhein e. V. und Ursula Ellermann (re.) von
„Die Pflege“ laden Krebskranke zur Veranstaltung
„Pinselstrich und Tintenfass“ ein.
ANMELDUNG & KOSTEN:
Für die Teilnahme am
Workshop ist eine vorherige Anmeldung notwendig.
Ansprechpartnerin Martina Hanßen: +49 (0) 2841
656 20 50 oder
kontakt@krebsberatung-niederrhein.de. Außerdem
fällt eine Teilnahmegebühr in Höhe von 10 Euro
pro Person (Material inklusive) an.
Die
Krebsberatung Niederrhein e. V. ist eine
Anlaufstelle für von Krebs Betroffene und
Angehörige, die auf ein breites Netzwerk aus
Ärzt:innen, Kliniken, Therapeut:innen und
Selbsthilfegruppen zugreifen kann und
vermittelt. In der Krebsberatung mit ihrem Sitz
im Gewerbegebiet Eurotec (Eurotec-Ring 40, 47445
Moers) beraten erfahrene Psychoonkologinnen bei
Fragen rund um das Thema Krebs.
Oft geht
es in der Beratung neben gesundheitlichen
Aspekten auch um berufliche und finanzielle
Themen, die Ratsuchende beschäftigen. Bei allen
Fragen hilft die Krebsberatung Niederrhein e. V.
– kostenlos und unabhängig. Es handelt sich bei
der Beratungsstelle um eine Kooperation zwischen
der Stiftung Bethanien Moers, der St. Josef
Krankenhaus GmbH und dem ambulanten Pflegedienst
„Die Pflege“ GmbH.
Anschrift und
Kontakt: Krebsberatung Niederrhein e. V.
Eurotec-Ring 40, 47445 Moers. Tel.: (02841) 656
20 50
E-Mail:
kontakt@krebsberatung-niederrhein.de
www.krebsberatung-niederrhein.de
Tariftreuegesetz: Spitzenverband übt erhebliche
Kritik
Schwächung von Mittelstand und
Scheinbeteiligung - Mittelstand wird massiv
geschwächt, große Betriebe profitieren.
BFB-Hauptgeschäftsführer Peter
Klotzki sagt: "Der bekannt gewordene Entwurf
eines Tariftreuegesetzes stellt insbesondere für
die planenden Freien Berufe eine weitere
wirtschaftliche und bürokratische Belastung dar.
Der Entwurf verlangt Standards von kleinen
Betrieben, die aus der Welt der großen
tarifgebundenen Unternehmen stammen.
Große Betriebe haben sowohl beim Umgang mit
erhöhtem Verwaltungsaufwand als auch bei
finanziellen Mehraufwänden bessere
Voraussetzungen. Die Freien Berufe machen mit
rund 1,48 Mio. Selbständigen knapp 40 Prozent
aller Selbstständigen aus. Im Schnitt
beschäftigen sie Teams mit drei Mitarbeitenden.
Tarifliche Strukturen sind nicht
gewachsen. Gleichzeitig tragen sie Verantwortung
für entscheidende neue Aufgaben wie die
Sanierung und Rettung unserer Infrastruktur,
etwa Brückenerneuerung durch Ingenieurbüros,
Schienenbau oder den Aufbau von neuer
Infrastruktur für Nachhaltigkeit wie
Windenergie-Parks.
Das Tariftreuegesetz
ist die Durchsetzung hoher tariflicher Standards
mit der Brechstange, um Tarifbindung staatlich
zu fördern. Die Ursachen des abnehmenden Grads
der tariflichen und gewerkschaftlichen Bindung
haben ihre Ursache auch in sich selbst.
Unbeteiligte sollen diese jetzt korrigieren. Die
Drei-Tages-Frist für die Stellungnahme massiv
betroffener Berufsgruppen wirkt wie eine
Scheinbeteiligung. Am Tariftreuegesetz hängen
Existenzen.
Die Verbände müssen mehr
Zeit zur Stellungnahme bekommen. Bundeskanzler
Merz und Wirtschaftsministerin Reiche müssen den
Stopp dieses Vorhabens zur Chefsache machen.
Sonst wird
„made for Germany“ ein Wunschprojekt bleiben
und der Mittelstand wird weiter geschwächt."
Über den BFB
Der Bundesverband der
Freien Berufe e. V. (BFB) vertritt als einziger
Spitzenverband der freiberuflichen Kammern und
Verbände die Interessen der Freien Berufe in
Deutschland. Allein die rund 1,48 Millionen
selbstständigen Freiberuflerinnen und
Freiberufler steuern knapp zehn Prozent zum
Bruttoinlandsprodukt bei. Sie beschäftigen über
4,7 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
darunter ca. 129.000 Auszubildende. Die
Bedeutung der Freien Berufe für Wirtschaft und
Gesellschaft geht weit über ökonomische Aspekte
hinaus. Die Gemeinwohlorientierung ist ihr
zentrales Merkmal.
Urlaubsfahrt mit Hindernissen: Was ist beim
Unfall zu tun?
• Warnweste nicht
vergessen
• Unfallbericht: Unterschiedliche
Beweiskraft in unterschiedlichen Ländern
•
Zuhause oder im Ausland reparieren?
Sommer und Ferien: ein unschlagbares Duo. Bei
Urlaubsbeginn atmen alle tief durch und denken
an Erholung. Niemand rechnet mit einem Unfall.
Doch wenn es wirklich passiert, ist es gut,
vorbereitet zu sein.
Die HUK-COBURG rät, vor
dem Aussteigen eine Warnweste anzuziehen. In den
meisten europäischen Ländern ist das Tragen
Pflicht. Wer ohne erwischt wird, muss zahlen.
Die Höhe des Bußgeldes variiert: Die Spanne
reicht von 14 Euro bis zu ein paar hundert Euro.
Oft müssen nicht nur Auto- sondern auch
Motorradfahrer eine Leuchtweste tragen. Ebenso
variabel gehen die Staaten mit der Frage um, ob
Warnwesten nur für den Fahrer oder für alle
Fahrzeuginsassen vorhanden sein müssen. Mit
einem Exemplar für jeden ist man immer auf der
sicheren Seite.
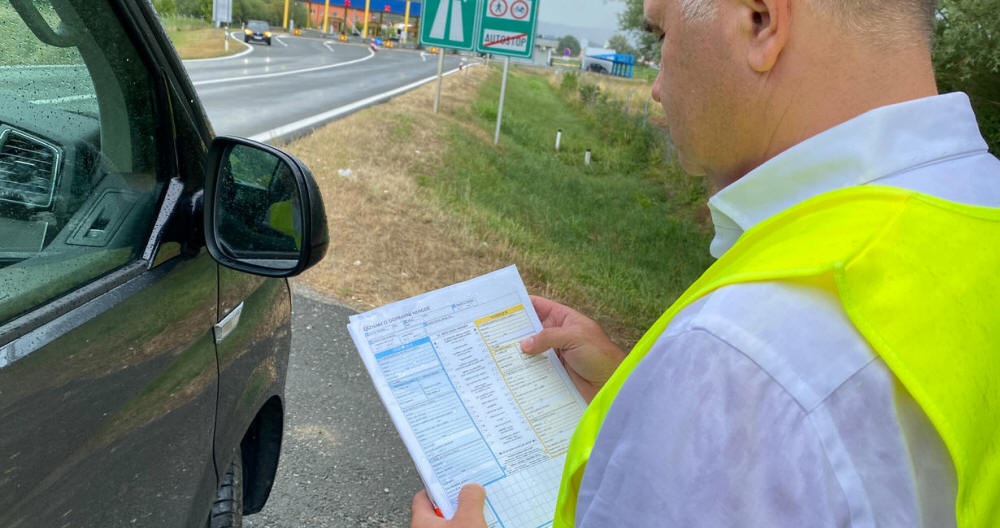
Auch im Urlaub können Unfälle passieren. Es ist
gut vorbereitet zu sein. Foto: HUK-COBURG
Es gibt keine Vorschrift zur Aufbewahrung
von Warnwesten. Aber um sie vor dem Aussteigen
anziehen zu können, müssen sie griffbereit
liegen, am besten im Handschuhfach oder in den
Seitenfächern der Türen.
Genauso wichtig wie
die Warnweste ist das Absichern der Unfallstelle
mit einem Warndreieck. Liegt die Unfallstelle in
einer Kurve oder vor einer Kuppe, muss das
Dreieck immer davor aufgestellt werden. Am
wichtigsten ist, die anderen Verkehrsteilnehmer
rechtzeitig und deutlich sichtbar vor der
Gefahren-stelle zu warnen.
Zudem gibt es
Staaten, wie zum Beispiel Polen oder Rumänien,
die vorschreiben, jeden Unfall der Poli-zei zu
melden. Um nichts falsch zu machen, ist ein
Anruf bei der Polizei also immer richtig. Selbst
wenn sie – wie mancherorts üblich – nur große
Sach- oder Personenschäden aufnimmt.
Mit
oder ohne Polizei, ein Unfall muss protokolliert
werden. Nur wer Ansprüche belegen kann, hat
An-spruch auf Entschädigung. Deshalb gehört der
europäische Unfallbericht - den man bei seiner
Kfz-Versicherung bekommt - ins Handschuhfach.
Wer die Fragen nach den Personalien der
Unfallbeteilig-ten und Zeugen, der Versicherung
und dem Unfallhergang sorgfältig beantwortet,
hat eine solide Basis für die Schadenregulierung
gelegt. Aber natürlich sollten auch noch Fotos
von der Unfallstelle gemacht werden. Den
Europäischen Unfallbericht gibt es für manche
Länder zweisprachig.
Wichtig: In vielen
europäischen Staaten, z.B. in Frankreich, kommt
dem Europäischen Unfallbericht eine ungleich
wichtigere Rolle zu als in Deutschland. Der
Unterschreibende erkennt den Inhalt
unwi-derruflich an. Anmerkungen oder
Widersprüche müssen unbedingt unter Punkt 14
festgehalten wer-den. Bei Widersprüchen oder
Sprachschwierigkeiten füllt am besten jeder
seinen eigenen Bericht aus und unterzeichnet
ihn. Anschließend werden die Kopien
ausgetauscht.
Nicht allein in diesem
Punkt unterscheidet sich die Schadenregulierung
der einzelnen Länder. Sobald es im Ausland
kracht, gilt für die Schadenregulierung in der
Regel nationales Recht: So stehen Geschädig-ten
z.B. Wertminderung, Nutzungsausfall oder auch
Mietwagenkosten nicht in allen europäischen
Staa-ten zu oder sie liegen deutlich hinter den
hierzulande üblichen Summen. Kfz-Versicherte mit
einer Aus-land-Schadenschutz-Versicherung müssen
darüber nicht nachdenken.
Dieses
Zusatzmodul zur Kfz-Haftpflichtversicherung
garantiert, dass der eigene Versicherer
Personen- und Sachschäden so regu-liert, als
hätte sich der Unfall im Inland ereignet. Statt
der gegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherung
reguliert dann der eigene Versicherer den durch
einen Dritten verursachten Schaden.
Reparatur im Urlaub oder zu Hause
Natürlich
trübt ein Unfall die Urlaubsfreude, doch muss er
die Ferien nicht komplett verderben. Ist das
Auto nicht mehr fahrbereit, gibt es ungeklärte
Fragen: Ein Schutzbrief, wie ihn die meisten
Kfz-Versicherer anbieten, hilft. Das gilt auch,
wenn der Geschädigt sich in der fremden Sprache
nur schwer oder gar nicht verständigen können.
Hier fungiert der Schutzbriefanbieter als
Bindeglied und unter-stützt telefonisch bei
Verständigungsproblemen.
Unfall oder
Panne lassen den Stresspegel steigen. Gut, vor
Reiseantritt die Notrufnummer mit deutscher
Vorwahl einzuspeichern. Gibt es eine App, gehört
auch sie auf das Mobiltelefon. Nach dem
Erstkontakt übernimmt der Schutzbriefanbieter
die Pannen- und Unfallorganisation.
Entweder wird das Auto vor Ort fahrbereit
gemacht oder zur Reparatur in eine Werkstatt
abgeschleppt. Verzögert sich die Reparatur,
unterstützt der Schutzbriefanbieter in der Regel
auch die Umorganisation des Urlaubs. Bei einer
kurzen Urlaubsunterbrechung brauchen Kunden ein
Hotel vor Ort. Dauert das Warten zu lan-ge, kann
der Wagen später abgeholt werden. In diesem Fall
benötigen Geschädigte einen Mietwagen oder
Bahntickets.
Ob beim Reparaturauftrag in
der Werkstatt oder beim Anmieten eines Pkw ohne
eine der üblichen Kreditkarten geht nichts: Es
geht dabei nicht um das Bezahlen, sondern um das
Hinterlegen der erfor-derlichen
Sicherheitskaution. Sie fällt an für Kosten, die
nicht über den KFZ-Schutzbrief gedeckt wer-den
können, z.B. für Kraftstoff bzw. Strom oder
Zusatzversicherungen für den Mietwagen.
Ist der Unfallwagen fahrbereit und
verkehrssicher, steht der Reparatur zu Hause
nichts im Weg. Scha-denersatzansprüche lassen
sich jederzeit von Deutschland aus geltend
machen. Alle Versicherer in der EU müssen
entweder selbst in jedem anderen EU-Staat
regulieren oder dort einen Schadenbeauftragten
für die Regulierung haben. Abgewickelt wird der
Schaden nach dem Recht des Unfalllandes, aber in
der Sprache des Geschädigten.
Enthält die
eigene Kfz-Versicherung nicht das Zusatzmodul
Auslandsschaden-Schutzversicherung, hilft zu
Hause die Auskunftsstelle (Tel. 0800-250 260 0;
aus dem Ausland: 0049 40 300 330 300) weiter.
Mit Hilfe des gegnerischen Autokennzeichens
ermittelt sie den verantwortlichen Versicherer
bzw. dessen Schadenregulierungsbeauftragten.
Hat die gegnerische Versicherung oder ihr
Repräsentant drei Mona-te nichts von sich hören
lassen, kann man sich auch an die
Entschädigungsstelle der Verkehrsopferhilfe in
Berlin wenden.
Kleidungsvorschriften im Auto
Mit
den Sommerferien kommt nicht nur die Reiselust,
sondern auch der Wunsch nach leichter, bequemer
Kleidung – selbst am Steuer. Doch wie sieht es
rechtlich aus, wenn man nur schnell zum Strand,
zum Bäcker oder in den Supermarkt fährt? Darf
man barfuß oder in Flip-Flops fahren – oder
sogar oben ohne? Der ACV Automobil-Club Verkehr
gibt zur Ferienzeit einen Überblick über
rechtliche Grundlagen, Sicherheitsrisiken und
mögliche Konsequenzen beim Autofahren mit
ungewöhnlicher Kleidung.
Gesetzliche
Vorschriften zum Schuhwerk beim Autofahren
Im
deutschen Straßenverkehrsgesetz gibt es keine
explizite Regelung, die das Tragen eines
bestimmten Schuhwerks beim Autofahren
vorschreibt. Ob Flip-Flops, Schlappen oder
Pantoffeln – grundsätzlich darf jeder selbst
entscheiden, welches Schuhwerk er trägt.
Eine Ausnahme gilt für Berufskraftfahrer, etwa
Bus- oder Lkw-Fahrer: Sie sind laut § 44 Abs. 2
der Unfallverhütungsvorschrift (DGUV Vorschrift
70) verpflichtet, feste und geschlossene Schuhe
zu tragen.
Auch bei privaten Fahrten
sollte das Schuhwerk so gewählt werden, dass es
die sichere Fahrzeugführung nicht
beeinträchtigt. Kommt es durch ungeeignetes
Schuhwerk zu einem Unfall, kann dem Fahrer eine
Mitschuld zugesprochen werden. Rechtsgrundlage
ist § 1 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung, der
besagt, dass sich jeder so zu verhalten hat,
„dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder
mehr, als nach den Umständen unvermeidbar,
behindert oder belästigt wird.“
Risiken
und rechtliche Folgen beim Fahren mit
ungeeignetem Schuhwerk
Warum sind Schlappen
oder Flip-Flops am Steuer riskant?
Sommerschuhe wie Schlappen, Adiletten oder
Flip-Flops bieten deutlich weniger Halt als
festes Schuhwerk. Die Gefahr, vom Brems- oder
Gaspedal abzurutschen oder mit dem Schuh hängen
zu bleiben, ist groß. Zudem fehlt oft das
gewohnte Gefühl für Gas, Bremse und Kupplung,
die Kontrolle über die Pedale nimmt ab. In
Gefahrensituationen können dadurch wertvolle
Sekunden verloren gehen.
Sind High Heels
am Steuer erlaubt?
Das Tragen von High Heels
ist zwar nicht verboten, erhöht jedoch das
Unfallrisiko. Die Absätze können sich leicht
verkeilen und damit schnelles Bremsen oder
Beschleunigen erschweren. Zwar droht kein
direktes Bußgeld, bei einem Unfall kann dem
Fahrer jedoch eine Teilschuld zugesprochen
werden.
Was gilt beim Barfußfahren?
Auch
das Autofahren ohne Schuhe ist grundsätzlich
erlaubt. Beim Barfußfahren fehlt jedoch nicht
nur der nötige Halt, sondern auch der notwendige
Druck, um im Ernstfall eine Vollbremsung
wirkungsvoll durchzuführen. Besonders in den
Sommermonaten steigt durch Schwitzen zusätzlich
die Gefahr, von den Pedalen abzurutschen. Kommt
es dadurch zu einem Unfall, kann auch hier eine
Mitschuld drohen.
Was droht bei fehlendem
oder ungeeignetem Schuhwerk?
Wird ein Unfall
durch ungeeignetes Schuhwerk mitverursacht, kann
dies als Verletzung der allgemeinen
Sorgfaltspflicht gewertet werden. In solchen
Fällen drohen zivilrechtliche Mithaftung und
gegebenenfalls versicherungsrechtliche
Nachteile.
Eine strafrechtliche
Verfolgung ist nur dann denkbar, wenn grob
verkehrswidriges Verhalten vorliegt und andere
konkret gefährdet wurden. Der Nachweis, dass der
Unfall etwa durch Flip-Flops mitverursacht
wurde, ist in der Praxis jedoch schwer zu
führen.
Nackt oder freizügig Autofahren –
ist das erlaubt?
Grundsätzlich dürfen sowohl
Männer als auch Frauen nackt Auto fahren. Jedoch
kann Nacktheit als Ordnungswidrigkeit nach § 118
OWiG gewertet werden, etwa wenn sich andere
Verkehrsteilnehmer belästigt fühlen. In solchen
Fällen drohen Verwarnungen oder Platzverweise.
Kommt es zu einer Anzeige, kann ein Bußgeld
von bis zu 1.000 Euro verhängt werden, abhängig
vom Einzelfall und der Einschätzung der
Ordnungsbehörde. Solche Fälle sind allerdings
selten.
Maskiert Auto fahren:
Zulässigkeit und Konsequenzen
Das Tragen von
medizinischen Masken, etwa FFP2- oder OP-Masken,
ist beim Autofahren unproblematisch. Anders
sieht es bei Verkleidungsmasken aus, die
wesentliche Teile des Gesichts verdecken.
Solche Maskierungen sind nur zulässig, wenn
sie weder die Sicht noch das Gehör
beeinträchtigen und keine vollständige
Verhüllung des Gesichts darstellen. Maßgeblich
ist hier § 23 Abs. 1 Satz 1 StVO. Auch die
Fahrtauglichkeit darf nicht eingeschränkt sein.
Kommt es durch Sicht- oder
Aufmerksamkeitsbeeinträchtigung zu einem Unfall,
droht ein Bußgeld von 60 Euro. Zudem gilt: Bei
Polizeikontrollen muss eine Maske zur
Identifikation abgenommen werden.
Mit
Maske geblitzt - was gilt?
Verdeckt eine
Verkleidungsmaske das Gesicht so stark, dass der
Fahrer auf dem Blitzerfoto nicht identifiziert
werden kann, dürfen die Behörden andere
Maßnahmen ergreifen. Dazu zählt insbesondere die
Anordnung eines Fahrtenbuchs für den
Fahrzeughalter, wenn die Fahrereigenschaft nicht
zweifelsfrei ermittelt werden kann.
Versicherungsschutz bei Unfällen -
Kfz-Haftpflichtversicherung:
Die
Haftpflichtversicherung übernimmt Schäden am
Fahrzeug des Unfallgegners in der Regel auch
dann, wenn der Fahrer barfuß, mit Flip-Flops
oder Maske gefahren ist. Allerdings kann die
Schadensfreiheitsklasse hochgestuft werden, mit
Folgen für die Beitragshöhe.
Kaskoversicherung:
Bei grober Fahrlässigkeit,
z. B. durch ungeeignetes Schuhwerk oder eine
verrutschte Maske, kann der Versicherer die
Leistung anteilig kürzen oder verweigern, sofern
der Schaden dadurch mitverursacht wurde.
ACV Fazit:
Auch wenn Flip-Flops, High Heels
oder freizügige Kleidung am Steuer nicht
grundsätzlich verboten sind: Wer ohne festen
Halt oder mit eingeschränkter Sicht fährt,
gefährdet sich und andere. Der ACV empfiehlt
deshalb: Beim Autofahren immer auf geeignetes
Schuhwerk und freie Sicht achten.
Touristen als leichte Beute: Teurer
Schein statt echtem Ticket
Ob
Eiffelturm, Sagrada Família oder Kolosseum –
Europas Sehenswürdigkeiten locken in der
Ferienzeit täglich tausende Menschen an. Das
wissen auch Trickser und nutzen genau das für
sich: Immer mehr Reisende landen bei der
Online-Suche nach Eintrittskarten auf Seiten,
die zwar kassieren, aber keine oder deutlich
teurere Tickets liefern – in manchen Fällen
sogar verbunden mit einem teuren Abo. Die
Urlaubsfreude ist dahin, das Geld oft auch.
Beim Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ)
Deutschland häufen sich die Beschwerden. Höchste
Zeit, die Masche dahinter aufzudecken.

Tickets für europäische Sehenswürdigkeiten?
Nicht jedes Ticket führt zum Ziel, denn beim
Onlinekauf lauern teure Fallen. (Bild:
KI-generiert)
Ein europaweites Phänomen
mit System
„Diese Betrugsmasche ist nicht
plump – sondern juristisch getarnt.
Genau das
macht sie so schwer angreifbar.“
- Alexander
Wahl, Jurist beim EVZ Deutschland
Viele
Reisende buchen Eintrittskarten heute ganz
selbstverständlich online. Was bequem klingt,
kann jedoch schnell zur Kostenfalle werden. Wer
nicht direkt beim offiziellen Anbieter kauft,
zahlt oft deutlich mehr – oder geht ganz leer
aus.
Trotzdem landen viele Verbraucher
bei dubiosen Drittanbietern: Mal sind offizielle
Kontingente ausverkauft, mal wirkt das
alternative Angebot schlicht bequemer. Häufig
merken Betroffene nicht einmal, dass sie gar
nicht auf der echten Website gelandet sind. Ein
Klick auf eines der obersten Google-Ergebnisse
genügt – schon befindet man sich auf einer
täuschend echt gestalteten Drittanbieterseite.
Denn was einigen Verbrauchern nicht
bewusst ist: Viele der ersten Treffer sind
bezahlte Anzeigen, die genau deshalb ganz oben
erscheinen – ohne vorherige Kontrolle. Dabei ist
die optische und namentliche Ähnlichkeit zur
gesuchten Seite definitiv kein Zufall: Sie soll
Suchende gezielt in die Irre führen. Leider mit
Erfolg.
Wer über solche Seiten Tickets
bestellt, spielt ungewollt Lotto: Manch
Betroffener erhält zwar Zugang – doch oft nur zu
überteuerten Preisen oder aber zu minderwertigen
Ersatzangeboten. Statt der gebuchten Tour gibt
es dann eine improvisierte Führung, teilweise
sogar abseits der eigentlichen Attraktion. Und
im schlimmsten Fall? Das gebuchte Ticket kommt
überhaupt nicht.
Von Funkstille bis
Fantasie-Termin
Wer auf diesen Seiten bucht,
erfährt oft erst viel später, dass es Probleme
gibt. Denn nach der Zahlung passiert
erstmal…nichts. Kein QR-Code, keine Bestätigung.
Viele hoffen dennoch, dass die Tickets noch
eintreffen – und stehen am Ausflugstag vor
verschlossenen Türen. Andere erhalten immerhin
eine Nachricht: Für den gebuchten Tag seien
leider keine Karten mehr verfügbar – das Geld
ist zu diesem Zeitpunkt aber längst abgebucht.
Als vermeintliches Entgegenkommen werden
Ersatztermine angeboten – meist Wochen oder gar
Monate später. Für die meisten Betroffenen
schlicht nutzlos. Wer daraufhin sein Geld
zurückfordert, bekommt sehr unterschiedliche
Reaktionen: Manchmal eine volle Erstattung,
häufiger aber nur 20 Prozent – und in vielen
Fällen sogar gar nichts.
Die Begründung: Für
Tickets zu festen Terminen gilt kein
Widerrufsrecht. Was juristisch korrekt klingt,
wird aber in diesem Fall zweckentfremdet.
„Diese Regel nutzen unseriöse Anbieter
gezielt“, sagt Alexander Wahl. Denn: „Wird ein
gebuchtes Ticket nicht geliefert, ist das kein
Rücktritt, sondern schlicht Vertragsbruch. Das
Widerrufsrecht hat damit nichts zu tun.“ Viele
Verbraucher lassen sich dennoch verunsichern –
schließlich stoßen sie bei der Onlinerecherche
ihrer Rechte auf genau diese Formulierung.
Ein Klick, ein Passwort – und ein Vertrag
Noch raffinierter ist die oft verknüpfte
Abo-Falle. Viele glauben, ihre Tickets seien im
Kundenkonto gespeichert, und registrieren sich
dort. Was sie nicht ahnen: Mit ihrer Anmeldung
schließen sie eine kostenpflichtige
Mitgliedschaft über knapp 80 Euro pro Quartal
ab. Getarnt wird das zum Beispiel als
„Line-Skip-Service“ – bevorzugter Einlass ohne
Warten. Doch Beschwerden beim EVZ zeigen: Selbst
wer diesen Service aktiv abwählt, bleibt nicht
verschont.
Sobald das Geld abgebucht ist,
wird es knifflig: Die dreitägige Probezeit
inklusive Widerrufsrechts ist dann längst
abgelaufen – und vielen fällt der Vertrag erst
auf, wenn die Abbuchung längst erfolgt ist. „Das
System ist ausgeklügelt“, sagt Wahl. „Die
Anbieter geben sich juristisch korrekt und
hoffen, dass sich verunsicherte Kunden nicht zur
Wehr setzen.“
Dabei ist auch diese
Masche rechtlich angreifbar: Wer nicht erkennt,
dass er ein Abo abschließt, kann dem auch nicht
wirksam zustimmen. „Ist der Bestell-Button nicht
klar als zahlungspflichtig gekennzeichnet, kommt
kein wirksamer Vertrag zustande“, erklärt der
Jurist. Das Problem: Das eigene Recht bei
Anbietern außerhalb Deutschlands durchzusetzen,
ist für Einzelpersonen ohne Unterstützung sehr
schwer.
Deshalb vor der Buchung prüfen:
Ist das die offizielle Seite?
Am besten
direkt auf der Website der Sehenswürdigkeit oder
über bekannte Tourismusportale buchen. Was lässt
sich an der URL und der Homepage ablesen?
Tippfehler, generische Namen oder fehlendes
Impressum sind Warnzeichen.
Was ist der
reguläre Eintrittspreis?
Starke Abweichungen
– nach oben oder unten – deuten auf unseriöse
Anbieter hin.
Wer echte Eindrücke sammeln
will, sollte auch beim Ticketkauf genau hinsehen
– sonst bleibt am Ende leider nicht die
Sehenswürdigkeit, sondern nur das Abo in
Erinnerung.
Schon reingefallen?
Wer
bereits Opfer dieser oder ähnlicher Maschen mit
Anbietern im EU-Ausland geworden ist, kann sich
an das Juristen-Team des Europäischen
Verbraucherzentrums (EVZ) Deutschland wenden –
die Beratung ist kostenlos und auf
grenzüberschreitende Fälle spezialisiert.
https://www.evz.de/einkaufen-internet/tickets/online-tickets-kaufen-faq.html

4,4 Millionen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer haben 2024 Mehrarbeit geleistet
• Mehrarbeit in der Finanz- und
Versicherungsbranche und der Energieversorgung
am weitesten verbreitet
• Knapp ein Fünftel
der Betroffenen leistet unbezahlte Überstunden
Für viele Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in Deutschland gehören Überstunden
zum Arbeitsalltag: Knapp 4,4 Millionen von ihnen
haben im Jahr 2024 durchschnittlich mehr
gearbeitet, als in ihrem Arbeitsvertrag
vereinbart war. Das entsprach einem Anteil von
11 % der insgesamt 39,1 Millionen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.
Dabei leisteten Männer mit einem Anteil von 13 %
etwas häufiger Mehrarbeit als Frauen (10 %).
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der
Finanz- und Versicherungsbranche und der
Energieversorgung leisten am häufigsten
Mehrarbeit
Deutliche Unterschiede zeigten
sich mit Blick auf die einzelnen
Wirtschaftsbereiche. Am weitesten verbreitet war
Mehrarbeit in den Bereichen Finanz- und
Versicherungsleistungen und Energieversorgung,
wo 17 % beziehungsweise 16 % der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon
betroffen waren.
Am niedrigsten war der
Anteil mit 6 % im Gastgewerbe, gefolgt von der
Erbringung sonstiger wirtschaftlicher
Dienstleistungen wie etwa Wach- und
Sicherheitsdienstleistungen oder
Reinigungsdienstleistungen (8 %). 15 % der
Betroffenen mit mindestens 15 Stunden Mehrarbeit
pro Woche Für die meisten Beschäftigten war der
Umfang der Mehrarbeit auf wenige Stunden pro
Woche begrenzt. 45 % gaben an, durchschnittlich
weniger als fünf Überstunden geleistet zu haben.
Bei insgesamt 73 % waren es weniger als
zehn Stunden. Allerdings leisteten 15 % der
Betroffenen mindestens 15 Stunden Mehrarbeit in
der Woche. Bei einem Großteil fließt die
Mehrarbeit in ein Arbeitszeitkonto ein
Mehrarbeit kann in Form von bezahlten und
unbezahlten Überstunden geleistet werden oder
auf ein Arbeitszeitkonto einfließen, über das
sie später wieder ausgeglichen werden kann.
Von den Personen, die 2024 mehr gearbeitet
hatten als vertraglich vereinbart, leistete
knapp jede oder jeder Fünfte (19 %) unbezahlte
Überstunden. 16 % wurden für ihre Überstunden
bezahlt. 71 % nutzten ein Arbeitszeitkonto für
die geleistete Mehrarbeit. Mehrarbeit wurde
teilweise über eine Kombination der drei Formen
geleistet.
Straßenverkehrsunfälle im Mai 2025: 4 % mehr
Verletzte als im Vorjahresmonat
Zahl der
Getöteten und der Unfälle mit Personenschaden
ebenfalls gestiegen
Im Mai 2025
sind in Deutschland 37 400 Menschen bei
Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach
vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 4 %
oder 1 600 Verletzte mehr als im Vorjahresmonat.
Die Zahl der Verkehrstoten stieg
ebenfalls an: 255 Menschen kamen im Mai 2025 bei
Straßenverkehrsunfällen ums Leben, das waren 14
Tote mehr als im Vorjahresmonat. Auch die Zahl
der Unfälle nahm zu: Bei Unfällen mit
Personenschaden um 1 500 auf 30 300 (+5 %) und
bei Unfällen, bei denen es bei Sachschaden
blieb, um 5 400 auf 195 400 (+3 %).
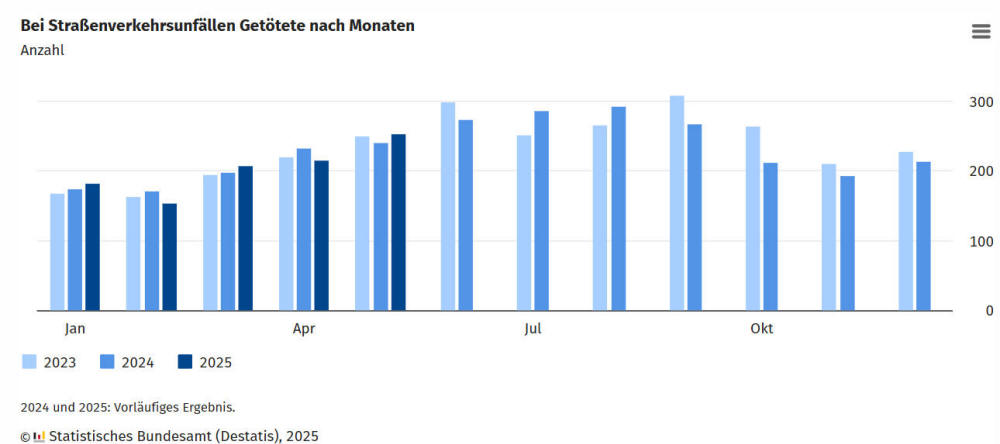
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025
erfasste die Polizei insgesamt gut eine Million
Straßenverkehrsunfälle. Das waren in etwa so
viele wie im Vorjahreszeitraum. Darunter waren
110 400 Unfälle mit Personenschaden (+1 % oder
+1 500), bei denen 1 018 Menschen getötet
wurden. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwa gleich
geblieben. Die Zahl der Verletzten im
Straßenverkehr stieg in diesem Zeitraum um 1 000
oder 1 %.
|