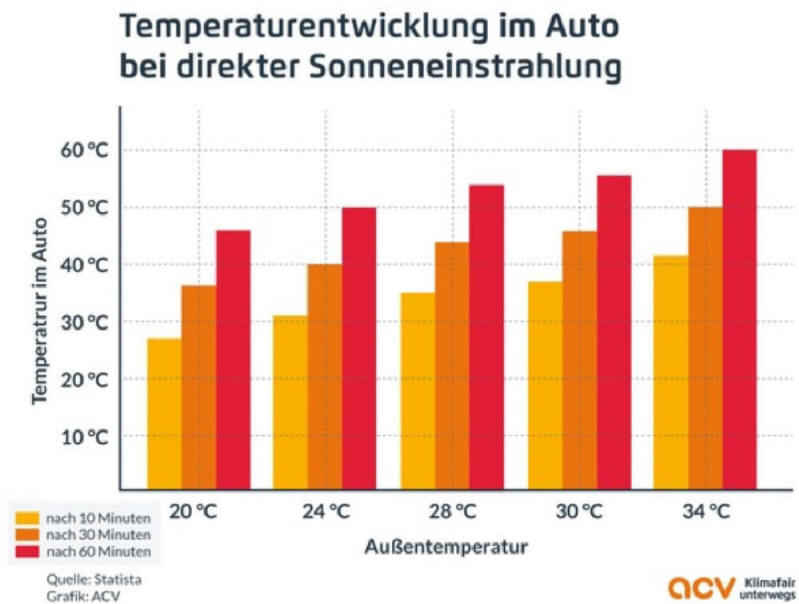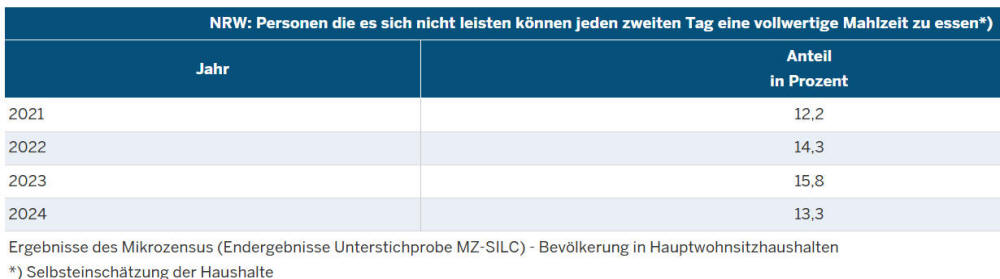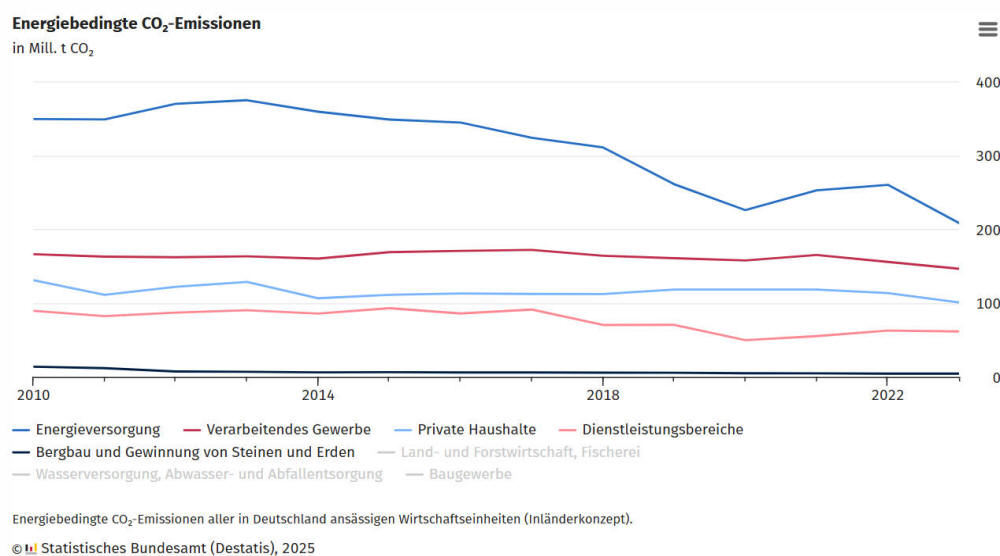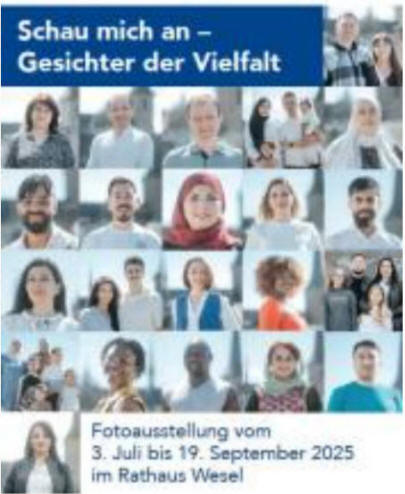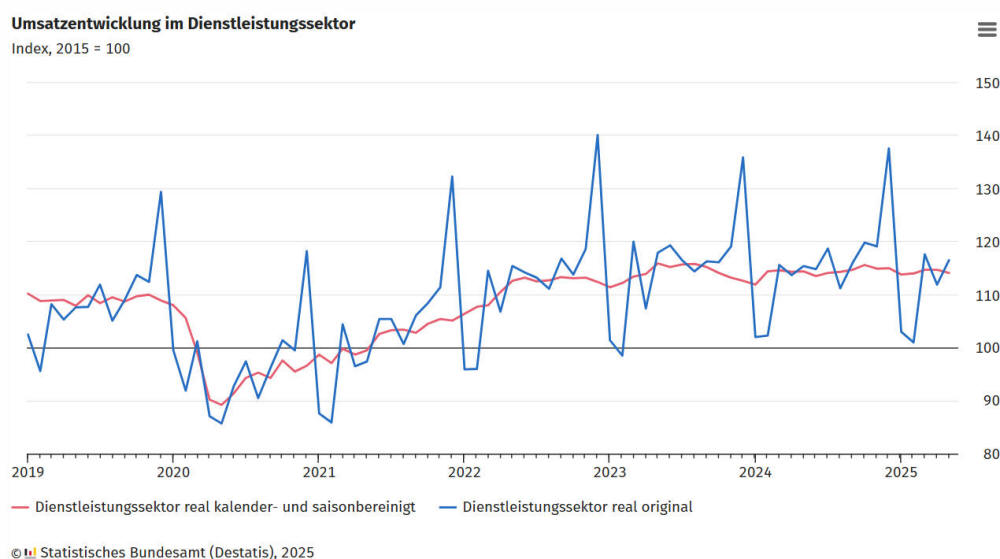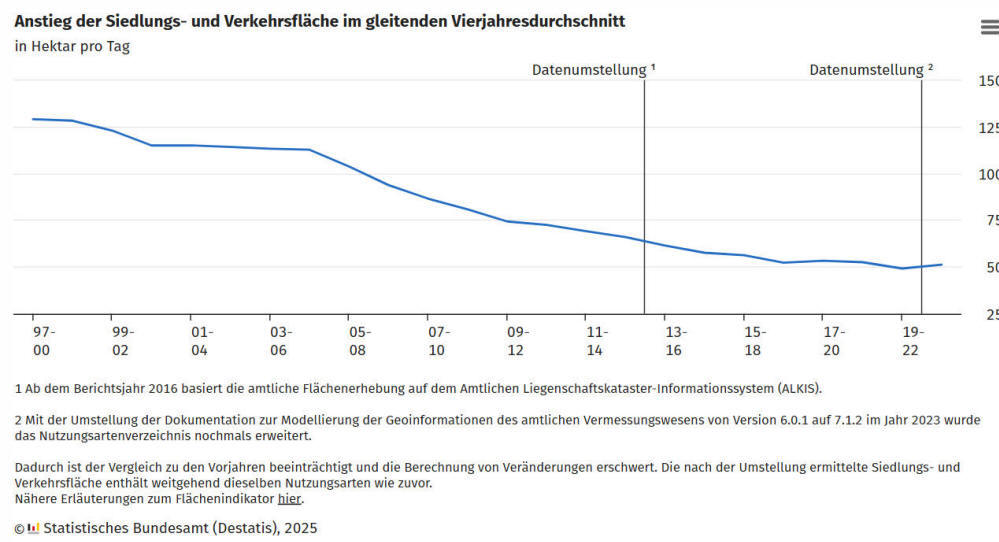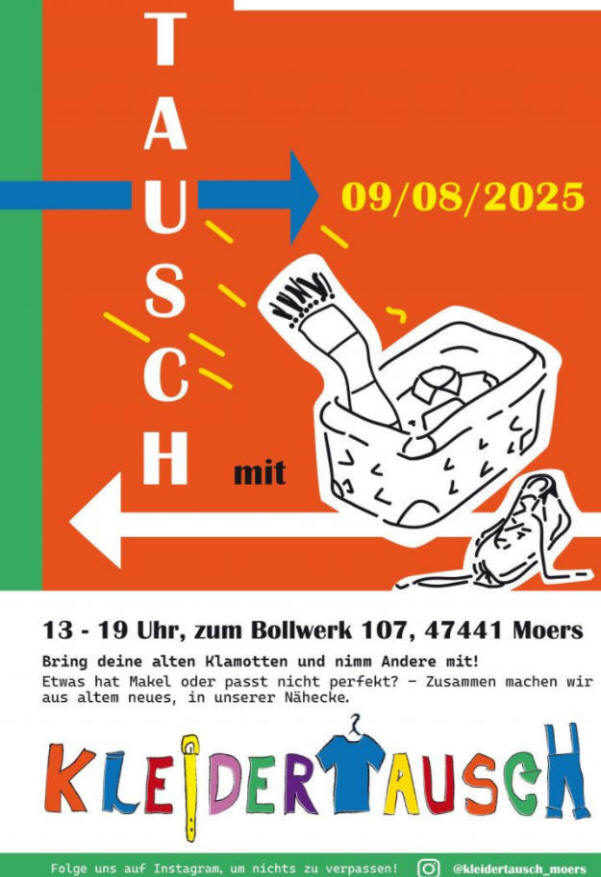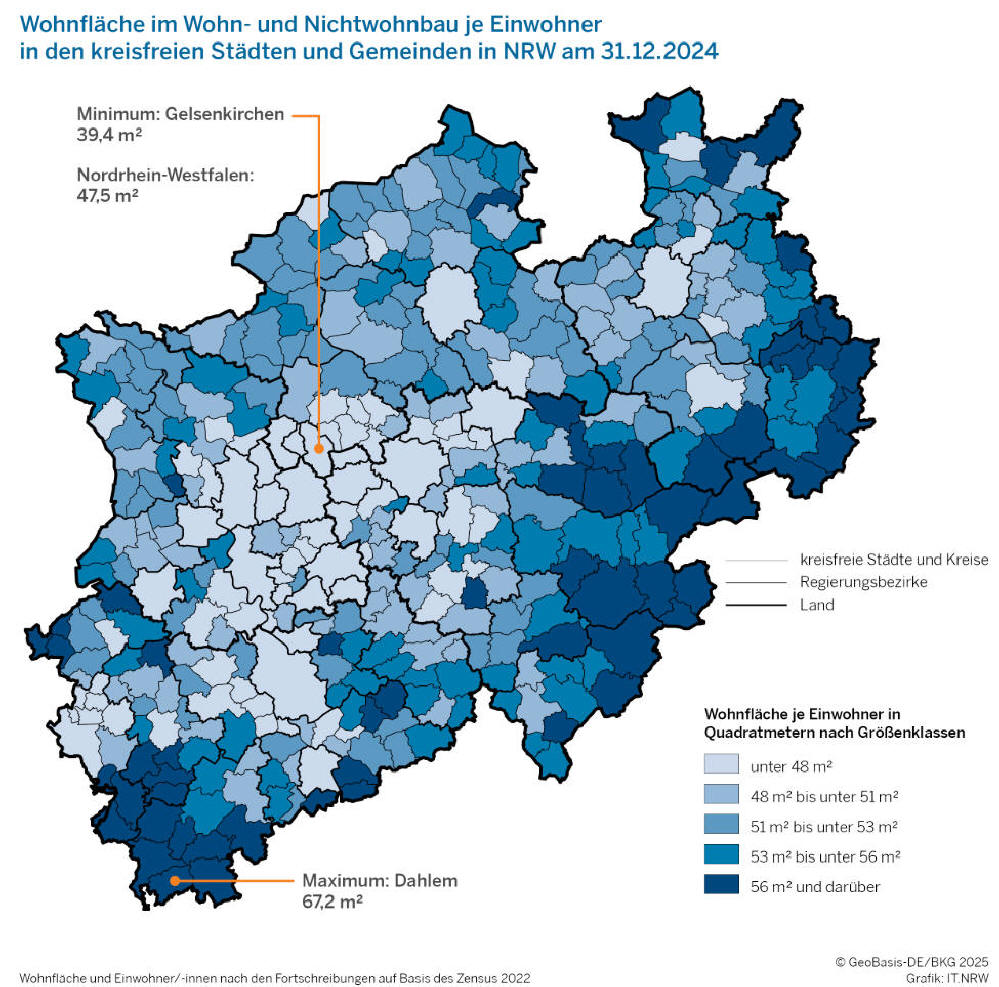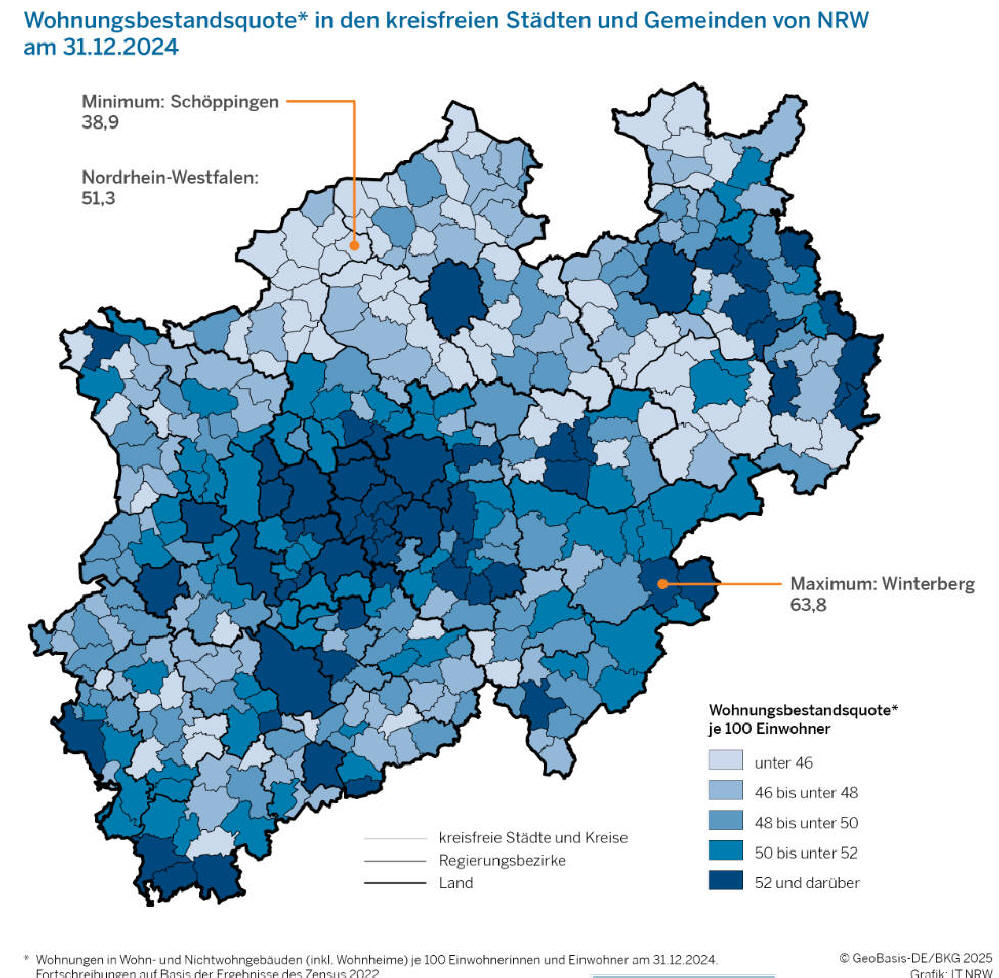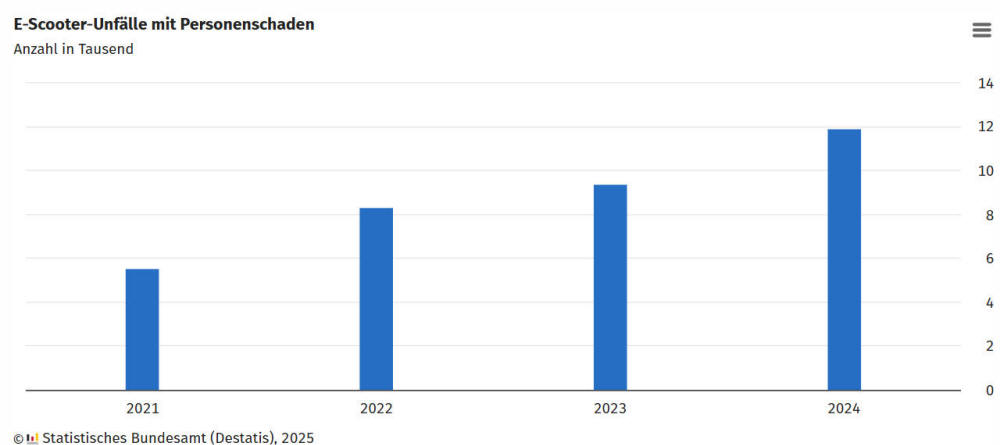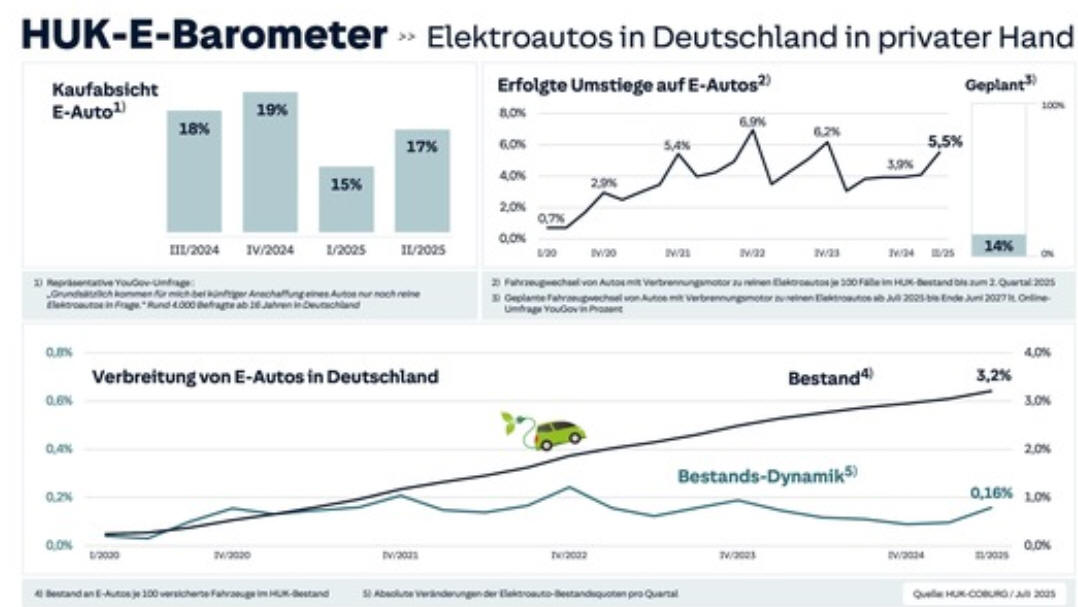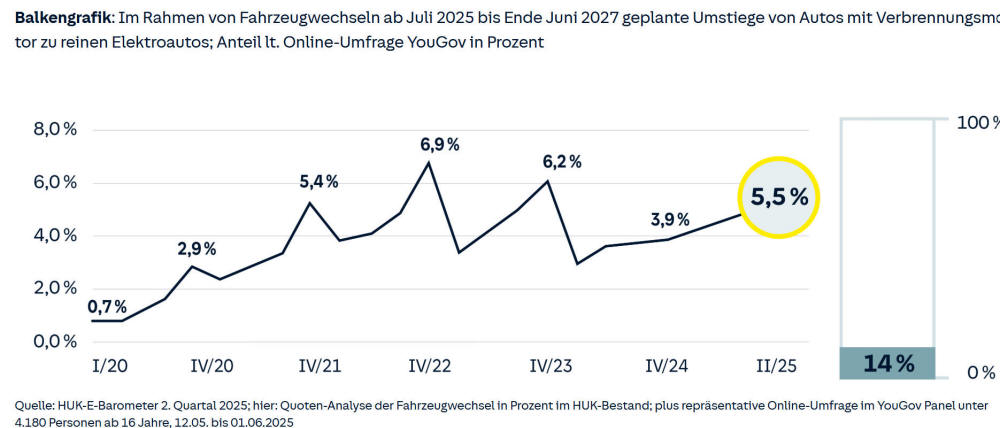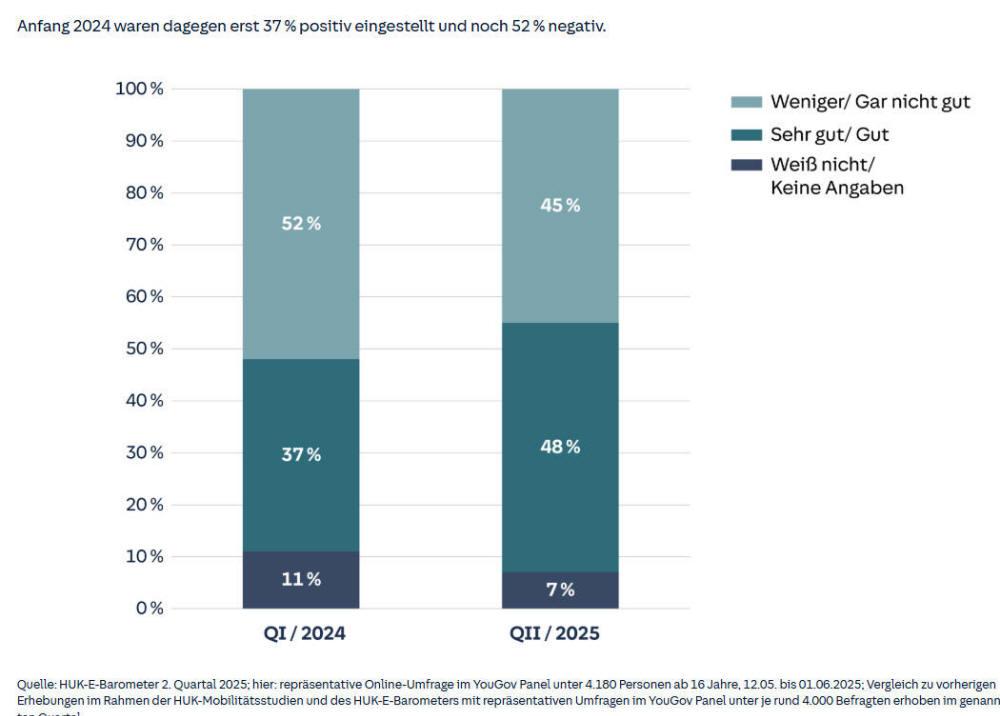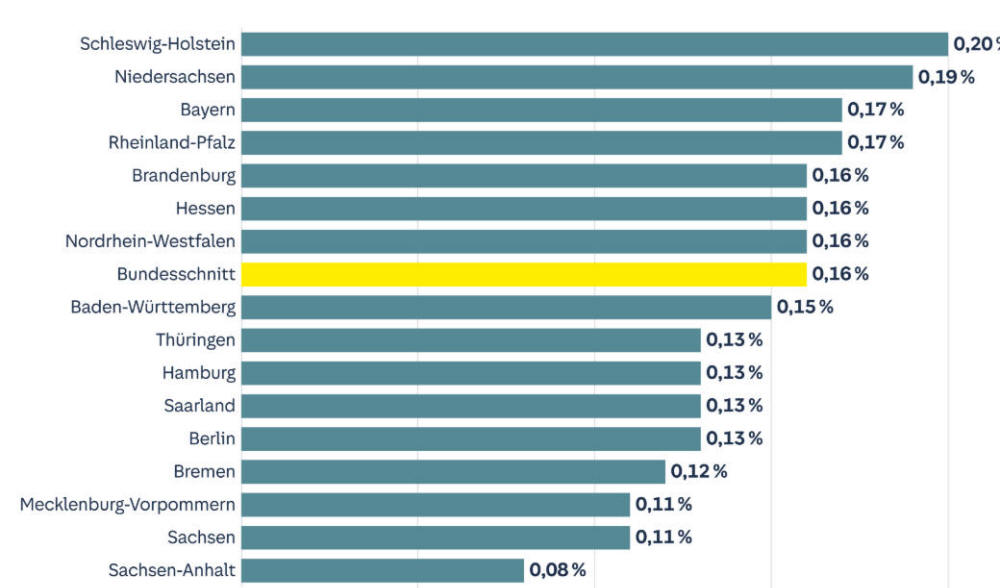|
KW 32:
Montag, 4. - Sonntag, 10. August 2025
Themen u.a.:
Schöner ankommen in NRW – Sanierung des
Dinslakener Bahnhofsgebäudes: Planungsphase
nimmt Fahrt auf
Die
Vorbereitungen zur Entwicklung des Dinslakener
Bahnhofs schreiten voran. Am 24. Juli 2025
trafen sich Bürgermeisterin Michaela Eislöffel
und ein Team der Stadtentwicklung mit
Vertreterinnen und Vertretern der Deutschen
Bahn, von BEG / NRW.Urban sowie dem beauftragten
Architekturbüro „PRAGLOWSKI ARCHITEKTEN“ aus
Aachen zu einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin.

v. links: Lukas Suter, Axel Praglowski (beide
Praglowski Architekten), Jens Thieme (Deutsche
Bahn), Carsten Kirchhoff (NRW.URBAN),
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel, Jana
Wandiger, Alexandro Hugenberg (beide
Stadtentwicklung Dinslaken)
Im Rahmen
der umfassenden Begehung des Empfangsgebäudes
wurde eine Bestandsaufnahme der baulichen
Substanz vorgenommen. Zudem wurden zentrale
Anforderungen und Perspektiven aller
Projektpartner erläutert und abgestimmt. Diese
Erkenntnisse bilden nun die Grundlage für die
weitere planerische Ausarbeitung.
Auf
Basis der Bestandsaufnahme wird das Aachener
Architekturbüro die Planungen vertiefen und
einen konkreten Entwurf zur Ertüchtigung und
gestalterischen Aufwertung des Gebäudes
erarbeiten. Ziel ist ein zeitgemäßer,
funktionaler und städtebaulich überzeugender
Bahnhof, der sowohl den Anforderungen des
Verkehrs als auch den Erwartungen der
Bürgerinnen und Bürger gerecht wird. Für die
Stadt Dinslaken entstehen in der aktuellen
Planungsphase keine Kosten. Erst bei der
baulichen Umsetzung wird eine finanzielle
Beteiligung erforderlich.
Durch die
Aufnahme in das Programm „Schöner ankommen in
NRW“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales,
Bauen und Digitalisierung (MHKBD) des Landes NRW
und der DB InfraGO sind die Grundlagen für eine
finanzielle Unterstützung gelegt, wenn das
genehmigte Haushaltssicherungskonzept der Stadt
vorliegt.
Bürgermeisterin Michaela
Eislöffel hatte die entsprechende
Willensbekundung zur Aufnahme in das Programm
bereits Anfang 2023 unterzeichnet. Das Programm
ermöglicht Kommunen den Einsatz von
Städtebaufördermitteln und eigenem Engagement
bei der Sanierung und Nutzung der
Empfangsgebäude der DB InfraGO AG.
„Der
heutige Vor-Ort-Termin ist ein bedeutender
Schritt auf dem Weg zur Sanierung unseres
Empfangsgebäudes“, betont Bürgermeisterin
Michaela Eislöffel. „Nach der grundsätzlichen
Einigung mit der Deutschen Bahn und der Aufnahme
in das Förderprogramm kommen wir nun in die
konkrete Planungsarbeit. Dieses Gebäude prägt
unser Stadtbild und verdient unsere volle
Aufmerksamkeit.
Wir nutzen die aktuelle
Förderchance konsequent, um die Sanierung
planmäßig und zielgerichtet voranzutreiben. Der
Bahnhof hat eine hohe Bedeutung für Pendlerinnen
und Pendler, für Gäste und für alle
Dinslakenerinnen und Dinslakener. Auch in Zeiten
der Haushaltskonsolidierung setzen wir gezielt
auf Investitionen, die unsere Stadt zukunftsfest
machen.“
„Neu gestalten kann man nur
Zusammen“ – dieser Gedanke prägt auch das
Bahnhofsvorhaben, das im engen Schulterschluss
mit Land, Bahn, Architekturbüro, Verwaltung und
Stadtgesellschaft voranschreitet. Die
Bahnflächenentwicklungsgesellschft NRW (BEG NRW)
als gemeinsame Tochtergesellschaft des Landes
NRW und der DB InfraGO steuert das Programm und
hat vor der jetzigen konkreten Planung gemeinsam
mit der Stadt Dinslaken und der DB einen ersten
Workshopprozess durchgeführt, in dessen Rahmen
ein denkmalgerechtes Sanierungs- und
Nutzungskonzept erarbeitet wurde.
Das
von den Partnern gemeinsam entwickelte Konzept
wurde im Zuge einer Förderkonferenz von MHKBD,
Bezirksregierung Düsseldorf und VRR erörtert und
als Grundlage der weiteren Schritte
einvernehmlich festgelegt. In der
Förderkonferenz erfolgte zudem die Freigabe der
Beauftragung der Entwurfsplanung von Architekten
und Fachplanern einschließlich umfassender
Bestandsaufnahme über die BEG.
Die
Kosten der ersten Planungsphase mit
Entwurfsplanung tragen die Städtebauförderung
des Landes NRW und die DB InfraGO zu je 50
Prozent. Bereits kurz nach ihrem Amtsantritt
hatte Bürgermeisterin Eislöffel gemeinsam mit
der Bundestagsabgeordneten und ehemaligen
Bürgermeisterin Sabine Weiss, dem
Landtagsabgeordneten Stefan Zimkeit sowie
Mitarbeitenden der Stadtverwaltung das Gespräch
mit der Deutschen Bahn gesucht, um die Situation
am Bahnhof grundlegend zu verbessern.
Bei einer Fördergeberkonferenz im vergangenen
Jahr wurden wichtige Weichen gestellt, um einen
entsprechenden Förderantrag auf den Weg zu
bringen. Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz
und Verkehr des Landes NRW sowie die
Bezirksregierung Düsseldorf unterstützen das
Projekt.
Seitdem haben die beteiligten
Partner ein Grobkonzept erarbeitet und die
Planung weiter konkretisiert. Mit der
Beauftragung des Architekturbüros „PRAGLOWSKI
ARCHITEKTEN“ durch die
Bahnflächenentwicklungsgesellschaft ist ein
weiterer wichtiger Meilenstein erreicht.
Das Architekturbüro erläutert: „Mit der
behutsamen Sanierung des Empfangsgebäudes in
Dinslaken schreiben wir dessen eindrucksvolle
Historie weiter: Vom monumentalen Rundbogenbau
um 1915 über den Kontrapunkt der
Nachkriegsmoderne – erhaltene Bausubstanz
erzählt von der vielseitigen Wandlung. Wir
verbinden diesen reichen Bestand mit einer
modernen Architektur, die dem Stadtbild gerecht
wird und zugleich gestalterische Akzente setzt.“
Die Stadt Dinslaken begleitet das
Projekt mit großer Zuversicht und hohem
Engagement für einen Bahnhof, der seiner Rolle
als Tor zur Stadt gerecht wird und als moderner
Mobilitätsknoten überzeugt. Die Entwurfsplanung
soll im Frühsommer 2026 vorliegen und wird dann
Grundlage der weiteren Finanzierungs- und
Förderabstimmungen zwischen Stadt, Kreis, DB,
Städtebau- und Verkehrsförderung zur
Realisierung der Sanierung und Wiedernutzung des
Gebäudes.
Dinslaken: Wasserspiele wieder in
Betrieb
In der Duisburger
Straße gibt es ab sofort wieder eine willkommene
Abkühlung an heißen Tagen. Nachdem die
Ablaufleitungen erneut gespült wurden, sprudeln
die Wasserspiele von nun an wieder täglich in
der Innenstadt.
Mit neuen Gittern über
den Abläufen sollen die Wasserspiele künftig vor
Verschmutzungen und Vandalismus geschützt
werden. So können die Wasserspiele in der
Duisburger Straße wieder ohne
Überschwemmungsgefahr die Fußgänger*innen
erfrischen.
Wirtschaftsfaktor Tourismus: Mona Neubaur am
Niederrhein
Die NRW-Ministerin
hat den LVR-Archäologischen Park Xanten mit
Römermuseum (APX) und das Freizeitzentrum Xanten
(FZX) mit der Xantener Nord- und Südsee besucht.
„Die Region eignet sich nicht nur für einen
Kurzurlaub – man kann hier wunderbare Wochen
verbringen.“ Mit diesen Worten hat Mona Neubaur,
stv. Ministerpräsidentin des Landes NRW sowie
Ministerin für Wirtschaft, Industrie,
Klimaschutz und Energie, das Reiseziel
Niederrhein gewürdigt.
Im Rahmen ihrer
„Touristischen Sommerreise“ durch NRW machte
Neubaur, deren Ressort auch den Tourismus
umfasst, Station in Xanten im Kreis Wesel. Hier
nutzte sie die Gelegenheit, um bei zwei
touristischen Highlights des Niederrheins „auch
einmal hinter die Kulissen zu blicken“. Auf dem
Besuchsprogramm standen der LVR-Archäologische
Park Xanten mit Römermuseum (APX) und das
Freizeitzentrum Xanten (FZX) mit der Xantener
Nord- und Südsee.
Nach einer kurzen
Begrüßung der Ministerin durch Ingo Brohl,
Landrat des Kreises Wesel und
Aufsichtsratsvorsitzender der Niederrhein
Tourismus GmbH, ging es mit der neuen
elektrischen Wegebahn „APXpress“, die leise
schnurrend für Barrierefreiheit auf dem
weitläufigen Gelände sorgt, durch den Park.
Angesteuert wurden unter anderem die
Handwerkerhäuser und der Hafentempel.
Auch das wichtigste Projekt des APX war Thema:
eine Ausstellungshalle an der nahen Xantener
Südsee, in der nachgebaute römische Schiffe aus
der inklusiven Werft des Parks dauerhaft
ausgestellt werden sollen. „Der LVR möchte so
langfristig einen zentralen Dreh- und Angelpunkt
für die Vermittlung des UNESCO-Welterbes
Niedergermanischer Limes einrichten, der als
wichtige touristische Triebfeder gilt“, so Dr.
Peter Kienzle, Leiter Bauforschung am APX. Auch
Publikumsausflüge mit nachgebauten römischen
Booten sind geplant. Die enorme Nachfrage bei
Probefahrten im Sommer 2024 hat das hohe
Potenzial solcher Limes-Erlebnisse gezeigt.
Wasser hat immer eine hohe Anziehungskraft.
Das wurde auch bei der zweiten Station deutlich.
Im FZX schipperte die Besuchergruppe entspannt
mit der Elektro-Barkasse „Style-e“ über die
Südsee. Anschließend ging es auch noch durch den
Kanal zur Nordsee. Dabei erläuterte FZX-Leiter
Ludwig Ingenlath das Erfolgsrezept der
Freizeitanlage, in der nicht nur junge Familien
auf ihre Kosten kommen. Auch der
Gesundheitstourismus spielt inzwischen eine
zentrale Rolle: Das barrierefreie Angebot
umfasst verschiedene Stationen wie
„Wasseranwendung“, „Bewegung am Wasser“ oder
„Ernährung“.
„Xanten, mit der starken und
kooperativen Entwicklung von touristischen
Schwergewichten wie APX, FZX und einer
lebendigen, historischen Innenstadt mit Xantener
Dom und Kurpark sowie beeindruckender Natur- und
Kulturlandschaft, steht stellvertretend für die
hohe Attraktivität des Niederrheins insgesamt“,
so Landrat Brohl.
„Xanten und der Kreis
Wesel zeigen schon jetzt vorbildlich, wie hohe
Lebensqualität und touristische Attraktivität
Hand in Hand gehen. Dies gilt es
weiterzuentwickeln. Wer unsere Region zum ersten
Mal besucht, ist von ihrer Vielfalt und
Schönheit begeistert und kommt gerne wieder.“
Damit ist Tourismus auch „ein
substanzieller Wirtschaftsfaktor“, wie Mona
Neubaur betonte. Er generiert Wachstum, sichert
Einkommen und schafft Arbeitsplätze.

Ministerin Mona Neubaur (3.v.r.) wurde im
Xantener APX von Landrat Ingo Brohl (4.v.r.)
begrüßt. Mit auf dem Foto (v.l.): Nina Jörgens,
Prokuristin von Niederrhein Tourismus, Dr.
Constantin Kappe, APX-Projektleiter Ausstellung
Welterbe und Schifffahrt, Dr. Heike Döll-König,
Geschäftsführerin von Tourismus NRW, Thomas
Görtz, Bürgermeister der Stadt Xanten, Guido
Kohlenbach, Fachbereichsleiter Regionale
Kulturarbeit des LVR, Dr. Peter Kienzle, Leiter
Bauforschung am APX, und Lukas Hähnel, Leiter
der EntwicklungsAgentur Wirtschaft (EAW, Kreis
Wesel). Foto: NT
Kreis Wesel bildet aus – jetzt bewerben!
Einen umfassenden Überblick der vielfältigen
Aufgaben einer öffentlichen Verwaltung erhalten
– das bietet die Kreisverwaltung jungen
Menschen, die eine Ausbildung im Kreishaus
beginnen. Ab sofort können sich Interessierte
auf die verschiedenen Ausbildungsplätze beim
Kreis Wesel bewerben.
„Als einer der
größten regionalen Arbeitgeber ist es uns
wichtig, eine abwechslungsreiche und praxisnahe
Ausbildung zu garantieren“, sagt Sandra
Postulka, Bereichsleitung des Vorstandsbereichs
1. „Wir bereiten die jungen Talente auf eine
langfristige Karriere als Fachkräfte in der
Verwaltung vor. Davon profitieren die
Auszubildenden genauso wie die Kreisverwaltung.
Die Chance auf eine Übernahme nach bestandener
Prüfung ist sehr gut.“
Derzeit werden
rund 75 Auszubildende durch über 130 geschulte
Mitarbeitende qualifiziert ausgebildet und
professionell auf den Berufseinstieg in die
verschiedensten Bereiche der Verwaltung
vorbereitet.
In folgenden Berufen bildet
die Kreisverwaltung Wesel aus:
-
Inspektoranwärterin und Inspektoranwärter
(duales Studium - kommunaler Verwaltungsdienst)
- Bachelorstudium Verwaltungsinformatik an
der Hochschule Rhein-Waal
-
Verwaltungsfachangestellte
-
Vermessungstechnikerin und Vermessungstechniker
- Straßenwärterin und Straßenwärter
-
Fachinformatiker Systemintegration
Weitere
Informationen zum Ablauf des Bewerbungsprozesses
gibt es unter https://www.kreis-wesel.de/ausbildung
Kleve: Kunstausstellung „Diamant Painting“
Fr., 08.08.2025 - 00:00 - Do., 04.09.2025 -
00:00 Uhr
Tausende kleine Perlen Zauber. In
allen Farben, zieren sie noch bis zum 4.
September 2025 die Ausstellungswände im Café
Samocca an der Hagschen Str. 71 in Kleve.
Die arbeitsbegleitende Maßnahme „Kreatives
Gestalten“ der Haus Freudenberg GmbH am Standort
in Goch unter der Leitung von Renate
Kersten-Böhm macht mit „Diamant Painting“ und
einigen Collagen die Welt ein bisschen bunter.
Impulse für Wirtschaft? Fehlanzeige!“ 100
Tage Bundesregierung.
IHK: Reformen fehlen
Die Stimmung der Betriebe am
Niederrhein hat sich abkühlt. Bei ihrem Start
hatte die neue Bundesregierung Hoffnung in der
Wirtschaft hervorgerufen. Doch die Maßnahmen
reichen nicht für eine Trendwende. Das zeigt
eine Umfrage der Niederrheinischen IHK.
IHK-Präsident Werner Schaurte-Küppers
fordert, die Wirtschaft mehr zu entlasten: „Die
Regierung hat mit ihrer Wachstumsoffensive Mut
gemacht. Nach den ersten hundert Tagen im Amt
macht sich Katerstimmung breit. Auf dem Zeugnis
steht eine Drei Minus.

Foto Niederrheinische IHK/Michael Neuhaus
Da ist Luft nach oben. Die Lösungen liegen
auf dem Tisch: Die Körperschaftssteuer sollte
schon jetzt sinken – nicht erst ab 2028. Der
Soli für Unternehmen muss weg und die
Stromsteuer für alle Betriebe runter.
Investieren wird leichter, wenn der Staat
digitaler und schlanker wird. Doch von
grundlegenden Reformen sehen wir bislang
nichts.“
Bürokratie-Monster
Tariftreuegesetz Bürokratie ist das Top-Risiko
der Wirtschaft. Mit dem Tariftreuegesetz plant
die Bundesregierung eine weitere Regulierung.
Öffentliche Aufträge sollen nur noch an
Unternehmen gehen, die ihre Beschäftigten nach
Tarif bezahlen. Auch NRW plant wieder ein
Tariftreuegesetz einführen.
„Was gut
klingt, ist für viele Betriebe kontraproduktiv.
Das hatten wir schon in NRW. Solche Gesetze
erhöhen die Tarifbindung nicht, sondern
schrecken kleine Unternehmen von öffentlichen
Ausschreibungen ab. Konsequenz: Weniger Angebote
und höhere Preise für den Staat. Die Zeche zahlt
der Steuerzahler. Das ist kein Vorbild für den
Bund. Mit neuen Bürokratie-Monstern kommen wir
nicht aus der Rezession“, so Schaurte-Küppers.
Kommunalwahl und Integrationsratswahl in
Kleve: Wahlbenachrichtigungen werden verschickt
Ab dem Wochenende werden die
Wahlbenachrichtigungen zur Kommunalwahl und
Integrationsratswahl am 14. September 2025 an
Kleverinnen und Klever verschickt. Mehr als
42.750 Personen im Klever Stadtgebiet sind Mitte
September dazu aufgerufen, an der Wahl zum
Bürgermeister, Stadtrat und Kreistag
teilzunehmen. Außerdem sind rund 18.000 Menschen
in Kleve für die Wahl des Integrationsrates
berechtigt.

Wahlräume
Das Wahlgebiet der Stadt Kleve
wurde im Vergleich zu den zuletzt durchgeführten
Wahlen wieder kleinteiliger in deutlich mehr
Stimmbezirke mit zum Teil neuen Wahlräumen
aufgeteilt. Alle Wahlberechtigten werden daher
gebeten, sich die Angaben zu ihrem Wahlraum, die
wie gewohnt auf der Wahlbenachrichtigung genannt
sind, anzuschauen.
Briefwahl
Ab
Dienstag, 12. August 2025, beginnt das
Briefwahlgeschäft in Kleve.
Die
Wahlberechtigten können sowohl
- per QR-Code,
der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung
aufgedruckt ist,
- per Online-Formular, das
auf der Homepage der Stadt Kleve unter
www.kleve.de vorgehalten wird,
- per
schriftlichem Wahlscheinantrag, der ebenfalls
auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung
aufgedruckt ist
- per E-Mail oder Telefax
oder schriftlich
einen Antrag auf
Briefwahl stellen. Der Antrag muss den
Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsdatum
und die Wohnanschrift enthalten. Eine
fernmündliche Antragstellung ist unzulässig.
Zudem besteht die Möglichkeit, im Rathaus
die Briefdirektwahl vorzunehmen. Die
Öffnungszeiten der Briefdirektwahlbüros finden
die Wahlberechtigten auf der Vorderseite der
Wahlbenachrichtigung. Die Briefdirektwahlbüros
befinden sich in der 1. Etage im Sitzungszimmer
1.29 und sind sowohl über die Haupttreppe als
auch den Aufzug zu erreichen.
Bei Fragen
können sich Kleverinnen und Klever gerne an die
Mitarbeiter des Wahlamtes unter den
Telefonnummern 84-200, 84-210 und 84-555 wenden.
Zudem stellt die Stadt Kleve viele Informationen
rund um die anstehenden Wahlen auf
www.kleve.de/wahl bereit.
Neue
Helge Schneider-Doku zum 70. Geburtstag
Helge Schneider-Fans fiebern einer neuen
Dokumentation über den Mülheimer
Allround-Künstler entgegen - und ganz bald hat
das Warten ein Ende: Ab dem 19. August ist
"Helge Schneider - The Klimperclown" in der ARD
Mediathek zu sehen, am 20. August um 22:50 Uhr
live im Ersten. Einer der vielseitigsten
deutschen Künstler blickt dabei anlässlich
seines 70. Geburtstags am 30. August auf sein
Leben zurück. Helge Schneider porträtiert sich
dabei selbst.
Mit Originalaufnahmen,
Sketchen und Musikclips und ganz ohne Kommentare
Dritter entsteht ein Film geprägt von absurdem
Humor, Musik und ehrlicher Einblicke in seine
vielseitige Karriere. Der Film spielt mit
Elementen der klassischen Doku und changiert
gekonnt zwischen Wahrheit und Fiktion.
Gemeinsam mit seinem Gitarristen und
langjährigen Partner Sandro Giampietro verbindet
der Mülheimer Originalaufnahmen auf Super 8 und
VHS mit Spielszenen, Musikclips und
Live-Mitschnitten zu einem facettenreichen Bild.
idr - Weitere Informationen unter:
https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldung-helge-schneider-100.html
Kleve: Kanalarbeiten im Fahrbahnbereich mit
Vollsperrung der Meißnerstraße ab Montag, 11.
August 2025
Ab Montag, 11.
August 2025, werden auf der Meißnerstraße in
Kleve neue Schmutz- und Regenwasserkanäle in dem
dortigen Stichweg verlegt. Zur Durchführung der
notwendigen Tiefbauarbeiten ist die Vollsperrung
der Meißnerstraße an der Einmündung zum dort
gelegenen Stichweg erforderlich. Eine Durchfahrt
über die Meißnerstraße von der Kalkarer Straße
bis zur Pannofenstraße und umgekehrt ist dann
nicht mehr möglich.

Aus Richtung Pannofenstraße und aus Richtung
Kalkarer Straße kann im Anliegerverkehr zwar
jeweils bis an die Baustelle herangefahren
werden, es besteht jedoch keine
Wendemöglichkeit. Von der Kalkarer Straße aus
bleibt die Einfahrt in den Stichweg während der
Bauarbeiten möglich. Hierüber wird auch die
Erreichbarkeit der dort befindlichen Häuser für
den Rettungsdienst und die Feuerwehr
gewährleistet.
Umleitungen für den
Straßenverkehr werden über die Kalkarer Straße
und die Pannofenstraße eingerichtet.
Voraussichtlich dauern die Bauarbeiten bis zum
Winter an.
Moers:
Hitzeschlacht beim Badewannenrennen erwartet
Saisonhighlight im Naturfreibad mit
After-Race-Party
Die
Badewannen stehen in den „Startlöchern“: Am
Samstag, 16. August, steigt im Naturfreibad
Bettenkamper Meer das wohl heißeste
Sommerhighlight der Saison. Denn für die 16.
Auflage des legendären Badewannenrennens
prognostizieren Wetterexperten Sonne satt bei
hochsommerlichen Temperaturen – perfekte
Bedingungen für einen Nachmittag voller Spaß,
Kreativität und Wasseraction.
Los geht
es um 14 Uhr bei freiem Eintritt. „Die Flotten
Ottos“, „Die Ente bleibt draußen“, „Die miesen
Miesmuscheln“ oder „Die flinken Wasserflöhe“ –
30 Teams haben sich aktuell bereits für den
besonderen sportlichen Wannenspaß angemeldet und
schon bei der Namenswahl ihre Kreativität
bewiesen. Der jüngste Teilnehmer ist gerade
einmal acht, der älteste 71 Jahre alt.
Die Teilnahme ist unkompliziert, schwimmen muss
man können – und möglichst originell verkleidet
sein. Denn neben sportlichem Ehrgeiz zählt vor
allem der olympische Gedanke und natürlich der
Spaßfaktor. Wer noch mitmachen möchte: Ein paar
letzte Startplätze sind noch frei. Um sie zu
belegen, müssen sich interessierte Hobbypaddler
allerdings schnellstmöglich per Mai an
badewanne@moers.dlrg.de melden.
Gepaddelt wird im K.-o.-System auf einer Distanz
von rund 100 Metern – solange, bis ein
Siegerteam feststeht. Für die schnellsten Teams
und kreativsten Kostüme winken wieder attraktive
Preise: Für das schönste Kostüm gibt es auf
Einladung der Bundestagsabgeordneten Kerstin
Radomski eine Reise nach Berlin, die schnellsten
Paddler erhalten Tickets für das Comedy
Arts-Festival.
Im Anschluss an das
Rennen startet gegen 18 Uhr die After-Race-Party
mit DJ Altan, der für Stimmung bis 22 Uhr sorgt.
Auch für kühle Drinks und leckere Snacks ist
gesorgt – beste Voraussetzungen also für einen
unvergesslichen Sommerabend im Naturfreibad
Bettenkamper Meer.
Da das Event
erfahrungsgemäß viele Besucherinnen und Besucher
anzieht, bitten die Veranstalter – DLRG Moers,
die ENNI Sport & Bäder Niederrhein und der
Freundeskreis Bettenkamper Meer – um die Anreise
mit dem Fahrrad.
Das Bettenkamper Meer
ist an dem Tag übrigens das einzige geöffnete
Freibad in Moers. Das Solimare bleibt am 16.
August aufgrund einer Veranstaltung geschlossen.
Noch ein Grund mehr also, das Badewannenrennen
zu besuchen und Abkühlung im Naturfreibad zu
suchen. Weitere Informationen gibt es auf
www.enni.de oder www.bettenkamper-meer.de.
Touristiker aus Kleve, Bedburg-Hau,
Kranenburg und Emmerich stärken die
Zusammenarbeit
Kreis Kleve. Im
Rahmen eines interkommunalen Treffens kamen am
vergangenen Dienstag die Touristikerinnen aus
Kleve, Bedburg-Hau, Kranenburg und Emmerich am
Rhein zusammen. Ziel war es, die Zusammenarbeit
im Bereich Tourismus weiter zu intensivieren und
gemeinsame Projekte zu besprechen.

Mitarbeiter aus dem Tourismus im Schuhmuseum, im
Hintergrund Regal mit Schuhen
Bei einer
Führung durch das Klever Schuhmuseum erhielten
die Teilnehmerinnen zunächst spannende Einblicke
in die Geschichte der Schuhindustrie in Kleve.
Norbert Leenders, ehrenamtlicher Mitarbeiter im
Schuhmuseum und gelernter Schuhtechniker führte
durch die Ausstellung und beeindruckte mit
seinem umfassenden Wissen über das
traditionsreiche Schuhhandwerk.
Schwerpunktthemen beim anschließenden fachlichen
Austausch waren die Weiterentwicklung
touristischer Angebote wie der
grenzüberschreitenden Liberation Route Europe
oder der Radroute Via Romana. Außerdem planen
die Kommunen, neue, gemeindeübergreifende
Erlebnisse zu schaffen.
Die
Teilnehmerinnen betonten die Bedeutung eines
regelmäßigen Austauschs. „Der Tourismus kennt
keine Gemeindegrenzen – umso wichtiger ist
gemeinsames Denken und Handeln“, sagte Martina
Gellert, Leitung Tourismus & Freizeit bei der
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve
GmbH.
Moers: Pixelnerds Academy vermittelt Wissen
an mittelständische
Unternehmen
Wirtschaftsförderer
Florian Szepan informierte sich über das neue
Angebot von Geschäftsführer Philip Leuchtenberg,
der neben seinem Pixelnerds GmbH nun die
Pixelnerds Academy gegründet hat.

(Foto: pst)
Über ein neues Angebot der
Moerser Digital-Agentur Pixelnerds GmbH
informierte sich Wirtschaftsförderer Florian
Szepan. Hintergrund des Besuchs war die neu
gegründete Pixelnerds Academy. Geschäftsführer
Philip Leuchtenberg hat sie ins Leben gerufen,
um kleinen und mittleren Unternehmen
praxisnahes, wirtschaftlich relevantes
Digitalwissen zu vermitteln.
Der Fokus
liegt dabei auf den Themen KI, Online-Marketing
und Social Media. Die ‚Pixelnerds Academy‘ soll
kein theoretisches Konstrukt sein, sondern in
flexiblen Formaten strukturiert Wissen
vermitteln. Ob vor Ort, als Inhouse-Schulung
oder in Kleingruppen – die Art der
Wissensvermittlung wird speziell an die
Bedürfnisse der Unternehmen angepasst.
„Es gibt keine langen Vorträge, sondern konkrete
Tools, Beispiele und Umsetzungshilfen“,
erläuterte Geschäftsführer Leuchtenberg. Das
Wissen vermitteln die erfahrenen Dozentinnen und
Dozenten ausschließlich in der Agentur oder bei
Firmen, die Fortbildungen gebucht haben. So
lassen sich die Inhalte besser und direkter
vermitteln.
„Ich freue mich sehr über
das Angebot. Gerade kleine und mittlere
Unternehmen sind auf die Wissensvermittlung
angewiesen. Die Teilnehmenden werden hier sicher
viel mitnehmen und erfolgreich umsetzen können“,
so Wirtschaftsförderer Szepan zum Abschluss
seines Besuchs. Weitere Informationen gibt es
auf der Internetseite pixelnerds-academy.de Das
Unternehmen ist in der Unterwallstraße 14 zu
finden.
Gewerbeflächen-Entwicklung in
Dinslaken: Die Investoren-Tour Ruhr besucht das
MCS-Gelände
Investorentour auf
dem MCS-Gelände im vergangenen Jahr (2024) Stadt
und DIN FLEG führen Gespräche mit potenziellen
Investoren Die Stadt Dinslaken präsentiert am
Donnerstag, 4. September 2025, das MCS-Gelände
bei der Investoren-Tour Ruhr.

Bei dieser Veranstaltung wird sie das bedeutende
Areal in der Innenstadt gemeinsam mit der
Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft (DIN
FLEG) und der städtischen Wirtschaftsförderung
in Zusammenarbeit mit der EntwicklungsAgentur
Wirtschaft (EAW) des Kreises Wesel
interessierten Investoren und Akteur*innen der
Immobilienbranche vorstellen.
Organisiert in vier unterschiedlichen Touren mit
je drei Stopps bietet die Investoren-Tour einen
umfänglichen Überblick über Entwicklungsflächen
im Ruhrgebiet. Interessierte können sich über
die Internetseite www.investoren-tour.ruhr zur
Veranstaltung kostenpflichtig anmelden. Schon
zum dritten Mal nimmt die Stadt Dinslaken an der
Investoren-Tour Ruhr teil. Die Veranstaltung
wird von der Stony Real Estate Capital und der
Business Metropole Ruhr durchgeführt.
„Mit seiner industriellen Geschichte und der
klaren Entwicklungsperspektive bietet das
MCS-Gelände in Dinslaken eine gute Gelegenheit
für zukunftsorientierte Investitionen und
schafft Raum, in dem sich Stadtleben und Gewerbe
auf besondere Weise verbinden lassen“, so Simon
Koller, EAW vom Kreis Wesel.
Die
Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft und
die Stadt Dinslaken arbeiten seit 2019 gemeinsam
und mit hohem Einsatz und Tempo an der
Entwicklung des MCS-Geländes zu einem
innovativen Gewerbestandort. Erste
Investorengespräche wurden bereits 2022 im
Rahmen der internationalen Immobilienmesse „Expo
Real“ in München geführt. Gemeinsam wurde das
Gelände aktiv beworben und das Interesse
potenzieller Investoren geweckt.
Im
Oktober dieses Jahres wird Bürgermeisterin
Eislöffel erneut die Dinslakener Delegation auf
der Expo Real anführen und beim Besuch der
Investorentour am MCS-Gelände die potenziellen
Investoren persönlich begrüßen. Im Jahr 2022
wurde der Planungsprozess zunächst unterbrochen,
da die gesamte Anlage auf Empfehlung des
Landschaftsverband Rheinland (LVR) vorläufig
unter Denkmalschutz gestellt wurde.
Seit
2024 steht aber fest: Das MCS-Gelände wird nur
teilweise Denkmal. Damit konnte die Stadt
Dinslaken in einem vergleichsweise kurzen
Verfahren und im intensiven Austausch mit dem
LVR Einigung über den Denkmalwert der Gebäude
erzielen. In die Denkmalliste eingetragen wurden
nach eingehender Prüfung nur das
Verwaltungsgebäude an der Ecke
Thyssenstraße/Karlstraße, das Schalthaus an der
Bahnlinie im rückwärtigen Bereich des
Grundstücks sowie die ersten beiden Hallenteile
entlang der Karlstraße.
Dies entspricht
lediglich rund einem Drittel der Gesamtanlage.
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel erläutert:
„Mit der aktiven Weiterentwicklung des
MCS-Geländes setzen wir einen wichtigen Impuls
für Dinslaken als Wirtschaftsstandort. Die
vergangenen Monate standen ganz im Zeichen
gemeinsamer Arbeit mit unserer
Flächenentwicklungsgesellschaft DIN FLEG und der
Wirtschaftsförderung, um auf dieser
traditionsreichen Fläche neue Chancen für
Unternehmen, Beschäftigung und Innovation zu
schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch
gezielte Gespräche mit Investoren und die
Teilnahme an Fachveranstaltungen die Weichen
stellen, damit dieses Areal bald wieder ein
bedeutender Teil unserer Stadt wird.“
„Der Denkmalschutz erfordert neue
Planungsansätze und kreative Lösungen in der
städtebaulichen Konzeption. Hierfür gibt es
viele erfolgreich umgesetzte Beispiele in
anderen Städten. Die Fläche hat großes Potenzial
zu einem neuen Anziehungspunkt mit historischer
Identität zu werden. Dieser spannenden
Planungsaufgabe haben wir uns gerne angenommen
und arbeiten seit letztem Jahr in enger
Zusammenarbeit mit der Stadt Dinslaken an einem
Nachnutzungskonzept, das den Bedarf an
Gewerbeflächen und die Besonderheit des
Standortes gleichermaßen berücksichtigt“,
erläutert Natalie Telders, Geschäftsführerin der
DIN FLEG.
Parallel dazu werden Gespräche
mit potenziellen Investoren sowie
Fördermittelgebern geführt. Das Projekt wird auf
Immobilienfachmessen, wie zuletzt auf der polis
Convention im Mai in Düsseldorf, beworben. Im
Oktober 2025 wird die Stadt das Projekt auf der
Expo Real, der größten internationalen Fachmesse
für Immobilien, in München vorstellen, die
Delegation wird erneut geleitet von
Bürgermeisterin Eislöffel. Bereits 2013 war die
Produktion am einstigen Betriebsgelände der
Mannesmann Röhrenwerke vollständig eingestellt
worden.
Nach mehrjährigen Verhandlungen
gelang es der Stadt Dinslaken in Zusammenarbeit
mit der DIN FLEG Ende 2019, das brachliegende
rund 8 Hektar große MCS-Gelände an der
Thyssenstraße zu erwerben. Seitdem wurden
bereits vorbereitende Maßnahmen und
gutachterliche Untersuchungen für eine
Flächenaufbereitung vorgenommen.
Gefahren für Kinder und Tiere in
aufgeheizten geparkten Autos
Wie man im
Ernstfall richtig handelt
Der
Hochsommer kehrt zurück: In den kommenden Tagen
werden in vielen Teilen Deutschlands erneut
Temperaturen von über 30 °C erwartet. Eine
häufig unterschätzte Gefahr rückt damit wieder
in den Fokus: Ein kurzer Einkauf oder ein
schneller Gang zur Apotheke – während ein
schlafendes Kind oder ein Haustier im geparkten
Auto bleibt – kann binnen Minuten zu einem
medizinischen Notfall führen.
Denn der
Innenraum eines Fahrzeugs heizt sich unter
direkter Sonneneinstrahlung extrem schnell auf,
ein Hitzschlag droht. Der ACV Automobil-Club
Verkehr beantwortet sieben zentrale Fragen zum
Thema und informiert über Risiken, notwendige
Maßnahmen im Notfall sowie rechtliche
Konsequenzen.
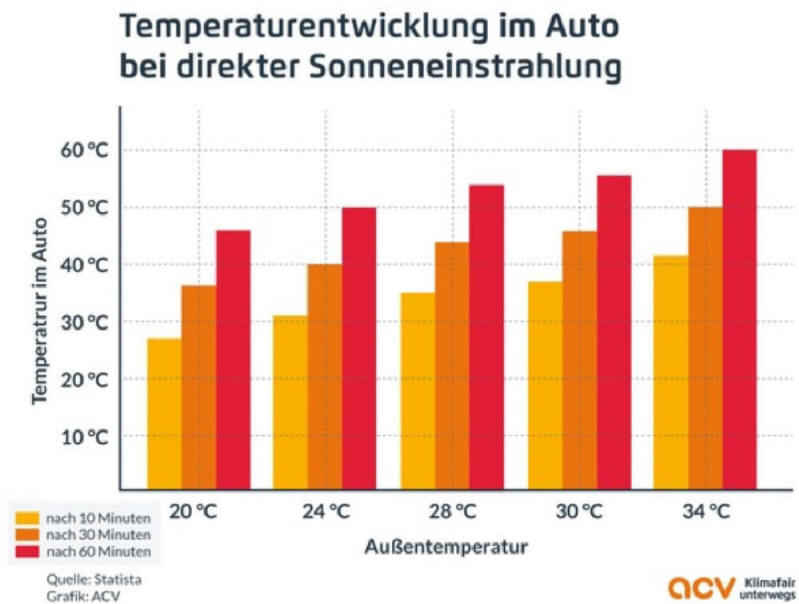
Entwicklung der Temperatur im geparkten Auto
bei direkter Sonneneinstrahlung nach Standzeit
und Außentemperatur. Grafik: ACV / Quelle:
Statista
•
Warum ist Hitze im
geparkten Auto so gefährlich?
Ein
abgestelltes Fahrzeug kann sich durch
Sonneneinstrahlung binnen kurzer Zeit stark
aufheizen. Die großen Fensterflächen wirken
dabei wie Brenngläser: Sonnenlicht dringt ein
und trifft im Innenraum auf Sitze, Armaturen und
Verkleidungen. Diese absorbieren die Wärme, die
sich im Innenraum staut, vergleichbar mit einem
Treibhauseffekt.
Die Temperaturen steigen
rasch in gefährliche Bereiche. Die Luft wird
stickig, während gleichzeitig der
Sauerstoffgehalt sinkt – ein Hitzestau entsteht.
Auch bei moderaten Außentemperaturen kann dies
bereits nach wenigen Minuten lebensbedrohliche
Bedingungen schaffen.
•
Wie schnell wird es
im geparkten Auto lebensgefährlich heiß?
Laut
einer Statista-Auswertung kann die Temperatur im
Fahrzeuginnenraum bereits bei einer
Außentemperatur von 24 °C nach zehn Minuten mit
direkter Sonneneinstrahlung auf etwa 31 °C
steigen. Nach 30 Minuten sind bereits rund 40 °C
möglich. Bei einer Außentemperatur von 30 Grad
Celsius sind es nach 30 Minuten 46 °C, nach
einer Stunde sogar 56 °C. Auch wenn das Fahrzeug
im Schatten steht, kann sich der Innenraum stark
aufheizen. Die Gesundheitsgefahr besteht
weiterhin, nur verzögert.
Hinweis: Die
genannten Werte sind Durchschnittswerte zur
Veranschaulichung und hängen von Faktoren wie
Sonneneinstrahlung, Fahrzeugfarbe, Verglasung
und Luftzirkulation ab.
•
Warum sind Kinder
und Tiere besonders gefährdet?
Kinder und vor
allem Babys können mit Hitze nur schwer umgehen.
Ihr Körper nimmt schneller Wärme auf, weil sie
im Verhältnis zu ihrem Gewicht mehr Hautfläche
haben. Gleichzeitig können sie überschüssige
Wärme schlecht abgeben, da sie weniger schwitzen
als Erwachsene. Die Hitze staut sich und
belastet den Kreislauf. Temperaturen um 40 Grad
bringen den kindlichen Organismus rasch an seine
Grenzen. Im Extremfall kann das lebensbedrohlich
sein.
Auch Tiere, insbesondere Hunde,
sind bei Hitze stark gefährdet. Sie regulieren
ihre Körpertemperatur hauptsächlich über
Hecheln, was bei hoher Umgebungstemperatur
schnell an seine Grenzen stößt. Schweißdrüsen
haben sie nur in sehr begrenztem Umfang. Ein
Hitzschlag kann die Folge sein. Da weder Kinder
noch Tiere die Gefahr einschätzen oder sich
selbst befreien können, besteht besondere
Schutzverantwortung.
•
Welche Strafen
drohen beim Zurücklassen von Kindern oder Tieren
im Fahrzeug?
Ob ein entsprechendes Verhalten
strafbar ist, hängt von der konkreten
Gefährdungssituation ab. Eine Strafbarkeit kann
bereits dann vorliegen, wenn ein Kind oder Tier
in eine potenziell hilflose Lage gebracht wird,
unabhängig davon, ob bereits eine
Gesundheitsschädigung eingetreten ist.
Strafen, wenn ein Kind im Auto gelassen wird
• Aussetzung (§ 221 StGB): Wird ein Kind in eine
hilflose Lage gebracht, droht eine
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren. Bei schwerer Gesundheitsschädigung kann
die Strafe auf bis zu zehn Jahre steigen.
•
Fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB): Führt
die Hitze zu einer Gesundheitsschädigung, sind
bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine
Geldstrafe möglich.
• Verletzung der
Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB):
Bei erheblicher Gefährdung der körperlichen
Entwicklung drohen bis zu drei Jahre
Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.
•
Fahrlässige Tötung (§ 222 StGB): Kommt das Kind
infolge der Hitzebelastung zu Tode, droht
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine
Geldstrafe.
Strafen, wenn ein Tier im
Auto gelassen wird
Auch bei Tieren sind
rechtliche Konsequenzen möglich, die nach dem
Tierschutzgesetz geahndet werden:
•
Ordnungswidrigkeit (§ 18 TierSchG): Wird ein
Tier bei Hitze unzureichend versorgt, können
Bußgelder von mehreren Hundert bis mehreren
Tausend Euro verhängt werden.
• Verstoß gegen
das Tierschutzgesetz (§ 17 TierSchG): Bei
erheblichen Schäden oder Tod des Tieres droht
eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren.
•
Wie ist zu handeln,
wenn ein Kind oder Tier im heißen Auto bemerkt
wird?
Fahrzeug auf Zugänglichkeit überprüfen
- Verantwortliche Person ausfindig machen (z. B.
über Lautsprecherdurchsagen im Supermarkt oder
auf dem Parkplatz)
- Bei akuter Gefahr
umgehend den Notruf (112) verständigen
-
Zustand beobachten: Reagieren Kind oder Tier
nicht oder wirken sie apathisch, besteht
unmittelbare Lebensgefahr
•
In akuten Fällen
darf die Autoscheibe eingeschlagen werden, um
Leben zu retten. Dabei sollte eine Seitenscheibe
mit Abstand zur betroffenen Person oder dem Tier
gewählt werden und gezielt in einer Ecke
eingeschlagen werden. Ein fester Gegenstand –
etwa ein Nothammer oder Schlüsselbund – kann
helfen, die Verletzungsgefahr durch Glassplitter
zu minimieren.
Wichtig: Auch beim
eigenständigem Eingreifen sollte der Notruf
stets informiert werden. Die Leitstelle kann
telefonisch unterstützen und ggf.
Erste-Hilfe-Anweisungen geben.
•
Ist das Einschlagen
der Scheibe rechtlich zulässig?
Bei
nachgewiesener akuter Gefahrensituation liegt
ein rechtfertigender Notstand gemäß § 34 StGB
vor. Eine damit verbundene Sachbeschädigung ist
in diesem Fall nicht rechtswidrig.
Es wird
empfohlen, möglichst Zeugen hinzuzuziehen oder
Fotos und Videos zur Dokumentation anzufertigen,
um die Situation nachvollziehbar zu machen.
•
Was passiert, wenn
man nicht hilft?
Grundsätzlich ist man dazu
verpflichtet, in akuten Gefahrensituationen
Hilfe zu leisten, soweit dies zumutbar ist. Wer
ein Kind oder ein Tier in einer
lebensbedrohlichen Lage bemerkt und gar nichts
unternimmt, kann sich strafbar machen.
Unterlassene Hilfeleistung liegt vor, wenn Hilfe
erforderlich und ohne erhebliche eigene
Gefährdung möglich gewesen wäre (§ 323c StGB).
Je nach Einzelfall kann eine Geldstrafe oder
eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr
verhängt werden.
Neue Hörstellen der Liberation Route Europe
in Wesel eingeweiht
Am
Montag, 4. August, wurden bei sonnigem Wetter
zwei neue Hörstationen der „Liberation Route
Europe“ in Wesel-Bislich feierlich vorgestellt.
Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und
Beigeordneter Rainer Benien begrüßten die
Anwesenden am Deich in Bislich, wo eine der
neuen Stationen errichtet wurde.

Gotthard Kirch, Geschäftsführer des Vereins
Liberation Route NRW e.V., erläuterte die
historische Bedeutung der Route, die als
zertifizierte Kulturroute des Europarats
zentrale Orte der Befreiung Europas von der
NS-Herrschaft verbindet.
Dank des
Förderprojekts „Public History“ mit Mitteln aus
dem Förderprogramm „Heimat-Zeugnis“ des
Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und
Digitalisierung des Landes NRW konnte unter
anderem die bestehende Hörstelle „V-Zeichen am
Rhein“ in Büderich erneuert und eine neue
Station an der Pieta-Kapelle in Bislich
eingerichtet werden.
Beide Hörstellen
bestehen aus markanten Steinfindlingen mit
QR-Codes, über die Besucher*innen informative
Hörstücke abrufen können. Die neue Station in
Bislich erinnert an die sogenannten
„Bailey-Brücken“, die 1945 eine entscheidende
Rolle beim Vormarsch der Alliierten spielten.
Der Standort wurde bewusst gewählt: die
Hörstelle steht auf der ehemaligen Rampe einer
solchen Brücke.
Der Findling wurde von
der Firma Holemans GmbH gestiftet, die Montage
übernahm der Heimat- und Bürgerverein Bislich
e.V. Zeitgleich ist auch eine neue Broschüre der
Liberation Route NRW erschienen. Sie stellt
Geschichten, Wanderungen und Radtouren zu den
Hörstellen im Rheinland zwischen Emmerich und
Hellenthal in der Eifel vor. Ein aktualisierter
Routenplan der Radtour Wesel bindet nun auch die
neue Station in Bislich mit ein.
Die
Broschüre wird im Stadtarchiv Wesel, bei der
Stadtinformation Wesel und im Deichdorfmuseum
Bislich erhältlich sein. Interessierte
Bürger*innen sind herzlich eingeladen, die
Hörstellen zu besuchen und sich auf eine
akustische Reise in die Geschichte der Befreiung
Europas zu begeben.

NRW: Fast jede achte Person ist nicht in der
Lage, sich jeden zweiten Tag eine vollwertige
Mahlzeit zu leisten
* Anteil Betroffener im Zeitraum seit
2021 erstmals rückläufig.
* Auch
Nahrungsmittelpreise in 2024 weniger stark
gestiegen.
Rund jede achte Person in
Nordrhein-Westfalen lebte im Jahr 2024 in einem
Haushalt, der nach eigenen Angaben aus
finanziellen Gründen nicht in der Lage war, sich
jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit,
d. h. eine Mahlzeit mit Fleisch, Geflügel oder
Fisch oder eine entsprechende vegetarische
Mahlzeit, zu leisten. Wie das Statistische
Landesamt mitteilt, ist der Anteil Betroffener
damit erstmals seit 2021 rückläufig.
Anteil Betroffener sank 2024 erstmals wieder
Im Jahr 2024 konnten sich nach eigener
Einschätzung 13,3 % der Bevölkerung – das ist
rund jede achte Person – nicht wenigstens jeden
zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten.
Der Anteil der betroffenen Menschen ist damit im
Vergleich zum Vorjahr, in dem noch 15,8 % aller
Befragten angaben, aus finanziellen Gründen
Einschränkungen im Bereich der Ernährung
hinnehmen zu müssen, um 2,5 Prozentpunkte
gesunken.
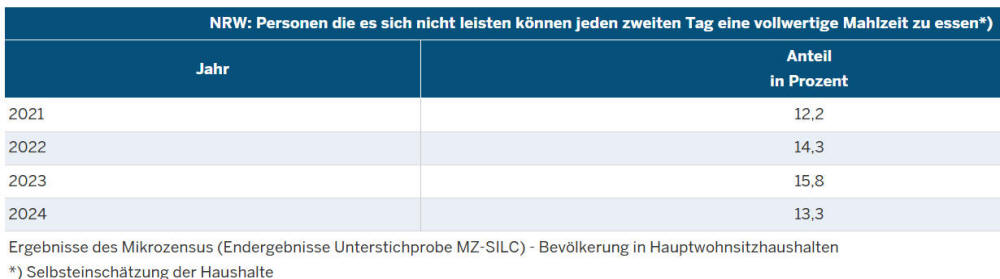
Der kontinuierliche Anstieg seit dem Jahr
2021 setzt sich damit zunächst nicht fort, der
Anteil Betroffener lag mit 13,3 % dennoch über
dem Niveau von 2021. Auch Nahrungsmittelpreise
in 2024 weniger stark gestiegen Ein möglicher
Einflussfaktor auf die Einschätzung, ob man sich
eine vollwertige Mahlzeit leisten kann, könnte
die Entwicklung der Nahrungsmittelpreise sein.
In den Jahren 2022 (+14,6 %) und 2023
(+13,0 %) haben die Preise für Nahrungsmittel
deutlich zugenommen. Im Jahr 2024 stiegen die
Preise für Nahrungsmittel hingegen nur noch um
1,4 %, womit die Preiserhöhung deutlich unter
dem Niveau der beiden Vorjahre lag.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Themenseite Inflation unter
https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/themenschwerpunkte/Inflation/die-entwicklung-der-nahrungsmittelpreise-nrw-seit-2015
Welche Personen in der Bevölkerung
müssen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation
auf unterschiedliche Güter, Dienstleistungen
oder soziale Aktivitäten verzichten? Ergebnisse
zu diesen und weiteren Fragen rund um das Thema
„materielle und soziale Entbehrung” finden Sie
in unserem Schwerpunktartikel auf der
Themenseite Armut unter
https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/themenschwerpunkte/armut/wer-nrw-ist-von-erheblicher-materieller-und-sozialer-entbehrung-betroffen
Energiebedingte CO2-Emissionen seit 2010
um 29,6 % gesunken
• Emissionen aus Verbrennung von Kohle in der
Energieversorgung um 52 % reduziert •
CO2-Emissionen im Straßenverkehr stagnieren seit
2020
Die energiebedingten CO2-Emissionen
der Wirtschaftszweige und der privaten Haushalte
sind seit 2010 um 29,6 % gesunken (2023: 543,0
Millionen Tonnen gegenüber 2010: 770,9 Millionen
Tonnen). Energiebedingte Emissionen haben den
größten Anteil an den gesamten CO2-Emissionen
von in Deutschland ansässigen Privatpersonen und
Unternehmen. 2023 lag der Anteil bei 73,5 %.
Darunter fallen alle Emissionen, die durch
die Verbrennung fossiler Energieträger und von
Biomasse zur Energieerzeugung entstehen.
Insgesamt haben die Wirtschaftszweige und die
privaten Haushalte 2023 zusammen 738,7 Millionen
Tonnen CO2 verursacht. Seit 2010 sind die
Emissionen damit um 25,1 % gesunken (2010: 986,6
Millionen Tonnen).
CO2-Emissionen aus
Kohle in der Energieversorgung von 2010 bis 2023
halbiert
Den größten Anteil an den
energiebedingten CO2-Emissionen hatte im Jahr
2023 die Energieversorgung (u. a. Strom- und
Fernwärmeanbieter) mit 38,4 %, gefolgt vom
Verarbeitenden Gewerbe (27,0 %) und den privaten
Haushalten (18,6 %). Zusammen machten sie 84,0 %
der energiebedingten CO2-Emissionen aus.
Der Rückgang der energiebedingten
CO2-Emissionen insgesamt ist vor allem auf die
Reduktion im Bereich der Energieversorgung
zurückzuführen. Dieser Wirtschaftszweig
reduzierte seine energiebedingten CO2-Emissionen
um 40,3 % (2023: 208,6 Millionen Tonnen
gegenüber 2010: 349,6 Millionen Tonnen).
Insbesondere hier hatte die Reduktion des
Einsatzes von Kohle (-52,0 %) in Kraftwerken zur
Erzeugung von Strom und Wärme für andere
Wirtschaftszweige und private Haushalte einen
großen Einfluss.
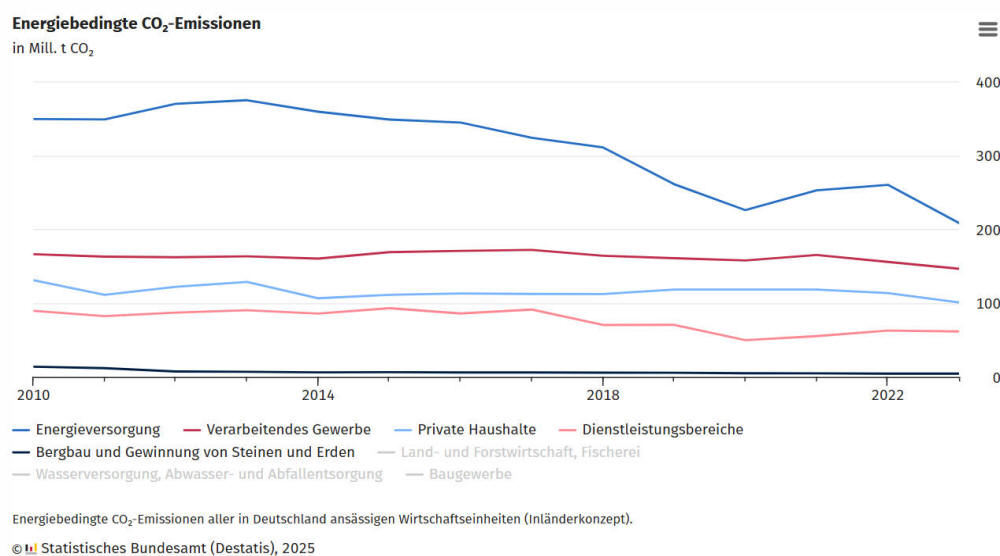
Private Haushalte reduzieren Emissionen aus
leichtem Heizöl um ein Drittel
Bei den
privaten Haushalten entstehen ebenfalls
energiebedingte CO2-Emissionen, etwa beim Heizen
und der Warmwasseraufbereitung. Diese lagen im
Jahr 2023 bei 101,0 Millionen Tonnen. Die
energiebedingten CO2-Emissionen privater
Haushalte gingen zwischen 2010 und 2023 um
23,1 % zurück (2010: 131,3 Millionen Tonnen).
Sie entstehen fast ausschließlich
(98,9 %) durch die Verbrennung von Naturgasen
(Erdgas und Grubengas) (46,4 Millionen Tonnen),
Mineralölen (28,2 Millionen Tonnen, darunter
leichtes Heizöl: 26,2 Millionen Tonnen) und
Biomasse wie zum Beispiel Holz
(25,2 Millionen Tonnen). Die Emissionen aus
leichtem Heizöl wurden seit 2010 um ein Drittel
(-33,0 %) reduziert, die Emissionen aus
Naturgasen gingen um 18,3 % zurück.
Verarbeitendes Gewerbe zweitgrößter Emittent
energiebedingter CO2-Emissionen
Der
zweitgrößte Emittent energiebedingter
CO2-Emissionen war im Jahr 2023 das
Verarbeitende Gewerbe mit 146,7 Millionen Tonnen
CO2 (-11,8 % gegenüber 2010). Sie entstehen vor
allem durch die Verbrennung von Naturgasen
(33,0 %), abgeleiteten Gasen wie Kokerei-,
Gicht- und Konvertergas (20,4 %) sowie
Mineralölen (16,5 %).
Die Betriebe des
Verarbeitenden Gewerbes nutzen diese
Energieträger beispielsweise zur Strom- und
Wärmeerzeugung in sogenannten
Industriekraftwerken oder zur Prozessfeuerung in
bestimmten Produktionsverfahren, etwa bei der
Stahlherstellung. Während die Emissionen aus
Mineralölen (-23,1 % gegenüber 2010) und
Naturgasen
(-11,4 % gegenüber 2010) deutlich
sanken, sind die Emissionen aus abgeleiteten
Gasen um 5,1 % gegenüber 2010 angestiegen.
Weiterhin reduzierte der
Dienstleistungsbereich seine energiebedingten
CO2-Emissionen um 31,1 %. Er verursachte 11,4 %
der energiebedingten CO2-Emissionen im Jahr
2023.
Emissionen aus dem Straßenverkehr
stagnieren seit 2020
Nach den
energiebedingten CO2-Emissionen stellte der
Straßenverkehr mit einem Anteil von 20,9 % die
zweitgrößte Quelle für CO₂-Emissionen dar,
gefolgt von prozessbedingten Emissionen (5,5 %).
Prozessbedingte Emissionen stammen nicht aus der
Energiegewinnung, sondern entstehen etwa bei
chemischen Reaktionen in industriellen
Herstellungsverfahren oder in der
Landwirtschaft.
Im Jahr 2023 wurden
durch den Straßenverkehr CO2-Emissionen in Höhe
von 154,7 Millionen Tonnen ausgestoßen. Im Jahr
2010 lag der Wert noch bei
164,7 Millionen Tonnen (-6,1 % 2023 gegenüber
2010). Im Zeitraum 2010 bis 2019 sind die
Emissionen zunächst leicht um 6,9 % gestiegen.
Von 2019 auf 2020 sind die Emissionen um 12,2 %
auf 154,6 Millionen Tonnen gefallen. Dieser
Rückgang der Emissionen ist vor allem durch die
Einschränkungen während der Corona-Pandemie zu
erklären.
Seither stagnieren die
CO2-Emissionen im Straßenverkehr auf diesem
Niveau (+0,1 % 2023 gegenüber 2020). Den größten
Anteil an den Emissionen im Straßenverkehr
hatten im Jahr 2023 mit 57,5 %
(88,9 Millionen Tonnen) die privaten Haushalte.
In den einzelnen Jahren seit 2010 lag ihr Anteil
relativ stabil bei um die 60 %.
Waldbrände am Urlaubsort - Diese Rechte
haben betroffene Reisende
Frankreich und Spanien werden derzeit von
verheerenden Waldbränden heimgesucht.
Urlauber:innen werden während ihres Aufenthalts
von den Bränden überrascht und müssen teilweise
evakuiert werden. Viele Menschen fragen sich
nun, ob sie ihre geplante Reise in betroffene
Regionen überhaupt antreten können.
„Bei
akuter Gefahr für Leib und Leben durch
Waldbrände am Urlaubsort können Pauschalreisende
in der Regel ohne Probleme vom Vertrag
zurücktreten oder die Reise vorzeitig
abbrechen“, so die Verbraucherzentrale NRW. „In
jedem Fall sollte zuerst der Reiseveranstalter
kontaktiert werden, um die bestehenden
Möglichkeiten zu besprechen.” Das sollten
Reisende jetzt wissen:
Rücktritt von
einer Pauschalreise
Haben Reisende eine
Pauschalreise gebucht, können sie vor
Reisebeginn kostenlos vom Vertrag zurücktreten,
wenn unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände
vorliegen, die die Reise erheblich
beeinträchtigen. Solche Umstände liegen bei
Ereignissen vor, die weder Reisende noch
Reiseveranstalter durch Vorkehrungen
kontrollieren oder vermeiden können. Dazu
gehören zum Beispiel Waldbrände, Überflutungen
oder Erdbeben. Außergewöhnliche Wetterlagen wie
extreme Hitze zählen hingegen nicht dazu.
Abbruch der Pauschalreise
Geraten
Reisende während ihres Aufenthalts vor Ort in
eine Krisensituation und wird dadurch die Reise
erheblich beeinträchtigt, können sie den
Pauschalreisevertrag kündigen und für die nicht
genutzten Reiseleistungen eine Erstattung
verlangen. Für die bereits genutzten
Reiseleistungen müssen Betroffene den
vereinbarten Reisepreis zahlen.
Umfasst
der Reisevertrag auch die An- und Abreise, so
muss der Reiseveranstalter bei einer Kündigung
des Vertrags unverzüglich die Rückbeförderung
der Reisenden organisieren. Die eventuellen
Mehrkosten für die Rückbeförderung gehen dabei
zulasten des Reiseveranstalters.
Fortsetzung der Pauschalreise
Wer seinen
Urlaub nicht abbricht und im Krisengebiet
bleibt, kann eventuell den Reisepreis mindern.
Dies ist vom Einzelfall abhängig und etwa dann
möglich, wenn einzelne Reiseleistungen wie
Transport, Verpflegung, Unterkunft oder Ausflüge
nicht mehr dem gebuchten Standard entsprechen
oder sogar ganz ausfallen.
Wichtig:
Verbraucher:innen müssen dem Reiseveranstalter
die außergewöhnlichen Umstände nachweislich und
unverzüglich als Reisemangel anzeigen. Insgesamt
ist zu empfehlen, sich mit dem Reiseveranstalter
in Verbindung zu setzen und die aktuelle Lage
und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu
besprechen.
Rundreisen
Auch eine als
Pauschalreise gebuchte Rundreise kann im
Einzelfall kostenlos storniert werden, wenn
wichtige oder besondere Reisebestandteile nicht
durchgeführt beziehungsweise entscheidende
Reiseziele nicht angefahren werden können.
Fällt nur ein kleiner Teil des Programms
aus, ist dies jedoch lediglich ein Reisemangel,
für den Reisende den Reisepreis mindern können.
Auch hier gilt: Verbraucher:innen müssen dem
Reiseveranstalter die außergewöhnlichen Umstände
nachweislich und unverzüglich als Reisemangel
anzeigen.
Nachteile bei Buchung von
Einzelleistungen
Wer Reiseleistungen wie Flug
oder Unterkunft einzeln gebucht hat, muss unter
Umständen nicht zahlen, wenn die Leistung nicht
erbracht werden kann. Solange eine individuell
gebuchte Unterkunft jedoch zugänglich und ohne
Gesundheitsgefahr bewohnbar ist, sind Reisende
auf die Kulanz des Anbieters angewiesen und
müssen mit einem Stornoentgelt bis zu 100
Prozent des Reisepreises rechnen, wenn sie die
Reise nicht antreten möchten.
Bei
Unterkünften, die direkt bei Eigentümer:innen im
Ausland gebucht wurden, gilt das Recht des
Landes, in dem die Unterkunft liegt. Wird ein
Flug wegen eines Waldbrandes annulliert, haben
Fluggäste die Wahl zwischen Erstattung des
Flugpreises und einem Ersatzflug zum
nächstmöglichen oder späteren Zeitpunkt.
Reiserücktrittsversicherung
Eine
Reiserücktritts- oder -abbruchversicherung nützt
bei derartigen unvermeidbaren, außergewöhnlichen
Umständen nichts, da ein solches Geschehen nicht
als Rücktritts- bzw. Abbruchgrund vereinbart ist
und sie daher in der Regel nicht einspringt.
Sie sichert zum Beispiel das Risiko des
Reisenden ab, vor oder während der Reise zu
erkranken. Sie zahlt aber auch bei anderen
Umständen, wenn zum Beispiel ein erheblicher
Schaden am Eigentum des Versicherten entsteht
oder wenn ein naher Angehöriger stirbt."
Weiterführende Informationen:
Die
Verbraucherzentrale NRW stellt Betroffenen
Musterbriefe zur Kündigung einer Reise wegen
unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände vor
und nach Reiseantritt zur Verfügung unter:
www.verbraucherzentrale.nrw/node/10380
Deutsche Bahn: Sperrung Weseler Straße in
Dinslaken erforderlich
Die
Deutsche Bahn informiert: "Für den dreigleisigen
Ausbau zwischen Emmerich und Oberhausen erneuert
die Deutsche Bahn (DB) auch die
Eisenbahnüberführung (EÜ) 'Weseler Straße' in
Dinslaken.
Der Neubau der Brücke erfolgt
in drei Phasen. Die Arbeiten am nördlichen Teil
der Brücke sind bereits seit letztem Jahr
abgeschlossen.
Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf den mittleren Teil
der
Brücke, mit dem Ziel, diesen Teil bis zum Herbst 2025
abzuschließen.
Im Anschluss beginnt das
Team mit den Arbeiten am dritten Teil der
Brücke. Für die aktuell laufende Bauphase
benötigen die Fachleute ein Traggerüst, auf dem
nach und nach das neue Brückenteil entstehen
wird. Um den Aufbau des Gerüsts sicher und
effizient durchzuführen, muss die Weseler Straße
(B8) an den kommenden Wochenenden, von Freitag,
8. August (20 Uhr) bis Sonntag, 10. August (6
Uhr) sowie von Freitag, 15. August (20 Uhr) bis
Sonntag, 17. August (6 Uhr) für den
Straßenverkehr gesperrt werden.
Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert.
Um die Einschränkungen für Fußgänger:innen und
Radfahrer:innen auf das Mindeste zu begrenzen,
bleibt eine Seite des Weges während der
Bauzeiten geöffnet. Die DB setzt vor Ort
modernste Arbeitsgeräte ein. Trotzdem lässt sich
Baulärm leider nicht vollständig vermeiden. Die
DB bittet die Anwohner:innen hierfür um
Verständnis."
Seniorenvertretung trifft sich
Am Dienstag, 12. August 2025, trifft sich die
Seniorenvertretung in Dinslaken. Die Sitzung
beginnt um 17:00 Uhr im Stadthaus in der
Wilhelm-Lantermann-Straße (großer Sitzungssaal,
6. Etage).
Wesel: Kleine Händlerinnen, kleine
Händler, kleine Preise – Kindertrödelmarkt in
der Innenstadt zwischen Kornmarkt und Rathaus
Im Rahmen des diesjährigen
Ferienaktionsprogramms findet am kommenden
Samstag, 9. August 2025, in der Innenstadt
zwischen Kornmarkt und Rathaus ein
Kindertrödelmarkt statt. Von 10:00 Uhr bis 15:00
Uhr können Kinder und Jugendliche im Alter von 6
bis 16 Jahren unter anderem ausgedientes
Spielzeug, zu klein gewordene Jeans und
ausgelesene Bücher für ein angemessenes
Taschengeld anbieten.
Verkauft werden
dürfen nämlich nur Kinderspielsachen,
Kinderkleidung und Gebrauchsgegenstände für
Kinder. Die Teilnahme kann auch ohne vorherige
Anmeldung erfolgen und ist kostenlos. Zu Beginn
des Trödelmarktes werden 5,00 Euro Müllpfand
eingesammelt (bitte passend in bar mitbringen).
Das Müllpfand wird nach Abbau des
Standes und sorgfältiger Reinigung der Fläche
erstattet. Entstandener Müll ist persönlich zu
entsorgen. Decken, Sonnenschirme und Tische sind
selbst mitzubringen. Infos zum
Ferienaktionsprogramm unter: https://www.unser-ferienprogramm.de/wesel/index.php
„Schau mich an – Gesichter der Vielfalt“ –
Ausstellung im Weseler Rathaus
Was bedeutet es, sein Heimatland zu verlassen –
nicht aus freien Stücken, sondern aus Angst,
Verzweiflung oder der Hoffnung auf ein Leben in
Sicherheit? Was bleibt, wenn fast alles
zurückgelassen werden muss? Und was entsteht,
wenn man an einem neuen Ort ankommt?
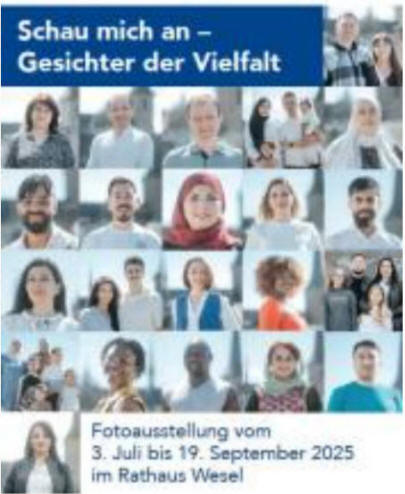
Mit diesen Fragen beschäftigt sich das
Fotoprojekt „Schau mich an – Gesichter der
Vielfalt“, das in Kooperation mit dem
Integrationsbüro der Stadt Wesel und der vhs
Wesel – Hamminkeln – Schermbeck entstanden ist.
In 22 eindrucksvollen Portraits erzählen
geflüchtete Menschen, die heute in Wesel leben,
von ihrer Herkunft, ihrer Flucht und ihrem
Neuanfang.
Die Ausstellung macht
sichtbar, was oft unsichtbar bleibt: Die
Gesichter und Geschichten hinter dem Begriff
„Geflüchtete“. Sie möchte Begegnung ermöglichen,
Empathie fördern und ein stärkeres Bewusstsein
für die Herausforderungen und Erfolge
geflüchteter Menschen schaffen.
Die
Ausstellung ist im Rathaus Wesel auf dem Flur
vor dem Büro der Bürgermeisterin zu sehen.
Interessierte sind herzlich eingeladen, die
Ausstellung während der Öffnungszeiten des
Rathauses zu besichtigen.

Umsatz im Dienstleistungsbereich im Mai 2025
um 0,5 % niedriger als im Vormonat
-0,5 % zum Vormonat (real)
-0,4 % zum
Vormonat (nominal)
-0,3 % zum Vorjahresmonat
(real)
+1,9 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Der Dienstleistungssektor in Deutschland
(ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen)
hat im Mai 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender-
und saisonbereinigt real 0,5 % (preisbereinigt)
und nominal (nicht preisbereinigt) 0,4 % weniger
Umsatz erwirtschaftet als im April 2025.
Verglichen mit dem Vorjahresmonat Mai 2024
verzeichnete der kalender- und saisonbereinigte
Umsatz einen realen Rückgang von 0,3 % und einen
nominalen Anstieg von 1,9 %.
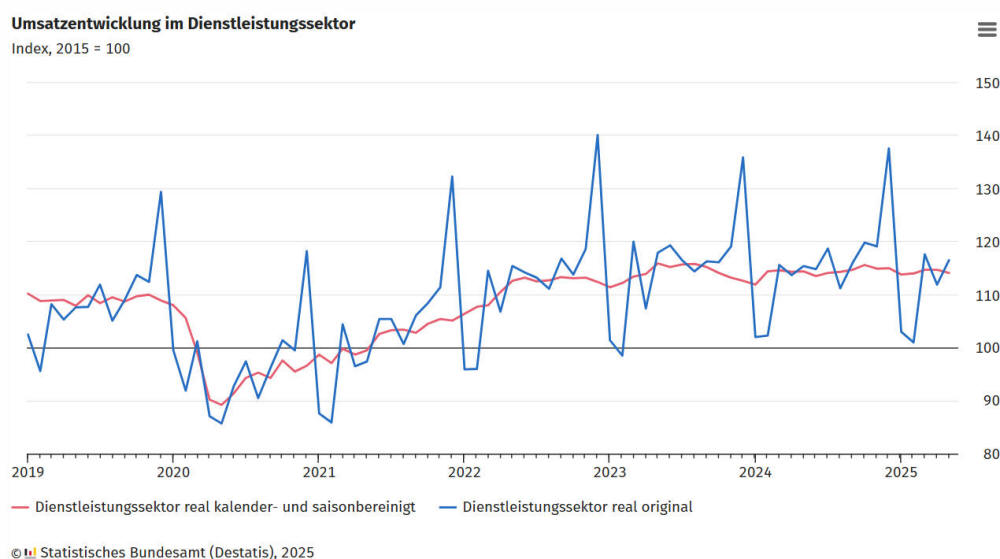
Den größten realen Umsatzzuwachs im Mai 2025
gegenüber dem Vormonat die freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen
Dienstleistungen mit einem Anstieg von 1,3 %,
gefolgt vom Bereich Information und
Kommunikation mit einem Zuwachs von 0,5 %.
Im Gegensatz hierzu sanken die realen
Umsätze im Grundstücks- und Wohnungswesen sowie
im Bereich Verkehr und Lagerei um 1,2 %
beziehungsweise 1,3 %. In den sonstigen
wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel
Vermietung von beweglichen Sachen und
Vermittlung von Arbeitskräften) war der reale
Umsatzrückgang gegenüber April 2025 mit 1,7 % am
größten.
4 % weniger BAföG-Geförderte im Jahr 2024
• Durchschnittlich 635 Euro pro
Monat für BAföG-Geförderte
• Gesamtausgaben
für BAföG-Förderung sinken um 9 % im Vergleich
zum Vorjahr
• Neues Förderinstrument: 10 700
Studienanfängerinnen und -anfänger erhalten
Unterstützung über die neue Studienstarthilfe
Im Jahr 2024 haben 612 800 Personen
monatliche Leistungen nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
erhalten. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, waren das 22 800 oder 4 %
weniger Geförderte als im Vorjahr. Damit sank
die Zahl der BAföG-Geförderten auf den
niedrigsten Wert seit dem Jahr 2000, nachdem sie
in den Jahren 2022 und 2023 leicht angestiegen
war.
Fast acht von
zehn BAföG-Geförderten im Jahr 2024 waren
Studierende
Im Jahr 2024 waren 79 %
der BAföG-Geförderten Studierende (483 800) und
21 % waren Schülerinnen und Schüler (129 000).
Studierende erhielten monatlich im Durchschnitt
657 Euro an BAföG-Förderung. Bei Schülerinnen
und Schülern lag der durchschnittliche
monatliche Förderbetrag bei 539 Euro.
Die Höhe des individuellen Förderbetrags ist
unter anderem abhängig von der besuchten
Ausbildungsstätte (zum Beispiel Berufsfachschule
oder Hochschule), der Unterbringung (bei den
Eltern oder auswärts) sowie vom Einkommen der
Geförderten und ihrer Eltern.
Weiterhin
höherer Frauenanteil unter den BAföG-Geförderten
BAföG-Geförderte waren im Jahr 2024 häufiger
weiblich als männlich, typischerweise unter 25
Jahre alt und wohnten mehrheitlich nicht bei
ihren Eltern. So war ähnlich wie in den
Vorjahren der Frauenanteil unter den Geförderten
mit 59 % größer als der Männeranteil (41 %).
Zwei Drittel der Geförderten (67 %) waren unter
25 Jahre alt. 71 % der Geförderten wohnten nicht
bei ihren Eltern.
Förderung mit neuer
Studienstarthilfe größtenteils aufgrund von
Bürgergeld-Bezug
Ab dem Wintersemester
2024/2025 wurde die "Studienstarthilfe" als
neues Förderinstrument im BAföG eingeführt.
Dabei handelt es sich um einen einmaligen
finanziellen Zuschuss zum Studienbeginn in Höhe
von 1 000 Euro. Die Studienstarthilfe richtet
sich an Personen unter 25 Jahren, die vor Beginn
des Studiums bestimmte Sozialleistungen beziehen
und sich erstmalig für ein Studium
immatrikulieren.
Die Förderung mit
Studienstarthilfe erfolgt unabhängig von einem
möglichen monatlichen BAföG-Bezug. Im Jahr 2024
wurden 10 700 Personen mit einer
Studienstarthilfe gefördert. Der Bund wendete
dementsprechend 10,7 Millionen Euro für die
Studienstarthilfe auf.
Der Anspruch auf
Studienstarthilfe begründete sich meist mit
Leistungen nach SGB II ("Bürgergeld"), welche
61 % der Studienstarthilfe-Geförderten vor
Studienbeginn bezogen. Bei 21 % der
Studienstarthilfe-Geförderten lag der Bezug von
Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz
zugrunde, bei 16 % der Bezug von Wohngeld nach
dem Wohngeldgesetz. Ähnlich wie bei
den BAföG-Geförderten war der Frauenanteil unter
den Studienstarthilfe-Geförderten mit 57 % höher
als der Männeranteil (43 %).
Der besondere Abendhimmel

Düster, aber faszinierend mit
heftiger Windboe: Rollwolke über Moers am 5.
August BZ-haje
Kreis Kleve: Fortbildung für Ehrenamtliche
in den Tourist Informationen
Mit einem großen Dank an das unverzichtbare
Engagement der Ehrenamtlichen in den Tourist
Informationen fand am vergangenen Montag eine
gemeinsame Netzwerkveranstaltung der Wirtschaft,
Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) und
der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing
Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH (WFG) statt.
Mehr als 20 ehrenamtliche Mitarbeitende
wurden von den Geschäftsführerinnen Verena Rohde
(WTM) und Sara Kreipe (WFG) im AOK-Haus in Kleve
herzlich begrüßt, um sich auszutauschen und neue
Impulse zu gewinnen.
Im Mittelpunkt der
Veranstaltung stand neben dem Netzwerken eine
praxisorientierte und kurzweilige Fortbildung.
In interaktiven Workshops behandelte der
Referent Harald Münzner, verantwortlich für
Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus bei
der Stadt Kalkar, Themen wie Servicequalität und
Kommunikation mit den Gästen. „Unsere
ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind das
freundliche Gesicht unserer Städte“, betont
Martina Gellert, Leitung Tourismus & Freizeit
bei der WTM.
„Sie empfangen Besucher aus
aller Welt, geben Insidertipps und tragen mit
ihrem Engagement dazu bei, dass die Gäste sich
willkommen fühlen.“ Auch Dr. Manon Loock-Braun,
Prokuristin und Bereichsleitung Tourismus bei
der WFG unterstrich die Bedeutung des Ehrenamts:
„Ohne dieses freiwillige Engagement wäre eine
kontinuierliche und persönliche Präsenz in
unseren Tourist Informationen, die das
Schaufenster unserer Städte sind, schwer
möglich.“

Die Veranstaltung bot außerdem Raum für
Austausch über Erfahrungen und Herausforderungen
bei der Arbeit in den Tourist Informationen. Bei
Kaffee und Kuchen wurden schnell neue Kontakte
geknüpft und Pläne für zukünftige Treffen
geschmiedet. Ein großer Dank geht an die AOK in
Kleve, die ihre Eventfläche für das Treffen zur
Verfügung stellte.
Wer Interesse an
einer ehrenamtlichen Tätigkeit im
Tourismusbereich hat, ist herzlich eingeladen,
sich bei den Tourist Informationen in Kleve
(unter 02821 84806 oder tourismus@wtm-kleve.de)
oder Emmerich am Rhein (unter 02822 931040
oder tourismus@wfg-emmerich.de) zu melden.
Wesel Fachkräfte der Zukunft: Landrat
Ingo Brohl begrüßt 26 neue Auszubildende in der
Kreisverwaltung
Am Dienstag, 5.
August 2025, begrüßte Landrat Ingo Brohl 26 neue
Auszubildende bei der Kreisverwaltung. „Als
Kreisverwaltung Wesel bieten wir einen
umfassenden und praxisnahen Start ins
Berufsleben. Unsere Ausbildung bietet eine
spannende Vielfalt an sinnstiftenden Aufgaben
und schafft ein stabiles Fundament für die
berufliche Zukunft.
Mit der Arbeit in
einer öffentlichen Verwaltung können die jungen
Talente einen positiven Beitrag für die Menschen
im Niederrhein Kreis Wesel und insgesamt für das
Funktionieren unseres
freiheitlich-demokratischen Staatswesen leisten.
Als Arbeitgeber profitieren wir vom Engagement
und den jungen Sichtweisen unserer neuen
Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr,
dass wir auch in diesem Jahr so viele junge
Menschen für einen Karrierestart beim Kreis
Wesel gewinnen konnten.“
Die Ausbildung
beim Kreis Wesel zeigt erneut auch in diesem
Jahr ein vielseitiges Ausbildungsprogramm.
Sieben Inspektoranwärterinnen und -anwärter, 15
Auszubildende für den Bereich
Verwaltungsfachangestellte, ein Student im
Bereich Verwaltungsinformatik, zwei
Auszubildende als Vermessungstechniker und eine
Auszubildende zur medizinischen Fachangestellten
starteten am Dienstag ihre Ausbildungszeit.
Die Kreisverwaltung Wesel ist stolz darauf,
ihre Auszubildenden auf eine langfristige
Karriere als Fachkräfte in der Verwaltung
praxisorientiert vorzubereiten. Somit bestehen
für die Auszubildenden gute Chancen, nach
erfolgreich bestandener Ausbildung in ein
krisensicheres Dauerarbeitsverhältnis übernommen
zu werden.
Die kontinuierliche Förderung
von Nachwuchstalenten ist für den Kreis Wesel
außerdem ein wichtiger Beitrag, um dem
Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken. Zurzeit
befinden sich insgesamt 75 Auszubildende in
verschiedenen Ausbildungsberufen bei der
Kreisverwaltung Wesel.
Die
Kreisverwaltung Wesel heißt ihre 26 neuen
Auszubildenden herzlich willkommen.

Diese Nachwuchskräfte haben ihren Dienst
aufgenommen:
Inspektoranwärterinnen und
-anwärter
Jakob Jordans
Maja Kommer
Emma Sophie Kotzke
David Röhrkasten
Ricky
Sarkisian
Maike Thürmer
Vivien Plückelmann
Student im Bereich Verwaltungsinformatik.
Timo Köpp
Verwaltungsfachangestellte
Daniel Baier
Michelle Ditsch
Hannah
Louisa Konen
Marvin Loch
Ajosha Plotzke
Hannah Pollmann
Mia-Sophie Reiche
Laura
Rabea Rösken
Anne-Christine Schikyr
Siyer
Tekin
Michelle Uhde
Kirsten van der Kuil
Niklas Walter
Nadine Willmes
Emma Sofia
Wolf Varandas
Vermessungstechniker
Marc
Düpre
Luca Teklote
Medizinische
Fachangestellte
Jule Kröncke
Studierende
im Rahmen des Projektes „Studienförderung
Soziale Arbeit“
Friederike Niblau
Hannah
Cebula
Tiziana Pagana
Stadt
Moers reagiert auf Parkverstöße
Die Stadt Moers macht die bestehende
Parkregelung in Teilen des Rheinkamper Rings nun
sichtbarer. In den betroffenen Straßen werden
dafür erlaubte Parkflächen mit
Markierungssteinen – sogenannten ‚P‘-Steinen -
deutlich gekennzeichnet.
Es handelt sich
um eine Klarstellung der geltenden Vorgaben.
Anlass waren Beschwerden von Anwohnerinnen und
Anwohnern über Falschparker. Die Maßnahme
betrifft die Straßen Beckers Kull,
Maria-Juchacz-Straße, Am Hasloth, An der Hees,
Im weißen Hag und Vichter Acker.
Risikofaktor Energiewende: Unternehmen
verlieren Vertrauen, Investitionen bleiben aus -
IHK stellt NRW-Zahlen zum Energiewendebarometer
2025 vor
Die Energiewende
gerät zunehmend zum Risiko für die
NRW-Wirtschaft: Viele Unternehmen fühlen sich
überfordert, Investitionen werden gestoppt,
Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Das zeigt
das aktuelle Energiewende-Barometer 2025 des
Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK),
an dem sich über 3.600 Unternehmen beteiligt
haben – davon 727 aus Nordrhein-Westfalen.
Wettbewerbsfähigkeit massiv unter Druck
Das Ergebnis ist alarmierend: Nur jedes fünfte
Unternehmen in NRW sieht positive Auswirkungen
der Energiewende auf die eigene
Wettbewerbsfähigkeit. In der Industrie sind es
sogar nur 13,1 % der befragten Unternehmen. 36,9
% aller Unternehmen und 58,4 % der
Industrieunternehmen sehen eine zum Teil
deutliche Verschlechterung der
Wettbewerbsfähigkeit.
Unternehmen
ziehen Konsequenzen „Überwiegend halten die
NRW-Unternehmen am Ziel fest, klimaneutral zu
werden (88,5 %)“, sagt Ralf Stoffels, Präsident
von IHK NRW. „Doch der Weg dahin ist schwierig.
Gerade in NRW mit der hohen Anzahl
energieintensiver Branchen sind die Unternehmen
skeptischer als im Bund. Die Unsicherheit zeigt
sich darin, dass viele weiterhin nicht
investieren.“
Die Investitionen von
Unternehmen gelten als Frühwarnsystem für die
wirtschaftliche Entwicklung. Besonders
dramatisch ist die Lage in NRW: 42 % der
produzierenden Unternehmen verschieben
Investitionen, 29,3 % stoppen Ausgaben für
Klimaschutzprojekte. Das ist ein Rückschritt in
der Transformation – und ein strukturelles
Risiko für Arbeitsplätze und Innovationskraft.
Was die Transformation behindert Viele
Probleme der Energiewende sind hausgemacht. Mit
68,5 % erreicht die Unzufriedenheit mit der
Bürokratie einen neuen Rekordwert. 60,2 % der
Unternehmen kritisieren die fehlende Planbarkeit
der politischen Rahmenbedingungen der
Energiewende.
48,2 % der
nordrhein-westfälischen Unternehmen bemängeln
zudem langsame Planungs- und
Genehmigungsverfahren. Die hohen Energiepreise
(30%), Finanzierungsmöglichkeiten (17,7 %) und
fehlende Fachkräfte (17,3 %) sind weitere
Aspekte, die die Transformation erschweren.
Klare Forderung an die Politik Im
Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung
zugesagt, die Stromsteuer für alle Verbraucher
auf das europäische Mindestmaß zu senken. Diese
Entlastung ist bis heute ausgeblieben, obwohl
sich 84,2 % aller Unternehmen klar für eine
Senkung der Strompreise aussprechen. Diese würde
zudem Investitionen in klimafreundliche Anlagen
und Technologien vom Elektroauto bis zur
Wärmepumpe attraktiver machen. Strom ist für
45,8 % der Unternehmen im letzten Jahr teurer
geworden, was die Standortnachteile verschärft.
Ein Plan B für die Energiewende
„Wir brauchen einen Plan B für die Energiewende,
damit diese funktioniert“, so Ralf Stoffels
weiter. „Nur, wenn die Unternehmen auch in
Zukunft am Standort Nordrhein-Westfalen
investieren, sichern wir Arbeitsplätze und
unseren Wohlstand.“
Von der Politik
erwartet die nordrhein-westfälische Wirtschaft
klare, verlässliche Rahmenbedingungen und einen
deutlichen Abbau von Bürokratie, die zum
kostenintensiven Treiber der Energiewende
geworden ist. Es sei höchste Zeit für einen
„Plan B“, damit die Energiewende vom
Risikofaktor zum Entwicklungsfaktor für die
Unternehmen wird.
Die bundesweiten
Ergebnisse finden Sie hier:
Energiewende hat für jeden dritten Betrieb
negative Folgen
Rohrbruch in Moers-Kapellen: Einige
Anwohner der Bahnhofstraße waren bis nachmittags
ohne Trinkwasser
Ein
Wasserrohrbruch in Moers-Kapellen hat den
Bereitschaftsdienst des Moerser
Wasserlieferanten ENNI Energie & Umwelt
Niederrhein (Enni) am frühen Dienstagmorgen in
Atem gehalten. Eine große Netzleitung mit einem
Durchmesser von 15 Zentimetern war vermutlich
infolge eines bergbaubedingten Spätschadens im
Gehweg der Bahnhofstraße am Ortsausgang vor der
Hausnummer 76 geborsten.
„Solche Schäden
treten in ehemaligen Bergbaugebieten zwar nur
noch selten auf, sind aber auch Jahre nach Ende
der Bergbautätigkeit möglich“, erklärte Markus
de Zeeuw, Baustellenbeauftragter der Enni, nach
der Schadensaufnahme. So drangen aus einem
Längsriss in der Leitung große Mengen Wasser
aus, wodurch in einigen angrenzenden Häusern
Keller vollliefen.
Für die Reparatur
musste der Bereitschaftsdienst die
Wasserversorgung zwischen den Hausnummern 58 und
76 für die Anwohner einige Stunden sperren. In
Zusammenarbeit mit einem Tiefbauunternehmen
legten Mitarbeiter das beschädigte Leitungsstück
frei, tauschten es auf einer Länge von rund
sechs Metern aus und banden es über sogenannte
Muffen wieder an das Wassernetz an.
Zuvor hatte Enni die Bürger und Vertreter einer
dort anliegenden Seniorenresidenz informiert,
die sich während der Arbeiten über einen
bereitgestellten Hydranten mit Wasser versorgen
konnten. Noch am Dienstagnachmittag war der
Schaden behoben.
Da sich die Bruchstelle
außerhalb des Straßenbereiches befand, wurde der
Straßenverkehr nur wenig beeinträchtigt.
Fußgänger werden aber noch bis zur kommenden
Woche an der Baustelle vorbeigeleitet. „Bis
dahin wird es dauern, bis der erst vor wenigen
Wochen erneuerte Gehweg wieder hergestellt sein
wird.“
Dinslaken: Fortschritte beim Neubau zur
Erweiterung der Klaraschule
Der
erste Bauabschnitt für die Erweiterung der
Klaraschule zu einer dreizügigen Grundschule
entwickelt sich planmäßig und ist bereits gut
sichtbar auf dem Schulgelände. Nur wenige Monate
nach dem Ratsbeschluss Ende Januar konnten durch
die ProZent GmbH die vorgefertigten Module am
30. Juli 2025 aufgestellt werden.

Ein wichtiger Meilenstein im Gesamtprojekt, wie
Mario Balgar, Geschäftsführer der ProZent GmbH,
erläutert: "Die Zusammenarbeit aller Beteiligten
von der ProZent GmbH über die städtischen
Fachämter bis hin zur Schule verläuft
reibungslos. Dank eines Modulbauers, der
Produktion und Lieferung in kurzer Zeit
sicherstellen konnte, schreitet der Bau schnell
voran.
Das Gebäude entspricht modernen
Standards innen wie außen und bewegt sich auch
bei den Baukosten in einem erwartbaren Rahmen."
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel erklärt: "Der
Modulbau an der Klaraschule steht nicht nur für
Geschwindigkeit, sondern auch für moderne
Bauqualität und vorausschauende Planung. Die
Erweiterung der Klaraschule trägt dazu bei, den
wachsenden Bedarf an Schulplätzen in Dinslaken
zu decken. Es ist erfreulich, dass hier zeitnah
wertvolle Räume für Unterricht und Lernen
geschaffen werden."
In den kommenden
Wochen erfolgen der Ausbau der Innenräume sowie
die technische Ausstattung. Lediglich eine
kurzfristige Lieferverzögerung bei den Fenstern
ist zu verzeichnen. Diese Nachlieferung ist
jedoch für die nächsten zwei Wochen terminiert.
Die Arbeiten können planmäßig fortgesetzt
werden. Das neue Gebäude in Modulbauweise wird
zwei Klassenräume mit zwei dazugehörigen
Differenzierungsbereichen sowie Sanitärräumen
bieten.
Im Anschluss an die
Hochbauarbeiten werden durch den Fachdienst
Grünflächen in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst
Tiefbau die Schulhofflächen als ansprechender
Bewegungs- und Aufenthaltsraum für Schülerinnen
und Schüler gestaltet und eine ökologische
Regenwasserversickerung realisiert.
Alle
Projektbeteiligten blicken weiterhin
zuversichtlich auf die Inbetriebnahme des neuen
Gebäudes, die in enger Abstimmung mit der Schule
und der Verwaltung voraussichtlich etwa zwei
Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres
erfolgen soll. Durch diese abgestimmte
Verschiebung ist sichergestellt, dass der
Unterricht an der Klaraschule gemäß
Ratsbeschluss planmäßig und ohne Einschränkungen
stattfinden wird.
Die leichte
Terminverschiebung hat keine Auswirkungen auf
den regulären Schulbetrieb. Der Modulbau steht
exemplarisch für effizientes und
zukunftsorientiertes Bauen im Schulbereich und
dient als Modell für künftige Projekte in der
Region.
Das MuseumMobil kommt nach Kleve!
Vom 8. bis zum 17. August ist das Haus der
Geschichte Nordrhein-Westfalen mit MuseumMobil
zu Gast in Kleve! Entdecken Sie im
MuseumMobil-Container am Koekkoekplatz in Kleve
Geschichten aus Nordrhein-Westfalen, die
überraschen, berühren und Erinnerungen wecken –
von der Landesgründung bis heute. Freuen Sie
sich auf ein vielfältiges Programm aus
Gesprächen, einem Sammelsamstag und Angeboten
für Gruppen und Kinder.

Der Container des MuseumMobil. Foto: Stiftung
Haus der Geschichte NRW / Jan Heesen.
Informationen und Texte der Stiftung Haus der
Geschichte NRW.
Auf der Suche nach der
Geschichte unseres Landes laden wir Sie ein, mit
uns über Nordrhein-Westfalen ins Gespräch zu
kommen. Beteiligen Sie sich mit ihrer
NRW-Geschichte am Aufbau der Sammlung des neuen
Hauses zur nordrhein-westfälischen
Landesgeschichte.
Alle Angebote im Rahmen des
MuseumMobil in Kleve sind komplett kostenfrei!
Eröffnung MuseumMobil Kleve - 7. August 2025,
18:00 Uhr
Was passiert, wenn durch den
Anstieg des Meeresspiegels 17 Millionen
orangefarbenen Klimaflüchtlinge mit ihren
Wohnwagen auf der linken Spur nach Deutschland
rollen? Sind wir dann bereit, unsere geliebten
holländischen Nachbarn aufzunehmen?
Zur
Eröffnung von MuseumMobil in Kleve nimmt der
niederländische Kabarettist Patrick Nederkoorn
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
Deutschen und Niederländer humorvoll unter die
Lupe. Mit amüsanten, lebensnahen - manchmal auch
bitterbösen - Anekdoten erzählt er vom Umgang
beider Seiten der Grenze mit Themen wie
Migration und Klimawandel.
B.C.
Koekkoek-Haus, Koekkoekplatz 1, 47533 Kleve
Info und Anmeldung: Tel. +49 211 513 613-33
Sammelsamstag Kleve - 16. August 2025,
14 bis 17 Uhr
Haben Sie ein
Objekt zu Hause, das NRW-Geschichte geschrieben
hat? Gegenstände aus der Zeit nach 1946 – einen
Koffer vom Dachboden mit Fotos oder Dingen aus
Unna, die von der Alltags- oder
Wirtschaftsgeschichte erzählen? Oder andere
zeithistorische Gegenstände, Dokumente oder
Fotos aus Ihrer Region?
Mit Ihrer Unterstützung sammeln wir in Kleve
Ihre Geschichte(n).
Kommen Sie damit am
Sammelsamstag in die Touristeninformation im
Klever Rathaus, Minoritenplatz 2, und machen Sie
Ihre persönliche NRW-Geschichte zum Teil der
Sammlung des künftigen Hauses der Geschichte
Nordrhein-Westfalen.
Touristeninformation, Minoritenplatz 2, 47533
Kleve
Info und Anmeldung: Tel. 0211 513
613-33
besucherservice@hdgnrw.de
Das
MuseumMobil ist barrierearm zugänglich.
-
Eine Rampe ermöglicht den stufenlosen Zugang mit
Rollstuhl oder Rollator zu unserem
Ausstellungscontainer.
- Die
Ausstellungstexte sind in deutscher
Alltagssprache, in einfacher Sprache und
englischer Sprache über Touchscreens vor Ort
einfach zu lesen.
- Für blinde und
seheingeschränkte Besucherinnen und Besucher
besteht die Möglichkeit, die
Ausstellungsinformationen über ein Tablet mit
Screenreaderfunktion abzurufen.
- Sprechen
Sie hierfür gerne unsere Kolleginnen und
Kollegen vor Ort an.
Angebote für Gruppen
Für Gruppen bis zu 10 Personen bieten wir nach
Anmeldung einen begleiteten Besuch des
MuseumMobil an: eine kurze Einführung wird
verbunden mit einem Besuch unserer begehbaren
Ausstellung.
53 Objekte aus
Nordrhein-Westfalen zeigen Ihnen ein breites
Spektrum unserer Geschichte. Kommen Sie anhand
der Objekte und mit interaktiven Impulsen mit
uns ins Gespräch: Was ist eigentlich
Nordrhein-Westfalen für Sie und was ist Ihre
persönliche NRW-Geschichte?

Siedlungs- und Verkehrsfläche wächst jeden
Tag um 51 Hektar
• 14,6 % der Gesamtfläche Deutschlands sind
Siedlungs- und Verkehrsflächen
• Revidierte
Ergebnisse für 2020 bis 2022 verfügbar
Die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland
ist im vierjährigen Mittel der Jahre 2020 bis
2023 durchschnittlich um 51 Hektar pro Tag
gewachsen. Dies zeigen die aktuellen
Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) zum Nachhaltigkeitsindikator "Anstieg
der Siedlungs- und Verkehrsfläche".
Insgesamt nahm der tägliche Anstieg im Mittel
der Jahre 2020 bis 2023 gegenüber dem
vergleichbaren Zeitraum der Vorjahre um rund 2
Hektar zu (49 Hektar pro Tag in den Jahren 2019
bis 2022). Ziel der Bundesregierung in der
deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist es, den
durchschnittlichen täglichen Anstieg bis zum
Jahr 2030 auf unter 30 Hektar zu begrenzen. Bis
2050 wird eine Flächenkreislaufwirtschaft
angestrebt. Das heißt, es sollen dann netto
keine weiteren Flächen für Siedlungs- und
Verkehrszwecke beansprucht werden.
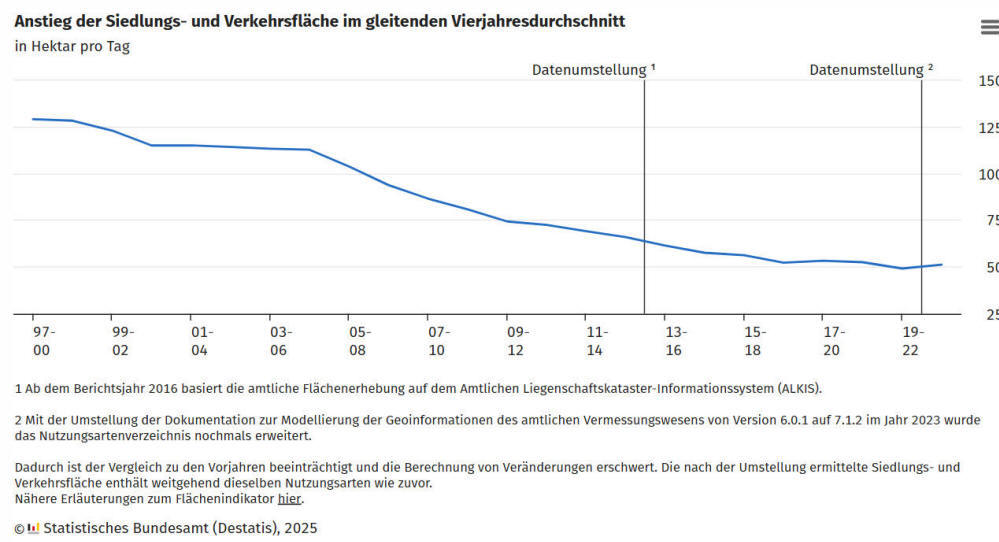
Die Siedlungs- und Verkehrsfläche darf nicht
mit versiegelter Fläche gleichgesetzt werden, da
sie auch unversiegelte Frei- und Grünflächen
enthält. Dazu zählen beispielsweise alle den
Gebäuden unmittelbar zugehörigen Flächen wie
Haus- und Vorgärten oder Campingplätze. Auch
Grünanlagen, Spielplätze und Friedhöfe zählen
zur Siedlungs- und Verkehrsfläche.
Flächen für Wohnbau, Industrie und Gewerbe
wachsen langsamer
Innerhalb der
Siedlungsfläche zeigte sich 2023 ein verändertes
Bild im Vergleich zu den Vorjahren: Die Flächen
für Wohnbau, Industrie und Gewerbe sowie
öffentliche Einrichtungen wuchsen 2023 um 35
Hektar pro Tag. Teil der Industrie- und
Gewerbeflächen sind auch Flächen für den Ausbau
der erneuerbaren Energien.
Besonders
deutlich war die Zunahme der Flächen für
Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Bayern um
17,2 % im Jahr 2023. Insgesamt war die Zunahme
der Flächen für Wohnbau, Industrie und Gewerbe
sowie öffentliche Einrichtungen im Jahr 2023
jedoch aufgrund der abnehmenden Bautätigkeit im
Innen- und Außenbereich von Gemeinden und
Städten schwächer als in den beiden Vorjahren.
2022 hatte die Zunahme dieser Flächen 37
Hektar pro Tag betragen, 2021 waren es 39 Hektar
pro Tag und 2020 noch täglich 40 Hektar.
Ursächlich hierfür waren insbesondere Rückgänge
der Flächen für Industrie und Gewerbe in
Brandenburg (-7,1 %) und Thüringen (-6,7 %).
Sport-, Freizeit- und Erholungs- sowie
Friedhofsflächen nahmen 2023 gegenüber dem
Vorjahr deutlich zu, nämlich um 17 Hektar pro
Tag (2022: 12 Hektar pro Tag).
Besonders
stark nahmen die Sport-, Freizeit- und
Erholungsflächen in Brandenburg mit +14,8 % zu.
Grund hierfür ist die Rückführung von
Bauerwartungsflächen zu Sport-, Freizeit- und
Erholungsflächen. 14,6 % der Bodenfläche
Deutschlands für Siedlungs- und Verkehrszwecke
verwendet 14,6 % und damit 5,2 Millionen Hektar
der Gesamtfläche Deutschlands werden für
Siedlungs- und Verkehrszwecke in Anspruch
genommen.
Davon entfallen 9,5 % (3,4
Millionen Hektar) auf die Siedlungsfläche
(einschließlich Bergbaubetriebe, Tagebau, Grube
und Steinbruch) und 5,1 % (1,8 Millionen Hektar)
auf die Verkehrsfläche. Insgesamt umfasst die
Gesamtfläche Deutschlands 35,8 Millionen Hektar.
Die Fläche für Vegetation bildet mit
83,1 % den höchsten Anteil (29,7 Millionen
Hektar). Diese besteht im Wesentlichen aus
Flächen für Landwirtschaft mit 50,3 % (18,0
Millionen Hektar) und Waldflächen mit 29,9 %
(10,7 Millionen Hektar). Lediglich 2,3 % der
bundesdeutschen Fläche sind mit Gewässern (0,8
Millionen Hektar) bedeckt.
NRW-Industrie: Energieintensive
Produktion im Juni 2025 um 2,1 % gesunken
* Produktion in der übrigen Industrie
unverändert.
* Metallerzeugung und
-bearbeitung mit Produktionseinbußen.
*
Rückläufige Werte im Vergleich zu Februar 2022
sowohl in der energieintensiven als auch in der
übrigen Industrie. S
Die Produktion der
NRW-Industrie ist im Juni 2025 nach vorläufigen
Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt um
0,7 % gegenüber Mai 2025 gesunken. Wie
Information und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt mitteilt, sank die
Produktion in den energieintensiven
Wirtschaftszweigen um 2,1 %. Die Produktion in
der übrigen Industrie blieb gegenüber dem
entsprechenden Vormonat unverändert. Verglichen
mit dem Vorjahresmonat sank die Produktion um
3,3 %. Die der energieintensiven Industrie sank
um 9,0 %; die Produktion in der übrigen
Industrie blieb auch hier unverändert.
Metallerzeugung und -bearbeitung mit größtem
Rückgang innerhalb der energieintensiven
Branchen
Im Vergleich zu Mai 2025 waren in
NRW für die energieintensiven Branchen im Juni
2025 unterschiedliche Entwicklungen zu
beobachten: Innerhalb der energieintensiven
Branchen wurde für die Metallerzeugung und
-bearbeitung ein Produktionsrückgang von 5,3 %
(−11,1 % ggü. dem Vorjahresmonat) ermittelt. In
der Kokerei- und Mineralölverarbeitung sank die
Produktion um 1,5 % (−12,6 % ggü. dem
Vorjahresmonat).
Die chemische Industrie
vermeldete hingegen ein leichtes Produktionsplus
von 0,1 % (−8,3 % ggü. dem Vorjahresmonat).
Unterschiedliche Entwicklungen auch in den
Branchen der übrigen Industrie In den Branchen
der übrigen Industrie waren ebenfalls
unterschiedliche Entwicklungen zu erkennen: Die
Produktionsleistung bei der Herstellung von
Möbeln stieg um 5,1 % (+1,3 % ggü. dem
Vorjahresmonat).
Im Bereich Herstellung
von Nahrungs- und Futtermitteln wurde ein
Produktionsplus von 2,9 % verzeichnet (+3,1 %
ggü. dem Vorjahresmonat). Auch die Herstellung
von Kraftwagen und Kraftwagenteilen konstatierte
eine Produktionssteigerung von 2,5 % (+0,1 %
ggü. dem Vorjahresmonat).
Die
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten sowie
elektronischen und optischen Erzeugnissen
vermeldete dagegen einen Produktionsrückgang von
7,7 % (−5,6 % ggü. dem Vorjahresmonat). Die
Getränkeherstellung verzeichnete ein
Produktionsminus von 3,9 % (−6,7 % ggü. dem
Vorjahresmonat).
Im Vergleich zu Februar
2022, zu Beginn des Krieges in der Ukraine, sank
die Produktion im Juni 2025 insgesamt um 11,6 %
(−15,8 % in der energieintensiven Industrie;
−9,3 % in der übrigen Industrie). Wie das
Statistische Landesamt weiter mitteilt, lag der
revidierte kalender- und saisonbereinigte Wert
für den Berichtsmonat Mai 2025 um 0,8 % unter
dem Vormonats- und 3,6 % unter dem
Vorjahreswert.
Sieben Auszubildende starten 2025 in ihr
Berufsleben bei der Stadt Wesel
Sieben neue Auszubildende wurden am 01.08.2025
bei der Stadt Wesel begrüßt.

Jeweils von links nach rechts: 1. Reihe: Kenan
Mimic, Jan Philipp Albustin, Malin Erk, Nele
Schruff, Dana Bachmann, Eike-Simon Möthe 2.
Reihe: Heiko Hemmers, Vorsitzender
Gesamtpersonalrat, Regina Schmitz-Lenneps,
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wesel,
Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, Jan Leibnitz,
Beigeordneter Dr. Markus Postulka 3. Reihe:
Beigeordneter Rainer Benien, Teamleiter
Informationstechnik Michael Pumpe, Teamleiterin
Bauleitplanung Christiane Hanisch,
Stadtinspektoranwärterin Clarissa Bollmann,
Alicia Özmen (Jugend- und
Auszubildendenvertretung), Ausbildungsleiter
Yannik Meis, Nick Weilers (Jugend- und
Auszubildendenvertretung)
Sieben
Nachwuchskräfte haben zum 01. August 2025 ihre
Ausbildung bei der Stadt Wesel begonnen.
Jan-Philipp Albustin, Dana Bachmann, Malin Erk,
Kenan Memic und Nele Schruff erlernen den Beruf
der/des Verwaltungsfachangestellten. Zudem
startet Jan Leibnitz als Auszubildender für den
Beruf des Bauzeichners. Darüber hinaus beginnt
Eike-Simon Möthe seine Ausbildung zum
Fachinformatiker.
Begrüßt wurden die
neuen Auszubildenden unter anderem durch
Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, die beiden
Beigeordneten der Stadt Wesel Rainer Benien und
Dr. Markus Postulka, Ausbildungsleiter Yannik
Meis, Heiko Hemmers vom Gesamtpersonalrat, sowie
der Gleichstellungsbeauftragten Regina
Schmitz-Lenneps und Mitgliedern der Jugend- und
Auszubildendenvertretung.
Zum 01.
September 2025 werden acht weitere dual
Studierende im gehobenen nichttechnischen
Verwaltungsdienst ihr duales Studium aufnehmen.
Ebenfalls am 01. September 2025 werden zwei
Notfallsanitäter und eine duale Studentin der
Sozialen Arbeit ihre Ausbildung bei der Stadt
Wesel beginnen. Des Weiteren beginnen vier
Brandmeisteranwärter und
Brandmeisteranwärterinnen, sowie erstmalig ein
dualer Student im Studiengang Raumplanung ihre
Laufbahn bei der Stadt Wesel.
Insgesamt
sind dann mit Stand zum 01. Oktober 2025 bei der
Weseler Stadtverwaltung 44 Auszubildende
beschäftigt. Auch für das Jahr 2026 sucht die
Stadt Nachwuchskräfte. Eingestellt werden
Inspektoranwärterinnen bzw. Inspektoranwärter
für den gehobenen Dienst (Bachelor-Studiengang
FH) und Verwaltungsfachangestellte, sowie
Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste mit der Fachrichtung
Bibliothek.
Bewerbungen können online
über das Bewerbungsportal auf der städtischen
Internetseite eingereicht werden.
Bewerbungsschluss ist der 9. Oktober 2025.
Weitere Informationen und das Bewerbungsportal
finden Interessierte unter www.wesel.de/ausbildung.
Nachwuchskräfte sind bei der Stadt Moers
gestartet
Neuer Schwung fürs
Rathaus und die städtischen Einrichtungen:
Insgesamt 45 junge Menschen sind am Freitag, 1
August, bei der Stadtverwaltung Moers offiziell
ins Berufsleben eingetreten.

Insgesamt 45 junge Menschen sind am Freitag, 1
August, bei der Stadtverwaltung Moers in ihre
Ausbildung, in ihr berufsbegleitendes Studium
oder in ihr Praktikum gestartet. (Foto: pst)
Sie werden in der kommenden Zeit in
verschiedenen Berufen und Bereichen ausgebildet.
Darunter befinden sich Auszubildende zu
Verwaltungsfachangestellten sowie Anwärterinnen
und Anwärter für den Beamtendienst, aber auch
Brandmeisteranwärterinnen und –anwärter,
Notfallsanitäterinnen und -sanitäter sowie
Praktikantinnen/Praktikanten und Auszubildende
in Berufen in Kindertageseinrichtungen und im
sozialen Dienst.
Zudem sind an dem Tag
zwei angehende Verwaltungsinformatiker und eine
zukünftige Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste für die Arbeit in der
Bibliothek Moers gestartet.
Gute Ideen
in die Ausbildung einbringen
Thomas Waerder,
Leiter des Fachdienstes Interner Service, sowie
Vertreterinnen und Vertreter der
Ausbildungsleitung und weiterer Fachbereiche
begrüßten die Neuzugänge: „Heute beginnt für Sie
ein neuer Lebensabschnitt. Sie stehen am Anfang
einer spannenden Reise, die Sie hoffentlich zu
qualifizierten Fachkräften machen wird. Wir
freuen uns, Sie auf diesem Weg begleiten zu
dürfen!“
Thomas Waerder riet den jungen
Leuten, neugierig und kreativ zu sein und sich
bereits während der Ausbildung mit guten Ideen
einzubringen. Auch Vera Breuer, Leiterin das
Fachbereichs Jugend, richtete motivierende Worte
an die neuen Kolleginnen und Kollegen: „Die
Ausbildung hier ist eine gute Herausforderung an
der Sie wachsen können.“
Hilfestellungen
und die Beantwortung von Fragen rund um die
Ausbildung bot auch Kerstin Krech, Vorsitzende
der Jugend- und Auszubildendenvertretung, an:
„Wir sind für euch da!“
Quiz in
Moers
Die 3 besten Teams werden mit
einem Verzehr-Gutschein belohnt. Pro Team
können maximal 6 Teilnehmende antreten, die
Startgebühr beträgt pro Person 3 Euro. Anmelden
könnt ihr euch dienstags bis samstags ab 18 Uhr.
Entweder vor Ort bei den Kellnern/Kellnerinnen
selbst oder ihr ruft kurz an (0 28 41 / 1 69 25
78).

Veranstaltungsdatum 06.08.2025 - 19:30
Uhr - 22:00 Uhr. Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107, 47441 Moers. Veranstaltungsort Halle
Moers: Sparkassen Summer Soul am See
Jedes Jahr an einem Samstag im August
verwandelt sich das Gelände am Freizeitpark
Moers-Kapellen in eine Open-Air-Party. Auf der
Bühne bringen verschiedene Künstler mit Sounds
zwischen Soul, Funk und Rock die Zuhörer zum
Tanzen. Ohne Eintritt, aber dafür mit einer
riesigen Portion Funk & Soul steigt die Party
mit Liveacts vom Feinsten.

Für das leibliche Wohl sorgen Getränke- und
Imbissstände, so dass bis in die Nacht gefeiert
wird. Die Veranstaltung im Grünen mit Blick auf
den See des Freizeitparks hat eine ganz
besondere Atmosphäre und lockt Besucher aus
Moers und dem Umland. Event details
Veranstaltungsdatum 09.08.2025 - 18:00
Uhr - 23:30 Uhr. Veranstaltungsort Freizeitpark
Moers-Kapellen (Bahnhofstraße, Ecke Lauersforter
Straße)
Kleidertausch Moers
Der Kleidertausch ist
in neuem Format zurück! Bring deine alten
Klamotten und nimm Neue mit! Etwas hat kleine
Makel? Zusammen machen wir es wieder neu in
unserer Nähecke.
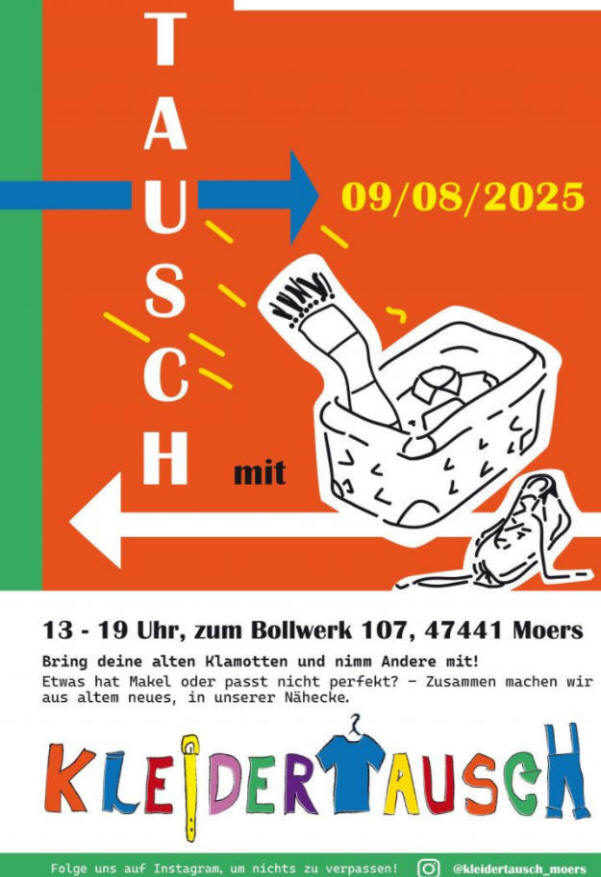
Veranstaltungsdatum 09.08.2025 - 13:00
Uhr - 19:00 Uhr Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107 47441 Moers Veranstaltungsort Halle-Outdoor
Moers: Architekturführung
Innenstadt 2 - Homberger Straße
Entlang den Moerser
Haupt-Geschäftsstraßen entdecken wir in der
Innenstadt Gebäude aus ganz unterschiedlichen
Zeiten. Oft ist ihre Architektur verkleidet
oder verändert worden. Wer hochschaut, entdeckt
aber gerade an den Fassaden oberhalb der
Ladengeschosse Details, die Auskunft über die
Geschichte der Häuser geben.

Treffpunkt: Oranierhäuser, Haagstraße 63
Geführt von: Eva-Maria Eifert Kosten: 8 Euro
Weitere Infos zu den Stadtführungen.
Veranstaltungsdatum 10.08.2025 - 10:30
Uhr - 12:30 Uhr. Veranstaltungsort Homberger
Höfe am Kreisverkehr Augustastraße
IG BAU
Duisburg-Niederrhein: Bewerbung bis 1. September
– 300 Euro pro Monat Stipendium winkt: Fitte
Azubis sollen ihren Hut in den Ring werfen
Top-Azubis haben die Chance auf ein
dickeres Portemonnaie: Gute und engagierte
Auszubildende in Duisburg können sich jetzt für
ein Stipendium bewerben. Die gewerkschaftsnahe
Hans-Böckler-Stiftung unterstützt mit dem
Projekt „Talente in der Beruflichen Bildung“
(TiBB) junge Menschen, die in der Ausbildung
hervorstechen.
Ihnen winken mit dem
Stipendium 300 Euro pro Monat – und das drei
Jahre lang, so die IG BAU Duisburg-Niederrhein.
Wer sich bewerben wolle, müsse am Ende des
ersten oder am Anfang des zweiten
Ausbildungsjahres sein. Die
Hans-Böckler-Stiftung nehme Bewerbungen noch bis
zum 1. September entgegen. Mehr Infos unter:
www.tibb-boeckler.de/index.htm

„Es geht um fitte Azubis: Um Jugendliche, die in
der Ausbildung gut sind, die im Betrieb einiges
bewegen und die sich auch im Alltag engagiert
zeigen und Verantwortung übernehmen“, sagt
Karina Pfau von der IG BAU. Wer in Duisburg so
einen Azubi kenne, solle ihm einen Tipp auf das
TiBB-Stipendium geben.
„Es lohnt sich,
jetzt den Hut in den Ring zu werfen. Dabei
spielt es keine Rolle, welchen Beruf der Azubi
ansteuert: Ob als Maler oder Maurer, Floristin,
Fliesenleger oder Forstwirt – ganz egal.
Hauptsache, die Azubis sind motiviert und haben
Lust, die Arbeitswelt von morgen mit guten Ideen
voranzubringen“, so die Vorsitzende der IG BAU
Duisburg-Niederrhein, Karina Pfau.
Neben
dem monatlichen Stipendiengeld fördere TiBB die
Azubis auch gezielt: „Es gibt ‚Extra-Portionen
Bildung‘: Das Stipendium unterstützt die
Jugendlichen darin, den späteren Beruf zu
meistern. Es bietet Module zur Weiterbildung.
Dabei geht es um berufsübergreifende
Kompetenzen, um Demokratie- und
Karriereförderung. Außerdem winken Sprachkurse
und ein Auslandsaufenthalt“, so Karina Pfau.
Gefördert wird das Stipendium vom
Bundesministerium für Forschung, Technologie und
Raumfahrt.
Wer kann Streit
schlichten? Stadt Wesel sucht ehrenamtliche
Schiedspersonen
Schiedsfrauen und
Schiedsmänner helfen den Beteiligten bei
kleineren zivil- und strafrechtlichen
Streitigkeiten, ihre Auseinandersetzung
unbürokratisch und kostengünstig beizulegen.
Schiedspersonen arbeiten ehrenamtlich und werden
unter Aufsicht des Amtsgerichtes tätig. Sie
entscheiden nicht wie ein Richter, sondern haben
die Aufgabe, zwischen den sich streitenden
Parteien zu schlichten.
Die
Schiedsamtsbezirke Wesel I und Wesel III sind im
Herbst 2025 neu zu besetzen. Daher macht die
Stadt Wesel darauf aufmerksam, dass sich
interessierte Personen um das Amt bewerben
können und Bewerbungen von Menschen mit
Migrationshintergrund ausdrücklich erwünscht
sind.
Schiedspersonen können
wiedergewählt werden. Aktuell stellt sich die
amtierende Schiedsperson für den Schiedsbezirk
Wesel I für eine Wiederwahl zur Verfügung. Für
den Schiedsamtsbezirk Wesel III liegen bislang
noch keine Bewerbungen vor. Interessierte
Personen, die diese ehrenamtliche Aufgabe
wahrnehmen möchten, sollten über ein
ausgeprägtes Rechtsempfinden verfügen, in dem
jeweiligen Schiedsamtsbezirk ihren Wohnsitz
haben und mindestens 25 Jahre alt sein.
Der Schiedsamtsbezirk Wesel I umgrenzt
folgendes Gebiet: Nördliche Innenstadt,
Schepersfeld, Feldmark bis Grenze Flüren. Der
Schiedsamtsbezirk Wesel III erstreckt sich auf
das Gebiet von Grav-Insel über Flürener Feld und
Flürener Heide bis einschließlich Blumenkamp.
Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Mitzubringen sind gesunde Menschenkenntnis,
Lebenserfahrung, Geduld, die Fähigkeit zur
Abfassung von schriftlichen Protokollen und
Vergleichen sowie die Bereitschaft, an Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen.
Nicht gewählt werden kann, wer die Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt
und wer unter Betreuung steht. Zur Schiedsperson
soll nicht gewählt werden, wer das 75.
Lebensjahr vollendet hat.
Die
Schiedspersonen werden durch den Rat der Stadt
Wesel für die Dauer von fünf Jahren gewählt.
Anschließend bestätigt die Leitung des
Amtsgerichts Wesel die Wahl und bestellt die
Gewählten zu Schiedspersonen. Bewerbungen können
schriftlich bei der Stadt Wesel (Rechtsservice,
Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel) bis zum 01.
September 2025 eingereicht werden.
Neben
Angaben zur Person (Name, Vorname, Geburtsname,
Geburtstag, Geburtsort, Beruf, Anschrift) sollte
die Bewerbung auch einen kurzen Lebenslauf
beinhalten. Für Rückfragen stehen die
Mitarbeiterin des Rechtsservice der Stadt unter
der Rufnummer 0281/203-2511 sowie der Teamleiter
des Rechtsservice der Stadt unter der Rufnummer
203-2412 zur Verfügung.
Brid erzählt aus der
oranischen Zeit von Moers
Bei der
Stadtführung ‚Brid und die Soldaten‘ am Samstag,
9. August, gibt es lustige und spannende
Geschichten aus der niederländischen Zeit von
Moers zu erleben. Start ist um 17.30 Uhr an der
Kapelle im Park Rheinberger Straße/Mühlenstraße.
Eine Betreuerin der Kriegstruppen, dargestellt
von Gästeführerin Renate Brings-Otremba,
erzählt, wie Prinz Moritz von Oranien die
Spanier aus Moers vertrieben hat.

(Foto: pst)
Zu hören ist auch die
Geschichte über den ‚Alten Dessauer‘ (Fürst
Leopold I.), der damals nicht nur den oranischen
Kommandanten im Schlafrock überraschte. Brid
zeigt auch, wo früher in Moers das Pesthaus
stand und berichtet, wie die Pest im 17.
Jahrhundert in Europa wütete.
Die
Teilnehmenden sollten zur Führung ein Pinneken
(kleines Schnapsglas) und zwei Fünf-Cent-Münzen
mitbringen. Die Teilnahme an der Führung kostet
pro Person 12 Euro. Verbindliche Anmeldungen
sind in der Stadt- und Touristinformation von
Moers Marketing möglich: Kirchstraße 27a/b,
Telefon 0 28 41 / 88 22 6-0.
Dinslaken: Sperrzeiten der DB-Brücke Weseler
Straße
Die DB-Brücke auf der
Weseler Straße wird im August an drei
Wochenenden gesperrt. Die Sperrzeiten lauten wie
folgt:
01.08.2025, 22:30 Uhr - 04.08.2025,
04:30 Uhr
08.08.2025, 22:30 Uhr -
11.08.2025, 04:30 Uhr
15.08.2025, 22:30 Uhr
- 18.08.2025, 04:30 Uhr
Für
Kraftfahrzeuge gibt es eine Umleitung über
Voerder Straße, Dinslakener Straße und
Rahmstraße. Fußgänger*innen werden auf die
Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Voerde geleitet.
Radfahrende verwenden, wie auch zum
gegenwärtigen Zeitpunkt, die eingerichtete
Radumleitung. Unter der Woche ist die Weseler
Straße wie zuvor befahrbar mit einer
Spureinengung.
Moers: Mitgestalten und mitentscheiden -
Integrationsratswahl am 14. September
Stadtpolitik mitgestalten:
Die Wahl des Integrationsrats findet am Sonntag,
14. September, auch in Moers statt. Der
Integrationsrat ist ein wichtiges politisches
Gremium für Menschen mit internationaler
Familiengeschichte.

Das Gremium vertritt die Interessen von Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte und bringt ihre
Perspektiven zu Themen wie Bildung, Arbeit,
Teilhabe, Chancengerechtigkeit und dem Abbau von
Benachteiligung aktiv in die Kommunalpolitik
ein.
Ziel ist es insgesamt, zu einem
guten Miteinander in der Stadt beizutragen. Wer
sich an der Wahl beteiligt, stärkt letztendlich
die Vielfalt in Moers. Vertreten sind in dem
Gremium neben den gewählten Mitgliedern auch
Vertreterinnen und Vertreter des Rats, der
ebenfalls am 14. September neu gewählt wird.
Wahlberechtigung – Eintragung in das
Wählerverzeichnis Wahlberechtigt sind
unterschiedliche Personengruppen.
Dazu
zählen Menschen mit einer ausländischen
Staatsangehörigkeit und einem rechtmäßigen
Aufenthalt in Deutschland, Deutsche mit einer
zusätzlichen Staatsangehörigkeit, eingebürgerte
Deutsche sowie Deutsche, die als Kinder
ausländischer Eltern die deutsche
Staatsangehörigkeit durch Geburt im Inland
erhalten haben.
Voraussetzungen sind,
dass man am Wahltag mindestens 16 Jahre alt ist
und spätestens bis zum 29. August 2025 mit
Hauptwohnsitz in Moers gemeldet ist. Zudem
müssen Personen ihren rechtmäßigen Aufenthalt
seit mindestens einem Jahr (ab 14. September
2024) im Bundesgebiet haben und in das
Wählerverzeichnis der Stadt Moers für die
Integrationsratswahl eingetragen sein.
Versand von Wahlbenachrichtigungen
Wahlberechtigte Moerserinnen und Moerser, die
bereits im Wählerverzeichnis vermerkt sind,
erhalten eine Wahlbenachrichtigung. Diese werden
voraussichtlich zwischen dem 4. und dem 24.
August versandt.
Wer nach dem Datum keine Wahlbenachrichtigung
erhalten hat und glaubt wahlberechtigt zu sein,
kann sich an die Mitarbeitenden der Fachgruppe
Wahlen wenden. Zudem kann es je nach
Staatsangehörigkeit sein, dass die Person auch
zur Teilnahme an den Kommunalwahlen berechtigt
ist. In diesem Fall werden zwei unterschiedliche
Wahlbenachrichtigungen versandt. Auch beachtet
werden sollte, dass zur Stimmabgabe am 14.
September möglicherweise zwei unterschiedliche
Wahllokale aufgesucht werden müssen.
Für
die Integrationswahl richtet die Stadt Moers
sieben Wahllokale ein. Für die Kommunalwahlen
sind es 72 Wahllokale. Auch die Beantragung von
Briefwahlunterlagen ist für die
Integrationsratswahl möglich. Weitere
Informationen zur Wahl des Integrationsrates und
der Kontakt zur Fachgruppe Wahlen finden Sie
unter dem Suchwort ‚Integrationsratswahl
2025‘

NRW: Wohnungsbestand 2024 im Vergleich zum
Vorjahr kaum gestiegen
*
9,3 Millionen Wohnungen in Wohn- und
Nichtwohngebäuden am 31.12.2024.
*
Durchschnittswohnung in NRW ist
92,4 Quadratmeter groß.
* Rund die Hälfte
der Wohnungen hat drei oder vier Räume.
*
Wohnfläche je Einwohner ist in Gelsenkirchen am
geringsten.
Zum Stichtag 31.12.2024 gibt
es in Nordrhein-Westfalen insgesamt
9,3 Millionen Wohnungen in Wohn- und
Nichtwohngebäuden. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, ist die Zahl der Wohnungen damit um
0,4 % höher als ein Jahr zuvor (+40.047
Wohnungen).
Die Durchschnittswohnung ist
92,4 qm groß – ein Drittel der Wohnungen hat
fünf und mehr Räume Im Durchschnitt ist eine
Wohnung in NRW 92,4 Quadratmeter groß. Jedem
Einwohner unseres Bundeslandes stehen
durchschnittlich 47,5 Quadratmeter Wohnfläche
zur Verfügung. Rein rechnerisch hat jede Wohnung
4,2 Räume (einschließlich Küchen) und wird von
1,9 Personen bewohnt.
Rund die Hälfte
der Wohnungen hat drei (24,5 %) oder vier
(26,8 %) Räume. Rund ein Drittel (34,3 %) aller
Wohnungen verfügt über fünf oder mehr Räume.
11,0 % sind Zweiraum- und 3,3 %
Einraumwohnungen. Die rein rechnerisch größten
Wohnungen des Landes gibt es Ende 2024 in den
Gemeinden Hopsten im Kreis Steinfurt
(135,8 Quadratmeter), Borgentreich im Kreis
Höxter (134,2) und Stemwede im Kreis
Minden-Lübbecke (133,8).
In den Städten
Aachen (76,0 Quadratmeter), in Gelsenkirchen
(76,8) sowie in Duisburg und Köln (jeweils 77,3)
sind die Wohnungen im Schnitt am kleinsten. Auch
die Wohnfläche, die jeder Einwohner zur
Verfügung hat, ist in den Städten Gelsenkirchen
(39,4 Quadratmeter) und Duisburg (40,0) sehr
gering, wohingegen im Hochsauerlandkreis (54,9)
sowie im Kreis Höxter (57,0) deutlich mehr
Wohnfläche je Einwohner zur Verfügung steht.
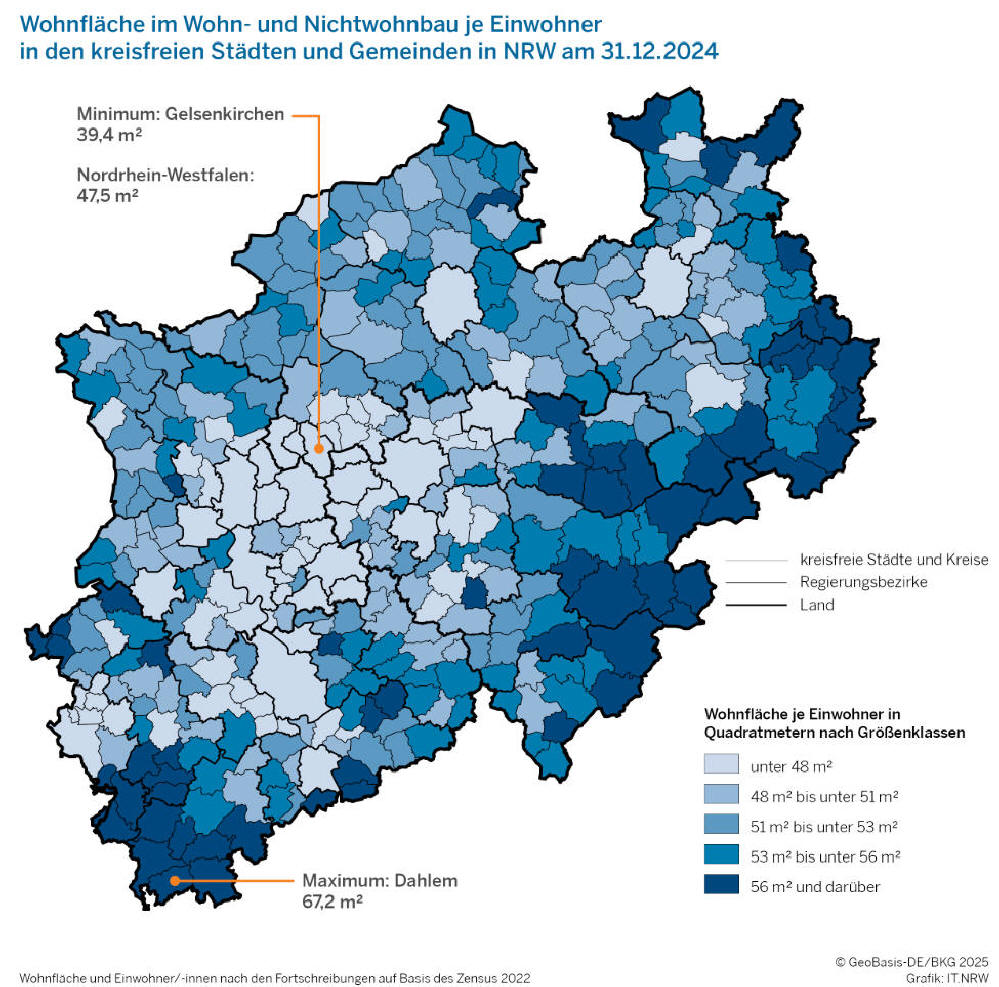
Wohnungsbestandsquote liegt je nach Gemeinde
zwischen 38,9 und 63,8
Die
Wohnungsbestandsquote – die Anzahl der Wohnungen
je 100 Einwohner – liegt für NRW bei 51,3.
Wenige Wohnungen – gemessen an der Einwohnerzahl
– weisen die Gemeinden Schöppingen im Kreis
Borken (38,9 Wohnungen je 100 Einwohner) und
Horstmar im Kreis Steinfurt (39,0) auf.
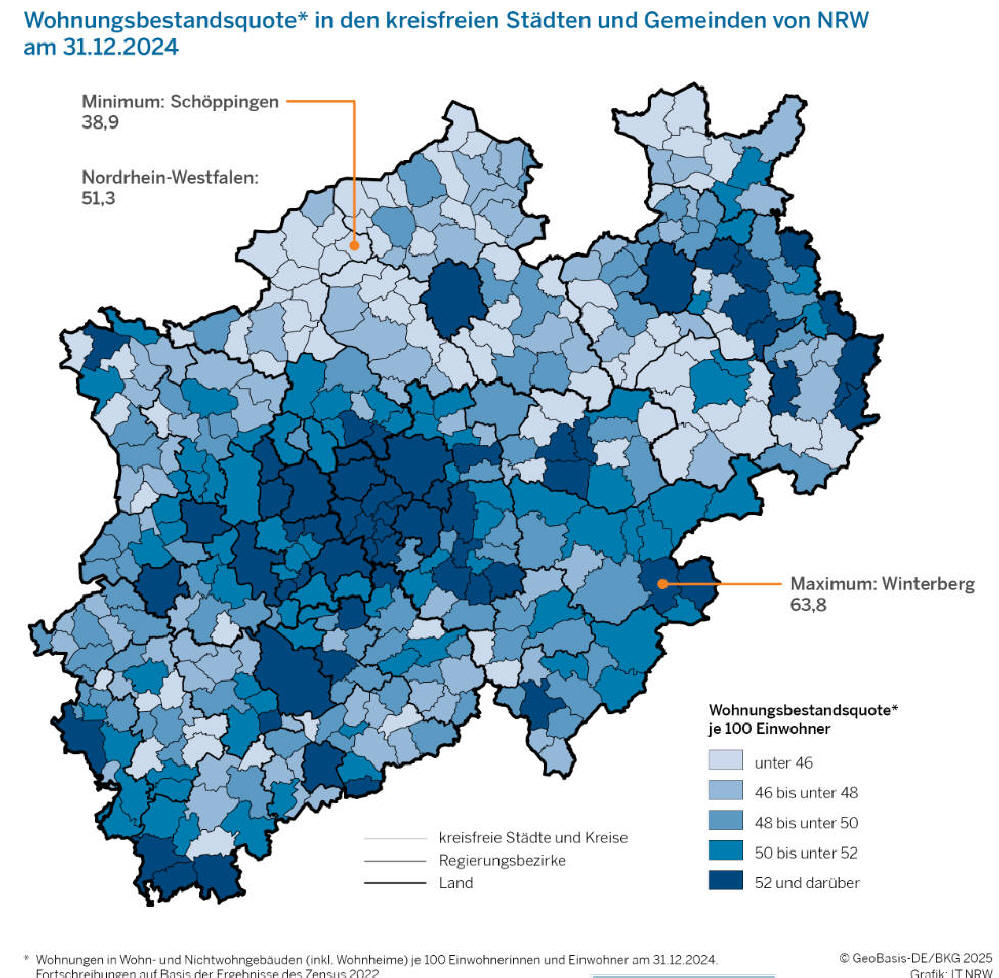
Eine hohe Wohnungsbestandsquote haben die
Gemeinden Winterberg im Hochsauerlandkreis
(63,8) und Altena im Märkischen Kreis (58,7)
sowie die Stadt Düsseldorf (57,4 Wohnungen je
100 Einwohner).
26,7 % mehr E-Scooter-Unfälle mit
Personenschaden im Jahr 2024
·
48,6 % der Verunglückten auf E-Scootern waren
jünger als 25 Jahre
· Häufigste
Unfallursache: Falsche Straßenbenutzung
·
Unfallkalender zeigt, an welchen Tagen besonders
viele mit dem E- Scooter verunglücken
Die Zahl der E-Scooter-Unfälle, bei denen
Menschen verletzt oder getötet wurden, ist
weiter gestiegen. Im Jahr 2024 registrierte die
Polizei in Deutschland 11 944 E-Scooter-Unfälle
mit Personenschaden – das waren 26,7 % mehr als
im Jahr zuvor (9 425 Unfälle). Dabei kamen
insgesamt 27 Menschen ums Leben, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.
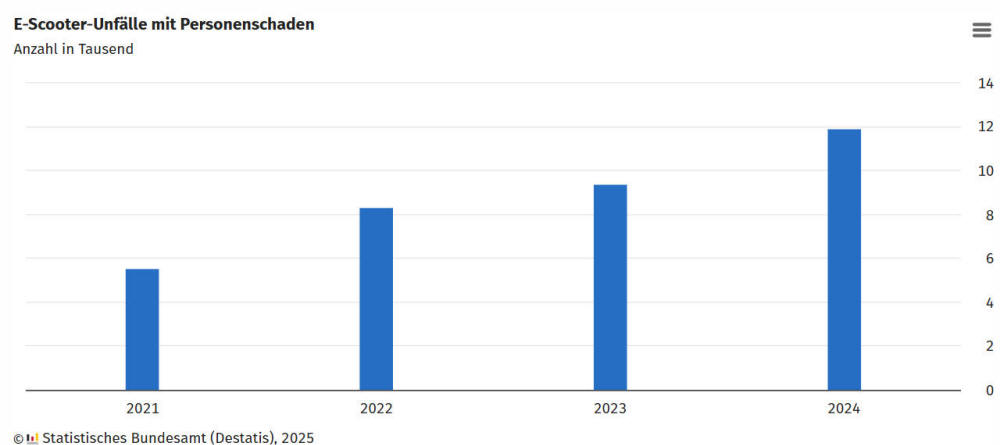
Die Zahl der Todesopfer ist damit gegenüber
2023 ebenfalls gestiegen, damals starben 22
Menschen bei E-Scooter-Unfällen. 1 513 Menschen
wurden im Jahr 2024 bei solchen Unfällen schwer
verletzt und 11 433 leicht.
10 886 oder
83,9 % der Verunglückten waren selbst mit
dem E-Scooter unterwegs, darunter auch alle
27 Todesopfer. Zudem waren 508 oder 4,7 % der
Verunglückten, die selbst auf
einem E-Scooter unterwegs waren, Mitfahrerinnen
oder Mitfahrer. Im Jahr 2023 waren noch 328 oder
3,9 % der Verunglückten
auf E-Scootern Mitfahrende.
Laut
Straßenverkehrsordnung sind E-Scooter nur für
eine Person vorgesehen, das Mitfahren weiterer
Personen ist nicht erlaubt. Anteil an allen
Unfällen mit Personenschaden binnen Jahresfrist
von 3,2 % auf 4,1 % gestiegen Insgesamt
spielen E-Scooter im Unfallgeschehen eine
vergleichsweise geringe Rolle: 2024 registrierte
die Polizei insgesamt 290 701 Verkehrsunfälle
mit Personenschaden, lediglich an 4,1 % war
ein E-Scooter-Fahrer oder
eine E-Scooter-Fahrerin beteiligt.
Gegenüber 2023 mit damals 3,2 % ist der Anteil
allerdings gestiegen. Deutlich wird der
Unterschied im Vergleich zu Fahrradunfällen: Im
Jahr 2024 hat die Polizei deutschlandweit rund
93 279 Unfälle mit Personenschaden registriert,
an denen Fahrradfahrerinnen und -fahrer
beteiligt waren, das waren 32,1 % aller Unfälle
mit Personenschaden.
445 Menschen, die
mit einem Fahrrad unterwegs waren, kamen dabei
ums Leben, 13 919 wurden schwer verletzt, 79 242
leicht. Junge Menschen besonders häufig
in E-Scooter-Unfälle verwickelt Besonders junge
Menschen sind in E-Scooter-Unfälle verwickelt.
48,6 % der im Jahr 2024
verunglückten E-Scooter-Fahrenden waren jünger
als 25 Jahre, 82,0 % waren jünger als 45 Jahre.
Dagegen gehörten nur 3,3 % zur
Altersgruppe 65plus. Zum Vergleich: Bei den
Unfallopfern, die mit dem Fahrrad
oder Pedelec unterwegs waren, war der Anteil der
unter 25-Jährigen mit 21,4 % deutlich niedriger.
Gleichzeitig waren nur 48,3 % von ihnen jünger
als 45 Jahre. Dagegen war ein deutlich größerer
Teil (20,5 %) 65 Jahre oder älter.
Ein
Grund für die Unterschiede dürfte sein, dass jüngere
Menschen im Allgemeinen mehr
mit E-Scootern unterwegs sind als ältere.
Häufigste Unfallursache war falsche
Straßenbenutzung Unfälle können nicht immer auf
einen einzigen Grund zurückgeführt werden.
Häufig registriert die Polizei mehrere
Fehlverhalten.
Das häufigste
Fehlverhalten der E-Scooter-Fahrenden mit einem
Anteil von 21,2 % war die falsche Benutzung der
Fahrbahn oder der Gehwege.
Die E-Scooter-Nutzenden müssen, so weit
vorhanden, Fahrradwege oder Schutzstreifen
nutzen. Ansonsten sollen sie auf Fahrbahnen oder
Seitenstreifen ausweichen, das Fahren auf
Gehwegen ist verboten.
Vergleichsweise
häufig legte die Polizei den E-Scooter-Fahrenden
das Fahren unter Alkoholeinfluss zur Last
(12,4 %). Zum Vergleich: Im selben Zeitraum
waren es bei Fahrradfahrenden 7,8 % und bei
zulassungsfreien Krafträdern wie Mofas,
S-Pedelecs und Kleinkrafträdern 5,9 %.
Nicht angepasste Geschwindigkeit war das
dritthäufigste Fehlverhalten, das die Polizei
bei E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrern
feststellte (8,0 %), danach folgte die
Missachtung der Vorfahrt (6,2 %). 50,5 % der
verunglückten E-Scooter-Fahrenden verletzten
sich bei Zusammenstößen mit Pkw Von den
11 944 E-Scooter-Unfällen mit Personenschaden im
Jahr 2024 waren 31,4 % Alleinunfälle – das
heißt, es gab keine Unfallgegnerin
beziehungsweise keinen Unfallgegner. 14 der 27
tödlich Verunglückten auf E-Scootern kamen bei
Alleinunfällen ums Leben.
Von den
Verletzten verunglückten 35,3 % bei
Alleinunfällen. An 7 948
(66,5 %) E-Scooter-Unfällen mit Personenschaden
war eine zweite Verkehrsteilnehmerin oder ein
zweiter Verkehrsteilnehmer beteiligt, meist war
dies eine Autofahrerin oder ein Autofahrer
(5 302 Unfälle). Bei solchen Zusammenstößen mit
Autos verletzten sich 50,5 % der
verunglückten E-Scooter-Nutzenden, 7 starben.
Zum Vergleich: An 1 140
(14,3 %) E-Scooter-Unfällen waren Radfahrende
beteiligt, bei diesen Zusammenstößen verletzten
sich aber nur 4,7 % der
verunglückten E-Scooter-Fahrenden. Bei Unfällen
mit zwei Beteiligten trug zu 47,6 % die oder
der E-Scooter-Fahrende die Hauptschuld am
Unfall. Betrachtet man, wer der Unfallgegner
oder die Unfallgegnerin war, gibt es durchaus
Unterschiede: Bei Zusammenstößen mit einem Pkw
(5 302 Unfälle) waren die E-Scooter-Fahrenden
nur in 35,2 % der Fälle die
Hauptverursacherinnen oder Hauptverursacher.
Bei Unfällen mit Fahrradfahrenden
(1 140 Unfälle) waren es 72,7 % und bei Unfällen
mit einer Fußgängerin oder einem Fußgänger
(869 Unfälle) waren es sogar 87,7 % der Unfälle,
an denen die E-Scooter-Fahrenden die Hauptschuld
trugen. 53,7 % der E-Scooter-Unfälle ereigneten
sich in Großstädten Unfälle
mit E-Scootern geschehen besonders häufig in
Großstädten. Im Jahr 2024 wurden 53,7 %
der E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden in
Städten mit mindestens 100 000 Einwohnerinnen
und Einwohnern registriert.
Bei Unfällen
mit Pedelecs (29,6 %) oder Fahrrädern ohne
Hilfsmotor (45,1 %) war der Anteil deutlich
geringer. 30,9 % der E-Scooter-Unfälle mit
Personenschaden spielten sich in Städten mit
mindestens einer halben Million Einwohnerinnen
und Einwohnern ab. Bei Unfällen
mit Pedelecs waren es dagegen 12,2 %, bei
Fahrrädern ohne Motor 26,7 %.
Neues Update verbessert Geoportale im Kreis
Wesel
Die Geoportale des Kreises
Wesel wurden kürzlich auf die neue Masterportal
Version 3.0 umgestellt. Mit diesem Update bieten
die Geoportale den Bürgerinnen und Bürgern sowie
Fachanwendenden noch mehr Funktionen und eine
verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Die
Geoportale sind digitale Kartenportale, in denen
viele wichtige Informationen rund um Freizeit,
Kataster und Umwelt gebündelt sind.
Über
die Portale können Interessierte
Grundstücksdaten, Bebauungspläne, Rad- und
Wanderrouten und viele weitere Geodaten online
abrufen. Dies erleichtert sowohl die persönliche
Planung als auch behördliche Prozesse. Die neue
Masterportal Version 3.0 bringt eine modernere
Oberfläche und verbesserte Suchfunktionen mit.
So können Nutzerinnen und Nutzer
schneller und intuitiver die gewünschten
Informationen finden. Auch die Darstellung der
Karten wurde optimiert, damit alle Daten
übersichtlicher und klarer sichtbar sind – egal
ob auf dem Computer, Tablet oder Smartphone.
„Mit dem Update auf Masterportal 3.0 setzen
wir auf eine zeitgemäße und leistungsstarke
Plattform, die den Ansprüchen der Nutzerinnen
und Nutzer im Kreis Wesel gerecht wird“, sagt
Dana Müller, Koordinationsbereichsleitung
Geobasisdaten.
Helmut Czichy,
Vorstandsmitglied für den Bereich Planung, fügt
hinzu: „Wir wollen so den Zugang zu wichtigen
Geodaten noch einfacher machen und die digitale
Kommunikation fördern.“
Die Geoportale
des Kreises Wesel sind weiterhin kostenlos und
rund um die Uhr erreichbar unter https://www.kreis-wesel.de/leben-arbeiten/bauen-wohnen-kataster/geoportale-im-kreis-wesel.
Zusätzliche Informationen zur Benutzung der
Geoportale gibt es in einer Kurzanleitung unter https://www.kreis-wesel.de/leben-arbeiten/bauen-wohnen-kataster/geoportale-im-kreis-wesel/kurzanleitung-geoportale.
Gemeinsam golfen – Gemeinsam helfen! Golf
Club Hünxerwald e.V. engagiert sich für die
Deutsche Krebshilfe
Am
10.08.2025 richtet der Golf Club Hünxerwald e.V.
eines der bundesweiten Benefiz-Golfturniere im
Rahmen der 44. Golf-Wettspiele zugunsten der
Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche
KinderKrebshilfe aus. Gemeinsam mit rund 130
Golfclubs in ganz Deutschland engagiert sich der
Club für den guten Zweck. Golferinnen und Golfer
sind herzlich eingeladen, ihren sportlichen
Einsatz mit der Hilfe für krebskranke Menschen
zu verbinden.
Das Turnier steht ganz im
Zeichen der Solidarität: Die Erlöse aus dem
Turnier fließen direkt in die Arbeit der
Deutschen Krebshilfe. Für die Teilnehmenden des
Turniers in Hünxe gibt es zudem einen
sportlichen Anreiz: Die Brutto- und
Nettosiegerinnen und -sieger haben die Chance,
sich in einem Regionalfinale für das
Bundesfinale am 4. Oktober 2025 im Golfpark
Rothenburg-Schönbronn zu qualifizieren.
Interessierte Golferinnen und Golfer können sich
für das Turnier in Hünxe anmelden. Alle
Turnierpreise werden von dem langjährigen
Sponsor DekaBank, dem Wertpapierhaus der
Sparkassen, gestellt.
Gebundener Ganztag – Mehr als nur
Unterricht
Ab dem Schuljahr
2026/2027 gilt bundesweit ein Rechtsanspruch auf
Ganztagsbetreuung für alle Erstklässlerinnen und
Erstklässler in den Grundschulen. Ziel dieses
Anspruchs ist es, die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu verbessern, Bildungsungleichheiten
abzubauen und Kindern einen verlässlichen Lern-
und Lebensort zu bieten.
In
Nordrhein-Westfalen soll dieser Anspruch
überwiegend über das Modell der Offenen
Ganztagsgrundschule (OGS) umgesetzt werden. Die
OGS sieht vor, dass der Unterricht am Vormittag
stattfindet und am Nachmittag durch ein
freiwilliges Angebot ergänzt wird, bestehend aus
Mittagessen, Betreuung sowie Freizeit- und
Förderangeboten.
Daneben existiert mit
der gebundenen Ganztagsschule ein weiteres
Modell der Ganztagsorganisation. Hier sind
Unterricht und außerunterrichtliche Aktivitäten
rhythmisiert über den gesamten Schultag
verteilt. Die Teilnahme ist für alle
Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Diese
Form bietet pädagogisch besonders wertvolle
Strukturen, da sie mehr Raum für individuelle
Förderung, soziales Lernen, Inklusion und
Integration eröffnet.
Gebundene
Ganztagsschulen gelten als besonders geeignet,
um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von
Schülerinnen und Schülern einzugehen und
Chancengleichheit im Bildungssystem zu fördern.
Dennoch spielt diese Organisationsform im
nordrhein-westfälischen Grundschulbereich bisher
nur eine untergeordnete Rolle.
Die
Ministerin für Schule und Bildung hat die Kleine
Anfrage 5890 mit Schreiben vom
24. Juli 2025
namens der Landesregierung im Einvernehmen mit
der Ministerin für Kinder, Jugend, Familie,
Gleichstellung, Flucht und Integration sowie der
Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und
Digitalisierung beantwortet.
Vorbemerkung
der Landesregierung
Nach § 24 Absatz 4 Achtes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in der Fassung
des Ganztagsförderungsgesetzes vom 2. Oktober
2021 greift ab 1. August 2026 ein aufwachsender
Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Kinder
im Grundschulalter.
Zur Umsetzung des
Rechtsanspruchs baut Nordrhein-Westfalen auf dem
langjährigen, erfolgreichen Modell der Offenen
Ganztagsschule auf. Das erfolgreiche kooperative
Trägermodell in der Zusammenarbeit von
Grundschulen und freien und öffentlichen Trägern
der Jugendhilfe sowie weiteren Trägern und
außerschulischen Partnern soll weitergeführt
werden.
Dazu hat die Landesregierung am
2. Juli 2024 den gemeinsamen Erlass des
Ministeriums für Schule und Bildung und des
Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie,
Gleichstellung, Flucht und Integration „Offene
Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche
Ganztags- und Betreuungsangebote im
Primarbereich“ gebilligt, der zum 1. August 2026
in Kraft tritt.
Die
Erfüllungsverantwortung für die Umsetzung des
Rechtsanspruchs richtet sich gem. § 24 Abs. 4
SGB VIII i.V. m §§ 79 Abs. 1, 85 Abs. 1 SGB VIII
unmittelbar immer und ausschließlich an den
Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
1. Wie viele Grundschulen im gebundenen Ganztag
gibt es insgesamt in NordrheinWestfalen (bitte
Schulträger und Kommune aufführen)?
In
Nordrhein-Westfalen gibt es 18 gebundene
Ganztagsgrundschulen, davon zehn private
Ersatzschulen und acht öffentliche Grundschulen.
2. Wie viele Grundschulen in NRW haben
im Jahr 2024 (zum Schuljahr 2024/25) die
Form
des gebundenen Ganztags beantragt (bitte
Schulträger und Kommune aufführen?
Der
Landesregierung liegen bis auf vereinzelte
Beratungsanfragen bei den Bezirksregierungen
keine Informationen zu konkreten
Antragsstellungen zum Schuljahr 2024/2025 zur
Organisationsform des gebundenen Ganztages an
Grundschulen in Nordrhein-Westfalen vor.
3. Welche Unterstützung bietet die
Landesregierung in der Planung und Umsetzung
des gebundenen Ganztags an den Grundschulen in
NRW?
Da der Zeitrahmen des
Ganztagsbetriebs gebundener Ganztagsschulen (§ 9
Absatz 1
SchulG) gemäß BASS 12-63 Nr. 2 nicht
den durch das Ganztagsförderungsgesetz vom 2.
Oktober 2021 vorgegebenen Zeitrahmen erfüllt,
setzt das Land bei der Umsetzung des
aufwachsenden Rechtsanspruchs auf
Ganztagförderung für Kinder im Primarbereich auf
die langjährig bewährten Strukturen des Offenen
Ganztages im Primarbereich.
Nach Maßgabe
des Haushalts leistet das Land in offenen
Ganztagsschulen im Primarbereich (§ 9 Absatz 3
SchulG) und in außerunterrichtlichen Ganztags-
und Betreuungsangeboten (§ 9 Absatz
2 SchulG)
Zuschüsse für Einsatz, Koordinierung und
Fortbildung des Personals außerschulischer
Träger (§ 94 Absatz 2 SchulG).
Darüber
hinaus besteht eine verlässliche und etablierte
Unterstützungsstruktur für Ganztagsschulen, auch
zur konzeptionellen Ausgestaltung des Ganztags.
Die Serviceagentur „Ganztagsbildung NRW“
unterstützt Ganztagsschulen und außerschulische
Träger der Ganztagsangebote in der
Zusammenarbeit mit Partnern und bei der
Ausgestaltung des Erziehungs- und
Bildungsauftrages in der Ganztagsschule.
Kleine Anfrage 5890 vom 24. Juni 2025 der
Abgeordneten Silvia Gosewinkel, Dilek Engin und
Andrea Busche SPD
Dinslaken: Führungen durch die Ausstellung
„x-positions 8 – einblicke“
Eigens für die aktuelle Ausstellung „x-positions
8 – einblicke“ hat das Museumsteam des
Dinslakener Museums Voswinckelshof gemeinsam mit
den Künstlerinnen ein altes Konzept für
Ausstellungsführungen neu gestaltet: duale
Kunstführungen. Museum und Künstlerinnen führen
gemeinsam durch die Ausstellung und heben ihre
jeweilige Sicht auf die Kunstwerke hervor.
Die Künstlerinnen erzählen gerne vom
kreativen Schaffensprozess und laden ein, die
fertigen Kunstwerke auch aus dieser Perspektive
kennenzulernen. Das Museum wiederum ordnet die
Kunstwerke in größere künstlerische
Zusammenhänge ein und berichtet von der manchmal
diskursiven, aber immer spannenden
Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen
Künstlerinnen.
Die Dopplung von
künstlerischer und kuratorischer Sicht
verspricht neue, ungewohnt und durchaus
kontroverse Eindrücke. Fragen aus dem Publikum
sind dabei ausdrücklich erwünscht. Mit den
unterschiedlichen Perspektiven und den
Publikums-Fragen entsteht eine interessante,
vielfältige und ganz sicher unterhaltsame
Führung.
Zwei Termine sind bisher für die
dualen Kunstführungen festgelegt:
• Mittwoch,
der 6. August um 16.00 Uhr mit den Künstlerinnen
Magdalena Graf und Renate Scheel
• Sonntag,
der 17. August um 16.00 Uhr mit den
Künstlerinnen
Regine Kielmann und Barbara
Spiekermann-Horn
Die Ausstellung
„x-positions 8 – einblicke“ ist noch bis zum 7.
September im Museum Voswinckelshof zu sehen. Der
Eintritt ist frei. Das Museum ist dienstags bis
sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die
Ausstellung endet am Sonntag, 7. September 2025.
Weitere Informationen zum Museum
Voswinckelshof sind hier zu finden.
x-positions sind: Magdalena Graf, Claudia
Holsteg-Küpper, Regine Kielmann, Petra Klein,
Elke Munse, Antje Paselk, Renate Scheel, Barbara
Spiekermann-Horn, Brigitte Tackenberg-Özek.
Malerei, Skulptur, Fotokunst, Zeichnung, Collage
und Mixed Media sind die Formate und Techniken
der neun Künstlerinnen.
Nur ihre Themen
sind noch vielfältiger. Der Name der Ausstellung
ist Programm: Die Künstlerinnen gewähren neue
Einblicke in ihr Schaffen, zeigen bislang
ungezeigte Werke und arrangieren sie
zu einer überraschenden
Ausstellung.
www.x-positions.de
Dinslaken: Planwagenfahrt durch das
Rotbachtal
Am Mittwoch, 13.
August 2025, findet die Planwagenfahrt ins
beliebte Rotbachtal zum letzten Mal in diesem
Jahr statt. Die Planwagenfahrt führt von der
Wassermühle in Hiesfeld parallel zum Bachlauf
des Rotbachs bis zum Zusammenfluss von Rot- und
Schwarzbach.
Von dort geht es durch die
Kirchheller Heide zum Weihnachtssee und zum
Heidesee, bevor es am „Kompetenzzentrum Wald“
auf dem Heidhof die Möglichkeit zum kostenlosen
Besuch einer naturwissenschaftlichen Ausstellung
und zum Besuch des Kiosks gibt.
Nach
diesem 30-minütigen Aufenthalt verläuft die
Fahrt weiter über Oberlohberg zurück zur
Wassermühle nach Hiesfeld. Während der Fahrt
erhalten die Teilnehmenden zahlreiche
Informationen über Flora, Fauna und Geographie.
Die Fahrt dauert von 14 bis 17 Uhr. Der
Treffpunkt befindet sich an der Wassermühle in
Hiesfeld. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro
pro Person und wird vor Ort beim Gästeführer
entrichtet. Eine verbindliche Anmeldung nimmt
das Team der Stadtinformation telefonisch unter
02064 – 66 222 oder per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de gerne
entgegen.
Evangelisches Entwicklungswerk legt Jahresbilanz
vor – 15,5 Millionen Euro Spenden aus dem
Rheinland, Westfalen und Lippe
Brot
für die Welt hat im vergangenen Jahr bundesweit
deutlich mehr Spenden und Kollekten von
Privatpersonen und Gemeinden erhalten. Im Gebiet
der evangelischen Landeskirchen Rheinland,
Westfalen und Lippe waren es 15,5 Millionen
Euro, das ist deutlich mehr als 2023 (2023: 13,2
Millionen Euro, Steigerung um 17 Prozent).
Deutschlandweit spendeten die Menschen 4,6
Millionen Euro mehr als im Jahr 2023.
„Danke an alle Unterstützerinnen und
Unterstützer für ihre Spende an Brot für die
Welt. Insbesondere in diesen für viele Menschen
finanziell schweren Zeiten ist jeder Beitrag ein
starkes Zeichen der Solidarität“, sagt Kirsten
Schwenke, juristische Vorständin der Diakonie
RWL. Weil die Entwicklungsorganisation weniger
Geld aus dem „Bündnis Entwicklung hilft“
erhalten hat, ist das Spendenergebnis insgesamt
leicht rückläufig.
Das liegt
insbesondere am rückläufigen Spendenaufkommen
beim „Bündnis Entwicklung hilft“ im Zuge der
Ukraine-Unterstützung. Bundesweit gingen bei
Brot für die Welt im vergangenen Jahr 73,9
Millionen Euro Spenden und Kollekten ein (2023:
75,9 Mio. Euro).
Entwicklungsprojekte
von Brot für die Welt Neben Spenden und
Kollekten erhielt Brot für die Welt im
vergangenen Jahr Geld des Kirchlichen
Entwicklungsdienstes und Drittmittel. Das sind
vor allem Mittel des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ).
Insgesamt standen dem Hilfswerk
der evangelischen Kirchen und Freikirchen für
seine Arbeit 332,3 Millionen Euro zur
Verfügung—rund 0,2 Millionen Euro mehr als im
Vorjahr. Das ist unter anderem auf mehr
Einnahmen aus Nachlässen zurückzuführen. Brot
für die Welt hat im vergangenen Jahr weltweit
2.919 Projekte gefördert. Regionale Schwerpunkte
waren Afrika und Asien.
Insgesamt wurden
318,7 Millionen Euro verausgabt. Rund 91 Prozent
der verwendeten Mittel, 289,3 Millionen Euro,
hat Brot für die Welt für Entwicklungsprojekte
ausgegeben. Für Werbe- und Verwaltungsaufgaben
wurden rund 9 Prozent eingesetzt. Das Deutsche
Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)
bewertet den Anteil der Werbe- und
Verwaltungsausgaben an den Gesamtausgaben als
niedrig. Das ist die beste zu vergebende
Kategorie.
Brot für die Welt setzt sich
als Werk der evangelischen Landes- und
Freikirchen und ihrer Diakonie seit 1959 für
globale Gerechtigkeit, Ernährungssicherheit,
Klimagerechtigkeit und Menschenrechte ein.
Gemeinsam mit 1.500 Partnerorganisationen
ermöglicht Brot für die Welt in fast 90 Ländern,
dass benachteiligte Menschen ihre
Lebenssituation aus eigener Kraft nachhaltig
verbessern.
Bahn-Sanierung
fatal: „Einzelwagenverkehr nicht abschaffen“
„Schnapsidee“ der Deutschen Bahn:
Sparprogramm auf Kosten von Umwelt- und
Klimaschutz

Foto: Michael Lünen/Pixabay CC/PublicDomain
Bahn-Sanierung fatal: „Einzelwagenverkehr
nicht abschaffen“ ÖDP gegen „Schnapsidee“ der
Deutschen Bahn: Sparprogramm auf Kosten von
Umwelt- und Klimaschutz Es wäre ein
Mehrfach-Debakel: Laut
Medienberichten befürchtet die
Eisenbahnergewerkschaft EVG, dass die
Bahntochter DB-Cargo ihren europaweiten
„Einzelwagenverkehr“ kippt.
Mit dem
Verlust dieses Lieferdienstes gingen aber nicht
nur Tausende Arbeitsplätze verloren. Noch
schlimmer wiegt, dass unter der Entscheidung des
Bahnmanagements die Umwelt und das Klima leiden,
weil statt der Güterwaggons täglich zusätzliche
32.000 Lastwagen über unsere Straßen rollen.
Laut
DB-Eigenlob blasen die „1,7 Millionen Tonnen
CO2 pro Jahr“ in die Luft. Prof. Dr. Herbert
Einsiedler vom Bundesvorstand der
Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP – Die
Naturschutzpartei) spricht vom „Schlag gegen das
CO2-Reduktionsziel Deutschlands“. „Natürlich
muss die Bahn Verluste möglichst vermeiden“,
erkennt Einsiedler an.
Trotzdem setzt
die Schnapsidee an der falschen Stelle an, ist
sich der Ökonom sicher: „Die Bahn AG ist zu 100
Prozent im Besitz der Bundesrepublik Deutschland
und die Bundesregierung hat als Eigentümerin die
Verpflichtung, das Gemeinwohl zu
berücksichtigen. Der Artikel 14 des
Grundgesetzes sagt klar: Eigentum verpflichtet.“
Deshalb spricht sich die ÖDP für den Erhalt des
DB-Einzelwagenverkehrs aus. Er ist eindeutig
umweltfreundlicher und emissionsärmer als der
Gütertransport im Lastwagen über die Straßen.
Das neue HUK-E-Barometer
Trendwende bei E-Mobilität möglich: Privatleute
steigen so häufig von Verbrenner- auf
Elektroautos um wie zuletzt Ende 2023 – Erstmals
bewertet bundesweit eine Mehrheit E-Autos als
„gut“ oder „sehr gut“ – Am stärksten ziehen die
Bestandsquoten bei Stromern laut HUK-E-Barometer
in Schleswig-Holstein und Niedersachsen an
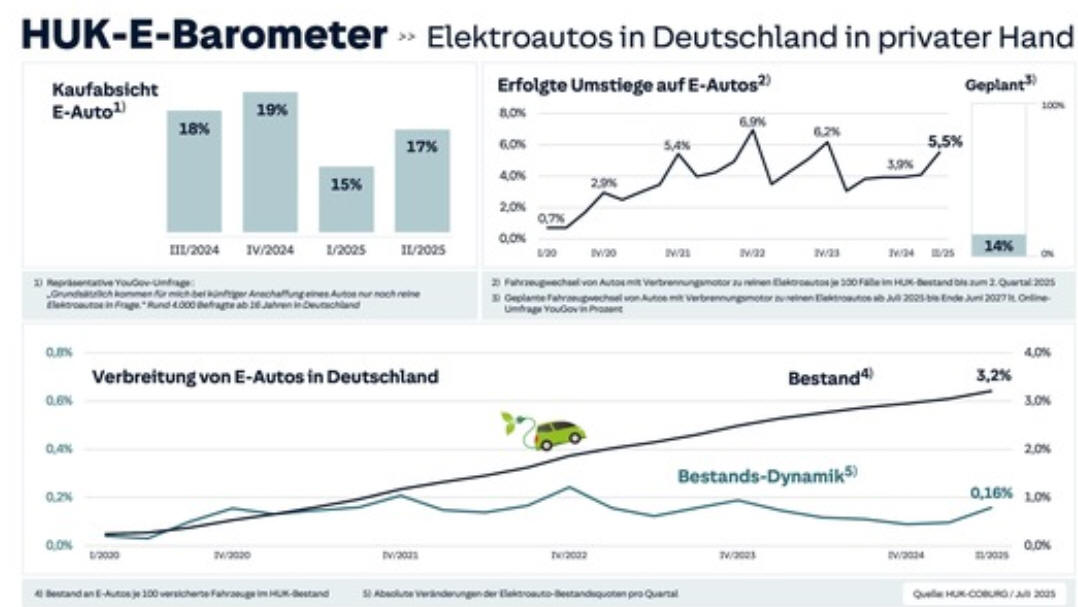
Das einstige Elektro-Spitzenland
Baden-Württemberg fällt aus den Top-3 der
Bundesländer heraus
Vor allem Männer,
Jüngere und Vielfahrer bewerten Elektroautos
positiver
Eine deutliche Mehrheit der
Bundesbürger will, dass auch gebrauchte E-Autos
bei staatlicher Förderung berücksichtigt werden
Private Autofahrer entscheiden sich nach
langer Zurückhaltung wieder vermehrt für
Elektroautos. Im zweiten Quartal 2025 stiegen
laut HUK-E-Barometer rund ein Drittel mehr beim
Fahrzeugwechsel von einem Verbrenner auf ein
reines E-Auto um als im Quartal zuvor. Insgesamt
waren es bundesweit 5,5 Prozent aller
Fahrzeugwechsel (4,1% in Q1 2025).
Einen
Wert in ähnlicher Höhe gab es zuletzt Ende 2023,
also vor dem Wegfall der staatlichen Kaufprämie.
Und auch der Gesamtbestand an privaten E-Autos
hat im zweiten Quartal 2025 spürbar angezogen
auf 3,2 Prozent. Die Dynamik der Bestandszunahme
ist damit ebenfalls die höchste seit mehr als
einem Jahr.
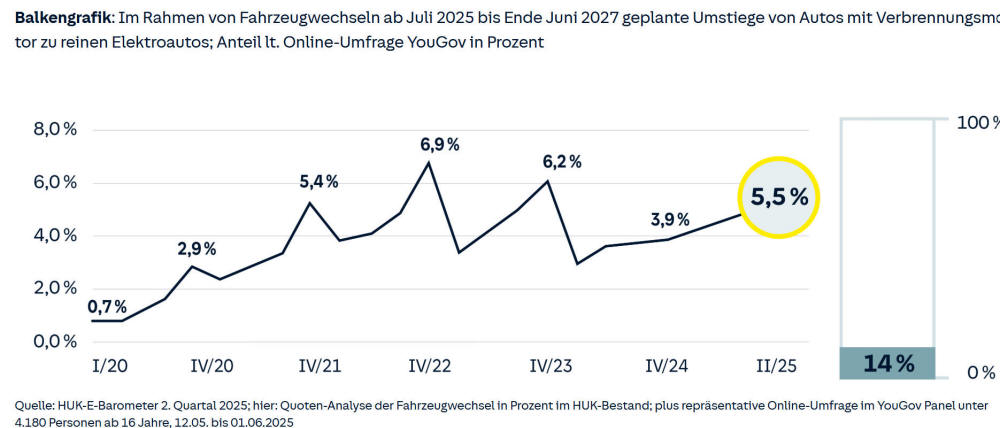
Das sind zentrale Messergebnisse des neuen
HUK-E-Barometers, das sich aus Daten des
umfangreichen Versicherungsbestands des
marktführenden Unternehmens ergibt. Parallel
werden von HUK-COBURG jedes Quartal neu durch
bundesweit repräsentative Online-Befragungen die
Einstellungen zu Elektroautos sowie
Verhaltensweisen der deutschen Bevölkerung
erfragt.
Und auch hier deutet sich ein
Umschwung an. So erklärt jetzt erstmals mit 48
Prozent eine relative Mehrheit der Deutschen ab
16 Jahren, dass sie E-Autos „sehr gut“ oder
„gut“ findet, 45 Prozent der Befragten finden
sie „weniger“ oder „gar nicht gut“. Anfang 2024
waren dagegen erst 37 Prozent positiv
eingestellt und noch 52 Prozent negativ.
Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der
HUK-COBURG: „Ob der Umstieg zur E-Mobilität in
Deutschland gelingt, entscheidet sich im
privaten Automarkt, denn er umfasst gut 90
Prozent des Gesamtmarktes. Deshalb sind die
neuen Trendsignale wichtiger als etwa
Neuzulassungszahlen bei gewerblich genutzten
Pkw, die nur etwa zehn Prozent ausmachen.“
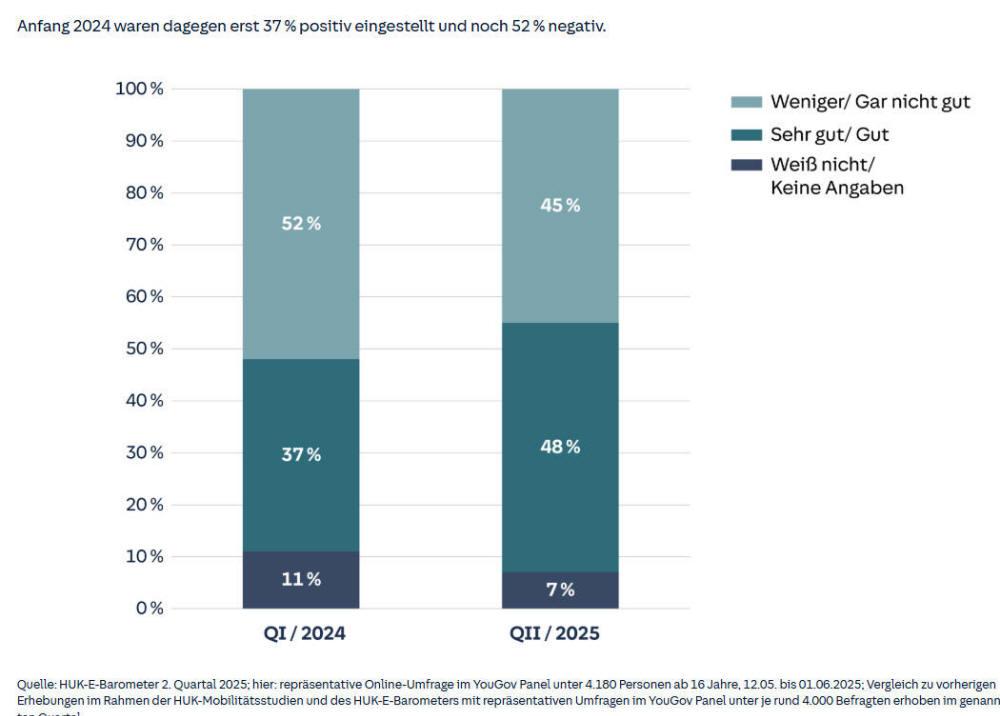
Baden-Württemberg fällt ab,
Norddeutschland steigt auf
Beim verstärkten
Privatinteresse an Elektroautos fahren im
abgelaufenen Quartal vor allem zwei Bundesländer
vorneweg. In Schleswig-Holstein und
Niedersachsen haben die Quoten an E-Autos
gemessen am dortigen gesamten Autobestand am
kräftigsten zugenommen. Bayern und
Rheinland-Pfalz folgen dahinter schon mit etwas
Abstand. Die rote Laterne behalten die
ostdeutschen Bundesländer Sachsen und
Sachsen-Anhalt wie bereits im gesamten
Jahresverlauf 2025.
Überraschend
schwächelt aber das Autoland Baden-Württemberg.
Beim Elektro-Anteil am Privatbestand steht es
nun erstmals seit fünf Jahren – dem Beginn der
HUK-Auswertung 2020 – nicht mehr unter den
Top-3-Ländern. Begonnen hat dieser Abstieg Mitte
2022. Damals hatte das Ländle im
Bundesländer-Vergleich noch die höchste
Bestandsquote an Elektroautos, bevor es in
dieser Kategorie zunächst hinter Bayern
zurückfiel und inzwischen auch Niedersachsen und
Schleswig-Holstein vorbeiziehen lassen muss.
Am stärksten ziehen die Bestandsquoten an
Stromern laut HUK-E-Barometer in
Schleswig-Holstein und Niedersachsen an Beim
verstärkten Privatinteresse an Elektroautos
fahren im abgelaufenen Quartal vor allem zwei
Bundesländer vorne weg. In Schleswig-Holstein
und Niedersachsen haben die Quoten an E-Autos
gemessen am dortigen gesamten Autobestand am
kräftigsten zugenommen.
Bayern und
Rheinland-Pfalz folgen dahinter schon mit etwas
Abstand. Die rote Laterne behalten die
ostdeutschen Bundesländer Sachsen und
Sachsen-Anhalt wie bereits im gesamten
Jahresverlauf 2025. Zuwachs des Anteils von
E-Autos am gesamten privaten Autobestand in den
einzelnen Bundesländern im 2. Quartal 2025
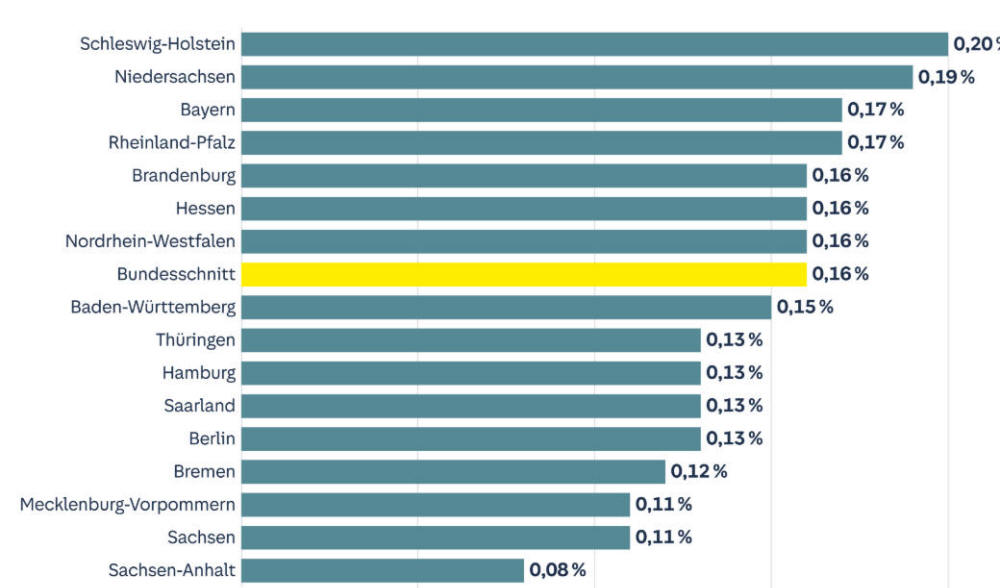
Noch deutlicher hinkt Baden-Württemberg bei
den Umstiegen auf reine Elektroantriebe bei
Fahrzeugwechseln hinterher. Im zweiten Quartal
2025 stiegen in Niedersachsen (6,6%), Bayern
(6,4%) und Hessen (5,9%) die meisten Privatleute
von einem Verbrenner- auf einen Elektromotor um.
Für die Autofahrer im Südwesten hingegen liegt
dieser Wert mit nur 4,9 Prozent sogar noch unter
dem Bundesschnitt von 5,5 Prozent.
Jüngere und Männer sind die größten E-Auto-Fans
Nicht nur regional sind die Unterschiede in
Sachen Elektromobilität groß. Auch zwischen
Älteren und Jüngeren gehen die Einstellungen
hierzu deutlich auseinander - und diese Schere
öffnet sich weiter. So bewerten aktuell 65
Prozent der unter 40-Jährigen Elektroautos als
„sehr gut“ oder „gut“. Anfang 2024 waren es 49
Prozent. Bei den ab 40-Jährigen ist die
Zustimmung dagegen weit geringer (39 %) und die
Steigerung gegenüber Anfang 2024 (31%) auch nur
halb so hoch.
Männer zeigen sich
gegenüber Frauen dabei grundsätzlich deutlich
positiver gegenüber E-Autos (55 % zu 41 %).
Extrem unterschiedlich sind daher etwa
Einstellungen bei Männern unter 40 Jahren
gegenüber Frauen ab 40 Jahren. Hier liegen die
Quoten um mehr als das Doppelte auseinander (73
% zu 34 %). Noch größer sind die Unterschiede
bei der Kaufabsicht. So erklären nur zehn
Prozent der Frauen ab 40 Jahren, sich "künftig
grundsätzlich nur noch ein reines Elektroauto"
anschaffen zu wollen. Bei Männern unter 40
Jahren ist die Quote mit 31 Prozent hingegen
sogar dreifach höher.
Reichweite schreckt
Vielfahrer offenbar nicht
Auch Vielfahrer
finden offenbar wachsendes Gefallen an
E-Mobilität. Wer mehr als 20.000 Kilometer im
Jahr unterwegs ist, bewertet E-Autos aktuell zu
54 Prozent positiv („sehr gut“ oder „gut“).
Anfang 2024 waren es mit 29 Prozent fast die
Hälfte weniger.
Tatsächlich ziehen auch
die Anschaffungen von E-Autos bei denen an, die
vergleichsweise viel fahren. Wer etwa mehr als
12.000 Kilometer im Jahr unterwegs ist, stieg im
zweiten Quartal 2025 bei Fahrzeugwechseln zu 6,1
Prozent auf Elektroantriebe um. Diese
Umstiegsquote liegt damit um ein Drittel höher
als bei Fahrern mit einer Jahresleistung bis
6.000 Kilometern (4,2 %).
Und eine
weitere Messung im zweiten Quartal 2025 ergibt:
80 Prozent derjenigen, die bislang schon ein
E-Auto haben und mehr als 12.000 Kilometer im
Jahr fahren, wählen beim Fahrzeugwechsel erneut
ein reines E-Auto. Ihre Erfahrungen auf längeren
Strecken mit Reichweite und Lademöglichkeiten
sind also offenbar nicht so schlecht.
Gebrauchte E-Autos als Game Changer
Vermehrte
Wechsel zum E-Auto in der privaten Bevölkerung
könnten auch durch politische Weichenstellungen
befördert werden. So plädiert laut
HUK-E-Barometer eine deutliche Mehrheit von 60
Prozent der Deutschen ab 16 Jahren dafür, dass
auch gebrauchte E-Autos bei einer staatlichen
Förderung berücksichtigt werden. Sogar jeder
Dritte aus dieser Gruppe erklärt, dass dann für
ihn persönlich die Anschaffung eines
Elektroautos wahrscheinlicher wird.
Dr.
Rheinländer: „Käufe von Gebrauchtwagen sind um
ein Vielfaches häufiger als Zulassungen neuer
Fahrzeuge im deutschen Automarkt. Je mehr
Elektroautos im Gebrauchtwagenmarkt daher eine
Rolle spielen, desto stärker werden die Effekte
sein –besonders für das Klima."

NRW: 4 von 5 Personen mit
Migrationshintergrund sprachen 2024 zu Hause
Deutsch
* 18,4 % sprachen zu Hause gar kein Deutsch.
* Deutliche Unterschiede zwischen selbst
Eingewanderten und ihren Nachkommen.
*
Türkisch, Arabisch und Russisch häufigste
ausländische Sprachen.
Im Jahr 2024
lebten rund 5,69 Millionen Personen mit
Migrationshintergrund in NRW. Von diesen
sprachen mit 26,7 % über ein Viertel zu Hause
ausschließlich Deutsch. Wie das Statistische
Landesamt anhand von Erstergebnissen des
Mikrozensus 2024 weiter mitteilt, lebten 54,8 %
in einem Haushalt, in dem neben Deutsch
mindestens eine weitere Sprache gesprochen
wurde. 18,4 % der Personen mit
Migrationshintergrund in NRW sprachen 2024 zu
Hause gar kein Deutsch.

Deutliche Unterschiede zwischen
Eingewanderten und ihren Nachkommen Personen,
die selbst nach 1955 nach Deutschland
eingewandert sind, sprechen in den eigenen vier
Wänden seltener Deutsch als ihre direkten
Nachkommen. In 2024 verständigten sich 18,8 %
der Eingewanderten zu Hause ausschließlich auf
Deutsch, bei Kindern von Eingewanderten lag
dieser Anteil mit 42,8 % mehr als doppelt so
hoch.
Demgegenüber sprachen 25,1 % der
Eingewanderten zu Hause gar kein Deutsch, bei
den direkten Nachkommen von Eingewanderten lag
dieser Anteil bei nur 5,0 %. Türkisch, Russisch
und Arabisch häufigste ausländische Sprachen Von
Personen mit Migrationshintergrund insgesamt,
bei denen im Haushalt neben Deutsch noch
mindestens eine andere Sprache gesprochen wird,
unterhielten sich 21,5 % überwiegend auf
Deutsch.
Am zweithäufigsten wurde
Türkisch (15,0 %) als hauptsächlich verwendete
Sprache genannt, gefolgt von Russisch (10,3 %),
Arabisch (9,8 %) und Polnisch (6,6 %). Die
Bevölkerung mit Migrationshintergrund, die zu
Hause gar kein Deutsch spricht, verständigte
sich dort am häufigsten auf Türkisch (12,5 %),
Russisch (10,7 %), Arabisch (10,5 %), Ukrainisch
(9,0 %) und Polnisch (7,7 %).
|