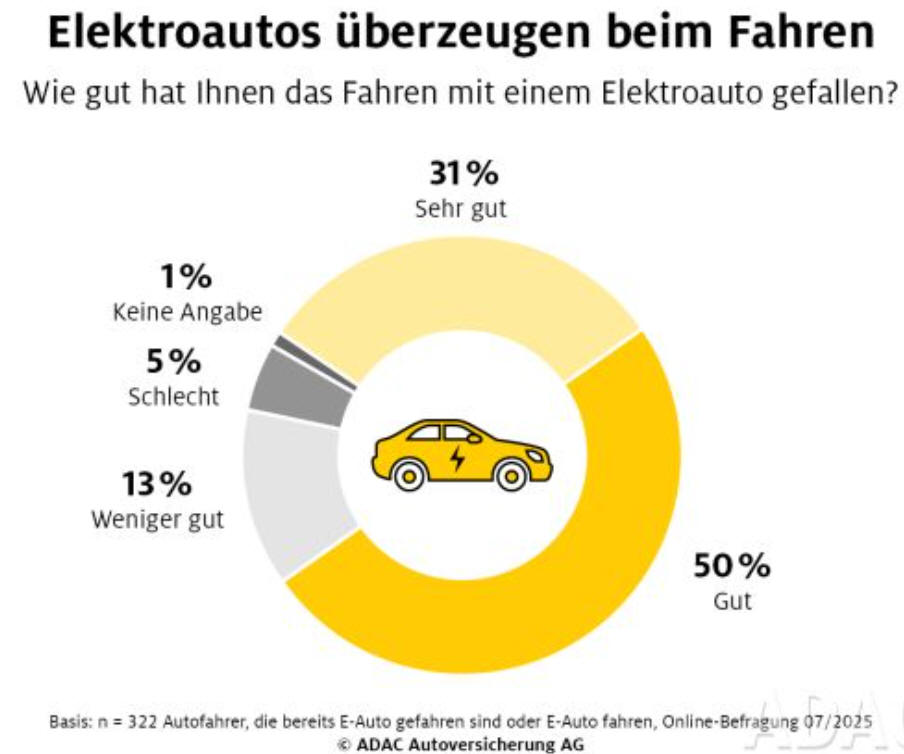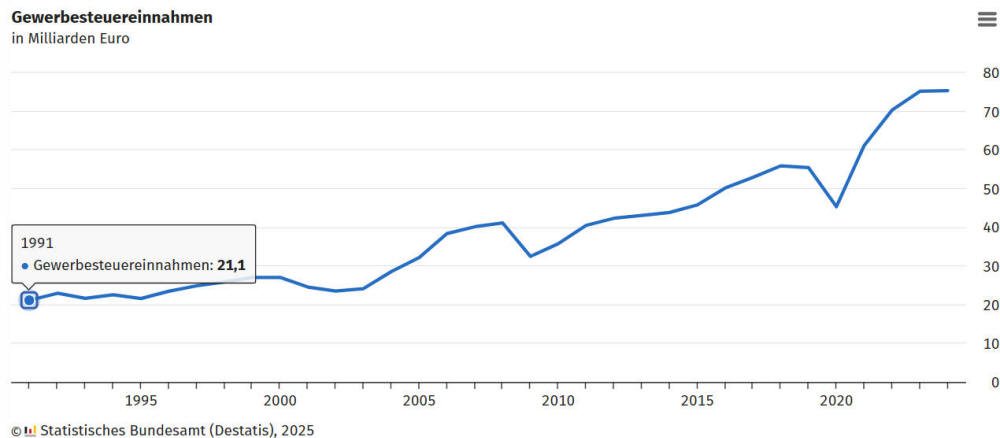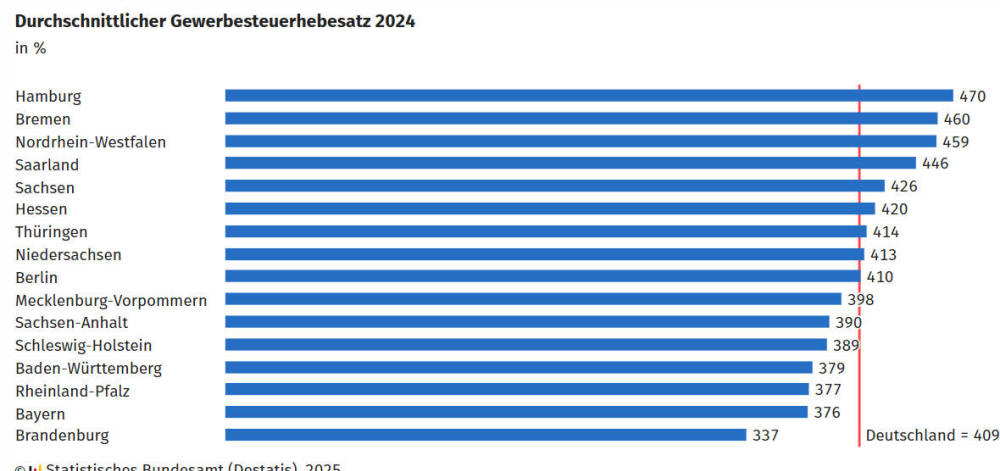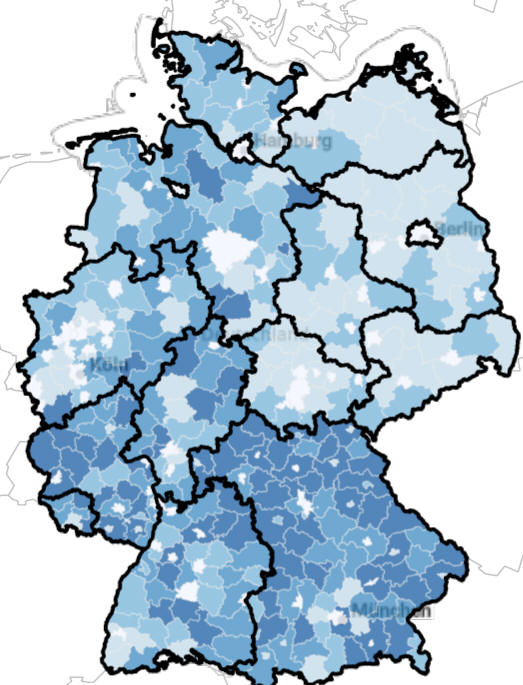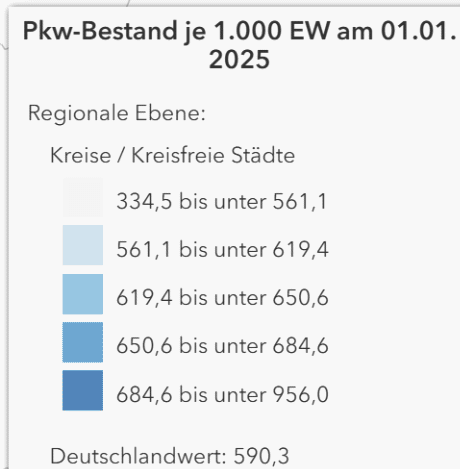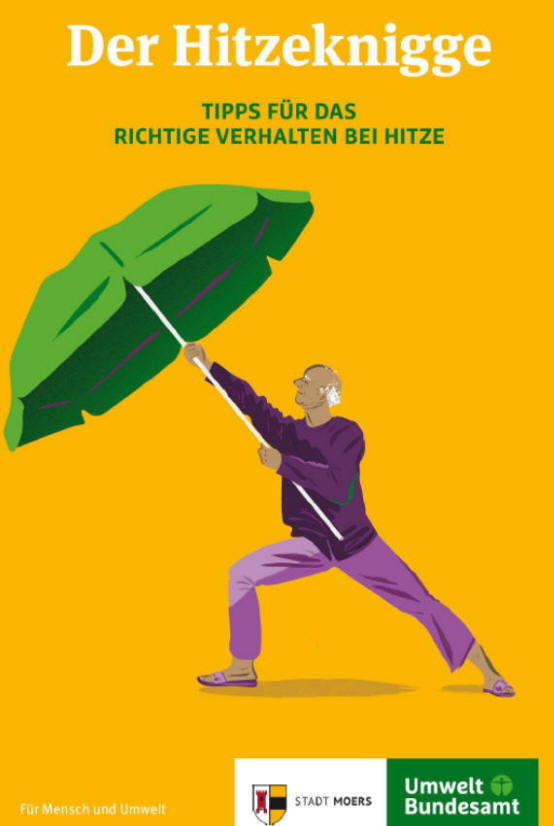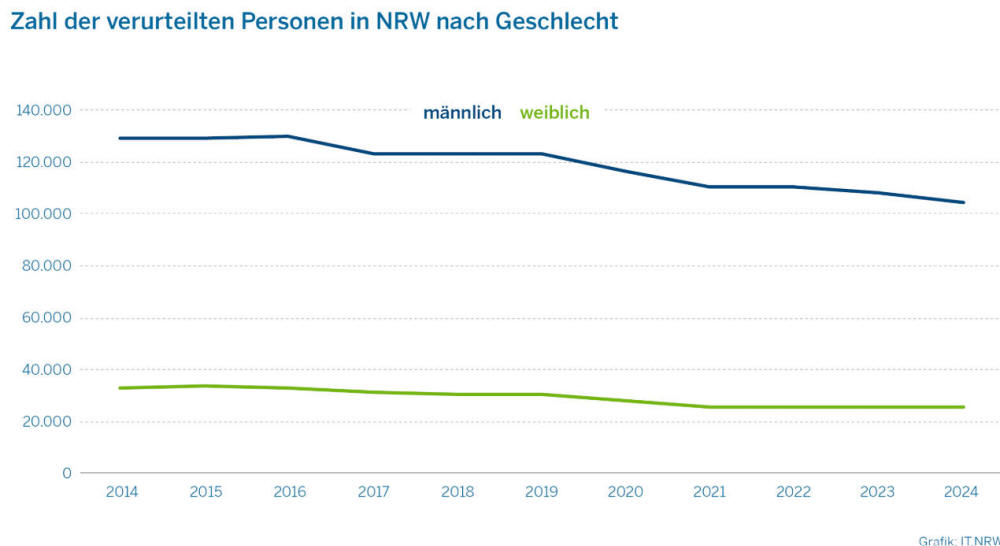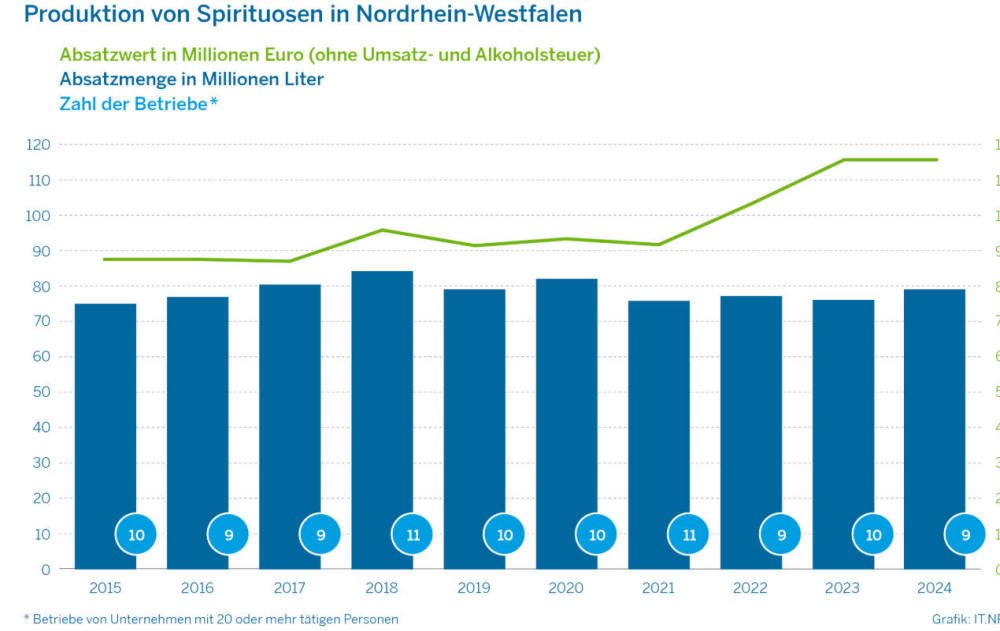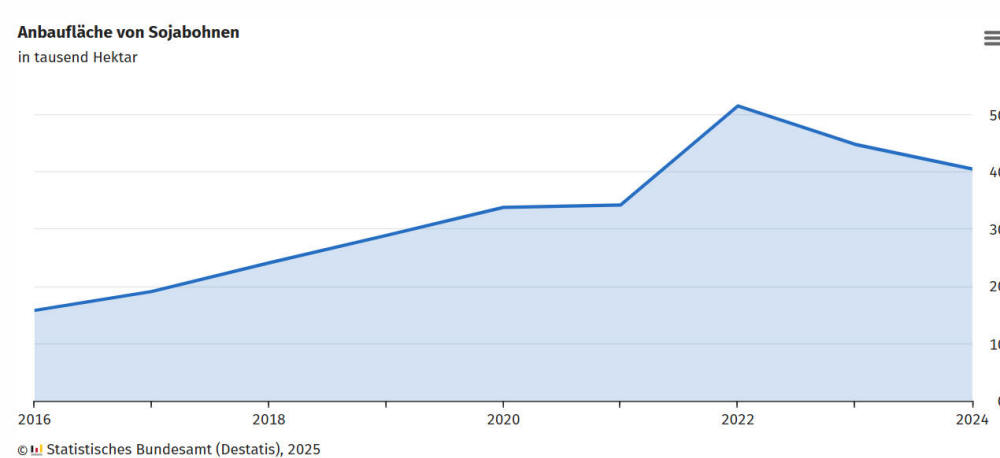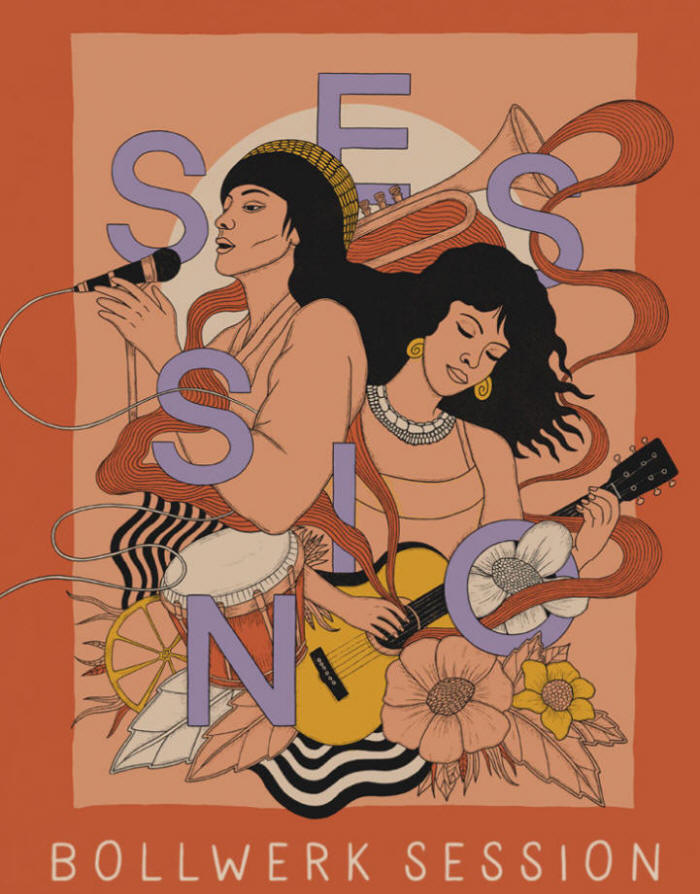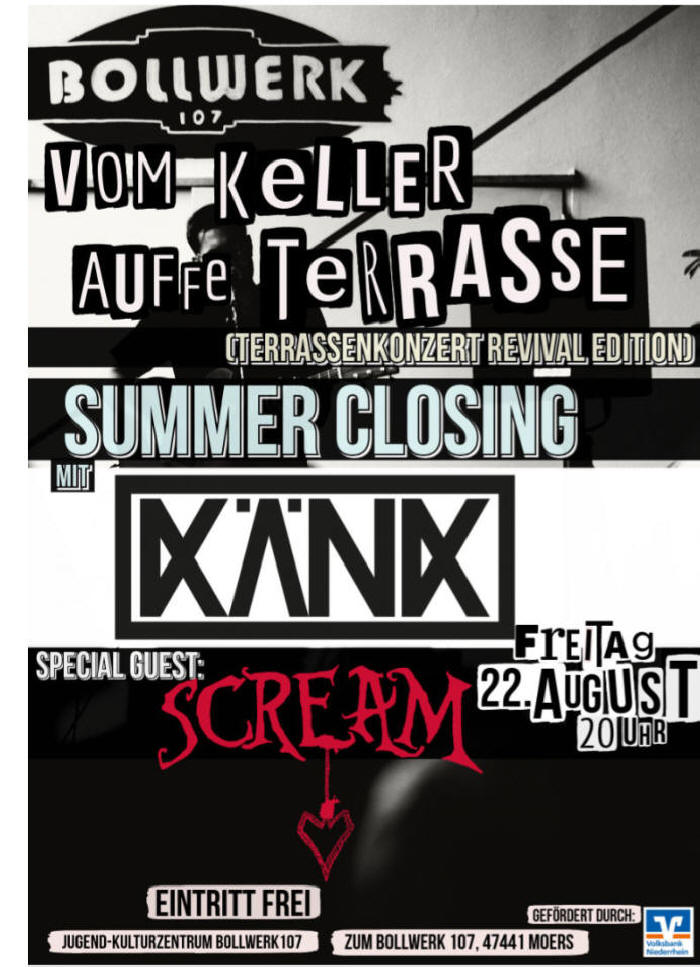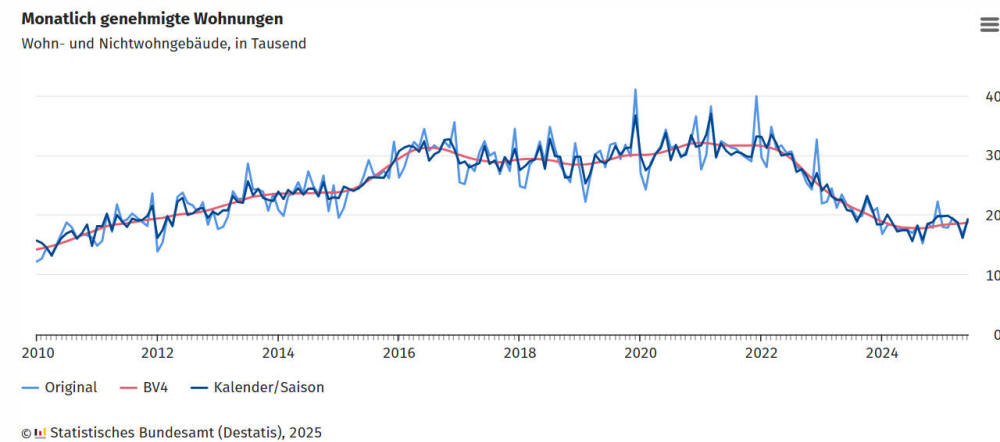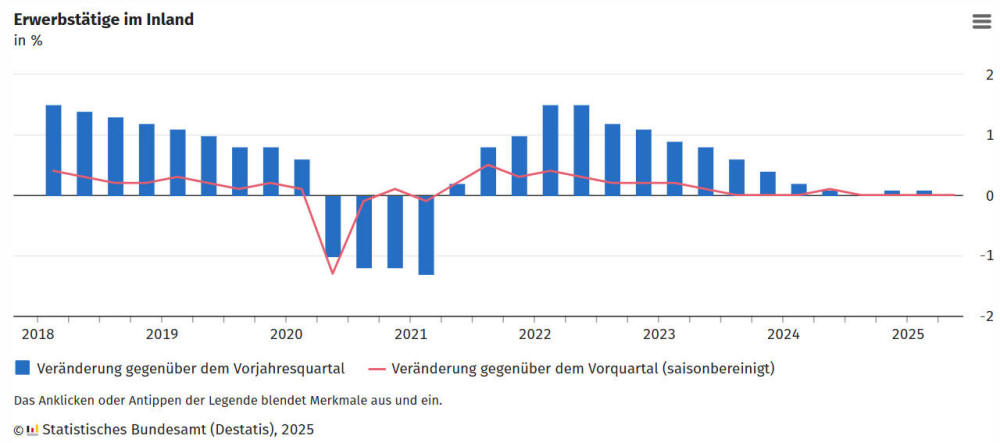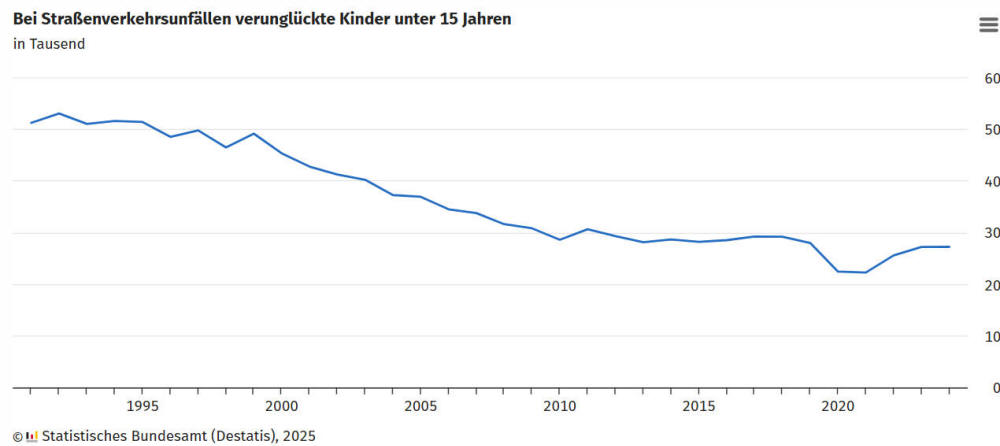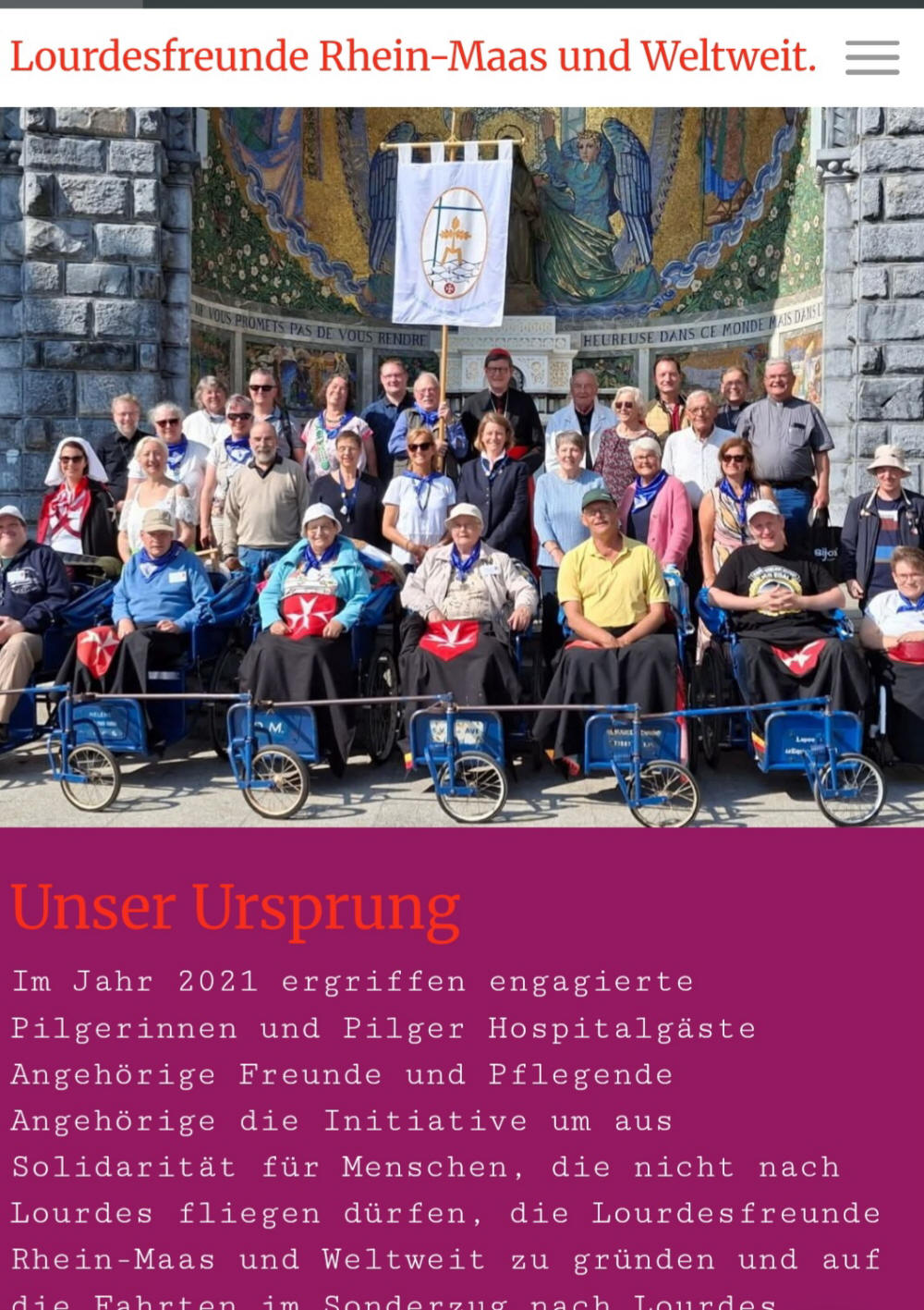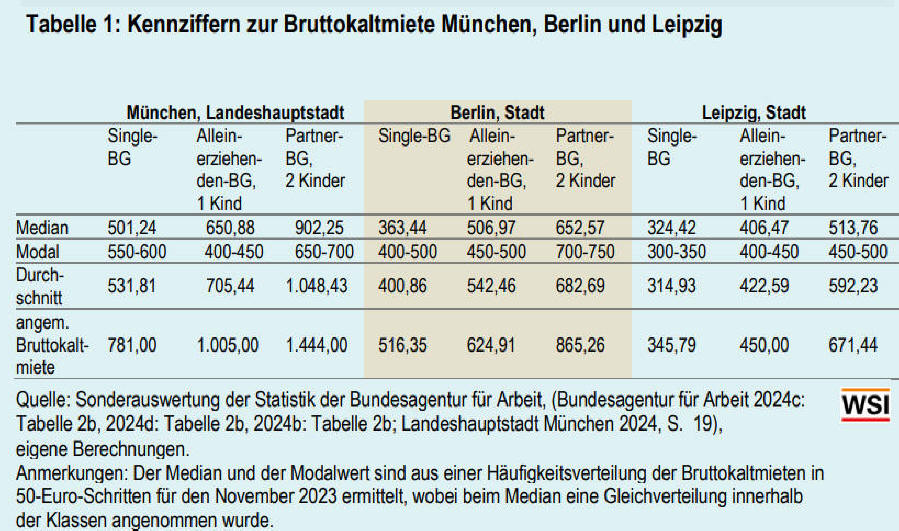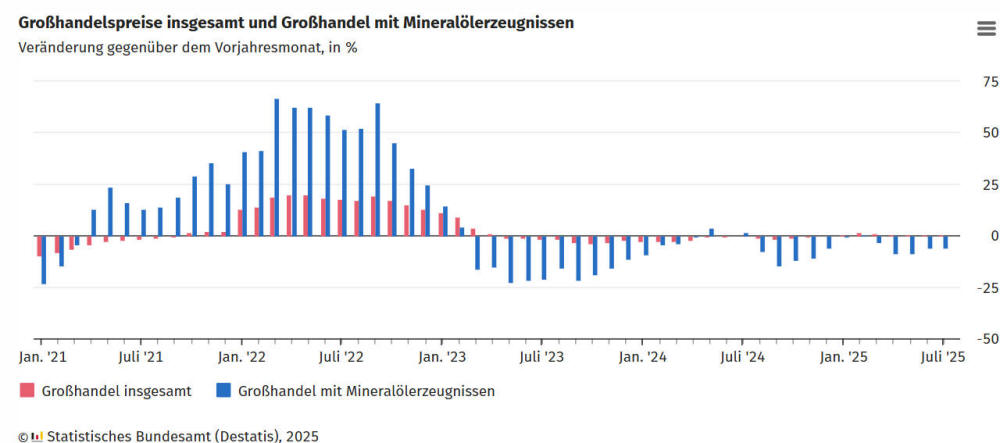|
KW 34:
Montag, 18. - Sonntag, 23.8.2025
Themen u.a.:
Stadt Dinslaken fordert THW für Einsatz am
Rotbachsee an
Um den
Fischbestand im Rotbachsee zu retten, hat die
Stadtverwaltung das Technische Hilfswerk (THW)
um Amtshilfe gebeten. Seit gestern Abend
(21.08.) läuft die Havariepumpe.

THW
Einsatz am Rotbachsee
Ziel ist es, das
Gewässer mit Hilfe der Pumpe durchzuwälzen zur
Sauerstoffanreicherung. Damit soll das
Fischsterben gestoppt und die Gefahr einer
weiteren Verschlechterung der Wasserqualität
gebannt werden. Die Pumpen sollen zunächst bis
Sonntag laufen, dann werden die Werte des
Wassers erneut durch den Lippeverband überprüft.
Die Stadtverwaltung bedankt sich ganz herzlich
für den Einsatz aller Beteiligten.
Neue U.S.-Zollvorschriften:
Temporäre Einschränkungen beim postalischen
Warenversand in die USA für Privat- und
Geschäftskunden
•
Executive Order
„Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for
all Countries“ der USA ändern die Grundlagen für
den postalischen Warenversand in die USA für
alle Post- und Paketdienstleister.
•
Mit Ablauf des 22.
August müssen Deutsche Post und DHL Paket
übergangsweise die Annahme und den Transport von
Geschäftskunden-Paketen sowie Warenpost über den
Postweg in die USA aussetzen.
•
Warenversand über
DHL Express weiter möglich
•
Päckchen und Pakete,
die ausschließlich Geschenke von Privatpersonen
an Privatpersonen mit einem Warenwert bis 100
US-Dollar enthalten und auch als „Geschenk /
gift“ deklariert sind, sowie Dokumente können
weiter wie gewohnt versendet werden

Aufgrund der neuen zollrechtlichen Bestimmungen
gemäß der Executive Order „Suspending Duty-Free
De Minimis Treatment for all Countries“, die ab
dem 29. August 2025 gelten, kommt es zu
temporären Einschränkungen beim postalischen
Warenversand in die USA für Privat- und
Geschäftskunden. Mit Ablauf des 22. August
können Deutsche Post und DHL Paket vorerst keine
Pakete und Warenpost International von
Geschäftskunden in die USA mehr annehmen und
befördern.
•
Grund für die
voraussichtlich vorübergehenden Einschränkungen
sind neue, von den U.S.-amerikanischen Behörden
geforderte Prozesse für den postalischen
Versand, die von den bisher geltenden Regelungen
abweichen. Wesentliche Fragen sind noch
ungeklärt, insbesondere, wie und von wem die
Zollgebühren künftig zu erheben sind, welche
zusätzlichen Daten erforderlich sind und wie die
Datenübermittlung an die amerikanische
Zollbehörde (U.S. Customs and Border Protection)
erfolgen soll.
Nicht betroffen von der
Executive Order sind Pakete von Privatpersonen
an Privatpersonen mit einem Warenwert bis 100
US-Dollar, die als „Geschenk / gift“ deklariert
sind. Diese Sendungen werden allerdings noch
stärker als bisher kontrolliert werden, um einen
Missbrauch privater Geschenkesendungen zum
Versand kommerzieller Waren zu unterbinden.
Beim Versand von Dokumenten in Briefen
ändert sich ebenfalls nichts. Weiter möglich ist
zudem der Warenversand per DHL Express und der
kommerzielle Import von Waren in die USA unter
Anwendung der aktuell geltenden Zollsätze. Diese
gelten auch für Privatkunden-Pakete mit einem
Warenwert über 100 USD.
•
Diese Änderungen
betreffen alle Post- und Paketdienstleister
weltweit, von denen viele bereits ein Aussetzen
des postalischen Versands in die USA angekündigt
haben. Auch die Vereinigung der europäischen
Postdienstleister - PostEurop - hat bereits
kommuniziert, dass ihre Mitgliedsunternehmen in
Übereinstimmung mit den zuständigen nationalen
Behörden den Versand von Waren über die
Postnetzwerke in die USA vorübergehend
einschränken oder aussetzen werden müssen.
•
Unterschied zwischen
postalischer und kommerzieller Verzollung
Die
Prozessänderungen der Executive Order betreffen
die postalische und die kommerzielle Verzollung
in unterschiedlicher Weise. Der Transport und
die Einfuhr postalischer Sendungen erfolgt durch
nationale Postunternehmen, die spezielle
Vereinbarungen mit den Zollbehörden und dem
United States Postal Service (USPS) haben.
Der postalische
Verzollungsprozess ist in der Regel einfacher
und kostengünstiger. Grundlage für die
postalische Verzollung ist der Weltpostvertrag.
Dieser Weg der Einfuhr von Sendungen steht
nunmehr für kommerzielle Sendungen und jegliche
Sendungen mit einem Warenwert über 100 USD
zunächst nicht mehr zur Verfügung.
Die
kommerzielle Verzollung, wie sie beispielsweise
DHL Express anbietet, steht Kunden weiter zur
Verfügung. Allerdings fällt auch hier die
bisherige Zollfreigrenze (sog. „De Minimis“)
weg. Alle kommerziell verzollten Sendungen, auch
solche mit Warenwert unter 100 USD, sind
verzollungspflichtig. Für Waren aus Deutschland
bzw. der Europäischen Union beträgt der Zollsatz
voraussichtlich 15 Prozent des Warenwertes –
einige Warengruppen können aber auch höheren
Zöllen unterliegen.
Diese Verzollungsart
betrifft bisher primär den gewerblichen
Warenverkehr und wird oft durch spezialisierte
Zollagenten oder -broker durchgeführt.
Kommerzielle Sendungen unterliegen strengeren
Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der
Beschreibung, der Klassifikation und dem
Wertnachweis der Ware, und anderen Kontrollen.
Die Anmeldung der Ware erfolgt beim Versand
mit DHL Express durch DHL als Verzollungsagent
in den USA. Die Zahlung der fälligen Abgaben
erfolgt gemäß des zwischen Versender und
Empfänger vereinbarten "Incoterm" (International
Commercial Terms). Dort ist festgelegt, wer für
die Kosten und Risiken während des Transports
von Waren verantwortlich ist – und eben wer für
die Verzollung zuständig ist.
Bis zum
Inkrafttreten der Executive Order gilt für
Sendungen aus der Europäischen Union noch die
derzeitige Regelung, dass Waren mit einem
geringen Wert (bis 800 USD) ohne Zollgebühren in
die USA importiert werden können. Mit den
Änderungen werden alle Importe, außer rein
private Sendungen mit Geschenken mit einem Wert
von unter 100 USD, zum 29. August 2025
zollpflichtig. Die Regelungen gelten für die USA
und Puerto Rico.
DHL verfolgt die weitere
Entwicklung sehr genau und steht – gemeinsam mit
seinen europäischen Partnern – in Kontakt mit
den US-Behörden. Ziel des Unternehmens ist, den
postalischen Warenversand in die USA so schnell
wie möglich wieder aufzunehmen.
Park & Plus - Ausflugstipps für die Ferien (7):
Ein Tag im Freizeitzentrum Xanten und im
Archäologischen Park Xanten
Ein Tag
in den Revierparks und Freizeitzentren des
Regionalverbandes Ruhr (RVR) ist wie ein kleiner
Urlaub. Und ein Ausflug zu den grünen
Erholungsinseln lässt sich bestens verbinden mit
einem Abstecher zu Museen, Schlössern und
Ausstellungen in der Umgebung. In den
Sommerferien stellt der idr wöchentlich einen
Tipp vor. Diesmal stehen das Freizeitzentrum
Xanten und der Archäologische Park des
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) im Fokus.
Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) ist ein
ideales Ziel für Familien. Rund um die beiden
großen Seen – Xantener Südsee und Xantener
Nordsee – gibt es weitläufige Badestrände mit
flachen Uferbereichen. Spielplätze und eine
Wasserspielzone sorgen dafür, dass es den
Jüngsten nicht langweilig wird. Auch wer es
sportlich mag, hat an den großen Badeseen viele
Möglichkeiten: Fahrten im Tret- oder Ruderboot
sind ebenso möglich wie Stand-up-Paddling und
Wasserski auf zwei Anlagen.
Abseits des
Wassers wartet u. a. eine Adventuregolf-Anlage
mit 18 naturnahen Bahnen. Wer sich vom Wasser
aufs Rad schwingt, ist in rund einer
Viertelstunde am LVR-Römermuseum. Dort tauchen
Besucherinnen und Besucher ein in die römische
Vergangenheit Xantens. Exponate zum Anfassen und
Ausprobieren, Hörspiele und viele Stationen für
Kinder bieten spannende Einblicke in das Leben
vor 2.000 Jahren.
Das Römermuseum ist
Teil des Archäologischen Parks. Auf dem Gelände
der römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana machen
rekonstruierte Bauten wie Amphitheater,
Stadtmauer und Tempelanlagen das Leben im alten
Rom anschaulich. idr - Infos:
http://www.rvr.ruhr/ferientipps
Bundesministerin Bärbel Bas setzt
Sozialstaatskommission ein - Reformvorschläge
werden Ende 2025 vorgestellt
Berlin, 21. August 2025 -
Zur Erarbeitung von Vorschlägen für
einen modernen und entbürokratisierten
Sozialstaat unter Bewahrung des sozialen
Schutzniveaus hat Bundesministerin Bärbel Bas
eine erweiterte Regierungskommission mit
Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern
und Kommunen eingesetzt. Die
Sozialstaatskommission nimmt ihre Arbeit im
September auf und wird entsprechend des
Koalitionsvertrages bis Ende 2025 ihre
Ergebnisse in Form eines Abschlussberichts
vorlegen.

©
Foto F. Pinjo / BMAS.
Die Kommission wird vorhandene
Reformvorschläge für einen modernen Sozialstaat
und eine effiziente und bürgerfreundliche
Sozialverwaltung prüfen und priorisieren. In
Fachgesprächen werden Expertise und Vorschläge
der Sozialpartner, der Sozial- und
Wirtschaftsverbände, des Bundesrechnungshofs und
weiterer Stakeholder aus Wissenschaft und Praxis
einschließlich des Normenkontrollrats und der
Initiative für einen handlungsfähigen Staat
einbezogen.
Der Fokus liegt auf
steuerfinanzierten Leistungen wie Bürgergeld,
Wohngeld und Kinderzuschlag. Die Zusammenlegung
von Sozialleistungen, die Beschleunigung von
Verwaltungsabläufen und die Digitalisierung sind
weitere Aufgabenstellungen.
Die konkreten
Maßnahmenvorschläge sollen ab Anfang 2026 von
den fachlich zuständigen Ressorts umgesetzt
werden. Für Punkte, bei denen eine weitere
konzeptionelle Prüfung und Konkretisierung
notwendig ist, wird die Kommission Prüfaufträge
formulieren. Diese sollen ab Anfang 2026 in den
Ressorts konzeptionell weiterentwickelt und zur
Entscheidungsreife gebracht werden.
Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel
Bas:
„Wir haben einen starken Sozialstaat.
Wir müssen es jedoch schaffen, den Sozialstaat
und die Sozialverwaltung vor Ort
bürgerfreundlicher, wirksamer und effizienter zu
gestalten. Gleichzeitig muss das soziale
Schutzniveau bewahrt werden. Wer in Not gerät,
muss sich auf den Sozialstaat verlassen können,
ohne Wenn und Aber. Die staatliche Unterstützung
muss unbürokratisch und schnell erfolgen. Die
Kommission zur Sozialstaatsreform soll dazu
einen Beitrag leisten.“
Gemeinsame EU/USA-Erklärung zu transatlantischem
Handel und Investitionen
Die EU
und die USA haben eine Gemeinsame Erklärung
veröffentlicht, die einen Rahmen für einen
fairen, ausgewogenen und für beide Seiten
vorteilhaften transatlantischen Handel und
Investitionen schafft. Sie baut auf der
politischen Einigung von
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und
US-Präsident Donald Trump vom 27. Juli auf. Die
Erklärung (engl.) ist hier verlinkt.
Die transatlantischen Beziehungen sind
mit 1,6 Billionen Euro jährlich die wertvollsten
Wirtschaftsbeziehungen der Welt. Das Abkommen
sichert diese Beziehungen und Millionen
Arbeitsplätze in der EU. Vorhersehbarkeit,
Stabilität, Sicherheit Die
Kommissionspräsidentin betonte, dass die EU
stets das Beste für ihre Bürgerinnen, Bürger und
Unternehmen anstrebt:
„Im Angesicht einer
schwierigen Situation haben wir unseren
Mitgliedstaaten und unserer Industrie geholfen
und Klarheit und Kohärenz im transatlantischen
Handel wiederhergestellt. Das ist nicht das Ende
des Prozesses, sondern wir arbeiten weiterhin
mit den USA zusammen, um mehr Zollsenkungen zu
vereinbaren, um weitere Bereiche der
Zusammenarbeit zu ermitteln und mehr Potential
für das Wirtschaftswachstum zu schaffen.“
Strategisches Abkommen, von dem viele
Sektoren profitieren EU-Handelskommissar Maros
Šefčovič sagte mit Blick auf die intensive und
konstruktive Zusammenarbeit mit der
US-amerikanischen Seite: „Die Gemeinsame
Erklärung hat in einer Zeit, in der sich die
globale Handelslandschaft grundlegend verändert,
echtes Gewicht. Es ist ein ernstzunehmendes,
strategisches Abkommen – und wir stehen voll und
ganz hinter ihm.“
Šefčovič betonte, dass
ein breites Spektrum von Sektoren profitieren
wird – dazu gehören auch strategische
Wirtschaftszweige wie Autos, Arzneimittel,
Halbleiter und Holz. Ein Handelskrieg hätte
viel Schaden angerichtet Der
Handelskommissar fügte hinzu: „Die Alternative –
ein Handelskrieg mit Hochzöllen und politischer
Eskalation – würde Arbeitsplätze, Wachstum und
Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks
schädigen. Stattdessen müssen die EU und die USA
einen Weg der Zusammenarbeit einschlagen, der
auf unser gemeinsames Ziel der
Reindustrialisierung und Stärkung der
wirtschaftlichen Resilienz abgestimmt ist.“
Erster Schritt in einem fortlaufenden
Prozess In der Gemeinsamen Erklärung wird die
Verpflichtung beider Seiten dargelegt, auf die
Wiederherstellung von Stabilität und
Berechenbarkeit im Handel und bei den
Investitionen zwischen der EU und den USA zum
Nutzen von Unternehmen und Bürgern
hinzuarbeiten. Das ist der erste Schritt in
einem Prozess, der den Handel steigern und den
Marktzugang in weiteren Sektoren verbessern
wird.
Details Für die überwiegende
Mehrheit der EU-Ausfuhren, einschließlich
strategischer Sektoren wie Kraftfahrzeuge,
Arzneimittel, Halbleiter und Holz, gilt ein
Zollsatz von maximal 15 Prozent (all-inclusive,
beinhaltet also auch bestehende MFN-Zölle).
Sektoren, für die bereits
Meistbegünstigungstarife von 15 Prozent oder
mehr gelten, unterliegen keinen zusätzlichen
Zöllen.
Für Personenkraftwagen und
Kraftfahrzeugteile werden die 15 Prozent
parallel zum Start des EU-Verfahrens für
Zollsenkungen für US-Erzeugnisse gelten. Ab dem
1. September wird eine Reihe von Produktgruppen
von einer Sonderregelung profitieren, bei der
nur Meistbegünstigungstarife gelten. Dazu
gehören nicht verfügbare natürliche Ressourcen
(z. B. Kork), alle Flugzeuge und
Luftfahrzeugteile, Generika und ihre
Inhaltsstoffe sowie chemische Ausgangsstoffe.
Beide Seiten unternehmen ehrgeizige
Anstrengungen, um diese Regelung auf andere
Produktkategorien auszuweiten – ein wichtiges
Ergebnis für die EU. Die EU und die USA
beabsichtigen, ihre Volkswirtschaften vor
Überkapazitäten im Stahl- und Aluminiumsektor zu
schützen und an sicheren Lieferketten zu
arbeiten. Dazu gehört eine Zollkontingentslösung
für EU-Ausfuhren von Stahl und Aluminium und
deren Derivaten.
Nächste Schritte
Die Kommission wird mit Unterstützung der
EU-Mitgliedstaaten und des Europäischen
Parlaments und im Einklang mit den einschlägigen
internen Verfahren rasch die wichtigsten Aspekte
der Vereinbarung umsetzen. Die EU wird sich auch
an der Aushandlung eines Abkommens über einen
fairen, ausgewogenen und für beide Seiten
vorteilhaften Handel mit den USA im Einklang mit
dem vereinbarten Rahmen und den geltenden
Verfahren beteiligen.
Im Anschluss an
das politische Abkommen zwischen der EU und den
USA hat die EU mit Wirkung vom 7. August auch
die am 24. Juli 2025 angenommenen Maßnahmen zur
Wiederherstellung des Gleichgewichts
ausgesetzt. Hintergrund Die transatlantische
Partnerschaft ist eine Schlüsselfunktion des
Welthandels und die bedeutendste bilaterale
Handels- und Investitionsbeziehung weltweit.
Der Waren- und Dienstleistungsverkehr
zwischen der EU und den USA hat sich in den
vergangenen zehn Jahren verdoppelt und lag 2024
bei über 1,6 Billionen Euro. Der Warenhandel
betrug 867 Milliarden Euro, der Handel mit
Dienstleistungen 817 Milliarden Euro. Das sind
täglich mehr als 4,2 Milliarden Euro an Waren
und Dienstleistungen über den Atlantik.
Diese vertiefte und umfassende Partnerschaft
wird durch gegenseitige Investitionen
untermauert. Im Jahr 2022 investierten
Unternehmen aus der EU und den USA in die Märkte
der jeweils anderen Seite 5,3 Billionen Euro.
Rotbachsee droht umzukippen: Stadt Dinslaken
leitet Maßnahmen ein
Aktuell
droht der Rotbachsee aufgrund der andauernden
Hitze und des geringen Niederschlags der
vergangenen Wochen umzukippen. Mitarbeitende des
Lippeverbandes hatten den Angelsportverein ASV
Petri Heil vor Ort informiert, der umgehend die
Stadtverwaltung in Kenntnis gesetzt hatte.

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel veranlasste
sofortige Maßnahmen einzuleiten: „Ich danke dem
Verein für ihr rasches Handeln. Wir hoffen, dass
die freiwillige Feuerwehr Hiesfeld mit dem
Einleiten von Frischwasser Erfolg haben wird und
den Fischbestand sowie das Ökosystem retten zu
können.“
Einige Fische, darunter
Jungfische, Brassen und große Karpfen, treiben
bereits seit Dienstagmorgen (19.08.) an der
Wasseroberfläche, nun versucht die freiwillige
Feuerwehr Hiesfeld den verbliebenen Fischbestand
durch Rezirkulationsmaßnahmen und die Einleitung
von Frischwasser – rund 80 bis 96 Kubikmeter pro
Stunde - zu retten.
Der vom Lippeverband
gemessene Sauerstoffgehalt lag mit einem
Milligramm pro Liter bereits in einem sehr
kritischen Bereich (Der Grenzwert liegt bei 7
Milligramm pro Liter). Die Temperatur war mit 23
bis 24,5 Grad bei der Messung sehr hoch. Die
Wassereinleitung soll nun so lange
aufrechterhalten werden, wie nötig.
In
den kommenden Tagen werden Mitarbeitende der
Stadtverwaltung aus dem Fachdienst Tiefbau und
die freiwillige Feuerwehr den See beobachten und
prüfen, ob sich das Ökosystem durch die
Maßnahmen wieder erholt.
Wesel - „Schule hat begonnen“:
Verkehrssicherheit zum Start des neuen
Schuljahres
Mit Beginn des
neuen Schuljahres am Mittwoch, 27. August 2025,
kehren die Schüler*innen wieder in das Weseler
Straßenbild zurück. In Wesel besuchen rund 6.500
Kinder und Jugendliche eine Weseler Schule, rund
2.350 davon eine Grundschule.
556 Kinder
sind i-Dötzchen.
Für diese
Schul(weg)neulinge ist es das erste Mal, dass
sie überhaupt eine Schule besuchen. Außerdem
wechseln 565 Kinder von der Grundschule auf eine
weiterführende Schule und müssen sich an einen
neuen Schulweg gewöhnen. Daher ist vor allem in
den ersten Tagen und Wochen des neuen
Schuljahres die besondere Rücksichtnahme aller
Verkehrsteilnehmer*innen gefragt.
Die
Partner*innen für die Schulwegsicherung in Wesel
(Polizei Wesel, Kreisverkehrswacht, Schulamt des
Kreises Wesel, Schulleitungen, Stadt Wesel)
ergreifen deshalb verschiedene Maßnahmen, um
einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. Um den
ersten Weg zur Schule zu erleichtern, wurden für
die Eltern Schulwegsicherungspläne ausgearbeitet
und über die Schulen verteilt.
Zudem
werden an folgenden Stellen im Stadtgebiet Wesel
Spannbänder mit der Aufschrift „Brems Dich! –
Schule hat begonnen.“ durch den ASG Wesel
aufgehängt: Schillstraße (stadteinwärts rechts
vor der Musik- und Kunstschule) B8 Reeser
Landstraße an der Fußgängerbrücke am
Schulzentrum (in Absprache mit Straßen NRW) B8
Höhe Lippesportplatz (stadteinwärts)

v.r.n.l.
Frank Schulten, Anne Jansen, Sandra Klingler,
Anna Kiesow, Rebecca Hohrein, Bürgermeisterin
Ulrike Westkamp, Kerstin Gelbke-Motte, Rainer
Benien, Andreas Westermann, Beatrix
Christodoulou, Urban Beckmann, Silke Swoboda,
Iris Overlöper (Vertreter*innen v. Polizei,
Kreisverkehrswacht, Stadt Wesel, Schulamt Kreis
Wesel)
Es wird ein verstärkter Einsatz
der städtischen Überwachungskräfte und des
Bezirksdienstes der Polizei Wesel an Schulen,
insbesondere an Grundschulen und auf Schulwegen
zur Kontrolle von Halt- und Parkverboten
durchgeführt. Dadurch sollen die Eltern für die
Benutzung der Hol- und Bringzonen sensibilisiert
werden.
Ferner werden in den nächsten
Wochen die städtischen Messfahrzeuge zur
Geschwindigkeitskontrolle im Umkreis der Weseler
Schulen, vor allem Grundschulen und auf
Schulwegen, eingesetzt.
Eine
Verkehrssicherheitsaktion/Anhalteaktion findet
vom 15. September 2025 bis zum 26. September
2025 in Kooperation mit der Polizei Wesel, den
Weseler Grundschulen und der Ordnungsbehörde der
Stadt Wesel statt. Hieran nehmen in diesem Jahr
vier Grundschulen bzw. 10 Klassen der
Jahrgangsstufe 3 mit rund 250 Schüler*innen
teil.
Durch diese Aktion sollen die
Kraftfahrzeugführer*innen durch den Einsatz der
Grundschüler*innen als „kleine
Hilfspolizist*innen“, die Denk- und Dankzettel
verteilen, für ihre gefahrene Geschwindigkeit
sensibilisiert werden.
An verschiedenen
Grundschulen besteht ein Lotsendienst. Dieser
erfolgt ehrenamtlich durch die Eltern und trägt
erheblich zur Steigerung der Verkehrssicherheit
für Grundschulkinder bei. Vor vielen Schulen
sind Fahrradstraßen geschaffen worden. Hier hat
der Radverkehr Vorrang und auf ihn ist besondere
Rücksicht zu nehmen. Auch bereits im
Vorschulalter und während des Schuljahres findet
immer wieder Verkehrs-/Mobilitätserziehung
statt.
Durch die Polizei Wesel, das
Schulamt des Kreises Wesel und die
Kreis-Verkehrswacht werden verschiedene
Aktionen, wie zum Beispiel Verkehrspuppenbühne,
„Sicherheit durch Sichtbarkeit“ und
Radfahrausbildung, durchgeführt.
Das
Schulamt setzt einen Schwerpunkt auf die
Umsetzung des Projektes „Rollerfit“ (erweiterte
Verkehrserziehung für Rollerfahrende). Hierfür
wurden durch Spenden Roller + Parcourzubehör
angeschafft. Die Schulen können über einen
QR-Code die Gegenstände ausleihen. Hierbei
werden sowohl die Schüler*innen als auch deren
Eltern für das richtige Verhalten im
Straßenverkehr und mögliche Gefahrenquellen
sensibilisiert.
Um allen Schüler*innen
die Möglichkeit der Schulung im Bereich
Mobilität anbieten zu können, werden noch
weitere Sponsoren gesucht. Ziel aller Maßnahmen
ist ein sicherer Start ins neue Schuljahr bzw.
ins Schulleben für die Schüler*innen in Wesel.
Außerdem gibt es seit 2019 einen noch immer
aktuellen Schulelternappell. Der Appell wurde
von der Kreisverkehrswacht initiiert.
In diesem Appell werden die Eltern gebeten,
folgende Punkte zu beachten: Verzichten Sie
bitte – wann immer möglich – darauf, Ihr Kind
mit dem Auto zur Schule zu bringen. Ist es nicht
zu vermeiden, lassen Sie Ihr Kind in
ausreichender Entfernung von der Schule
aussteigen.
Üben Sie mit Ihrem Kind
frühzeitig den Schulweg, zu Fuß und/oder mit dem
Fahrrad. Hat Ihr Kind die Radfahrprüfung
abgelegt, sollte es in der Lage sein,
selbständig mit dem Rad zur Schule zu fahren.
Lassen Sie Ihr Kind, wenn es sich sicher fühlt,
den Schulweg alleine bewältigen.
Ambulante Versorgung: Erste KVNO
„Startpraxis“ entsteht in Kleve
Lokale Versorgungsstrukturen stärken und
gleichzeitig ärztlichen Nachwuchs beim Schritt
in die Selbstständigkeit unterstützten – mit
ihrer ersten „Startpraxis“ möchte die
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) in
Kleve gleich zwei Herausforderungen im
ländlichen Raum begegnen. Dafür richtet sie vor
Ort eine bestens ausgestattete Hausarztpraxis
ein. Unterstützt wird sie dabei von der Stadt
Kleve.
Zur Verbesserung der
hausärztlichen Versorgung entsteht in Kleve die
erste Startpraxis der KVNO.

Foto: aFotostock - stock.adobe.com
Dr.
med. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der
KV Nordrhein, erklärt das Konzept: „Wir bauen
eine moderne Praxisstruktur auf, die später von
Ärztinnen und Ärzten übernommen wird – eng von
uns begleitet und mit klarem Fokus auf
Selbstständigkeit. Unser Ziel ist es, frühzeitig
Strukturen dort zu schaffen, wo der Bedarf
wächst – und so die ambulante Versorgung vor Ort
langfristig zu stabilisieren. Die Startpraxis
verbindet Sicherstellungsaufgaben,
Nachwuchsförderung und moderne
Versorgungsansätze in einem Konzept.“
Vor
Ort sollen Patientinnen und Patienten, aber auch
Ärztinnen und Ärzte auf optimale Voraussetzungen
treffen. Von der Patientensteuerung über
Videosprechstunden bis zum
Self-Check-in-Terminal legt die KVNO von Beginn
an Wert auf moderne Räumlichkeiten, in denen die
Möglichkeiten der Digitalisierung ausgeschöpft
werden. Bereits im April 2026 sollen dort die
ersten Patientinnen und Patienten behandelt
werden.
Aufgebaut und betrieben wird die
Praxis zunächst durch die KVNO, die mit ihren
Fachleuten die anfangs angestellten Ärztinnen
und Ärzte eng beim Betrieb der Praxis begleiten.
Anschließend soll die Praxis dann nach einer
Anfangsphase übernommen und selbstständig
weitergeführt werden. Die enge Begleitung durch
die KVNO bietet dafür beste Startbedingungen.
„Mit der Etablierung der Startpraxis in
Kleve verbessern wir gezielt die hausärztliche
Versorgung in unserer Stadt. Als Stadtverwaltung
begrüßen wir das Engagement der Kassenärztlichen
Vereinigung Nordrhein in Kleve und unterstützen
das Vorhaben aktiv, zumal es sich um ein zeitnah
realisierbares Projekt mit unmittelbarem
Mehrwert handelt“, so Bürgermeister Wolfgang
Gebing.
„Hiermit endet das Engagement
der Stadt Kleve zur Stärkung der medizinischen
Versorgung allerdings nicht. Zusätzlich wird
sich die Stadt Kleve hinsichtlich der
Einrichtung eines medizinischen
Versorgungszentrums in kommunaler Trägerschaft
von externen Fachleuten beraten lassen, um die
Realisierbarkeit eines solchen Vorhabens zu
ergründen“, sagt der Bürgermeister. Hierzu hat
der Rat der Stadt Kleve die Verwaltung
beauftragt. Stellenausschreibungen sind bereits
online
Ausführliche Informationen über
das moderne Konzept der Startpraxis bietet die
KV Nordrhein auf ihrer Internetseite. Unter
www.kvno.de/ueber-uns/kvno-startpraxis finden
sich sowohl alle Einzelheiten zur Startpraxis
als auch die entsprechenden
Stellenausschreibungen der KVNO für den Standort
Kleve.
Die MVZ MADERMA GmbH
eröffnet zum 01.10.2025 eine dermatologische
Facharztpraxis in der Kirchstr. 72 in
Duisburg-Homberg
Geschäftsführer
und ärztlicher Leiter Dr. Mario Mader: „In den
letzten Jahren hat die MVZ MADERMA GmbH die
dermatologische Versorgung am Niederrhein und im
westlichen Ruhrgebiet kontinuierlich und
erfolgreich ausgebaut.
Ein wohnortnahes
Behandlungsangebot für die Patientinnen und
Patienten unserer Region weiter zu etablieren
und zu verbessern bleibt auch in Zukunft unser
Ziel. Wir freuen uns sehr, nunmehr auch in
DuisburgHomberg präsentzu sein und dort die
dermatologische Versorgung langfristig
sicherstellen zu können.“
In der Praxis
wird ein qualifiziertes und hochmotiviertes Team
ein breites Spektrum dermatologischer Diagnostik
und Behandlung anbieten. Dazu Dr. Mader: „Neben
der konservativen Dermatologie werden operative
Eingriffe sowie die Lasermedizin Schwerpunkte
unserer Praxis in Duisburg-Homberg sein.“
Termine können ab sofort online über die
Homepage www.hautarzt-homberg.de vereinbart
werden. Über die MVZ MADERMA GmbH Die MVZ
MADERMA GmbH ist ein inhabergeführtes
medizinisches Versorgungszentrum mit Sitz in
Wesel am Rhein.
Derzeit bietet das MVZ
dermatologische Leistungen in insgesamt 8 Praxen
in Wesel, Xanten, Bocholt, Dinslaken, Goch und
Bottrop sowie einer Belegbettenabteilung im St.
Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort an. Um die
Versorgung der Patientinnen und Patienten
kümmern sich 39 Ärztinnen und Ärzte.
Anmeldungen für den diesjährigen
Klimaschutzpreis der Stadt Wesel noch bis zum
14. September möglich
In der Stadt Wesel wird auch im Jahr 2025 der
Klimaschutzpreis verliehen. In rund drei Wochen
endet die Bewerbungsfrist für den Weseler
Klimaschutzpreis 2025. Jetzt ist der optimale
Zeitpunkt, um sich zu bewerben.

In Wesel wird auch im Jahr 2025 der
Klimaschutzpreis verliehen
Egal ob
Einzelpersonen, Vereine, Unternehmen,
Personengruppen, Arbeitsgemeinschaften, Schulen,
KiTas oder sonstige Institutionen, alle können
sich noch bis Sonntag, 14. September 2025, um
den Klimaschutzpreis bewerben.
Das Klima
durch die Schaffung eines Arten- und
Klimaschutzwaldes nachhaltig verbessern,
Totholzhaufen und Nistkästen für vielfältige
Lebensräume bereitstellen, gebrauchte
Elektrogeräte aufbereiten oder Informationen
rund um Energiesparen und Abfallvermeidung
vermitteln. Um dem Klimawandel lokal zu
begegnen, braucht es kreative Ideen. Und auch
kleinere Initiativen können große Wirkung
entfalten.
Der Westenergie
Klimaschutzpreis prämiert bereits seit 30 Jahren
vielfältige Maßnahmen für natürliche Klima- und
Umweltbedingungen. Er würdigt damit das
bürgerschaftliche Engagement vor Ort. Die
Projekte müssen auf Weseler Stadtgebiet
umgesetzt sein. Projekte die bereits prämiert
wurden, können nicht noch mal eingereicht
werden.
Die Jury honoriert die drei
besten Projekte mit Geldpreisen. Dem Gewinner
winken 2.500,- €, der zweite und dritte Platz
erhalten jeweils 1.500,- € bzw. 1.000,- €. Der
Westenergie Klimaschutzpreis fördert das
Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und
motiviert, sich für den Umweltschutz stark zu
machen. Die Einreichung der Bewerbungsunterlagen
ist bis zum 14. September 2025 unter https://klimaschutzpreis.westenergie.de/bewerbungsformular möglich.
Dort finden die Bewerber*innen auch die
geltenden Teilnahmebedingungen. Die
Preisverleihung findet am Donnerstag, 23.
Oktober 2025, 15 Uhr, im Weseler Rathaus
(Ratssaal) statt. Die Preisträger*innen müssen
damit einverstanden sein, dass ihr Name und Foto
und das Projekt in der Presse und im Internet
veröffentlicht werden. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Für Rückfragen steht
Klimaschutzmanager Ulrich Kemmerling zur
Verfügung (Telefon: 0281/203-2724 oder per
Mail: ulrich.kemmerling@wesel.de)
Die 10 besten Ideen für das Finale der
Klever Birne 2025 stehen fest!
Ressourcen klever teilen - gemeinsam
Nachhaltigkeit gestalten: 2025 steht der
Nachhaltigkeitswettbewerb Klever Birne ganz im
Zeichen der Tauschwirtschaft. Die Vorjury hat
aus 22 eingereichten Beiträgen die zehn
kreativsten Vorschläge zur gemeinschaftlichen
Nutzung von Ressourcen wie Mobilität, Raum,
Wissen und Zeit ausgewählt.

Die Top 10 der Klever Birne 2025. Foto: Claudia
de Kruijf / HSRW.
„Obwohl wir in diesem Jahr die Spielregeln
ein wenig enger gefasst und das Thema Sharing
Economy vorgegeben haben, haben wir ähnlich
viele Bewerbungen wie in den vergangenen zwei
Jahren erhalten“, freut sich Christina Martens,
auf Seiten der Hochschule Rhein-Waal (HSRW)
mitverantwortlich für die Durchführung der
Klever Birne.
„Die Bandbreite der
eingereichten Ideen war enorm“, ergänzt Pascale
van Koeverden von der Stadt Kleve. „Viele Ideen
tragen zu mehr als nur einem Nachhaltigkeitsziel
bei. Die Mehrheit der Vorschläge befasst sich
tatsächlich mit nachhaltigem Konsum und
Produktion, aber immer in Kombination mit
weiteren Aspekten, wie etwa Maßnahmen zum
Klimaschutz, weniger Ungleichheiten oder
hochwertiger Bildung.“
Beworben haben
sich neben Studierenden der HSRW auch einzelne
Bürger*innen, Unternehmen und Vereine. In den
Top 10 finden sich Ideen zu einem stadtweiten
Mehrwegsystem für Kaffeebecher, Tauschschränke
für Alltagsgegenstände in Ergänzung zu
bestehenden oder im Aufbau befindlichen
Bibliotheken der Dinge und ein Secondhand-Markt
in der Stadthalle. Eine Gruppe engagierter
Bürger*innen möchte ehrenamtliche
Quartiersarbeit leisten und gute Nachbarschaften
schaffen.
Ein Kollegenteam plant den
Aufbau eines für jeden*r zugänglichen lokalen
Umweltdatennetzwerks. Es werden Gärten gesucht
für die Pflanzung gemeinschaftlicher
Miniaturesswälder und Unterstützung für die
solidarische Landwirtschaft, bei der sich ein
Landwirt mit einer Gruppe privater Haushalte
zusammenschließt und nachhaltig Gemüse und Obst
produziert.
Die zehn Teams, darunter fünf
Projektgruppen von Studierenden bzw. ehemaligen
Studierenden der HSRW, bereiten sich derzeit auf
die Preisverleihung am 11. September 2025 vor.
Dann gilt es die Jury und auch das Publikum von
ihren Ideen in einem dreiminütigen Pitch zu
überzeugen. Zu gewinnen gibt es drei Preise, die
mit Geldbeträgen in Höhe von 1.000 € bis 2.000
€, einem Coaching und einer Urkunde ausgelobt
sind, sowie den Publikumspreis.
Bei der
Vorbereitung auf ihren Pitch erhalten sie
Unterstützung von der Stadt Kleve und dem
Projekt TransRegINT (Transformation der Region
Niederrhein: Innovation, Nachhaltigkeit und
Teilhabe) der HSRW, die die Klever Birne in
diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Folge
gemeinsam veranstalten.
Wer nun neugierig
geworden ist, kann sich in den kommenden Wochen
bis zur Preisverleihung der Klever Birne am 11.
September 2025 die Einzelvorstellungen der
diesjährigen Finalist*innen auf der Webseite von
TransRegINT – https://transform-hsrw.org/ – oder
auf den Social-Media-Kanälen von TransRegINT
anschauen und genauer informieren. Der Zugang
zur Preisverleihung ist kostenfrei, allerdings
wird um Anmeldung unter
https://transform-hsrw.org/pn_termin/klever-birne-preisverleihung/
gebeten.
Hintergrund
Der
Ideenwettbewerb „Klever Birne“ ist eine
Kooperation vom Projekt TransRegINT der
Hochschule Rhein-Waal mit der Stadt Kleve. Der
Nachhaltigkeitspreis wurde erstmals im Jahr 2023
vergeben. Ziel ist es unter anderem, die
Menschen in Kleve und Umgebung für Themen der
Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und
Innovationsthemen zu identifizieren. Mit dem
Projekt ‚TransRegINT - Transformation der Region
Niederrhein: Innovation, Nachhaltigkeit,
Teilhabe‘ hat sich die Hochschule Rhein-Waal zum
Ziel gesetzt, den nachhaltigen Wandel in der
Region wissenschaftsbasiert mitzugestalten.
Gefördert wird das Projekt durch das
Programm ‚Innovative Hochschule‘ des
Bundesministeriums für Forschung, Technologie
und Raumfahrt. Diese Förderinitiative
unterstützt Hochschulen dabei, aus
Forschungserkenntnissen kreative Lösungen für
die drängenden Herausforderungen unserer Zeit zu
finden.
Bis Ende 2027 wird ‚TransRegINT‘
mit Fördergeldern in Höhe von knapp zehn
Millionen Euro gefördert. Dies ermöglicht es,
Lösungen zu erarbeiten, um die Zukunft in der
Region im Sinne der 17 Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen zu gestalten.
Wesel: Vorverkauf für die neue Saison
2025/2026 im Städt. Bühnenhaus
Im September startet die neue Spielzeit des
Städtischen Bühnenhauses mit zahlreichen
Theater- und Konzertveranstaltungen. Der
Einzelkartenvorverkauf des Abonnementspielplanes
für das Schauspiel, Samstags- und
Sonntagsboulevard, Bühnenwelten und
Konzertreihe beginnt am kommenden Samstag, dem
23.08.2025.

Auch für das umfangreiche Angebot des
Kindertheaters gibt es ab diesem Tag Tickets.
Für die Sonderveranstaltungen startet der
Verkauf am Samstag, dem 30.08.2025. Für alle
Sparten können auch noch preisgünstige Abos
erworben werden.
Tickets sind an der
Theaterkasse im Centrum und im Online-Shop https://www.wesel.de/kultur-freizeit/staedtisches-buehnenhaus/online-tickets erhältlich.
Spieleabende für Erwachsene in der
Stadtbibliothek Dinslaken
Spielen verbindet und macht jede Menge Spaß! Wer
Lust hat, in geselliger Runde neue Brett- und
Kartenspiele zu entdecken, ist bei den
Spieleabenden in der Stadtbibliothek Dinslaken
genau richtig. Hier können sowohl
Neueinsteiger*innen als auch erfahrene
Spieler*innen spannende Titel ausprobieren,
gemeinsam lachen und vielleicht sogar den einen
oder anderen Sieg davontragen.
„Brettspiel Teddy“ alias Oliver Scholz stellt
die Spiele vor, erklärt die Regeln und gibt
hilfreiche Tipps. So bleibt mehr Zeit für das
Wesentliche: den gemeinsamen Spielspaß. Nach den
sommerlichen Spieleabenden im Museum
Voswinckelshof geht es ab September in der
Stadtbibliothek weiter.
Die Spieleabende
finden an folgenden Terminen immer mittwochs von
18:30 bis 21:30 Uhr statt: 3.9., 1.10., 5.11.
und 10.12. Die Teilnahme ist kostenlos, kleine
Snacks und Getränke stehen bereit.
Eine
Anmeldung ist ab sofort unter folgender
E-Mail-Adresse möglich: bibliothek@dinslaken.de
Ansprechpartnerin Silke Burkhardt
Stadtbibliothek Dinslaken Telefon: 02064 66275
Silke.burkhardt@dinslaken.de
ADAC:
Elektroautos überzeugen beim Fahren
Umfrage der ADAC
Autoversicherung: 81 Prozent gefällt das Fahren
mit E-Autos / Größere Fahrzeugauswahl und
bessere Akkus machen Stromer attraktiver / Treue
zur Automarke und Versicherung nicht gesichert
(ADAC Autoversicherung AG) Wer schon einmal
am Steuer eines Elektroautos saß, zeigt sich
davon fast immer angetan. Das ist das Ergebnis
einer repräsentativen bundesweiten Umfrage der
ADAC Autoversicherung. Demnach sagen 81 Prozent
der Autofahrer, die bereits ein Elektroauto
gefahren sind, dass es ihnen gut oder sehr gut
gefallen habe.
Größere Fahrzeugauswahl
macht Umstieg attraktiver
Aktuell sind
elektrisch angetriebene Fahrzeuge wieder im
Kommen. Im ersten Halbjahr 2025 waren laut
Kraftfahrt-Bundesamt 17,7 Prozent aller in
Deutschland neu zugelassenen Pkw Elektroautos.
Europaweit überschritten die E-Autos nach einer
Analyse der Unternehmensberatung PwC erstmals
die Millionenmarke bei den Neuzulassungen – ein
Plus von 25 Prozent gegenüber dem
Vorjahreszeitraum.
Die Umfrage der ADAC
Autoversicherung befasst sich auch mit den
Gründen für den Aufwärtstrend. Ausschlaggebend
ist nach Einschätzung der meisten Autofahrer (76
Prozent) vor allem die größer gewordene Auswahl
an Elektroautos. Zudem sehen die
Umfrageteilnehmer Verbesserungen bei den Akkus.
So führen 61 Prozent den Aufschwung bei den
Stromern auf die höheren Reichweiten und
kürzeren Ladezeiten durch die weiterentwickelten
Antriebsbatterien zurück.
Nur jeder
Dritte will der Automarke treu bleiben
Ob
Autofahrer bei einem Wechsel auf ein Elektroauto
bei ihrer derzeitigen Automarke und
Kfz-Versicherung bleiben würden, ist für viele
offen. Lediglich 31 Prozent derjenigen, die
aktuell kein Elektroauto fahren, geben an, dass
sie ihrer Automarke auch mit einem E-Auto treu
bleiben würden.
34 Prozent neigen
dagegen zum Wechsel der Marke. Etwa ein weiteres
Drittel (35 Prozent) zeigt sich unentschlossen
bzw. macht hierzu keine Angabe. Etwas größer ist
die Treue der Verbraucher bei der
Kfz-Versicherung. Immerhin 58 Prozent der
Befragten ohne Elektroauto würden auch mit einem
Stromer bei ihrem bisherigen Versicherer
bleiben.
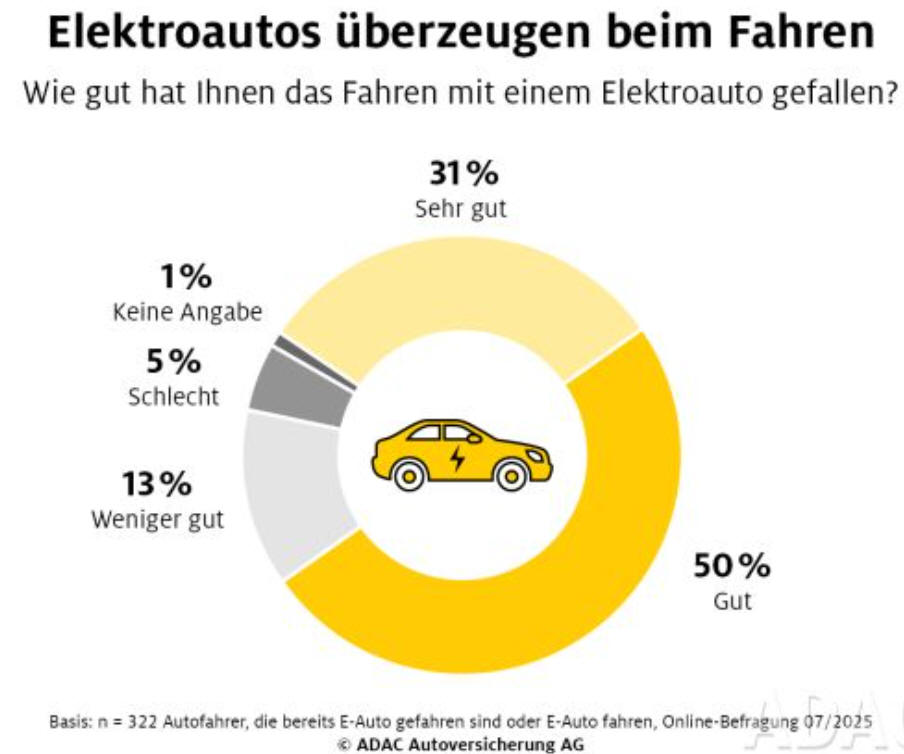
Versicherungsschutz soll Schutz des Akkus
beinhalten
Nicht verzichten möchte die große
Mehrheit in jedem Fall auf einen Schutz für die
Antriebsbatterie eines elektrischen Fahrzeugs.
Für 72 Prozent aller Befragten wäre ein
Versicherungsschutz für den Akku wichtig. Dieser
gilt als das Herzstück und das teuerste Bauteil
eines Elektroautos. Ein Austausch kann bis zu
20.000 Euro oder sogar mehr kosten. Die ADAC
Autoversicherung empfiehlt daher Käufern von
E-Autos, darauf zu achten, dass der
Versicherungsschutz eine sogenannte
Allgefahrendeckung für den Akku beinhaltet.
Probefahrt für Kaufentscheidung wichtig
Die Umfrage der ADAC Autoversicherung zeigt
auch, wie wichtig Probefahrten für den Kauf
eines Elektroautos sind. 86 Prozent der
Autofahrer würden ohne Probefahrt kein E-Auto
kaufen. Für 78 Prozent müsste die gewünschte
Testfahrt auch das Laden des Fahrzeugs
beinhalten. 70 Prozent würden sogar gerne
mehrere Probefahrten machen bevor sie sich zum
Kauf eines Elektroautos entscheiden.
Für
die Umfrage der ADAC Autoversicherung hat das
Institut Norstat im Juli 2025 insgesamt 1071
Autofahrer ab 18 Jahren online befragt, die beim
Abschluss einer Kfz-Versicherung (Mit-)
Entscheider sind.

Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 um 0,2 %
höher als im Vorjahr
•
Gewerbesteuereinnahmen steigen – wenn auch nur
geringfügig – im vierten Jahr in Folge auf einen
neuen Höchststand
• Mehr als die Hälfte der
Bundesländer verzeichnet gegenüber dem Vorjahr
rückläufige Einnahmen aus der Gewerbesteuer
• Grundsteuereinnahmen nehmen gegenüber dem
Vorjahr zu
Die Gemeinden in Deutschland
haben im Jahr 2024 rund 75,3 Milliarden Euro an
Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt. Dies
bedeutet ein leichtes Plus von rund 0,2
Milliarden Euro oder 0,2 % gegenüber dem
Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt. Damit wurde auch 2024 ein
neuer Rekord bei den Gewerbesteuereinnahmen
erreicht. Nach einem Rückgang im ersten
Corona-Jahr 2020 waren die
Gewerbesteuereinnahmen bereits in den Jahren
2021 bis 2023 auf neue Höchststände seit Beginn
der Zeitreihe im Jahr 1991 gestiegen.
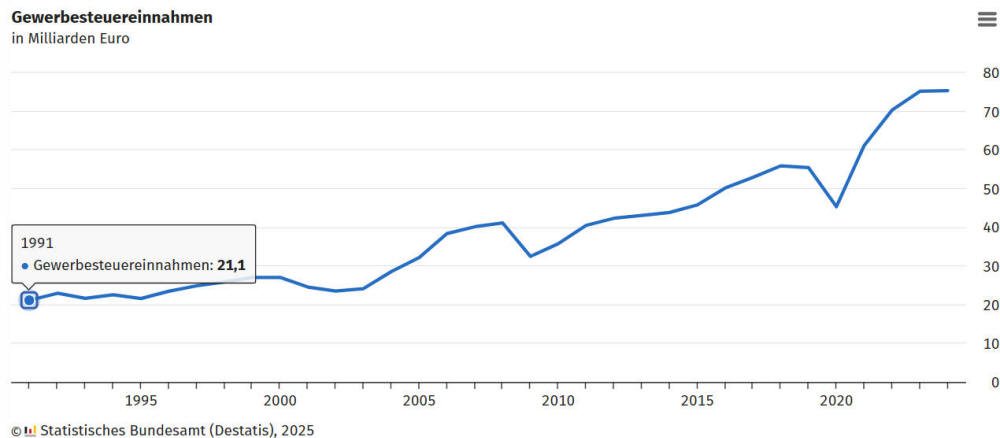
Unter den Flächenländern verzeichneten
Mecklenburg-Vorpommern mit +9,8 % und
Rheinland-Pfalz mit +9,0 % die höchsten Anstiege
bei den Gewerbesteuereinnahmen. Bei den
Stadtstaaten hatte nur Bremen einen Zuwachs in
Höhe von +13,5 %. Dennoch verzeichnete mehr als
die Hälfte der Bundesländer gegenüber dem
Vorjahr rückläufige Gewerbesteuereinnahmen.
Unter den Flächenländern war dies allen voran
Sachsen-Anhalt mit -9,9 %, gefolgt von Saarland
und Thüringen mit jeweils ‑5,0 %.
Bei
den Stadtstaaten verbuchten Hamburg mit -9,3 %
und Berlin mit -3,2 % Rückgänge. Einnahmen aus
der Grundsteuer B steigen um 3,8 % Die Einnahmen
der Gemeinden aus der Grundsteuer A, die auf das
Vermögen der land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe erhoben wird, betrugen im Jahr 2024
insgesamt 0,4 Milliarden Euro. Das war ein
Anstieg um 2,9 % zum Vorjahr.
Einnahmen aus der
Grundsteuer B steigen um 3,8 %
Die Einnahmen
der Gemeinden aus der Grundsteuer A, die auf das
Vermögen der land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe erhoben wird, betrugen im Jahr 2024
insgesamt 0,4 Milliarden Euro. Das war ein
Anstieg um 2,9 % zum Vorjahr. Aus der
Grundsteuer B, die auf Grundstücke außerhalb der
Land- und Forstwirtschaft erhoben wird, nahmen
die Gemeinden im Jahr 2024 insgesamt 15,6
Milliarden Euro ein, das war ein Plus von 3,8 %.
Seit 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer
auf Basis reformierter Regeln und neu
festgesetzter Hebesätze erhoben. Hintergrund ist
die sogenannte Länderöffnungsklausel bei der
Grundsteuer, die im Rahmen der Grundsteuerreform
eingeführt wurde und von der inzwischen einige
Bundesländer Gebrauch gemacht haben.
Insgesamt nur 0,8 % mehr Einnahmen aus Grund-
und Gewerbesteuer
Insgesamt erzielten die
Gemeinden in Deutschland im Jahr 2024 Einnahmen
aus den Realsteuern, das heißt aus Grund- und
Gewerbesteuer, von rund 91,4 Milliarden Euro.
Gegenüber 2023 war dies ein Anstieg um 0,8
Milliarden Euro beziehungsweise 0,8 %.
Durchschnittlicher Gewerbesteuerhebesatz leicht
gestiegen
Die von den Gemeinden
festgesetzten Hebesätze zur Gewerbesteuer sowie
zur Grundsteuer A und B entscheiden maßgeblich
über die Höhe ihrer Realsteuereinnahmen.
Im Jahr 2024 lag der durchschnittliche
Hebesatz aller Gemeinden in Deutschland für die
Gewerbesteuer bei 409 % und damit
2 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Bei der
Grundsteuer A stieg der durchschnittliche
Hebesatz im Jahr 2024 gegenüber 2023 um
7 Prozentpunkte auf 362 %. Der durchschnittliche
Hebesatz der Grundsteuer B
erhöhte sich im selben
Zeitraum um 13 Prozentpunkte auf 506 %.
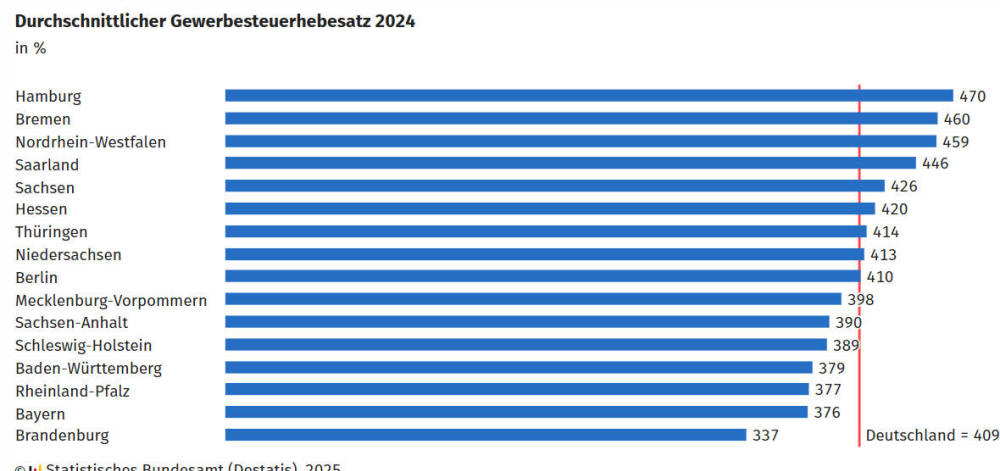
NRW: Pkw-Dichte steigt im Vergleich zum
Vorjahr um 0,6 % leicht an
*
Deutschlandweiter Anstieg von 0,3 % zum
01.01.2025.
* Pkw-Dichte in Deutschland
steigt stetig seit 2008.
* NRW: Kreis
Euskirchen mit höchster und Gelsenkirchen mit
niedrigster Pkw-Dichte.
Mit 590 Pkw je
1.000 Einwohnerinnen und Einwohner lag NRW zum
Stichtag 01.01.2025 gleichauf mit dem
bundesdeutschen Durchschnitt. Wie Information
und Technik Nordrhein-Westfalen als
Statistisches Landesamt anlässlich der
Aktualisierung des Regionalatlas Deutschland
mitteilt, stieg die Pkw-Dichte damit im
Vergleich zum Vorjahr von 586 Pkw je 1.000
Einwohnerinnen und Einwohnern um 0,6 Prozent
leicht an.
Der Kreis Euskirchen wies im
Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte in
NRW mit über 800 Pkw je 1.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern die höchste Pkw-Dichte auf und lag
damit auch deutschlandweit auf dem zweiten
Platz. Dies ist auf einige größere Unternehmen
in der Autovermietungsbranche zurückzuführen.
Die kreisfreie Stadt Gelsenkirchen hatte mit 476
Pkw je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die
niedrigste Pkw-Dichte in NRW.
Deutschlandweit ist die Pkw-Dichte zum
01.01.2025 angestiegen
Zum Stichtag
01.01.2025 stieg die Pkw-Dichte bundesweit auf
durchschnittlich 590 Pkw je 1.000 Einwohnerinnen
und Einwohner an, was einer Steigerung von
0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (588)
entspricht. Damit stieg die Pkw-Dichte in
Deutschland stetig seit 2008.
Pkw-Dichte
bei mehr als zwei Drittel der Bundesländer
angestiegen
Auf Ebene der Bundesländer waren
räumliche Unterschiede erkennbar: Während der
Süden Deutschlands durchschnittlich 628 Pkw je
1.000 Einwohnerinnen und Einwohner registrierte,
waren es im Osten durchschnittlich 511 Pkw. Im
Ost-West-Vergleich fällt auf, dass der Westen
mit durchschnittlich 598 Pkw je 1.000
Einwohnerinnen und Einwohner eine höhere
Pkw-Dichte aufwies als der Osten. Am niedrigsten
war die Pkw-Dichte in Berlin mit 334 Pkw je
1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern; das
Saarland wies mit 646 die höchste Pkw-Dichte
auf.
Während die Pkw-Dichte bei etwas mehr als
zwei Drittel der Bundesländer im Vergleich zum
Vorjahr anstieg, sank diese in Hamburg, Bremen,
Hessen und Berlin. Wolfsburg weiterhin mit
höchster Pkw-Dichte Wolfsburg hatte zum
01.01.2025, wie im Vorjahr, die höchste
Pkw-Dichte. Diese sank gegenüber dem 01.01.2024
von 965 auf 956 Pkw je 1.000 Einwohnerinnen und
Einwohner. Neben Berlin lag der niedrigste Wert
der Pkw-Dichte in der kreisfreien Stadt Leipzig
mit 384 Pkw je 1.000 Einwohnerinnen und
Einwohner.
|
Kreise und kreisfreie Städte |
Pkw-Bestand je 1.000 EW am 01.01. |
|
Anzahl |
|
Kleve, Kreis |
636 |
|
Rhein-Kreis Neuss |
616,6 |
|
Viersen, Kreis |
655,9 |
|
Wesel, Kreis |
651,7 |
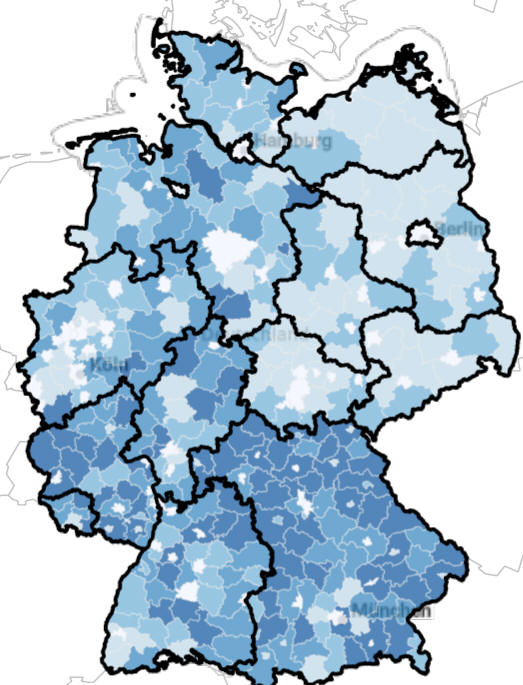 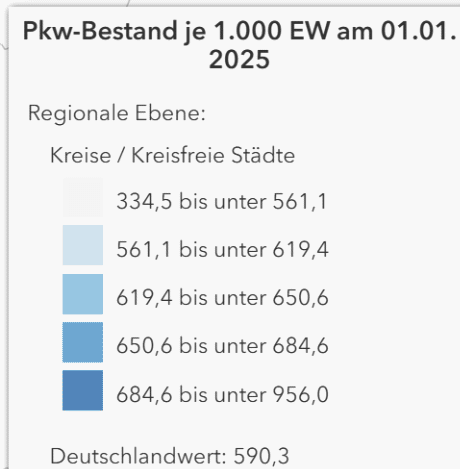
Bis zu 220 neue Arbeitsplätze: Moers setzt
starkes Zeichen in Genend
Die
Wirtschaftsförderung der Stadt Moers hat drei
städtische Grundstücke im Gewerbepark Genend für
insgesamt knapp eine Million Euro verkauft und
damit den Weg für bis zu 220 neue Arbeitsplätze
geebnet.
Auf rund 22.000 Quadratmetern
werden sich Drifte Wohnform (mit Verwaltung,
Lager, Logistik, Dienstleistungen), die
Ratiodata SE/Unternehmensgruppe Niedermaier
Invest mit ihrer Niederlassung aus Duisburg
(Services rund um die Digitalisierung) sowie ein
etablierter, regionaler Gesundheitsdienstleister
(mit Herstellung, Lagerung und Logistik von
Arzneimitteln) ansiedeln.
Moers hält
starke Unternehmen in der Stadt und gibt ihnen
Raum für Entwicklung. Das neue Unternehmen
bereichert das starke IT-Mittelstandsprofil der
Stadt. Mit den Grundstücksverkäufen hat die
Wirtschaftsförderung einen Impuls für Wachstum
und Beschäftigung gesetzt. Weitere stehen kurz
vor dem Abschluss.
Kreis Wesel saniert Radwege und
Fahrbahnschäden auf der Nordstraße/Auedamm (K7)
in Wesel
Der Kreis Wesel
beginnt am Montag, 1. September 2025, mit der
Sanierung der rund 1,6 Kilometer langen
beidseitigen Radwege entlang der Nordstraße
zwischen der Reeser Landstraße (B8) und der
Emmericher Straße (L7). Die Arbeiten sollen
voraussichtlich bis Freitag, 13. Oktober 2025,
abgeschlossen sein.
Während der Bauzeit
wird die Nordstraße für den Durchgangsverkehr
als Einbahnstraße ausgewiesen. Im ersten
Bauabschnitt (nördlicher Geh- und Radweg) bleibt
die Fahrtrichtung von der Reeser Landstraße (B8)
zur Emmericher Straße (L7) geöffnet.
Im
zweiten Bauabschnitt (südlicher Geh- und Radweg)
wird die Fahrtrichtung umgekehrt – dann ist die
Strecke von der L7 in Richtung B8 befahrbar. Für
den jeweils gesperrten Fahrtrichtungsverkehr
wird eine weiträumige Umleitung über das
umliegende Straßennetz eingerichtet. Der Rad-
und Fußgängerverkehr wird während der gesamten
Bauzeit wechselseitig aufrechterhalten. Auch
alle querenden und einmündenden Straßen bleiben
geöffnet.
Informationen zu
Ersatzhaltestellen des öffentlichen Busverkehrs
werden an den jeweils betroffenen Haltestellen
gesondert bekannt gegeben. Im Rahmen der
Gesamtmaßnahme werden zudem zwei Fahrbahnschäden
am Auedamm saniert. Dort kommt eine temporäre
Ampelanlage zum Einsatz, um den Verkehr im
Wechselbetrieb zu regeln.
Die Sanierung
der Radwege sowie die Beseitigung der
Fahrbahnschäden an der Kreisstraße 7 sind ein
weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung der
Verkehrsinfrastruktur im Kreis Wesel und dienen
der Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle
Teilnehmenden.
Mit der Durchführung der
Arbeiten wurde nach öffentlicher Ausschreibung
die Firma Eurovia aus Bottrop beauftragt. Der
Kreis Wesel dankt allen Verkehrsteilnehmenden
für ihr Verständnis und ihre Geduld während der
Bauphase.
Kleve: Mit Kostüm und Fantasie – Kinder
erleben Theater hautnah
Mi., 03.09.2025 -
16:30 - Fr., 30.01.2026 - 17:30 Uhr
Theater erleben mit allem, was dazugehört:
Kostüme anprobieren, in neue Rollen schlüpfen,
sich mit Bewegung und Stimme ausdrücken,
gemeinsam fantasievolle Geschichten erfinden –
und das alles mit ganz viel Spaß! In diesem Kurs
entdecken Kinder von 7 bis 9 Jahren spielerisch
die bunte Welt des Theaters.

Sie können ausprobieren, was in ihnen steckt,
sich kreativ entfalten und dabei im geschützten
Rahmen Selbstvertrauen und Teamgeist entwickeln.
Der Kurs startet am 03. September und läuft bis
Ende Januar 2026 immer mittwochs von 16.30 –
17.30 Uhr in der Ackerstraße 50-56 in Kleve.
Moerser Hitzeknigge 2025: Wo’s kühl bleibt
und Wasser fließt
Hohe Temperaturen an heißen
Sommertagen stellen besonders für ältere und
hitzeempfindliche Menschen eine große Belastung
dar. Um die Bevölkerung zu sensibilisieren und
konkrete Unterstützung zu geben, hat die Stadt
Moers ihren bewährten ‚Hitzeknigge‘ überarbeitet
und um neue Angebote ergänzt.
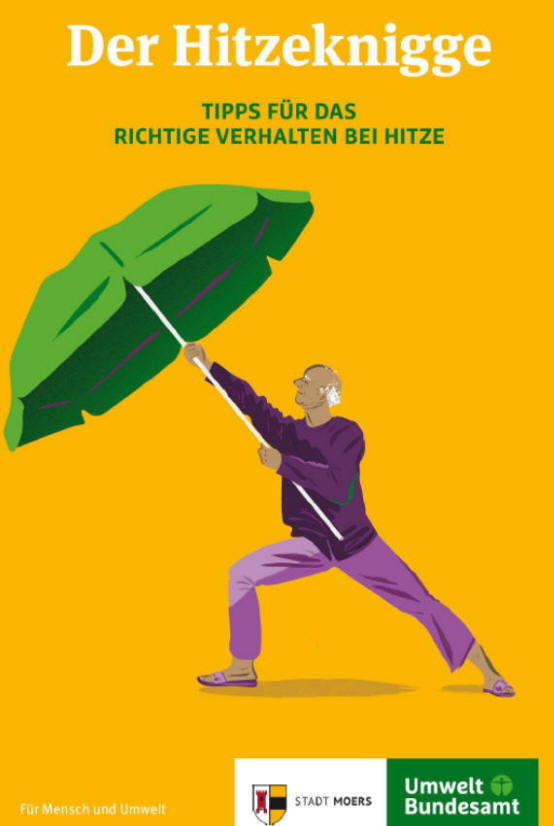
Die aktualisierte Broschüre – auf Grundlage von
Empfehlungen des Umweltbundesamtes, individuell
auf Moers zugeschnitten – enthält neben
allgemeinen Tipps zum Umgang mit Hitze - wie
luftige Kleidung, ausreichende
Flüssigkeitszufuhr, angepasste Ernährung und
wirksame Erste-Hilfe-Maßnahmen - auch ganz
praktische Hinweise für den Alltag in Moers. Neu
ist eine digitale Karte mit kühlen Orten in
Moers.
Sie zeigt sowohl öffentliche
Gebäude mit klimatisierten oder angenehm
temperierten Räumen als auch schattige Plätze im
Freien. Ebenfalls eingetragen sind die
Trinkbrunnen am Rathaus, am Skatepark im
Freizeitpark und am Kö. Hier kann kostenlos
frisches Wasser getankt werden.
Für
unterwegs gibt es die Informationen jetzt auch
mobil: In der App ‚Gut versorgt in Moers‘ steht
ab sofort eine ‚Hitzekachel‘ bereit. Darüber
kommt man zu schnellen Tipps, zur Karte der
kühlen Orte und zu weiteren Hinweise zum
Hitzeschutz. Darüber hinaus bietet sie weitere
Informationen zu Gesundheit, Pflege und
Freizeitangeboten in Moers.
Mit der
kostenlosen App sind ältere Menschen aus Moers
immer gut informiert und versorgt.
Alle Infos, der aktuelle Hitzeknigge und die
Karte, sind online abrufbar.
Moers: Briefwahlunterlagen online
beantragen
Die
Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahlen
und die Integrationsratswahl wurden ab Dienstag,
12. August, verschickt. Für die
Postleitzahlbezirke 47445 und 47447 sind die
Benachrichtigungen bereits am Samstag, 9.
August, auf den Weg an die Wahlberechtigten
gegangen.
Die Wählerinnen und Wähler
müssen jedoch nicht auf die Post warten: Die
Briefwahl - sowohl für die Kommunalwahlen als
auch für die Integrationsratswahl - kann ab
sofort bequem online beantragt werden
Weitere Informationen zur Briefwahl.
Kommunalwahl 2025 - Briefwahlunterlagen online
beantragen.
Integrationsratswahl 2025 - Briefwahlunterlagen
online beantragen.
Kommunalwahl: Social-Media-Reihe der Stadt
informiert leicht verständlich
Kleve: Notreparatur einer Gasleitung:
Straße Brücktor voll gesperrt
Im
Rahmen einer Notmaßnahme musste die Straße
Brücktor am Dienstag voll gesperrt werden. Bild:
mpix-foto - stock.adobe.com Für die dringende
Reparatur einer schadhaften Gasleitung muss die
Straße Brücktor in Kleve ab sofort voll gesperrt
werden.
Die Sperrung bezieht sich auf
den Bereich unmittelbar vor der Hausnummer
Brücktor 3, unweit der Einmündung zur
Grabenstraße. Aus Richtung Stadthalle bleibt die
Einmündung zur Grabenstraße befahrbar, sodass
der Straßenverkehr hierüber abfließen kann.
Für Verkehr in Richtung Stadthalle wird ab
dem Kreisverkehr Kalkarer Straße eine Umleitung
über die Kermisdahlstraße, Königsgarten und
Wasserstraße eingerichtet. Fußgängerinnen und
Fußgänger können die Baustelle auf der Straße
Brücktor passieren. Voraussichtlich dauern die
Arbeiten bis zur Mitte der kommenden Woche an.
Lebendige Stadtgeschichte: Stadtarchiv
Kleve erhält beeindruckende Postkartensammlung
Alexander Ahrens übergibt die umfangreiche
Sammlung an Archivleiterin Katrin Bürgel.
Durch eine beachtliche Schenkung ist das Klever
Stadtarchiv seit kurzem um zahlreiche Ansichten
und Motive unserer Stadt reicher. Die Sammlung
umfasst unzählige historische Postkarten und
Fotos mit Motiven aus der Stadtgeschichte.

Sie wurde von Rolf Ahrens angelegt, der im
letzten Jahr verstorben ist. Rolf Ahrens leitete
lange das Bestattungshaus Ahrens in Kleve. Er
begann 1987 den Aufbau seiner Sammlung mit
Postkarten der 1960er-Jahre. Danach erweiterte
er sie stetig durch Ankäufe in Antiquariaten,
auf Ansichtskartenbörsen und im Internet.
Außerdem erhielt er Fotoalben von seinen
Kundinnen und Kunden. Bereits vor 30 Jahren
präsentierte Rolf Ahrens seine Bilder in der
Ausstellung „Gruß aus Kleve“ in der Schwanenburg
sowie 2004 in der Ausstellung „Cleve - Fotos
erzählen Stadtgeschichte“ in der Klever
Stadtbücherei.
Die Sammlung besteht aus
27 Alben, die Bilder seit Ende des 19.
Jahrhunderts enthalten. Der Kurort „Bad Cleve“,
aber auch die Zerstörung der Stadt im Zweiten
Weltkrieg und Ansichten aus der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts gehören zu den Motiven.
Sogar einige historische Dokumente wie ein
Geldschein über 500 Millionen Mark für den Kreis
Cleve (1924) oder eine Lebensmittelkarte für den
Bezug von Kartoffeln (1948/49) finden sich
darin.

Postkarte Sammlung Rolf Ahrens
Um die
Postkarten- und Fotosammlung nach dem Tod seines
Vaters gesamtheitlich für die Stadt Kleve zu
erhalten, bot Alexander Ahrens sie dem
Stadtarchiv als Schenkung an. Archivleiterin
Katrin Bürgel nahm das Angebot gerne an: „Gerade
Fotos erzählen eine lebendige Geschichte und
sind für den Einsatz in archivpädagogischen
Projekten hervorragend geeignet. Diese wertvolle
Ergänzung zu den Beständen des Stadtarchivs
ermöglicht es, die Entwicklung der Stadt
anschaulich zu dokumentieren.“
Die
Sammlung Rolf Ahrens kann zu den Öffnungszeiten
im Stadtarchiv Kleve, Triftstraße 33, eingesehen
werden. Dienstags bis freitags öffnet das
Stadtarchiv von 09:00 bis 13:00 Uhr, dienstags
und donnerstags ist zusätzlich nachmittags von
14:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Kontakt zum
Stadtarchiv: Tel. 02821-84700 oder per E-Mail:
stadtarchiv@kleve.de
Klever
Schuh-Geschichte kennenlernen
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Kleve zu
einem Zentrum der Schuhproduktion. Bis zum
Zweiten Weltkrieg prägten über 50 Schuhfabriken
mit mehreren Tausend Beschäftigten die Stadt –
rund 6.000 „Schüsterkes“ fanden hier Arbeit.

Schuhfabrik Hoffmann circa 1950 - Bild Paul
Theissen
Diese bewegte
Industriegeschichte steht im Mittelpunkt einer
besonderen Stadtführung, die die Wirtschaft,
Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) am
Sonntag, den 31. August, anbietet. Der Rundgang
startet um 11 Uhr am Schusterdenkmal am EOC
(Hoffmannallee 41–51, vor dem Eingang zur
Apotheke) und führt für etwa zwei Stunden durch
die Klever Oberstadt.
Mit fundiertem
Fachwissen und lebendigen Geschichten vermittelt
der Schuhtechniker Norbert Leenders spannende
Einblicke in die traditionsreiche Schuhstadt
Kleve. Unterwegs geht es vorbei an historischen
Fabrikanlagen – wie der fast vollständig
erhaltenen Fabrik Pannier oder Teilen der
ehemaligen Schuhfabrik Hoffmann.
Zum
Abschluss erwartet die Teilnehmenden ein Besuch
im Schuhmuseum, das die Geschichte mit vielen
Exponaten lebendig werden lässt. „Die
Schuhindustrie hat Kleve einst stark geprägt und
viele Familien über Generationen hinweg
beschäftigt. Mit dieser Führung möchten wir ein
Stück Stadtgeschichte lebendig machen und
gleichzeitig zeigen, welche Spuren die Industrie
bis heute im Stadtbild hinterlassen hat“, sagt
Martina Gellert, Leitung Tourismus & Freizeit
bei der WTM.
Die Teilnahme kostet 9 Euro
pro Person. Buchungen sind online unter
www.kleve-tourismus.de oder telefonisch in der
Tourist Information unter 02821 84-806 möglich.
Neuauflage Faltkarte zum
Rad-Knotenpunktsystem im Kreis Wesel: Radeln
nach Zahlen
Die
EntwicklungsAgentur Wirtschaft des Kreises Wesel
hat eine Neuauflage der beliebten und handlichen
Übersichtskarte zum Knotenpunktsystem erstellt.
Die Karte zeigt alle 170 Knotenpunkte des
touristischen Radnetzes im Kreisgebiet.
Landrat Ingo Brohl: „Das Radeln nach Zahlen
macht die Planung der eigenen Touren denkbar
einfach. Anhand der Knotenpunkte entlang des
Weges lässt man sich leiten und kann so ganz
entspannt seinen Weg durch den schönen
Niederrhein Kreis Wesel finden. In der
Neuauflage der Karte sind nun weitere
Knotenpunkte vermerkt, sodass eine Vielzahl
neuer Strecken durch das praktische
Orientierungssystem abgedeckt ist.“
Das
im Jahr 2024 rechtsrheinisch fertig installierte
Knotenpunktsystem für die touristischen
Radrouten ermöglicht auf den über 800 Kilometern
Radwegen im Kreis ein sehr flexibles und
einfaches Planen und Abfahren der Routen. Mit
der Aktualisierung des Knotenpunksystems ist der
Kreis Wesel auf dem aktuellsten Stand der
Beschilderung und macht das Radfahren noch
attraktiver.
Anlässlich des Jubiläums
zum 50-jährigen Bestehen des Kreises Wesel laden
die „50 Jahre – 50 km“ Touren dazu ein, den
Kreis Wesel auf ausgewählten Rundkursen von
jeweils rund 50 Kilometern zu entdecken. Diese
speziell ausgearbeiteten Touren verbinden
Sehenswürdigkeiten, Natur und Kultur und bieten
ein besonderes Erlebnis für alle
Radbegeisterten. Eine Übersicht der Touren gibt
es unter
www.kreis-wesel.de/politik-verwaltung/die-kreisverwaltung/50-jahre-kreis-wesel.
Die neue Faltkarte ist kostenlos
erhältlich und kann im Internetshop des Kreises
Wesel bestellt, oder bei den kreisangehörigen
Kommunen und Tourist-Informationen direkt
abgeholt werden.
Weitere Informationen zu
den Themen Tourismus und Radfahren gibt es unter
www.kreis-wesel.de/tourismus

NRW: Zahl der Verurteilungen 2024 um 3 %
niedriger als ein Jahr zuvor
* Gegenüber 2014 gab es 19,1 % weniger
Verurteilungen.
* 80 % der Verurteilten
waren männlich.
* Frauen wurden am
häufigsten wegen anderer Vermögens- und
Eigentumsdelikte verurteilt – Männer wegen
Straftaten im Straßenverkehr.
Die Zahl
der Verurteilungen in Nordrhein-Westfalen ist
zurückgegangen. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
mitteilt, sprachen die NRW-Gerichte im Jahr 2024
insgesamt 130.470 Verurteilungen aus, das waren
3,0 % weniger als 2023. Gegenüber dem Jahr 2014
ist diese Anzahl um 19,1 % gesunken. Damals
waren 161.334 Personen verurteilt worden.
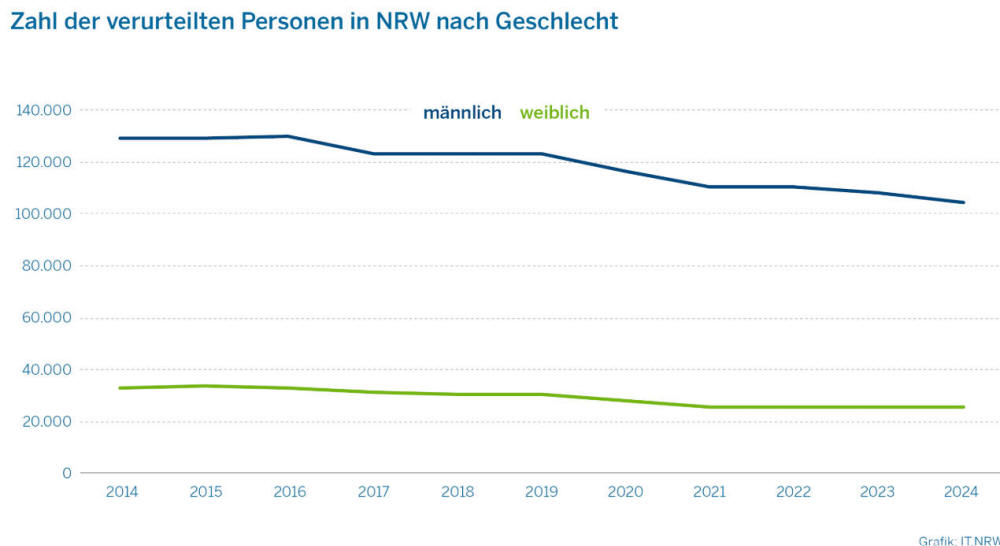
Der Anteil der Verurteilungen an allen zur
gerichtlichen Hauptverhandlung zugelassenen
Verfahren („Verurteilungsquote“) lag in den
vergangen zehn Jahren relativ konstant zwischen
76 und 79 %. Zahl der Verurteilungen bei Frauen
und Männern rückläufig – 80 % der Verurteilten
waren männlich Rund 80 % der Verurteilten im
Jahr 2024 waren männlich und rund 20 % weiblich.
Bei beiden Geschlechtern gab es seit
2014 Rückgänge der Verurteilungen, wodurch das
Geschlechterverhältnis im Zeitvergleich relativ
konstant geblieben ist. Frauen wurden am
häufigsten wegen anderer Vermögens- und
Eigentumsdelikte verurteilt – Männer wegen
Straftaten im Straßenverkehr. Die
Hauptdeliktsgruppen, die absolut betrachtet am
häufigsten zur Verurteilung führten,
unterschieden sich zwischen den Geschlechtern.
In 2024 wurde von den 25.664
verurteilten Frauen fast jede dritte wegen
anderer Vermögens- und Eigentumsdelikte, wie
z. B. Betrug, Erschleichen von Leistungen,
Urkundenfälschung und Sachbeschädigung, schuldig
gesprochen. Etwa ein Viertel der Frauen wurde
wegen Diebstahls und Unterschlagung und rund ein
Fünftel wegen Straftaten im Straßenverkehr
verurteilt.
Bei den 104.805 verurteilten
Männern kamen Straftaten im Straßenverkehr im
Jahr 2024 am häufigsten vor; ein Viertel aller
Verurteilungen von Männern entfiel auf diese
Hauptdeliktsgruppe. Bei jeder fünften
Verurteilung waren andere Vermögens- und
Eigentumsdelikte ursächlich. Jeweils eine von
sieben Verurteilungen von Männern ging auf die
Hauptdeliktsgruppen andere Straftaten gegen die
Person (z. B. Körperverletzung, Bedrohung,
Beleidigung) und Diebstahl und Unterschlagung
zurück.
Dashboard „Strafverfolgung NRW
interaktiv“ liefert Ergebnisse für die Jahre
2014 bis 2024 Im Dashboard Strafverfolgung NRW
interaktiv unter
https://www.giscloud.nrw.de/arcgis/apps/experiencebuilder/experience/?id=d292827a59a0498baeca86b5fa2952da
stehen weitere Merkmale der
Strafverfolgungsstatistik für die Berichtsjahre
2014 bis 2024 zur Verfügung.
NRW-Industrie: Spirituosenproduktion stieg
2024 um fast 4 %
* Spirituosenproduktion in Gläsern reicht
3,5-mal um den Äquator.
* Durchschnittlicher
Absatzwert in 10 Jahren um fast 25 % gestiegen.
* Ein Fünftel der Spirituosenproduktion in
Deutschland kam aus NRW-Betrieben.
Im
Jahr 2024 sind in neun der 9.746 produzierenden
Betriebe des nordrhein-westfälischen
Verarbeitenden Gewerbes insgesamt 79,1 Millionen
Liter Spirituosen hergestellt worden. Mit dieser
Menge hätten 4,0 Milliarden 2 cl Schnapsgläser
gefüllt werden können. Aneinandergereiht hätten
die sog. Pinnchen ausgereicht, um die Erde am
Äquator 3,5-mal zu umrunden.
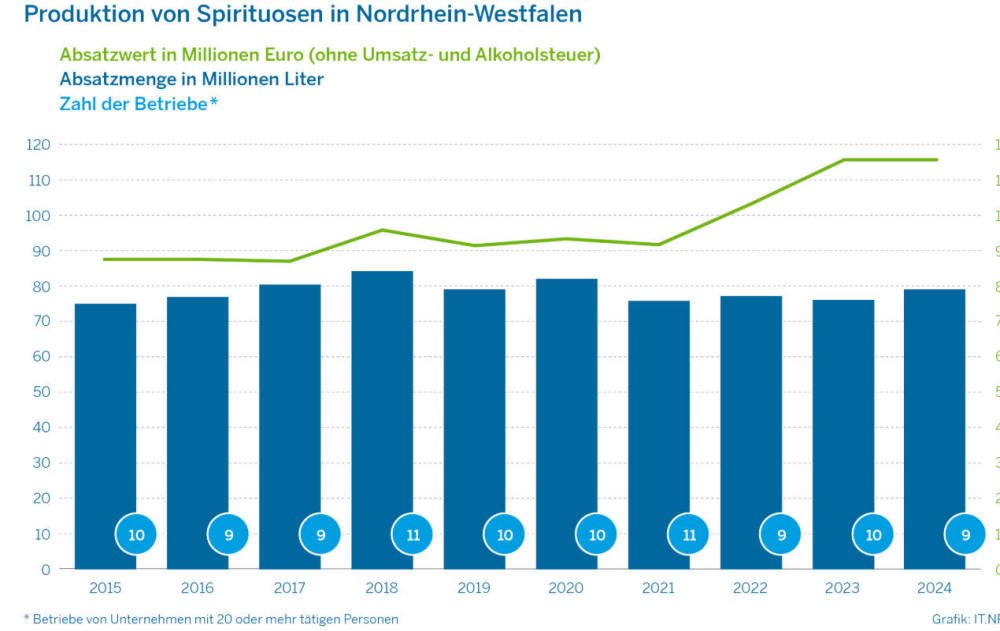
Im Vergleich zu 2023 ergibt sich bei der
Absatzmenge ein Anstieg von 2,9 Millionen Litern
bzw. 3,8 %. Wie das Statistische Landesamt
mitteilt, lag der Absatzwert von industriell
hergestelltem Wodka, Likör, Korn u. Ä. im Jahr
2024 bei nominal 115,5 Millionen Euro. Er war
damit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert
(–33.000 Euro). Gegenüber dem Jahr 2015 stieg
die Absatzmenge um 4,1 Millionen Liter bzw.
5,5 % und der Absatzwert erhöhte sich nominal um
27,6 Millionen Euro bzw. 31,4 %.
Durchschnittlicher Absatzwert seit 2015 um fast
25 % gestiegen
Der durchschnittliche
Absatzwert je Liter Spirituosen betrug im
letzten Jahr 1,46 Euro und war damit um 3,7 %
niedriger als 2023 mit damals 1,52 Euro je
Liter. Gegenüber 2015 stieg der
durchschnittliche Absatzwert um 24,6 %
(damals:1,17 Euro je Liter). Beinahe 20 % der
gesamtdeutschen Produktion entfiel auf NRW
Bundesweit sank die Absatzproduktion von
Spirituosen im letzten Jahr um 1,6 % auf 400,5
Millionen Liter, während der nominale Absatzwert
um 4,6 % auf 1,3 Milliarden Euro stieg.
19,8 % der gesamtdeutschen Absatzproduktion
(2023: 18,7 %) und 9,1 % des gesamtdeutschen
Absatzwertes (2023: 9,5 %) entfielen auf
nordrhein-westfälische Betriebe. Im ersten
Quartal 2025 stieg die Spirituosenproduktion Im
ersten Quartal 2025 sind in NRW nach vorläufigen
Ergebnissen in neun Betrieben 21,6 Millionen
Liter Spirituosen (+24,0 % gegenüber dem
entsprechenden Vorjahreszeitraum) hergestellt
worden. Der nominale Absatzwert stieg um 17,6 %
auf 30,7 Millionen Euro.
Trockenheit in der Landwirtschaft: Anbaufläche
von Sojabohnen von 2016 bis 2024 um 156,8 %
gestiegen - Trockenresistentere Kultur boomt
Trockenheit und Dürre werden in der
Landwirtschaft zunehmend zum Problem. Eine
Lösung dafür ist der Wechsel hin zu
trockenresistenteren Ackerkulturen wie etwa
Soja. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, sind die Anbauflächen für Sojabohnen
vom Jahr 2016, für das erstmals Zahlen zu
Sojabohnen erhoben wurden, bis zum Jahr 2024 um
156,8 % gestiegen.
Im vergangenen Jahr
haben knapp 4 500 landwirtschaftliche Betriebe
auf insgesamt 40 500 Hektar Sojabohnen angebaut.
2016 waren es rund 2 400 Betriebe und knapp 15
800 Hektar. Soja wird nicht nur als Futtermittel
in der Nutztierhaltung eingesetzt, sondern in
geringerem Umfang auch zur Herstellung von
Nahrungsmitteln verwendet.
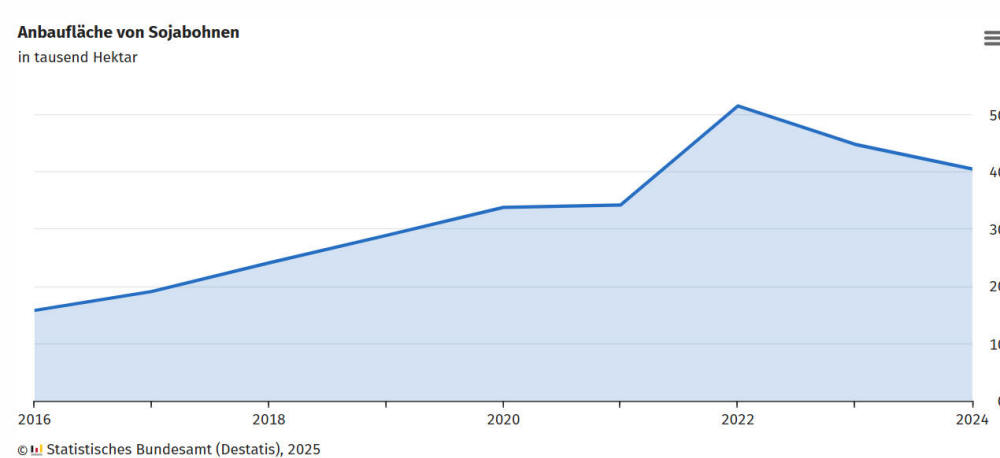
Potenziell bewässerbare Freilandfläche in
der Landwirtschaft nimmt zu
Eine weitere
Möglichkeit, der Trockenheit in der
Landwirtschaft zu begegnen, ist die Bewässerung
von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die
potenziell bewässerbare Freilandfläche nahm von
2009 bis 2022 um knapp ein Viertel (23,9 %) zu.
Das ist die Fläche, die mit Bewässerungsanlagen
ausgestattet beziehungsweise erreichbar ist.
Mit 791 800 Hektar waren 2022 rund 4,8 % der
landwirtschaftlich genutzten Freilandfläche in
Deutschland bewässerbar. Seit 2009 setzen mehr
Betriebe auf effiziente Tröpfchenbewässerung
Dass immer längere Trockenphasen in der
Landwirtschaft einen nachhaltigeren Umgang mit
der Ressource Wasser erfordern, spiegelt sich
auch im zunehmenden Einsatz von
bewässerungseffizienten Techniken wie der
Tröpfchenbewässerung wider.
Im
Unterschied zu Beregnungsanlagen wird das Wasser
dabei nicht von oben auf den Pflanzen und dem
Boden verteilt, sondern am Boden direkt zu den
Pflanzenwurzeln geführt. 2022 setzten rund
5 700 landwirtschaftliche Betriebe
Tröpfchenbewässerung ein. Das waren gut drei
Viertel (78,1 %) mehr als noch 2009. Dagegen
ging die Zahl der Betriebe, die ihre Flächen mit
Beregnungsanlagen bewässerten, im selben
Zeitraum leicht zurück auf zuletzt knapp 11 900
(-1,9 %).
DIN-Tage: Dinslaken feiert vom 29. bis 31.
August wieder großes Stadtfest
Vom 29. bis 31. August 2025 finden endlich
wieder die nächsten DIN-Tage statt. Tausende
Besucher*innen aus nah und fern erleben dann ein
vielfältiges Programm in der Innenstadt.
Zwischen Altmarkt, Neutorplatz, Stadtpark,
Burginnenhof und Burgtheater gibt es Musik,
Tanz, Mitmachaktionen und vieles mehr.

Offizielle Eröffnung durch Bürgermeisterin
Eislöffel
Am Freitag, 29. August, eröffnet
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel die DIN-Tage
um 18 Uhr auf dem Altmarkt. „Die DIN-Tage sind
ein Ort der Begegnung, der guten Gespräche und
lassen uns gemeinsam feiern. Danke allen
Vereinen, Initiativen, Künstlerinnen und
Künstlern, Sponsoren und Sponsoren, die dazu
beitragen, die Veranstaltung auch trotz knapper
finanzieller Ressourcen zu einem besonderen
Erlebnis werden zu lassen.
Unsere
DIN-Tage sind über unsere Stadt hinaus bekannt.
Die Dinslakenerinnen und Dinslakener, so wie
alle Besucherinnen und Besucher verleihen
unserem Stadtfest einen besonderen Charme. Ich
lade alle herzlich ein, gemeinsam dafür zu
sorgen, dass unser Stadtfest ein großes
Miteinander wird.“
•
Drei Tage Livemusik auf vielen Bühnen – von Rock
bis Shanty, von Jazz bis Mittelalterfolk
Das musikalische Programm der DIN-Tage 2025
beginnt am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Altmarkt
mit „Jonnys Leidenschaft“, gefolgt um 20 Uhr von
der energiegeladenen „The Legendary Ghetto
Band“. Parallel dazu gibt es auf der Bühne am
Neutor ab 18 Uhr handgemachte Live-Musik von
„Kärnseife“.
Ab 20 Uhr sorgt die
„Classic Night Band“ mit Jazz, Swing und Oldies
für nostalgische Stimmung. Auf der Jugendwiese
im Stadtpark gibt es von 17 bis 23 Uhr eine
große Open-Air-Party mit elektronischer Musik,
der passenden Licht- und Lasershow und vielen
weiteren Angeboten.
•
Am Samstag, 30. August, startet das
Musikprogramm bereits am Mittag: Auf dem
Altmarkt treten ab 13 Uhr die „Kleinen Strolche“
auf, bevor um 14 Uhr die niederländische
„Joekskapel Göt Net“ für internationales Flair
sorgt und im Anschluss dann das Team von Frisör
Schürmann eine Stylingshow zeigt.
Um
17.30 Uhr übernimmt die
Udo-Lindenberg-Tribute-Band „UDOpie“, und ab 20
Uhr bringt „Freakshow“ Rock-Cover-Hits auf die
Bühne. Währenddessen läuft am Neutor ab 13 Uhr
„Dinslaken Moves“ mit Showeinlagen des TSV
Kastell, der Tanzschulen Uta Keup und Rautenberg
sowie der Tanzgarde „We sind wer dor“. Ab 16.30
Uhr übernimmt Schlagersänger Nico Gemba, gefolgt
von „Lecker Nudelsalat“ (17 Uhr) und den
„Schlagerschlampen“, die Rock und Schlager neu
interpretieren.
Im Burginnenhof sind am
Samstag unter anderem die Rock-Schule
Hamminkeln, Singer-Songwriter Danny Lattendorf,
die Formation „Blechspielzeug“ und die
Blaskapelle Göt Net zu erleben. Wer es härter
mag, sollte ab 17.30 Uhr ins Burgtheater zum
SYLS-Festival kommen: Mit Rage, Tri State
Corner, Thy Great Empire, Terrrorstahl und Toxic
Order erwartet das Publikum ein energiegeladenes
Rock- und Metal-Line-up bis in den späten Abend.
•
Der Sonntag, 31. August, gehört tagsüber vor
allem dem maritimen Klang: Auf dem Altmarkt
richtet der Shanty Chor Hiesfeld ab 11 Uhr ein
ganzes Festival mit internationalen Gästechören
aus, unter anderem aus Polen, den Niederlanden,
England und Münster, bevor um 17.15 Uhr die
Dinslakener Band „Soda Maker“ ihr Comeback
feiert.
•
Am Neutor sorgt die Kinderdisco der Tanzschule
Rautenberg von 13.30 bis 14.30 Uhr für
ausgelassene Stimmung bei den jüngsten
Besucher*innen. Ab 16 Uhr heißt es dann
Heimspiel für „Galahad“, die mit
Mittelalterfolk, Barock- und Rockeinflüssen das
Publikum begeistern. Im Burginnenhof
präsentieren am Sonntag ab 12 Uhr unter anderem
„Goldrichtig She Talks“, „Solo für zwei“, das
Duo „Anna und Cesare“ sowie der „Frauenchor
Liederkranz Barmingholten“ abwechslungsreiche
Livemusik bis zum späten Nachmittag.
•
Vielfältige Programmorte und neue Attraktionen:
Jugend-DIN-Tage, Burg-Café, Stadtpark-Party und
vieles mehr
Natürlich gibt es aber nicht nur
das große Bühnenprogramm während der DIN-Tage.
Am Neutor gibt es für Groß und Klein einen
bunten Rummel mit Karussell und süßen
Leckereien. Im Stadtpark stehen die
Jugend-DIN-Tage im Mittelpunkt: Hier finden
Kinder und Jugendliche ein eigenes Angebot mit
einem bunten Mitmach- und Abenteuerprogramm,
kreativen Aktionen und sportlichen
Herausforderungen. Die Erlöse kommen Projekten
für junge Menschen in Dinslaken zugute.
•
Spiel und Spaß im Stadtpark gibt es am Samstag
von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17
Uhr.
Am Freitag, den 29. August wird der
Stadtpark wird ab 17 Uhr zum Dancefloor - von
der Jugend für die Jugend. Der Eintritt ist
kostenlos, Getränke und Snacks dürfen
mitgebracht werden (ausgenommen: Glasflaschen).
Kostenloses Wasser wird zur Verfügung gestellt.
5 Artists sorgen auf der großen Bühne für eine
bunte Mischung aus House, Electro, Techno und
Bass – rundherum gibt es viele Stände von
Dinslakener Organisationen und der Aufsuchenden
Jugendarbeit (AJA).
•
Historischer Burginnenhof bietet Kulinarisches
Der historische Burginnenhof lädt zum Burg-Café
ein, wo Besucher*innen bei kulinarischen und
fairen Angeboten, Kulturprogramm und Infoständen
entspannen können. Wie jedes Jahr wird der
Burginnenhof zum Ort der Begegnung, der Vielfalt
und des Engagements. Die gesamten Café-Erlöse
kommen traditionell sozialen Zwecken in
Dinslaken zugute.
Unter dem Motto
„Bücher spenden, Schätze teilen“ findet dieses
Jahr wieder der jährliche Kiloverkauf auf 2
Etagen in der Kathrin-Türks-Halle statt. Seit
über 20 Jahren wird der Kiloverkauf von unserem
Kulturförderverein „Freundeskreis
Stadtbibliothek und Stadtarchiv Dinslaken e.V.“
ausgerichtet und ist bekannt bei Bücherfreunden
und Schnäppchenjägern weit über Dinslaken
hinaus. Am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am
Sonntag von 9 bis 16 Uhr finden Tausende Bücher
kiloweise neue Besitzer*innen.
•
Ökumenischer Gottesdienst, verkaufsoffener
Sonntag und weitere Highlights
Das Stadtfest
wird von einem verkaufsoffenen Sonntag,
Mitmach-Aktionen der Vereine und Initiativen
sowie einem breiten gastronomischen Angebot
begleitet.
Am Freitagabend findet um 19 Uhr
in der Stadtkirche der traditionelle ökumenische
Gottesdienst statt: offene Türen, gemeinsames
Innehalten und Willkommensgesten für alle
Generationen.
•
Am Ententeich öffnet die Kutscherstube für
verschiedene Veranstaltungen ihre Türen.
Die
Stadtinformation am Rittertor erweitert an den
DIN-Tagen ihre Öffnungszeiten: Am Samstag ist
sie von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 13 bis
18 Uhr geöffnet.
Einen Link zum aktuellen
Programmheft der DIN-EVENT GmbH gibt es auf der
städtischen Homepage www.dinslaken.de. Das
Programmheft selbst liegt an vielen Stellen und
Geschäften aus, unter anderem ist es auch in der
Stadtinformation am Rittertor, in der
Kathrin-Türks-Halle und in zahlreichen
Geschäften erhältlich.
Die Stadt dankt
allen Beteiligten und Unterstützer*innen für ihr
Engagement und wünscht allen Besucher*innen
wunderschöne DIN-Tage 2025.
•
Anreise und Parkmöglichkeiten
Die DIN-Tage
finden zentral in der Dinslakener Innenstadt
statt, vor allem rund um den Altmarkt,
Neutorplatz, Stadtpark, Burginnenhof und
Burgtheater. Besucher*innen werden gebeten,
möglichst umweltfreundlich anzureisen.
Mit dem Auto erreichen Sie Dinslaken über die
Autobahnen A59 (Ausfahrt Dinslaken Wesel) oder
A3 (Ausfahrt Dinslaken Süd). Parkmöglichkeiten
gibt es in verschiedenen Parkhäusern und
Parkbereichen in der Innenstadt, unter anderem
in der Tiefgarage am Rathaus. Bitte beachten
Sie, dass einige Straßen in der Innenstadt
während der DIN-Tage gesperrt sein können und
das Parken in der Althoffstraße wegen Sperrungen
vermieden werden sollte. Die Zufahrt wird
eingeschränkt und nur für die Hotelgäste sowie
Anwohner möglich sein. Gleiches gilt für die
Parkstraße, die bis 07.09.2025 gesperrt ist.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist
Dinslaken erreichbar: Der Bahnhof Dinslaken
liegt nur etwa 10 Gehminuten vom Geschehen
entfernt und wird von Regionalzügen angefahren.
Die komplette Sperrung der Bahnstrecke durch die
Deutsche Bahn ist Ende August wieder aufgehoben.
Außerdem fährt die Straßenbahnlinie 903 zwischen
Duisburg und der Dinslakener Innenstadt.
Mit dem Rad ist Dinslaken auch über verschiedene
Themen- und Freizeitrouten zu erreichen, die in
Teilen über eine eigenständige Radwegweisung
verfügen.
Fahrräder können zum Beispiel an
den Fahrradstellflächen am Bahnhofsvorplatz, am
Parkplatz am Neutor, an der KTH, in den
Bereichen Neutor Galerie / Saarstraße,
Rutenwallweg sowie im Bereich des Burgtheaters
abgestellt werden.
Im Rahmen der DIN-Tage
wird es zu folgenden Verkehrseinschränkungen
kommen:
Die Althoffstraße, Parkstraße sowie
die Straße am Altmarkt werden für den
Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Bahnstraße
und Duisburger Straße nur teilweise voll
gesperrt.
Ein Parken in diesen Straßen ist
während der Veranstaltung somit nicht möglich.
Die Stadt empfiehlt, auf umliegende
Parkflächen oder Parkhäuser auszuweichen.
Besucher*innen können ohne Einschränkungen die
Parkgarage unter dem Rathaus, das Parkhaus der
Neutor Galerie sowie die Parkfläche am
Sportverein SuS 09 Dinslaken ansteuern. An allen
genannten Standorten sind zahlreiche Parkflächen
verfügbar.
Auch für den Radverkehr sind
die genannten Straßen während der Veranstaltung
grundsätzlich nicht befahrbar. Zudem sollten die
Fahrräder, auch aufgrund des hohen
Besucheraufkommens durch die Fußgängerzonen
geschoben, nicht gefahren, werden.
Die
Stadt empfiehlt, je nach Wetter und
individueller Planung die Anreise frühzeitig zu
planen, um entspannt und sicher die DIN-Tage zu
genießen.
Dinslaken: Museum Voswinckelshof drei Wochen
dienstags geschlossen
In dieser
und in den kommenden beiden Wochen bleibt das
Museum Voswinckelshof jeweils am Dienstag aus
Personalgründen zusätzlich geschlossen. Nicht
betroffen sind Schulklassen, Kindergeburtstage
und angemeldete Gruppen sowie die
Niederrheinische Kaffeetafel.
Faire Wochen machen Vielfalt erlebbar, auch
in Wesel
In diesem Jahr finden
vom 12. bis zum 26. September bundesweit die
größten Aktionswochen des Fairen Handels statt.
Rund 2.000 Veranstaltungen in Deutschland laden
zum Mitmachen ein. Unter dem Motto „Fair handeln
– Vielfalt erleben!“ machen sie deutlich, wie
wichtig Vielfalt ist. Auch Wesel macht mit: in
diesem Jahr haben sich der Weltladen esperanza,
die Stadtbücherei Wesel sowie das städtische
Klimaschutzmangement zusammengeschlossen.
Gleich an drei Spielorten soll das Motto
„Vielfalt“ erlebbar gemacht werden. In der
Stadtbücherei findet vom 06. - 27. September
2025 eine Medienausstellung zum Fairen Handel
statt. Karin Mindthoff von der Eine-Welt-Gruppe
Wesel wird das Medienangebot der Stadtbücherei
zusätzlich mit Produkten aus dem Weltladen und
weiterer Literatur bereichern.
Wer gerne
neue Produkte ausprobieren und die bunte Welt
des fairen Handels kennenlernen möchte, ist
eingeladen, während des zweiwöchigen
Aktionszeitraums den Weltladen am Leyens-Platz
zu besuchen. Am Freitag, 26. September 2025, 16
Uhr, lädt das Klimaschutzmanagement der Stadt
Wesel gemeinsam mit WeselMarketing und der
Stadtführerin Anne Klein zu einem nachhaltigen
Stadtspaziergang ein.
Der Treffpunkt für
die Führung ist vor dem Eine-Welt-Laden am
Leyens-Platz/Goldstraße. Auch der
Stadtspaziergang steht ganz im Zeichen der
Vielfalt: „Städte sind per se vielfältig – sie
sind historisch gesehen Orte des Handels, sie
sind Lebensraum für Menschen, Tiere und
Pflanzen, aber auch Orte der Begegnung“, so in
der Ankündigung zur Veranstaltung.
Im
Rahmen dieser Stadtführung werden verschiedene
Orte in der Innenstadt besichtigt, die auf
besondere Weise für Vielfalt und Nachhaltigkeit
stehen, u.a. der Weltladen und die Bibliothek
der Dinge. Mit dabei ist auch die
Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW. Sie
wird gemeinsam mit dem Team Klimaschutz der
Stadt Wesel über städtebauliche Planung in
Zeiten des Klimawandels sprechen.
Dabei
steht im Mittelpunkt, wie Städte klimaresilient
umgebaut werden können, die Energieversorgung
der Zukunft aussieht und wie das Stadtklima
nachhaltig verbessert werden kann. Die
Teilnahme an der Stadtführung ist kostenlos. Um
eine vorherige Anmeldung wird jedoch gebeten
über die Stadtinformation Wesel am Großen Markt;
Tel.: 0281 / 203 26 22 oder per Mail an
stadtinformation@weselmarketing.de.

NRW: Neue
Kartenanwendung zeigt räumliche Mobilität von
Azubis
* Zwei Drittel der
dualen Auszubildenden machten ihre Ausbildung an
ihrem Wohnort – ein Drittel in einem anderen
Kreis oder einer anderen kreisfreien Stadt in
NRW.
* Beispiel Düsseldorf: Etwa 45 % der
Azubis mit Ausbildungsstätte in Düsseldorf
wohnten bei Vertragsabschluss auch dort.
*
Unterschiedliches Mobilitätsverhalten in den
Ausbildungsbereichen feststellbar.
Im
Jahr 2024 haben rund 272.000 Personen eine
Ausbildung im dualen System in einer
Ausbildungsstätte in Nordrhein-Westfalen
gemacht. Rund 68 % absolvierten ihre Ausbildung
in der kreisfreien Stadt oder in dem Kreis, wo
sie schon bei Vertragsabschluss wohnten. Die
übrigen kamen aus anderen kreisfreien Städten
und Kreisen an ihren Ausbildungsort.
Wie
anziehend sind die Städte und Gemeinden in NRW
als Ausbildungsorte? Und wohin bewegen sich die
Azubis aus räumlicher Perspektive bei der Wahl
ihrer Ausbildungsstätte? Antworten auf diese
Fragen liefert die neue interaktive Anwendung
Mobilität von Auszubildenden in NRW unter
https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/mobilitaet-auszubildender,
die der Landesbetrieb Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt
veröffentlicht. Datenbasis ist die
Berufsbildungsstatistik zum 31.12.2024.
Die Anwendung gibt Einblicke in die Mobilität
von Auszubildenden auf Ebene der kreisfreien
Städte und Kreise sowie der Gemeinden in NRW.
Betrachtet werden die Beziehungen zwischen dem
Ort der Ausbildungsstätte und dem Wohnort der
Auszubildenden zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses.
Apfelernte 2025 übersteigt voraussichtlich
1-Million-Tonnen-Marke
Nach
erster Schätzung erstmals seit 2022 wieder mehr
als 1,0 Millionen Tonnen Äpfel
– Erntemenge
voraussichtlich um 15,7 % höher als im Vorjahr
- Pflaumen- und Zwetschenernte mit
44 500 Tonnen auf durchschnittlichem Niveau
Die deutschen Obstbaubetriebe erwarten im
Jahr 2025 eine überdurchschnittliche Apfelernte
von rund 1 009 000 Tonnen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) nach einer ersten Schätzung
vom Juli 2025 mitteilt, werden damit
voraussichtlich 38 300 Tonnen (+3,9 %) mehr
Äpfel geerntet als im Durchschnitt der
vergangenen zehn Jahre (970 500 Tonnen).
Die Millionen-Tonnen-Marke wird damit zum
ersten Mal seit 2022 (1 071 000 Tonnen) wieder
erreicht und die vergleichsweise geringe
Apfelernte des Vorjahres (872 000 Tonnen) um
15,7 % übertroffen. Grund für die positiven
Ernteerwartungen sind die milden
Witterungsbedingungen zur Blütezeit sowie in den
meisten Anbauregionen ausgebliebene Frost- und
Hagelereignisse. Äpfel werden 2025 bundesweit
auf einer Fläche von 32 700 Hektar erzeugt und
bleiben das mit Abstand am meisten geerntete
Baumobst in Deutschland.
Die
bedeutendsten Anbauregionen liegen in
Baden-Württemberg (Bodenseeregion) und
Niedersachsen (Altes Land). In Baden-Württemberg
werden auf einer Fläche von 11 600 Hektar
voraussichtlich 362 000 Tonnen Äpfel geerntet,
in Niedersachsen wird auf 8 400 Hektar
Anbaufläche eine Apfelernte von 330 000 Tonnen
erwartet. Diese beiden Bundesländer vereinen
damit 61,1 % der Apfelanbaufläche in Deutschland
und erzeugen mehr als zwei Drittel der
heimischen Äpfel (68,6 %).
Pflaumen- und
Zwetschenernte auf einem durchschnittlichen
Niveau erwartet Die Pflaumen- und Zwetschenernte
wird in diesem Jahr mit 44 500 Tonnen
voraussichtlich um 700 Tonnen (+1,6 %) leicht
höher ausfallen als im Durchschnitt der letzten
zehn Jahre (43 800 Tonnen). Auch der
Vorjahreswert lag bei 43 800 Tonnen.
Die
größten Anbauflächen für Pflaumen und Zwetschen
liegen mit 1 700 Hektar in Baden-Württemberg und
mit 900 Hektar in Rheinland-Pfalz. Trotz
direkter Nachbarschaft dieser beiden Länder
zeigen sich deutliche regionale Unterschiede bei
der Erntemenge im Vergleich zum Vorjahr.
In Baden-Württemberg liegt die diesjährige
Ernteschätzung für Pflaumen und Zwetschen mit
17 200 Tonnen fast ein Drittel (-32,7 %) unter
der im Jahr 2024 erzielten Erntemenge von 25 600
Tonnen. In Rheinland-Pfalz hingegen wird die mit
7 500 Tonnen vergleichsweise geringe Pflaumen-
und Zwetschenernte des Vorjahres voraussichtlich
um fast die Hälfte (+46,5 %) auf 11 000 Tonnen
ansteigen.
Die regionalen Unterschiede
beim Vorjahresvergleich basieren auf dem
Umstand, dass die baden-württembergischen
Obstbaubetriebe 2024 eine überdurchschnittlich
gute Pflaumen- und Zwetschenernte erzielten,
während die übrigen Anbauregionen teils starke
Ertragseinbußen verzeichnet hatten. Bundesweit
werden aktuell auf einer Fläche von 4 100 Hektar
Pflaumen und Zwetschen für den Marktobstanbau
erzeugt.
Moers: 36 Teams stachen ins Meer - Die Maui
Brüder hatten beim Badewannenrennen im
Bettenkamper Meer die Nase vorne
Die Temperaturen blieben zwar hinter der
angesagten Sommerhitze zurück, dafür ging es auf
dem Wasser umso heißer her: Gleich 36 Teams
kämpften am letzten Samstag beim 16.
Badewannenrennen im Moerser Bettenkamper Meer um
den Sieg.
Die DLRG Moers, die ENNI Sport
& Bäder Niederrhein (Enni) und der Freundeskreis
Bettenkamper Meer hatten gemeinsam zu dem
Saisonhighlight in das Naturfreibad eingeladen.

„Die Stimmung war wie immer großartig“,
freut sich Tobias Berndt, Vorsitzender des
Freundeskreises Bettenkamper Meer, über die
vierstellige Zahl an Zuschauern, die die
Athletinnen und Athleten in ihren besonderen
Ruderbooten anfeuerten. Berndt: „Dass es ein
bisschen kühler war als angesagt, hat es den
Wettkämpfern auf dem Wasser ein wenig leichter
gemacht.“
Durchgesetzt haben sich als
schnellste Paddler schließlich „Die Maui
Brüder“. Sie können sich über Karten für das
ComedyArts Festival in Moers freuen. Grund zur
Freude hatten außerdem „Die Ringjäger“. Sie
überzeugten durch die kreativsten Kostüme und
fahren auf Einladung der Bundestagsabgeordneten
Kerstin Radomski nach Berlin.
Wie
immer stand an dem Tag dabei nicht die
sportliche Leistung, sondern vor allem der Spaß
im Vordergrund. So hatten alle Sportlerinnen und
Sportler ebenso wie alle Besucherinnen und
Besucher nach dem Rennen die Gelegenheit, den
Tag bei der After-Race-Party mit DJ Altan
ausklingen zu lassen. „Es war eine wunderbare
Sommerparty und wir haben wieder viel positives
Feedback von den Gästen erhalten“, erzählt
Tobias Berndt.
„Viele haben bereits
angekündigt, auch im kommenden Jahr wieder mit
dabei zu sein.“ Denn eines ist für die
Organisatoren bereits jetzt klar: 2026 geht das
Badewannenrennen in Bettenkamp in die 17. Runde.
Weitere Informationen zum Naturfreibad
Bettenkamper Meer gibt es auf www.enni.de oder
www.bettenkamper-meer.de.
Neue Gedenktafel für Erna Suhrborg –
eine Malerin, die Wesel bis heute in ihren Bann
zieht
Mit einer neuen
Gedenktafel für die „FrauenWege” in der
Sandstraße wird an die bekannte Weseler Malerin
Erna Suhrborg erinnert. Die Tafel würdigt das
Engagement und die spannende Lebensgeschichte
dieser inspirierenden Persönlichkeit.

von link: Gleichstellungsbeauftragte Regina
Lenneps, Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und die
Eheleute Suhrborg vor dem Portrait der Malerin
Erna Suhrborg in der Sandstraße
Wer sich
selbst ein Bild von Erna Suhrborg und anderen
Frauen, die in Wesel wirkten, machen möchte, ist
eingeladen, durch die Sandstraße in der Weseler
Innenstadt zu spazieren. Neben Portraits der
bedeutenden Frauen sind auch Hinweise zu ihrem
Leben angebracht – mal in Schriftform, mal als
QR-Code, so auch zu Erna Suhrborg.
Erna
Margarete Weidlich wurde am 16. März 1910 in
Uerdingen geboren. Sie war das zweite von sieben
Kindern. Ihre Eltern waren Ernst Wilhelm
Weidlich, ein Obermüllermeister, und seine Frau
Sophia. 1912 verschlug es die Familie aus
beruflichen Gründen nach Amsterdam, wo ihr Vater
Betriebschef einer Mehlfabrik wurde. Die
Grachtenstadt prägte Erna früh. Sie verbrachte
viel Zeit im Rijksmuseum und bewunderte die
Werke von Rembrandt.
Der Erste Weltkrieg
trennte die Familie, als ihr Vater 1917 zum
Wehrdienst einberufen wurde. Erna besuchte
während des Krieges eine deutsche Schule in
Amsterdam. Nach dem Ersten Weltkrieg lebte die
Familie vier weitere Jahre in Amsterdam, bevor
sie 1922 nach Rotterdam umzog. Dort schloss Erna
ihre Schulzeit ab und absolvierte von 1926 bis
1928 eine Ausbildung zur Lehrerin für
Kunstgewerbe.
Erna lernte den Maler Jan
Damme kennen, der sie in die handwerklichen
Techniken der Malerei einführte. Später
entwickelte sie eine enge Freundschaft mit Georg
August Stahl, der sie mit der modernen Kunst
vertraut machte. 1937 heiratete sie Dietrich
Suhrborg, der aus Duisburg stammte. Nach der
Hochzeit bestimmte vor allem das Familienleben
ihren Alltag.
Der Kiesbetrieb der
Suhrborgs expandierte, was dazu führte, dass die
Familie ihren Wohnsitz 1939 in Richtung
Niederrhein verlegte. In Wesel-Flüren erlebte
Erna die Zerstörung ihres Hauses während des
Zweiten Weltkrieges. Erst 1953 konnte die
Familie in ihr Heim zurückkehren. Erna widmete
sich leidenschaftlich der Malerei und
entwickelte so ihren eigenen, einzigartigen
Stil. Ab 1954 begann sie, ihre Werke
auszustellen.
Der Durchbruch gelang ihr
1964 mit einer beeindruckenden Ausstellung auf
Schloss Ringenberg (Hamminkeln). Erna Suhrborg
etablierte sich als angesehene Künstlerin. Ihre
Werke zeigen eine tiefe Verbundenheit zur Natur.
Sie schuf Aquarelle und wagte sich selbstbewusst
an verschiedene Materialien. Dadurch wurde ihre
künstlerische Ausdruckskraft noch
facettenreicher.
Am 23. Januar 1995
verstarb sie in Wesel. Als besondere
Wertschätzung der Stadt Wesel wurde eine Straße
in Wesel-Fusternberg, die Erna-Suhrborg-Stege,
nach der Künstlerin benannt. Alle drei Jahre
wird der Erna-Suhrborg-Preis ausgelobt. Diese
besondere Auszeichnung, gestiftet von Gabriele
und Dieter Suhrborg, wird an talentierte
Künstlerinnen vergeben.
Seit 2020 wird
zusätzlich ein Nachwuchspreis für Schülerinnen
verliehen. Damit sollen junge Talente ermutigt
werden, ihren eigenen Weg in der Kunst zu
finden. Dieser Preis ist eine Hommage an die
Kunst. Er erinnert an eine Persönlichkeit, die
Wesel mit ihrem Können bis heute nachhaltig
geprägt hat.
Wer sich neben Erna
Suhrborg auch über andere inspirierende Frauen
aus Wesel informieren möchte, kann zudem im
Rathaus in der ersten Etage vor Zimmer 116 eine
kostenlose Broschüre mit dem Titel „Die
WEGgefährtinnen“ mitnehmen.
BDP kritisiert
Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär
Schutzberechtigte und sieht darin klare
Verletzung von nationalem sowie europäischem
Recht auf Familienleben
Das am 24. Juli 2025 in
Kraft getretenen Gesetz zur Aussetzung des
Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte
soll laut Aussage der Bundesregierung die
„Aufnahme- und Integrationssysteme in
Deutschland entlasten“ und nur in Härtefällen
nicht zur Anwendung kommen. Das Gesetz gilt
zunächst für zwei Jahre mit einer Prüfoption auf
Verlängerung. Bis dahin sind keine
Wartelisten-Registrierungen möglich, es werden
keine Anträge bearbeitet und subsidiär
Schutzberechtigte können ihre engsten
Familienangehörigen wie Ehepartner*innen und
minderjährige Kinder nicht nach Deutschland
nachholen.

Das Vorgehen wird von
Organisationen wie PRO ASYL, dem
Bundesfachverband Minderjährigkeit und Flucht
(BuMF) und der evangelischen Kirche scharf
kritisiert. Der Berufsverband Deutscher
Psychologinnen und Psychologen (BDP) schließt
sich der Kritik an und sieht darin eine klare
Verletzung von nationalem und europäischem Recht
auf Familienleben. Dieses Recht ist durch das
Grundgesetz (Art. 6), die Grundrechtecharta
(Art. 7) und die Europäische
Menschenrechtskonvention (EMRK, Art. 8)
geschützt.
Die Aussetzung bedeutet für
die durch Flucht und Vertreibung oft schwer
traumatisierten Geflüchteten, neben den
bestehenden physischen und psychischen
Belastungen, zusätzliches Leid durch die Sorge
um das Leben ihrer Verwandten. Das kann
Integrationsbemühungen von Betroffenen negativ
beeinflussen und es ist davon auszugehen, dass
sich nun wieder vermehrt Menschen auf die
gefährlichen Fluchtrouten begeben. In diesem
Zusammenhang weist der Verband auch auf eine
mögliche Verletzung der
UN-Kinderrechtskonvention hin, wenn Kinderrechte
missachtet und Kindeswohl durch die Aussetzung
des Familiennachzugs nicht gewährleistet werden.
Dabei ist laut Mediendienst Integration die
Zahl der Asylsuchenden in Deutschland ohnehin
rückläufig und nur rund 8 % der Visa für
Familienzusammenführung gingen in den letzten
Jahren an Angehörige von subsidiär
Schutzberechtigten.
Die Wartezeiten bei
den Nachzugsverfahren hingegen sind enorm lang
und die Situation bei der psychosozialen
Versorgung von Geflüchteten in Deutschland nach
wie vor prekär. Ein hoher Bedarf trifft in den
spezialisierten Psychosozialen Zentren (PSZ) auf
eine große Versorgungslücke und massiv
überlastetes Personal. „Nicht behandelte durch
Krieg und Verfolgung entwickelte Traumata von
Geflüchteten werden oft durch eine prekäre
Unterbringung, Diskriminierungserfahrungen und
Isolation noch chronifiziert und führen zu
Traumafolgestörungen wie Depressionen“,
erläutert Leo Teigler,
BDP-Präsidiumsbeauftragte*r für
Menschenrechtsfragen.
Auch bei frühzeitig
erkannten Bedarfen sieht das
Asylbewerberleistungsgesetz erst nach 36 Monaten
eine psychotherapeutische Versorgung vor und die
Wartezeiten sind oft noch deutlich länger. Um
der Versorgungsknappheit entgegenzuwirken,
bräuchte es einen deutlich früheren Zugang zu
Therapieplätzen mit Sprachmittlung sowie den
Ausbau von niedrigschwelligen psychologischen
Beratungsangeboten, die Betroffene
stabilisieren, einer Chronifizierung von
psychischen Erkrankungen und der Entwicklung von
destruktiven Coping-Mechanismen
entgegenzuwirken.
Die realen Zahlen im
Bereich Flucht und Migration sowie die Bedarfe
von Geflüchteten stehen im direkten Kontrast zur
restriktiven Migrations- und Flüchtlingspolitik
der aktuellen Bundesregierung. Damit verletzt
die Bundesregierung nationales und europäisches
Recht und kommt ihrer humanitären Verantwortung
nicht nach.
Auch subsidiär
Schutzberechtigte haben ein Recht auf
Familienleben und es gilt grundsätzlich die
Rechte und das Wohl von Minderjährigen zu
schützen. Der BDP appelliert an die Regierung,
ihrer Verantwortung nachzukommen und einer
weiteren Ausgrenzung und Diskriminierung von
Geflüchteten, auch subsidiär Schutzberechtigten,
entgegenzutreten.
Moers: Baumaßnahmen an Schulen und Kitas
während der Ferien
Um den
laufenden Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen,
hat das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt an
verschiedenen Moerser Schulen sowie Kitas wieder
größere und kleinere Baumaßnahmen während der
Ferien durchgeführt.
Das
Gesamtinvestitionsvolumen betrug dabei rund 1,4
Millionen. So erfolgte an der
Gemeinschaftsgrundschule Eick-West im Zuge des
Umbaus der Fernwärme der Rückbau eines
unterirdischen Kellerraums. I
In der
Kindertageseinrichtung an der
Konrad-Adenauer-Straße konnten die Holzböden im
Gruppenraum und Flur des Dachgeschosses
instandgesetzt werden. An der
Heinrich-Pattberg-Realschule ist die Sanierung
der Dreifach-Turnhalle im Bereich der Tribüne
noch in vollem Gange.
Bereits
fertiggestellt sind an der St. Marien-Schule die
OGATA-Küche mit Essbereich sowie an der
Astrid-Lindgren-Schule die OGATA-Erweiterung für
den Gruppenraum und die Verwaltung. Die Arbeiten
zur Beseitigung eines Wasserschadens im Bereich
der OGATA der Grundschule Hülsdonk dauern länger
an und sind erst etwa dreieinhalb Wochen nach
Ferienende abgeschlossen.
Kreis Kleve: Geschichte trifft Erlebnis
Seit mehr als zwei Jahrzehnten
laden die öffentlichen Stadt- und
Themenführungen in Kleve dazu ein, die Stadt aus
immer neuen Blickwinkeln zu entdecken.

Gruppenfoto im Grünen mit den Stadtführern aus
Kleve, die verschiedene Gegenstände, wie Schuh
und Schwan in die Kamera halten
Was 2004
mit acht verschiedenen Führungen begann, hat
sich inzwischen zu einem abwechslungsreichen
Programm entwickelt: In diesem Jahr bot die
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve
GmbH (WTM) insgesamt 28 verschiedene Führungen
an rund 50 Terminen an.
„Jede Führung
ist eine kleine Zeitreise – mal spannend, mal
genussvoll, mal überraschend. Wir möchten
unseren Gästen zeigen, dass Kleve weit mehr zu
bieten hat als man auf den ersten Blick
vermutet“, sagt Verena Rohde, Geschäftsführerin
der WTM.
Die Themen sind so vielfältig
wie die Geschichte der Stadt: Neben regelmäßigen
Rundgängen durch die Schwanenburg (24.08.)
stehen etwa Führungen zur Klever Schuhindustrie
(31.08.), kulinarische „Häppchen-Touren“
(13.09.) oder abendliche Erkundungen der dunklen
Kapitel der Stadtgeschichte (17.10.) auf dem
Programm.
Führungen in Gewandung – etwa
mit Änneke Schenk auf Schenkenschanz (27.09.)
oder mit Elsa, der Frau des Nachtwächters
(10.10.) – erfreuen sich großer Beliebtheit.
Auch die historischen Gartenanlagen werden
vielfältig bespielt: Zehn verschiedene
Themenführungen laden zum Erkunden ein, darunter
auch zur Beleuchtung des Parks in Verbindung mit
dem Besuch der „China Lights“ im Klever
Tiergarten (12.10.).
Im Forstgarten
locken interaktive „Outdoor Games“ für Kinder
und Jugendliche (23.10.). Radtouren wie die neue
Tour „Einblicke und Ausblicke“, die in diesem
Jahr Premiere feierte, bereichern das Angebot –
eine Fortsetzung ist bereits für 2026 geplant.
„Ob zu Fuß, auf dem Rad oder mit kleinen
kulinarischen Pausen – unsere Führungen
verbinden Geschichte, Natur und Lebensart. Genau
diese Mischung macht Kleve so erlebenswert.“
Neben den öffentlichen Führungen stehen über 50
Touren für Gruppen zur Verfügung – ideal für
Vereins- und Betriebsausflüge oder auch
Weihnachtsfeiern.
Die Führungen können
individuell zum Wunschtermin gebucht werden und
kosten ab 75 Euro pro Gruppe bis 20 Personen.
Gruppen ab 15 Personen können zudem aus
attraktiven Tagesprogrammen wählen, die eine
Stadtführung mit einem Mittagessen und zum
Beispiel einem Besuch im Klever Tiergarten oder
einer Draisinenfahrt verbinden.
Schon im
Herbst fängt das neunköpfige Team der
Stadtführerinnen und Stadtführer mit der Planung
für das nächste Jahr an. Damit der ein oder
andere Stadtführungsgutschein seinen Weg unter
den Tannenbaum finden kann, soll das Programm
2026 bis Mitte Dezember feststehen.
Nähere Informationen zu den Führungen und
Tagesarrangements gibt es auf
www.kleve-tourismus.de. Die öffentlichen
Führungen können hier auch bequem online gebucht
werden.
Moers: Bollwerk Session
Ihr wollt euch musikalisch
auszuprobieren? Ihr wollt eure Musik vor
Publikum testen? Ihr wollt mit anderen Musikern
und Musikerinnen zusammen jammen? Dann seid ihr
bei der Bollwerk Session richtig. Hier könnt ihr
musikalisch aktiv werden, euch mit anderen
Musikern und Musikerinnen vernetzen, euch
inspirieren lassen oder einfach nur Musik
lauschen.
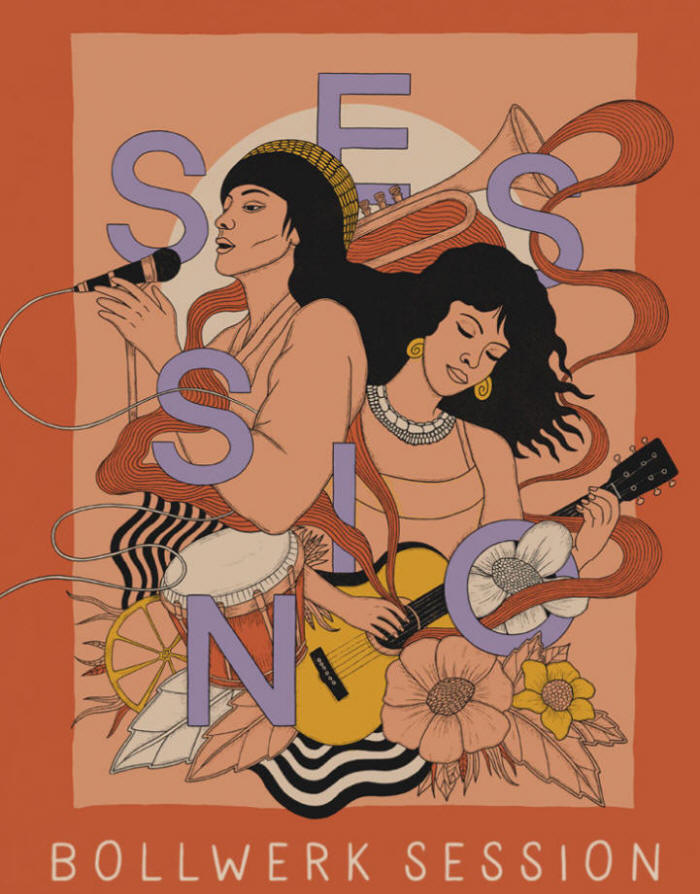
Meldet euch gerne vorher unter info@bollwerk107.de an.
Gefördert durch Soziokultur NRW und dem
Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW.
Veranstaltungsdatum 23.08.2025 - 20:00
Uhr - 22:30 Uhr. Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107, 47441 Moers.
Moers: TerrassenKonzert: -KÄNK & SCREAM
Wir verabschieden nicht nur
den Sommer, gleichzeitig verabschieden wir uns
von einigen liebgewonnenen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen aus der Bollwerk107 Kneipe. Was
wäre da passender, als zwei Bands mit Ursprüngen
aus unserem Freiraum-Bandkeller und dem
Kneipen-Team?
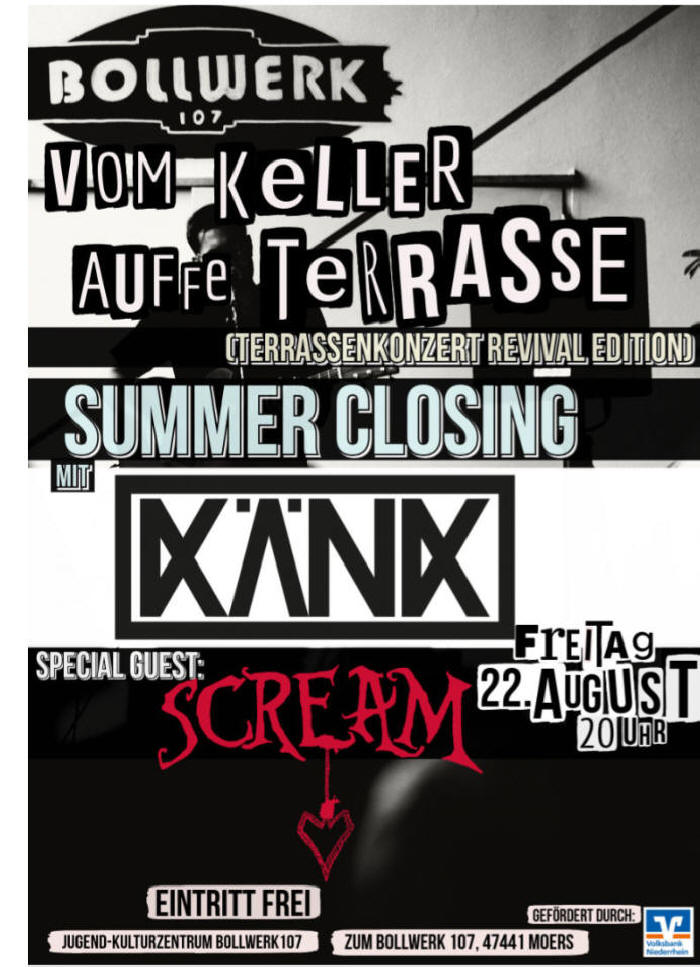
Känk begleiten Euch durch einen wundervolles
Summer Closing und bringen Euch als special
guest Scream mit auf die Bühne. Das wird ein
grandioser Abschied! Gefördert durch die
Volksbank Niederrhein. Veranstaltungsdatum
22.08.2025 - 20:00 Uhr - 22:30 Uhr.
Veranstaltungsort Zum Bollwerk 107, 47441 Moers.
Moerser Stadtteilhäppchen - Schwafheim
- ein kulinarischer Spaziergang
In netter Gesellschaft in ca. 5 Stunden durch
den grünen Stadtteil Schwafheim. Während der
Pausen gibt es kulinarische und historische
Häppchen.

Geführt von Renate Brings-Otremba.
Treffpunkt: Parkplatz ALDI. Kosten: 28,70 Euro
Weitere Infos zu den Stadtführungen.
Veranstaltungsdatum 23.08.2025 - 10:00
Uhr -15:00 Uhr. Veranstaltungsort Kirchweg 38,
47447 Moers.
Moers: Stadtspaziergang
Lassen Sie uns die
spannende Moerser Stadtgeschichte vom
Mittelalter bis zur Industrialisierung auf
Stadtspaziergängen entdecken. Geführt von
Eva-Maria Eifert Treffpunkt: Moers Banhof
(Vorplatz) Kosten: 8 Euro

Weitere Infos zu den Stadtführungen.
Stadtspaziergang 1 am 10.05.2025
Stadtspaziergang 2 am 20.07.2025
Veranstaltungsdatum 24.08.2025 - 10:30
Uhr - 12:30 Uhr. Veranstaltungsort Vor der
Stadt: Bahnhof – Schlachthof – Friedhof Klever
Straße – Homberger Straße
Moers: Vinyltreff
Monatlicher Schallplattenbasar am Niederrhein im
Gewerbegebiet Moers-Hülsdonk für alle
diejenigen, die die guten alten Schallplatten zu
schätzten wissen. Das Vinylgestöber findet bei
freiem Eintritt für Besucher statt. Kostenfreie
Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Die Räumlichkeiten sind barrierefrei.
Veranstaltungsdatum 23.08.2025 - 10:00
Uhr -16:00 Uhr. Veranstaltungsort MUSIC & MORE.
Adresse: Am Schürmannshütt 26, 47441
Moers-Hülsdonk.
Bürgerfest Moers Utfort - Eick 2025
24.08.2025 - 12:00 Uhr - 18:00 Uhr.
Veranstaltungsort Roseggerstraße 23, 47445
Moers. Veranstaltungsort Schulhof. Veranstalter
Turnverein Utfort-Eick 1981 e.V., Roseggerstraße
53, 47445 Moers.
Trödelmarkt Repelen
Veranstaltungsdatum 24.08.2025 - 11:00
Uhr - 18:00 Uhr.
Veranstaltungsort Markt 1-3,
47445 Moers. Veranstalter WMV Märkte & Mehr UG
Trotz Belastung durch US-Zollpolitik:
Rezessionsrisiko bleibt niedrig
Trotz der erheblichen wirtschaftlichen
Belastungen, insbesondere durch die aggressive
Zollpolitik der US-Regierung, bleibt das
Rezessionsrisiko für die deutsche Wirtschaft
niedrig und hat sich in den vergangenen Wochen
kaum verändert. Das signalisiert der monatliche
Konjunkturindikator des Instituts für
Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung.
Für den Zeitraum
von August bis Ende Oktober 2025 weist der
Indikator, der die neuesten verfügbaren Daten zu
den wichtigsten wirtschaftlichen Kenngrößen
bündelt, eine Rezessionswahrscheinlichkeit von
25,5 Prozent aus. Anfang Juli betrug sie für die
folgenden drei Monate 23,0 Prozent. Die
statistische Streuung des Indikators, in der
sich die Verunsicherung der
Wirtschaftsakteur*innen ausdrückt, ist
gleichzeitig von bereits geringen 7,1 auf 5,7
Prozent gesunken.
Unter dem Strich zeigt
der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator
daher aktuell „gelb-grün“, was für ein leichtes
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den
kommenden Monaten steht. Nach Analyse des IMK
ist daher die Wahrscheinlichkeit gering, dass
die deutsche Wirtschaft nach dem geringfügigen
BIP-Rückgang im zweiten Quartal im laufenden
dritten Quartal erneut schrumpfen und somit in
eine technische Rezession rutschen könnte.
„Die Datenlage stützt unsere Einschätzung,
dass der ausgehandelte Handelskompromiss
zwischen EU und USA zwar die absehbare leichte
Konjunkturerholung in Deutschland bremst, aber
nicht stoppt“, sagt IMK-Konjunkturexperte Peter
Hohlfeld.
Die aktuelle leichte Zunahme
des Rezessionsrisikos beruht in erster Linie auf
realwirtschaftlichen Indikatoren, vor allem auf
den Rückgängen bei Industrieproduktion und
Auftragseingängen aus dem Ausland. Positiver ist
der Trend bei Finanzmarkt- und
Stimmungsindikatoren – er verhindert, dass die
Rezessionswahrscheinlichkeit stärker gestiegen
ist. Auch der Index für die LKW-Fahrleistung,
der als Frühindikator für die Produktion gilt,
wies zuletzt nach oben.
In der
Gesamtschau prognostiziert das IMK weiterhin
eine konjunkturelle Stagnation in diesem Jahr,
wobei die absehbar stärkeren privaten und
öffentlichen Investitionen eine wichtige
Voraussetzung dafür liefern, dass sich die
Aussichten ab der zweiten Jahreshälfte aufhellen
dürften.
„Damit die expansiven
fiskalischen und investiven Maßnahmen der
Bundesregierung sich voll auf die Konjunktur
auswirken können, ist es aber wichtig, dass auch
der Konsum der privaten Verbraucher*innen
stärker wächst und die privaten Haushalte die
nach wie vor hohe Sparquote reduzieren“, sagt
Konjunkturforscher Hohlfeld.
„Das
passiert nur, wenn die Menschen wieder mehr
Vertrauen in die wirtschaftliche Lage
entwickeln. Periodisch aufflackernde Debatten
über Kürzungen, etwa bei der sozialen Sicherung,
reduzieren das Vertrauen eher.“
Moers: Baumaßnahmen an Schulen und Kitas
während der Ferien
Um den
laufenden Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen,
hat das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt an
verschiedenen Moerser Schulen sowie Kitas wieder
größere und kleinere Baumaßnahmen während der
Ferien durchgeführt. Das
Gesamtinvestitionsvolumen betrug dabei rund 1,4
Millionen. So erfolgte an der
Gemeinschaftsgrundschule Eick-West im Zuge des
Umbaus der Fernwärme der Rückbau eines
unterirdischen Kellerraums.
In der
Kindertageseinrichtung an der
Konrad-Adenauer-Straße konnten die Holzböden im
Gruppenraum und Flur des Dachgeschosses
instandgesetzt werden. An der
Heinrich-Pattberg-Realschule ist die Sanierung
der Dreifach-Turnhalle im Bereich der Tribüne
noch in vollem Gange.
Bereits
fertiggestellt sind an der St. Marien-Schule die
OGATA-Küche mit Essbereich sowie an der
Astrid-Lindgren-Schule die OGATA-Erweiterung für
den Gruppenraum und die Verwaltung. Die Arbeiten
zur Beseitigung eines Wasserschadens im Bereich
der OGATA der Grundschule Hülsdonk dauern länger
an und sind erst etwa dreieinhalb Wochen nach
Ferienende abgeschlossen.
Pflegewende jetzt! BAGSO stellt
Forderungen an die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum
„Zukunftspakt Pflege“
Eine
Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll bis Ende 2025
Eckpunkte für eine Reform der Pflegeversicherung
erarbeiten. Die BAGSO –
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen fordert in ihrer
Stellungnahme zum Beschluss „Zukunftspakt
Pflege“, eine umfassende Perspektive auf die
Thematik einzunehmen und eine zukunftsfähige
Pflegepolitik zu entwickeln, die vor allem
präventiv und vorsorgend ausgerichtet ist.
Die BAGSO appelliert an die Politik, eine
Pflegewende zu gestalten, die
Gesundheitsförderung, Prävention und
Rehabilitation deutlich stärkt und Kommunen mehr
Verantwortung überträgt. Zudem ist eine
Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige
einzuführen. Die Qualitätssicherung in der
professionellen Pflege muss sich stärker an der
Lebensqualität und Rehabilitation der
Pflegebedürftigen orientieren.
Für eine
stabile und sozialverträgliche Finanzierung sind
alle Möglichkeiten zur Verbesserung der
Einnahmenseite zu prüfen, u.a. durch eine
Zusammenlegung von Kranken- und
Pflegeversicherung. Zu den entscheidenden
Stellschrauben, die ein gesundes Älterwerden
unterstützen, zählt die BAGSO insbesondere eine
wirksame und nachhaltige Seniorenpolitik in den
Bundesländern, die Entwicklung
altersfreundlicher Städte und Gemeinden, eine
aktivierende, gesundheitsfördernde und präventiv
wirkende Altenhilfe in den Kommunen, die
stärkere Vernetzung von Altenhilfe und Pflege
sowie die Stärkung und Weiterentwicklung der
altersmedizinischen Versorgung.
Diese
Punkte sind aus Sicht der BAGSO in die zu
erarbeitende Pflegereform zu integrieren. In
der Stellungnahme heißt es: „Auch wenn
Finanzierungsfragen zu stellen sind, darf es aus
Sicht der BAGSO nicht vordringlich darum gehen,
wie die Kosten der pflegerischen Versorgung
einer alternden Gesellschaft künftig zu
verteilen sind. Der Fokus muss vielmehr darauf
gerichtet sein, sowohl nach Art und Umfang als
auch hinsichtlich ihrer Qualität ausreichende
Angebote der Sorge und Pflege sicherzustellen.“
Die BAGSO setzt sich seit Langem für
eine grundlegende Pflegereform ein. Ihre
Forderungen hat sie im Mai 2023 im
Positionspapier "Sorge und Pflege: Neue
Strukturen in kommunaler Verantwortung"
formuliert.
Zur Stellungnahme "Zeit für die Pflegewende –
jetzt!"
Zum Positionspapier "Sorge und Pflege: Neue
Strukturen in kommunaler Verantwortung"

Baugenehmigungen für Wohnungen im Juni 2025:
+7,9 % zum Vorjahresmonat
Baugenehmigungen im Neubau im 1. Halbjahr 2025
zum Vorjahreszeitraum: +14,1 % bei
Einfamilienhäusern
-8,3 % bei
Zweifamilienhäusern
+0,1 % bei
Mehrfamilienhäusern
Im 1. Halbjahr 2025
insgesamt 2,9 % mehr Baugenehmigungen als im
Vorjahreszeitraum Baugenehmigungen im Neubau im
1. Halbjahr 2025 zum Vorjahreszeitraum: +14,1 %
bei Einfamilienhäusern -8,3 % bei
Zweifamilienhäusern +0,1 % bei
Mehrfamilienhäusern
Im Juni 2025 wurde
in Deutschland der Bau von 19 000 Wohnungen
genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, waren das 7,9 % oder 1 400
Baugenehmigungen mehr als im Juni 2024. Im
gesamten 1. Halbjahr 2025 wurden 110 000
Wohnungen genehmigt. Das waren 2,9 % oder 3 100
Wohnungen mehr als im 1. Halbjahr 2024, als die
Zahl genehmigter Wohnungen auf den niedrigsten
Stand für eine erste Jahreshälfte seit 2010
gesunken war. In diesen Ergebnissen sind sowohl
Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn-
und Nichtwohngebäuden als auch für neue
Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.
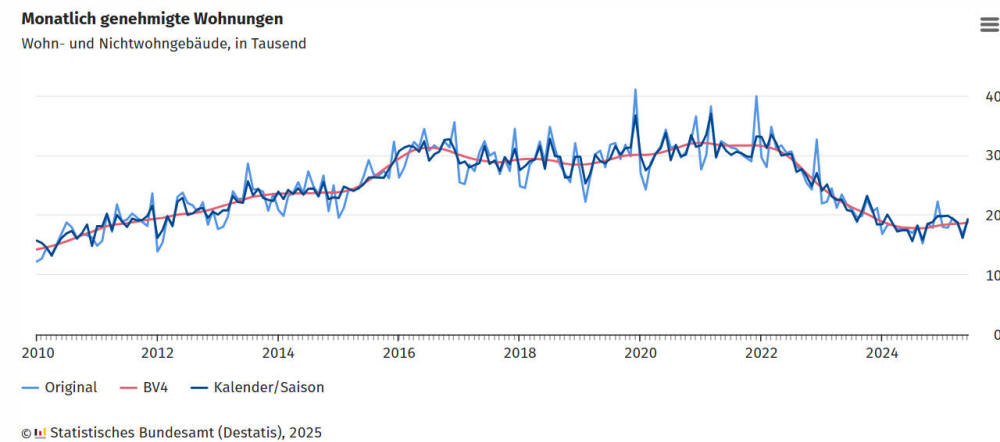
1. Halbjahr 2025: Aufwärtstrend nur bei
Einfamilienhäusern
In neu zu errichtenden
Wohngebäuden wurden im Juni 2025 insgesamt
15 200 Wohnungen genehmigt. Das waren 9,5 % oder
1 300 Wohnungen mehr als im Vorjahresmonat. Im
gesamten 1. Halbjahr 2025 wurden 4,3 % oder
3 700 mehr Neubauwohnungen in Wohngebäuden
genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg
die Zahl der Baugenehmigungen für
Einfamilienhäuser um 14,1 % (+2 600) auf 21 300.
Bei den Zweifamilienhäusern sank die
Zahl um 8,3 % (-500) auf 6 000 genehmigte
Wohnungen. In Mehrfamilienhäusern, der
zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, wurden im
1. Halbjahr 2025 insgesamt 57 300 neue Wohnungen
genehmigt. Damit blieb die Zahl genehmigter
Neubauwohnungen in Mehrfamilienhäusern nahezu
unverändert (+0,1 % oder 31 Wohnungen) gegenüber
dem Vorjahreszeitraum.
Ausgaben für Sozialhilfe im Jahr 2024 um 14,8 %
gestiegen
Deutliche
Ausgabenanstiege bei allen Leistungen der
Sozialhilfe nach SGB XII
Seite teilen
Pressemitteilung Nr. 303 vom 18. August 2025
WIESBADEN – Im Jahr 2024 haben die
Sozialhilfeträger in Deutschland 20,2 Milliarden
Euro netto für Sozialhilfeleistungen nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, stiegen die Ausgaben damit
gegenüber dem Vorjahr um 14,8 %.
Die
Ausgaben sind bei allen Leistungen der
Sozialhilfe deutlich gestiegen. Der Großteil der
Ausgaben für Sozialhilfeleistungen ging mit
56,5 % auf die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung zurück: Auf diese Leistungen,
die vollständig aus Erstattungsmitteln des
Bundes an die Länder finanziert werden,
entfielen im Jahr 2024 nach Angaben des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
11,4 Milliarden Euro. Sie stiegen damit
gegenüber dem Vorjahr um 13,3 %.
Die
Nettoausgaben für Hilfe zur Pflege stiegen um
17,7 % auf 5,3 Milliarden Euro. Für die Hilfe
zum Lebensunterhalt wurden 1,6 Milliarden Euro
ausgegeben, das waren 11,1 % mehr als im
Vorjahr. In die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe
zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten sowie die Hilfe in anderen
Lebenslagen flossen zusammen 1,9 Milliarden Euro
und damit 19,4 % mehr als im Jahr 2023.
Nettoausgaben für Leistungen der
Eingliederungshilfe nach SGB IX um 12,9 %
gestiegen
Die bis Ende 2019
im SGB XII geregelten Leistungen der
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
und von Behinderung bedrohten Menschen wurden
zum 1. Januar 2020 durch das
Bundesteilhabegesetz (BTHG) in das Neunte Buch
Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.
Die
Ausgaben der Eingliederungshilfe werden seither
in einer eigenen Statistik erfasst: Danach
wurden im Jahr 2024 für die Leistungen der
Eingliederungshilfe insgesamt 28,7 Milliarden
Euro netto ausgegeben. Das war eine Steigerung
um 12,9 % gegenüber dem Vorjahr.
Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025
nahezu unverändert
Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 2.
Quartal 2025
0,0 % zum Vorquartal
(saisonbereinigt)
+0,4 % zum Vorquartal
(nicht saisonbereinigt)
0,0 % zum
Vorjahresquartal
Im 2. Quartal 2025 waren
rund 46,0 Millionen Menschen in Deutschland
erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die
Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal
saisonbereinigt unwesentlich um 7 000 Personen
(0,0 %). Im 1. Quartal 2025 war die
saisonbereinigte Erwerbstätigkeit leicht um 17
000 Personen (0,0 %) angestiegen.
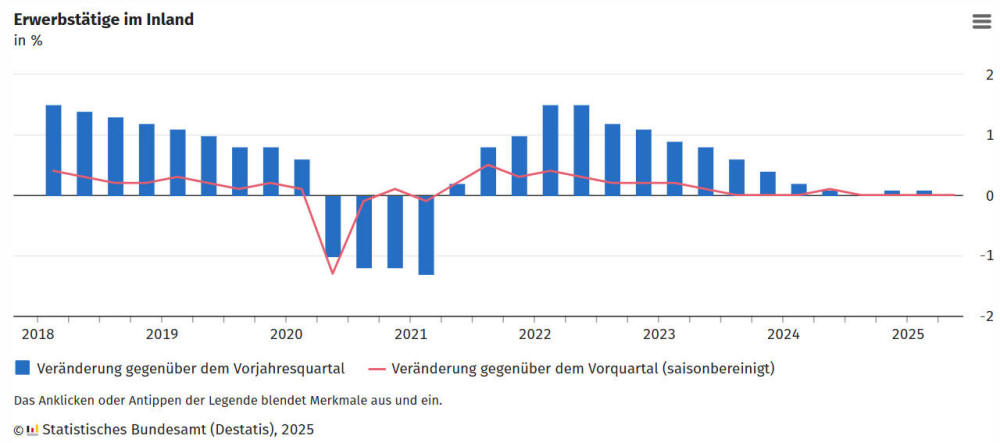
Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg
die Zahl der Erwerbstätigen im 2. Quartal 2025
gegenüber dem 1. Quartal 2025 um
198 000 Personen oder 0,4 %. Ein solcher Anstieg
der Erwerbstätigkeit im 2. Quartal eines Jahres
ist saisonal üblich. Im Jahr 2025 fiel die
Zunahme allerdings deutlich schwächer aus als im
Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024
(+266 000 Personen; +0,6 %).
Erwerbstätigkeit auf dem Vorjahresniveau
Verglichen mit dem 2. Quartal 2024 stieg die
Zahl der Erwerbstätigen im 2. Quartal 2025
geringfügig um 10 000 Personen (0,0 %). Der
Beschäftigungsanstieg im Vorjahresvergleich
hatte seinen Höhepunkt nach der Corona-Krise im
2. Quartal 2022 (+679 000 Personen; +1,5 %).
Danach flachte der Beschäftigungszuwachs immer
weiter ab.
Im 1. Quartal 2025 war das
Vorjahresniveau nur noch um 40 000 Personen
(+0,1 %) überschritten worden. Unterschiedliche
Entwicklungen in den einzelnen
Dienstleistungsbereichen Während im 2. Quartal
2025 die Erwerbstätigenzahl gegenüber dem
Vorjahresquartal in den Dienstleistungsbereichen
wuchs (+178 000 Personen; +0,5 %), sank die
Erwerbstätigkeit außerhalb der
Dienstleistungsbereiche um insgesamt
168 000 Personen (‑1,5 %).
Dabei
entwickelte sich die Beschäftigung innerhalb der
Dienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der
Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung,
Gesundheit setzte seinen langjährigen
Aufwärtstrend fort und wuchs kräftig um 225 000
Personen (+1,9 %). Die absolut zweitgrößte, aber
ungleich geringere Zunahme innerhalb der
Dienstleistungsbereiche im 2. Quartal 2025
verzeichnete der Bereich Sonstige
Dienstleistungen (unter anderem Verbände und
Interessenvertretungen) mit +24 000 Personen
(+0,8 %).
Im Bereich Finanz- und
Versicherungsdienstleister war ein Plus von
19 000 Personen (+1,8 %) zu verzeichnen. Dagegen
sank im Bereich Information und Kommunikation
die Zahl der Erwerbstätigen weiter, und zwar um
4 000 Personen (-0,3 %). Hier war im 3. Quartal
2024 der fast neun Jahre und über die
Corona-Krise hinweg anhaltende
Beschäftigungsaufbau zu Ende gegangen.
Im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe
vergrößerte sich das Minus auf 38 000 Personen
(-0,4 %). Bei den Unternehmensdienstleistern, zu
denen auch der Bereich Vermittlung und
Überlassung von Arbeitskräften gehört, sank die
Zahl der Beschäftigten um 56 000 Personen
(-0,9 %).
Abwärtstrend im Produzierenden
Gewerbe setzt sich fort Im Produzierenden
Gewerbe ohne Baugewerbe ging die
Erwerbstätigenzahl im 2. Quartal 2025 gegenüber
dem Vorjahresquartal weiter kräftig zurück
(-141 000 Personen; -1,7 %). Im Baugewerbe sank
die Beschäftigung im 2. Quartal 2025 ebenfalls,
und zwar um 21 000 Personen (-0,8 %) und in der
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei nahm sie um
6 000 Personen (-1,0 %) ab.
Mehr
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weniger
Selbstständige
Erneut war die positive
Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung maßgeblich dafür verantwortlich,
dass die Erwerbstätigkeit gegenüber dem
Vorjahresquartal nicht noch weiter zurückging.
Beschäftigungsverluste gab es hingegen bei der
Zahl der Beschäftigten mit ausschließlich
marginalen Tätigkeiten (geringfügig entlohnte
und kurzfristig Beschäftigte sowie Personen in
Arbeitsgelegenheiten).
Insgesamt erhöhte
sich die Zahl der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im 2. Quartal 2025 im Vergleich zum
2. Quartal 2024 leicht um 54 000 (+0,1 %) auf
42,3 Millionen Personen. Dagegen ging die Zahl
der Selbstständigen einschließlich mithelfender
Familienangehöriger weiter zurück. Ihre Zahl
sank im Vorjahresvergleich um 44 000 Personen
(-1,2 %) auf 3,7 Millionen.
Arbeitsvolumen geht um 0,5 % zurück
Die
durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je
erwerbstätiger Person sank nach ersten
vorläufigen Berechnungen des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der
Bundesagentur für Arbeit im 2. Quartal 2025 im
Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,5 % auf
315,4 Stunden.
Das gesamtwirtschaftliche
Arbeitsvolumen – also das Produkt aus der kaum
veränderten Erwerbstätigenzahl und den
gesunkenen geleisteten Stunden je erwerbstätiger
Person – nahm im gleichen Zeitraum ebenfalls um
0,5 % auf 14,5 Milliarden Stunden ab.
Erwerbstätigenzahlen in der EU Nach Angaben des
europäischen Statistikamtes Eurostat vom
14. August 2025 stieg die nach europäisch
harmonisierten Methoden berechnete
Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 in den
27 Staaten der Europäischen Union (EU) und im
Euroraum jeweils durchschnittlich um 0,7 %
gegenüber dem Vorjahresquartal.
Bundeskanzler reist nach Washington
Bundeskanzler Friedrich Merz wird am Montag
gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten
Wolodymyr Selenskyj und anderen europäischen
Staats- und Regierungschefs zu politischen
Gesprächen nach Washington reisen.
Die
Reise dient dem Informationsaustausch mit
US-Präsident Donald Trump nach dessen Treffen
mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in
Alaska. Bundeskanzler Merz wird mit den Staats-
und Regierungschefs den Stand der
Friedensbemühungen diskutieren und das deutsche
Interesse an einem schnellen Friedensschluss in
der Ukraine unterstreichen.
Gegenstand
der Gespräche sind unter anderem
Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und
die fortdauernde Unterstützung der Ukraine in
der Abwehr der russischen Aggression. Dazu
gehört auch die Aufrechterhaltung des
Sanktionsdrucks.
NATO-Generalsekretär besucht die USA
Am 18. August 2025 wird der
NATO-Generalsekretär, Mark Rutte, Washington DC
besuchen Der Generalsekretär wird an einem vom
Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald J.
Trump, ausgerichteten Treffen mit dem
Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj,
und anderen europäischen Staats- und
Regierungschefs teilnehmen.
Kreis Wesel: Durchführung der
repräsentativen Wahlstatistik bei der
Kommunalwahl am 14. September 2025
Kreiswahlleiter Dr. Lars Rentmeister informiert
darüber, dass auch im Rahmen der Kommunalwahl am
14. September 2025 wieder die sogenannte
repräsentative Wahlstatistik durchgeführt wird.
Hierfür wurden erneut Stimmbezirke mit
mindestens 400 Wahlberechtigten ausgewählt.
In einigen Stimmbezirken in den
kreisangehörigen Kommunen Alpen, Dinslaken,
Hamminkeln, Kamp-Lintfort, Moers,
Neukirchen-Vluyn, Schermbeck, Voerde und Wesel
werden wieder Stimmzettel mit
Unterscheidungsmerkmalen nach Geschlecht und
Geburtsjahrgang ausgegeben. Diese Merkmale
lauten etwa „H. weiblich, geboren 1991 bis 2000“
oder „D. männlich, divers oder ohne Angabe im
Geburtenregister, geboren 1966 bis 1980“.
Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses sieht das
Kommunalwahlgesetz für die repräsentative
Wahlstatistik besondere Schutzmaßnahmen vor. Die
Stimmenauszählung, die am Wahlabend von den
Wahlvorständen in den Kommunen vorgenommen wird,
findet getrennt von der statistischen Auswertung
der Stimmzettel statt, welche beim Landesbetrieb
Information und Technik in Düsseldorf (IT NRW)
durchgeführt wird. Wählerverzeichnisse und
gekennzeichnete Stimmzettel dürfen nicht
zusammengeführt werden.
Hinsichtlich der Auswertung der überlassenen
Wahlunterlagen unterliegt IT NRW einer strengen
Zweckbindung. Die Ergebnisse der Statistiken
einzelner Stimmbezirke dürfen nicht
bekanntgegeben werden.
IHK: Kommunen
sollen „Möglichmacher“ sein Besserer Service für
die Wirtschaft
Am 14. September
finden in NRW die Kommunalwahlen statt. Die
Entscheider vor Ort beeinflussen, wie attraktiv
ein Standort für Unternehmen ist. Sie können die
Gesetze aus Berlin und Brüssel nicht ändern,
Gestaltungsspielraum ist aber da, betont die
Niederrheinische IHK. Wie das aussehen kann,
will sie der Politik mit Beispielen aus der
Praxis zeigen.
Die Kommunen stehen im
Wettbewerb. Schlanke, schnelle und
wirtschaftsfreundliche Verwaltungen können sich
abheben. „Anträge dauern zu oft Monate oder
Jahre. Das kostet die Wirtschaft Geld. Im
schlimmsten Fall suchen sich die Unternehmen
einen neuen Standort. Deshalb brauchen wir
Menschen in den Behörden, die sagen: Ich möchte,
dass ein Projekt gelingt und treibe das aktiv
voran. Als Behördenlotsen sollen sie Betriebe
durch Genehmigungen leiten. Weg von
unterschiedlichen Zuständigkeiten, hin zu festen
Ansprechpartnern“, sagt Dr. Stefan
Dietzfelbinger, Hauptgeschäftsführer der
Niederrheinischen IHK.

Foto IHK
Prozesse beschleunigen
Damit
Behörden serviceorientiert handeln können,
braucht es schlanke Prozesse. „Viel Bürokratie
gibt der Bund vor, aber jede Verwaltung kann an
den eigenen Prozessen arbeiten“, so
Dietzfelbinger. „Da hilft auch mal ein Blick in
die Nachbarstädte. Wir müssen voneinander
lernen.“
Gleichzeitig sind Kommunen die
Schnittstelle zu den Bürgern. Sie sind mit
verantwortlich, dass Betriebe vor Ort akzeptiert
werden. Das fängt damit an, junge Menschen für
Technik und Wirtschaft zu begeistern. Helfen
kann laut IHK, Bildungseinrichtungen wie
Science-Labs anzusiedeln. Ebenso gilt es
Projekte wie die „Lange Nacht der Industrie“ zu
unterstützen, die Einblicke hinter die Kulissen
ermöglichen.
Für die neue Wahlperiode
hat die IHK acht Schwerpunkte festgelegt. Sie
liefert Beispiele aus der Region und wirbt für
pragmatische Lösungen. So soll der
Wirtschaftsstandort zukunftssicher werden. Die
Forderungen finden sich unter
www.ihk.de/niederrhein/kommunalwahl.
Der Niederrhein ist zu teuer IHK wirbt
vor Kommunalwahl für niedrige Steuern
Hohe
Steuern machen den Standort unattraktiv.
Unausweichlich, sagen die Kommunen, denen es
finanziell nicht gut geht. Zu kurz gedacht,
findet die Niederrheinische IHK. Um die
Wirtschaft anzukurbeln, sollten Gewerbe- und
Grundsteuern gesenkt werden.
„Am 14.
September ist Kommunalwahl. Nicht nur Berlin und
Brüssel können etwas verändern, auch die
Kommunen. Finanziell sieht es vielerorts nicht
rosig aus. Aber wer seine Wirtschaft belastet,
verbaut sich die Zukunft. Unternehmen suchen
sich andere Standorte. Für Investoren wird der
Standort uninteressant. Das kostet Einnahmen und
Arbeitsplätze“, so Dr. Stefan Dietzfelbinger.
Am Niederrhein liegen die Gewerbesteuern
fast zehn Prozent höher als im deutschen
Durchschnitt. Duisburg stellt sich gegen den
Trend. Die Stadt senkt ihre Gewerbe- und
Grundsteuer. „Daran sollten sich andere Kommunen
orientieren. Zusätzliche Belastungen wie die
neue Verpackungssteuer sind nicht tragbar. Jede
Kommune kann für sich entscheiden, ob sie die
Steuer einführt. Das schafft ungleiche
Bedingungen zwischen Städten, aber auch
Branchen. Von dem Mehr an Bürokratie ganz zu
schweigen“, betont Dietzfelbinger.
Das braucht die Wirtschaft von der Politik
Für die neue Wahlperiode hat die IHK acht
Schwerpunkte festgelegt. Sie liefert Beispiele
aus der Region und wirbt für pragmatische
Lösungen. So soll der Wirtschaftsstandort
zukunftssicher werden. Die Forderungen finden
sich unter
www.ihk.de/niederrhein/kommunalwahl.
Wirtschaft braucht Fläche IHK will mehr
Platz für Unternehmen
Standorte, die keine
Flächen anbieten, fallen wirtschaftlich zurück.
Unternehmen investieren weniger oder anderswo.
Anlässlich der Kommunalwahl ruft die
Niederrheinische IHK die Politik auf zu handeln.
Duisburg hat fast keine freien Flächen mehr.
Auch am Niederrhein gibt es immer weniger
Spielraum.
„Unsere Unternehmen stehen im
internationalen Wettbewerb. Da können sie nicht
Jahre auf neue Gewerbeflächen warten.
Ausgewiesene Flächen müssen schnell mobilisiert
werden. Brachflächen sollten schneller nutzbar
sein. Kommunen sollten auch gezielt Flächen auf
Vorrat kaufen, um flexibel auf Anfragen von
Unternehmen reagieren zu können“, sagt Dr.
Stefan Dietzfelbinger.
IHK liefert
Beispiele aus der Praxis Duisburg verfügt über
15 Hektar freie Fläche, die die Wirtschaft
nutzen kann. Das reicht gerade noch für ein
Jahr. Auch an anderen Standorten sieht es
schlecht aus. Moers sollte die Gewerbegebiete
„Kohlenhuck“ und „Kapellen“ schnell entwickeln.
Dinslaken den Kooperationsstandort
„Dinslaken-Barmingholten“. Kommunale
Kooperationen sind laut IHK eine gute Option, um
mehr Flächen anbieten zu können. Goch und Weeze
haben dadurch ein 47 Hektar großes Gewerbegebiet
erschließen können. Ein weiteres positives
Beispiel liefert Wachtendonk. Hier kann ein
Non-Food-Discounter eine Gewerbebrachfläche so
lange nutzen, bis sie entwickelt wird. Ein
Entgegenkommen, das dem Händler vor Ort hilft.
„Das ist pragmatisch, davon brauchen wir mehr“,
so Dietzfelbinger.
Für die neue
Wahlperiode hat die IHK acht Schwerpunkte
festgelegt. Sie liefert Beispiele aus der Region
und wirbt für pragmatische Lösungen. So soll der
Wirtschaftsstandort zukunftssicher werden. Die
Forderungen finden sich unter
www.ihk.de/niederrhein/kommunalwahl.
27 260 Kinder im Jahr 2024 bei
Verkehrsunfällen verunglückt
•
Zahl der im Straßenverkehr getöteten unter
15-Jährigen gegenüber 2023 von 44 auf 53
gestiegen
• Risiko Schulweg: 6- bis
14-Jährige verunglücken am häufigsten zwischen 7
und 8 Uhr • Die meisten verunglückten Kinder
waren mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs
Alle 19 Minuten ist im letzten Jahr ein
Kind im Straßenverkehr verletzt oder getötet
worden. Rund 27 260 Kinder unter 15 Jahren
verunglückten im Jahr 2024 bei Verkehrsunfällen,
wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt. Damit kamen in etwa so viele Kinder zu
Schaden wie im Jahr 2023 (27 240).
Die
Zahl der getöteten Kinder stieg 2024 gegenüber
2023 von 44 auf 53. Nach einem deutlichen
Rückgang während der Corona-Pandemie in den
Jahren 2020 und 2021 war die Zahl der bei
Verkehrsunfällen verletzten und getöteten Kinder
2022 und 2023 wieder gestiegen.
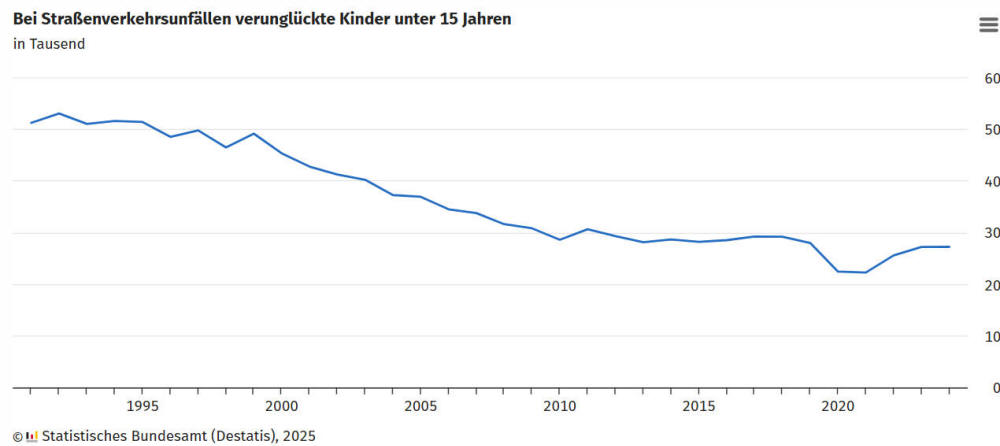
Ältere Kinder verunglücken besonders
häufig morgens auf dem Schulweg
Die
6- bis 14-Jährigen verunglücken montags bis
freitags besonders häufig in der Zeit von 7 bis
8 Uhr im Straßenverkehr. Dies ist die übliche
Zeit, zu der sich die Kinder auf dem Weg zur
Schule befinden. In dieser Zeit wurden im
vergangenen Jahr 13 % der verunglückten 21 870
Kinder im entsprechenden Alter verletzt oder
getötet.
In den folgenden Stunden bis 13
Uhr sind die Unfallzahlen niedriger. Montags bis
freitags in den Zeiten von 15 bis 16 Uhr sowie
16 bis 17 Uhr erreichen sie mit einem Anteil von
je 9 % den nächsthöchsten Wert. Jüngere Kinder
verunglücken am häufigsten im Auto, ältere
Kinder auf dem Fahrrad Die meisten Kinder, die
2024 im Straßenverkehr verunglückten, waren mit
dem Auto unterwegs (35 %). 33 % saßen auf einem
Fahrrad und 21 % gingen zu Fuß, als der Unfall
passierte.
Betrachtet man jedoch
verschiedene Altersgruppen, ergibt sich ein
differenzierteres Bild: Unter 6-Jährige sind
besonders häufig im Auto mit betreuenden
Erwachsenen unterwegs, demzufolge verunglücken
sie hier am häufigsten (58 % im Jahr 2024).
Schulkinder bewegen sich mit zunehmendem Alter
selbstständig im Straßenverkehr – entsprechend
steigt der Anteil der Radfahrenden und
Fußgängerinnen und -gänger unter den
Verunglückten. 6- bis 14-Jährige verunglückten
am häufigsten auf ihrem Fahrrad (38 %), 29 % in
einem Auto sowie 20 % zu Fuß.
Schulweg: Sicherheit vor
Schnelligkeit
· Website
informiert über Gefahrenstellen auf Schulweg
· Haftungsprivileg für Kinder
· Autofahrer
müssen aufpassen: Fuß vom Gas
Die
Sommerferien sind in einigen Bundesländern schon
vorbei. Zigtausende Kinder und Jugendliche
machen sich wieder auf den Schulweg. Klar ist,
der Verkehr erfordert volle Aufmerksamkeit. Das
spiegelt sich seit Jahren in den Zahlen des
Statistischen Bundesamtes wider: Kinder
verunglücken besonders häufig am frühen Morgen,
zwischen 7 und 8 Uhr, sowie ab Mittag, wenn die
Schule aus ist.

Nicht immer ist der kürzeste Weg der sicherste.
Auf dem Schulweg auf dem Schulweg zählt vor
allem Sicherheit. Foto: HUK-COBURG
Der
Weg zur Schule sollte also nicht der kürzeste,
sondern der sicherste sein. Ein kleiner Umweg
kann sich lohnen, wenn dafür Ampeln oder
Schülerlotsen das Überqueren der Straße sicherer
machen. Doch welches ist der sicherste Weg?
Eltern können eigene Erfahrung auf der Seite
https://www.schulwege.de/ faktenbasiert noch
einmal gegenchecken: Hier lässt sich eine
möglichst sichere Route auf Basis bekannter
gefährlicher Bereiche berechnen.
Einen
Teil der Daten zur Erkennung der Gefahrenstellen
liefert die HUK-COBURG an die „Initiative für
sichere Straßen“, Betreiber des
Schulweg-Portals. Basis ist der Telematik-Tarif
des Versicherers, den fast 700.000 Kunden
nutzen. In aggregierter und anonymisierter Form
geben diese Daten Hinweise auf Gefahrenstellen
im Verkehr. Weitere Daten, die in die Berechnung
einfließen, sind u.a. die polizeilichen
Unfalldaten sowie Meldungen von
Verkehrsteilnehmern.
Eltern von
ABC-Schützen rät die HUK-COBURG, die Route
zusammen mit ihren Kindern zu planen und
mehrfach abzulaufen. Wichtig ist auch, dass ein
Kind mit ausreichendem Abstand zum fließenden
Verkehr am Bordstein stehen bleibt. Und vor der
Straßenüberquerung sollten Kinder immer den
Blickkontakt zum Autofahrer suchen. Richtig üben
lässt sich nur unter realen Bedingungen: Also
morgens, wenn die Schule beginnt und mittags,
wenn sie endet.
Doch der Gesetzgeber
weiß, dass Kinder von der Komplexität des
motorisierten Straßenverkehrs oft überfordert
sind. Dies gilt besonders für die Einschätzung
von Geschwindigkeiten und Entfernungen. Darum
haften Kinder für Schäden, die sie Dritten bei
einem Verkehrsunfall fahrlässig zufügen, erst ab
ihrem zehnten Geburtstag. Das hat für Autofahrer
weitreichende Konsequenzen.
Werden sie
in einen Unfall mit einem nicht-deliktsfähigen
Kind verwickelt, haften sie unabhängig von der
Schuldfrage. Autofahrer müssen also stets damit
rechnen, dass Kinder sich im Straßenverkehr
nicht regelkonform verhalten. Ein Kind sehen,
heißt vorsichtig fahren, beide Straßenseiten im
Auge behalten und jederzeit bremsbereit sein.
Dies gilt in besonderem Maße in
verkehrsberuhigten Zonen sowie vor Kindergärten
und Schulen.
Ob ältere Kinder über zehn
Jahren tatsächlich für einen Unfall und seine
Folgen einstehen müssen, hängt von ihrer
Einsichtsfähigkeit ab. Entscheidend ist, ob sie
die eigene Verantwortung und die Konsequenzen
ihrer Handlungen richtig einschätzen können.
Gleichzeitig kommt es auf das individuelle
Verschulden in der konkreten Situation an und
auf die Frage, ob von einem Kind dieses Alters
korrektes Verhalten überhaupt erwartet werden
konnte.
Lautet die Antwort ja, müssen
aber auch Kinder für sämtliche
Haftpflichtansprüche ihres Opfers aufkommen.
Sobald das Kind selbst Geld verdient, muss es
zahlen. Haben die Eltern ihre Aufsichtspflicht
verletzt, können auch sie zur Kasse gebeten
werden. Schutz bietet in beiden Fällen eine
private Haftpflichtversicherung.
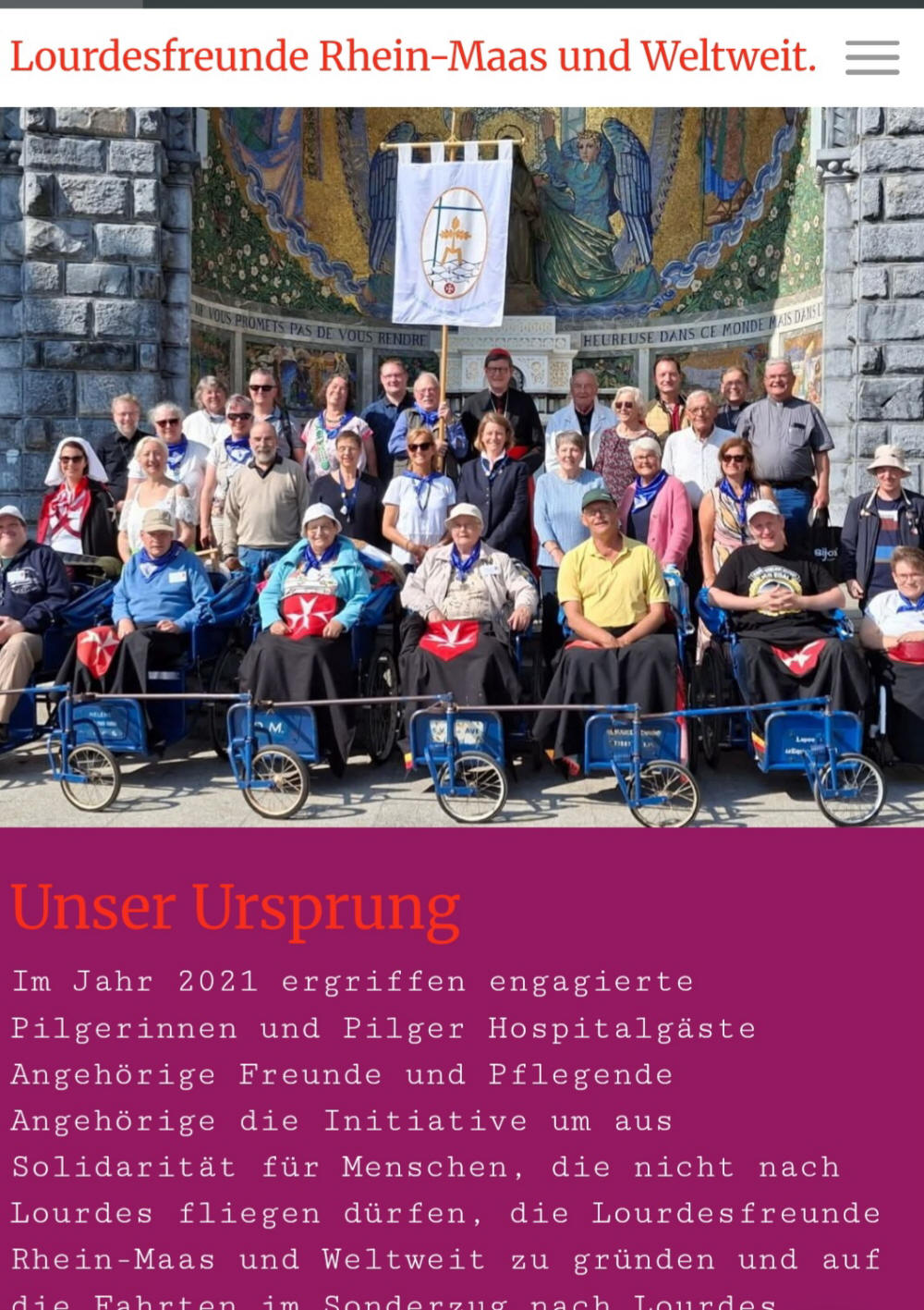
Dinslaken: Einladung: Live-Abstimmung über
Projekte "Demokratie in Aktion" - Am 26. August
findet die Live-Abstimmung statt.
Zum Auftakt der dritten Förderphase des
Bundesprojekts „Demokratie leben“ lädt die
Stadtverwaltung alle Dinslakenerinnen und
Dinslakener herzlich zum Eröffnungstreffen
„Demokratie in Aktion!“ am 26.08.2025 ab 17 Uhr
in den Innenhof des Rathauses,
Willi-Dittgen-Steige, ein.

Der letzte Ferientag wird zeigen, wie lebendig
und engagiert Demokratie in Dinslaken gelebt
wird. „Demokratie bedeutet Mitbestimmung –Sie
können bei dem Treffen aktiv über wichtige
Projekte für unsere Stadt abstimmen. Beteiligung
ist wichtig, denn sie wahrt die Demokratie, die
aktuell weltweit bedroht wird.
Nutzen
Sie Ihr Stimmrecht und machen Sie mit. Nur so
bleibt unser Dinslaken auch weiterhin ein Ort
des Respekts, der Vielfalt und des
Zusammenhalts. Ich freue mich auf Ihr Engagement
– alle sind aufgerufen mitzumachen“, so
Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.
Projekte, über die am 26. August live abgestimmt
werden kann, sind beispielsweise ein großes
Mitsing-Konzert "SING2GETHER - Jede Stimme
zählt", das eine Live-Band, lokale Chöre und das
Publikum in einem immersiven Konzert- und
Gemeinschaftserlebnis vereinen wird oder ein
Kunstprojekt für Schulen, bei dem der abstrakte
Begriff der Demokratie unter kunstpädagogischer
Begleitung ganz konkrete Formen annehmen darf.
In ungezwungener Atmosphäre wird es im
Burginnenhof solch ein Zusammenkommen geben.
Erste Projektanträge, die über das
Bundesprogramm gefördert werden sollen, werden
vorgestellt. Das Besondere an diesem Tag ist:
alle Anwesenden werden zur Jury und können live
über die Bewilligung der Anträge mitentscheiden.
Die Abstimmung erfolgt per Smartphone
oder Handzeichen. Wer die Arbeit von „Tolerantes
Dinslaken“ aus der Vergangenheit kennt, kann
sich gerne wieder einbringen und Erfahrungen
austauschen, wer neu dazukommen möchte, ist
herzlich dazu eingeladen sich zu beteiligen.
Für das zukünftig dauerhafte
Demokratiebündnis, das über Anträge diskutiert
und abstimmt, kann man sich vor Ort bewerben. Es
handelt sich um ein wichtiges Ehrenamt mit dem
man seine Stadt aktiv mitgestalten kann. Ein
buntes Rahmenprogramm rundet die Veranstaltung
ab.
Musikalisch begleitet wird die
Veranstaltung vom Butterwegge. Seit zehn Jahren
bewegt er sich zwischen Punk und Folk mit einer
klaren Haltung gegen Ausgrenzung und Rassismus.
Mit Band oder Solo spielt er in ganz Deutschland
und auf Festivals wie dem Ruhrpott Rodeo und
Punk im Pott. Es gibt Getränke und Popcorn.
Das Kinder- und Jugendparlament ist mit
einem Mini-Kiosk vor Ort und verteilt gemischte
Tüten. Mit dem Programm Demokratie leben fördert
das Bundesministerium für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
zivilgesellschaftliches Engagement auf allen
Ebenen des Staates für ein vielfältiges und
demokratisches Miteinander sowie die Arbeit
gegen Radikalisierungen und Polarisierungen in
der Gesellschaft. Weitere Infos unter tolerantes-dinslaken.de
Aktion Mensch-Umfrage: Mehrheit der
Menschen mit Behinderung wurde in den letzten
Jahren diskriminiert - Angst vor negativen
Folgen, wenn sie sich wehren
Nach Diskriminierungserfahrung: Mehr als ein
Drittel der Menschen mit Behinderung plagen
Selbstzweifel, fast jede*r Vierte begibt sich in
soziale Isolation
77 Prozent sind sich
sicher: In Deutschland wird nicht genug gegen
Diskriminierung getan – Bildung und härtere
Strafen als Lösungsansätze
Aktion Mensch
appelliert: Diskriminierungsfreies Miteinander
ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Sechs
von zehn Menschen mit Behinderung wurden in den
letzten fünf Jahren in unterschiedlichen
Alltagssituationen diskriminiert – am häufigsten
im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz oder im
Gesundheitssystem. Für mehr als ein Viertel von
ihnen ist Diskriminierung sogar ein ständiges
Problem. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt
eine aktuelle bundesweite Online-Umfrage, die
die Sozialorganisation Aktion Mensch heute
veröffentlicht hat.
Die
Befragungsergebnisse zeigen weitreichende Folgen
für die Betroffenen auf: Knapp die Hälfte aller,
die in den letzten Jahren mit Diskriminierung
konfrontiert waren, hat im Anschluss ähnliche
Situationen vermieden, um einer erneuten
Benachteiligung zu entgehen. 27 Prozent der
Befragten haben als Konsequenz zudem nur noch
Orte aufgesucht, an denen sie nicht
diskriminiert werden.
Auch das
Selbstbewusstsein und der Selbstwert leiden
unter der Herabwürdigung: Über ein Drittel gibt
an, nach ihrer Diskriminierungserfahrung gedacht
zu haben, nicht gut genug zu sein und jeweils
fast ein Viertel zog sich sozial zurück oder gab
sich selbst die Schuld – ein Beweis für die
tiefgreifenden psychologischen Auswirkungen, die
Diskriminierung haben kann.
Diskriminierung über alle Lebensbereiche hinweg
Am häufigsten haben die befragten Menschen mit
Behinderung Diskriminierung demnach in der
Öffentlichkeit (29 Prozent) erlebt, am
Arbeitsplatz (24 Prozent) oder im
Gesundheitssystem (23 Prozent). Ihre Erfahrungen
– in durchweg allen Lebensbereichen negativer
als die der Allgemeinbevölkerung – reichen von
unfairer Behandlung und schlechteren Chancen
über diskriminierende Sprache bis hin zu
fehlender Barrierefreiheit, die ihnen eine
gleichberechtigte Teilhabe im Alltag verwehren.
Jede*r Zehnte verweist zudem auf negative
Erfahrungen im Internet; meistgenannt hier:
beleidigende oder herabwürdigende Nachrichten.
Gefühl der Ohnmacht und Informationsdefizit
Besonders erschreckend ist, dass 41 Prozent der
Befragten nicht wissen, wie sie sich gegen
Diskriminierung wehren können. Viele von ihnen
wurden im Anschluss an ihre Ungleichbehandlung
daher nicht tätig – zum einen, weil sie glauben,
dass es nichts nützt, zum anderen aber auch aus
Angst, noch mehr Probleme zu bekommen oder weil
ihnen nicht klar ist, an wen sie sich wenden
können.
Dazu passt, dass bereits
bestehende unterstützende Maßnahmen nicht
ausreichend bekannt sind. So kennt rund ein
Drittel der Befragten weder das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz noch die
Antidiskriminierungs- oder Ombudsstellen und
etwa die Hälfte hat noch nie von Meldestellen
gegen Diskriminierung gehört. Als Lösungsansätze
erachtet die Mehrheit der befragten Menschen mit
Behinderung Bildungsinitiativen gegen
Diskriminierung (57 Prozent), den Abbau von
Barrieren (52 Prozent) sowie härtere Strafen und
eine bessere Anwendung von entsprechenden
Gesetzen (50 Prozent).
„Die Ergebnisse
unserer Befragung sind besorgniserregend. Sie
zeigen, dass Diskriminierung für Menschen mit
Behinderung Teil des Alltags ist – und das auf
persönlicher wie auch auf struktureller Ebene.
Wollen wir so als Gesellschaft zusammenleben?
Als Aktion Mensch lautet unsere entschiedene
Antwort: Nein. Für ein gleichberechtigtes und
diskriminierungsfreies Miteinander sind alle
gefragt: Staat, Gesellschaft und jede*r
Einzelne“, kommentiert Christina Marx,
Sprecherin der Sozialorganisation.
Neue
Studie: Bürgergeld: Einkommen bei
Mindestlohnbeschäftigung deutlich höher als mit
Grundsicherung – Zahlen zu allen Landkreisen und
Städten
Auch wer zum Mindestlohn
arbeitet, hat ein deutlich höheres verfügbares
Einkommen als vergleichbare Personen, die
Bürgergeld beziehen. Das gilt überall in
Deutschland und unabhängig von der
Haushaltskonstellation. Im deutschen
Durchschnitt liegt der Einkommensvorteil bei 557
Euro monatlich im Falle einer alleinstehenden
Person, die Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet.
Eine alleinerziehende Person mit einem
Kind hat bei Vollzeitbeschäftigung zum
Mindestlohn 749 Euro mehr zur Verfügung als bei
Bürgergeldbezug. Bei einer Paarfamilie mit zwei
Kindern und einer oder einem in Vollzeit zum
Mindestlohn Beschäftigten beträgt der Vorteil
660 Euro. In Ostdeutschland inklusive Berlin ist
der Lohnabstand etwas größer als im Westen. Bei
einer alleinstehenden Person sind es
beispielsweise durchschnittlich 570 Euro im
Osten gegenüber 549 Euro im Westen.
Regional unterscheidet sich der Umfang des
Einkommensvorteils bei Beschäftigung ebenfalls,
in vielen Städten und Landkreisen sind die
Unterschiede zum Bundesdurchschnitt nach oben
oder unten dabei eher moderat. Im regionalen
Vergleich am kleinsten ist der Lohnabstand zum
Bürgergeldbezug in Orten mit sehr hohen Mieten
wie z.B. in München und seinem Umland oder
Hamburg. Das zeigt eine neue Studie des
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Sie
liefert auch detaillierte regionale Daten für
alle 400 deutschen Landkreise und kreisfreien
Städte (siehe Tabelle im Anhang der Studie; Link
unten).*
Dass überall in Deutschland ein
deutlicher Lohnabstand zwischen einer
Vollzeitbeschäftigung zum Mindestlohn und
Bürgergeld besteht, ist auch eine Folge
entsprechend gestalteter Sozialleistungen, zeigt
die Untersuchung des WSI: Erstens gibt es mit
Wohngeld, Kindergeld und Kinderzuschlag
Leistungen, die verhindern sollen, dass
Menschen, die in Beschäftigung stehen, überhaupt
auf die Grundsicherung angewiesen sind. Zweitens
stellen die Hinzuverdienstregelungen im
Sozialgesetzbuch II sicher, dass auch Menschen,
die Bürgergeld beziehen, bei Erwerbstätigkeit
stets mehr Einkommen zur Verfügung haben als
ohne eine Beschäftigung.
„Aktuell steht
das Bürgergeld wieder im Zentrum einer oft
polemisch geführten Debatte. Eine häufig gehörte
Unterstellung ist, dass es sich für
Bezieher*innen von Bürgergeld nicht lohne,
erwerbstätig zu sein, weil das Bürgergeld zu
hoch sei. Die Zahlen dieser Studie zeigen
erneut, dass Bürgergeldempfänger*innen
unabhängig vom Haushaltstyp und von der Region,
in der sie wohnen, weniger Geld haben als
Erwerbstätige, die zum Mindestlohn arbeiten“,
sagt Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, die
wissenschaftliche Direktorin des WSI.
„In Regionen, in denen der Abstand geringer ist,
liegt dies an den Mieten, die in einigen
Gegenden extrem hoch sind. Das verweist auf ein
Feld, auf dem es im Gegensatz zum Niveau des
Bürgergelds tatsächlich dringend politischen
Handlungsbedarf gibt: Die Schaffung bezahlbaren
Wohnraums, die sowohl die Staatskasse als auch
die unteren Einkommen entlasten würde.“
Der erhebliche Abstand zwischen Bürgergeld und
Mindestlohnbeschäftigung mache auch klar, mit
wie wenig Geld Bürgeldempfänger*innen auskommen
müssen, betont die Soziologin. „Die Behauptung,
sie wollten nicht erwerbstätig sein, weil sich
mit dem Bürgergeld gut leben lasse, ist sachlich
falsch und stigmatisierend. Das ist das letzte,
was Bürgergeldempfänger*innen brauchen. Und es
hilft auch nicht bei der gesellschaftlichen
Problemlösung, weil es von wirksamen
Lösungsansätzen ablenkt.“
Tatsächlich
helfen würde Qualifizierung von erwerbsfähigen
Menschen im Bürgergeldbezug, gute Betreuung „und
in vielen Fällen Entlastung von sehr zeit- und
kraftintensiver Sorgearbeit, wie der Pflege von
Kranken und alten Angehörigen oder der Betreuung
von Kindern“, analysiert Kohlrausch. „Statt
Menschen mit niedrigen Erwerbseinkommen und
Bürgergeldempfänger*innen gegeneinander
auszuspielen, ist es Zeit, diese
arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen
endlich zu adressieren.“
Im Rahmen der
Analyse hat WSI-Forscher Dr. Eric Seils für drei
typische Haushaltskonstellationen
Modellrechnungen auf Basis des
„WSI-Steuer-/Transfermodells“ durchgeführt, das
alle relevanten Abgaben, das Bürgergeld sowie
weitere Sozialleistungen umfasst. Regionale
Daten zu den laufenden anerkannten Kosten der
Unterkunft wurden der SGB-II-Statistik der
Bundesagentur für Arbeit entnommen.
Den
Berechnungen zufolge kommt eine alleinstehende
Person, die 38,19 Stunden pro Woche zum
Mindestlohn arbeitet – was der
durchschnittlichen betriebsüblichen
Vollarbeitszeit entspricht –, auf einen
Bruttomonatslohn von 2121,58 Euro. Davon bleiben
nach Abzug von Einkommenssteuer und
Sozialversicherungsbeiträgen 1546 Euro.
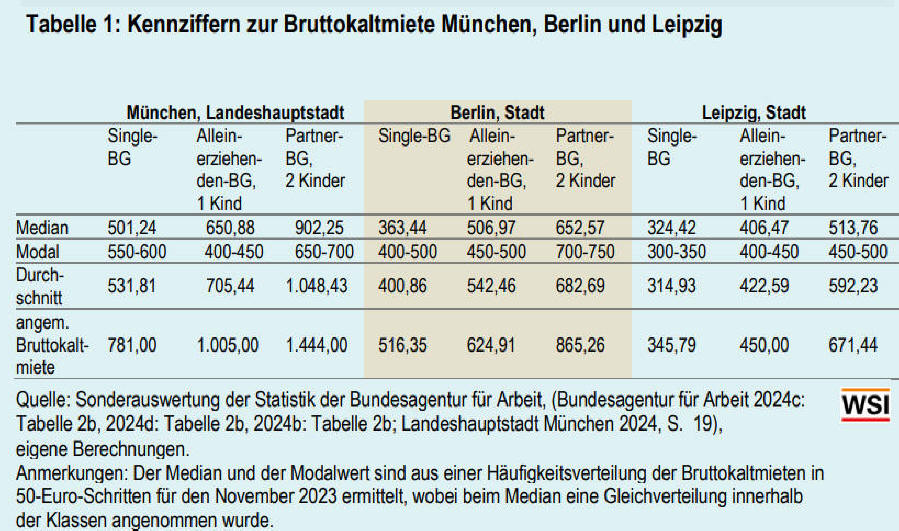
Zusammen mit 26 Euro Wohngeld, auf die im
Beispielfall im Bundesdurchschnitt Anspruch
besteht, ergibt sich ein verfügbares Einkommen
in Höhe von 1572 Euro. Wenn die Person
Bürgergeld bezieht, stehen ihr 563 Euro
Regelbedarf und bei gleicher Miete 451,73 Euro
für die Unterkunft, also in Summe 1015 Euro zu.
Der Lohnabstand beträgt damit 557 Euro. Auch
wenn man davon noch den Rundfunkbeitrag von
18,36 Euro abzieht, bleibt eine Differenz von
deutlich über 500 Euro.
Bei einer
alleinstehenden Person mit fünfjährigem Kind
ergibt sich bei gleicher Arbeitszeit ein
Nettolohn von 1636 Euro. Mitsamt Kindergeld,
Kinderzuschlag, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss
beträgt das verfügbare Einkommen 2532 Euro. Im
Falle von Bürgergeldbezug summieren sich die
beiden Regelsätze, der Mehrbedarf für
Alleinerziehende, die Kosten der Unterkunft und
der Sofortzuschlag auf 1783 Euro, was einem
Lohnabstand von 749 Euro entspricht.
Ein
Ehepaar mit zwei Kindern im Alter von fünf und
14 Jahren und einer Person als
Alleinverdiener*in kommt netto auf ein
Arbeitseinkommen von 1682 Euro, das verfügbare
Einkommen inklusive Kindergeld, Kinderzuschlag
und Wohngeld beträgt hier 3414 Euro.
Bürgergeld-Regelsätze, Kosten der Unterkunft und
Sofortzuschläge machen zusammen 2754 Euro aus,
also 660 Euro weniger.
Regionale
Abweichungen beruhen auf Unterschieden bei den
Mietkosten: Im Landkreis München, in Dachau und
in der Stadt München fällt der Lohnabstand
beispielsweise bei einem Single-Haushalt mit
379, 438 bzw. 444 Euro am geringsten aus, in
Nordhausen und dem Vogtlandkreis mit 662 bzw.
652 Euro am größten.
Sauna-Sommerevent „On the Beach“: Der
Saunatreff im August im Freizeitbad
Neukirchen-Vluyn
Sommer und
Sauna, auch das passt gut zusammen. Deswegen
lädt die ENNI Sport & Bäder Niederrhein (Enni)
auch im August wieder zu einem der beliebten
Saunatreffs ins Freizeitbad Neukirchen-Vluyn
ein. Am Samstag, 23. August, steigt das
Sauna-Sommer-event unter dem Motto „On the
Beach“. Neben den Aufgüssen zum sommerlichen
Schwitzen können sich die Gäste im Sauna-Garten
auf Leckereien vom Grill einstellen.
In den Saunen gibt es den ganzen Abend hinweg
sommergerechte Aufguss-Zeremonien. Gemäß dem
Motto geht es entsprechend exotisch zu: Litschi,
Orange, Mandarine, Zitrone und tropische
Kokosnuss stehen auf dem Aufgussplan. Hinzu
kommen Honig, Grüner Apfel und Eukalyptus. Tinto
de Verano oder Eistee runden einige der
Saunagänge ab.
Die Veranstaltung
beginnt wie gewohnt um 18 Uhr und dauert bis
Mitternacht. Die Besucher können das gesamte
Freizeitbad Neukirchen-Vluyn an den
Saunatreff-Abend ausschließlich textilfrei
nutzen. Weitere Informationen – auch zu den
Eintrittspreisen – gibt es unter
www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de.

Großhandelspreise im Juli 2025: +0,5
% gegenüber Juli 2024
Großhandelsverkaufspreise, Juli 2025 +0,5 % zum
Vorjahresmonat -0,1 % zum Vormonat
Die
Verkaufspreise im Großhandel waren im Juli 2025
um 0,5 % höher als im Juli 2024. Im Juni 2025
hatte die Veränderungsrate gegenüber dem
Vorjahresmonat bei +0,9 % gelegen, im Mai 2025
bei +0,4 %. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, fielen die
Großhandelspreise im Juli 2025 gegenüber dem
Vormonat Juni 2025 geringfügig um 0,1 %.
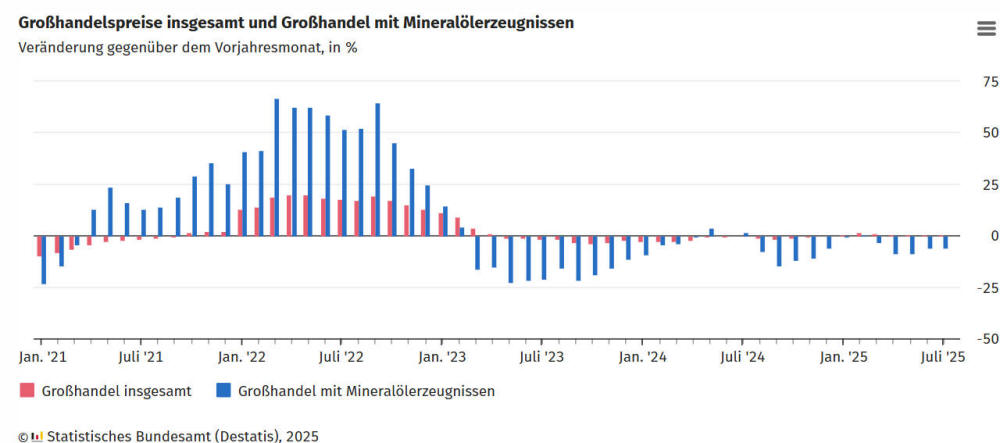
Gestiegene Preise für Nahrungs- und
Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie für
Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und
Nicht-Eisen-Metallhalbzeug Hauptursächlich für
den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt
gegenüber dem Vorjahresmonat war im Juli 2025
der Preisanstieg bei Nahrungs- und
Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Die
Preise lagen hier im Durchschnitt 3,5 % über
denen von Juli 2024 (-0,6 % gegenüber Juni
2025).
Insbesondere Kaffee, Tee, Kakao
und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich
teurer als ein Jahr zuvor (+16,0 %), gegenüber
Juni 2025 sanken die Preise aber um 6,2 %.
Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten
ebenfalls mehr als im Vorjahresmonat (+15,0 %)
und verteuerten sich auch im Vormonatsvergleich
(+0,8 ). Ebenfalls merklich mehr bezahlt werden
musste binnen Jahresfrist für Fleisch und
Fleischwaren (+9,4 %), lebende Tiere (+8,4 %)
sowie für Milch, Milcherzeugnisse, Eier,
Speiseöle und Nahrungsfette (+7,3 %).
Gegenüber Juni 2025 wurden die Produkte hier
billiger: lebende Tiere um 2,4 %, Milch,
Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und
Nahrungsfette um 0,4 % und Fleisch und
Fleischwaren um 0,1 %. Einen deutlichen Anstieg
der Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es
auch im Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen,
Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus
(+17,6 %). Sie sanken aber gegenüber Juni 2025
um 1,5 %.
Niedriger als im Juli 2024
waren dagegen die Preise im Großhandel mit
festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
(-5,7 %). Gegenüber Juni 2025 musste hier aber
2,0 % mehr bezahlt werden. Ebenfalls günstiger
im Vorjahresvergleich waren auf Großhandelsebene
Altmaterial- und Reststoffe (-9,0 %). Gegenüber
Juni 2025 wurden sie ebenfalls billiger
(-2,4 %).
Niedrigere Preise gegenüber
dem Vorjahresmonat und Vormonat gab es auch im
Großhandel mit Eisen, Stahl und Halbzeug daraus
(-5,6 % gegenüber Juli 2024; -0,2 % gegenüber
Juni 2025) sowie mit Datenverarbeitungs- und
peripheren Geräten (-4,8 % gegenüber Juli 2024;
-0,3 % gegenüber Juni 2025).
4 %
mehr Promovierende im Jahr 2024
•
212 400 Promovierende an deutschen Hochschulen
• 28 % strebten im Jahr 2024 ihren
Doktorgrad in Humanmedizin/
Gesundheitswissenschaften an
• Frauenanteil
an den Promovierenden bei 49 %
Im Jahr
2024 befanden sich an den Hochschulen in
Deutschland 212 400 Personen in einem laufenden
Promotionsverfahren. Das waren 7 500 oder 4 %
Promovierende mehr als im Jahr 2023. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, blieb der Frauenanteil an den
Promovierenden mit 49 % (103 500) fast
unverändert gegenüber dem Vorjahr (48 %).
Über ein Viertel promoviert in
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften
Mit
60 300 Personen strebte im Jahr 2024 gut ein
Viertel (28 %) der Promovierenden ihren
Doktorgrad in der Fächergruppe
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an. Die
zweitgrößte Gruppe bildeten die Promovierenden
in der Fächergruppe Mathematik,
Naturwissenschaften mit 47 700 Personen (22 %)
gefolgt von den Ingenieurwissenschaften mit
39 200 Promovierenden (18 %) und den Rechts-,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit
33 300 Promovierenden (16 %).
In den
einzelnen Fächergruppen zeigten sich deutliche
Unterschiede in der Geschlechterverteilung. So
waren etwa drei von vier Promovierenden (77 %)
in der Fächergruppe Ingenieurwissenschaften
Männer, während in der Fächergruppen Kunst,
Kunstwissenschaft zwei von drei Promovierenden
(67 %) Frauen waren.
In absoluten Zahlen
promovierten Männer am häufigsten in den
Ingenieurwissenschaften (30 000), Frauen in der
Fächergruppe
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (37 400).
16 % der Promovierenden haben 2024 mit
der Promotion begonnen
Im Jahr 2024 waren
34 700 Personen (16 % aller Promovierenden)
erstmalig als Promovierende an einer deutschen
Hochschule registriert. Das waren 8 % mehr als
im Vorjahr.
Mit 9 500 Personen hatte gut
ein Viertel (27 %) der Promotionsanfängerinnen
und -anfänger des Jahres 2024 eine ausländische
Staatsangehörigkeit. Damit lag der
Ausländeranteil bei den Promotionsanfängerinnen
und -anfängern etwas höher als bei den
Promovierenden insgesamt (25 %).
17 %
der Promovierenden verteilen sich auf vier
Hochschulen Im Jahr 2024 entfielen 17 % aller
Promovierenden auf lediglich vier Hochschulen.
Mit 9 700 Personen (5 % der Promovierenden) war
die Ludwig-Maximilians-Universität München die
Hochschule mit den meisten laufenden
Promotionsvorhaben, gefolgt von der Technischen
Universität München (9 400 Personen), der
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
(9 300 Personen) und der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen (7 900 Personen)
mit jeweils 4 % aller Promovierenden.
|