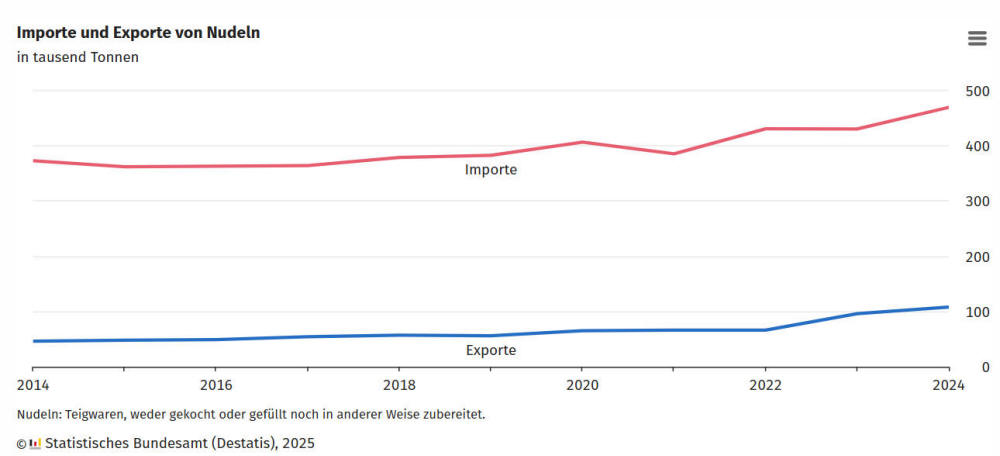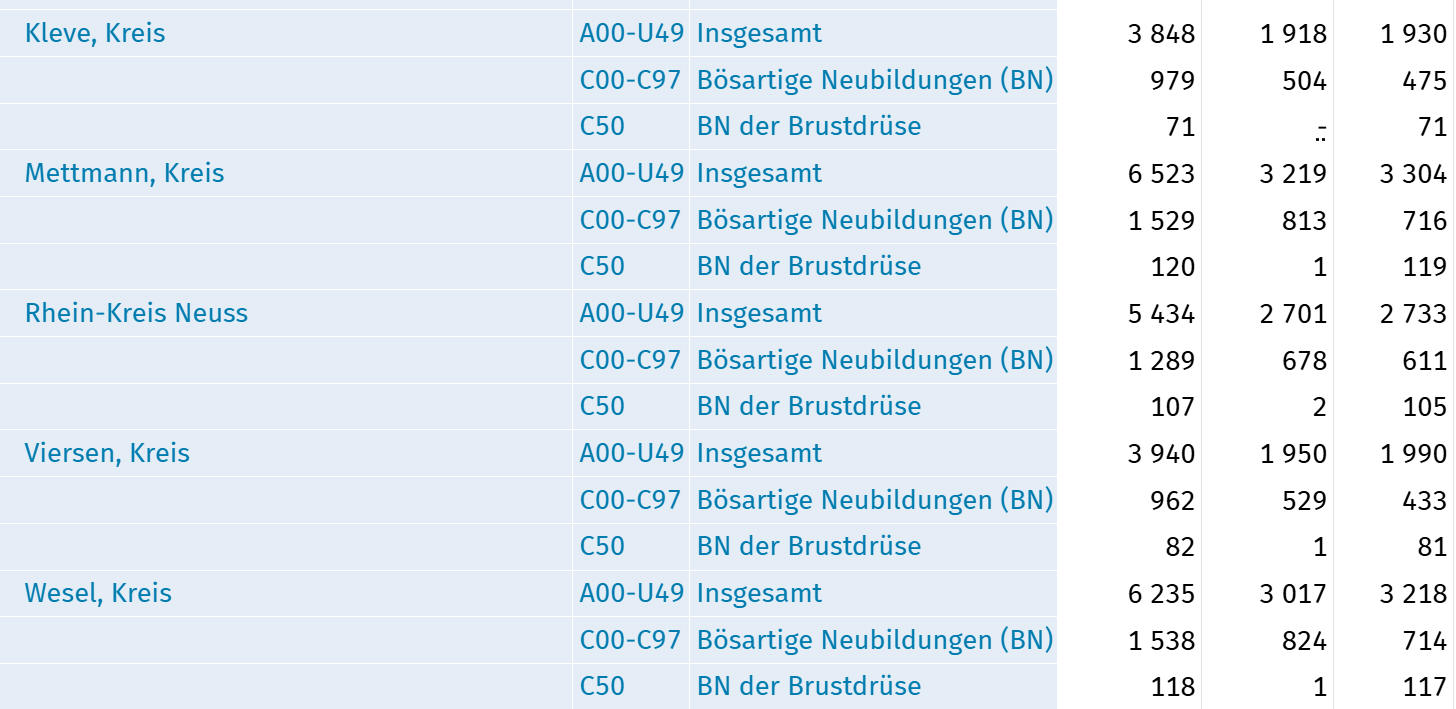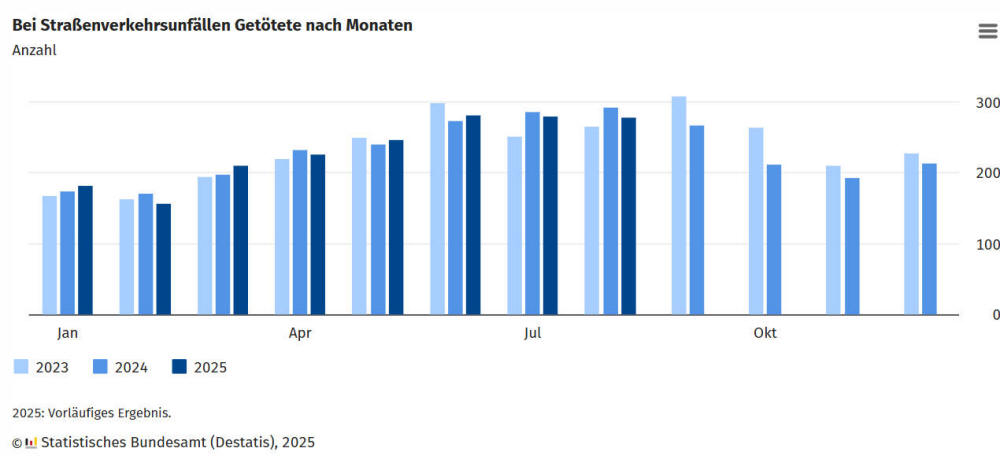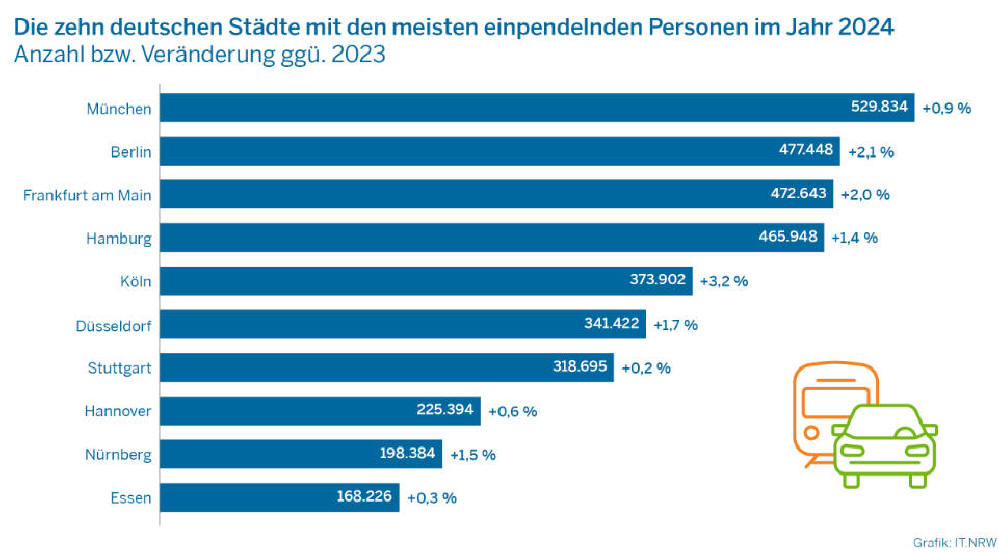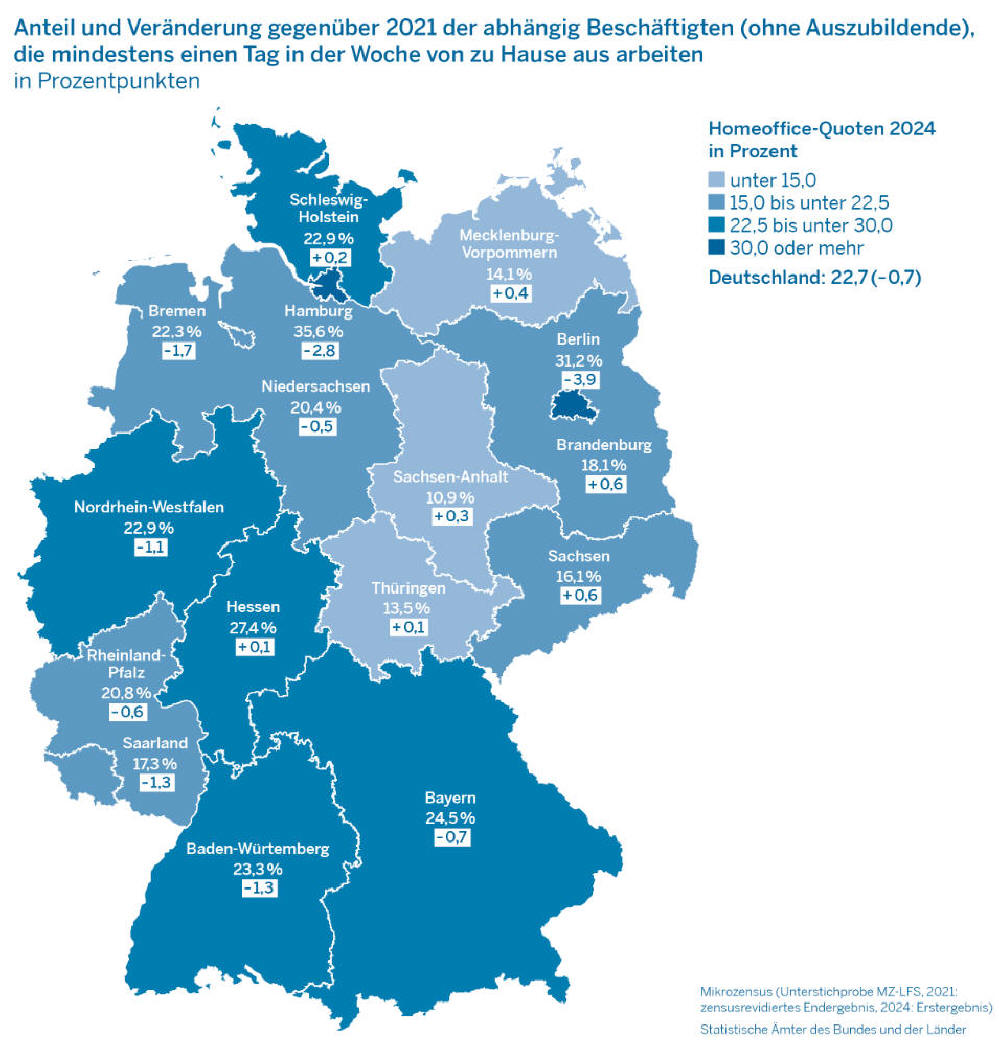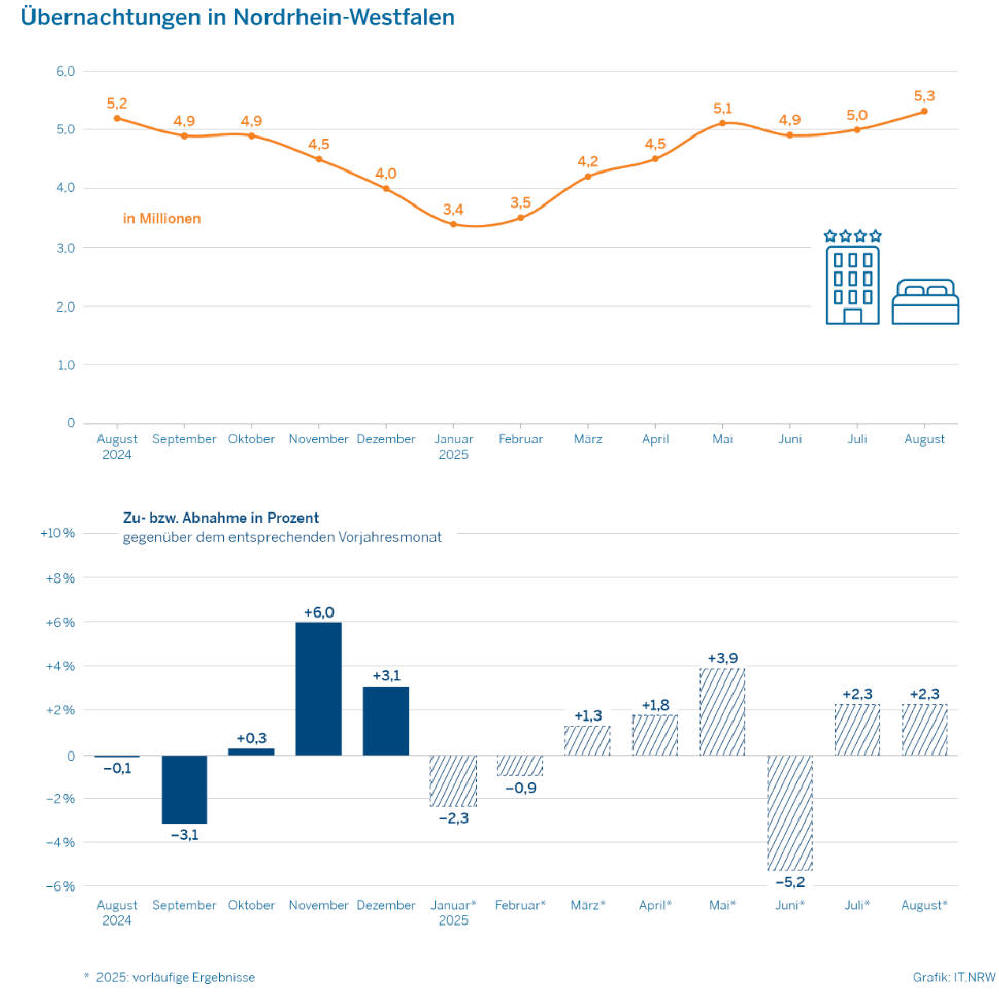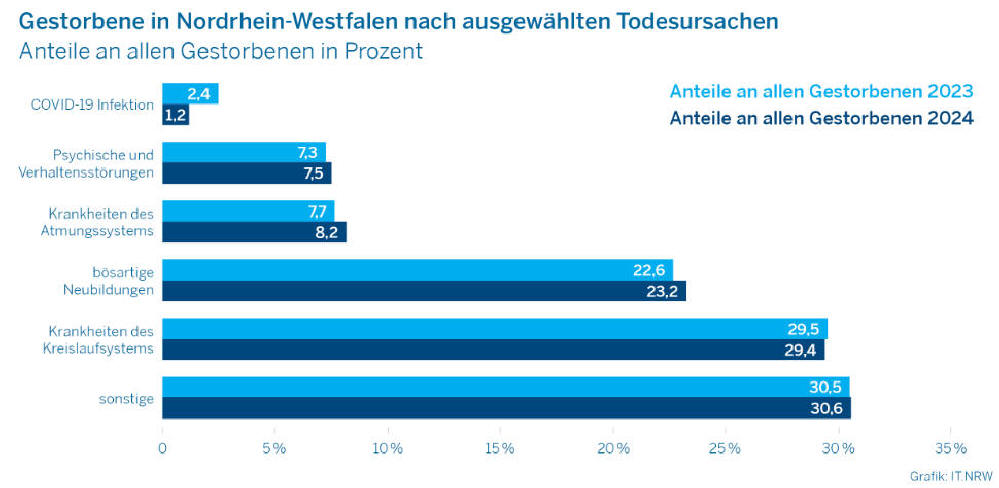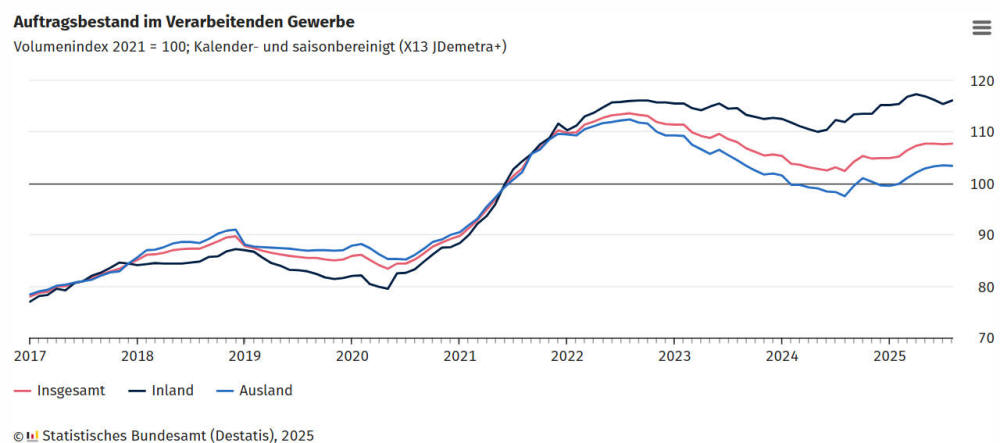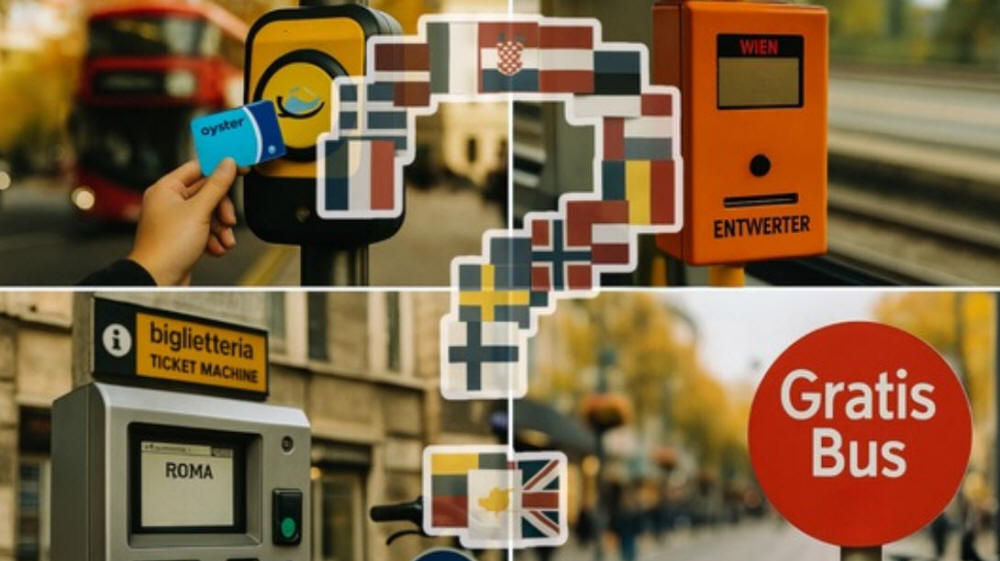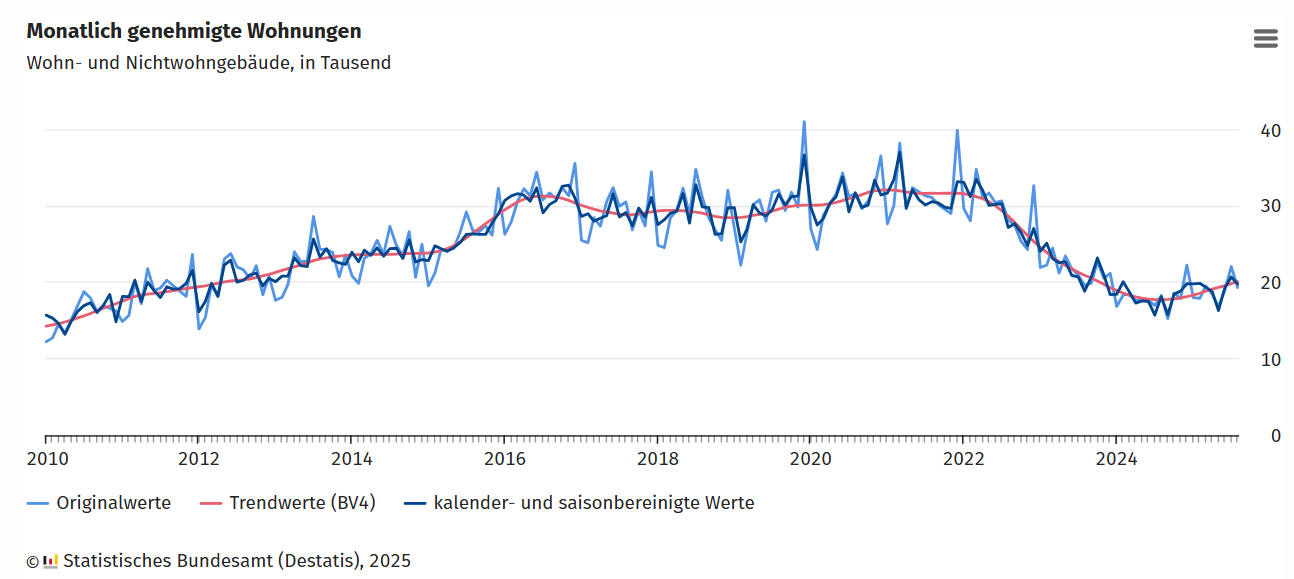|
KW 43: Montag 20. Oktober - Sonntag, 26. Oktober
2025
Themen u.a.:
Geflügelpest in
Rees bestätigt, Überwachungszone im Kreis Wesel
Gestern hat das Friedrich-Löffler-Institut (FLI)
den Verdacht des Ausbruchs der Geflügelpest in
einem Putenbetrieb in Rees im Kreis Kleve
bestätigt. Festgestellt wurde der Virustyp
H5N1. Für den Virustpen sind alle Vögel
empfänglich. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht
von dem Virustyp keine Gefahr für Menschen und
andere Säugetiere aus. Das FLI beobachtet die
Entwicklung intensiv.
Um den
betroffenen Betrieb werden eine Schutz- und
Überwachungszone eingerichtet. Die
Überwachungszone mit einem Radius von zehn
Kilometern reicht bis in den Kreis Wesel und
betrifft Teile von Hamminkeln und Xanten. In der
Überwachungszone gilt ab dem 24. Oktober 2025
eine Aufstallungspflicht für gehaltenes
Geflügel.
Als Aufstallung gilt eine
Haltung in geschlossenen Ställen oder unter
einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden,
nach oben gegen Einträge gesicherten dichten
Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von
Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen
muss. Wildvögel dürfen keinen Zugang zu
Futter-,Tränke- und Badestellen haben.
Zudem dürfen gehaltene Vögel weder in einen
tierhaltenden Betrieb hinein- noch
hinausgebracht werden. In der Zone ist die
Durchführung von Geflügelausstellungen,
Geflügelmärkten oder Veranstaltungen ähnlicher
Art verboten. Es gibt weitere Beschränkungen für
das Verbringen von Eiern und Fleisch. Die
Überwachungszone wird mit einer
Allgemeinverfügung vom heutigen Tag angeordnet
und tritt am 25.10.2025 um 0 Uhr in Kraft.
Sie ist im Amtsblatt des Kreises
veröffentlicht und unter folgendem Link
einzusehen: https://www.kreis-wesel.de/system/files/2025-10/241025%20Amtsblatt%20Nummer%2047.pdf
Die festgelegten Zonen können im
Internet unter dem folgendem Link als
interaktive Karte eingesehen werden:
https://visualgeoserver.fli.de/visualize-this-map/118722926FD7342AE3E3A39AB34AD73EAE17
DA1E322D54C9259C16CB32804546
Tierhalterinnen und Tierhalter können über den
Link prüfen, ob die eigene Tierhaltung im
betroffenen Gebiet liegt In der Überwachungszone
im Kreis Wesel befinden sich neben einem
größeren Putenmastbestand mit ca. 8.500 Tieren
überwiegend Klein- und Hobbyhaltungen. Einen
Teil der Betriebe wird der amtstierärztliche
Dienst in den kommenden Wochen nach festgelegten
Risikokriterien klinisch und in bestimmten
Fällen über Tupfer- oder Blutproben näher
untersuchen.
Hintergrund und
Handlungsempfehlung
Das
Geflügelpestgeschehen ändert sich derzeit sehr
dynamisch. Besonders auffällig sind aktuell die
hohen influenzabedingten Todesfälle bei den
durchziehenden Kranichen. Geflügelhalter und
-halterinnen, die ihre Tierzahlen bislang nicht
bei der Tierseuchenkasse NRW angemeldet haben,
sollten dies unverzüglich nachholen.
Die
größte Gefahr geht von einem Viruseintrag aus
der Wildvogelpopulation aus. Daher ist eine
Aufstallung unverzichtbar. Aufgrund der
Erfahrungen aus den Vorjahren muss im Laufe der
kommenden Wochen und Monate mit einer
Aufstallungspflicht für das gesamte Kreisgebiet
gerechnet werden.
Der Kreis Wesel bittet
alle Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter im
Kreis, die eigenen Biosicherheitsmaßnahmen zu
hinterfragen und zu verbessern, sowie
ungewöhnliche Krankheitserscheinungen und
erhöhte Todeszahlen beim Fachdienst Veterinär-
und Lebensmittelüberwachung zu melden. Totfunde
von Wildvögeln, insbesondere Wassergeflügel und
Greifvögeln sollten dem Veterinäramt gemeldet
werden.
Für Fragen und Meldungen steht der
Fachdienst Veterinär- und
Lebensmittelüberwachung unter
VET.LM@kreis-wesel.de und 0281 207 7021 bzw.
7022 zur Verfügung.
Vogelgrippe bei toter Kanadagans in
Duisburg-Walsum nachgewiesen
Bei einer in Walsum in der Nähe des Rheins tot
aufgefundenen Kanadagans wurde am heutigen
Freitag das Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen.
Derzeit werden bei Ausbruch der Vogelgrippe bei
Wildvögeln keine weiteren Restriktionsmaßnahmen
durchgeführt. Dennoch rät das Veterinäramt
Duisburg allen Geflügelhaltern seine
Biosicherheitsmaßnahmen zu überprüfen.
Wildvögel dürfen keinen Zugang zu Tränken und
Futterstellen von Hausgeflügel haben. Das
Überziehen von Schutzkleidung vor Betreten des
Stalls schützt vor einem Eintrag von außen.
Ebenso minimiert ein Aufstallen von Tieren oder
die Abdeckung von Volieren das
Ansteckungsrisiko. Die Influenza-Viren des
Menschen gehören zur gleichen Virenfamilie. Nur
Personen mit intensivem, direktem Kontakt zu
infiziertem Geflügel mit einer hohen Viruslast
können in seltenen Fällen selbst erkranken.
Auch wenn das Risiko einer Ansteckung für
Menschen sehr gering ist, sollten allgemeine
Hygienevorschriften (Händewaschen, Abstand zu
Wildgeflügel, Tiere nicht anfassen) eingehalten
werden. Weiter wird empfohlen, Hunde anzuleinen.
Freilaufende Hunde können mit potenziell
infiziertem Wildgeflügel in Kontakt kommen und
so zur Verbreitung des Virus beitragen.
Sollten Bürgerinnen und Bürger tote oder
auffällig kranke Wasser- oder Greifvögel finden,
können diese dem Veterinäramt unter Tel.
0203-283 7770 oder per E-Mail
veterinaeramt@stadt-duisburg.de gemeldet werden.
Benötigt werden dabei genaue Angaben zum
Standort und Kontaktdaten für Rückfragen.
„Neue Kommunal-Spitzen bestimmen
Zukunft“ IHK fordert Vorfahrt für die Wirtschaft
Anfang November nehmen an Rhein und Ruhr die neu
gewählten Räte, Kreistage, Bürgermeister und
Oberbürgermeister ihre Arbeit auf. Die IHK
appelliert an die Spitzen der Kommunen, dann
schnell und pragmatisch Entscheidungen für den
Standort zu treffen. Für die Unternehmen wird
die Luft dünn: Die Industrie muss massiv Stellen
abbauen. Der Mittelstand leidet unter Steuern
und Abgaben.

„Jetzt Vorfahrt für die Wirtschaft!“, fordert
deswegen IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan
Dietzfelbinger (IHK-Foto). „Es wird keine
einfache Wahlperiode, aber die entscheidende.
Die Kommunal-Spitzen entscheiden, wie stark der
Niederrhein aus der Krise hervorgehen kann.
Städte und Gemeinden haben eine zentrale Rolle:
Sie sind erste Ansprechpartner für die
Unternehmen.
Das Bauamt bestimmt, wie
schnell eine Baugenehmigung vorliegt. Die
Wirtschaftsförderung prägt das Investitionsklima
vor Ort. Zu viel Bürokratie schreckt ab. Hohe
kommunale Steuern und Abgaben vergraulen die
Betriebe. Jeder Euro, den die Kommunen in
bessere Bedingungen investieren, zahlt sich aus
– für Unternehmen, Beschäftigte und die Region.
Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“
Vorläufige Feststellung der EU: TikTok
und Meta haben gegen DSA-Transparenzpflichten
verstoßen
Die EU-Kommission hat vorläufig festgestellt,
dass sowohl TikTok als auch Meta gegen ihre
Verpflichtungen gemäß dem Gesetz über digitale
Dienste (DSA) verstoßen haben.
Die Verstöße
betreffen den angemessenen Zugang zu
öffentlichen Daten für Forscherinnen und
Forscher.
Außerdem hat Meta sowohl für
Instagram als auch für Facebook gegen die
Verpflichtung verstoßen, Nutzerinnen und Nutzern
einfache Mechanismen zur Meldung illegaler
Inhalte zur Verfügung zu stellen und es ihnen zu
ermöglichen, Entscheidungen über die Moderation
von Inhalten wirksam anzufechten.
„Unsere Demokratien sind auf Vertrauen
angewiesen. Das bedeutet, dass Plattformen die
Nutzer stärken, ihre Rechte respektieren und
ihre Systeme der Kontrolle öffnen müssen“, sagte
Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin für
technologische Souveränität, Sicherheit und
Demokratie. „Der DSA macht dies zu einer
Pflicht, nicht zu einer Wahl.
Mit den
heutigen Maßnahmen haben wir nun vorläufige
Ergebnisse zum Zugang von Forschern zu Daten auf
vier Plattformen veröffentlicht. Wir stellen
sicher, dass die Plattformen für ihre Dienste
gegenüber den Nutzern und der Gesellschaft
rechenschaftspflichtig sind, wie dies im
EU-Recht vorgesehen ist.“
Dinslaken: Stadtinformation am 25. Oktober 2025
geschlossen
Am Samstag, 25. Oktober 2025, bleibt die
Dinslakener Stadtinformation am Rittertor
geschlossen. Das Team der Stadtinformation
präsentiert an diesem Tag die Stadt Dinslaken
auf dem Hansefest in Wesel.
Ansonsten gelten
weiterhin die gewohnten Öffnungszeiten: Dienstag
bis Freitag 10 – 13 Uhr und 14 – 17 Uhr Samstag
10 – 13 Uhr.
Lesung mit
Melissa Müller am 28. Oktober in der Bibliothek
Moers
Eine wahre Liebesgeschichte nach dem Holocaust
steht im Mittelpunkt einer Lesung mit
Bestsellerautorin Melissa Müller. Sie liest am
Dienstag, 28. Oktober, um 19 Uhr in der
Bibliothek Moers aus ihrem Roman „Mit dir steht
die Welt nicht still“.

(Foto: Achim Bunz)
Darin erzählt sie von
Nanette Blitz und John Konig, die sich nach den
Schrecken der NS-Zeit verliebten und durch
Briefe wiederfanden. Bekannt wurde Müller durch
ihre Bücher „Das Mädchen Anne Frank“ und „Bis
zur letzten Stunde – Hitlers Sekretärin erzählt
ihr Leben“, die beide verfilmt wurden.
Veranstalter der Lesung sind die Barbara
Buchhandlung und die Bibliothek Moers. Tickets
gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Barbara
Buchhandlung (Burgstraße 10) und in der
Bibliothek (Wilhelm-Schroeder-Straße 10). An der
Abendkasse kostet der Eintritt 17 Euro.
Moerser Vortrag: ‚Amon: Mein Großvater hätte
mich erschossen‘
Jennifer Teege ist 38 Jahre alt, als sie
erfährt, wer ihr Großvater ist: Amon Göth, der
brutale KZ-Kommandant und Gegenspieler des
Jugendretters Oskar Schindler.

Teege (Foto: Thorsten Wulff)
selbst ist
die Tochter einer Deutschen und eines
Nigerianers, wuchs bei Pflegeeltern auf und hat
in Israel studiert. Im Vortrag ‚Amon: Mein
Großvater hätte mich erschossen‘ berichtet sie
am Mittwoch, 29. Oktober, ab 19 Uhr im Alten
Landratsamt, Kastell 5b, über den Umgang mit
ihrer Geschichte.
Die Veranstaltung ist
eine Kooperation der vhs Moers – Kamp-Lintfort
mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit Moers e.V., dem
Partnerschaftsverein Ramla-Moers e.V., Erinnern
für die Zukunft e.V. und der Fachstelle für
Demokratie der Stadt Moers im Auftrag des
Kreises Wesel im Rahmen des Landesprogramms
‚NRWeltoffen‘ des Landesministeriums für Kultur
und Wissenschaft NRW.
Der Abend ist
kostenlos, allerdings ist eine rechtzeitige
Anmeldung entweder telefonisch unter 0 28 41 /
201 - 565 oder online unter www.vhs-moers.de erforderlich.
Stadtwerke Wesel präsentieren:
Liederabend im Alten Stadtwerke Wasserwerk
Ein besonderes musikalisches Highlight erwartet
Kulturfreunde am Mittwoch, den 29. Oktober 2025,
um 19:30 Uhr im Alten Stadtwerke Wasserwerk. Das
Europäische Klassikfestival lädt im Rahmen
seiner Reihe „Ars musica ad Lupiam“, mit
Unterstützung der Stadtwerke Wesel, zum ersten
Liederabend an diesem außergewöhnlichen Ort ein.
Zu Gast sind die international gefeierte
Sopranistin Natalia Scriabina und der vielfach
ausgezeichnete Pianist Alexander Zolotarev. Zwei
herausragende Künstlerpersönlichkeiten, die dem
Publikum einen Abend voller musikalischer
Höhepunkte bieten werden. Natalia Scriabina
begann schon in jungen Jahren mit Gesang und
Tanz und erhielt ihre Ausbildung an renommierten
Moskauer Musikhochschulen.
Als
Preisträgerin mehrerer nationaler und
internationaler Wettbewerbe und ehemalige
Solistin des Gnessin Theatre of Opera ist sie
heute weltweit gefragt - mit Auftritten in
Europa und Asien. Ihr vielseitiges Repertoire
reicht von Opern und Romanzen bis hin zu
internationalen Volksliedern, Musicals und
Operetten.
Der Pianist Alexander
Zolotarev, Schüler von Größen wie Paul
Badura-Skoda, Alexander Lonquich und Pavel
Gililov, unterrichtet nicht nur an der
Musikhochschule Köln, sondern ist auch durch
zahlreiche Konzertreisen und Rundfunk- und
Fernsehaufnahmen bekannt.
Das Weseler
Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches
Programm freuen, mit Liedern von Glinka,
Warlamow, Mussorgsky, Tschaikowsky,
Rimsky-Korsakow und Rachmaninow, abgerundet
durch eindrucksvolle Klavierwerke von
Rachmaninow.
„Mit dem Liederabend im
Alten Stadtwerke Wasserwerk möchten wir zeigen,
das Kultur und Energie wunderbar zusammenpassen.
Unser historisches Gebäude bietet dafür eine
besondere Atmosphäre. Wir freuen uns sehr,
gemeinsam mit dem Europäischen Klassikfestival
solch hochkarätige Künstler nach Wesel zu holen“
sagt Rainer Hegmann, Geschäftsführer der
Stadtwerke Wesel GmbH.
Tickets sind im
Vorverkauf für 20,- € (ermäßigt 15,- €)
erhältlich. An der Abendkasse gilt ein Zuschlag
von 3,- €. Karten gibt es im Stadtwerke
Wasserturm, bei der Stadtinformation Wesel sowie
online unter www.eu-klassikfestival.de und
in allen Eventim-Ticketcentern (zzgl.
Systemgebühren).
Die Stadtwerke Wesel
präsentieren gemeinsam mit dem Europäischen
Klassikfestival dieses kulturelle Ereignis in
besonderem Ambiente und laden alle
Musikliebhaber ein, einen unvergesslichen Abend
im Alten Stadtwerke Wasserwerk zu erleben.
vhs Moers – Kamp-Lintfort: Wer erbt was? –
Info-Abend der vhs
Niemand denkt gern ans Erben – doch wer
vorsorgt, erspart den Liebsten späteren Streit.
Die vhs Moers – Kamp-Lintfort lädt am Mittwoch,
29. Oktober, ab 18.30 Uhr zu einem Info-Abend
rund um Erbfolge, Pflichtteil und Testament ein.
In den Räumen an der
Wilhelm-Schroeder-Straße 10 werden die
wichtigsten Grundlagen des Erbrechts
verständlich und praxisnah erklärt – mit
Beispielen direkt aus dem Leben. Im Mittelpunkt
stehen die Regelungen des Bürgerlichen
Gesetzbuchs zum Verwandten-, Ehegatten- und
Pflichtteilsrecht.
Eine vorherige Anmeldung
für den Abend ist erforderlich und telefonisch
unter 0 28 41 / 201 – 565 sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.
Schaurig-schöne Eisdisco zu
Halloween - Keine öffentliche Laufzeit in der
Moerser-Eiswelt an Allerheiligen
In der Moerser Eissporthalle gibt es zu
Halloween auch in diesem Jahr wieder eine Party
mit Gruselfaktor. Die gerade beim jüngeren
Publikum sehr beliebte wöchentliche Eisdisco
findet am Freitag, 31. Oktober, in dunkler,
schauriger Atmosphäre statt.
Bekannte
DJs spielen dabei wieder aktuelle Hits aus den
Charts. Die Party beginnt um 17 Uhr und endet um
21 Uhr. Gruselige Verkleidungen sind willkommen.
Am darauffolgenden Allerheiligentag, 1.
November, gelten in den Einrichtungen der ENNI
Sport & Bäder Niederrhein (Enni) die normalen
Wochenend-Öffnungszeiten.
Das Aktivbad
im Solimare und das Hallenbad im Enni Sportpark
Rheinkamp sind dann von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn können Gäste an
Allerheiligen von 9 bis 17 Uhr schwimmen und
plantschen. Saunagäste können hier an dem
Feiertag von 10 bis 18 Uhr schwitzen und
entspannen. In der Enni-Eiswelt gibt es wegen
eines ganztägigen Eishockeyturniers an
Allerheiligen keine öffentliche Laufzeit.
Der Herbst hält
Einzug – was tun in der Freizeit?
Vom legendären Drachentöter bis zu wunderbarem
Spielzeug reicht das Angebot in der Region. Die
Luft ist frisch, der Himmel etwas
wolkenverhangen, und das goldene Licht der
tiefer stehenden Sonne taucht die Welt in warme
Töne – der Herbst ist da. Zwischen raschelndem
Laub, kühlen Morgentemperaturen und ersten
Regenschauern zeigt sich die Jahreszeit von
ihrer typischen Seite: wechselhaft, lebendig und
voller Atmosphäre.
Auch für solche
Witterungsverhältnisse gibt es zahlreiche
Freizeitangebote im Trocknen und Warmen.
Kulturelle Abwechslung und geistige Anregung
bieten zum Beispiel die vielen Museen, die sich
mit ganz unterschiedlichen Themen befassen – von
Kunst und Geschichte bis zu Natur und Technik.
In vielen Fällen besteht zudem die
Möglichkeit, sich im Museumscafé zu stärken und
über das Erlebte auszutauschen. Hier einige
Tipps für einen gelungenen Museumsbesuch:
In
einem eindrucksvollen historischen Bauensemble
aus dem 16. bis 18. Jahrhundert präsentiert das
BEGAS HAUS in Heinsberg seine Sammlungen.
Herzstück des Rundgangs ist die Zusammenstellung
von Werken der Künstlerfamilie Begas, die über
vier Generationen hinweg bedeutende Beiträge zur
Kunst geleistet hat.
Gemälde, Skulpturen
und Grafiken zeichnen ein lebendiges Bild von
der Romantik über die Monumentalkunst des
Kaiserreichs bis in die Nachkriegszeit der
1950er Jahre. Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf
der regionalgeschichtlichen Sammlung. Dabei
zeichnet sich das Museumskonzept durch
erzählerische Vielfalt und (digitale)
Interaktivität aus und richtet sich an
Besucherinnen und Besucher jeden Alters.
Als Regionalmuseum widmet sich das
LVR-Niederrheinmuseum Wesel der Geschichte der
Region aus verschiedenen Perspektiven. Zentrales
Erzähl- und Architekturelement in der neuen
Dauerausstellung ist der Rhein und das Leben am
Fluss, der die erste Etage als verbindende
„Welle“ durchzieht.
An diesen Strom knüpfen
sich Geschichte und Geschichten der Region an.
Modern, medial und voller Emotionen ist die neue
Ausstellung vor allem für Familien ein tolles
Ausflugsziel mit vielen spannenden Themenfeldern
und Mitmach-Stationen.
Dem berühmtesten
„Sohn der Stadt“ ist das SiegfriedMuseum in
Xanten gewidmet. Hier taucht man ganz tief ein
in die sagenhafte Welt der Nibelungen. Uralte
Geschichten, die im Mittelalter auf Pergament
geschrieben die Jahrhunderte überdauert haben
faszinieren bis heute. Aber aufgepasst: Der
Nibelungenmythos hat – wie das legendäre
Rheingold – nicht nur eine schillernde, sondern
auch eine verfluchte Seite.
Auf zum Teil
überbauten historischen Gebäuderesten beherbergt
das Museum Ausstellungsstücke aus 600 Jahren
Wirkungsgeschichte und zeigt ein dramatisches
Bild jeder Epoche.
Einer der größten
Museumsbauten am Niederrhein befasst sich in der
Wallfahrtsstadt Kevelaer mit dem bäuerlichen und
bürgerlichen Leben vergangener Epochen, mit
altem Handwerk, Volksfrömmigkeit und
Schützenwesen. Herausragende Bestände des
Niederrheinischen Museums Kevelaer zeigen unter
anderem regionale Irdenware und wunderbares
Spielzeug.
Neben Highlights wie diesen
gibt es am Niederrhein auch einige charmante
kleinere Ausstellungen. Dazu gehören etwa das
Erlebnismuseum in Wegberg oder das ebenso
idyllisch gelegene Museum rund ums Geld in
Xanten-Wardt.
Und wer im Besitz der neuen
NiederrheinCard ist oder sich demnächst eine
zulegt, kann in vielen Fällen beim Museumsbesuch
bares Geld sparen. Denn zahlreiche Einrichtungen
sind schon NiederrheinCard-Partner und gewähren
attraktive Rabatte auf den Eintritt.
Weitere Infos zu Museen, Eintrittszeiten und
-preisen sowie zur NiederrheinCard gibt es hier:
https://www.niederrhein-tourismus.de/attraktionen
https://www.niederrhein-tourismus.de/niederrhein/niederrheincard

Eintauchen in die Vergangenheit – das ist unter
anderem im BEGAS HAUS möglich. Foto: gymi media
GmbH

Weltnudeltag 25.10.: 86 % der im Jahr 2024
importierten Nudeln kamen aus Italien
Die Importe von Nudeln sind im vergangenen Jahr
auf einen neuen Höchststand gestiegen. Der
Großteil davon stammt aus Italien. Knapp 469 700
Tonnen Nudeln im Wert von knapp 646,6 Millionen
Euro importierte Deutschland im Jahr 2024 aus
dem Ausland.
Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) zum Weltnudeltag am 25.
Oktober mitteilt, kamen knapp 404 100 Tonnen
oder 86,0 % der importierten Teigwaren aus
Italien. Mit großem Abstand folgten Österreich
mit knapp 16 800 Tonnen oder 3,6 % aller
Nudelimporte sowie die Türkei mit knapp 7 200
Tonnen oder 1,5 %.
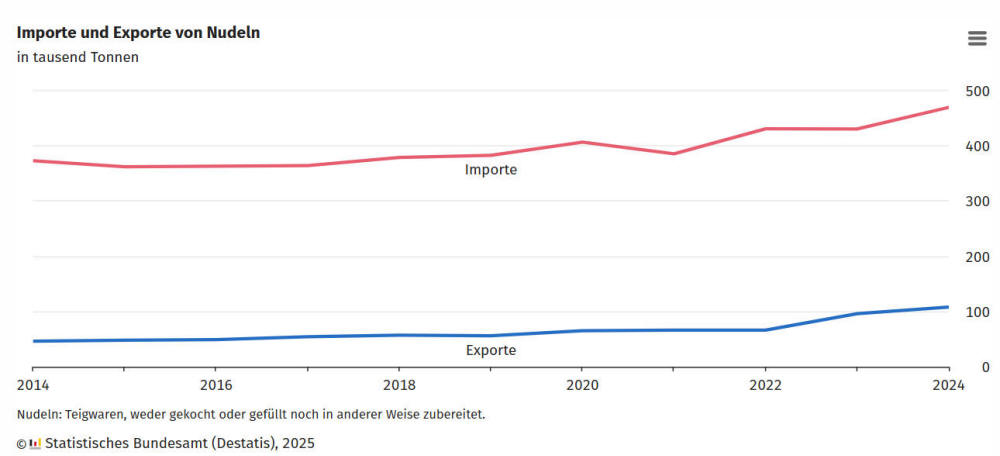
Im Jahr 2024 wurden insgesamt 9,1 % mehr
Nudeln als im Vorjahr (2023: 430 600 Tonnen)
importiert. Binnen zehn Jahren erhöhte sich die
Importmenge um 25,9 % (2014: 372 900 Tonnen).
Dabei lagen die Importe stets deutlich über den
Exporten. Im Jahr 2024 exportierte Deutschland
gut 108 200 Tonnen Nudeln im Wert von
168,5 Millionen Euro.
Gegenüber dem
Vorjahr 2023 wurden 12,6 % mehr Teigwaren
exportiert. Binnen zehn Jahren hat sich die
ausgeführte Menge mehr als verdoppelt
(+133,6 %). Die wichtigsten Abnehmer von Nudeln
aus Deutschland waren Frankreich mit 23,2 % der
Exporte im Jahr 2024, das Vereinigte Königreich
mit 20,1 % und Polen mit 9,1 %.
Seit
2023 werden mehr Nudeln ohne Eier produziert als
mit Eiern Zudem werden deutlich mehr Nudeln nach
Deutschland importiert, als hierzulande
produziert werden. Im vergangenen Jahr wurden
289 800 Tonnen Nudeln und ähnliche Teigwaren in
Deutschland hergestellt. Das waren 8,7 % mehr
als zehn Jahre zuvor (2014: 266 700 Tonnen).
Der Anstieg der heimischen Produktion ist
dabei vor allem auf den Trend zu veganen Nudeln
zurückzuführen: So werden seit 2023 hierzulande
mehr Nudeln ohne Eier produziert als solche, die
Eier enthalten. Die Produktion von Nudeln ohne
Eier lag im Jahr 2024 bei knapp 148 400 Tonnen,
bei Nudeln mit Eiern bei gut 141 400 Tonnen.
Während sich die Produktion von Nudeln ohne Eier
binnen zehn Jahren fast verdoppelte (+92,8 %),
ging die Produktion Eier-enthaltender Nudeln um
gut ein Viertel zurück (-25,5 %).
Pinktober in NRW: Brustkrebs bei Frauen
zweithäufigste Krebserkrankung mit Todesfolge
* 2024: 4.037 Menschen starben
an Brustkrebs, 99 % davon waren Frauen.
*
Anteil der Brustkrebstoten an allen Gestorbenen
seit 2020 unter 2 %.
* Durchschnittliches
Sterbealter lag bei 75,6 Jahren.
Im Jahr
2024 starben in Nordrhein-Westfalen 4.037
Menschen an Brustkrebs; 98,9 % davon waren
Frauen. Der Brustkrebsmonat Oktober bzw.
Pinktober gibt jährlich internationalen Anlass,
die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von
Brustkrebs in das öffentliche Bewusstsein zu
rücken.
Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen anlässlich des Pinktobers
mitteilt, war Brustkrebs bei Frauen mit 3.992
Fällen die zweithäufigste Krebserkrankung mit
Todesfolge – nach Lungen- und Bronchialkrebs mit
4.890 Todesfällen. Im Vergleich zum Vorjahr sank
die Zahl, der an Brustkrebs Gestorbenen um
4,2 %.
Der Anteil der Brustkrebstoten an
allen Gestorbenen lag 2024 bei 1,8 %; im Jahr
2000 betrug dieser noch 2,3 %. Seit 2020 liegt
der Anteil der an Brustkrebs gestorbenen
Menschen durchgehend unter 2 %.

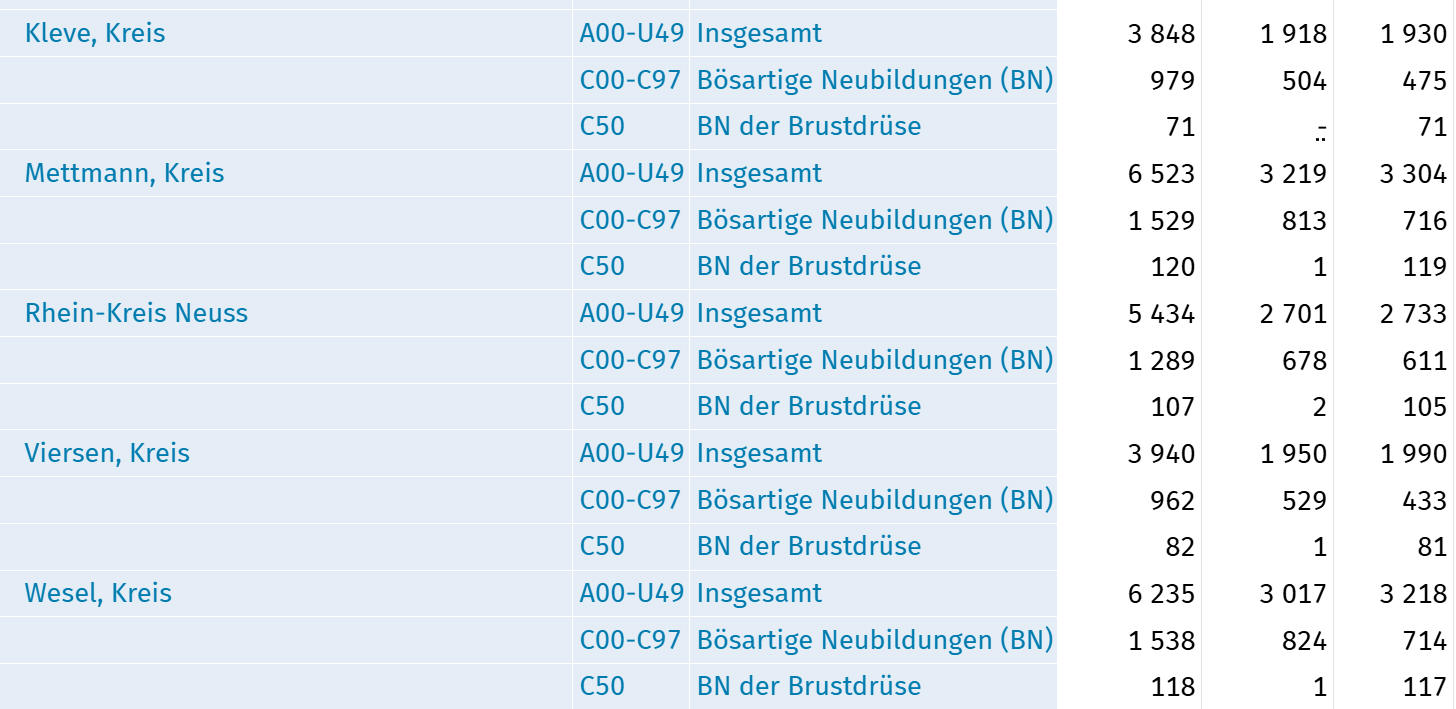
Durchschnittsalter der an
Brustkrebs Gestorbenen war 3,8 Jahre niedriger
als das aller Gestorbenen
Das
Durchschnittsalter der aufgrund von Brustkrebs
Gestorbenen lag bei 75,6 Jahren und war damit
3,8 Jahre niedriger als das durchschnittliche
Sterbealter aller Gestorbenen. Über zwei Drittel
der Brustkrebstoten waren 70 Jahre und älter,
gut ein Viertel zwischen 50 und 70 Jahre und
5,3 % jünger als 50 Jahre.

Stadt Düsseldorf verzeichnet die niedrigste
Brustkrebs-Sterberate
Die kreisfreie Stadt
Düsseldorf verzeichnete 2024 die niedrigste
Sterberate aufgrund von Brustkrebs mit 15
Sterbefällen je 100.000 Einwohnerinnen und
Einwohner. Im Ennepe-Ruhr-Kreis hatte es die
höchste Sterberate mit 32 Sterbefällen je
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gegeben. Im
Landesmittel starben 23 Personen von jeweils
100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern aufgrund
einer Brustkrebserkrankung.
Straßenverkehrsunfälle im August 2025: 2 %
weniger Verletzte als im Vorjahresmonat Zahl der
Verkehrstoten gegenüber August 2024 ebenfalls
gesunken
Im August 2025 sind in
Deutschland rund 35 300 Menschen bei
Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach
vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 2 %
oder 800 Verletzte weniger als im
Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten sank
um 14 Personen auf 280. Insgesamt registrierte
die Polizei im August 2025 rund 198 800
Straßenverkehrsunfälle, das waren 3 % oder 5 400
weniger als im Vorjahresmonat.
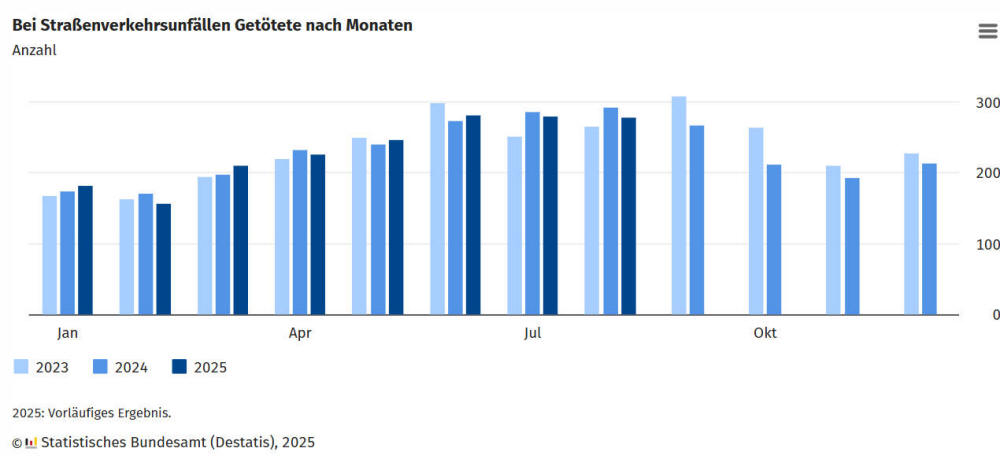
Im Zeitraum Januar bis August 2025 erfasste
die Polizei insgesamt
1,6 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit
2 % oder 27 000 weniger als im
Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung basiert
ausschließlich auf dem Rückgang der
Sachschadensunfälle (-27 000), während die Zahl
der Unfälle mit Personenschaden mit 198 000 auf
dem Vorjahresniveau lag.
Insgesamt
wurden in den ersten acht Monaten des Jahres
1 873 Menschen im Straßenverkehr getötet, das
waren 6 Personen weniger als im
Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verletzten im
Straßenverkehr blieb im Vorjahresvergleich mit
246 000 nahezu unverändert.
Wesel: Pixelkunst
mit Unternehmergeist - Gesamtschule am Lauerhaas
gewinnt IHK-Schulpreis
Mit
einer kreativen Ideen, Teamwork und
unternehmerischem Denken zum Sieg: Die
Gesamtschule am Lauerhaas in Wesel hat den
ersten Platz beim IHK-Schulpreis 2025 belegt.
Mit ihrem Projekt „DevsPlayground“ überzeugte
das dreiköpfige Schülerteam die Jury der
Niederrheinischen IHK.
Dario Albrecht,
Jan und Tim Boesang entwickeln eigene
Computerspiele mit viel Leidenschaft. Ihre
Spiele zeichnen sich durch 2D-Pixel-Art-Grafiken
aus. Ganz im Stil klassischer Videospiele. Von
der Idee über die Programmierung bis hin zum
Design entsteht fast alles in Eigenregie. Für
das Team steht der Spaß im Mittelpunkt.
„Das größte Learning war, wie man ein Spiel
komplett eigenständig entwickelt und auf größere
Plattformen bringt“, sagt Tim Boesang. Das Team
erhielt neben dem Schulpreis-Pokal ein Preisgeld
in Höhe von 1.500 Euro.

Foto: Niederrheinische IHK/Jacqueline Wardeski
„Der Schulpreis ist eine tolle Chance, über
den Unterricht hinaus etwas Eigenes zu schaffen.
Man lernt nicht nur viel über Projektarbeit und
Wirtschaft, sondern wächst auch als Team. Ich
kann nur empfehlen, mitzumachen“, betont Jana
Bartels, die den Schulpreis bei der IHK
organisiert.
Der Schulpreis wurde
bereits zum 22. Mal verliehen. Er fördert
praxisnahe Projekte, die wirtschaftliches Denken
und persönliche Kompetenzen stärken. Insgesamt
nahmen zwölf Teams von sieben Schulen aus
Duisburg sowie den Kreisen Kleve und Wesel am
Wettbewerb teil.
Die Anmeldung für den
IHK-Schulpreis 2026 läuft bereits. Weitere
Informationen zum Wettbewerb gibt es unter
www.ihk.de/niederrhein, auf Instagram unter
@ihkniederrhein oder bei Jana Bartels, Tel. 0203
2821-283, E-Mail: bartels@niederrhein.ihk.de.
PRO BAHN plädiert für mehr
Fahrgastbeteiligung, Bürgernähe, Digitalisierung
und Schienenkompetenz
Der Fahrgastverband PRO BAHN nimmt Stellung zur
Zusammenlegung der Aufgabenträger in
Nordrhein-Westfalen zu Schiene.NRW

Drei Aufgabenträger formieren zusammen die neue
Anstalt Schiene.NRW.
Bürgernähe und
Beteiligung der Fahrgäste fordert der
Fahrgastverband PRO BAHN von einem neuen Gesetz
über den öffentlichen Verkehr in
Nordrhein-Westfalen. Der Fahrgastverband ist mit
dem ersten Entwurf des Gesetzes, das von
Verkehrsminister Oliver Krischer den Verbänden
zur Stellungnahme vorgelegt wurde, sehr
unzufrieden.
„Nur einen minimalistischen
Entwurf zur Gründung des geplanten, landesweiten
Aufgabenträgers Schiene.NRW, ohne groß reale
Probleme im ÖPNV anzugehen“, so kritisieren
Lothar Ebbers, Rainer Engel und Dr. Thomas
Probol die geplante Novelle des ÖPNV-Gesetzes.
„Die hohe Kompetenz, die die bisherigen
Aufgabenträger für den Schienennahverkehr
gewonnen haben, wird für das Land nur
unzureichend genutzt.“
Das Land
Nordrhein-Westfalen will die Organisation des
Schienenpersonenverkehrs im Land effizienter und
schlagkräftiger machen. Gegenwärtig wird diese
Aufgabe von Zweckverbänden für das Rheinland,
Rhein-Ruhr und Westfalen-Lippe getrennt
wahrgenommen. „Auch bei einer landesweiten
Organisation des Schienenverkehrs darf die
Bürgernähe nicht verloren gehen“, erklärt Rainer
Engel, stellvertretender Vorsitzender des
Fahrgastverbandes.
„Wir zeigen auf, wie
mehr Bürgernähe möglich ist, ohne dass die von
der Landesregierung erwünschten Vorteile
verloren gehen. Wir wollen nicht zurück in die
Zeiten einer ortsfernen Bundesbahn, gegen die
die Bürger mit den Füßen abgestimmt hatten und
ins Auto umgestiegen waren.
Über
einzelne Bahnhöfe und Bahnstrecken in der Eifel
und Ostwestfalen muss man zuerst vor Ort
diskutieren. Wir befürchten aber, dass mit dem
neuen Gesetz darüber in Hochhäusern zwischen
Ruhr und Emscher entschieden wird. Schon jetzt
sind die bisherigen Aufgabenträger zu ortsfern
und fahrgastfern“.
Nachdem in
Nordrhein-Westfalen die Organisation der
Eisenbahnzüge in die Hand von kommunalen
Zweckverbänden gelegt wurde, hat der
Schienenverkehr einen enormen Aufschwung erlebt.
„Diesen Aufschwung darf man nicht wieder
verspielen“, erklärt der stellvertretende
Vorsitzende Probol: „Obwohl digitale Information
gut informieren könnte, stehen Fahrgäste bei
vielen Baustellen und Zugausfällen immer wieder
ratlos auf dem Bahnsteig.
Bessere
Information muss eine zentrale Organisation wie
die geplante Schiene.NRW in die Hand nehmen und
braucht dafür einen klaren Auftrag des
Gesetzgebers. Mit einer hochqualitativen
Digitalisierung bei Fahrgastauskunft und
Anschlusssicherung kann der Fahrgast einfacher
und schneller nach guten Alternativen suchen.“
Die beiden Vertreter von Verbraucherinteressen
sind sich einig: „Die Gesetzesnovelle benötigt
dringend die Vorgabe regional verorterter
Fachgremien und die Empfehlung einer
hochqualitativen Digitalisierung.“
Ebbers
verweist besonders darauf, dass das Mitdenken
und Mitreden von Fahrgast-Institutionen in allen
Gremien den öffentlichen Verkehr sehr stark
verbessern kann. „In den Niederlanden gibt es
die aktive Mitarbeit von Verbraucherverbänden,
und dort zeigt die Erfahrung, dass die Hälfte
aller Verbesserungsvorschläge angenommen und
auch tatsächlich umgesetzt wird“, weiß Ebbers.
„Wenn die Landesregierung wirklich etwas
verändern möchte, dann ist jetzt die Zeit, das
neue Gesetz auf Bürgernähe auszurichten und
engagierten Bürgern über ihre Verbände die
Möglichkeit zur Mitgestaltung zu geben.“
„Schienenkompetenz für NRW“, treibt Engel und
Probol um: „Rhein-Ruhr-Express, Regionalzüge und
S-Bahnen müssen sich mit Fernzügen und
Güterzügen die gleichen Schienen teilen. Bei
Infrastrukturmaßnahmen muss man Fernverkehr,
Nahverkehr und Güterverkehr gemeinsam denken.
Das vorliegende Gesetz wirkt wie ein Maulkorb,
wenn bei der neuen Schiene.NRW nur über
Nahverkehr nachdenken darf.
Die
Entwicklung des Standorts Nordrhein-Westfalen
braucht alle Verkehrsarten auf der Schiene. Die
einzige Institution mit nötiger Fachkunde wird
Schiene.NRW sein, um auf allen Feldern
mitzureden und gegenüber dem Bund als Eigentümer
der Schienen durchzusetzen, und dafür braucht
Schiene.NRW einen Auftrag, das ist aktive
Strukturförderung.“
Ebbers kritisiert
auch die Regelungen über die Finanzierung des
öffentlichen Verkehrs. „Alle Förderpauschalen
sollten alle drei Jahre per Gesetz geprüft
werden, um das Verkehrsangebot mindestens
aufrechtzuerhalten, besser noch auszubauen“,
ergänzt Ebbers. „Ebenfalls sollte das
Sozialticket ins neue Gesetz aufgenommen werden,
wobei der soziale Anteil zukünftig z. B. aus dem
Sozialtopf kommen muss, nicht mehr aus
ÖPNV-Mitteln.“
Abschließend bekräftigen
Ebbers, Engel und Probol noch einmal: „Den
angekündigten großen Wurf hat Herr
Verkehrsminister Krischer verpasst. Aber er kann
bis zum Einbringen des Gesetzes in den Landtag
deutlich nachbessern.“
EU-Kommission vergibt Schülerzeitungspreis in
Deutschland: Einsendeschluss: 15. Januar
Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder
geht in eine neue Runde, gesucht werden die
besten Schülerzeitungen Deutschlands. In diesem
Rahmen vergibt die Vertretung der Europäischen
Kommission in Deutschland ihren
Schülerzeitungspreis „Europa“.
Mit der
Auszeichnung würdigt sie Schülerzeitungen, die
sich mit Europa im Alltag ihrer jugendlichen
Leserinnen und Leser beschäftigen. Sie bittet
junge Medienmacherinnen und Medienmacher an
deutschen Schulen aller Schulkategorien, die
über aktuelle europäische Themen schreiben,
Podcasts oder Videos über europäische Projekte
erstellen oder über Erfahrungen mit Europa an
ihrer Schule bloggen, ihre Beiträge bei der
Jugendpresse oder direkt bei der Vertretung
der Europäischen Kommission einzureichen.
Einsendeschluss ist der 15. Januar 2026.
Bewerbungen, Preise und Jury Die
Schulkategorien umfassen die Grund-, Haupt-,
Real- und Förderschulen, die Gymnasien sowie die
beruflichen Schulen. Im Februar werden die
Preisträgerinnen und Preisträger auf einer
Jurysitzung ausgewählt. Der Sonderpreis
„Europa“ ist mit einem Preisgeld von 1.000
Euro ausgestattet.
Neben Preisgeldern
ist eine feierliche Preisverleihung im Bundesrat
und der Schülerzeitungskongress mit einem
vielfältigen Weiterbildungsprogramm durch
Workshops, unter anderem zu europäischen Themen,
Teil der Ehrung der Redaktionen. Die Bewerbung
auf einen oder mehrere Sonderpreise können über
das Bewerbungsportal Mitmachen
- Schülerzeitung oder direkt in der
Vertretung der Europäischen Kommission
eingereicht werden.
Jugendpresse
Deutschland
Die Jugendpresse sucht jedes
Jahr die besten Schülerzeitungen Deutschlands.
Damit sollen die Leistung und das Engagement
junger Journalistinnen und Journalisten
öffentlich präsentiert und gewürdigt und sie
auch vernetzt und finanziell belohnt werden.
Gewinner 2025
Die Schülerzeitung
„PEER plus“ des Egbert-Gymnasium
Münsterschwarzach in Bayern gewann
den Schülerzeitungpreis der Europäischen
Kommission in diesem Jahr. Die Zeitung „PEER
plus“ hat mit verschiedenen journalistischen
Formaten zum Thema Europa überzeigt.
Neben
Berichten über europapolitische Diskussionen in
der Schule wurden drei Themen tiefer
behandelt: Populismus in Europa, das
europäische Asylsystem und die Absenkung
des Wahlalters. Bei allen Beiträgen wurde
zwischen Berichterstattung und Kommentar
unterschieden.
2026 wird die Vertretung der
Europäischen Kommission in Deutschland den Preis
zum siebzehnten Mal vergeben.
EU-Staaten beschließen 19. Sanktionspaket
gegen Russland
Die Europäische
Kommission begrüßt die Annahme des 19.
Sanktionspakets gegen Russland durch die
EU-Mitgliedstaaten. Das neue Sanktionspaket
erhöht den Druck auf die russische
Kriegswirtschaft erheblich.
Kaja Kallas,
Hohe Vertreterin der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der
Kommission, sagte:„Wir haben gerade unser 19.
Sanktionspaket verabschiedet. Es richtet sich
unter anderem gegen russische
Energieunternehmen, Banken, Kryptobörsen und
Unternehmen in China. Die EU reguliert auch die
Bewegungen russischer Diplomaten, um
Destabilisierungsversuchen entgegenzuwirken. Für
Putin wird es immer schwieriger, seinen Krieg zu
finanzieren. Jeder Euro, den wir Russland
vorenthalten, ist ein Euro, den es nicht für den
Krieg ausgeben kann. Das 19. Paket wird nicht
das letzte sein.“
Die Maßnahmen im
Detail Die neuen Maßnahmen konzentrieren sich
auf Schlüsselsektoren wie Energie, Finanzen, die
militärisch-industrielle Basis,
Sonderwirtschaftszonen sowie auf die Ermöglicher
und Profiteure des russischen Angriffskrieges:
Ein vollständiges Verbot von russischem
Flüssigerdgas (LNG) und ein weiteres Vorgehen
gegen die Schattenflotte sind die bisher
schärfsten Sanktionen gegen Russlands
Energiesektor.
Die Maßnahmen zielen auch
auf Finanzdienstleistungen und Infrastruktur
(einschließlich erstmals Kryptowährungen) sowie
auf den Handel ab. Auch der
Dienstleistungssektor ist Gegenstand der
Maßnahmen, und die Instrumente zur Bekämpfung
von Umgehungen werden gestärkt. Mit diesem Paket
steigt die Zahl der gelisteten Schiffe in
Russlands Schattenflotte auf insgesamt 557.
Verbot von russischem Flüssigerdgas
Maria Luís Albuquerque, EU-Kommissarin für
Finanzdienstleistungen und die Spar- und
Investitionsunion, erklärte: „Mit diesem 19.
Paket setzen wir eine breite Palette
zusätzlicher Maßnahmen ein, um die schwächelnde
russische Wirtschaft noch weiter zu schwächen.
Ein Verbot von Flüssiggas wird dort ansetzen, wo
es am meisten weh tut, während zusätzliche
Maßnahmen zu Finanzdienstleistungen -
einschließlich Kryptowährungen - und strengere
Maßnahmen zur Bekämpfung von Umgehungen
ebenfalls eine starke Wirkung haben werden.
Der Umfang und die Tiefe dieser Maßnahmen
unterstreichen unsere unermüdliche
Entschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen.
Wir werden weiterhin neue Maßnahmen entwickeln
und umsetzen, solange es nötig ist.“
Dan
Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und
Wohnungswesen, ergänzte: „Europa hat eine
historische Entscheidung getroffen. Wir werden
alle Einfuhren von russischem Flüssiggas bis
Ende 2026 stoppen und gegen die
Öl-Schattenflotte vorgehen. Dies ist ein
beispielloser Schritt, den die EU in Einigkeit
und voller Solidarität mit der Ukraine
unternimmt.
Er wird Putins Kriegsmaschine
einen schweren Schlag versetzen und die
Friedensbemühungen für Kiew unterstützen. Europa
muss seine Energieunabhängigkeit zurückgewinnen.
Die Ukraine muss sich durchsetzen.“
Eine
ausführliche Liste der beschlossenen Sanktionen
finden Sie in Kürze im Amtsblatt
der EU.
Moers: Infoabend
über die bereichernde Aufgabe als Pflegefamilie
Manchmal können Kinder aus ganz
unterschiedlichen Gründen nicht in ihren
leiblichen Familien auswachsen. In solchen
Situationen bieten Pflegefamilien den Kindern
einen sicheren Ort, liebevolle Versorgung und
Förderung. Deshalb sucht der Pflegekinderdienst
(PKD) der Stadt Moers herzliche und geduldige
Menschen, die die Kinder aufnehmen und sich um
sie kümmern möchten.
Am Dienstag, 28.
Oktober, findet von 17 bis 19 Uhr in den Räumen
des Pflegekinderdienstes in Utfort, Rathausallee
141, ein Informationsnachmittag über diese
bereichernde Aufgabe statt. Das Team des PKD
vermittelt Interessierten einen Überblick über
die Voraussetzungen, die eine Pflegefamilie
mitbringen sollte.
Aktuell betreuen die
Mitarbeitenden etwa 120 Kinder in Dauer- und
Bereitschaftspflegefamilien. Zudem bieten sie
fachliche Begleitung durch persönliche
Ansprechpartnerinnen und -partner, Schulungen,
Fortbildungen, Pflegegeld und Zusatzleistungen.
An dem Info-Nachmittag steht das Team
des PKD für alle Fragen zum Thema zur Verfügung.
Wer sich vorstellen kann, einem Kind ein
liebevolles Zuhause auf Zeit zu geben, ist
herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Flick-Café
Neu_Meerbeck: Von Herbstfarben zum Adventszauber
Ein fehlender Knopf, ein kleiner Riss oder ein
verblasster Stoff – oft braucht es nur ein paar
Handgriffe, um alten Lieblingsstücken neues
Leben einzuhauchen. Das Flick-Café im
Stadtteilbüro Neu_Meerbeck lädt am Dienstag, 4.
November, von 14.30 bis 17 Uhr dazu ein,
Kleidung zu reparieren, aufzuwerten und kreativ
zu gestalten.
Unter fachkundiger
Anleitung können Besucherinnen und Besucher
kleinere Defekte beheben oder Stoffe mit neuen
Details versehen. Eine erfahrene Nähexpertin
bringt Nähmaschine und Material mit und gibt
praktische Tipps für gelungene
Upcycling-Projekte. So bleibt Mode länger
tragbar und wird zur individuellen Alternative
zu schnelllebigen Trends. Während Kaffee, Tee
und Kekse für eine gemütliche Atmosphäre sorgen,
steht das Treffen diesmal ganz im Zeichen des
Übergangs von Herbstfarben zu Adventszauber.
Neben dem Nähen bleibt Zeit für Gespräche
über kreative Ideen, nachhaltige Mode und
Projekte aus dem Stadtteil. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich – einfach vorbeikommen,
mitmachen und sich inspirieren lassen.
Rückfragen und weitere Informationen:
Stadtteilbüro Neu_Meerbeck, Telefon: 0 28 41 /
201-530, E-Mail: stadtteilbuero.meerbeck@moers.de
Enni liest Zähler bei 3.900
Kunden ab - Ableseteam im November in Vluyn
unterwegs
Das Ableseteam der ENNI Energie & Umwelt
Niederrhein (Enni) ist im Zuge des sogenannten
rollierenden Ableseverfahrens im November in
Neukirchen-Vluyn unterwegs. „Dieses Mal erfassen
wir im Ortsteil Vluyn bei etwa 3.900
Haushaltskunden rund 6.100 Strom-, Gas- und
Wasserzählerstände. Dabei unterstützt uns die
Dienstleistungsgesellschaft ASL Services“,
informiert Lisa Bruns als zuständige
Mitarbeiterin der Enni.
Sind vereinzelte
Zähler nicht für die Ableser der ASL zugänglich,
hinterlassen sie eine Informationskarte im
Briefkasten. „Die Bewohner finden darauf die
Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, an die sie
die Zählerstände selbst mitteilen können“, sagt
Bruns.
Wichtiger Hinweis: Die Ablesung
erfolgt jährlich. Als wiederkehrendes Ereignis
informiert die Enni die Kunden nicht gesondert
darüber. Dennoch hofft Lisa Bruns auf deren
Unterstützung: „Wichtig für uns ist, dass die
Zähler frei zugänglich sind. Nur so ist ein
schneller und reibungsloser Ablauf
gewährleistet.“
Übrigens: Damit keine
schwarzen Schafe in die Häuser gelangen, haben
alle durch Enni beauftragten Ableser einen
Dienstausweis. Bruns: „Den sollten sich Kunden
zeigen lassen, damit keine ungebetenen Gäste ins
Haus gelangen.“ Im Zweifel sollten sich Kunden
bei der Enni unter der kostenlosen
Service-Rufnummer 0800 222 1040 informieren.
Zu Fuß, mit dem
Rad oder doch mit dem Auto? Wie bewegen sich die
Menschen in Wesel fort? – Stadt Wesel startet
Mobilitätsbefragung
Mobilität betrifft alle Menschen – auf dem Weg
zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit –
täglich werden in Wesel viele verschiedene Wege
zurückgelegt. Und nicht nur die Wege, sondern
auch die Fortbewegungsmittel sind vielfältig –
ob mit dem Bus, dem Auto, dem Fahrrad oder zu
Fuß.
Im Auftrag der Stadt Wesel wird
das Ingenieurbüro Helmert aus Aachen eine
Mobilitätsbefragung in Wesel durchführen, um
neue Erkenntnisse zum Mobilitätsverhalten der
Menschen in Wesel zu gewinnen. Die Aufteilung
aller Wege der Bevölkerung Wesels auf die
verschiedenen Verkehrsmittel bildet den
sogenannten Modal Split. Ein Kennwert, der somit
Auskunft gibt über die real existierende
Verkehrszusammensetzung inklusive Fußgänger- und
Radfahreranteilen.
Diese Verteilung
kann verlässlich und repräsentativ durch eine
Haushaltsbefragung ermittelt werden. Der Modal
Split ist unter anderem von Bedeutung, da
hieraus Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeit des
Verkehrssystems gezogen werden können.
Insbesondere die Förderung der Verkehrsmittel
des Umweltverbundes (Fuß-, Radverkehr sowie
Öffentlicher Verkehr) ist für die Stadt Wesel
ein wichtiges Anliegen.
Die gewonnenen
Daten stellen eine wichtige Grundlage für
zukünftige Verkehrsplanungen dar. Darüber hinaus
dienen die Daten auch als Grundlage für andere
verkehrsrelevante Planungsentscheidungen. Die
letzten Daten, die auf diese Weise in Wesel
erhoben wurden, stammen aus dem Jahr 2019. Für
die nun durchzuführende Mobilitätsbefragung
werden Ende Oktober und Anfang und Mitte
November insgesamt 4.780 zufällig ausgewählte
Haushalte in der Stadt Wesel angeschrieben mit
der Bitte, sich an der Befragung zu beteiligen.
Die Teilnahme kann über einen digitalen
Fragebogen im Internet, schriftlich über einen
Papierfragebogen oder über ein Telefoninterview
erfolgen. Ein Teil der ausgewählten Haushalte
nimmt an einer Pilotstudie teil, in der zum
ersten Mal eine App zur Erfassung der Wegedaten
genutzt wird. Zum Einsatz kommt die
MovingLab-App des Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt (DLR), die alle
datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen
einhält.
Die Teilnahme an der
Mobilitätsbefragung ist freiwillig, liegt jedoch
auch im Interesse der Bürger*innen, da in einer
mobilen Gesellschaft jede*r auf ein gutes
Verkehrsangebot angewiesen ist. Für die
Fachplaner*innen entstehen so Kenndaten, zum
Beispiel zur Wahl der Verkehrsmittel, zum Zweck
der Mobilität und zu den Verkehrsbeziehungen
innerhalb der Stadt und mit dem Umland.
In der Mobilitätsbefragung wird für einen
konkreten Stichtag das Mobilitätsverhalten aller
Haushaltsmitglieder abgefragt. Dabei geht es um
die genutzten Verkehrsmittel, die zurückgelegten
Wegstrecken sowie den Zweck der Wege – etwa „zur
Arbeit“ oder „zum Einkaufen“. Alle Angaben
werden ausschließlich für den Zweck der
Mobilitätserhebung verwendet und können nicht
personenbezogen ausgewertet werden.
Vor
der Weiterverarbeitung werden die Daten
anonymisiert, so dass keine Rückverfolgung der
Daten möglich ist. Hierzu werden die Angaben zu
Start und Ziel der Wege auf statistische Bezirke
aggregiert. So lassen sich aus den Daten die
Verkehrsströme im Stadtgebiet in Verbindung mit
den gewählten Verkehrsmitteln ableiten und
darstellen, ohne Rückschlüsse auf einzelne
Personen ziehen zu können.
Der Rücklauf
der Fragebögen soll bis Ende November 2025
abgeschlossen sein. Die Ergebnisse werden dann
durch das Ingenieurbüro Helmert ausgewertet und
aufbereitet dargestellt. Der Abschlussbericht
zur Befragung wird dann voraussichtlich im
zweiten Quartal 2026 vorliegen.

NRW: 5,0 Millionen Menschen pendelten 2024
über ihre Gemeindegrenze zur Arbeit
* Köln, Düsseldorf und Essen waren die stärksten
Einpendelknoten.
* Holzwickede mit höchster
Einpendelquote.
* Über 31.000 Personen
pendelten aus dem Ausland nach NRW.
Im
Jahr 2024 sind 5 Millionen Menschen in
Nordrhein-Westfalen über die Grenzen ihres
Wohnortes zur Arbeit gependelt. Wie das
Statistische Landesamt mitteilt, waren das 0,1 %
mehr als ein Jahr zuvor. 4,4 Millionen Personen
wohnten in der Gemeinde, in der sie auch
arbeiteten.
Die Städte Köln (373.902),
Düsseldorf (341.422) und Essen (168.226) waren
nach wie vor die drei stärksten Einpendelknoten
in NRW und befanden sich unter den Top 10 mit
den meisten Einpendelnden in Deutschland.
Deutschlandweit pendelten die meisten nach
München, Berlin und Frankfurt Deutschlandweit
pendelten im vergangenen Jahr 24,7 Millionen
Personen (+0,5 % gegenüber 2023) über die
Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit ein.
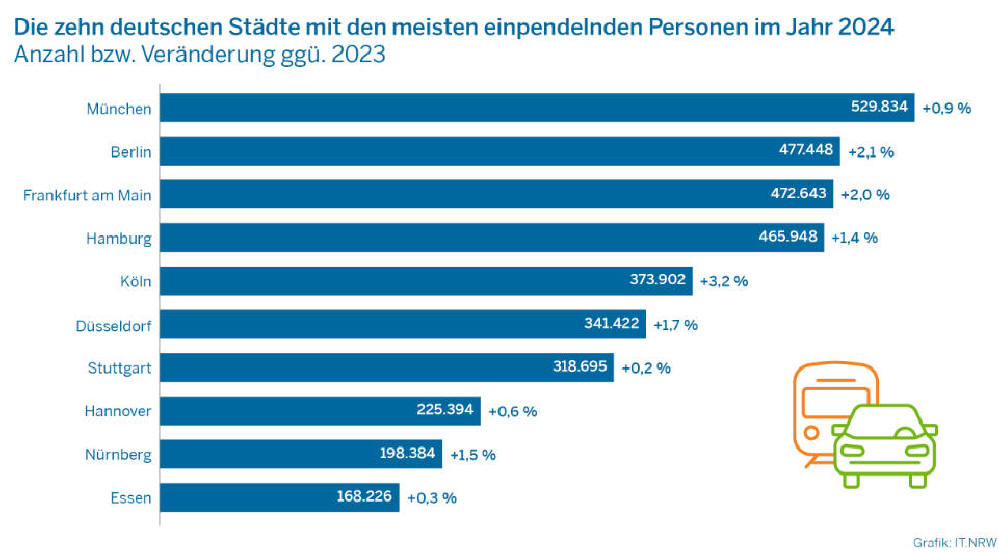
Nach München (529.834), Berlin (477.448) und
Frankfurt am Main (472.643) pendelten die
meisten Menschen. Pendleratlas aktualisiert Im
Pendleratlas
https://pendleratlas.statistikportal.de/
stellen die statistischen Ämter der Länder die
Ergebnisse der Pendlerrechnung 2024 interaktiv
dar. Unter anderem können hier deutschlandweit
Pendelverflechtungen zwischen einzelnen Städten
und Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden abgerufen
werden.
Holzwickede mit höchster
Einpendel- und Inden mit höchster Auspendelquote
Die Pendlermobilität in NRW konzentrierte
sich nach wie vor auf die Nord-Süd-Achse von
Bonn bis Duisburg und die West-Ost-Achse von
Mönchengladbach über das Ruhrgebiet bis nach
Dortmund und Bielefeld.
In 85 der 396
nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden gab
es 2024 einen Einpendelüberschuss, d. h. dort
war die Zahl der einpendelnden Personen höher
als die der auspendelnden Personen. Die höchsten
Einpendelquoten hatten Holzwickede (82,8 %) und
Tecklenburg (78,1 %), die niedrigsten wiesen
Schmallenberg (31,7 %) und Gronau (33,5 %) auf.
Die höchsten Auspendelquoten
verzeichneten Inden (85,9 %), Merzenich und
Odenthal (jeweils 84,8 %); die niedrigsten
Münster (26,1 %) und Köln (29,7 %). 31.291
Personen pendelten aus dem Ausland nach NRW Im
vergangenen Jahr pendelten insgesamt 31.291
Personen mit Hauptwohnsitz im Ausland zu ihrer
Arbeitsstätte in NRW.
Die stärksten
Verflechtungen gab es mit 3.349 Personen
zwischen Belgien und Aachen sowie mit 1.412
Personen zwischen den Niederlanden und Aachen.
In das gesamte Bundesgebiet pendelten insgesamt
254.851 Personen aus dem Ausland. Die meisten
pendelten nach Bayern (51.946) und
Baden-Württemberg (32.136), die wenigsten nach
Bremen (995) und Hamburg (4.455).
Die
stärksten Verflechtungen bestanden mit 7.358
Personen zwischen Frankreich und Saarbrücken
sowie mit 7.220 zwischen Polen und Berlin.
Angaben zu genutzten Verkehrsmitteln auf
Landesebene zeitgleich erschienen Die
Pendlerrechnung der Länder kann die genutzten
Verkehrsmittel nicht abbilden.
NRW: 14 % der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer pendelten 2024 mit Bus und Bahn zur
Arbeit Beschreibung:
* Pkw
unangefochten meistgenutztes Verkehrsmittel.
* Öffentliche Verkehrsmittel spielen in
kleineren Gemeinden nur eine untergeordnete
Rolle.
* Rund sieben von zehn Pendelnden
erreichen ihren Arbeitsplatz in weniger als
einer halben Stunde.
Der Pkw ist
unangefochten das am häufigsten von Pendlerinnen
und Pendlern genutzte Verkehrsmittel: Mit 68 %
legten im Jahr 2024 rund sieben von zehn
abhängig Erwerbstätigen in NRW ihren Arbeitsweg
überwiegend mit dem Auto zurück. Wie das
Statistische Landesamt auf Basis von
Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 weiter
mitteilt, pendelten 14 % der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern hauptsächlich mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zum Arbeitsplatz.
Weitere 10 % fuhren mit dem Fahrrad, Pedelec
oder E-Bike. Lediglich 6 % gingen zu Fuß und nur
1 % nutzte sonstige Verkehrsmittel, wie z. B.
Mofa/Motorrad. Öffentliche Verkehrsmittel
spielen in kleineren Gemeinden nur eine
untergeordnete Rolle Die für den Arbeitsweg
genutzten Verkehrsmittel unterscheiden sich
regional deutlich.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus
Kleinstädten pendeln häufiger mit dem Auto und
seltener mit Bus und Bahn als solche aus
Großstädten. So fuhren in 2024 nur 5 % der
Pendlerinnen und Pendler aus Gemeinden mit bis
zu 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, aber
80 % mit dem Pkw.
In Großstädten ab
500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nutzten
dagegen 29 % Bus und Bahn für ihren Arbeitsweg
und nur etwas mehr als die Hälfte (53 %) das
Auto. Rund sieben von zehn Pendelnden erreichten
ihren Arbeitsplatz in weniger als einer halben
Stunde Unabhängig von Verkehrsmittel und Wohnort
benötigte mit 69 % der Großteil der Pendelnden
im Jahr 2024 üblicherweise weniger als eine
halbe Stunde für den Weg zum Arbeitsplatz: Dabei
waren fast ein Fünftel (18 %) weniger als
10 Minuten unterwegs.

Gut die Hälfte (51 %) erreichte ihren
Arbeitsplatz in 10 bis unter 30 Minuten. Etwa
ein Viertel (24 %) der Pendlerinnen und Pendler
benötigte in der Regel 30 bis unter 60 Minuten
für die einfache Pendelstrecke. 6 % waren sogar
eine Stunde oder mehr unterwegs. Knapp die
Hälfte wohnte weniger als 10 Kilometer vom
Arbeitsplatz entfernt
Mit 25 % wohnte
ein Viertel der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer weniger als 5 Kilometer vom
Arbeitsplatz entfernt. Weitere 24 % hatten einen
einfachen Arbeitsweg von 5 bis unter
10 Kilometern. 29 % mussten 10 bis unter
25 Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz zurücklegen.
15 % der abhängig Erwerbstätigen pendelten 25
bis unter 50 Kilometer pro Strecke und 5 % sogar
50 oder mehr Kilometer.
Zukunft in Kleve mitgestalten:
Bürgerveranstaltung zur Fortschreibung des
Klimaschutzfahrplans
Am 4.
November 2025 können Bürgerinnen und Bürger im
Klever Rathaus am Klimaschutzfahrplan der Stadt
Kleve mitwirken. Die Stadt Kleve lädt alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger im Rahmen
der Klimaschutzwoche des Kreises Kleve herzlich
dazu ein, aktiv an der aktuell stattfindenden
Fortschreibung des Klimaschutzfahrplans der
Stadt mitzuwirken.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 04.
November 2025, ab 18:00 Uhr im Sitzungssaal (1.
OG, Raumnummer 1.29) des Rathauses Kleve,
Minoritenplatz 1 statt.
Im Zentrum des
Abends steht die gemeinsame Gestaltung des
Klimaschutzfahrplans für die Stadt Kleve. Nach
einer kurzen Einführung in die bisherigen
Klimaschutzaktivitäten der Stadt und das
aktuelle Treibhausgasbudget erhalten die
Teilnehmenden die Möglichkeit, sich aktiv
einzubringen. In einem interaktiven Workshop
möchten die Stadt Kleve Ideen, Anregungen und
Vorschläge sammeln und diskutieren.
Zu
den möglichen Themen gehören nicht nur
Sanierung, klimafreundliche Mobilität oder
erneuerbare Energien, sondern auch ein
gemeinsamer Blick auf die Bereiche
Lebensqualität, Gesundheit oder Wirtschaft in
Kleve. Auf Basis eines lockeren Austauschs zu
Themen nach Wahl der Anwesenden freut sich die
Stadt Kleve auf die Sammlung konkreter
Maßnahmenideen, mit denen die Klimaschutzziele
vor Ort weiter vorangebracht werden können.
Die Veranstaltung wird von Christoph Bors,
dem Klimaschutzmanager der Stadt Kleve, sowie
Sabine Lohoff von der Gertec GmbH begleitet.
Beide stehen den Teilnehmenden während des
Workshops beratend zur Seite und sorgen dafür,
dass jede Idee gehört wird. Die Stadt Kleve
setzt auf die Erfahrung, Kreativität und das
Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Durch
die gemeinsame Entwicklung des
Klimaschutzfahrplans entsteht ein Fahrplan, der
die Stadt nachhaltig verändert, zukunftsfähig
macht und aufzeigt, was jede und jeder Einzelne
aktiv zum Klimaschutz beitragen kann.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle
Interessierten sind eingeladen, ihre
Perspektiven einzubringen, mitzudiskutieren und
so die Zukunft der Stadt Kleve aktiv
mitzugestalten.
Weiterhin findet am
Dienstag, dem 28. Oktober 2025 um 19.30 Uhr ein
Vortrag der Klever Klimaanpassungsmanagerin
Merle Gemke im Gymnasium Goch statt. Unter der
Leitfrage "Welche Rolle spielt die
Klimaanpassung in der lebenswerten Stadt der
Zukunft?" stellt sie als ehemalige Schülerin des
Gymnasiums die Bedeutung der Klimaanpassung dar.
Der Eintritt ist frei.
Schneller zum
richtigen Arzt - „SePas digital“ hilft,
Patienten effizienter zu versorgen
Volle Notaufnahmen, lange Wartezeiten: viele
Patienten sind unsicher, an wen sie sich bei
akuten Beschwerden wenden sollen. Das Projekt
„SePas digital“ zeigt, wie moderne Technik
helfen kann, Patienten schon vor dem Besuch der
Notaufnahme gezielt zu beraten und zu steuern.
Damit sie schneller die passende medizinische
Hilfe erhalten und Kliniken entlastet werden.
Im Kern geht es darum, schnell und effizient
zu steuern, in welchem Versorgungsangebot der
Patient am besten aufgehoben ist und am
schnellsten fachärztlich versorgt werden kann.
Getragen wird das Projekt vom Klinikum
Lippe-Detmold. Es erprobt die Anwendung derzeit
im Alltag und entwickelt es weiter.
Interessierte haben am 4. November die
Möglichkeit, mehr über „SePas digital“ zu
erfahren. An diesem Tag findet um 16 Uhr die
Veranstaltung „Wege in die vernetzte Versorgung
– Digitale Patientensteuerung mit SePas digital“
des Gesundheitsnetzwerks Niederrhein e. V.
statt.
Die Teilnehmer erwarten
Impulsvorträge und Einblicke in die
Notfallversorgung und Digitalisierung im
Gesundheitswesen. Im Anschluss bleibt Zeit für
Austausch und Netzwerken bei einem Imbiss.
Anmeldungen sind unter
www.gesundheitsnetzwerk-niederrhein.de/ oder per
Mail an gnn@niederrhein.ihk.de möglich.
Mit dieser Veranstaltung setzt das
Gesundheitsnetzwerk Niederrhein ein klares
Zeichen für die Zukunft der regionalen
Gesundheitsversorgung. Als Zusammenschluss
engagierter Akteure aus dem Gesundheitswesen
verfolgt das Netzwerk das Ziel,
Versorgungsstrukturen zu verbessern, Prozesse zu
vernetzen und Innovationen zu fördern, die den
Menschen in der Region direkt zugutekommen.
Das „Gesundheitsnetzwerk
Niederrhein e.V.“ ist ein Verein, der sich auf
Initiative der Niederrheinischen IHK für eine
Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung
sowie eine Stärkung der Gesundheitswirtschaft in
der Region Niederrhein, das heißt in Duisburg,
den Kreisen Kleve und Wesel, einsetzt. Besondere
Beachtung findet zudem die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit in der Euregio Rhein-Waal.
Kreis Wesel: Endspurt für zukünftige
Kindergarten-Eltern
Das
Kreisjugendamt Wesel bittet alle Eltern, die im
nächsten Kindergartenjahr ab 1. August 2026
einen Betreuungsplatz für ihr Kind in einer
Kindertageseinrichtung benötigen, ihren
Betreuungsbedarf bis zum 1. November 2025 zu
melden.
Die Anmeldung kann bequem über
das Portal KITA-ONLINE erfolgen unter www.kreis-wesel.de/kitaonline.
Dort sind auch alle weiterführenden
Informationen zum Online-Verfahren zu finden.
Eltern können sich dort über die einzelnen
Kindertageseinrichtungen in ihrer Kommune
informieren und bis zu drei Wunsch-Kitas
angeben.
Die Bedarfsmeldung über
KITA-ONLINE ersetzt jedoch nicht das persönliche
Gespräch in der Kita. Ein Betreuungsplatz kann
nur vergeben werden, wenn vorab auch eine
persönliche Vorstellung in der
Kindertageseinrichtung erfolgt ist. Natürlich
besteht auch für Eltern ohne Internetzugang nach
wie vor die Möglichkeit, die Bedarfsmeldung in
einer Kindertageseinrichtung vornehmen zu
lassen.
Die Leitungen der
Kindertageseinrichtungen vor Ort sind dabei
behilflich. Das Kreisjugendamt benötigt die
Wünsche der Eltern für die
Kindergartenbedarfsplanung, aber allein die
Kindertageseinrichtungen entscheiden nach den
jeweiligen Aufnahmekriterien über die Vergabe
der Plätze.
Durch eine Bedarfsmeldung
in KITA-ONLINE erhalten Eltern noch nicht
automatisch einen Betreuungsplatz für ihr Kind.
Eine Platzzusage kann nur durch eine
Kindertageseinrichtung übermittelt werden. Zum
Kreisjugendamt Wesel gehören die Kommunen Alpen,
Hamminkeln, Hünxe, Neukirchen-Vluyn, Schermbeck,
Sonsbeck und Xanten. Weitergehende Auskünfte
erteilt das Jugendamt des Kreises Wesel unter
der Rufnummer 0281/207-7104.
Kreis Wesel: Förderaufruf: Unterstützung für
ehrenamtliches Engagement in der
Integrationsarbeit
Das ehrenamtliche
Engagement im Bereich Integration hat im Kreis
Wesel einen hohen Stellenwert. Freiwillige
leisten mit ihrem Einsatz einen wichtigen
Beitrag zum interkulturellen Zusammenleben und
begleiten Menschen auf ihrem individuellen Weg
der Integration.
Mit der am 17. April
2025 veröffentlichten Richtlinie zur Förderung
Kommunaler Integrationszentren schafft das Land
Nordrhein-Westfalen neue Möglichkeiten zur
Stärkung der Resilienz und zur Primärprävention
gegen Radikalisierung. Das Kommunale
Integrationszentrum (KI) Kreis Wesel erhält im
Rahmen dieser Förderung Mittel, um insbesondere
das Engagement zugunsten jugendlicher und junger
erwachsener Geflüchteter sowie Neuzugewanderter
zu unterstützen.
Ein Teil der
Fördermittel kann an Dritte weitergegeben
werden: Anerkannte gemeinnützige Organisationen
von Menschen mit Einwanderungsgeschichte sowie
weitere Initiativen der Flüchtlings- und
Integrationsarbeit im Kreis Wesel können im Jahr
2025 eine Pauschalförderung in Höhe von 1.000
Euro erhalten. Diese Mittel sollen insbesondere
dazu beitragen, ehrenamtliches Engagement zu
stärken, soziale Kontakte zu fördern und die
Einbindung junger Geflüchteter und Zugewanderter
zu verbessern.
Gefördert werden unter
anderem folgende Maßnahmen:
Sachausgaben für
Angebote des Zusammenkommens und der
Orientierung als Präventionsmaßnahme gegen
extremistische Haltungen (z. B. interkulturelle
Feste oder soziale Begegnungsangebote)
Niedrigschwellige Sprach- und Lesegruppen
Angebote zu lebenspraktischen und einfachen
handwerklichen Tätigkeiten
Freizeit- und
Beschäftigungsangebote
Maßnahmen zum
interkulturellen Dialog, insbesondere
niedrigschwellige Angebote gegen
Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung
Maßnahmen sind nur dann förderfähig, wenn sie
zwischen dem 04. Juni und 31. Dezember 2025
durchgeführt wurden oder werden. Anträge können
gestellt werden, solange Mittel verfügbar sind –
spätestens jedoch bis zum 01. Dezember 2025.
Das Antragsformular finden Sie unter
folgendem Link:
https://www.kreis-wesel.de/system/files/2025-10/Antragsformular_Pauschale_Ehrenamt.pdf
Interessierte können das das ausgefüllte
Formular per E-Mail an
integration@kreis-wesel.de schicken. Im
Anschluss prüft das KI Kreis Wesel alle Anträge
und informiert die Antragstellenden zeitnah über
die Förderfähigkeit ihrer geplanten Maßnahme.
Kleve: Motorradtouren für den guten Zweck
Die Motorradtouren der
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve
GmbH (WTM) gehören seit Jahren fest zum Stadt-
und Themenführungsprogramm und erfreuen sich
großer Beliebtheit. Unter der Leitung der
ehrenamtlichen Tourguides Karl Josef Trappe und
Annette Döing erkundeten zahlreiche Teilnehmer
in dieser Saison auf sieben Touren den
Niederrhein und die angrenzenden Niederlande –
und taten dabei Gutes: Insgesamt kamen 1.051,10
Euro an Spenden zusammen.

Der Erlös wurde nun an den Förderverein für die
Kinderabteilung des St.-Antonius-Hospitals Kleve
e.V. übergeben. Der Verein engagiert sich seit
1999 dafür, das Umfeld, die Ausstattung und das
Ambiente der Kinderstationen zu verbessern – von
Spiel- und Bastelzimmern über technische Geräte
bis hin zu einem behindertengerechten Spielplatz
auf dem Krankenhaus-gelände.
„Wir freuen
uns sehr über das Engagement der Tourguides und
die Spendenbereitschaft der Teilnehmenden“,
betont WTM-Geschäftsführerin Verena Rohde.
„Unsere Motorradtouren zeigen, wie Freizeit,
Gemeinschaft und soziales Engagement Hand in
Hand gehen können.“
Auch der Förderverein
zeigt sich dankbar: „Diese Spende hilft uns,
weiterhin Projekte umzusetzen, die den
Aufenthalt unserer kleinen Patientinnen und
Patienten so angenehm wie möglich machen und
aktuell steht die Renovierung des Spielzimmers
an“, sagt Sabrina Schmidt-Lissek, Vertreterin
des Fördervereins.
„Gerade in Zeiten
knapper öffentlicher Mittel ist jede
Unterstützung wichtig, um Kindern und ihren
Eltern in schwierigen Momenten ein Stück
Normalität zu schenken.“ Die WTM bedankt sich
herzlich bei den Tourguides Karl Josef Trappe
und Annette Döing für ihren ehrenamtlichen
Einsatz sowie bei allen Teilnehmenden der Touren
für ihre großzügigen Spenden.
Neuauflage der beliebten Weseler
„WeibsBilder“
Das Stadtarchiv
Wesel freut sich, die Neuauflage seiner 2023
erschienenen Publikation „WeibsBilder – Weseler
Frauenwege aus fünf Jahrhunderten“
bekanntzugeben. Mit zahlreichen biografischen
Porträts – von der Revolutionärin und
Frauenrechtlerin Mathilde Franziska Anneke bis
zur Chemikerin Dr. Ida Noddack - bietet das Buch
faszinierende Einblicke in die Geschichte Wesels
aus weiblicher Perspektive.

Es erzählt vielfältige Frauenschicksale vom
Spätmittelalter bis ins 21. Jahrhundert. Trotz
unterschiedlicher Lebenswege eint die
porträtierten Frauen ein bemerkenswerter
Pioniergeist sowie der Mut, Grenzen zu
hinterfragen und zu überwinden.
Nach der
Veröffentlichung im Dezember 2023 war
„WeibsBilder“ aufgrund großer Nachfrage schnell
vergriffen. Ab sofort ist das Buch wieder zum
Preis von 20,00 Euro direkt im Stadtarchiv oder
über den Buchhandel erhältlich. Das Buch eignet
sich hervorragend als hochwertiges
Weihnachtsgeschenk.
Verleihung des Ehrenamtspreises 2025 –
Bekanntgabe der Preisträger*innen
Seit 2013 wird jährlich der Ehrenamtspreis der
Stadt Wesel vergeben. Der Haupt- und
Finanzausschuss hat am 23. September 2025
beschlossen, erneut zehn Personen und Gruppen
auszuzeichnen.
Die Preisträger*innen
sind:
Luc Eben
Margret Radsak
Eva Riehl
und Nathalie Makrlik
Evangelische Jugend im
Kirchenkreis Wesel
Bernhard Tepass
Peter
Mlodzieniewski
Marinekameradschaft Wesel e.
V.
Ehrenamtler*innen der Elternselbsthilfe
der Wohngemeinschaft Bislich
Hubertus
Hilgendorff
Halyna Fritz
Die Würdigung ist
verbunden mit einer Ehrenurkunde der Stadt
Wesel. In Anlehnung an den „Internationalen Tag
des Ehrenamtes“ sollen den Preisträger*innen in
einer Feierstunde am Samstag, 6. Dezember 2025,
die Ehrenamtspreise der Stadt Wesel verliehen
werden.
Kriterien
Bei der Auswahl der
zu Ehrenden wurden die folgenden, vom Rat
beschlossenen Kriterien zugrunde gelegt:
Die Personen, Gruppen oder Vereine engagieren
sich freiwillig und unentgeltlich für das
Gemeinwohl. Die zu Ehrenden sind seit mindestens
drei Jahren ehrenamtlich tätig.
Eigenvorschläge sind nicht zulässig. Gruppen und
Vereine dürfen aber Personen aus ihren eigenen
Reihen vorschlagen.
Die Vorschläge sind
schriftlich zu begründen.
Ehrungen von
Personen, Gruppen oder Vereinen in zwei
aufeinander folgenden Jahren sind nicht möglich.
Es werden nur Vorschläge von im Stadtgebiet
Wesel ehrenamtlich Tätigen angenommen.
Ablauf
Nach einem Pressegespräch am 22. Mai
2025 erfolgte der Aufruf in der lokalen Presse,
bis zum 15. August 2025 Vorschläge für mögliche
Ehrenamtspreisträger*innen einzureichen.
Zeitgleich wurde dieser Aufruf auf der Homepage
der Stadt Wesel veröffentlicht.
Zudem wurden
Weseler Vereine, Verbände und Institutionen
angeschrieben mit der Bitte, Vorschläge für
mögliche Ehrenamtspreisträger*innen
einzureichen. Mit dem Anschreiben wurde ein
Vorschlagsbogen versandt. Über ein
Online-Formular auf der städtischen
Internetseite konnten Vorschläge zudem digital
eingereicht werden.
Am 3. September 2025
hat eine Kommission, bestehend aus Vertretern
des Seniorenbeirates, des Stadtjugendringes und
der Verwaltung sowie einem Mitglied des
Jugendrates, aus den eingegangenen Vorschlägen
zehn mögliche Preisträger*innen nominiert. Der
Haupt- und Finanzausschuss hat diese zehn
Personen und Gruppen in seiner Sitzung am 23.
September 2025 gewählt.
-

NRW: Mehr als ein Fünftel der
abhängig Beschäftigten arbeitete 2024
zumindest zeitweise im Homeoffice
*
Homeoffice-Quote seit 2021
deutschlandweit relativ stabil.
*
Häufigkeit der Homeoffice-Nutzung in
allen Bundesländern rückläufig.
22,9 % der abhängig Beschäftigten (ohne
Auszubildende) in NRW arbeiteten 2024
mindestens einen Tag in der Woche von zu
Hause aus. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches
Landesamt anhand von Erstergebnissen des
Mikrozensus 2024 weiter mitteilt, lag
NRW damit nah am Bundesdurchschnitt von
22,7 %.
Im bundesweiten
Vergleich verzeichneten die Stadtstaaten
Hamburg (35,6 %) und Berlin (31,2 %)
sowie Hessen (27,4 %) im Jahr 2024 die
höchsten Homeoffice-Quoten. Die
geringsten Homeoffice-Quoten wiesen
Mecklenburg-Vorpommern (14,1 %),
Thüringen (13,5 %) und Sachsen-Anhalt
(10,9 %) auf. Homeoffice-Quote seit 2021
deutschlandweit relativ stabil Während
der Corona-Pandemie im Jahr 2021 haben
viele Unternehmen verstärkt auf
Homeoffice gesetzt.
Für
insgesamt gut sechs Monate gab es sogar
eine bundesgesetzliche Pflicht für
Arbeitgeber, ihren Angestellten unter
bestimmten Bedingungen Homeoffice zu
ermöglichen. Ende März 2022 liefen diese
Regelungen vollständig aus. Der Anteil
der abhängig Beschäftigten, die ihre
berufliche Tätigkeit zumindest teilweise
im Homeoffice ausübten, hat sich seitdem
nur wenig verändert.
In
Nordrhein-Westfalen gab es gegenüber
2021 einen vergleichsweise moderaten
Rückgang von 1,1 Prozentpunkten. Den
größten Rückgang verzeichnen Berlin mit
3,9 Prozentpunkten und Hamburg mit
2,8 Prozentpunkten. Im
Bundesdurchschnitt ist die
Homeoffice-Quote seit 2021 mit nur einem
Rückgang von 0,7 Prozentpunkten relativ
stabil geblieben.
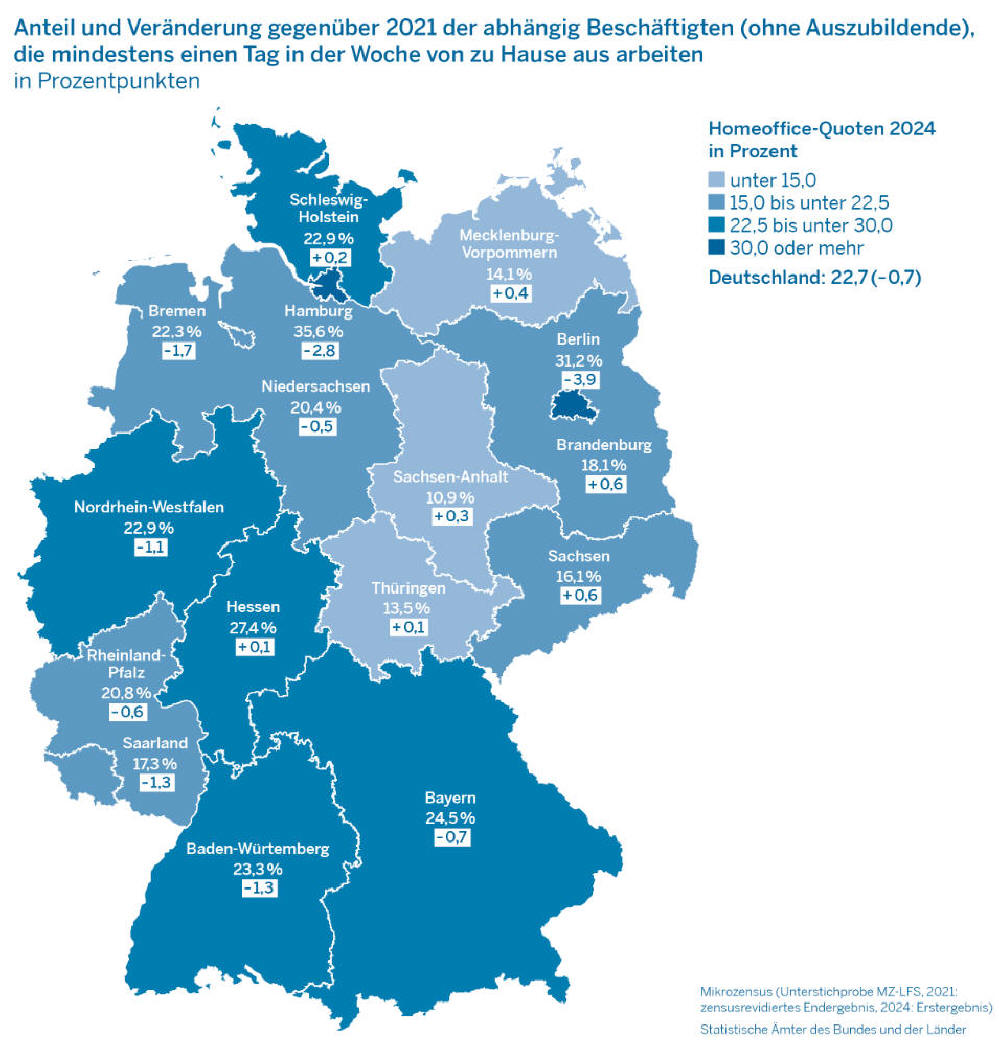
Daten der Abbildung
https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/307k_25.xlsx
XLSX, 164,8 KB
Häufigkeit der
Homeoffice-Nutzung in allen
Bundesländern rückläufig
Homeoffice
bleibt in Deutschland weiterhin
attraktiv. Das Ende der
Pandemie-Maßnahmen – insbesondere der
vorübergehenden Pflicht zum Homeoffice –
zeigt sich jedoch in einer deutlichen
Abnahme der Homeoffice-Tage pro Woche.
Während der Anteil der abhängig
Beschäftigten, die ihre berufliche
Tätigkeit zumindest teilweise im
Homeoffice ausübten, in den letzten drei
Jahren stabil geblieben ist, ist die
Häufigkeit der Homeofficenutzung bei
diesen Personen rückläufig.
Der
Anteil unter den Homeoffice-Nutzenden,
die an jedem Arbeitstag von zu Hause aus
arbeiten, hat in allen Bundesländern
abgenommen. In Nordrhein-Westfalen hat
sich dieser Anteil von 40,3 % im Jahr
2021 auf 20,0 % im Jahr 2024 halbiert.
Im Bundesländervergleich zeigt
sich der stärkste Rückgang in Hessen und
Hamburg: Dort sank der Anteil unter den
abhängig Beschäftigten mit
Homeofficenutzung, die arbeitstäglich
von zu Hause aus arbeiteten, von 39,8 %
bzw. 36,4 % im Jahr 2021 auf 17,7 % bzw.
14,4 % im Jahr 2024 (−22,1 Prozentpunkte
bzw. −22,0 Prozentpunkte).
In
Thüringen war der Rückgang am
geringsten: 2021 arbeiteten hier 32,8 %
der Beschäftigten mit Homeoffice an
jedem Arbeitstag von zu Hause, im Jahr
2024 lag ihr Anteil nur noch bei 24,6 %
(−8,2 Prozentpunkte)
NRW:
Mehr Gästeankünfte und Übernachtungen
aus dem Ausland im August
*
2,4 % mehr Gästeankünfte und 2,3 % mehr
Übernachtungen als im August 2024.
*
Trend der steigenden Ankünfte und
Übernachtungen ausländischer Gäste
zeichnet sich weiter ab.
In den
nordrhein-westfälischen
Beherbergungsbetrieben ist die Zahl der
Gästeankünfte im August 2025 mit rund
2,30 Millionen um 2,4 % höher
ausgefallen als im August 2024. Damals
wurden rund 2,24 Millionen Ankünfte
verzeichnet. Wie Information und Technik
Nordrhein-Westfalen als Statistisches
Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse
mitteilt, stieg gleichzeitig die
Gesamtzahl der Übernachtungen auf rund
5,31 Millionen.
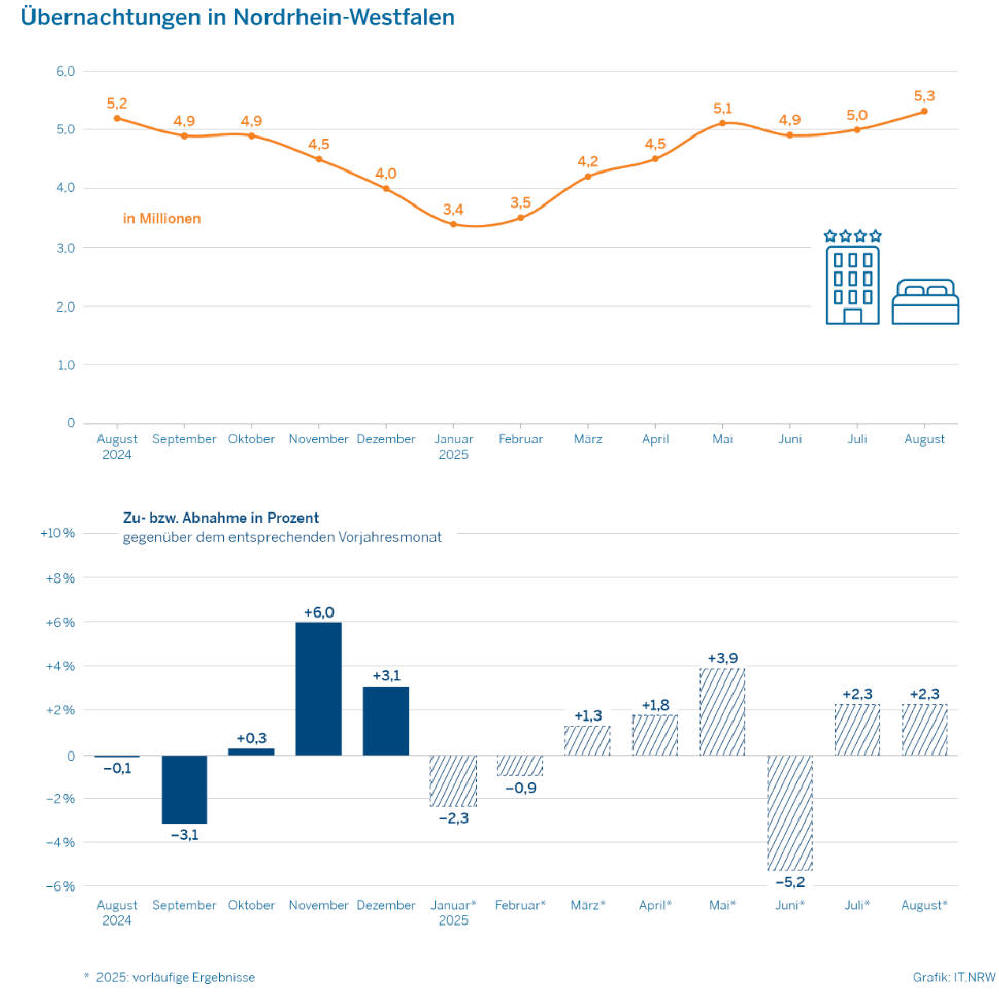
Da es im August
2024 noch rund 5,19 Millionen waren,
entspricht das einer Zunahme von 2,3 %.
Gäste aus dem Ausland machten gut ein
Viertel an den Ankünften und
Übernachtungen aus Im August 2025 lag
die Zahl der Ankünfte von Gästen aus dem
Ausland mit 0,58 Millionen um 12,5 %
höher als im August 2024 (damals:
0,51 Millionen).
Die
Übernachtungszahlen von ausländischen
Gästen übertrafen mit 1,22 Millionen
Übernachtungen und einem Zuwachs von
9,4 % das Niveau vom August 2024
(damals: ebenfalls rund 1,12 Millionen).
Der Anteil ausländischer Gäste an den
Gästen insgesamt betrug im August 2025
ca. 25 %. Die Übernachtungen
ausländischer Gäste hatten einen Anteil
von etwa 23 % an der Gesamtzahl der
Übernachtungen.
Feuerwehreinheiten aus
Duisburg sowie den Kreisen Kleve und Wesel
trainieren überörtliche Hilfeleistungen in Weeze
Die Feuerwehr Duisburg nimmt am
kommenden Samstag, 25. Oktober, auf dem Gelände
der „Training Base Weeze“ am Flughafen Weeze an
einer ganztägigen Großübung der
Feuerwehr-Bezirksbereitschaft 1 des
Regierungsbezirks Düsseldorf teil.
Feuerwehreinheiten aus den Kreisen Kleve und
Wesel und aus der Stadt Duisburg stellen
gemeinsam die Bezirksbereitschaft 1. 135
Feuerwehrleute mit 35 Fahrzeugen bilden diese
schlagkräftige Truppe, die überwiegend aus
ehrenamtlichen Kräften besteht.
Die
Bezirksbereitschaft hat in der Vergangenheit
bereits mehrere reale Einsätze erfolgreich
bewältigt: Oderhochwasser in Magdeburg,
Starkregen-Einsatz in Münster, Pfingststurm Ela,
Waldbrand im Kreis Viersen sowie die
Flutkatastrophe im Kreis Mettmann und im Ahrtal.
Bei der nun geplanten Übung wird das Szenario
angenommen, dass die Bezirksbereitschaft 1 eine
örtliche Feuerwehr ersetzen muss, die mehrere
Tage im Waldbrand-Einsatz war.
Die
Einsatzkräfte der Bereitschaft müssen den
Grundschutz in einer Stadt übernehmen und
realitätsnahe Übungseinsätze bewältigen. Am
Vormittag bekämpfen vier Löschzüge simulierte
Gebäudebrände; am Nachmittag fordert ein
Großbrand in einer Tiefgarage mit Ausbreitung
auf ein Wohngebäude die Feuerwehrleute.
Ziele der Übung sind die Führung und
Koordination der Bereitschaft, das
Zusammenstellen der Einheiten in einem
Bereitstellungsraum, die geordnete Anfahrt der
35 Einsatzfahrzeuge in das Einsatzgebiet sowie
die innere Organisation während eines lang
andauernden Einsatzes – einschließlich
Verpflegung, Nachschub, Ablösung und
Reservenbildung.
In Nordrhein-Westfalen
besteht seit mehr als 20 Jahren ein System der
vorgeplanten überörtlichen Hilfe, bei der
Feuerweheinheiten kommunenübergreifend
zusammengestellt werden. Diese Einheiten kommen
bei Großeinsatzlagen und Katastrophen immer dann
zum Einsatz, wenn die örtlichen
Feuerwehreinheiten nicht mehr in ausreichender
Zahl zur Verfügung stehen und auch die
gegenseitige Hilfe der Nachbarkommunen nicht
ausreicht.
Ebenso kann die Ablösung von
Kräften bei langwierigen Einsätzen durch diese
vorgeplanten Einheiten erfolgen. Die Grundidee
ist, dass diese Feuerwehrbereitschaften in
vorgeplantem Umfang überörtlich - auch außerhalb
Nordrhein-Westfalens – autark Hilfe leisten
können. Eine 24- stündige Einsatzbereitschaft
mit eigener Verpflegung und Schlafmöglichkeiten
muss dabei ohne Unterstützung der anfordernden
Stelle gewährleistet sein.
Kulturbüro vergibt Heimatpreis der Stadt
Moers
Die Stadt Moers vergibt
2025 einen Heimatpreis im Rahmen des
Förderprogramms
‚Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen - Wir
fördern, was Menschen verbindet‘. Bewerben
können sich Vereine, Institutionen oder
Personen, die sich mit ehrenamtlichem Engagement
für den Erhalt und die Sichtbarmachung von
Heimat und Brauchtum in Moers einsetzen.
Die detaillierten Kriterien sind im
Bewerbungsformular aufgeführt. Es ist unter dem
Suchbegriff ‚Heimatpreis‘
zu finden. Das Preisgeld von insgesamt 5.000
Euro kann, je nach Antragslage, gestaffelt an
bis zu drei Preisträgerinnen und Preisträger
vergeben werden. Bewerberinnen und Bewerber
müssen das zweiseitige Formular ausfüllen und
mit Nachweisen an die E-Mail-Adresse kulturbuero@moers.de senden.
Einsendeschluss ist Samstag, 1. November.
Am 26. Oktober Spuren der Moerser
Nachtwächter verfolgen
Am
Sonntag, 26. Oktober, um 17 Uhr geht es bei der
Nachtführung durch die Gassen der Altstadt.
Startpunkt ist das Denkmal von König Friedrich
I. auf dem Neumarkt. Stadtführerin Renate
Brings-Otremba lässt als Frau eines
Nachtwächters wieder das Mittelalter der
Grafenstadt lebendig werden.
Sie erzählt
spannende wie lustige Geschichten und
Begebenheiten aus der früheren befestigten
Grafenstadt. Die Teilnahme kostet pro Person 8
Euro. Verbindliche Anmeldungen zu der Führung
sind in der Stadt- und Touristinformation von
Moers Marketing möglich: Kirchstraße 27a/b,
Telefon 0 28 41 / 88 22 6-0.
vhs Moers – Kamp-Lintfort: Mit der vhs
stark und stabil in den Herbst
Mit 11 effektiven Übungen fit in den Herbst
starten: Wie man Energie und Mut mobilisiert und
eine starke Basis für den Alltag schafft, verrät
der Kurs ‚Stark und stabil in den Herbst‘ der
vhs Moers – Kamp-Lintfort. Start ist am
Donnerstag, 30. Oktober.
Insgesamt
findet das Workout fünfmal donnerstags jeweils
ab 19 Uhr im Alten Landratsamt, Kastell 5b,
statt. Neben einer verbesserten Fitness,
versprechen die Übungen auch eine Steigerung der
Konzentrationsfähigkeit. Eine rechtzeitige
Anmeldung für den Kurs ist erforderlich und kann
telefonisch unter 0 28 41 / 201 – 565 sowie
online unter www.vhs-moers.de erfolgen.
Gegen das Feuer in der
Ukraine – Weseler Feuerwehrauto auf dem Weg nach
Samar (Ukraine)
Wenn es brennt,
ist die Feuerwehr zur Stelle. Je besser die
Ausrüstung der Rettungskräfte, desto
wahrscheinlicher ist es, dass größere
Katastrophen verhindert werden können.

v.
l. Andre Becker (Feuerwehr Wesel),
Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und der Leiter
der Feuerwehr Wesel, Thomas Verbeet
In
Samar, Wesels ukrainische Partnerstadt, fehlt es
derzeit an vielen Dingen, vor allem im Bereich
des Rettungsdienstes. Die Stadt Wesel spendet
deshalb seinen ukrainischen Freunden ein
ausrangiertes, aber funktionstüchtiges
Feuerwehrauto.
„Dieses Fahrzeug rettet
Leben. Es hat hier in Deutschland jahrzehntelang
gute Dienste erwiesen. So möge es auch den
Menschen in der Ukraine in dieser schwierigen
Zeit helfen“, hebt Bürgermeisterin Ulrike
Westkamp hervor.
Das Fahrzeug ist
hierzulande aufgrund von strengeren
Emissionswerten nicht mehr für den Dienst
dauerhaft nutzbar. Das Fahrzeug hat nur noch
einen geringen Restwert. Die Überfahrt nach
Samar in der Ukraine übernimmt das Blau-Gelbe
Kreuz, ein gemeinnütziger Verein aus Köln.
vhs Moers – Kamp-Lintfort:
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
(PME)
Wer unter Stress, innerer
Unruhe oder Schlafproblemen leidet, dem könnte
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
(PME) helfen – ein aktives
Entspannungsverfahren. Die vhs Moers –
Kamp-Lintfort bietet ab Montag, 27. Oktober,
einen entsprechenden Kurs an, der insgesamt
siebenmal immer montags ab 16 Uhr stattfindet.
Durch eine schrittweise aufbauende
Entspannung der Muskulatur soll ein tiefes
körperliches Ruhegefühl eintreten, das zu
mentaler Gelassenheit führt. Der Kurs findet im
Alten Landratsamt, Kastell 5b, statt. Die
notwendige rechtzeitige Anmeldung kann
telefonisch unter 0 28 41 / 201 - 565 oder
online unter www.vhs-moers.de erfolgen.
Umstellung der
Telefonsysteme: Verwaltungsgebäude in Moers am
Mittwoch ab 12.30 Uhr telefonisch oder per Fax
nicht erreichbar
Am Mittwoch,
22. Oktober 2025, finden ab 12.30 Uhr
Umstellungsarbeiten an den Telefonsystemen und
dem Telefonhauptanschluss am Verwaltungsstandort
Moers statt. Die Kolleginnen und Kollegen der
Fachbereiche Gesundheitswesen,
Erziehungsberatung sowie das
Dienstleistungszentrum sind unter den bekannten
Rufnummern der Systematik 02841 / 202 - …. Dann
telefonisch oder per Telefax nicht erreichbar.
Alle Dienststellen und Mitarbeitenden in
Moers können während der Umschaltungsphase über
das ServiceCenter im Kreishaus Wesel unter
0281/207-0 erreicht werden. Am Donnerstag, 23.
Oktober 2025, sind die Arbeiten abgeschlossen
und die Anschlüsse wie gewohnt zu erreichen.
Kleve: Halbseitige Sperrung der
Hoffmannallee ab Dienstag
Die
Hoffmannallee wird auf Höhe des ehemaligen
AOK-Gebäudes halbseitig gesperrt. Ab Dienstag,
21. Oktober 2025, wird für ein Neubauprojekt an
der Hoffmannallee in Kleve auf dem Gelände des
ehemaligen AOK-Gebäudes eine Betonpumpe
aufgestellt und Beton angeliefert.
Für
die Durchführung der Arbeiten muss die
Hoffmannallee auf Höhe der Hausnummern 61-65
halbseitig in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt
werden. Während der Sperrung wird der Verkehr
auf einer Strecke von rund 60 Metern einspurig
geführt. Vorrang haben an der Engstelle
Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Klever
Innenstadt kommen.
Straßenverkehr, der
in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs ist, muss
an der Baustelle entsprechend warten und den
Gegenverkehr passieren lassen. Da die Arbeiten
noch im Laufe dieser Woche abgeschlossen sein
werden, wird auf die Stellung einer temporären
Ampelanlage verzichtet.
Gleichwohl ist
damit zu rechnen, dass es an der Engstelle zu
Verkehrsbeeinträchtigungen und Wartezeiten
kommen kann. Die Stadt Kleve empfiehlt daher,
die Baustelle nach Möglichkeit zu umfahren. In
der kommenden Woche wird die Fahrbahn wieder
uneingeschränkt benutzbar sein.
Schlosspark in Moers: Kranke Buche wird
gefällt – Workshops zur Zukunft Anfang 26
Viele Moerserinnen und Moerser kennen sie: die
große Buche im Schlosspark in der Nähe des
Pulverhauses/Schlosses. Seit Jahrzehnten gehört
sie zu den prägenden Bäumen im Park.

Die
alte Buche ist von mehreren Pilzen
befallen. Der Stamm ist so stark geschwächt,
dass die Standsicherheit nicht mehr
gewährleistet ist. (Foto: pst)
Doch sie
ist so stark geschädigt, dass sie gefällt werden
muss. Enni hat bei einer Kontrolle festgestellt,
dass die alte Buche von mehreren Pilzen befallen
ist. Der Stamm ist so stark geschwächt, dass die
Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist.
Diese Maßnahme hat somit nichts mit der
geplanten Umgestaltung des Schlossparks zu tun.
Alle Fällungen im Rahmen der künftigen
Sanierung sind weiterhin ausgesetzt. Nur kranke
oder bruchgefährdete Bäume werden derzeit
entfernt.
Zukunft des Schlossparks wird
gemeinsam geplant
Die denkmalgerechte
Sanierung des historischen Schlossparks wird
aktuell mit Unterstützung eines externen
Moderators vorbereitet. Über die Zukunft des
Parks soll gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern des Grafschafter Museums- und
Geschichtsvereins und der Bürgerinitiative sowie
mit der Moerser Politik entschieden werden.
Die geplanten Workshops finden
voraussichtlich Anfang 2026 statt. Dann soll es
um zentrale Fragen gehen, z. B.: Wie lässt sich
der Charakter des Schlossparks bewahren? Wie
kann er zugleich sicher, ökologisch und
attraktiv für kommende Generationen bleiben?

NRW:
Erwerbstätigenzahl seit 1991 um 22 % gestiegen
* 1,8 Millionen Erwerbstätige mehr
in NRW.
* Anzahl der Erwerbstätigen im
Produzierenden Gewerbe stark rückläufig.
*
Anteil der Erwerbstätigen im
Dienstleistungssektor steigt hingegen um über
50 %.
Die Zahl der Erwerbstätigen
in Nordrhein-Westfalen ist zwischen 1991 und
2024 von 8,1 Millionen auf 9,8 Millionen
gestiegen. Wie das Statistische Landesamt
mitteilt, entspricht das einem Zuwachs von rund
1,8 Millionen (+21,7 %) Erwerbstätigen. Die
Entwicklung der Erwerbstätigenzahl seit 1991
fiel je nach Wirtschaftssektor unterschiedlich
aus.

Nur rund jeder fünfte Erwerbstätige
arbeitete 2024 im Produzierenden Gewerbe
Im
Sektor Produzierendes Gewerbe sank die Zahl der
Erwerbstätigen um 29 % von drei Millionen im
Jahr 1991 auf 2,1 Millionen im Jahr 2024. War
1991 noch etwa ein Drittel der Erwerbstätigen im
Produzierenden Gewerbe beschäftigt, so
verringerte sich dieser Anteil 2024 auf 21,5 %.
Demnach arbeitete nur noch rund jeder Fünfte in
diesem Wirtschaftssektor.
Nahezu vier
von fünf Erwerbstätigen waren 2024 im
Dienstleistungssektor tätig Der Anteil der
Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor wächst
hingegen weiterhin: zwischen 1991 und 2024 um
2,7 Millionen (+53 %). Mit einem Anteil von 78 %
an der Gesamtwirtschaft waren 2024 nahezu vier
von fünf Personen in diesem Sektor tätig.
Vor 35 Jahren (1991: 5,0 Millionen) waren
hier lediglich drei von fünf Erwerbstätigen
beschäftigt. Innerhalb des
Dienstleistungssektors verzeichnete der Bereich
„Finanz-, Versicherungs- und
Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und
Wohnungswesen” den größten prozentualen Zuwachs:
Hier stieg die Erwerbstätigenzahl um 121 % auf
1,7 Millionen.
Auch der
Wirtschaftsbereich „Öffentliche und sonstige
Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private
Haushalte mit Hauspersonal” wuchs kräftig:
Zwischen 1991 und 2024 erhöhte sich die Zahl der
erwerbstätigen Personen um 1,3 Millionen auf
3,4 Millionen, was einem Zuwachs von 62 %
entspricht.
Im Sektor „Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei”, dem kleinsten
Wirtschaftssektor im Land, ist grundsätzlich ein
stetiger Rückgang der Erwerbstätigenzahl
festzustellen: Die Werte verringerten sich hier
von 110.000 im Jahr 1991 auf 78.000 im Jahr 2024
(−29 ).
NRW:
Kreislauferkrankungen mit fast 30 % häufigste
Todesursache in 2024
* Bösartige
Krebserkrankungen mit 23,2 % zweithäufigste
Todesursache.
* Atemwegserkrankungen waren
bei 8,2 % der Todesfälle ursächlich.
*
Psychische und Verhaltensstörungen bei 7,5 %
todesursächlich.
Im Jahr 2024 starben
laut Todesbescheinigung in Nordrhein-Westfalen
64.785 Menschen an einer Krankheit des
Kreislaufsystems. Wie das Statistische Landesamt
mitteilt, waren Kreislauferkrankungen damit –
trotz eines geringfügigen Anteilsrückgangs um
0,1 Prozentpunkte auf 29,4 % – weiterhin die
meistverbreitete Todesursache.
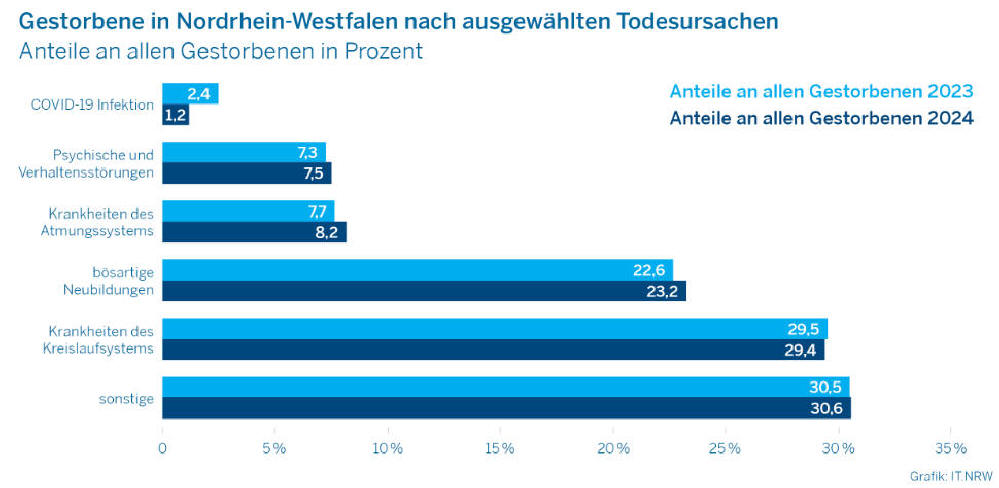
Die häufigsten Krankheitsgruppen unter den
Kreislauferkrankungen waren mit 30,7 %
ischämische Herzkrankheiten und mit 31,1 % die
Gruppe der Sonstigen Formen der Herzkrankheit.
Zu den ischämischen Herzkrankheiten zählen bspw.
Krankheitsbilder wie die chronisch ischämische
Herzkrankheit mit 13.804 gestorbenen Menschen
oder der akute Myokardinfarkt mit 5.817
Gestorbenen.
Häufigste sonstige Formen
der Herzkrankheit waren die Herzinsuffizienz mit
7.591 Todesfällen sowie Vorhofflimmern und
Vorhofflattern mit 4.640 gestorbenen Menschen.
Anteil der an bösartigen Neubildungen
Verstorbenen leicht gestiegen Zweithäufigste
Todesursache waren bösartige Neubildungen mit
51.183 Todesfällen.
Der Anteil der
Gestorbenen aufgrund dieser Todesursache stieg
gegenüber 2023 um 0,6 Prozentpunkte auf 23,2 %.
Die drei häufigsten Krebserkrankungen mit
Todesfolge waren Bronchien-/Lungenkrebs mit
11.410 Verstorbenen, Brustkrebs mit 4.037
gestorbenen Personen und
Bauchspeicheldrüsenkrebs mit 3.953 Todesfällen.
In 18.028 Fällen bzw. bei 8,2 % der Gestorbenen
waren Krankheiten des Atmungssystems
todesursächlich.
Gegenüber dem Vorjahr
entsprach dies einer Zunahme um
0,5 Prozentpunkte. Mehr als die Hälfte (53,1 %)
davon entfielen auf chronische Krankheiten der
unteren Atemwege. Bei 28,9 % der Todesfälle
aufgrund von Atemwegserkrankungen wurden
Pneumonien bzw. Lungenentzündungen (4.676 Fälle)
oder Grippe (537 Fälle) als Todesursache
erfasst.
Demenzerkrankungen häufigste
Todesursache der an Psychischen und
Verhaltensstörungen Verstorbenen
Der Anteil
der aufgrund von Psychischen und
Verhaltensstörungen Gestorbenen lag 2024 bei
7,5 % und stieg damit gegenüber 2023 um
0,2 Prozentpunkte. Insgesamt wurden 16.543
Verstorbene dieser Todesursache zugeordnet. Rund
85 % dieser Todesfälle (13.982) waren auf
Demenzerkrankungen zurückzuführen.
Weitere 7,1 % waren durch Alkohol bedingt. Die
Anzahl der laut Todesbescheinigung an COVID-19
Gestorbenen betrug 2.545 Fälle und hat sich
gegenüber 2023 anteilsmäßig von 2,4 % auf 1,2 %
etwa halbiert.
Durchschnittliches
Sterbealter blieb unverändert
Das
durchschnittliche Sterbealter der 220.432
Gestorbenen im Jahr 2024 lag in NRW bei
79,4 Jahren und blieb damit unverändert im
Vergleich zum Vorjahr. Männer starben im Schnitt
mit 76,9 Jahren, Frauen mit 81,9 Jahren und
damit durchschnittlich 5,1 Jahre später als
Männer.
Moers: Die Bastelfabrik – „Creepy
Creations“ für Kinder ab 8 Jahren
Boo!
An diesem Nachmittag wird’s bei uns gruselig:
Monster, Gespenster und Fledermäuse werden zu
schaurig-schöner Halloween-Deko. Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich, für das Material
wird ein Kostenbeitrag von 2 Euro erhoben.
Nähere Infos und Anmeldung unter Tel.: 0 28
41 / 201-751, unter jubue@moers.de oder
direkt in der Bibliothek Moers.
Veranstaltungsdatum 21.10.2025 - 15:00
Uhr - 16:00 Uhr. Veranstaltungsort
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 47441 Moers.
Moerser Quiz
Die 3
besten Teams werden mit einem Verzehr-Gutschein
belohnt. Pro Team können maximal 6 Teilnehmende
antreten, die Startgebühr beträgt pro Person 3
Euro. Anmelden könnt ihr euch dienstags bis
samstags ab 18 Uhr.
Entweder vor Ort bei
den Kellnern/Kellnerinnen selbst oder ihr ruft
kurz an (0 28 41 / 1 69 25 78). Event details
Veranstaltungsdatum 22.10.2025 - 19:30
Uhr - 22:00 Uhr Veranstaltungsort Zum Bollwerk
107, 47441 Moers.
Moers: 1. Bastelwerkstatt „Geister,
Gespenster und Co“ für Kinder ab 4 Jahren
Gespenster, Hexen, Fledermäuse und andere
„gruselige“ Kleinigkeiten können an diesem
Nachmittag gebastelt werden. Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich, für das Material
wird ein Kostenbeitrag von 2 Euro erhoben.
Nähere Infos und Anmeldung unter Tel.: 0 28
41 / 201-751, unter jubue@moers.de oder
direkt in der Bibliothek Moers.
Veranstaltungsdatum 23.10.2025 - 15:00
Uhr - 16:00 Uhr. Veranstaltungsort
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 47441 Moers.
Moers: Silent Reading Party
Viele kennen das Problem: Eigentlich wollte man
mehr lesen, aber dann kommt der Alltag
dazwischen – oder doch das Handy. Bei einer
Silent Reading Party nehmen wir uns bewusst Zeit
zum Lesen. Jede/Jeder bringt entweder ein
eigenes Buch mit oder sucht sich eines aus
unserem Bestand aus. In gemütlicher Atmosphäre,
bei Getränken und Snacks, liest erst einmal
jede/jeder für sich.
Nach der stillen
Lesezeit gibt es die Gelegenheit, sich
auszutauschen. Veranstaltungsdatum 24.10.2025 -
15:30 Uhr - 17:30 Uhr. Veranstaltungsort
Multifunktionsraum 1. OG Veranstaltungsort
Bibliothek, Zentrale Adresse
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 47441 Moers.
Moers: Familien-Quiz-Abend für Eltern
und Kinder (ab 5 Jahren)
Der
Quiz-Abend in den Sommerferien hat großen Spaß
gemacht – deshalb gibt‘s am „Tag der
Bibliotheken“ direkt einen weiteren Termin.
Welches Team kann die meisten Fragen beantworten
und wird damit zum Quiz-Meister des Abends? Für
Getränke und „Nervennahrung“ wird gesorgt.
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich,
es wird ein Kostenbeitrag von 2 Euro pro Person
erhoben. Nähere Infos und Anmeldung unter Tel.:
0 28 41 / 201-751 oder direkt in der Bibliothek
Moers. Veranstaltungsort
Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 47441 Moers.
Abendlicher Spaziergang mit Einkehr -
Moerser Altmarkt Feierabend!
Lassen Sie sich bei einem gemütlichen
abendlichen Bummel von A wie „Altmarkt“ bis Z
wie „Zwergengasse“ führen. Und hören Sie
allerlei Interessantes, mit wenigen Jahreszahlen
gespicktes, über die facettenreiche Moerser
Stadtgeschichte.

Zum geselligen Abschluss mit leckeren Häppchen
im Feinkost "Gourmoers" lassen wir den Abend
ausklingen. Geführt von Renate Brings-Otremba.
Treffpunkt: Denkmal Altmarkt
Weitere Infos zu den Stadtführungen.
Kosten: 27,20 Euro pro Person für Führung und
Verköstigung Kartenverkauf: Moers
Marketing
Veranstaltungsdatum 25.10.2025
- 18:30 Uhr - 21:30 Uhr. Veranstaltungsort
Steinstraße 7, 47441 Moers.
Moers: Der Frieden - Premiere
nach Aristophanes und Antoine Vitez
Deutsch von Claus Bremer, Hartmut Kirste und
Lothar Sprees
In "Der Frieden" ist der Krieg
nichts Neues, er ist nach 13 Jahren zum Alltag
geworden. Der Weinbauer Trygaios macht sich auf
den Weg, von den Göttern im Olymp Antworten zu
verlangen, doch die haben sich aus Enttäuschung
über die Menschen längst verabschiedet.

Bis auf den Gott des Krieges, der nun freie Bahn
für eine potenzielle Alleinherrschaft hat.
Intendant und Regisseur Daniel Kunze geht in
seiner ersten Inszenierung am Schlosstheater der
alten, aber dennoch unbeantworteten Frage nach,
warum Menschen sich bekriegen.
Eintritt: 27 Euro, ermäßigt 11 Euro Tickets
unter Telefon: 0 28 41 / 88 34-110 oder www.schlosstheater-moers.de
Veranstaltungsdatum 25.10.2025 - 19:30
Uhr - 21:30 Uhr. Veranstaltungsort Firma
Schlosstheater - Kastell 9, 47441 Moers.
Moers: Jenny Thiele: PLATZ Tour 2025
Dass elektronischer Pop
mehr sein kann als nur die Summe der einzelnen
Teile, wissen alle, die sich schon mal in einen
Diskokugel-Hit verliebt haben. Wie sehr man
dieses Prinzip aber zur Meisterschaft bringen
kann, dafür braucht es dann doch die Kölnerin
Jenny Thiele und ihr neues Album „Platz“.

Jenny Thiele hat einen Crush auf das
Zusammenlegen von Ideen und Ressourcen – sich
inspirieren, sich ausprobieren. Mit Irene Novoa
unterhält sie das Duo AnnaOtta – auf ihrer
gemeinsamen musikalischen Forschungsreise
emulieren die beiden hypnotischen Jazz mit
elektronischen Mitteln, machen Avantgarde
tanzbar. Und wie! Veranstaltungsdatum 25.10.2025
- 20:00 Uhr - 22:30 Uhr. Veranstaltungsort Zum
Bollwerk 107, 47441 Moers.
Spuren jüdischen Lebens in Moers
Seit Mitte des 17.
Jahrhunderts gibt es gesicherte Hinweise darauf,
dass Juden im niederrheinischen Moers gelebt
haben. Mit der grausamen Vernichtungspolitik der
Nationalsozialisten ist auch ein Stück unserer
eigenen Kultur und Geschichte zerstört worden.

Der Stadtrundgang führt zu den in der Stadt noch
vorhandenen Zeugnissen jüdischen Lebens. Bei
dieser Führung führt Sie Heidi Nüchter-Blömeke.
Treffpunkt: Mahnmal Synagogenbogen.
Weitere Infos zu den Stadtführungen. Kosten:
8 Euro.
Veranstaltungsdatum 26.10.2025 -
10:30 Uhr - 12:30 Uhr. Veranstaltungsort
Dr.-Hermann-Bähr-Straße, 47441 Moers
Trödelmarkt Repelen
Komm nach Repelen: Hier wird Trödeln jedes Mal
zum Erlebnis. Event details Veranstaltungsdatum
26.10.2025 - 11:00 Uhr - 18:00 Uhr
.Veranstaltungsort Markt 1-3 47445 Moers.
Veranstalter WMV Märkte & Mehr UG Adresse Hooghe
Weg 2, 47906 Kempen.
Klimaschutz in Moers: Neustart für die
Erfolgsinitiative KliMo
Insgesamt wurden neun Moerser Einrichtungen im
Rahmen der Klimaschutzinitiative KliMo
ausgezeichnet. Wie kann jeder im Alltag zum
Klimaschutz beitragen? Schon kleine
Veränderungen im Verhalten können große Wirkung
haben. Das zeigt das zgm (Zentrale
Gebäudemanagement) der Stadt Moers mit der
Klimaschutzinitiative Moers (KliMo).

Mit dem Beginn des Schuljahres 2024/25 startete
die städtische Initiative in eine neue Phase –
und das erstmals in kompletter Eigenregie. Seit
2012 sensibilisiert es Kinder, Jugendliche und
Mitarbeitende in städtischen Einrichtungen für
den verantwortungsvollen Umgang mit Energie,
Wasser und Ressourcen. Im Mittelpunkt stehen
die städtischen Kitas und Schulen, aber auch
Verwaltungsgebäude, Kultur- und
Bildungseinrichtungen sowie Sportstätten
profitieren von der Initiative.
„Unser
Ziel ist es, die Nutzenden aktiv einzubeziehen
und so ein klimafreundliches Verhalten zu
fördern“, erklärt Vanessa Meinert vom
Energiemanagement-Team.
Auszeichnung der
besten Kitas und Schulen
Das Ergebnis kann
sich sehen lassen. Allein im vergangenen
Schuljahr konnten 661 Megawattstunden Wärme und
84 Megawattstunden Strom eingespart werden. Das
entspricht einer CO₂-Reduktion von 2.219 Tonnen
innerhalb des Schuljahres – so viel, wie beim
jährlichen Stromverbrauch von 1.500 Haushalten
entstehen würde.
Neben Energieeinsparung
spielte das Thema Abfallvermeidung und -trennung
eine zentrale Rolle. Viele Einrichtungen
entwickelten dazu kreative Projekte. Die besten
Kitas und Schulen wurden am Mittwoch, 9.
Oktober, ausgezeichnet: die Kitas
Diergardtstraße, Walter-Karentz-Straße und
Wilhelm-Müller-Straße, die Grundschulen
Hülsdonk, Gebrüder-Grimm und Regenbogenschule
sowie die Justus-von-Liebig-Hauptschule, die
Heinrich-Pattberg-Realschule und
Geschwister-Scholl-Gesamtschule.
Im
Anschluss an die Urkundenverleihung stellte
Thomas Jenkes, technischer Leiter der sci:moers
gGmbH, die integrative Einrichtung
SCI:Kinderhaus auf der Kirschenallee vor. Sie
ist bereits seit 2019 als besonders
klimafreundlich ausgezeichnet. Ziel ist es,
künftig eine engere Zusammenarbeit zwischen der
Ackerschule, einem pädagogischen Projekt der
SCI:Gemeinschaftsschule in Moers, bei dem Kinder
draußen in der Natur lernen, und den Kitas sowie
Schulen zu fördern.
KliMo wirkt über die
Grenzen der Einrichtungen hinaus
„Besonders
hat es mich gefreut, dass die Kinder und
Jugendlichen das neu erlernte Wissen und neue
Verhaltensweisen wie Mülltrennung und Stoß-
statt Kipplüftung mit nach Hause nehmen. Dadurch
sehen wir, dass wir mit KliMo mehr erreichen
können, als wir durch die Verbräuche allein
messen können“, erzählt Vanessa Meinert im
anschließenden Austausch.
Diese
Erfahrung zeigt, dass KliMo weit über die
Grenzen der Einrichtungen hinauswirkt.
Besonders engagiert zeigten sich im vergangenen
Jahr die Grundschulen, die allein 52 Prozent
aller erreichten Punkte erzielten. Sie beweisen,
dass nachhaltiges Handeln bereits im Kindesalter
beginnt. Das zgm möchte an diesen Erfolg
anknüpfen und KliMo weiterentwickeln – mit neuen
Ideen, frischen Impulsen, um den Klimaschutz
noch stärker im Alltag zu verankern.
Ein
ausführlicher Artikel mit Informationen zu
Verbräuchen, Punktzahlen und den besten
Einrichtungen findet sich unter https://klimo.moers.de/news-2/artikel/klimo-praemien-fuer-das-schuljahr-2024-25-stehen-fest.
Besonders erfreulich: Auch teilnehmende Kitas
und Schulen, die nicht ausgezeichnet wurden,
erhalten eine Prämie.
Wesel: KI
& ChatGPT praktisch nutzen
Künstliche Intelligenz ist längst Teil des
Alltags – ob beim Schreiben, Übersetzen, Lernen
oder Organisieren. Wie sich diese Technologien
sinnvoll und sicher einsetzen lassen, zeigt die
vhs Wesel-Hamminkeln-Schermbeck im neuen Kurs
„KI & ChatGPT praktisch nutzen“, der am Montag,
27. Oktober, startet.
An fünf Terminen,
jeweils ab 17:30 oder 19:15 Uhr, lernen die
Teilnehmenden praxisnah, welche Möglichkeiten
KI-Anwendungen bieten und wie sie im beruflichen
und privaten Alltag unterstützen können. Der
Kurs vermittelt Grundlagen und zeigt konkrete
Beispiele für den produktiven, kreativen und
verantwortungsvollen Umgang mit KI-Werkzeugen.
Die Teilnahmegebühr beträgt 75,00 Euro.
Weitere Informationen und Anmeldung unter
0281-203 2590 oder www.vhs-wesel.de
iPhone-Kurs für Einsteiger und
Einsteigerinnen
Allen, die die
Funktionen ihres iPhones oder iPads besser
ausschöpfen möchten, bietet die vhs Moers –
Kamp-Lintfort einen Kurs für Einsteigerinnen und
Einsteiger. Start ist am Montag, 27. Oktober, um
18 Uhr in den Räumen der vhs,
Wilhelm-Schroeder-Straße 10. Das Seminar findet
insgesamt dreimal statt.
Neben einer
kompakten Einführung in die grundliegenden
Funktionen gibt es auch viele Tipps zur
Adressenverwaltung, zum Anlegen von Terminen,
zum Laden von Apps sowie zur Sicherung der Daten
über iCloud. Der Kurs ist ausschließlich für
Apple-Geräte geeignet.
Neben dem iPhone
oder iPad sollte auch ein Ladekabel mitgebracht
werden. Eine rechtzeitige Anmeldung für den Kurs
ist erforderlich und kann telefonisch unter 0 28
41 / 201 – 565 oder online unter www.vhs-moers.de erfolgen.
vhs Moers – Kamp-Lintfort: Infoabend
über Leistungen der Pflegeversicherung
Wann gilt man als pflegebedürftig? Wie wird
ein Antrag auf Pflegebedürftigkeit gestellt?
Diese und weitere Fragen rund um das Thema
beantwortet der Vortrag ‚Leistungen der
Pflegeversicherung‘ der vhs Moers –
Kamp-Lintfort am Donnerstag, 30. Oktober.
Im Alten Landratsamt, Kastell 5b, gibt es ab
18 Uhr Infos zur Pflegebedürftigkeit und zu den
Leistungen der Pflegekasse. Die Veranstaltung in
Kooperation mit dem Caritasverband Moers-Xanten
e.V. richtet sich an Betroffene und Angehörige
von Pflegebedürftigen mit und ohne Demenz.
Für den kostenlosen Abend ist eine vorherige
Anmeldung notwendig. Diese ist telefonisch unter
0 28 41/201 – 565 und online unter www.vhs-moers.de möglich.

Exporte von Eisen und
Stahl sinken in den ersten acht Monaten um 4,8 %
• Eisen- und Stahlexporte in die
USA weniger stark gesunken als die deutschen
Eisen- und Stahlexporte insgesamt
• 6,2 %
aller Exporte von Eisen und Stahl gehen in die
USA
• Wichtigstes Zielland für deutsche
Eisen- und Stahlexporte ist Polen
Seit dem 12. März 2025
erheben die USA für den Import von Eisen, Stahl
und Aluminium sowie Waren daraus Zusatzzölle in
Höhe von 25 %. Seit dem 4. Juni 2025 betragen
die Zusatzzölle 50 %. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden von Januar
bis August 2025 Eisen und Stahl sowie Waren
daraus im Wert von 2,5 Milliarden Euro aus
Deutschland in die Vereinigten Staaten
exportiert.
Im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum sanken die Exporte dieser
Handelsgüter in die USA um 2,3 %. Damit sanken
die Eisen- und Stahlexporte in die USA in den
ersten acht Monaten 2025 weniger stark als die
deutschen Eisen- und Stahlexporte insgesamt, die
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,8 % auf
39,9 Milliarden Euro zurückgingen. Dies ist der
niedrigste Wert für die ersten acht Monate eines
Jahres seit dem Jahr 2021, als Eisen- und
Stahlprodukte im Wert von 36,7 Milliarden Euro
exportiert wurden.
6,2 % aller deutschen Eisen-
und Stahlexporte gehen in die USA Insgesamt
gingen 6,2 % der deutschen Eisen- und
Stahlexporte von Januar bis August 2025 in die
USA. Damit lagen die Vereinigten Staaten auf
Rang 6 der wichtigsten Abnehmerstaaten dieser
Handelsgüter. Die meisten deutschen Eisen- und
Stahlexporte wurden in Staaten der Europäischen
Union (EU) geliefert.
Rang 1 belegte
Polen mit 3,7 Milliarden Euro oder 9,3 % aller
Eisen- und Stahlexporte, danach folgten
Frankreich (3,2 Milliarden Euro beziehungsweise
8,1 %) und die Niederlande (3,0 Milliarden Euro
beziehungsweise 7,6 %).
Im gesamten Jahr
2024 hatte Deutschland Eisen und Stahl sowie
Waren daraus im Wert von 60,6 Milliarden Euro
exportiert. Die Vereinigten Staaten lagen dabei
mit 3,8 Milliarden Euro oder 6,2 % der
Gesamtexporte im Jahr 2024 auf Rang 5 der
wichtigsten Abnehmerstaaten.
Importe von
Eisen und Stahl in den ersten acht Monaten 2025
insgesamt rückläufig Nach Deutschland importiert
wurden in den ersten acht Monaten 2025 Eisen und
Stahl im Wert von 34,0 Milliarden Euro. Das
waren 2,7 % weniger als im Vorjahreszeitraum
(darunter USA: 555 Millionen Euro; +7,6 %).
Damit fielen die Eisen- und Stahlimporte in den
ersten acht Monaten 2025 auf den niedrigsten
Stand seit 2020: Von Januar bis August 2020
wurden Eisen und Stahl sowie Waren daraus im
Wert von 25,2 Milliarden Euro nach Deutschland
importiert.
Wichtigstes Herkunftsland
von Eisen- und Stahlimporten war von Januar bis
August 2025 Italien. Von dort kamen 3,9
Milliarden Euro beziehungsweise 11,4 % der
Importe dieser Handelsgüter. Auf Rang 2 und 3
befanden sich Österreich (3,1 Milliarden Euro
beziehungsweise 9,0 %) und China (3,0 Milliarden
Euro beziehungsweise 8,9 %).
Aluminiumexporte in die USA sinken um 7,4 % zum
Vorjahreszeitraum
In den ersten acht Monaten
2025 exportierte Deutschland Aluminium und Waren
daraus im Wert von insgesamt
12,6 Milliarden Euro. Das waren 5,1 % mehr als
im Vorjahreszeitraum. Mengenmäßig gingen im
gleichen Zeitraum die Exporte dieser Güter um
0,2 % zum Vorjahr zurück.
In die
Vereinigten Staaten wurden Aluminium und Waren
daraus im Wert von 419 Millionen Euro geliefert.
Das entsprach einem Rückgang um 7,4 % gegenüber
dem Vorjahreszeitraum und einem wertmäßigen
Anteil von 3,3 % an den gesamten deutschen
Aluminiumexporten. Die USA lagen damit auf
Rang 10 der wichtigsten Abnehmerstaaten dieser
Handelsgüter.
Wie bei Eisen und Stahl
gingen auch bei Aluminium und Waren daraus die
meisten Exporte in EU-Mitgliedstaaten, vor allem
nach Frankreich (1,2 Milliarden Euro
beziehungsweise 9,7 % der gesamten
Aluminiumexporte), Österreich
(1,2 Milliarden Euro beziehungsweise 9,4 %) und
Polen (1,1 Milliarden Euro beziehungsweise
9,1 %).
In den ersten acht Monaten des
Jahres 2025 importierte Deutschland Aluminium
und Waren daraus im Wert von 13,8 Milliarden
Euro. Das waren 5,0 % mehr als im
Vorjahreszeitraum. Mengenmäßig gingen die
Aluminiumimporte um 1,6 % zurück. Wichtigste
Herkunftsländer für Aluminium und Waren daraus
waren in den ersten acht Monaten 2025 die
Niederlande (1,4 Milliarden Euro beziehungsweise
9,8 % der gesamtem Aluminiumimporte), Österreich
(1,2 Milliarden Euro beziehungsweise 8,7 %) und
Italien (1,1 Milliarden Euro beziehungsweise
8,0 %).
Auftragsbestand im Verarbeitenden
Gewerbe im August 2025: +0,1 % zum Vormonat
August 2025 +0,1 % real zum Vormonat
(kalender- und saisonbereinigt)
+5,0 % real
zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Reichweite des Auftragsbestands 7,9 Monate
Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand
im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen
Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) im August 2025 gegenüber Juli 2025
saison- und kalenderbereinigt um 0,1 %
gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat
August 2024 stieg der Auftragsbestand
kalenderbereinigt um 5,0 %.
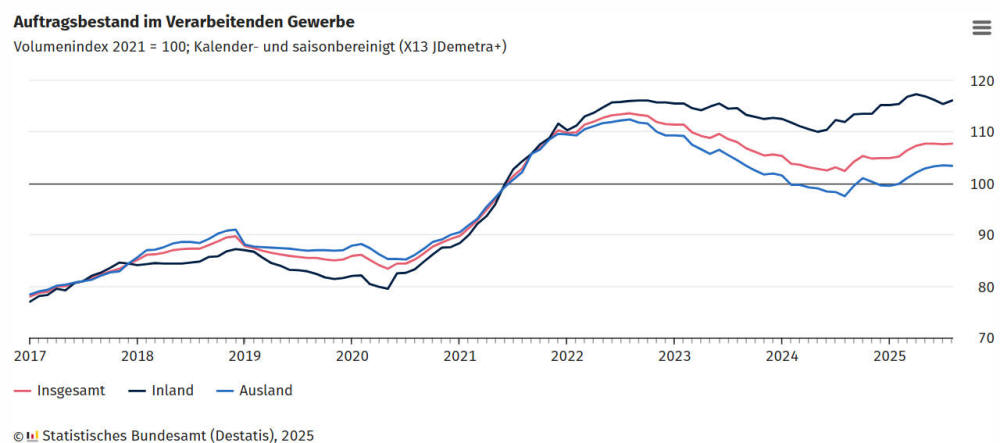
Die leicht positive Entwicklung des
Auftragsbestands gegenüber dem Vormonat ist auf
Anstiege im Maschinenbau (saison- und
kalenderbereinigt +1,1 %) und im Sonstigen
Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge,
Militärfahrzeuge) mit +0,9 % zum Vormonat
zurückzuführen.
Negativ auf das
Gesamtergebnis wirkte sich hingegen der Rückgang
in der Automobilindustrie mit -5,1 % aus. Die
offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im
August 2025 gegenüber Juli 2025 um 0,6 %, der
Bestand an Aufträgen aus dem Ausland fiel
hingegen um 0,1 %. Bei den Herstellern von
Vorleistungsgütern stieg der Auftragsbestand zum
Vormonat Juli 2025 um 1,3 %.
Bei den
Herstellern von Investitionsgütern sank er um
0,1 %, bei den Herstellern im Bereich der
Konsumgüter sank er um 0,4 %. Reichweite des
Auftragsbestands auf 7,9 Monate gestiegen Im
August 2025 stieg die Reichweite des
Auftragsbestands auf 7,9 Monate (Juli 2025:
7,8 Monate).
Bei den Herstellern von
Investitionsgütern blieb die Reichweite konstant
bei 10,7 Monaten, bei den Herstellern von
Vorleistungsgütern bei 4,3 Monaten und bei den
Herstellern von Konsumgütern bei 3,6 Monaten.
Die Reichweite gibt an, wie viele Monate
die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne
neue Auftragseingänge theoretisch produzieren
müssten, um die vorhandenen Aufträge
abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus
aktuellem Auftragsbestand und mittlerem Umsatz
der vergangenen zwölf Monate im betreffenden
Wirtschaftszweig berechnet.
Dinslaken: Energie sparen,
Kosten senken, Zukunft sichern: ÖKOPROFIT im
Kreis Wesel startet in die 8. Runde
Mit dem Start der 8. Runde des Projekts
ÖKOPROFIT bieten der Kreis Wesel und seine
Kommunen Unternehmen, sozialen Einrichtungen,
Vereinen sowie kommunalen Betrieben erneut die
Möglichkeit, durch gezielte Maßnahmen
Betriebskosten zu senken und nachhaltiger zu
wirtschaften.
Ein Jahr lang profitieren
die Teilnehmenden von intensiver fachlicher
Begleitung: In Einzelberatungen und praxisnahen
Workshops werden konkrete Einsparpotenziale
identifiziert, Betriebsabläufe optimiert und der
Einsatz erneuerbarer Energien geprüft. Auch die
Anpassung an die Folgen des Klimawandels wird in
den Fokus genommen.
Die gemeinsamen
Workshops fördern zudem den
branchenübergreifenden fachlichen Austausch und
stoßen zu Umsetzungen an. „Unser Ziel ist es,
gemeinsam mit den Betrieben den Energie- und
Ressourcenverbrauch dauerhaft zu senken und
zugleich die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken“,
betont das Projektteam.
Nach
erfolgreichem Abschluss erhalten die
Teilnehmenden das offizielle
ÖKOPROFIT-Zertifikat, das als Nachweis für
nachhaltiges Wirtschaften öffentlichkeitswirksam
eingesetzt werden kann. ÖKOPROFIT ist zudem ein
möglicher Einstieg in ein Umwelt- oder
Energiemanagement nach ISO 14001 bzw. ISO 50001
sowie in eine klimaneutrale Betriebsführung.
Bilanz der letzten Runde: 10 teilnehmende
Unternehmen haben mehr als 52 t/a Abfall, über
20.000 km/a und über 700.000 kWh/a Energie
eingespart! Das entspricht Kosteneinsparungen in
der Summe von rund 260.000 € pro Jahr.
Gesucht werden Betriebe aller Branchen und
Größen, auch soziale Einrichtungen, Vereine und
kommunale Akteure. Eine Mindestgröße von rund
acht Mitarbeitenden ist empfehlenswert. Die
Teilnahmegebühren richten sich nach
Unternehmensgröße und liegen zwischen 2.500 und
10.500 Euro.
Offizieller Start der
aktiven Arbeitsphase ist für Anfang 2026 geplant
– die Projektlaufzeit beträgt ein Jahr. Weitere
Infos & Anmeldung & Kontakt
www.oekoprofit-kreis-wesel.de
www.dinslaken.de/oekoprofit Für Rückfragen und
Beratung zur Teilnahme: Kreis Wesel -
EntwicklungsAgentur Wirtschaft Sonja Choyka
Tel.: 0281/207-2023 Mail:
sonja.choyka@kreis-wesel.de
Digitales Lernen, mehr Effizienz in der
Fahrausbildung und Transparenz bei
Durchfallquoten weisen in die richtige Richtung.
Kritik an Reduzierung der Fahrzeit auf 25
Minuten.
Der TÜV-Verband
begrüßt das Ziel des Bundesverkehrsministeriums,
den Führerscheinerwerb kostengünstiger und
moderner zu gestalten. „Bezahlbare Mobilität für
alle, mehr Transparenz bei Durchfallquoten, eine
effizientere Fahrausbildung und digitales Lernen
auf der Höhe der Zeit sind Schritte in die
richtige Richtung“, sagt Richard Goebelt,
Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim
TÜV-Verband. Kritisch sieht der TÜV-Verband
jedoch zentrale Vorschläge.
„Die
geplante Verkürzung der Fahrzeit bei der
praktischen Fahrprüfung auf 25 Minuten wäre ein
Rückschritt für die Fahranfängersicherheit“,
sagt Goebelt. „Die Prüfungsdauer muss so
bemessen sein, dass eine umfassende Beurteilung
der Fahrkompetenz in einem immer komplexer
werdenden Verkehrsgeschehen möglich ist. Eine
„Fahrprüfung light“, bei der Effizienz vor
Gründlichkeit steht, darf es nicht geben!“
Dies stünde im Widerspruch zu den im Jahr
2021 eingeführten Qualitätsverbesserungen, die
auf einer umfassenden wissenschaftlichen
Revision und der Beteiligung aller relevanten
Akteure beruhen. Zumal die Durchführung der
Prüfung kaum Einfluss auf die Gesamtkosten des
Führerscheinerwerbs hat. Zudem fehlen aus Sicht
des TÜV-Verbands wichtige Maßnahmen.
Notwendig sind schärfere Sanktionen, um gegen
die stark zunehmende Zahl der Täuschungsversuche
in den Theorieprüfungen vorzugehen. Verbindliche
und bundesweit einheitliche
Lernstandskontrollen, bevor Fahrschüler:innen
zur Prüfung zugelassen werden, würden die
Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen, das
Prüfungssystem entlasten und die Kosten für die
Fahrschüler:innen senken.
Der
TÜV-Verband steht bereit, die Reform im
Gesetzgebungsverfahren konstruktiv zu begleiten
– mit dem Ziel, Kosteneffizienz, Digitalisierung
und Verkehrssicherheit in Einklang zu bringen
bzw. zu halten. Über den TÜV-Verband: Als
TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen
Interessen der TÜV-Prüforganisationen und
fördern den fachlichen Austausch unserer
Mitglieder.
Wir setzen uns für die
technische und digitale Sicherheit sowie die
Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten,
Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage
dafür sind allgemeingültige Standards,
unabhängige Prüfungen und qualifizierte
Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe
Niveau der technischen Sicherheit zu wahren,
Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und
unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind
wir im regelmäßigen Austausch mit Politik,
Behörden, Medien, Unternehmen und
Verbraucher:innen.
Öffentliche Führungen durch
Ausstellung „Alles verkehrt. Mobil in Dinslaken“
Am Mittwoch, den 22. und
Sonntag, den 26. Oktober, findet im Museum
Voswinckelshof eine öffentliche Führung durch
die Sonderausstellung „Alles verkehrt. Mobil in
Dinslaken“ statt.Ob gehen, fahren, radeln,
gefahren werden, flanieren, schlendern, joggen –
in Dinslaken sind die Menschen auf
verschiedenste Arten unterwegs.

Ebenso vielfältig sind die Verkehrsmittel:
Straßenbahn und Bus, Nah- und Fernverkehrszug,
Automobil, Fahrrad und Elektro-Scooter, Motorrad
und Moped, Roller oder Skateboard. Doch was
heute selbstverständlich ist, hat sich erst seit
Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt. Davor
sind die meisten Menschen zu Fuß unterwegs
gewesen.
Heute ist Dinslaken eine mobile
Stadt mit vielerlei Verkehrswegen. Und mit
vielerlei Herausforderungen. Von all dem, von
der Entwicklung der Verkehrswege unserer Stadt
und den heutigen Herausforderungen, erzählt
diese Ausstellung. Sie zeigt Bilder aus dem
Stadtarchiv, Karten und Pläne zur
Verkehrsentwicklung Dinslakens sowie Exponate
aus der Museumssammlung.
Sie wirft
ebenso einen Blick auf die vielfältigen Arten,
wie wir uns und unseren Kindern Verkehr
beibringen. Und die Ausstellung ermöglicht einen
Blick in die Zukunft, anhand von ausgewählten
Grafiken des Illustrators Hans Günther Radtke.
Die öffentlichen Führungen laden ein,
die Ausstellung kennenzulernen, einen Einblick
in die verschiedenen Themenbereiche zu gewinnen,
besondere Ausstellungsstücke zu entdecken und
darüber ins Gespräch zu kommen - in diesem Fall
sind die Mitarbeitenden des Museums ganz
klassisch „per pedes“ unterwegs. Die nächsten
Termine sind:
22.10., 12 Uhr – Mittags im
Museum: Alles verkehrt. Mobil in Dinslaken
26.10., 15 Uhr – Sonntagsführung: Alles
verkehrt. Mobil in Dinslaken
Tag der Bibliotheken am 24. Oktober in der
Stadtbibliothek Dinslaken
Am
24. Oktober ist der „Tag der Bibliotheken“ und
bundesweit machen rund 8.000 Bibliotheken auf
ihre Angebote aufmerksam. Auch die
Stadtbibliothek Dinslaken beteiligt sich mit
einem kleinen Programm: Von 15 bis 17 Uhr findet
in der Kinderbibliothek ein Kreativnachmittag
statt.
Kinder ab sechs Jahren können
dort unter Anleitung Seifen aus frischem
Lavendel und ätherischen Ölen herstellen. Die
Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist die Anzahl
der Plätze begrenzt. Darüber hinaus können
Besucherinnen und Besucher den ganzen Tag über
die Spielekonsolen der Bibliothek nutzen oder
das E-Piano vor Ort ausprobieren.
Außerdem besteht die Möglichkeit, sich über die
digitalen Angebote der Bibliothek zu
informieren. Dazu zählen unter anderem die
Onleihe und der PressReader, mit denen
Nutzerinnen und Nutzer bequem online auf Bücher,
Zeitungen und Magazine zugreifen können.
Weitere Informationen zum bundesweiten Tag
der Bibliotheken gibt es auf der Webseite des
Bibliotheksverbandes unter https://www.bibliotheksverband.de/tag-der-bibliotheken
Bibliotheken sind schon lange nicht mehr
nur reine Ausleihstellen für Bücher. Sie sind
offene Treffpunkte für Menschen jeden Alters und
jeder Herkunft. Auch die Stadtbibliothek
Dinslaken versteht sich als Ort der Begegnung,
des Austauschs und des gemeinsamen Lernens. Das
zeigt sich im vielseitigen Programm der
Bibliothek: Vorlesestunden, Ferienangebote,
Bücherclubs oder Spieleabende laden regelmäßig
zur Teilnahme ein.
Auch Vereine und
Initiativen wie der Handarbeitstreff, die
Initiative „Zuhören draußen“ oder die 1.
Fotogemeinschaft "Objektiv" Dinslaken e.V.
nutzen die Räume. So entsteht ein Ort, an dem
Gemeinschaft gelebt und kreative Ideen gefördert
werden. „Bibliotheken verbinden Menschen und
bieten einen geschützten Raum zum Lernen und
Ausprobieren. Am Tag der Bibliotheken möchten
wir zeigen, wie vielfältig unsere Angebote sind
und dass für alle etwas dabei ist“, sagt
Constanze Palotz, die Leiterin der
Stadtbibliothek.
Bücher, Spiele, Begegnungen: Bibliothek
Moers feiert ‚ihren‘ Tag
Zwischen Bücherregalen
wird es am Freitag, 24. Oktober, besonders
lebendig: Die Bibliothek Moers feiert den
bundesweiten Tag der Bibliotheken mit einem
bunten Programm, das von stiller Lesezeit bis
zum spannenden Quizabend reicht.

Auch Spiele können am 24. Oktober ausprobiert
werden. (Foto: BIB)
Ab 15.30 Uhr können
Lesebegeisterte bei einer ‚Silent Reading Party‘
in ihre Lieblingsgeschichten abtauchen. Parallel
dazu öffnet sich ab 16.30 Uhr die Welt des
Gamings für alle, die digitale Abenteuer
lieben. Knifflig und gesellig wird es
schließlich ab 18 Uhr beim Familien-Quiz-Abend
Bibliothek. Hier sind Wissen, Witz und Teamgeist
gefragt.
Den ganzen Tag über lockt
außerdem ein Flohmarkt mit Büchern und Medien,
die neue Besitzerinnen und Besitzer suchen. Der
Eintritt ist frei. Es werden lediglich teilweise
kleine Kostenbeiträge für Material erhoben.
Weitere Informationen zum Programm und zu
Anmeldungen sind unter www.moers.de/veranstaltungen/veranstaltungen-bibliothek zu
finden.
Zeitreise ins Mittelalter: Historisches
Hansefest in Wesel
Wenn der
Klang von Trommeln durch die Straßen hallt,
Händler ihre Waren lautstark anpreisen und
Fackeln die Nacht erhellen – dann ist Hansefest
in Wesel. Vom 24. bis 26. Oktober verwandelt
sich die Hansestadt zum 30. Mal in eine Bühne
des Mittelalters und lädt Besucherinnen und
Besucher zu einer unvergesslichen Zeitreise ein.
„Das Hansefest ist wie ein lebendiges
Märchen, das unsere Stadt jedes Jahr aufs Neue
verzaubert“, sagt Dagmar van der Linden,
Geschäftsführerin von WeselMarketing. „Es ist
diese besondere Mischung aus Geschichte,
Kulinarik und Unterhaltung, die Jung und Alt
gleichermaßen begeistert.“
Die
Hansemeile – Köstlichkeiten und Kultur Von der
Brückstraße bis zur Kreuz-/Korbmacherstraße
präsentieren sich auf der Hansemeile zahlreiche
Hansestädte mit ihren Traditionen, Geschichten
und Spezialitäten. Ob Salzwedeler Baumkuchen,
die süffige „Heiße Hanseliebe“ – hier kommen
Genießer voll auf ihre Kosten.
„Die
Hansemeile ist wie ein Schaufenster der
mittelalterlichen Hansewelt“, schwärmt Sandra
Allofs, WeselMarketing. „Jede Stadt bringt ihren
eigenen Geschmack, ihre eigenen Geschichten und
ihren unverwechselbaren Charme mit – und das
alles mitten in Wesel.“
Bauern- und
Mittelaltermarkt – Handwerk zum Staunen
Auf
dem Bauern- und Mittelaltermarkt herrscht
quirliges Treiben: Händler aus Nah und Fern
bieten historische Gewänder, handgefertigte
Lederwaren, Schmuck aus Silberbesteck und
aromatische Kräuter an. Musikanten und Gaukler
verwandeln die Innenstadt in eine
mittelalterliche Bühne voller Leben.
Fackelzug und Feuershow – ein Gänsehautmoment
Am Samstagabend ab 18.30 Uhr lockt der
historische Umzug der Ritter und Gaukler:
Begleitet vom Flackern hunderter Fackeln ziehen
die Gruppen durch die Innenstadt bis zum Großen
Markt, wo eine atemberaubende Feuershow die
Menge erwartet.
„Wenn die Stadt in
goldenes Licht getaucht wird und die
Feuerkünstler den Himmel erhellen, ist das jedes
Mal ein magischer Moment – Gänsehaut
garantiert“, beschreibt van der Linden.
Besonderes beim 30. Hansefest Ein Höhepunkt in
diesem Jahr ist die feierliche Aufnahme der
Stadt Rees in die Rheinische Hanse.
Am
Samstag um 16 Uhr am Berliner Tor kommen
Delegationen aus allen Rheinischen Hansestädten
– Neuss, Kalkar & Grieth, Emmerich, Dinslaken,
Rees und Wesel – zusammen, um an der Zeremonie
teilzunehmen. Am Leyens-Platz findet am Samstag
von 14 bis 16 Uhr eine Versteigerung von
Kuriositäten und Spezereien (Jahrhundert
verbreitete Bezeichnung für Gewürzwaren) statt.
Der Weltladen bietet gesammelte
Kuriositäten aus aller Welt an und das
geschickteste Gebot erhält den Zuschlag. Der
Erlös der Versteigerung kommt den
Bildungsprojekten der Eine-Welt-Gruppe Wesel in
El Salvador zugute. Seefahrerromantik und
Gänsehaut pur verspricht das Shantychor-Treffen
am Sonntag von 12 bis 18 Uhr auf der Bühne am
Großen Markt.
Fünf Shanty-Chöre aus der
Region lassen die große Zeit der Seefahrt
musikalisch lebendig werden – von mitreißen-den
traditionellen Shantys über Lieder von
stürmischen Abenteuern bis hin zu schwungvollen
modernen Seemannsliedern. „Hier bleibt
garantiert niemand stillstehen – die Mischung
aus Rhythmus und Geschichten von der See geht
sofort ins Herz“, schwärmt Dagmar van der
Linden.
Als besonderer Höhepunkt singen
um 17.30 Uhr alle Chöre gemeinsam und verwandeln
den Großen Markt in ein Meer aus Stimmen.
Praktische Hinweise für Besucher*innen Das
abwechslungsreiche Programm mit Musik,
Kleinkunst und einem verkaufsoffenen Sonntag
wird von WeselMarketing und der Hanse-Gilde
Wesel e.V. organisiert – unterstützt von der
Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe.
Für die Anreise empfiehlt WeselMarketing, dem
städtischen Wegeleitsystem zu folgen. „Wer das
Hansefest besucht, soll unbeschwert genießen
können“, sagt van der Linden. „Deshalb ist das
Parken am Samstag und Sonntag in der Innenstadt
kostenlos – auch die Parkhäuser sind geöffnet.“
Der Flyer mit dem kompletten Programm
wird Anfang Oktober an alle Weseler Haus-halte
verteilt. Zudem ist er in der Stadtinformation
sowie online unter wesel-tourismus.de
erhältlich.
Öffnungszeiten Historisches
Hansefest
Freitag, 24.10.: 14–18 Uhr
Samstag, 25.10.: 10–20 Uhr
Sonntag, 26.10.:
11–18 Uhr Verkaufsoffener Sonntag ab 13 Uhr
Moers: vhs-Anschlusskurs ‚Kleine
Reparaturen und Montagen‘
Weitere
Tricks und Kniffe für kleinere Instandsetzungen
in den eigenen vier Wänden bietet der
Anschlusskurs ‚Kleine Reparaturen und Montagen –
für Leute mit Erfahrung, der vhs Moers –
Kamp-Lintfort.
Am Montag, 27. Oktober,
erhalten alle, die den Einsteigerkurs bereits
absolviert haben, weitere Tipps für notwendige
Ausbesserungsarbeiten. Veranstaltungsort ist die
vhs Moers, Wilhelm-Schroeder-Straße 10. Eine
rechtzeitige Anmeldung ist telefonisch unter 0
28 41 / 201 - 565 oder online unter www.vhs-moers.de möglich.
Deutscher Verein für bessere
Erwerbsintegration von Alleinerziehenden
Der Deutsche Verein für öffentliche und private
Fürsorge e.V. zeigt in seinen aktuellen
Empfehlungen auf, welche Maßnahmen die
Erwerbsintegration von Alleinerziehenden im SGB
II-Bezug fördern.
„Alleinerziehende sind
weiterhin im Grundsicherungsbezug
überrepräsentiert. Häufig mangelt es aber nicht
am Willen ihre Familie eigenständig zu sichern,
es scheitert an strukturellen Hürden“, erklärt
Dr. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Deutschen
Vereins für öffentliche und private Fürsorge
e.V.
„Jobcenter, Kommunen und Arbeitgeber
brauchen eine gemeinsame Strategie, die alle
relevanten Lebenslagen Alleinerziehender
einbezieht. Nur so kann eine nachhaltige
Erwerbsintegration gelingen.“
Der
Deutsche Verein erläutert in seinen neuen
Empfehlungen, wie der Vielzahl an
Herausforderungen im Leben Alleinerziehender
begegnet und eine Erwerbsintegration ermöglicht
werden kann. Eine zentrale Rolle spielen dabei
die Beratung und Unterstützung durch die
Jobcenter und sozialen Dienste anderer Träger.
Eine frühzeitige Beratung Alleinerziehender
ermöglicht es, Hürden in ihren Lebenssituationen
zu begegnen und ein Vertrauensverhältnis
aufzubauen.
Die Jobcenter sollten
Alleinerziehende auch dann beraten, wenn eine
Erwerbsintegration noch nicht möglich ist, z.B.
weil Kinder noch sehr klein sind. Sie können
dann frühzeitig zielgerichtete Maßnahmen
vorbereiten, die sich an der individuellen
Situation ausrichten. Dies kann eine berufliche
Weiterbildung sein, ein Praktikum bei einem
Arbeitgeber oder die direkte Erwerbsintegration.
Damit Alleinerziehende eine
Erwerbstätigkeit aufnehmen können, müssen aber
auch die Rahmenbedingungen stimmen. Verlässliche
Kinderbetreuung ist hierfür genauso zentral, wie
Vereinbarkeit und Familienfreundlichkeit bei
Arbeitgebenden. Auch zur Gestaltung dieser
Rahmenbedingungen und Zusammenarbeit der
beteiligten Akteure gibt der Deutsche Verein
Empfehlungen.
Der Deutsche Verein
sieht daher dem angekündigten Gesetzentwurf zur
Umgestaltung des Bürgergeldes zu einer neuen
Grundsicherung mit großem Interesse entgegen.
Die Regierungsfraktionen haben sich Anfang
Oktober 2025 auf einige Grundzüge hierzu
verständigt. In dem Papier spricht sich die
Regierungskoalition u.a. dafür aus, dass
Jobcenter zukünftig Eltern mit Kindern bereits
ab dem erst Lebensjahr mit dem Ziel einer
Integration beraten sollen. Hier wird alles auf
die konkrete gesetzliche Ausgestaltung ankommen.
Aus Sicht des Deutschen Vereins ist es
wichtig, dass Alleinerziehende auch mit kleinen
Kindern frühzeitig und gut im Jobcenter beraten
werden, um die individuell passende Hilfe und
Förderung anzubieten und eine dauerhafte
Erwerbsintegration zu erreichen oder
vorzubereiten.
Die Empfehlungen des
Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge e.V. zur Unterstützung von
Alleinerziehenden im SGB II-Bezug bei der
Erwerbsintegration durch die Jobcenter sind
unter
https://www.deutscher-verein.de/fileadmin/user_upload/dv/pdfs/Empfehlungen_Stellungnahmen/2025/DV-5-25_Erwerbsintegration_Alleinerziehender.pdf
abrufbar.
Von Gratis-Bus bis 200-Euro-Bußgeld –
Nahverkehr in Europa
Städtetrips
sind im Herbst besonders beliebt. Europas
Metropolen lassen sich dabei am besten mit Bus
und Bahn erkunden – schnell, günstig,
authentisch. Doch Vorsicht: Auch wer es einfach
nicht besser weiß, riskiert im Ausland schon bei
vermeintlich kleinen Fehlern sehr hohe
Bußgelder. Die Regeln unterscheiden sich von
Land zu Land erheblich – und genau das führt
immer wieder zu Problemen, wie die Fälle zeigen,
die beim Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ)
Deutschland eingehen.
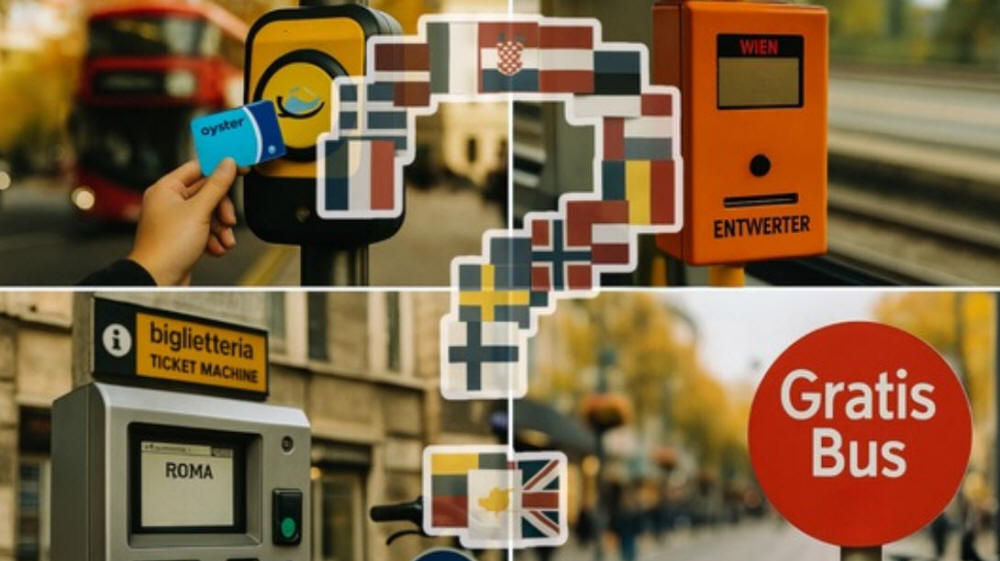
So abwechslungsreich wie die EU-Flaggen: Der
öffentliche Nahverkehr birgt einige Hürden.
(Foto: KI-generiert)
Ein Beispiel aus
Rom: Eine deutsche Familie, kaum 24 Stunden in
der Stadt, will nach einem langen Tag zurück ins
Hotel. Fahrkartenautomat an der Haltestelle?
Fehlanzeige. Also versucht der Vater online
Tickets zu kaufen – der Bus kommt aber schneller
als gedacht. Einsteigen, später zahlen, so der
Plan. Doch im Bus gibt es keine Fahrkarten, die
App lädt zu langsam. Kaum schließen sich die
Türen, steht der Kontrolleur vor ihnen. Er
spricht kein Englisch, der Vater zeigt den
offenen Ticketkauf auf dem Handy. Vergeblich: Am
Ende muss die Familie knapp 220 Euro sofort in
bar bezahlen.
„Fälle wie dieser erreichen
uns regelmäßig“, sagt Karolina Wojtal, Juristin
und Co-Leiterin des Europäischen
Verbraucherzentrums (EVZ). „Was zu Hause
selbstverständlich wirkt, kann im Ausland ganz
anders geregelt sein – auf die bekannten Abläufe
sollte man sich nicht verlassen. Und wer die
Spielregeln nicht kennt, zahlt schnell drauf.
Auch für Touristen gibt es da meist keine
Kulanz.“
Fallstricke im Ausland: ein
Überblick
1. Unterschiedliche „Währungen“
Mal ist die Zeit, mal die Zone, mal die Distanz
ausschlaggebend: In Athen gilt das Ticket 90
Minuten, egal wie weit man fährt. In Madrid
richten sich Preise nach Zonen, in Amsterdam
nach exakten Kilometern. Und in Luxemburg? Da
zahlt man gar nichts, denn dort ist – abgesehen
von der ersten Klasse – der gesamte ÖPNV
kostenlos.
2. Ticketpflicht ohne
Automaten
In vielen Städten sind Fahrscheine
nicht direkt im Bus oder der Metro erhältlich.
In Rom gibt es sie in Metrostationen, Tabakläden
oder über Apps. Automaten an Haltestellen fehlen
oft. Auch in Athen oder Prag gilt: Tickets
müssen vorab gekauft werden, denn wer ohne
Fahrschein einsteigt, zahlt hohe Bußgelder.
3. Entwerten, sonst sieht der Kontrolleur
schwarz
In Italien und Österreich reicht es
nicht, ein Ticket zu besitzen – es muss vor
Fahrtantritt entwertet werden. In Wien hängen
die Geräte vor allem an den Zugängen zur U-Bahn,
in Rom und Straßburg stehen sie direkt in Bussen
oder an den Tramhaltestellen. Wer diesen Schritt
vergisst, fährt offiziell „schwarz“.
4.
Tap-in, Tap-out – aber wehe, man vergisst’s
In den Niederlanden gilt das landesweite
Check-in/Check-out-System: Wer beim Aussteigen
vergisst auszuchecken, zahlt automatisch einen
pauschalen Tages-Höchstbetrag – bis zu 20 Euro
im Zug und zwischen vier und sechs Euro in Bus,
Tram oder Metro.
5. Extra-Ticket für
Hund, Rad und Co.
Vierbeiner (außer
Blindenhunde) brauchen in Rom ein eigenes Ticket
– anders als in vielen deutschen Städten, wo
zumindest kleine Tiere kostenlos mitfahren. In
Helsinki dürfen Fahrräder zwar mit in die Metro,
aber nur außerhalb der Stoßzeiten. Und in
Barcelona sind E-Scooter im Nahverkehr komplett
verboten. Für Reisende mit Gepäck, Kinderwagen
oder Rollstuhl gibt es in den meisten Ländern
eigene Regelungen, die aber nicht immer gut
ausgeschildert sind – hier lohnt sich ein Blick
ins Kleingedruckte, bevor man einsteigt.
Das sind nur einige Beispiele. Aber sie zeigen
deutlich, wie unterschiedlich Europäer Bus und
Bahn nutzen. „In der Regel ist es kein böser
Wille, der Reisende in Schwierigkeiten bringt,“
erklärt Wojtal. „sondern schlicht fehlende
Information. Doch am Bußgeld ändert das am Ende
leider nichts. Ein einziger vergessener
Handgriff – und aus einer Zwei-Euro-Fahrt wird
eine dreistellige Forderung.“
Und dann?
Wer im europäischen Nahverkehr ohne gültiges
Ticket erwischt wird – ob aus Versehen oder
wegen fehlender Sprachkenntnisse – gilt trotzdem
als klassischer Schwarzfahrer. Da helfen auch
gute Erklärungen nichts: Das Bußgeld muss
bezahlt werden. Da kann auch das EVZ nichts tun.
Anders kann es aussehen, wenn das Ticket
eigentlich gültig war oder technische Probleme
den Kauf verhindert haben. In solchen Fällen
kann sich ein Einspruch durchaus lohnen –
vorausgesetzt, man kann den Ablauf belegen.
Damit es gar nicht erst so weit kommt, drei
Faustregeln:
- Vorher informieren und am
besten ein paar Minuten extra einplanen, um im
Zweifel einen Mitarbeiter oder Mitreisenden zu
fragen.
- Dokumentieren wenn etwas
schiefgeht, Beweise sichern: Foto vom Ticket,
vom Automaten oder von der Fahrzeugnummer.
-
Nachhaken: Ein erster Schritt sollte der Kontakt
zum Unternehmen selbst sein. Dort den Fall
schildern und um eine (Kulanz-)Lösung bitten.
Führt das nicht zum Erfolg, bleibt zu prüfen, ob
das Unternehmen einer Schlichtungsstelle
angeschlossen ist. Eine Übersicht gibt es hier:
Streitbeilegungsstellen - Europäische
Kommission.
Viele Reisende gehen davon
aus, dass die EU-Fahrgastrechte auch im
Nahverkehr greifen – doch das stimmt nur sehr
eingeschränkt. Bei Busfahrten gelten sie erst ab
250 Kilometern, und bei Zügen können die
Mitgliedstaaten zahlreiche Ausnahmen machen. In
der Praxis zählt deshalb fast immer das, was in
den AGB der Verkehrsbetriebe steht – auch wenn
nicht alles darin automatisch rechtlich haltbar
sein muss.
„Gut vorbereitet reist es sich
entspannter“, sagt Wojtal. „Auf dem heimischen
Sofa – ohne Zeitdruck und mit stabiler
Internetverbindung findet man Antworten am
einfachsten. Und manchmal trennt schon die
Übersetzungsfunktion im Browser den Fahrschein
vom Bußgeld.“

Weltstatistiktag
* Breite
Basis an Datenmeldungen entscheidend für hohe
Datenqualität.
* Statistische Ergebnisse
wichtige Grundlage für die Demokratie.
*
Bürokratiekosten durch Statistik bei unter 1 %.
Täglich lesen und hören wir Daten und
Fakten: Inflation, Bevölkerungswachstum,
Kita-Plätze, Rezession und vieles mehr. Doch wo
kommen diese Daten eigentlich her? Mehr als 300
Statistiken pro Jahr erstellt der Landesbetrieb
Information und Technik Nordrhein-Westfalen
(IT.NRW) als Statistisches Landesamt des
bevölkerungsreichsten Bundeslandes nach
gesetzlichen Vorgaben.
Statistisches
Landesamt dankt allen Auskunftgebenden
Anlässlich des Weltstatistiktags am 20. Oktober
2025 dankt das Statistische Landesamt den
Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen sowie
weiteren Institutionen und Einrichtungen, die
ihre Daten übermitteln: „Für unsere hohe
Datenqualität sind die Auskunftgebenden ganz
entscheidend. Sie übermitteln uns ihre Daten,
auf die dann die Statistiken aufbauen. Es ist
sehr wichtig, dass wir vollständige und
wahrheitsgemäße Antworten erhalten.”, erklärt
Dr. Sylvia Zühlke als Leiterin des Statistischen
Landesamts.
Die Datenmeldungen werden
auf Basis wissenschaftlicher Methoden
nachvollziehbar bearbeitet. „Damit stärken wir
das Vertrauen in öffentliche, demokratische
Prozesse.” Neutralität und Objektivität sichern
zuverlässige Fakten „Wir erheben und
veröffentlichen Statistiken unabhängig von
politischem oder wirtschaftlichem Interesse oder
Beeinflussung.”, erläutert Dr. Sylvia Zühlke.
„Unsere Daten stellen zuverlässig Fakten
dar. Mit diesen Fakten können Informationen
überprüft und falsche Behauptungen widerlegt
werden. Die Daten der amtlichen Statistik sind
eine wichtige Basis wirtschaftlicher und
politischer Entscheidungen, die das Leben aller
Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen
beeinflussen. Damit liefern wir eine wichtige
Grundlage für unsere Demokratie.”
Aufwand für Auskunftgebende soll weiter
reduziert werden Den Aufwand für die Teilnahme
an den Statistiken überwacht das Statistische
Landesamt systematisch und hat sich
verpflichtet, diesen auf das für die Qualität
der Daten notwendige Minimum zu beschränken.
„Wir sehen die Belastung durch die
Datenmeldung. Doch der Aufwand ist in den
letzten 20 Jahren deutlich gesunken.”, sagt Dr.
Sylvia Zühlke. Weniger als ein Prozent der
gesamten Bürokratiekosten der Unternehmen
entfällt auf das Ausfüllen statistischer
Erhebungsbögen, zeigt das Belastungsbarometer
für Bürokratiekosten.
„Für eine weitere
Entlastung der Unternehmen sowie die
Vereinfachung der Meldungen durch Bürgerinnen
und Bürger arbeiten wir an KI-Lösungen und
prüfen im Sinne des Once-Only-Prinzips, wo wir
verstärkt bereits vorhandene Verwaltungsdaten
nutzen können.” (IT.NRW)
Baugenehmigungen
für Wohnungen im August 2025: +5,7 % zum
Vorjahresmonat
+7,6 % bei
Wohngebäuden insgesamt
+15,5 % bei
Einfamilienhäusern
-5,3 % bei
Zweifamilienhäusern
+4,9 % bei
Mehrfamilienhäusern
Im August 2025 wurde
in Deutschland der Bau von 19 300 Wohnungen
genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, waren das 5,7 % oder 1 000
Baugenehmigungen mehr als im August 2024. Dabei
stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im
Neubau um 5,2 % oder 800 auf 15 800. Die Zahl
genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau
bestehender Gebäude entstehen, stieg gegenüber
dem Vorjahresmonat um 8,0 % oder 300 auf 3 500.
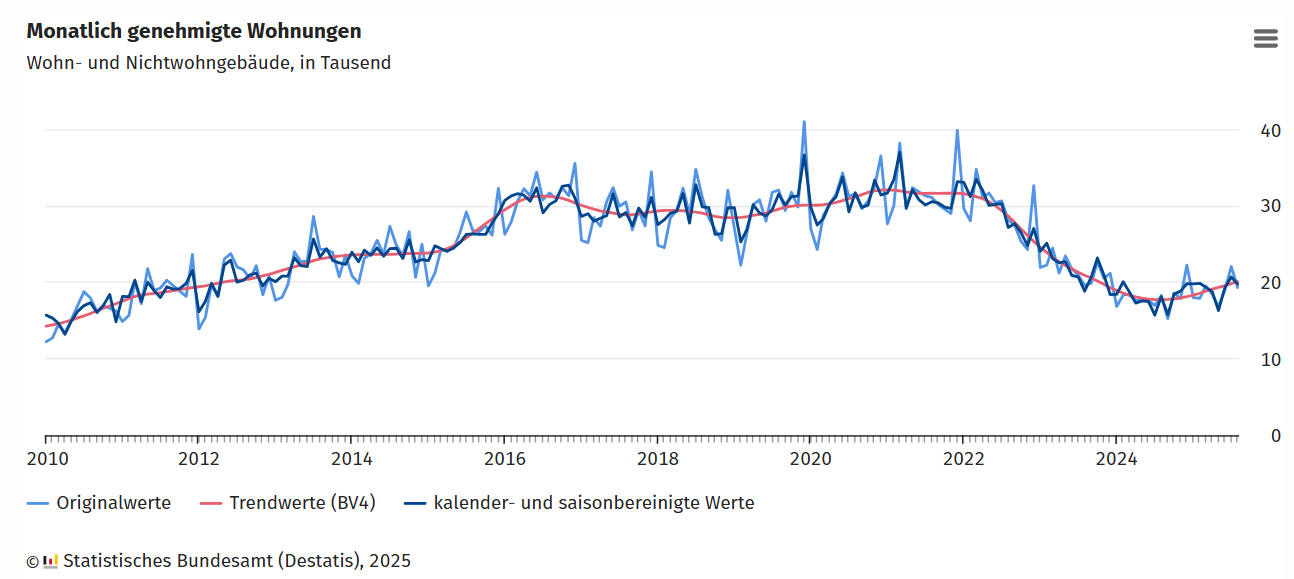
Januar bis August 2025: Aufwärtstrend bei
Einfamilienhäusern hält an
Im Zeitraum von
Januar bis August 2025 wurde deutschlandweit der
Bau von 151 200 Wohnungen in neuen sowie bereits
bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren 6,5 %
oder 9 300 Wohnungen mehr als von Januar bis
August 2024.
In neu zu errichtenden
Wohngebäuden wurden von Januar bis August 2025
insgesamt 122 000 Wohnungen genehmigt, das waren
7,6 % oder 8 600 Neubauwohnungen mehr als im
Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der
Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 15,5 %
(+3 900) auf 29 300.
Bei den
Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter
Wohnungen um 5,3 % (-500) auf 8 200. In
Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten
Gebäudeart, genehmigten die Bauaufsichtsbehörden
79 100 Neubauwohnungen. Das war einen Anstieg um
4,9 % (+3 700) gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
In neu zu errichtenden Nichtwohngebäuden
wurden von Januar bis August 2025 insgesamt
2 800 Wohnungen (zum Beispiel
Hausmeisterwohnungen) genehmigt (-18,5 %; -600).
Als Umbaumaßnahme in bestehenden Wohn- und
Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis August
2025 insgesamt 26 400 Wohnungen genehmigt, das
waren 5,2 % oder 1 300 Wohnungen mehr als im
gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
|









 Umstellung
auf Winterzeit: 26.10.2025
Uhr-Umstellung von 3 Uhr auf 2 Uhr.
Umstellung
auf Winterzeit: 26.10.2025
Uhr-Umstellung von 3 Uhr auf 2 Uhr.